Elektronische Masterarbeiten
|
|
|
- Fritzi Berger
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Elektronische Masterarbeiten Hinweis zum Urheberrecht: Für Dokumente, die in elektronischer Form über Datennetze angeboten werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Nach 53 des Urheberrechtsgesetzes dürfen von geschützten Werken einzelne Vervielfältigungen (z.b. Kopien, Downloads) nur zum privaten, eigenen wissenschaftlichen oder mit Einschränkungen sonstigen eigenen Gebrauch hergestellt werden, d.h. die Vervielfältigungen dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Jede weitergehende Nutzung bedarf der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der Autorin/des Autors. Die Benutzerin/Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich. Sie/Er kann bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
2 Entscheidungsfindung in Krisensituationen Das Planspiel als Lernmodell für den Krisenstab Masterarbeit von Norbert Kanschu us Erstprüfer: PD Michael Müller, Deutsche Hochschule der Polizei Zweitprüfer: POR Rudi Heimann, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport Münster, den 24. Juli 2009
3 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung S Hamlet ist allgegenwärtig S Polizei und Krisenmanagement S Untersuchungsfragestellung S Psychologische Faktoren bei der Entscheidungsfindung S Informationsverarbeitung S Wahrnehmung S Aufmerksamkeit und Bewusstsein S Situationsbewusstsein (situation awareness) S Soziale Informationsverarbeitung S Wahrnehmungsfehler S Bestimmtheits- und Kompetenztheorie S Stress S Zusammenfassung Diskussion S Der Begriff Krise S Merkmale einer Krise S Kennzeichen komplexer Handlungssituationen S Komplexität Vernetztheit S Intransparenz S. 29 1
4 3.2.3 Dynamik S Unvollständigkeit Fehlinterpretation S Planungs- und Entscheidungsprozess S Zielausarbeitung Zielkonkretisierung Zielpriorisierung S Informationssammlung und Modellbildung S Prognose S Planung Entscheidung Durchführung S Kontrolle S Zusammenfassung Diskussion S Krisenbewältigung im Krisenstab S Strategische Vorbereitungsmöglichkeiten der Krisenbewältigung S Ständiger Stab versus Aufrufstab S Personalauswahl S Befehlsstelle und Technikausstattung S Aus- und Fortbildungskonzept S Operative Vorbereitungsmöglichkeiten der Krisenbewältigung S Geteilte mentale Modelle (shared mental models) S Planentscheidung (standard operation procedure) S Zusammenfassung Diskussion S Trainingsmethoden der Krisenbewältigung S Erfahrungsbasiertes Lernen S. 57 2
5 5.2 Fallstudie und Planbesprechung S Das Planspiel als Trainingsmethode S Stabsübungen Stabsrahmenübungen Vollübungen S Krisenstabstraining in einem fremden Setting Das Planspiel MS Antwerpen S Debriefing: Reflexion Transfer S Trainerkompetenzen S Evaluation S Zusammenfassung Diskussion S Fazit S. 77 3
6 1 Einleitung 1.1 Hamlet ist allgegenwärtig So macht Bewusstsein Feiglinge aus uns allen; Der angebornen Farbe der Entschließung Wird des Gedankens Blässe angekränkelt; Und Wagestücke hohen Flugs und Werts, Durch diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt, Verlieren so der Handlung Namen. 1 Hamlet stellt in tiefster innerer Zerrissenheit fest, dass zu viele Fakten und Bedenken eine klare Entscheidung erschweren und uns des Gedankens Blässe alle zu Feiglingen macht. Damit wird bereits im Jahre 1603 die Problematik rund um die Entscheidungsfindung beschrieben. Wie agieren die verantwortlichen Entscheidungsträger der Polizei in Einsatzlagen? Teilen sie das Schicksal Hamlets? Kann sich der Bürger sicher sein, wenn er beim nächsten Bankbesuch Opfer einer Geiselnahme wird, dass der Polizeiführer keine Gelegenheit verpasst, lebensrettende Entscheidungen zu treffen? Wie viele Informationen braucht der Mensch, um eine klare Entscheidung zu treffen? Führt die Überflutung von Mitteilungen und Fakten nicht zu immer neuen Fragen und Bedürfnissen, bis schließlich eine regelrechte Handlungsunfähigkeit einsetzt? 2 Von Kindheit an lernen wir, unser Gehirn auf rationale Leistungsfähigkeit zu trimmen. Bedürfnisse werden in Sprache ausgedrückt. In der Schule werden diese rationalen Prozesse kontinuierlich ausgebaut, um an der Universität die Steigerung zu erfahren, dass wissenschaftlicher Anspruch immer das Absichern von Aussagen durch Belege bedeutet Der Monolog Hamlets aus: Hamlet, Prinz von Dänemark von William Shakespeare. Vgl. Dörner, Dietrich: Die Logik des Misslingens. Hamburg S. 145f. (künftig zitiert als: Dörner. 2008a). Vgl. Kast, Bas: Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft. Die Kraft der Intuition. Frankfurt am Main S. 16. (künftig zitiert als: Kast. 2009). 4
7 Auf die Frage, wie der Mensch am klügsten seine Entscheidungen treffen soll, wird die Mehrheit vorschlagen, rational vorzugehen. Also Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen und dann schließlich zu entscheiden; ohne sich von Gefühlen leiten zu lassen. Wären da nicht der berühmte siebte Sinn und das Bauchgefühl, die uns oftmals zu anderen als rationalen Entscheidungen führen. Offensichtlich ist es eine komplizierte Wechselwirkung aus Verstand und Gefühl, die den menschlichen Willen bestimmt. 4 Während die Psychologen uns noch vor wenigen Jahrzehnten für eine Art Reiz- Reaktions-Maschine hielten, die sich wie der Pawlow sche Hund willkürlich steuern lässt, ist dieser Behaviorismus dem Kognitivismus gewichen. Das Denken, Wahrnehmen und Erinnern rückte in das Zentrum der Betrachtung. Mittlerweile stehen der Wissenschaft mit der funktionellen Magnetresonanztomographie Apparaturen zur Verfügung, die den Hirnforschern transparent darstellen, dass praktisch jeder Gedanke auch von emotionalen Reaktionen begleitet wird. Steht uns nach der kognitiven Wende eine emotionale Wende bevor? 5 Die Gesamtsicht der psychischen, kognitiven, emotionalen und sozialen Einflussfaktoren beim menschlichen Handeln, insbesondere in komplexen Arbeitsprozessen, nimmt eine immer bedeutendere Rolle ein, wie sich in dem Forschungsfeld der sogenannten Human Factors widerspiegelt. Hierbei wird der Mensch als Individuum, aber auch als Teil einer Organisation, Mitarbeiter einer Gruppe oder im Umgang mit der Technik betrachtet. Insbesondere die sozialpsychologischen Aspekte des Teams mit seinen Themen Führung, Kommunikation, gemeinsamen mentalen Modellen und des geteilten Situationsbewusstseins stehen im Fokus der Untersuchung. 6 4 Vgl. Roth, Gerhard: Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten. Stuttgart S. 9ff. (künftig zitiert als: Roth. 2008). 5 Vgl. Kast S. 17f. 6 Vgl. Badke-Schaub, Petra und Gesine Hofinger und Kristina Lauche (Hrsg.): Human Factors. Psychologie sicheren Handelns in Risikobranchen. Heidelberg S. 14. (künftig zitiert als: Badke-Schaub/Hofinger/Lauche. 2008). 5
8 Organisationstheoretisch rückte der Mensch mit der Entwicklung der technischen Systemgestaltung von Frederic W. Taylor in den Vordergrund. Seine Vision Wohlstand für alle sollte durch eine optimale Gestaltung von Management, Arbeit und Unternehmen erreicht werden. 7 Im Rahmen dieses analytisch-funktionsorientierten Ansatzes wurde die Organisation mit ihren Individuen als zweckumsetzende, rationale Apparatur verstanden, in der sich auch Führungsprozesse friktionslos durch die passenden Methoden steuern lassen. Doch die Realität funktioniert anders: Hierarchie und Führung ist mit der Eigenwilligkeit und den Bereichsegoismen real handelnder Akteure und der Unübersichtlichkeit und Komplexität des sozialen Systems konfrontiert. Hier ist der Wandel vom analytisch-funktionsorientierten Ansatz zum empirischhandlungsorientierten Ansatz notwendig, der weniger das Sollen als das wirkliche Können in den Vordergrund stellt. 8 In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach dem Verhältnis von Lehren und Lernen neu. Führungs- und Managementlehre muss praktischer werden. Die klassische Wissensvermittlung muss mit erfahrungsbasiertem Lernen verknüpft werden. Dieses Probehandeln in komplexen Situationen einschließlich der kompetent begleiteten Reflexion wird in der pädagogischen Fachsprache shift from teaching to learning genannt. 9 Eine dieser erfahrungsbasierten und praxisnahen Lernmethoden ist die Ausbildung mittels Planspiel bzw. Simulation. Bei dieser szenariobasierten Fortbildungsmethode stellen sich kennzeichnende Verhaltensdefizite heraus, die in fachlich angeleiteten Nachbereitungen analysiert werden können, um dauerhafte Verhaltensänderungen herbeizuführen. Mit Hilfe von Computertechnik besteht die Möglichkeit, komplizierte und komplexe Sachverhalte abzubilden. 7 Vgl. Badke-Schaub/Hofinger/Lauche S. 10ff. 8 Vgl. Barthel, Christian u.a.: Einleitung. In: Christian Barthel und Jochen Christe-Zeyse und Dirk Heidemann: Professionelle Führung in der Polizei. Jenseits des Führungsmythos und technokratischer Managementansätze. Frankfurt am Main S. 14f. (künftig zitiert als: Barthel/Christe-Zeyse/Heidemann. 2006b). 9 Vgl. Barthel/Christe-Zeyse/Heidemann. 2006b. S
9 Planspiele bieten die Chance, die Psychologie des Denkens, des Entscheidens, des Planens und alle anderen kognitiven Prozesse zu fokussieren. 10 Simulationen sollen die Realität soweit abbilden, dass sich die Teilnehmer ernsthaft mit der Situation auseinandersetzen und sich dabei auch so fühlen, als stünden sie einer realen Krise gegenüber, d. h. beispielsweise Stress, Zeitdruck und Unsicherheit erfahren. 11 Das Planspiel mag die Wirklichkeit zwar einfacher beschreiben, aber es funktioniert wie ein Zeitraffer, der den Entscheider unmittelbar mit den Fehlern konfrontiert. So kann die Versuchsperson unter kompetenter Anleitung direkt lernen, dass es notwendig ist, die Entscheidungen zu analysieren, um das eigene Denken und Verhalten direkt zu korrigieren Polizei und Krisenmanagement In den wissenschaftlichen Publikationen zum Thema Krisenmanagement, Entscheidungsfindung in kritischen Situationen, Stabsarbeit und Human Factors nimmt die Institution Polizei einen festen Platz ein. Fast ausnahmslos wird durch die Autoren unter Hinweis auf ihre langjährigen und vielseitigen Erfahrungen ein positives Bild erfolgreicher polizeilicher Einsatzbewältigung dargestellt. Leider gibt es nur sehr wenige empirische Forschungen oder valide Evaluationen von Einsatzlagen der Polizei. Eine Aufbereitung findet erfahrungsgemäß nur dann statt, wenn offenkundig Fehler passiert sind, die in den Medien diskutiert werden, so dass meist politische Entscheidungsträger unter Druck stehen, die Geschehnisse offiziell untersuchen zu lassen. Als Beispiel sei hier der nach dem Leiter der Untersuchungskommission benannte Höcherl-Bericht von 1978 aufgeführt, der sich ausgiebig mit den Defiziten polizeilicher Informationsverarbeitung während der Entführung und späteren Vgl. Dörner. 2008a. S. 19. Starke, Susanne: Kreuzfahrt in die Krise. Frankfurt am Main S. 48. (künftig zitiert als: Starke. 2005). Vgl. Dörner. 2008a. S. 324f. 7
10 Ermordung des damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer beschäftigt. Auch die tragischen Ereignisse des Gladbecker-Geiseldramas im Jahre 1988 lassen sich teilweise auf defizitäre Polizeiarbeit zurückführen und sind uns aus der medialen Aufarbeitung bekannt. Zum Glück gehören Einsatzlagen dieser Kategorie zur absoluten Ausnahme, mit denen die Polizei nicht regelmäßig konfrontiert wird. Auf dem Gebiet von Einsatzlagen, wie Demonstrationen oder Veranstaltungen, gehören die extremen Herausforderungen eher zur Ausnahme. Im Vergleich zu einigen Nachbarländern, wie beispielsweise Frankreich, ist die Protestbewegung in Deutschland, wenn überhaupt vorhanden, eher friedlich. Auch bei der letzten großen Veranstaltung, die Fußball-WM 2006, war seitens der Polizei sehr wenig Krisenintervention erforderlich, da der gesamte Verlauf der Weltmeisterschaft von großer Ruhe geprägt war. Doch diese Ruhe ist offensichtlich vorbei; die Relevanz der polizeilichen Krisenintervention kann sich kurzfristig ändern! Die Bedrohungssituation durch den internationalen Terrorismus hat sich deutlich verschärft. Deutschland ist seit langem nicht mehr nur Rückzugsraum für Terroristen, sondern auch potentielles Anschlagsziel, wie die Fälle der Kofferbomber von Dresden und die Sauerlandgruppe zeigen. Die intensive Überwachung Ausreisewilliger, die sich aus Deutschland kommend, in Terrorlagern auf den heiligen Krieg vorbereiten lassen wollen, legt zusätzlich dar, dass uns komplexe Entscheidungen ins Haus stehen, deren Umfang heute noch nicht erfassbar ist. Zudem durchdringt eine in ihren Folgen noch nicht absehbare Wirtschaftsrezession das Land, die viele Arbeitsplätze gefährdet und die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter öffnet. Dies sind Entwicklungen, die eine Orientierung polizeilicher Krisenintervention in Richtung größerer Gefahren- und Schadenslagen, demonstrativer Aktionen und Arbeitskämpfe erfordert. Bei der Polizei werden für die Einsatzbewältigung außergewöhnlicher Lagen, wie beispielsweise Demonstrationen, größere Schadensereignisse, Geiselnahmen, Entführungen oder Erpressungen, verantwortliche Polizeiführer mit ihren 8
11 Führungsstäben betraut. Es werden Besondere Aufbauorganisationen gebildet, um Einsatzlagen zu bewältigen, die die Leistungsfähigkeit der Allgemeinen Aufbauorganisationen übersteigen. Dies trifft im Regelfall zu, wenn es sich um besonders komplexe Lagen handelt, bei denen eine Vielzahl von Einsatzkräften für einen längeren Zeitraum unter einheitlicher Führung eingesetzt wird. Je nach Bundesland kann dies von einem Führungsstab, dessen Mitarbeiter erst bei Auftreten der Situation alarmiert werden, bis zum ständig eingerichteten Stab reichen. 13 Unbestritten ist, dass eine professionelle Vorbereitung für die Bewältigung von besonderen Einsatzlagen einige strategische Entscheidungen erfordert, die kostenintensiv sind. Personal muss zur Verfügung gestellt, ausgebildet und ausgestattet werden. Es ist in Zeiten knapper Haushaltsmittel keine besonders populäre Entscheidung, feste Führungsstäbe für den eher seltenen Einsatzfall praktisch auf Vorrat einzurichten. Auf dem Gebiet der Aus- und Fortbildung bereitet die Polizei ihre Mitarbeiter häufig mit der Durchführung von Übungen auf die Krisenintervention vor. Eine praxisorientierte Szenariotechnik, die Echtlagen simulieren soll und sich weitgehend auf technisch-organisatorische Aspekte bezieht. Die hierzu richtungsweisende bundeseinheitliche Polizeidienstvorschrift (PDV) 230 wurde Anfang der siebziger Jahre entwickelt und ist seit dem nur geringfügig modifiziert worden. Eine strukturierte Übungsnachbereitung wird zwar vorgegeben, Human Factors spielen in der noch überaus analytisch-funktionsorientiert anmutenden PDV allerdings keine Rolle. Im Vordergrund stehen ausschließlich taktische und technisch-organisatorische Maßnahmen, während die Vermittlung sozialpsychologischer Kompetenzen keine Beachtung findet. Die Bedeutung der menschlichen Faktoren wird in der polizeilichen Teamarbeit unterschätzt. Im zwischenmenschlichen Bereich sind vor allem auch die Ursachen dafür zu finden, dass Einsatz- und Übungsnachbereitungen keine Selbstverständlichkeit sind Vgl. Starke S Vgl. ebenda. S. 7. 9
12 In der polizeilichen Praxis macht sich, wenn rückblickend über Einsatzlagen gesprochen wird, Erinnerungsoptimismus breit. Die negativen Aspekte des Geschehenen werden verdrängt und fantasiereich zu Erfolgsgeschichten ausgeschmückt. Einsatzlagen sind der Grundstoff für die Geschichten, die man sich auf Lehrgangstreffen erzählt, und nichts schweißt Kollegen oder Teams stärker zusammen als der gemeinsam durchgestandene schwierige Einsatz. 15 Es stellt sich auch die Frage, wer denn die Entscheidungen des Polizeiführers reflexiv betrachten soll. Dazu gehört neben der nötigen Kompetenz auch einiger Mut, denn die Polizei ist eine überaus hierarchisch aufgebaute Organisation mit Spuren von Standesdünkel; vielleicht trifft der Kritisierte am nächsten Tag zufällig eine anstehende Personalentscheidung über den Kritiker oder soll sich an dessen Beurteilung beteiligen. 1.3 Untersuchungsfragestellung Die Leitfragen dieser Arbeit lauten: Wie sollte kluge Entscheidungsfindung in Krisensituationen gestaltet sein und ist das Planspiel eine effektive Ausbildungsmethode für die Krisenbewältigung? Zur Beantwortung dieser Fragen werde ich mich im zweiten Kapitel meiner Ausführungen zunächst damit beschäftigen, unter welchen individuellen psychologischen Einflüssen Menschen ihre Entscheidungen treffen. Beginnend mit den Themen Wahrnehmung und Bewusstsein wird auch die soziale Informationsverarbeitung betrachtet, um schließlich daraus entstehende typische Verhaltenstendenzen und Fehler erklären zu können. Neben den rationalen Prozessen des Bewusstseins wird auch der Einfluss von Stress und Emotionen auf die individuelle Handlungsorganisation beleuchtet. 15 Christe-Zeyse, Jochen: Polizei und Management. In: Christian Barthel und Jochen Christe-Zeyse und Dirk Heidemann: Professionelle Führung in der Polizei. Jenseits des Führungsmythos und technokratischer Managementansätze. Frankfurt am Main S (künftig zitiert als: Christe-Zeyse. 2006). 10
13 Das dritte Kapitel beschreibt, welche Anforderungen die Verantwortlichen im Krisenstab für die komplexe Problembewältigung erfüllen müssen. Hierzu werden neben der Erklärung des Begriffes Krise die Merkmale komplexer Entscheidungssituationen mit ihren typischen Tendenzen zum Fehlverhalten aufgezeigt. Anschließend steht im Mittelpunkt der Betrachtung, welche mentalen Prozesse notwendig sind, um ein komplexes Problem zu bewältigen. Zu diesem Zweck werden die einzelnen Stufen der Handlungsorganisation beschrieben. Im vierten Kapitel werden die strategischen und operativen Vorbereitungsmöglichkeiten für die Problembewältigung mit dem Krisenstab dargestellt. Auf der strategischen Seite sind dies die grundsätzlichen Ressourcenentscheidungen hinsichtlich Personal, Räumlichkeiten, Technik und Ausbildung. In operativer Hinsicht liegen die Vorbereitungsmöglichkeiten in den geteilten mentalen Modellen, der Teamarbeit sowie der Erstellung von Planentscheidungen. Das fünfte Kapitel befasst sich mit den Ausbildungsformen für Krisenstäbe. Nach Darstellung der Vorteile erfahrungsbasierten Lernens werden die allgemeinen Trainingsmöglichkeiten beschrieben und die Lehrmethode des Planspiels näher erläutert. Besondere Aufmerksamkeit liegt hierbei auf der Phase der Reflexion und der erforderlichen Trainerkompetenzen sowie der Evaluation. Die dargestellten Rahmenbedingungen werden auf ihre Anwendbarkeit in der polizeilichen Aus- und Fortbildung überprüft. 2 Psychologische Faktoren bei der Entscheidungsfindung Bereits Ende der achtziger Jahre erstellte der Bamberger Psychologe Dietrich Dörner mittels Computersimulationen Fantasieländer und ließ Versuchspersonen als Bürgermeister virtuell regieren. Die Probanden konnten Steuern erhöhen bzw. senken, in den Arbeits- und Wohnungsmarkt eingreifen oder das Freizeitverhalten beeinflussen. Die Folgen der verschiedensten Entscheidungen 11
14 wurden in einem Zeitraffer eingespielt, so dass die Kausalität zwischen Entscheidung und Entwicklung schnell deutlich wurde. Es zeigte sich, dass etwa nur die Hälfte der Versuchspersonen mit dem hohen ökonomisch-ökologischen Vernetzungsgrad umgehen konnte. Viele hatten die virtuelle Stadt rasch an den Rand des Ruins getrieben. Die Versuche belegen, dass Menschen komplexe Systemzusammenhänge nur sehr schwer erfassen und Rückkopplungen nicht immer erkennen können. 16 Bei den Versuchen Dörners stehen nicht Erfolg oder Misserfolg einer Entscheidung im Vordergrund, sondern vielmehr die zur Entscheidungsfindung führenden kognitiven Prozesse der Probanden. Die Merkmale komplexer Handlungssituationen und den Planungs- und Entscheidungsprozess werde ich im nächsten Kapitel erläutern. Zunächst sollen einige individualpsychologische Determinanten im Umgang mit Informationswahrnehmung und -verarbeitung betrachtet werden. Wie funktioniert unser Denkapparat und worin liegen die Folgen dieser Funktionsweisen? 2.1 Informationsverarbeitung Wahrnehmung Wahrnehmung ist die psychische Funktion, die es unserem Organismus ermöglicht, mit seinen Sinnesorganen Informationen der Umwelt aufzunehmen und zu verarbeiten. Sie steht dabei unter dem vielseitigen Einfluss von Gedächtnis, Gefühlen, Erwartungen, Motivationen und Denken. Vornehmliches Ziel des Wahrnehmungssystems ist keine Eins-zu-eins-Abbildung der Realität, sondern die Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit, um die Existenz des Individuums zu sichern. Diese primäre Aufgabe gibt Erklärungsansätze für Phänomene menschlichen Verhaltens, denn im Grunde sind wir mit einem steinzeitlichen 16 Vgl. Roth S. 130f. 12
15 Überlebensapparat ausgestattet, der noch genau so funktioniert, wie vor hunderttausenden von Jahren. 17 Es gibt zwei grundlegende Arten der Informationsverarbeitung im Gehirn. Die erste Perspektive, der bottom-up Prozess, weist dem Wahrnehmenden eine weitgehend passive Rolle zu. Hierbei geht das Signal von den Sinnesrezeptoren zu den sensorischen Zentren der Großhirnrinde und wird dort in ausführbare Handlungen umgesetzt, praktisch vom Reiz zum Gehirn, ohne Verzerrungen und Anreicherungen. Das zweite Modell, der top-down Prozess, ist die interessantere Perspektive, um einige Phänomene und Fehler menschlichen Verhaltens bei der Informationsverarbeitung erklären zu können. Bei dem top-down Prozess werden praktisch von oben herab eingehende Wahrnehmungen mit relevanten Gedächtnisinhalten verglichen und interpretiert. Hierbei sind also nicht nur die objektiven Reize eines Signals wesentlich, sondern auch die subjektiven Erwartungen des Menschen. Im Gedächtnis abgespeicherte Kontextinformationen werden genutzt, um die Ambiguität der Wahrnehmungssituation zu reduzieren und Konsistenz zu den vorhandenen mentalen Modellen herzustellen, auch wenn die Realität durch die Integration des Wahrgenommenen verzerrt wird. 18 Diese konstruktiven und interpretierenden Eigenschaften der Psyche spielen bei den zwischenmenschlichen Interaktionen der sozialen Informationsverarbeitung eine einflussreiche Rolle Aufmerksamkeit und Bewusstsein Informationen, die wir über die Sinnesorgane aufnehmen, bleiben für weniger als eine Sekunde im sensorischen Zentrum unseres Gehirns, das über eine enorme Speicherkapazität verfügt. Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf einen dieser Reize und wird er im Vergleich mit unserem abgespeicherten Wissen als bekannt eingestuft, die 17 Vgl. Schaub, Harald: Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Situation Awareness. In: Petra Badke-Schaub und Gesine Hofinger und Kristina Lauche (Hrsg.): Human Factors. Psychologie sicheren Handelns in Risikobranchen. Heidelberg S. 73. (künftig zitiert als: Schaub. 2008). 18 Vgl. Schaub S
16 sogenannte Mustererkennung, wird er in den Kurzzeitspeicher übertragen. Passiert dies nicht, wird der Reiz erst gar nicht bewusst zur Kenntnis genommen. Die Kapazität des Kurzzeitspeichers liegt bei 7 (plus/minus zwei) Informationen, die für etwa 7 Sekunden gespeichert bleiben. Wird eine Information innerhalb der 7 Sekunden als relevant erachtet und zieht weiterhin unsere Aufmerksamkeit auf sich, wird sie in das Langzeitgedächtnis übertragen, das eine unbegrenzte Speicherkapazität hat. 19 Ist ein Wahrnehmungsinhalt wichtig und bekannt und gibt es im Gehirn ein entsprechendes Bearbeitungsprogramm, dann wird dieses Routineprogramm angestoßen, ohne dass das Bewusstsein eingeschaltet wird. Dies gilt beispielsweise für Automatismen beim Autofahren. Wird ein Wahrnehmungsinhalt als wichtig und neu eingestuft, werden sie in den assoziativen Arealen des Gehirns mit den unterschiedlichsten Inhalten des Gedächtnisses abgeglichen und dadurch mit Bedeutung verbunden. Dies ist nach gegenwärtiger Auffassung der Moment, in dem uns die Inhalte bewusst werden. Allerdings ist das Bewusstsein hinsichtlich der benötigten Stoffwechselenergie recht teuer. Bei anstrengender geistiger Arbeit steigert sich der Verbrauch um ein Vielfaches, so dass man richtig ins Schwitzen kommen kann. Deshalb strebt das Gehirn danach, Dinge abzuarbeiten, ohne das Bewusstsein zu gebrauchen und Routineprogramme werden ausgebildet. 20 Aus arbeitsökonomischen Gründen werden viele Prozesse automatisch abgearbeitet. Durch diese Automatismen werden Ressourcen der Aufmerksamkeit frei, um sich anderen Aufgaben zu widmen und effizienter zu funktionieren. 21 Wie oben erwähnt, kann das Kurzzeitgedächtnis nicht beliebig viele Reize gleichzeitig verwerten. Dies trifft insbesondere für den Prozess der Aufmerksamkeit zu, worunter der psychische Zustand zu verstehen ist, bei dem das Bewusstsein auf bestimmte Objekte, Vorgänge, Gedanken ausgerichtet ist. 19 Vgl. Abele, Andrea und Guido Gendolla: Soziale Informationsverarbeitung. In: Jürgen Straub und Wilhelm Kempf und Hans Werbik (Hrsg.): Psychologie. Eine Einführung. Grundlagen, Perspektiven. München S (künftig zitiert als: Abele und Gendolla. 1997). 20 Vgl. Roth S. 81ff. 21 Vgl. Gigerenzer, Gerd: Bauchentscheidungen. Die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition. 3. Auflage. München S. 28. (künftig zitiert als: Gigerenzer. 2008). 14
17 Damit die beschränkte Verarbeitungskapazität so sinnvoll wie möglich genutzt wird, steuert die Aufmerksamkeit die Wahrnehmung auf (subjektiv) wichtige Reize, wobei die Relevanz der Reize von der individuellen Motivation und Emotion abhängt. Immer wenn wir mit etwas Neuem konfrontiert werden und es um die Verarbeitung komplexer Details geht, brauchen wir unser Bewusstsein. Diese Bewusstseinsvorgänge sind zwar in ihrer Kapazität beschränkt, langsam und fehleranfällig, aber sie können flexibel mit neuen Informationen umgehen und diese auf ihre Bedeutung und Zusammenhänge überprüfen Situationsbewusstsein (situation awareness) Um Handlungssicherheit zu erreichen, muss der Mensch verschiedene Aspekte einer Situation wahrnehmen, korrekt interpretieren und notwendige Handlungen generieren. Das heißt, nicht nur der aktuelle Zustand und dessen Einordnung ist entscheidend, sondern auch Prognosen über die Entwicklung der Situation. Diese Trias von Fähigkeiten wird als Situationsbewusstsein (situation awareness) bezeichnet. Das Forschungsgebiet der situation awareness wird in jüngster Zeit sowohl als handlungstheoretisches als auch anwendungsorientiertes Konzept im Kontext mit komplexen Arbeitsprozessen untersucht. Ausgangspunkt des Modells ist die Tatsache, dass Handelnde die aktuelle Situation und auch die Folgen möglicher Handlungsoptionen in mentalen Schemata im Langzeitgedächtnis gespeichert haben. Dies bedeutet, dass das Geschehen während des aktiven Handelns in das mentale Modell integriert wird, so dass eine Generalisierung der Erfahrung entsteht, die eine zukünftige Antizipation in vergleichbaren Situationen ermöglicht. Situation awareness setzt sich aus den drei folgenden Ebenen zusammen: Auf der ersten Ebene werden die relevanten Informationen durch Wahrnehmung erfasst. Auf der zweiten Ebene findet die Interpretation und Bewertung der wahrgenommenen Informationen statt. Die Eindrücke werden zu einem 22 Vgl. Roth S
18 sinnvollen mentalen Modell zusammengefügt. Dies geschieht in einem Prozess der sich ständig aktualisierenden Informationsstrukturierung. Die dritte Ebene ist die Projektion in die Zukunft, demnach wird die potentielle Entwicklung des Zustandes in der unmittelbaren Zukunft abgeleitet. Dieser Prozess ist nur möglich, wenn der Beurteilende den aktuellen Status der Situation sowie kausale Konsequenzen optionaler Handlungen in Form von mentalen Schemata im Langzeitgedächtnis abgespeichert hat. 23 Situation awareness ist ein Konstrukt, das Informationsverarbeitung, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Gedächtnis zusammenfügt. Mit diesem Modell können die Prinzipien menschlicher Wahrnehmung mit den Bedingungen sicheren Handelns verglichen werden, um Ableitungen und Empfehlungen für Arbeits-, Planungs- und Entscheidungsprozesse zu generieren Soziale Informationsverarbeitung Aufgrund ihrer von vielen individuellen Faktoren abhängenden Informationsverarbeitung fällen Menschen Urteile verschiedenster Art und konstruieren sich so ihre soziale Welt, die das aktuelle Handeln beeinflusst. Auf dem überaus vielfältigen Gebiet der sozialen Informationsverarbeitung gibt es eine Menge spannender Fragen: Wie und warum nehmen wir Personen in bestimmter Weise wahr und beurteilen sie auf die eine oder andere Art? Hat der erste Eindruck wirklich ein so starkes Gewicht, wie viele Redensarten behaupten? Sind schöne Menschen auch intelligent? Oder: Wie entstehen Vorurteile? Für die Beantwortung dieser Fragen sind zum einen die bereits angeführten Prozessstufen der Wahrnehmung und Aufmerksamkeit entscheidend, zum anderen aber auch der Aspekt, wie Informationen im Langzeitgedächtnis organisiert sind. 23 Nolze, Anette und Mike Hänsel und Michael P. Müller: Situationsbewusstsein im Team. In: Cornelius Buerschaper und Susanne Starke (Hrsg.): Führung und Teamarbeit in kritischen Situationen. Frankfurt am Main S. 73f. (künftig zitiert als: Nolze/Hänsel/Müller. 2008). 24 Vgl. Schaub S
19 Ein Erklärungsansatz ist das Modell des assoziativen Netzwerkes. Hierbei sind die Informationen in Kategorien unterteilt, die hierarchisch geordnet und miteinander verbunden sind. Diese Kategorien sind mit Schubladen vergleichbar. Wird durch eine Information eine Schublade geöffnet, ist es wahrscheinlich, dass alle dort abgelegten Inhalte zur Verfügung stehen. Der Effekt der Aktivierung kategorialer Informationen im Zusammenhang mit Erinnerung und Abspeicherung von Wahrnehmungen wird in der Psychologie priming genannt. 25 Sozialen Informationen, die unsere Aufmerksamkeit erregen, muss Sinn gegeben werden. Diese Bedeutungsverleihung erfolgt über den Vergleich mit bereits gespeicherten Informationen, die in sozialen Kategorien geordnet sind. Zentrale soziale Kategorien sind beispielsweise Gruppen, wie ethnische Zugehörigkeit, Nationalität oder Geschlecht, wobei der typische Vertreter einer Kategorie Prototyp genannt wird. Jeder Kategorie sind Annahmen und Erwartungen implizit, sogenannte Stereotype, die dazu führen, dass bereits die bloße Kategorisierung einer Person zu einer bewertenden Aussage über die Persönlichkeitseigenschaften führen kann. Diese Aussage bezeichnen wir auch als Vorurteile. 26 Ein weiterer sinngebender Prozess in der sozialen Urteilsbildung ist der primacy Effekt. Hierbei haben die zuerst wahrgenommenen Informationen oder Eigenschaften zu einer Person einen stärkeren Einfluss auf den Gesamteindruck als die späteren Informationen. Ein ähnliches Phänomen ist der halo Effekt (Heiligenschein-Effekt), bei dem wir nicht nur dazu neigen, physisch attraktiven Personen Intelligenz, Warmherzigkeit und Freundlichkeit zuzuschreiben, sondern wir sind auch eher bereit, von diesen zu lernen und deren Empfehlungen zu folgen Vgl. Abele und Gendolla S Vgl. ebenda. S
20 Ein psychologisches Konstrukt, das zur Erklärung der Kategorisierungseffekte herangezogen wurde, ist das des Schemas. Mentale Schemata sind auf Erfahrung basiertes, verallgemeinertes, abstraktes Wissen. Es werden prototypische Situationen im Gedächtnis gespeichert, die eine Klassifikation von zukünftigen Ereignissen erleichtern sollen Wahrnehmungsfehler Bei der menschlichen Informationsverarbeitung kann es zu Wahrnehmungsfehlern und Verzerrungen, sogenannten biases, kommen. Durch die beschränkte Kapazität des Bewusstseins besteht die Gefahr, dass eine selektive Aufmerksamkeit und Fixierung auf unwichtige Informationen stattfindet und wichtige Geschehnisse außer Acht gelassen werden. Wahrnehmungsfehler sind auch auf den Gebrauch von Urteilsheuristiken zurückzuführen. Diese Faustregeln der Urteilsbildung ermöglichen schnelle Handlungsprozesse bei Informationsdefiziten, bergen aber auch die Gefahr von Fehlern. Die Verfügbarkeitsheuristik ist eine dieser Faustregeln. Hiernach bestimmen verfügbare Gedächtnisinformationen unsere Urteilsbildung einseitig. Zu dieser Gruppe gehört der bereits vorgestellte priming Effekt, bei dem eine bestehende Kategorisierung zur Meinungsbildung beiträgt. Mit dieser Urteilsheuristik korrespondiert auch die Kriminalitätstheorie des labeling approach, die besagt, dass in der Frühphase der Verfolgung einer Straftat ein typisches Etikett zu einem ungerechtfertigten Verdacht führen kann. So könnte etwa bei der Ermittlung im Rahmen einer Straftat mit antisemitischem Hintergrund der Springerstiefel tragende Skinhead schneller unter Tatverdacht stehen als die konkreten Anhaltspunkte es rechtfertigen. Zur Verfügbarkeitsheuristik gehört auch die Häufigkeitseinschätzung. Hier werden Ereignisse, von denen wir oft und kürzlich gehört haben, als zahlreicher bewertet als andere Ereignisse. Als Beispiel würde eine Person, die täglich über fremdenfeindliche Straftaten in der Tageszeitung liest, dazu neigen, die Häufigkeit dieser Taten in der Realität zu überschätzen. 18
21 Eine andere Faustregel, die Repräsentativitätsheuristik, führt dazu, dass eine Information als zentraler Stimulus einer Kategorie zugeordnet werden kann, ohne dass die Wahrscheinlichkeit, mit der dieses Ereignis in der Realität auftritt, beachtet wird. Sollten wir den Beruf einer Person erraten, die uns als Organisationstalent und verantwortlich für mehrere Personen beschrieben wird, so würden wir eher auf Unternehmer anstatt auf Hausfrau tippen, obwohl es in Deutschland statistisch mehr Hausfrauen mit diesen Attributen gibt als Unternehmer. 27 Eine weitere Heuristik ist die Ankerbildung, wonach die erste Information die Orientierung für das Urteil bildet und es zur sogenannten Urteilsverankerung kommt. Die Folge ist, dass alle weiteren Informationen in Richtung dieses Ankers verzerrt werden. Ein Beispiel ist der primacy Effekt, der unter dem Thema soziale Informationsverarbeitung beschrieben wird. Wenn wir in der Beschreibung einer Person als erstes das Merkmal höflich und dann skrupellos erfahren, wird unser Eindruck über diese Person positiver sein als wenn die Attribute in umgekehrter Reihenfolge genannt werden Bestimmtheits- und Kompetenztheorie Die Wirkung unserer Persönlichkeit auf andere und somit auch die Darstellung der eigenen Persönlichkeit scheint beim menschlichen Verhalten eine herausragende Rolle zu spielen. Es geht darum, ein positives Selbstbild zu bewahren und den Eindruck bestmöglichst zu beeinflussen, den andere von uns haben. Wenn dies nicht gelingt, kommt es zu Phänomenen wie Informationsabwehr und Umdeutung, zu Aggression, Flucht und dem Versuch, die in Frage gestellte Kompetenz zu retten Vgl. ebenda. S Vgl. ebenda. S Vgl. Strohschneider, Stefan: Kompetenzdynamik und Kompetenzregulation beim Planen. In: Stefan Strohschneider und Rüdiger von der Weth (Hrsg.): Ja, mach nur einen Plan. Pannen und Fehlschläge Ursachen, Beispiele, Lösungen. 2. Auflage. Bern S. 50. (künftig zitiert als: Strohschneider. 2002). 19
22 Bei den genannten Phänomenen handelt es sich um emotionale Prozesse, die die Frage aufwerfen, welchen Einfluss Emotionen auf das Handeln haben. Zur psychologischen Erklärung des emotionalen Geschehens gehört die Grundannahme, dass Menschen ein Bedürfnis nach Bestimmtheit und Kompetenz haben. Unter Bestimmtheit ist das Ausmaß zu verstehen, im dem man sich imstande fühlt, die Ereignisse und das Geschehen in der Umwelt vorauszusagen und zu erklären. 30 Kompetenz ist das Ausmaß, in dem man sich imstande fühlt, die Probleme seines Alltags zu bewältigen, also das subjektive Zutrauen, in der jeweiligen Situation die eigenen Ziele verwirklichen zu können. 31 Wenn man Bestimmtheit und Kompetenz mit zwei Tanks vergleicht, deren Pegel sich entsprechend den erlebten Situationen verändert, dann werden die Pegel von Bestimmtheits- und Unbestimmtheitsereignissen und von Effizienz- und Ineffizienzereignissen beeinflusst. Erfüllt sich die Entwicklungsprognose einer Situation, dann ist dies ein Bestimmtheitsereignis, erfüllt sie sich nicht, dann ist dies ein Unbestimmtheitsereignis. Es handelt sich um ein Bedürfnis nach passiver Kontrolle und Vorhersagbarkeit der Geschehnisse in der Umwelt. Ein Effizienzereignis ist eine erfolgreich durchgeführte Handlung und ein Ineffizienzereignis liegt dann vor, wenn unser Handeln nicht erfolgreich war. 32 Die Pegelstände sind wichtig für unsere Balance. Sie geben Rückmeldung, ob wir die Welt verstehen und voraussagen können und ob wir die aktive Bewältigung eines Problems leisten können. Verschiedene Pegelstände führen zu emotionalen Handlungstendenzen, die wir uns vergegenwärtigen sollten, um das eigene Handeln oder das von anderen besser verstehen zu können. So steigert sich bei niedriger Bestimmtheit und niedriger Kompetenz unser Sicherungsverhalten, demnach kommt es zur gesteigerten Beobachtung der Vgl. Dörner, Dietrich: Emotion und Handeln. In: Petra Badke-Schaub und Gesine Hofinger und Kristina Lauche (Hrsg.): Human Factors. Psychologie sicheren Handelns in Risikobranchen. Heidelberg S. 97. (künftig zitiert als: Dörner. 2008b). Vgl. Strohschneider S. 36. Vgl. Dörner. 2008b. S
23 Umgebung durch ängstliche Blicke in alle Richtungen. Je nach Erfolgseinschätzung besteht die Tendenz zu Angriff oder Flucht. Durch eine niedrige Bestimmtheit steigert sich die Explorationstendenz, das heißt die Verhaltensweise, unbekannte Bereiche zu erforschen, um neues Wissen zu sammeln. Dies setzt allerdings eine große Kompetenz voraus, mit anderen Worten das Vertrauen erfolgreich agieren zu können. Niedrige Kompetenz erzeugt eine Affiliationstendenz, also den Drang sich enger an andere zu binden. Eine Gruppe bedeutet Unterstützung und Hilfe und ist die wichtigste Quelle der Kompetenz. Obwohl Gruppenzugehörigkeit beschränkend auf Kreativität und Selbstverwirklichung Einfluss nimmt und Anpassung gefordert ist. Niedrige Kompetenz erzeugt auch Wahrnehmungsabwehr. Demnach werden Informationen, die auf eine Krise und Handlungsnotwendigkeit hindeuten, ignoriert, denn ein Versagen würde die Gefahr weiteren Kompetenzverlusts mit sich bringen. Zudem wird die Bereitschaft zur Selbstreflexion gemindert, denn dies könnte Selbstkritik nahe legen, die weitere Inkompetenz aufdeckt. Es kommt zur kompetenzschutzbezogenen Rationalität oder Kompetenzhygiene, wobei die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Kompetenzgefühls im Vordergrund steht und nicht die Lösung akuter Probleme Stress Beim Umgang mit Krisensituationen ist Stress ein wesentlicher Faktor, über dessen grundsätzlichen Erscheinungsformen und Wirkungen sich die Handelnden bewusst sein sollten, um Symptome rechtzeitig erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Allerdings würde eine detaillierte Aufarbeitung des Themas mit Stresssymptomen, Entstehungstheorien und Stressbewältigungsstrategien den Rahmen dieser Arbeit sprengen, deshalb beschränke ich mich auf einen groben Überblick. 33 Vgl. ebenda. S
24 Stressreaktionen haben zunächst eine adaptive Funktion, demnach handelt es sich um eine Anpassungsreaktion unseres Organismus an eine Situation, die als die eigene Kompetenz übersteigend wahrgenommen wird. Sie dienen der Aufrechterhaltung unserer Handlungsfähigkeit. 34 Dem steinzeitlichen Muster folgend, reagiert der Körper mit einer Zunahme der physiologischen Erregung, die auch kognitive Ressourcen verbraucht, so dass unser ohnehin schon beschränkter Denkapparat insbesondere im Bereich des Arbeitsgedächtnisses und der Aufmerksamkeit noch weniger leisten kann. Eine wesentliche Stresstheorie ist das Allgemeine Adaptionssyndrom. Hierbei reagieren Organismen auf Stressoren mit einem physiologischen Erregungsmuster, der sogenannten Widerstandsphase, um die Anforderung einer Situation zu bewältigen und schließlich in einer Erschöpfungsphase zu enden. In der Widerstandsphase reagiert der Mensch auf neue Stressoren empfindlicher, so dass der Erregungszustand immer mehr steigt und es in der Eskalation zum totalen Zusammenbruch des Organismus kommen kann. Die weitere bedeutende Stresstheorie ist das Transaktionale Stressmodell, das eine kognitive Bewertung der Situation durch den Handelnden als Grundannahme unterstellt. Ein Reiz wird erst dann zum Stressor, wenn er als solches bewertet, empfunden oder erlebt wird. Stress entsteht also nicht durch die objektiven Reize, sondern durch die kognitive Verarbeitung des Betroffenen. Erst wenn die eigenen Ressourcen zur Bewältigung der Situation als nicht ausreichend eingeschätzt werden, wird eine Stressreaktion ausgelöst und eine Bewältigungsstruktur coping genannt kommt zur Anwendung. Die Form des coping ist abhängig von Erfahrung, Einstellung, Veranlagung und den persönlichen Fähigkeiten des Beurteilenden, was die höchstindividuelle Ausformung von Stressempfinden erklärt. Stressreaktionen können sowohl physisch, also körperlich, sowie psychisch, also kognitiv, emotional und behavioral sein. 34 Vgl. Starke S
25 Körperlich bereitet sich der Organismus auf Aktionen wie Angriff oder Flucht vor. Demnach erhöhen sich Blutdruck, Herzfrequenz und Atmung. Bei hohem Stress werden vegetativ-hormonell hohe Dosen Kortisol, Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet, die uns reaktionsbereit und aufmerksam machen, allerdings auch Teile des Gehirns lahm legen. Die Kommandos für diese Reaktionen kommen vom Gehirn; die Organe sind praktisch nur Erfüllungsgehilfen. 35 Im kognitiven Bereich können Einengung der Wahrnehmung auf relevant erscheinende Reize, längere Reaktionszeiten und Gedächtnisdefizite auftreten. Auf der emotionalen Ebene kann es unter anderem zu Emotionen wie Ärger, Aggression, Angst oder Frustration kommen. Im sozialen Miteinander sind oft geringere Hilfs- oder Kooperationsbereitschaft, konfliktreiches Umgehen mit anderen und Vernachlässigung von Teamaspekten zu beobachten. 36 Wie können wir diesen Effekten entgegenwirken? Erstens müssen wir lernen, Stressreaktionen und ihre Wirkung auf die Handlungsund Entscheidungsfähigkeit bei uns und anderen zu erkennen, um entsprechende kurzfristige Stressbewältigungsstrategien anzuwenden. Dies sind beispielsweise spontane Entspannung durch Atmungsregulation, Gedankenstopp oder positive Selbstinstruktion. Zweitens müssen die Kompetenzen und Ressourcen durch Erfahrung, Trainings, Routine-Entscheidungen, Teamarbeit und Persönlichkeit gesteigert werden. 37 Die Methode des erfahrungsbasierten Lernens, wie etwa die Ausbildung mittels Planspiel, bietet in vielen Facetten die Möglichkeit, den Umgang mit Stress und dessen Bewältigung zu üben. 35 Vgl. Traufetter, Gerald: Intuition. Die Weisheit der Gefühle. Reinbek bei Hamburg S. 16. (künftig zitiert als: Traufetter. 2009). 36 Vgl. Starke S Vgl. Ungerer, Dietrich und Jörn Ungerer: Lebensgefährliche Situationen als polizeiliche Herausforderung. Entstehung Bewältigung - Ausbildung. Frankfurt am Main S. 60. (künftig zitiert als: Ungerer und Ungerer. 2005). 23
26 2.4 Zusammenfassung Diskussion Bei dem Studium der ausgewählten Fachliteratur zu dem Thema Informationsverarbeitung wird deutlich, dass sich viele psychologische Fachtermini, wie etwa top-down Prozess, priming, mentale Schemata, situation awareness, naturalistic decision making oder Transaktionales Stressmodell in weiten Kernaussagen überschneiden und ergänzen. Es gibt zwei Prozesse der Wahrnehmung: Den bottom-up Prozess, bei dem der Reiz objektiv und unverzerrt wahrgenommen wird und den top-down Prozess, der die eingehenden Informationen mit Gedächtnisinhalten abgleicht und interpretiert. Menschen in ihren jeweiligen Arbeitsumgebungen nutzen ihr Wissen und ihre Erfahrung dazu, die Problemsituation einer abgespeicherten Kategorie zuzuordnen und das mit dieser Situation assoziierte Handlungsmuster abzurufen. Bei der zwischenmenschlichen Interaktion gibt es eine Reihe von Phänomenen, die unser Urteil über andere Menschen beeinflussen und unter Umständen vorschnell verzerren. Hierzu gehören die in Folge von Kategorisierung und mentalen Schemata entstehenden Stereotype und Vorurteile. Ergänzend gibt es die Urteilsheuristiken. Sie ermöglichen zwar eine schnelle Urteilsbildung bei defizitärer Informationslage, bergen aber auch die Gefahr von Fehlurteilen. Ferner existiert die Bestimmtheits- und Kompetenztheorie, welche die Grundannahme vertritt, dass Menschen ein implizites Bedürfnis haben, die Geschehnisse in ihrer Umwelt vorhersagen bzw. erklären zu können und Handlungserfordernisse erfolgreich bewältigen zu können. Sind diese Bedürfnisse gefährdet, kommt es unter Umständen zu negativen Verhaltenstendenzen, wie Informationsabwehr, Umdeutung oder Kompetenzhygiene. Auch Stress spielt bei der Entscheidungsfindung in Krisensituationen eine wichtige Rolle. Im Vordergrund steht die Erkenntnis, dass Stressreaktionen unseren Organismus auf Situationen vorbereiten, die eher Anforderungen aus einer prähistorischen Entwicklungsstufe erfüllen. Der Mensch wird primär in die Lage versetzt durch körperliches Handeln zu reagieren; kognitive Leistungsfähigkeit wird beschränkt. 24
27 Stressreaktionen können physisch, kognitiv, emotional und behavioral erfolgen, wobei sowohl das Stressempfinden als auch die Wirkung von Stressbewältigungsstrategien hochindividuell ist. In Bezug auf die Informationsverarbeitungs-, Planungs- und Entscheidungsprozesse ist wichtige Voraussetzung, dass die Wege von den Informationsreizen bis zu den Einflussgrößen der Aufnahme und Verarbeitung verstanden werden, um ihren Einfluss auf menschliches Verhalten bestimmen zu können. Nur dann können Gestaltungsempfehlungen hinsichtlich des Arbeitsprozesses, des Arbeitsplatzes, der Aus- und Fortbildung und des gesamten soziotechnischen Systems erstellt werden. 3 Der Begriff Krise Bei dem Wort Krise werden den meisten Menschen wahrscheinlich negative Konnotationen in den Sinn kommen. Wirtschaftskrise Finanzmarktkrise Krisengebiet Krisenherd Lebenskrise sind alles Begrifflichkeiten, die Gefahren, Bedrohungen, Ungewissheiten und vielleicht auch bereits Leid und Schaden in sich bergen. Der Begriff Krise entstammt der griechischen Sprache und hat die Bedeutung Entscheidung, entscheidende Wendung und wird beschrieben als schwierige Situation, Zeit, die den Höhe und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt 38 Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das chinesische Wort für Krise sowohl Gefahr als auch Gelegenheit bedeutet. 39 Krise kann also auch als Chance betrachtet werden, endlich den Beweis antreten zu können, dass alle Vorbereitungen getroffen wurden, um die Herausforderungen einer Krise bewältigen zu können. Die Beteiligten bekommen ein Feedback, ob sie kompetent genug waren, ob die Leistungsfähigkeit des Teams stimmte, ob die technischen und organisatorischen Vgl. Duden. Fremdwörterlexikon. Mannheim S Vgl. Starke S
28 Vorkehrungen passten oder ob sie das Ausbildungskonzept adäquat auf die Anforderungen vorbereitete. Zudem bietet eine erfolgreiche Krisenbewältigung das Potential, ein Team zusammenzuschweißen und in das kollektive Gedächtnis einzugehen die Mitarbeiter gehen stärker aus der Krise heraus als in die Krise hinein Merkmale einer Krise Für die Entscheidungsträger sind die typischen Charakteristika einer Krise die dringende Notwendigkeit von Handlungsentscheidungen, ein Gefühl von Bedrohung, ein Anstieg an Unsicherheit, Dringlichkeit und der Eindruck, das Ergebnis sei von prägendem Einfluss auf die Zukunft. Außerdem haben es die Entscheidungsträger oft mit unvollständiger oder verfälschter Information zu tun. 41 Je nach Ausformung dieser Faktoren ergibt sich das Anforderungsprofil an die Mitarbeiter der Krisenbewältigung. 42 Eine Krisensituation setzt sich aus vielen einzelnen kritischen Situationen zusammen. Ihre Abgrenzung zu alltäglichen Arbeitsprozessen besteht darin, kein Routinehandeln zu sein. Routine bedeutet in den meisten Berufsfeldern, dass die Rahmenbedingungen des Handelns, die Handlungsprozesse selbst und auch die Ergebnisse bekannt sind und beherrscht werden. Bei einer kritischen Situation reicht Routine nicht mehr aus. Es passiert etwas, das die Alltagsabläufe unterbricht und besondere Entscheidungen und Maßnahmen erfordert von denen abhängt, ob und wann sich die Arbeitsprozesse wieder in Richtung Routinehandeln bewegen. 43 Der Unterschied zwischen einer Krisensituation und einem Notfall besteht darin, dass der Notfall plötzlich eintritt, es ein identifizierbares auslösendes Ereignis gibt und eine rasche Reaktion notwendig ist. Meistens erfordern diese Situationen die Vgl. Jenewein, Wolfgang und Marcus Heidbrink: High-Performance-Teams. Die fünf Erfolgsprinzipien für Führung und Zusammenarbeit. Stuttgart S (künftig zitiert als: Jenewein und Heidbrink. 2008). Vgl. Wiener/Kahn (1962). Zitiert in: Gredler, Margaret: Designing and Evaluating Games and Simulations. A Process Approach. London S. 78. Vgl. Starke S. 13. Vgl. Strohschneider, Stefan (Hrsg.): Entscheiden in kritischen Situationen. Frankfurt am Main S. VI. 26
29 schnelle Anwendung bestehender Pläne und Prozeduren, die vorbereitet und trainiert werden können. Bei einer Krise kommen Merkmale wie Komplexität, Dynamik und Unvollständigkeit der Strukturkenntnisse hinzu. Dennoch sind die Grenzen zwischen Notfall und Krise fließend. Ein Notfall kann sich schnell zur Krise entwickeln, wenn die vorbereiteten Bewältigungsprozeduren nicht funktionieren. Umgekehrt ist es aber auch möglich, dass sich Sequenzen der Krisensituation mit der Notfallplanung bearbeiten lassen. 44 Es stellt sich die Frage, ob besondere polizeiliche Einsatzlagen Krisensituationen sind? Nehmen wir an, dass es in der Fußgängerzone einer Großstadt zu einem Banküberfall mit anschließender Geiselnahme gekommen ist. Mindestens ein Täter, mit einer Pistole und einer Handgranate bewaffnet, befindet sich noch im Objekt und hat mehrere Menschen in seiner Gewalt. Der Täter hat sich gleich nach seinem Eindringen in die Bank über Notruf bei der Polizei gemeldet und gedroht, Geiseln zu erschießen, wenn er auch nur eine Uniform auf der Straße sieht. Er fordert 2 Millionen Euro Lösegeld, eine Packung des Arzneimittels Methadon, Verbandzeug und ein Presseteam für ein Interview vor Ort. Kurz nach dem Telefonat ist in dem Gebäude ein Schuss gefallen; seitdem sind Schmerzenslaute einer weiblichen Person zu hören. Die Beurteilung kann kurz ausfallen: Die Allgemeine Aufbauorganisation der Polizei, die für die Bewältigung der Routineaufgaben, wie Anzeigen- oder Unfallaufnahme konzipiert ist, kann die Bewältigung einer solchen Lage nicht leisten. Es sind viele Polizeibeamte unter der Leitung eines Polizeiführers erforderlich, die in einer spezifischen Besonderen Aufbauorganisation gegliedert sind. Als Führungsinstrument des Polizeiführers wird der Führungsstab zusammengerufen. 45 Es herrscht hoher Entscheidungs- und Handlungsdruck. Das Leben und die Gesundheit mehrerer Geiseln sind bedroht. Vermutlich gibt es bereits Schwerverletzte, die medizinisch versorgt werden müssen. Der Täter stellt Vgl. Starke S. 12f. Vgl. PDV 100. Ziffer S
Inhaltsverzeichnis. I Human Factors und sicheres Handeln i. II Individuelle und teambezogene Faktoren 6i
 IX I Human Factors und sicheres Handeln i 1 Human Factors 3 Petra Badke-Schaub, Gesine Hofinger und Kristina Lauche 1.1 Die menschlichen Faktoren und die Disziplin Human Factors 4 1.2 Verwandte Disziplinen
IX I Human Factors und sicheres Handeln i 1 Human Factors 3 Petra Badke-Schaub, Gesine Hofinger und Kristina Lauche 1.1 Die menschlichen Faktoren und die Disziplin Human Factors 4 1.2 Verwandte Disziplinen
(Chinesische Weisheit)
 Typische menschliche Denkfehler und deren Auswirkungen Worauf ihr zu sinnen habt, ist nicht mehr, dass die Welt von euch spreche, sondern wie ihr mit euch selbst sprechen solltet. (Chinesische Weisheit)
Typische menschliche Denkfehler und deren Auswirkungen Worauf ihr zu sinnen habt, ist nicht mehr, dass die Welt von euch spreche, sondern wie ihr mit euch selbst sprechen solltet. (Chinesische Weisheit)
Nervensystem Gliederung des Nervensystems der Wirbeltiere
 Nervensystem Gliederung des Nervensystems der Wirbeltiere Aufgaben Welche Aufgaben erfüllt das Nervensystem? - Welche Vorgänge laufen bei einer Reaktion ab? - Was ist das Ziel der Regulation? - Was ist
Nervensystem Gliederung des Nervensystems der Wirbeltiere Aufgaben Welche Aufgaben erfüllt das Nervensystem? - Welche Vorgänge laufen bei einer Reaktion ab? - Was ist das Ziel der Regulation? - Was ist
Neurobiologische Erkenntnisse und ihre Bedeutung für die pflegerisch-pädagogische Arbeit im Rahmen der Soziomilieugestaltung
 Neurobiologische Erkenntnisse und ihre Bedeutung für die pflegerisch-pädagogische Arbeit im Rahmen der Soziomilieugestaltung 1 Melitta Hofer seit 1997 Krankenschwester seit 2001in der Klinik Nette-Gut
Neurobiologische Erkenntnisse und ihre Bedeutung für die pflegerisch-pädagogische Arbeit im Rahmen der Soziomilieugestaltung 1 Melitta Hofer seit 1997 Krankenschwester seit 2001in der Klinik Nette-Gut
Wie wir die Erkenntnisse der Gehirnforschung für mehr Kreativität und innovative Ideen nutzen können.
 Wie wir die Erkenntnisse der Gehirnforschung für mehr Kreativität und innovative Ideen nutzen können. Kreativität und innovative Ideen sind gefragter als je zuvor. Sie sind der Motor der Wirtschaft, Wissenschaft
Wie wir die Erkenntnisse der Gehirnforschung für mehr Kreativität und innovative Ideen nutzen können. Kreativität und innovative Ideen sind gefragter als je zuvor. Sie sind der Motor der Wirtschaft, Wissenschaft
6. Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein
 19 6. Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein Das Selbstwertgefühl ist eine Selbsteinschätzung, der wahrgenommene Wert der eigenen Person. Die Selbsteinschätzung erfolgt in der Auseinandersetzung mit sich
19 6. Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein Das Selbstwertgefühl ist eine Selbsteinschätzung, der wahrgenommene Wert der eigenen Person. Die Selbsteinschätzung erfolgt in der Auseinandersetzung mit sich
Meet The Expert - Bewältigungsstrategien. DGBS Jahrestagung Sep. 2017
 Meet The Expert - Bewältigungsstrategien DGBS Jahrestagung 07. -09. Sep. 2017 Stress Definition Stress (engl. für Druck, Anspannung ; lat. stringere anspannen ) bezeichnet durch spezifische äußere Reize
Meet The Expert - Bewältigungsstrategien DGBS Jahrestagung 07. -09. Sep. 2017 Stress Definition Stress (engl. für Druck, Anspannung ; lat. stringere anspannen ) bezeichnet durch spezifische äußere Reize
Professionelles (Re)Agieren lernen. Wolfgang Papenberg
 Professionelles (Re)Agieren lernen Kurzvortrag anlässlich der Tagung Gewaltprävention in der Pflegepraxis Mülheim 15. März 2013 Wolfgang Papenberg Vorbemerkung Leider habe ich bei dem Kurzvortrag die falsche
Professionelles (Re)Agieren lernen Kurzvortrag anlässlich der Tagung Gewaltprävention in der Pflegepraxis Mülheim 15. März 2013 Wolfgang Papenberg Vorbemerkung Leider habe ich bei dem Kurzvortrag die falsche
Evaluation und Abschluss
 Die Arbeit mit dem einzelnen Klienten: Evaluation und Abschluss Literatur zum Selbststudium Literaturempfehlungen Müller, Burkhard: Sozialpädagogisches Können ein Lehrbuch zur multiperspektivischen Fall.
Die Arbeit mit dem einzelnen Klienten: Evaluation und Abschluss Literatur zum Selbststudium Literaturempfehlungen Müller, Burkhard: Sozialpädagogisches Können ein Lehrbuch zur multiperspektivischen Fall.
1 Inhalte der Funktion Informationsmanagement
 1 1 Inhalte der Funktion Informationsmanagement Darstellung der Inhalte der Funktion Informationsmanagement und deren Bedeutung sowohl für handelnde Personen als auch in einem Unternehmen / einer Organisation.
1 1 Inhalte der Funktion Informationsmanagement Darstellung der Inhalte der Funktion Informationsmanagement und deren Bedeutung sowohl für handelnde Personen als auch in einem Unternehmen / einer Organisation.
Pädagogische Führung als dialogische Intervention
 Pädagogische Führung als dialogische Intervention Tagung Lerncoaching 29.8.15 Dieter Rüttimann, Prof. ZFH Die Lernplattform (Schley & Breuninger) 40 Szenen aus dem Schulalltag, 10 Szenen auf dem Familienalltag
Pädagogische Führung als dialogische Intervention Tagung Lerncoaching 29.8.15 Dieter Rüttimann, Prof. ZFH Die Lernplattform (Schley & Breuninger) 40 Szenen aus dem Schulalltag, 10 Szenen auf dem Familienalltag
in die Einführung Sportpsychologie Teili: Grundthemen Verlag Karl Hofmann Schorndorf Hartmut Gabler/Jürgen R. Nitsch / Roland Singer
 Hartmut Gabler/Jürgen R. Nitsch / Roland Singer Einführung in die Sportpsychologie Teili: Grundthemen unter Mitarbeit von Jörn Munzert Verlag Karl Hofmann Schorndorf Inhalt Einleitung 9 I. Sportpsychologie
Hartmut Gabler/Jürgen R. Nitsch / Roland Singer Einführung in die Sportpsychologie Teili: Grundthemen unter Mitarbeit von Jörn Munzert Verlag Karl Hofmann Schorndorf Inhalt Einleitung 9 I. Sportpsychologie
Mannheim. Dr. Thomas Fröschl, Karlsruhe ias-Gruppe
 Warnen oder sichern: Menschengerechte Strategien zur Gefahrenabwehr bei Arbeiten im Gleisbereich Dr. Thomas Fröschl, Diplom-Psychologe, ias Aktiengesellschaft, Zentrum Karlsruhe Beitrag zum Abschlusssymposium
Warnen oder sichern: Menschengerechte Strategien zur Gefahrenabwehr bei Arbeiten im Gleisbereich Dr. Thomas Fröschl, Diplom-Psychologe, ias Aktiengesellschaft, Zentrum Karlsruhe Beitrag zum Abschlusssymposium
Mit allen Sinnen wahrnehmen
 Mit allen Sinnen wahrnehmen Alles was unser Gehirn verarbeitet, nehmen wir durch unsere fünf Sinne wahr. Der größte Teil davon wird unbewusst erfasst es ist kaum nachvollziehbar, welcher Teil aus welcher
Mit allen Sinnen wahrnehmen Alles was unser Gehirn verarbeitet, nehmen wir durch unsere fünf Sinne wahr. Der größte Teil davon wird unbewusst erfasst es ist kaum nachvollziehbar, welcher Teil aus welcher
Mach s Dir selbst. Woran erkenne ich, dass mir Coaching helfen könnte? Wann besteht denn überhaupt Coaching-Bedarf?
 Mach s Dir selbst Via Selbstcoaching in ein erfülltes Leben. Oftmals machen sich die Menschen Gedanken darüber, was denn andere denken könnten, wenn Sie Hilfe von außen für Ihre Probleme in Anspruch nehmen
Mach s Dir selbst Via Selbstcoaching in ein erfülltes Leben. Oftmals machen sich die Menschen Gedanken darüber, was denn andere denken könnten, wenn Sie Hilfe von außen für Ihre Probleme in Anspruch nehmen
Modelle zum Handlungslernen
 Modelle zum Handlungslernen Inhaltsübersicht 1. Ein kybernetische Modell der Handlung 2. Ein Modell der Handlungsregulation 3. Ein Modell der Wahrnehmung 4. Ein Modell des Lernens durch Handeln 5. Ein
Modelle zum Handlungslernen Inhaltsübersicht 1. Ein kybernetische Modell der Handlung 2. Ein Modell der Handlungsregulation 3. Ein Modell der Wahrnehmung 4. Ein Modell des Lernens durch Handeln 5. Ein
CRM-Grundlagen. Modul 1 - Anhänge INCREASE-Weiterbildungscurriculum Intellectual Output 2 Projektnr AT02-KA M1-A13
 CRM-Grundlagen Quelle: Nickson, Ch (2016, May 27): Crisis Resource Management (CRM). Abgerufen von: http://lifeinthefastlane.com/ccc/crisisresource-management-crm/ am 07/07/2016 1. Kennen Sie den Kontext/das
CRM-Grundlagen Quelle: Nickson, Ch (2016, May 27): Crisis Resource Management (CRM). Abgerufen von: http://lifeinthefastlane.com/ccc/crisisresource-management-crm/ am 07/07/2016 1. Kennen Sie den Kontext/das
Die mentale Stärke verbessern
 1 Die mentale Stärke verbessern 2 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 4 Was können wir uns unter der mentalen Stärke vorstellen?... 5 Wir suchen die mentale Stärke in uns... 6 Unsere Gedanken haben mehr Macht,
1 Die mentale Stärke verbessern 2 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 4 Was können wir uns unter der mentalen Stärke vorstellen?... 5 Wir suchen die mentale Stärke in uns... 6 Unsere Gedanken haben mehr Macht,
Stress entsteht im Kopf Die Schlüsselrolle von Denkmustern im Umgang mit Stress und Belastungen
 Stress entsteht im Kopf Die Schlüsselrolle von Denkmustern im Umgang mit Stress und Belastungen Betriebliches Eingliederungsmanagement in Schleswig-Holstein 2016 Fachtag und Auszeichnung Büdelsdorf, 7.
Stress entsteht im Kopf Die Schlüsselrolle von Denkmustern im Umgang mit Stress und Belastungen Betriebliches Eingliederungsmanagement in Schleswig-Holstein 2016 Fachtag und Auszeichnung Büdelsdorf, 7.
WORKSHOP 3 Sexualisierte Gewalt ansprechen? Opferperspektive Mythen Scham und Schuld Hintergründe von Traumatisierung
 WORKSHOP 3 Sexualisierte Gewalt ansprechen? Opferperspektive Mythen Scham und Schuld Hintergründe von Traumatisierung 1. Sensibilisierung 2. Mythen abbauen LERNZIELE 3. Sekundäre Viktimisierung verhindern
WORKSHOP 3 Sexualisierte Gewalt ansprechen? Opferperspektive Mythen Scham und Schuld Hintergründe von Traumatisierung 1. Sensibilisierung 2. Mythen abbauen LERNZIELE 3. Sekundäre Viktimisierung verhindern
Umgang mit Stress und Angst im beruflichen Kontext. Definitionen Modelle - Bewältigung
 Umgang mit Stress und Angst im beruflichen Kontext Definitionen Modelle - Bewältigung Definitionen im Wandel der Zeit Hans Selye: Stress ist eine unspezifische Reaktion des Körpers auf eine Belastung Tierversuche
Umgang mit Stress und Angst im beruflichen Kontext Definitionen Modelle - Bewältigung Definitionen im Wandel der Zeit Hans Selye: Stress ist eine unspezifische Reaktion des Körpers auf eine Belastung Tierversuche
Biologische Psychologie I
 Biologische Psychologie I Kapitel 7 Mechanismen der Wahrnehmung, des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit Organisationsprinzipien eines sensorischen Systems: Primärer und sekundärer sensorischer Kortex
Biologische Psychologie I Kapitel 7 Mechanismen der Wahrnehmung, des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit Organisationsprinzipien eines sensorischen Systems: Primärer und sekundärer sensorischer Kortex
Wann brauche ich interkulturelle Handlungsfähigkeit? Seite 10. Was versteht man unter Kultur? Seite 11
 Wann brauche ich interkulturelle Handlungsfähigkeit? Seite 10 Was versteht man unter Kultur? Seite 11 Wie entstehen interkulturelle Fehlinterpretationen? Seite 13 1. Die interkulturelle Herausforderung
Wann brauche ich interkulturelle Handlungsfähigkeit? Seite 10 Was versteht man unter Kultur? Seite 11 Wie entstehen interkulturelle Fehlinterpretationen? Seite 13 1. Die interkulturelle Herausforderung
Unterrichtseinheit 21
 Unterrichtseinheit 21!! 1 INHALTSVERZEICHNIS 5.14 Übung: Sprache - Arbeitsblatt 6 - Verständigung S. 3 5.15 Theoretische Grundlagen: Kommunikation, Regeln und S. 4 "Verkehrsschilder" 5.16 Theoretische
Unterrichtseinheit 21!! 1 INHALTSVERZEICHNIS 5.14 Übung: Sprache - Arbeitsblatt 6 - Verständigung S. 3 5.15 Theoretische Grundlagen: Kommunikation, Regeln und S. 4 "Verkehrsschilder" 5.16 Theoretische
Inhalt. 3 Soziale und individuelle Vorstellungen von Krankheit und
 Einleitung 13 I Gesundheit und Krankheit in unserer Gesellschaft 17 1 Zum begrifflichen Verständnis von Gesundheit und Krankheit 18 1.1 Gesundheit und Krankheit als Dichotomie 18 1.2 Gesundheit und Krankheit
Einleitung 13 I Gesundheit und Krankheit in unserer Gesellschaft 17 1 Zum begrifflichen Verständnis von Gesundheit und Krankheit 18 1.1 Gesundheit und Krankheit als Dichotomie 18 1.2 Gesundheit und Krankheit
Cognitive Finance Paradigmenwechsel und neue Sicht auf Wirtschaft und Kapitalmärkte
 Etwas ist faul im Staate Dänemark. Dieses Hamlet-Zitat lässt sich heute auch auf den Stand der Wirtschafts- und Kapitalmarktforschung übertragen. Bereits seit Jahren herrscht in zentralen Bereichen der
Etwas ist faul im Staate Dänemark. Dieses Hamlet-Zitat lässt sich heute auch auf den Stand der Wirtschafts- und Kapitalmarktforschung übertragen. Bereits seit Jahren herrscht in zentralen Bereichen der
Persönlichkeitsinventar Open IS-10
 Ergebnisbericht Beatrice Beispiel 32 Jahre weiblich Das Verfahren Das Persönlichkeitsinventar OPEN IS-10 (Inventory of Strengths 10) stellt ein Verfahren zur Messung von psychologischen Stärken und Tugenden
Ergebnisbericht Beatrice Beispiel 32 Jahre weiblich Das Verfahren Das Persönlichkeitsinventar OPEN IS-10 (Inventory of Strengths 10) stellt ein Verfahren zur Messung von psychologischen Stärken und Tugenden
Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld
 Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Bestimmungsfaktoren des Konsumentenverhaltens
 Der,,denkfaule Konsument Welche Aspekte bestimmen das Käuferverhalten? Ein Ausblick auf passives Informationsverhalten, Involvement und Auswirkungen auf Werbemaßnahmen Bestimmungsfaktoren des Konsumentenverhaltens
Der,,denkfaule Konsument Welche Aspekte bestimmen das Käuferverhalten? Ein Ausblick auf passives Informationsverhalten, Involvement und Auswirkungen auf Werbemaßnahmen Bestimmungsfaktoren des Konsumentenverhaltens
Tatiana Lima Curvello
 Fachgruppe Interkulturelle Systemische Therapie und Beratung DGSF Interkulturelle Paartherapie : Umgang mit Trennungen in multikulturellen Beziehungen 04.11.2017 1 Wann ist Kultur relevant? Kultur als
Fachgruppe Interkulturelle Systemische Therapie und Beratung DGSF Interkulturelle Paartherapie : Umgang mit Trennungen in multikulturellen Beziehungen 04.11.2017 1 Wann ist Kultur relevant? Kultur als
Behavioral Finance. Gewinnen mit Kompetenz. Joachim Goldberg Rüdiger von Nitzsch. FinanzBuch Verlag München
 Joachim Goldberg Rüdiger von Nitzsch 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Behavioral Finance Gewinnen
Joachim Goldberg Rüdiger von Nitzsch 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Behavioral Finance Gewinnen
Process-experiential psychotherapy
 Process-experiential psychotherapy IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 1 Der therapeutische Ansatz der process-experiential psychotherapy (PEP) entwickelte sich aus einer direktiveren Form der klientenzentrierten
Process-experiential psychotherapy IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 1 Der therapeutische Ansatz der process-experiential psychotherapy (PEP) entwickelte sich aus einer direktiveren Form der klientenzentrierten
Psychologisches Grundwissen für die Polizei
 Günter Krauthan Psychologisches Grundwissen für die Polizei Ein Lehrbuch 4., vollständig überarbeitete Auflage BEÜZPVU Vorwort zur 4. Auflage und Anmerkungen X Teil I Einführung 1 Psychologie für Polizeibeamte:
Günter Krauthan Psychologisches Grundwissen für die Polizei Ein Lehrbuch 4., vollständig überarbeitete Auflage BEÜZPVU Vorwort zur 4. Auflage und Anmerkungen X Teil I Einführung 1 Psychologie für Polizeibeamte:
Haben alle Mitglieder eines Systems dieselbe Intelligenz?
 Haben alle Mitglieder eines Systems dieselbe Intelligenz? Oft wird diese Frage gestellt und meistens wird sie mit Natürlich, es haben doch alle das selbe Gehirn beantwortet. Doch reicht das aus, damit
Haben alle Mitglieder eines Systems dieselbe Intelligenz? Oft wird diese Frage gestellt und meistens wird sie mit Natürlich, es haben doch alle das selbe Gehirn beantwortet. Doch reicht das aus, damit
Die richtigen Zutaten für eine professionelle Entwicklung
 Die richtigen Zutaten für eine professionelle Entwicklung Dr. Helen Jossberger Was sind Ihrer Meinung nach die richtigen Zutaten für eine professionelle Entwicklung? Was ist für Sie gute Anleitung? Was
Die richtigen Zutaten für eine professionelle Entwicklung Dr. Helen Jossberger Was sind Ihrer Meinung nach die richtigen Zutaten für eine professionelle Entwicklung? Was ist für Sie gute Anleitung? Was
Stabilität und Veränderung psychologischer Aspekte im höheren Erwachsenenalter. Dr. Stefanie Becker
 Stabilität und Veränderung psychologischer Aspekte im höheren Erwachsenenalter Dr. Stefanie Becker Stiftungsgastdozentur der Universität des 3. Lebensalters, Frankfurt, im Sommersemester 2007 Themen der
Stabilität und Veränderung psychologischer Aspekte im höheren Erwachsenenalter Dr. Stefanie Becker Stiftungsgastdozentur der Universität des 3. Lebensalters, Frankfurt, im Sommersemester 2007 Themen der
Mangelnde Repräsentation, Dissoziation und doppeltes Überzeugungssystem
 Mangelnde Repräsentation, Dissoziation und doppeltes Überzeugungssystem Prof. Dr. Rainer Sachse, IPP 2001 1 Affektive Schemata Diese affektiven Schemata bilden sich aufgrund von affektiver Verarbeitung
Mangelnde Repräsentation, Dissoziation und doppeltes Überzeugungssystem Prof. Dr. Rainer Sachse, IPP 2001 1 Affektive Schemata Diese affektiven Schemata bilden sich aufgrund von affektiver Verarbeitung
Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit
 Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit Herzlich Willkommen zum Impulsreferat: Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit im Kontext globalen und gesellschaftlichen Wandels und soziodemographischer
Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit Herzlich Willkommen zum Impulsreferat: Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit im Kontext globalen und gesellschaftlichen Wandels und soziodemographischer
Unterrichtseinheit 9
 Unterrichtseinheit 9!! 1 INHALTSVERZEICHNIS 4.1 Übung: "Erkennung der Gelenke" S. 3!! 2 4.1 "ERKENNUNG DER GELENKE" Das Video ansehen Einführung zur Übung Ich möchte, dass Sie über Folgendes nachdenken:
Unterrichtseinheit 9!! 1 INHALTSVERZEICHNIS 4.1 Übung: "Erkennung der Gelenke" S. 3!! 2 4.1 "ERKENNUNG DER GELENKE" Das Video ansehen Einführung zur Übung Ich möchte, dass Sie über Folgendes nachdenken:
Lehrersein mit Leichtigkeit
 Dr. Wolfgang Worliczek Lehrersein mit Leichtigkeit Lebensqualität trotz Schule 1 Illustration Christian Tschepp 2 Lehrerinnen + Lehrer sind wichtig! Sie begleiten Kinder in Phasen, die für ihr Selbstbild
Dr. Wolfgang Worliczek Lehrersein mit Leichtigkeit Lebensqualität trotz Schule 1 Illustration Christian Tschepp 2 Lehrerinnen + Lehrer sind wichtig! Sie begleiten Kinder in Phasen, die für ihr Selbstbild
Die Psychologie der Personenbeurteilung
 Die Psychologie der Personenbeurteilung von Uwe Peter Kanning Hogrefe Verlag für Psychologie Göttingen Bern Toronto Seattle 1. Alltägliches unter die Lupe genommen ^ 1.1 Personen und soziale Situationen
Die Psychologie der Personenbeurteilung von Uwe Peter Kanning Hogrefe Verlag für Psychologie Göttingen Bern Toronto Seattle 1. Alltägliches unter die Lupe genommen ^ 1.1 Personen und soziale Situationen
FRAGEBOGEN ZUM KOMPETENZERWERB: ENDE EINES AUSLANDSAUFENTHALTES
 FRAGEBOGEN ZUM KOMPETENZERWERB: ENDE EINES AUSLANDSAUFENTHALTES Nachname: Vorname: Art des Auslandsaufenthaltes (Praktikum, Freiwilligendienst, ): Programm: Aufenthalt vom bis Name des Unternehmens oder
FRAGEBOGEN ZUM KOMPETENZERWERB: ENDE EINES AUSLANDSAUFENTHALTES Nachname: Vorname: Art des Auslandsaufenthaltes (Praktikum, Freiwilligendienst, ): Programm: Aufenthalt vom bis Name des Unternehmens oder
Stressbewältigung im Spitzensport: auf den Spuren der inneren Strategien
 Stressbewältigung im Spitzensport: auf den Spuren der inneren Strategien Dr Mattia Piffaretti Sportpsychologe FSP Schweizer Wakeboard und Wasserski Verband, Magglingen, 5. April 2014 www.actsport.ch /
Stressbewältigung im Spitzensport: auf den Spuren der inneren Strategien Dr Mattia Piffaretti Sportpsychologe FSP Schweizer Wakeboard und Wasserski Verband, Magglingen, 5. April 2014 www.actsport.ch /
8. Schweizerische Tagung für Systemische Beratung & Familientherapie
 8. Schweizerische Tagung für Systemische Beratung & Familientherapie 14. 15.9.2018 Programm Was ist Marte Meo? Theoretische Grundlagen Erkenntnisse aus der Forschung - Neurobiologie Grundannahmen Praktische
8. Schweizerische Tagung für Systemische Beratung & Familientherapie 14. 15.9.2018 Programm Was ist Marte Meo? Theoretische Grundlagen Erkenntnisse aus der Forschung - Neurobiologie Grundannahmen Praktische
Täuschende Wahrnehmung. In diesem Dokument finden Sie Antworten und weiterführende Informationen. Viel Spaß beim Lesen, das Entdecken geht weiter!
 Täuschende Wahrnehmung In diesem Dokument finden Sie Antworten und weiterführende Informationen. Viel Spaß beim Lesen, das Entdecken geht weiter! 2 Erster Teil des Parcours 23. Selbstbild und Wirklichkeit?
Täuschende Wahrnehmung In diesem Dokument finden Sie Antworten und weiterführende Informationen. Viel Spaß beim Lesen, das Entdecken geht weiter! 2 Erster Teil des Parcours 23. Selbstbild und Wirklichkeit?
Gedächtnismodell. nach Büchel F. (2010). DELV Das eigene Lernen verstehen, S. 15 ff.
 Gedächtnismodell nach Büchel F. (2010). DELV Das eigene Lernen verstehen, S. 15 ff. Warum können wir uns gewisse Sachen besser und andere weniger gut merken und warum können wir uns an vermeintlich Gelerntes
Gedächtnismodell nach Büchel F. (2010). DELV Das eigene Lernen verstehen, S. 15 ff. Warum können wir uns gewisse Sachen besser und andere weniger gut merken und warum können wir uns an vermeintlich Gelerntes
III.Dämme gegen die Informationsflut: Strategien zur Bewältigung schwieriger Sachverhalte 49
 Vorwort 11 I. Prognosen: Fundamentals,Technische Analyse und Behavioral Finance 15 II. Anatomie eines Engagements: Wunsch und Wirklichkeit 31 1. Zwischen Hoffnung und Angst: Ein Erlebnisbericht 32 2. Die
Vorwort 11 I. Prognosen: Fundamentals,Technische Analyse und Behavioral Finance 15 II. Anatomie eines Engagements: Wunsch und Wirklichkeit 31 1. Zwischen Hoffnung und Angst: Ein Erlebnisbericht 32 2. Die
Netzwerk Betriebe am 2. Juni 2014 Stress lass nach Umgang mit Stress?!
 Netzwerk Betriebe am 2. Juni 2014 Stress lass nach Umgang mit Stress?! Petra Nägele Diplom-Psychologin Merkmale moderner Arbeitswelten -Verdichtung der Arbeit 63% -Termin- und Leistungsdruck 52% -Multitasking
Netzwerk Betriebe am 2. Juni 2014 Stress lass nach Umgang mit Stress?! Petra Nägele Diplom-Psychologin Merkmale moderner Arbeitswelten -Verdichtung der Arbeit 63% -Termin- und Leistungsdruck 52% -Multitasking
Die Individualpsychologie. Alfred Adlers. Einführung. Die wichtigsten psychologischen Richtungen. Tiefenpsychologie. Gestalt-/Kognitive Psychologie
 Die Individualpsychologie Alfred Adlers Einführung Die wichtigsten psychologischen Richtungen Tiefenpsychologie Verhaltenspsychologie Gestalt-/Kognitive Psychologie Humanistische Psychologie Systemische
Die Individualpsychologie Alfred Adlers Einführung Die wichtigsten psychologischen Richtungen Tiefenpsychologie Verhaltenspsychologie Gestalt-/Kognitive Psychologie Humanistische Psychologie Systemische
Gruppenbericht. Test GmbH Mustergruppe
 Gruppenbericht Test GmbH Mustergruppe 11.04.2016 2015 SCHEELEN AG RELIEF Gruppenbericht 1 Alle reden über Stress - wie messen ihn! Gute Unternehmen brauchen gute Mitarbeiter die anderen verbrauchen gute
Gruppenbericht Test GmbH Mustergruppe 11.04.2016 2015 SCHEELEN AG RELIEF Gruppenbericht 1 Alle reden über Stress - wie messen ihn! Gute Unternehmen brauchen gute Mitarbeiter die anderen verbrauchen gute
ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DER MASTERTHESIS VON LISA GANSTER
 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DER MASTERTHESIS VON LISA GANSTER Werteorientierung im beruflichen Handeln - Wirkung der besonderen Kursstruktur des TEAM BENEDIKT im Hinblick auf die Entwicklung von Achtsamkeit
ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DER MASTERTHESIS VON LISA GANSTER Werteorientierung im beruflichen Handeln - Wirkung der besonderen Kursstruktur des TEAM BENEDIKT im Hinblick auf die Entwicklung von Achtsamkeit
Womit beschäftigt sich Resilienz?
 Resilienz RESILIENZ Womit beschäftigt sich Resilienz? Das Resilienzkonzept beschäftigt sich mit der Frage was Menschen hilft, schwierige Situationen erfolgreich zu bewältigen und einen positiven Entwicklungsverlauf
Resilienz RESILIENZ Womit beschäftigt sich Resilienz? Das Resilienzkonzept beschäftigt sich mit der Frage was Menschen hilft, schwierige Situationen erfolgreich zu bewältigen und einen positiven Entwicklungsverlauf
D.h.: Das Spielmodel ist eine Richtlinie bzw. ein Führungsbuch der ganzen Entwicklungsprozess. Dadurch kann die Rolle des Trainers definiert werden:
 Tatsuro Suzuki Was ist taktische Periodisierung? - Extra. S. 35. Die Theorie (= Spielmodel) ist nicht ein Erkenntnis sondern ein Wissen, dieses Erkenntnis zu ermöglichen. Die Theorie an sich ist nicht
Tatsuro Suzuki Was ist taktische Periodisierung? - Extra. S. 35. Die Theorie (= Spielmodel) ist nicht ein Erkenntnis sondern ein Wissen, dieses Erkenntnis zu ermöglichen. Die Theorie an sich ist nicht
Einheit 2. Wahrnehmung
 Einheit 2 Wahrnehmung Wahrnehmung bezeichnet in der Psychologie und Physiologie die Summe der Schritte Aufnahme, Interpretation, Auswahl und Organisation von sensorischen Informationen. Es sind demnach
Einheit 2 Wahrnehmung Wahrnehmung bezeichnet in der Psychologie und Physiologie die Summe der Schritte Aufnahme, Interpretation, Auswahl und Organisation von sensorischen Informationen. Es sind demnach
Gerhard Roth Fühlen, Denken, Handeln
 Gerhard Roth Fühlen, Denken, Handeln Wie das Gehirn unser Verhalten steuert Neue, vollständig überarbeitete Ausgabe Suhrkamp Inhalt Vorwort zur überarbeiteten Auflage n Vorwort 15 Einleitung 18 1. Moderne
Gerhard Roth Fühlen, Denken, Handeln Wie das Gehirn unser Verhalten steuert Neue, vollständig überarbeitete Ausgabe Suhrkamp Inhalt Vorwort zur überarbeiteten Auflage n Vorwort 15 Einleitung 18 1. Moderne
NLP-Metaprogramme: verstehen und trainieren. Vorwort. (Stephan Landsiedel)
 Vorwort (Stephan Landsiedel) Wir stehen heute am Anfang einer neuen Epoche des Verstehens. Durch die Verwendung von Meta-Programmen können sehr eindeutige Feststellungen darüber getroffen werden, wie Menschen
Vorwort (Stephan Landsiedel) Wir stehen heute am Anfang einer neuen Epoche des Verstehens. Durch die Verwendung von Meta-Programmen können sehr eindeutige Feststellungen darüber getroffen werden, wie Menschen
Einführung in die Drei Prinzipien
 Einführung in die Drei Prinzipien Teil 1: Ist Stress nur eine Illusion? Teil 2: Inspiration für eigene Einsichten copyright DreiPrinzipien.org Illustrationen Alessandra Sacchi & Katja Symons mail@dreiprinzipien.org
Einführung in die Drei Prinzipien Teil 1: Ist Stress nur eine Illusion? Teil 2: Inspiration für eigene Einsichten copyright DreiPrinzipien.org Illustrationen Alessandra Sacchi & Katja Symons mail@dreiprinzipien.org
Exekutive Funktionen und ihre Bedeutung für Lernbegleitung. Regula Franz & Barbara Wirz, schul- in, FHNW
 Exekutive Funktionen und ihre Bedeutung für Lernbegleitung Regula Franz & Barbara Wirz, schul- in, FHNW Überblick 1. Was sind exekutive Funktionen? 2. Bedeutung für Schulerfolg 3. Wie fördern? Umsetzung
Exekutive Funktionen und ihre Bedeutung für Lernbegleitung Regula Franz & Barbara Wirz, schul- in, FHNW Überblick 1. Was sind exekutive Funktionen? 2. Bedeutung für Schulerfolg 3. Wie fördern? Umsetzung
Psychologische Stress-Modelle für Bearbeitung des Stromausfalls
 Psychologische Stress-Modelle für Bearbeitung des Stromausfalls Lazarus und Hobfoll Richard Lazarus (1922-2002) Transaktionale Stressmodell Ereignis Wahrnehmung Nein Erste Einschätzung: Ja Ist das, was
Psychologische Stress-Modelle für Bearbeitung des Stromausfalls Lazarus und Hobfoll Richard Lazarus (1922-2002) Transaktionale Stressmodell Ereignis Wahrnehmung Nein Erste Einschätzung: Ja Ist das, was
Mitarbeiterbindung 10 Erfolgsfaktoren der Einstellung und Bindung der passenden Mitarbeiter
 Mitarbeiterbindung 10 Erfolgsfaktoren der Einstellung und Bindung der passenden Mitarbeiter Themenübersicht Darüber sollten wir sprechen... 1. Attraktives Unternehmensprofil 2. Erfolgreiche soziale Integration
Mitarbeiterbindung 10 Erfolgsfaktoren der Einstellung und Bindung der passenden Mitarbeiter Themenübersicht Darüber sollten wir sprechen... 1. Attraktives Unternehmensprofil 2. Erfolgreiche soziale Integration
MENSCHENRECHTSBEIRAT. Gewalt in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
 MENSCHENRECHTSBEIRAT DER VOLKSANWALTSCHAFT Leichte Sprache Gewalt in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung Informationen über den Text: Der Menschen rechts beirat hat diesen Bericht geschrieben. In
MENSCHENRECHTSBEIRAT DER VOLKSANWALTSCHAFT Leichte Sprache Gewalt in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung Informationen über den Text: Der Menschen rechts beirat hat diesen Bericht geschrieben. In
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse
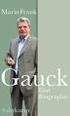 Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
Fragen zur Konfliktbearbeitung
 Fragen zur Konfliktbearbeitung 5. Was noch...? Was würde vielleicht sonst noch helfen können? An wen könntest Du Dich vielleicht auch noch wenden? 4. Einstellungen Welche Einstellung/Überzeugung könnte
Fragen zur Konfliktbearbeitung 5. Was noch...? Was würde vielleicht sonst noch helfen können? An wen könntest Du Dich vielleicht auch noch wenden? 4. Einstellungen Welche Einstellung/Überzeugung könnte
Folgende Aspekte charakterisieren das Stockholm-Syndrom:
 Stockholm-Syndrom Das Stockholm-Syndrom, das fälschlich auch als "Helsinki-Syndrom" bezeichnet wird, beschreibt einen Prozess, in dem die Geiseln eine positive emotionale Beziehung zu ihren Geiselnehmern
Stockholm-Syndrom Das Stockholm-Syndrom, das fälschlich auch als "Helsinki-Syndrom" bezeichnet wird, beschreibt einen Prozess, in dem die Geiseln eine positive emotionale Beziehung zu ihren Geiselnehmern
Dr. Adelheid Stieger-Lietz, MBA FÜHREN IN DER KRISE WORAUF ES WIRKLICH ANKOMMT
 Dr. Adelheid Stieger-Lietz, MBA FÜHREN IN DER KRISE WORAUF ES WIRKLICH ANKOMMT WAHRE FÜHRUNGSKOMPETENZ ZEIGT SICH IN KRISEN Wir leben in bewegten Zeiten. Krisen werden täglich durch die Massenmedien in
Dr. Adelheid Stieger-Lietz, MBA FÜHREN IN DER KRISE WORAUF ES WIRKLICH ANKOMMT WAHRE FÜHRUNGSKOMPETENZ ZEIGT SICH IN KRISEN Wir leben in bewegten Zeiten. Krisen werden täglich durch die Massenmedien in
Hacking Yourself Teil 1. Ein Neuro-Crashkurs
 Hacking Yourself Teil 1 Ein Neuro-Crashkurs Warum? große Probleme mit Aggression Schmerzsymptomatiken Beschäftigung mit Psychologie oft eine sehr softe Wissenschaft Überblick grober Crashkurs in Neurophysiologie
Hacking Yourself Teil 1 Ein Neuro-Crashkurs Warum? große Probleme mit Aggression Schmerzsymptomatiken Beschäftigung mit Psychologie oft eine sehr softe Wissenschaft Überblick grober Crashkurs in Neurophysiologie
Ich bin stark, wenn. Resilienz. Stefanie Schopp
 Ich bin stark, wenn Resilienz Stefanie Schopp Entscheidungsforschung? Als der Psychologe Antonio Damasioseinen Als der Psychologe Antonio Damasioseinen Patienten nach einer Gehirnoperation untersuchte,
Ich bin stark, wenn Resilienz Stefanie Schopp Entscheidungsforschung? Als der Psychologe Antonio Damasioseinen Als der Psychologe Antonio Damasioseinen Patienten nach einer Gehirnoperation untersuchte,
Update. Lehrende und Lernende bewegen. Eine Definition von Motivation
 Update Lehrende und Lernende bewegen Lehren macht Spaß, aber auch viel Arbeit. Motivation beinhaltet die Energie, die Lehrende und Lernende in Bewegung setzt, ihnen Kraft für die täglichen Herausforderungen
Update Lehrende und Lernende bewegen Lehren macht Spaß, aber auch viel Arbeit. Motivation beinhaltet die Energie, die Lehrende und Lernende in Bewegung setzt, ihnen Kraft für die täglichen Herausforderungen
Auswirkungen der traumatischen Erfahrung auf Gedanken, Gefühle und Verhalten
 Auswirkungen der traumatischen Erfahrung auf Gedanken, Gefühle und Verhalten Beziehungen Werte Vorstellung von Sicherheit Vertrauen Selbstwertgefühl Selbstwertvertrauen/-wirksamkeitserwartung Zentrale
Auswirkungen der traumatischen Erfahrung auf Gedanken, Gefühle und Verhalten Beziehungen Werte Vorstellung von Sicherheit Vertrauen Selbstwertgefühl Selbstwertvertrauen/-wirksamkeitserwartung Zentrale
Dürfen Fehler in der Jugendhilfe vorkommen Betrachtung aus der Sicht eines systemischen Risikomanagement
 Dürfen Fehler in der Jugendhilfe vorkommen Betrachtung aus der Sicht eines systemischen Risikomanagement Workshop der Arbeitsgruppe Meldepflichten am 9.12.2013 in Hünfeld Christine Gerber, Nationales Zentrum
Dürfen Fehler in der Jugendhilfe vorkommen Betrachtung aus der Sicht eines systemischen Risikomanagement Workshop der Arbeitsgruppe Meldepflichten am 9.12.2013 in Hünfeld Christine Gerber, Nationales Zentrum
Mehrweg statt Einweg. Gedanken-Flexibilität in Gesprächen und Verhandlungen
 Mehrweg statt Einweg Gedanken-Flexibilität in Gesprächen und Verhandlungen Auszug des Vortrags, gehalten beim BME Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik am 20. November 2012 1 von 14 Mehrweg
Mehrweg statt Einweg Gedanken-Flexibilität in Gesprächen und Verhandlungen Auszug des Vortrags, gehalten beim BME Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik am 20. November 2012 1 von 14 Mehrweg
1. Erzählen als Basisform der Verständigung
 1. Erzählen als Basisform der Verständigung Erzählen ist eine Grundform sprachlicher Darstellung, die in verschiedenen Formen und Kontexten und mit unterschiedlichen Zielen stattfindet. Erzählungen sind
1. Erzählen als Basisform der Verständigung Erzählen ist eine Grundform sprachlicher Darstellung, die in verschiedenen Formen und Kontexten und mit unterschiedlichen Zielen stattfindet. Erzählungen sind
Pflege und Betreuung: Theorien und Modelle. Irma M. Hinghofer-Szalkay
 Pflege und Betreuung: Theorien und Modelle Irma M. Hinghofer-Szalkay 2009 Das Wellness-Pflegemodell (WPM) Wellness-Gedanke: Halbert L. Dunn, USA 1959 Wellness: A state of wellbeing in which an individual
Pflege und Betreuung: Theorien und Modelle Irma M. Hinghofer-Szalkay 2009 Das Wellness-Pflegemodell (WPM) Wellness-Gedanke: Halbert L. Dunn, USA 1959 Wellness: A state of wellbeing in which an individual
27. ALZEYER SYMPOSIUM 08. November Julia Riedel und Daniela Eckhardt
 27. ALZEYER SYMPOSIUM 08. November 2017 Julia Riedel und Daniela Eckhardt Angenommen, Sie haben eine Autopanne, Ihr Auto steckt fest. Dazu ist es dunkel, es regnet, Sie frieren und sind allein. Was tun
27. ALZEYER SYMPOSIUM 08. November 2017 Julia Riedel und Daniela Eckhardt Angenommen, Sie haben eine Autopanne, Ihr Auto steckt fest. Dazu ist es dunkel, es regnet, Sie frieren und sind allein. Was tun
Gewaltfreie Kommunikation und Kinderrechte. - Ein Gruß aus der Küche
 Gewaltfreie Kommunikation und Kinderrechte - Ein Gruß aus der Küche Jenseits von richtig und falsch Gibt es einen Ort. Dort treffen wir uns. Rumi Dr. M. Rosenberg entwickelte in den 70er Jahren das Modell
Gewaltfreie Kommunikation und Kinderrechte - Ein Gruß aus der Küche Jenseits von richtig und falsch Gibt es einen Ort. Dort treffen wir uns. Rumi Dr. M. Rosenberg entwickelte in den 70er Jahren das Modell
Digitale Demokratie: Chancen und Herausforderungen von sozialen Netzwerken. Bachelorarbeit
 Digitale Demokratie: Chancen und Herausforderungen von sozialen Netzwerken Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen
Digitale Demokratie: Chancen und Herausforderungen von sozialen Netzwerken Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen
Inhaltsverzeichnis. Teil I Führungskräfte und Schachmeister
 Inhaltsverzeichnis Teil I Führungskräfte und Schachmeister 1 Strategische Herausforderungen für Führungskräfte................... 3 1.1 Dynamische Komplexität...................................... 4 1.1.1
Inhaltsverzeichnis Teil I Führungskräfte und Schachmeister 1 Strategische Herausforderungen für Führungskräfte................... 3 1.1 Dynamische Komplexität...................................... 4 1.1.1
Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann
 Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS
Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS
Schritt 6: Entscheidung
 : Entscheidung Die nachfolgenden Unterlagen wurden im Projekt Auswahl und Beurteilung von Führungskräften in Wissenschaft und Wirtschaft - wie unterscheiden sich Männer und Frauen? (Teilprojekt Wissenschaft;
: Entscheidung Die nachfolgenden Unterlagen wurden im Projekt Auswahl und Beurteilung von Führungskräften in Wissenschaft und Wirtschaft - wie unterscheiden sich Männer und Frauen? (Teilprojekt Wissenschaft;
Klaus, wie Sie im Vergleich zum Durchschnitt sind
 Kapitel 2 Dieses Kapitel ist ein Auszug aus den 9 Kapiteln Ihres 100-seitigen Persönlichkeits-Gutachtens Klaus, wie Sie im Vergleich zum Durchschnitt sind Einen Vergleich Ihrer Persönlichkeit mit dem Durchschnitt
Kapitel 2 Dieses Kapitel ist ein Auszug aus den 9 Kapiteln Ihres 100-seitigen Persönlichkeits-Gutachtens Klaus, wie Sie im Vergleich zum Durchschnitt sind Einen Vergleich Ihrer Persönlichkeit mit dem Durchschnitt
Mit Hilfe des Tools wird individuell erfasst,
 Stressprävention Jeder Mensch erlebt seine Umwelt aus seiner ganz eigenen Perspektive. Das gilt auch für das Stresserleben. Verschiedene Situationen haben unterschiedliche Auswirkungen auf jedes Individuum.
Stressprävention Jeder Mensch erlebt seine Umwelt aus seiner ganz eigenen Perspektive. Das gilt auch für das Stresserleben. Verschiedene Situationen haben unterschiedliche Auswirkungen auf jedes Individuum.
Schullehrplan Sozialwissenschaften BM 1
 Schullehrplan Sozialwissenschaften BM 1 1. Semester Wahrnehmung Emotion und Motivation Lernen und Gedächtnis Kommunikation - den Begriff der Wahrnehmung und ihre verschiedenen Dimensionen erklären (Sinneswahrnehmung,
Schullehrplan Sozialwissenschaften BM 1 1. Semester Wahrnehmung Emotion und Motivation Lernen und Gedächtnis Kommunikation - den Begriff der Wahrnehmung und ihre verschiedenen Dimensionen erklären (Sinneswahrnehmung,
Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten
 Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit
Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit
Zu Gustave Le Bons: "Psychologie der Massen"
 Geisteswissenschaft Karin Ulrich Zu Gustave Le Bons: "Psychologie der Massen" Die Massenseele - Über Massenbildung und ihre wichtigsten Dispositionen Essay Technische Universität Darmstadt Institut für
Geisteswissenschaft Karin Ulrich Zu Gustave Le Bons: "Psychologie der Massen" Die Massenseele - Über Massenbildung und ihre wichtigsten Dispositionen Essay Technische Universität Darmstadt Institut für
UMGANG MIT KRISEN & NEGATIVER KRITIK
 UMGANG MIT KRISEN & NEGATIVER KRITIK SEMINARREIHE RESILIENZ Krise? Einblicke in die Psychologie Umgang mit negativer Berichterstattung - psychologische Komponente Krisen sind Stress Öffentliche Kritik
UMGANG MIT KRISEN & NEGATIVER KRITIK SEMINARREIHE RESILIENZ Krise? Einblicke in die Psychologie Umgang mit negativer Berichterstattung - psychologische Komponente Krisen sind Stress Öffentliche Kritik
Wenn der Druck steigt. Körperliche und seelische Auswirkungen des Leistungsdrucks in der Schule auf Kinder und Jugendliche
 Körperliche und seelische Auswirkungen des Leistungsdrucks in der Schule auf Kinder und Jugendliche Körperliche und seelische Auswirkungen des Leistungsdrucks in der Schule auf Kinder und Jugendliche Agenda
Körperliche und seelische Auswirkungen des Leistungsdrucks in der Schule auf Kinder und Jugendliche Körperliche und seelische Auswirkungen des Leistungsdrucks in der Schule auf Kinder und Jugendliche Agenda
PSYCHOLOGIE DES SICHEREN FALLSCHIRMSPRUNGS. INSITA, , Schweinfurt Dr. Bettina Schleidt, Human-Factors-Consult.com
 PSYCHOLOGIE DES SICHEREN FALLSCHIRMSPRUNGS INSITA, 12.11.2016, Schweinfurt Dr. Bettina Schleidt, Human-Factors-Consult.com Zur Person Studium der Psychologie an der TU Darmstadt Promotion an der TU Kaiserslautern
PSYCHOLOGIE DES SICHEREN FALLSCHIRMSPRUNGS INSITA, 12.11.2016, Schweinfurt Dr. Bettina Schleidt, Human-Factors-Consult.com Zur Person Studium der Psychologie an der TU Darmstadt Promotion an der TU Kaiserslautern
Persönlichkeitsentwicklung mit dem Kernquadranten
 Persönlichkeitsentwicklung mit dem Kernquadranten Gute Führungskräfte sind authentisch und integer In der Literatur herrscht Einigkeit darüber, daß die Persönlichkeit der Führungskraft eine entscheidende
Persönlichkeitsentwicklung mit dem Kernquadranten Gute Führungskräfte sind authentisch und integer In der Literatur herrscht Einigkeit darüber, daß die Persönlichkeit der Führungskraft eine entscheidende
Personalauswahl zwischen Anspruch und Wirklichkeit
 Carolina Kleebaur Personalauswahl zwischen Anspruch und Wirklichkeit Wissenschaftliche Personaldiagnostik vs. erfahrungsbasiert-intuitive Urteilsfindung Rainer Hampp Verlag 2007 INHALTSVERZEICHNIS Abbildungsverzeichnis
Carolina Kleebaur Personalauswahl zwischen Anspruch und Wirklichkeit Wissenschaftliche Personaldiagnostik vs. erfahrungsbasiert-intuitive Urteilsfindung Rainer Hampp Verlag 2007 INHALTSVERZEICHNIS Abbildungsverzeichnis
Ringvorlesung Kinder stark machen! Ressourcen, Resilienz, Respekt. 28. Januar Defizite, Ressourcen, Resilienz Bedeutungen, Funktionen und Status
 Ringvorlesung Kinder stark machen! Ressourcen, Resilienz, Respekt. 28. Januar 2014 Defizite, Ressourcen, Resilienz Bedeutungen, Funktionen und Status Ressourcenorientierung ein Begriff/Schlüsselbegriff?
Ringvorlesung Kinder stark machen! Ressourcen, Resilienz, Respekt. 28. Januar 2014 Defizite, Ressourcen, Resilienz Bedeutungen, Funktionen und Status Ressourcenorientierung ein Begriff/Schlüsselbegriff?
MODUL 1 KRITISCHES DENKEN -KURZE ZUSAMMENFASSUNG-
 MODUL 1 KRITISCHES DENKEN -KURZE ZUSAMMENFASSUNG- I. WAS BEDEUTET KRITISCHES DENKEN? DIE KOMPETENZ. Kritisches Denken ist eine metakognitive Kompetenz. Es handelt sich dabei um eine übergeordnete kognitive
MODUL 1 KRITISCHES DENKEN -KURZE ZUSAMMENFASSUNG- I. WAS BEDEUTET KRITISCHES DENKEN? DIE KOMPETENZ. Kritisches Denken ist eine metakognitive Kompetenz. Es handelt sich dabei um eine übergeordnete kognitive
Begriffsbestimmungen in der Notfallpsychologie körperliche und psychische Folgen von Extremereignissen
 Zielgruppe: Die Ausbildung richtet sich an Mitarbeitende und Führungskräfte von Einrichtungen und Behörden, die intern nach kritischen Ereignissen zum Ort des Geschehens gerufen werden. Dort leisten sie
Zielgruppe: Die Ausbildung richtet sich an Mitarbeitende und Führungskräfte von Einrichtungen und Behörden, die intern nach kritischen Ereignissen zum Ort des Geschehens gerufen werden. Dort leisten sie
Warum sie so seltsam sind
 Warum sie so seltsam sind Vom Umgang mit Jugendlichen in der Pubertät Gedanken und Geschichten über den Bau von neuronalen Netzen (=Lernen), über die Konstruktion von Wirklichkeit, über den Nutzen der
Warum sie so seltsam sind Vom Umgang mit Jugendlichen in der Pubertät Gedanken und Geschichten über den Bau von neuronalen Netzen (=Lernen), über die Konstruktion von Wirklichkeit, über den Nutzen der
Notieren Sie spontan 10 Begriffe, die Ihnen zum Wort Stress einfallen.
 Was ist Stress? Notieren Sie spontan 10 Begriffe, die Ihnen zum Wort Stress einfallen. Wieviel Stressbelastung hatten Sie im letzten Monat? Wieviel wissen Sie über Stress und wie Sie dieser Belastung begegnen?
Was ist Stress? Notieren Sie spontan 10 Begriffe, die Ihnen zum Wort Stress einfallen. Wieviel Stressbelastung hatten Sie im letzten Monat? Wieviel wissen Sie über Stress und wie Sie dieser Belastung begegnen?
Pädagogische Psychologie
 Prof. Dr. Thomas Bienengräber Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Wirtschaftsdidaktik 1 Ziele der Veranstaltung Kennen verschiedener Bereiche des Menschen, die besondere Bedeutung im Kontext von Lehren
Prof. Dr. Thomas Bienengräber Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Wirtschaftsdidaktik 1 Ziele der Veranstaltung Kennen verschiedener Bereiche des Menschen, die besondere Bedeutung im Kontext von Lehren
alle SpreCHen von StreSS relief MaCHt ihn MeSSBar! WaS ist relief?
 Stressprävention Sie haben das Gefühl, dass einzelne Mitarbeiter nicht so richtig zufrieden sind am Arbeitsplatz? Dass ihre Leistungsfähigkeit eingeschränkt erscheint, dass sie überlastet wirken oder sogar
Stressprävention Sie haben das Gefühl, dass einzelne Mitarbeiter nicht so richtig zufrieden sind am Arbeitsplatz? Dass ihre Leistungsfähigkeit eingeschränkt erscheint, dass sie überlastet wirken oder sogar
