Eine Aufgabe aus der vierten Klasse (Prediger 2010):
|
|
|
- Victor Egger
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Dieser Text wurde heruntergeladen von der Website fachrechnen.ch. Verweise mit fachrechnen: beziehen sich auf weitere Texte, die dort gefunden werden können. Hansruedi Kaiser Fachrechnen vom Kopf auf die Füsse gestellt Mathematische Konzepte Der folgende Text ist ein Versuch. Aus der Fachliteratur ist zwar bekannt, dass die hier angegangenen Probleme existieren. Was ich hier dazu geschrieben habe, ist aber am Schreibtisch entstanden und noch nicht erprobt. Es ist daher noch unklar, ob die hier gewählte Darstellung für Berufsschullehrpersonen verständlich und nützlich ist. Für Rückmeldungen bin ich dankbar! Eine Aufgabe aus der vierten Klasse (Prediger 2010): Lisa rechnet 24 x 7 so: 24 x 7 = 20 x x 7 = = 168. i) Hat sie das richtig gemacht? Wie würdest Du das machen? ii) Berechne 54 x 6 so wie es Lisa gemacht hat. Emily (10 Jahre alt) protestiert: Lisa rechnet nicht richtig; 24 mal 7 ist nicht 20! Und was ist denn das nach der 20? Sie macht dann mit der Aufgabe nicht mehr weiter. Und dies, obwohl sie selbst normalerweise auch wie Lisa vorgeht und 24 x 7 in 20 x 7 und 4 x 7 zerlegt. Emilys Problem ist offenbar nicht, dass sie nicht rechnen kann. Ihr Problem ist, dass sie nicht versteht, wie hier das eingesetzt wird. Das ist kein Wunder, denn es gibt mindestens sechs verschiedene Arten, das zu verwenden (Prediger 2010). 1 Operation und Relation Emily ist sich an Aufgaben der Art 24 : 6-3 = gewohnt. Dort ist das eine Aufforderung, etwas zu tun: Schreibe dahinter die Antwort! Diese Antwort ist immer eine Zahl, in diesem Fall 1. Entspre- mehr dazu Online:
2 chend interpretiert sie auch in 24 x 7 = 20 das als Operation: Lisa hat 24 x 7 gerechnet und hinter dem 20 als Resultat notiert. In der Aufgabe ist aber mit 24 x 7 = 20 x x 7 eine Relation gemeint: Auf beiden Seiten des s steht (in einem gewissen Sinn) dasselbe (Prediger 2010). Diese Bedeutung des s ist für Emily, wenn nicht gerade ganz neu, so doch zumindest unvertraut. Entsprechend verwirrt reagiert sie. Genau gleich geht es Lernenden, die beispielsweise zum ersten Mal die Formel U = R x I sehen. In welchem Sinn kann R x I das Resultat von U sein? Überhaupt, wie kann U ein Resultat haben? Die Lernenden haben typischerweise in ihrer Schullaufbahn zuerst das als Operations-Zeichen angetroffen und die meisten haben noch vergleichsweise wenig Erfahrungen mit dem als Relations-Zeichen. Daher ist zu erwarten, dass sich die Interpretation als Operation immer wieder in den Vordergrund drängt. Entsprechend wichtig ist es, im Unterricht bewusst und explizit auf diesen Unterschied hinzuweisen. Etwas vorbeugen kann man, indem man das nie in Kettenrechnungen der folgenden Art einsetzt: 24 : 6 = 4-3 = 1!! Hier kann das nur als Operation verstanden werden ( Ich rechne 24 : 6 und erhalte 4; dann rechne ich weiter 4-3 und erhalte 1 ). Im Gegensatz dazu können in 24 : 6-3 = 1 beide Bedeutungen ohne Widerspruch nebeneinander bestehen ( Ich rechne 24 : 6-3 und erhalte 1 und 24 : 6-3 und 1 sind gleich ). 2 Formale und kontextgebundene Die Art der Relation, welche in oder auch in 24 x 7 = 20 x x 7 5 x 7 = 7 x 5 zum Ausdruck kommt, bezeichnet eine arithmetische und bedeutet im Wesentlichen: Man kann das so oder so rechnen; das Resultat ist dasselbe. Aber auch für Lernende, welche mit dieser Unterscheidung zwischen Operation und Relation zurechtkommen, sind noch lange nicht alle Ursachen für Verwirrungen und Missverständnisse ausgeräumt (Prediger 2010). In den beiden folgenden Formeln steht das zwar in beiden Fällen für die der beiden Seiten. Es ist aber nicht dieselbe Art von : (a-b)(a+b)=a²-b² fachrechnen.ch
3 a²+b²=c² Die erste gilt immer und unter allen Umständen. Die Formal drückt aus, dass die beiden Seiten der Gleichung formal gleich sind, dass die eine immer für die andere einstehen kann. Egal welche Zahlen man für a und b einsetzt, man wird auf beiden Seiten der Gleichung dasselbe Resultat erhalten. bedeutet hier also: Man kann das auf die eine wie die andere Art berechnen; es spielt keine Rolle, welche Variante man wählt ganz ähnlich wie im konkreten Fall von 5 x 7 = 7 x 5. Ganz im Gegensatz dazu die zweite der beiden Gleichungen. Hier gilt keinesfalls, dass man beliebige Zahlen für a, b und c einsetzen kann. Etwa ist nicht gleich 4 2. Die gilt nur in einem bestimmten Kontext, bei einer bestimmten Interpretation. Hier gilt sie, wenn man für a, b und c die Seitenlängen eines rechtwinkligen Dreiecks einsetzt, wo bei c die Länge der Seite gegenüber dem rechten Winkel (der Hypotenuse) sein muss. Nur wenn diese Bedingungen erfüllt sind, kann man diese kontextgebundene genauso nutzen, wie die formale oben: Egal welche Seite der Gleichung man berechnet, man kennt damit auch das Resultat, welches die Berechnung der anderen Seite ergeben würde. Die Lernenden treffen im Zusammenhang von für ihren jeweiligen Beruf wichtigen Formeln (wie etwa U = R x I) vor allem kontextgebundene an. Es ist auch wichtig, dass sie diese Gleichungen so verstehen, dass ihnen bewusst ist, dass diese eine mathematische Beschreibung eines realen Zusammenhangs sind. Das dürfte den Lernenden nicht so ohne weiteres klar sein, denn in ihrem bisherigen Mathematikunterricht haben sie sich mehrheitlich mit formaler beschäftigt, haben erkundet, welche Zusammenhänge zwischen Zahlen bestehen, unabhängig davon wofür diese Zahlen stehen (für ein Beispiel s. Abschnitt 7 unten). Entsprechend ist es wichtig, explizit zum Thema zu machen, dass eine solche kontextgebundene ein Modell für einen real gegeben Zusammenhang ist, den zuerst irgendjemand einmal entdecken musste. 3 Bedingungen für eine Unbekannte Die oben beschriebene kontextgebundene könnte man als allgemeine kontextgebundene bezeichnen. U = R x I steht dafür, dass in jedem Stromkreis dieser Zusammenhang zwischen Spannung (U), Widerstand (R) und Stromstärke (I) besteht. Es gibt unendlich viele Tripel <U,R,I>, unter denen man wählen kann, um die Gleichung zu erfüllen. Sind hingegen beispielsweise U und R bekannt, dann kann man I nicht mehr beliebig wählen. Beispielsweise ist mit 220 V = 100 Ω x I für I nur noch ein Wert möglich, nämlich 2.2 Ampere. Man könnte in diesem Fall von einer spezifischen kontextgebundenen sprechen. Der Kontext ist so klar gegeben, dass es für eine bestimmte Grösse, an der man interessiert ist, die man aber nicht direkt kennt, nur noch eine (oder manchmal einige wenige) Möglichkeiten gibt. In diesem Fall beschreibt die Gleichung nicht einen allgemeinen Zusammenhang (Stromkreise im Allgemeinen) sondern einen spezifischen (einen ganz bestimmten Stromkreis). fachrechnen.ch
4 Haben die Lernenden die verstanden, die in Formeln wie U = R x I zum Ausdruck kommt, dann sollten sie mit dieser spezifischen Varianten davon keine Mühe haben. Ausserhalb der Berufsbildung können Gleichungen dieser Art auch ohne Bezug auf einen bestimmten Kontext vorkommen. Die Gleichung x² = 6 - x definiert Rahmenbedingungen, welche die Unbekannte x erfüllen muss (Prediger 2010), auch ohne dass man x eine inhaltliche Interpretation gibt. In diesem Fall gibt es zwei mögliche Wert für x, welche diese Gleichung erfüllen: 2 und Definitionen Und nicht zuletzt tritt das auch in Definitionen auf (Prediger 2010). Die Steigung einer Strasse beispielsweise ist definiert als das Verhältnis des Höhenunterschieds zur Horizontaldistanz; oder in Form einer Gleichung m = y/x Diese Gleichung bezieht sich zwar auf einen bestimmten Kontext. Die einzelnen Grössen haben eine bestimmte Interpretation und die gilt nur in diesem Zusammenhang, so wie das auch bei der kontextgebundenen (s.o.) der Fall ist. Nur wird hier nicht ein Zusammenhang zwischen drei unabhängig messbaren Grössen mathematisch beschrieben, sondern die dritte Grösse, die Steigung, wird mittels der beiden anderen definiert. Die ist in diesem Fall also willkürlich. Man hätte auch etwas anderes festlegen können (beispielsweise m = y 3 /x 2 ), aber man hat sich nun einmal für diese Variante entschieden. Es geht hier also nicht um eine Gesetzmässigkeit, sondern um eine willkürlich Festlegung, welche aus bestimmten praktischen Erwägungen heraus getroffen wurde. Bei Lernenden, für die Mathematik aus unumstösslichen Wahrheiten aufgebaut ist ( 2+2 ist nun einmal 4 ), kann dieses Element der Willkürlichkeit verwirrend sein und muss thematisiert werden. Ein guter Anknüpfungspunkt ist die Frage, warum wohl genau diese Definition gewählt wurde. Ein Gefühl dafür können die Lernenden gewinnen, wenn sie Gelegenheit erhalten, spielerisch alternativen Definitionen zu erkunden. Solche willkürlichen Definitionen sind häufiger, als man denkt. Beispielsweise sind die ganzen trigonometrischen Funktionen wie Sinus (=Gegenkathete/Hypotenuse), Cosinus (=Ankathete/Hypotenuse) und Tangens (=Gegenkathete/Ankathete) Grössen, die sich zwar als nützlich erwiesen haben, die man aber auch anders hätte definieren können. fachrechnen.ch
5 5 Die verschiedenen Bedeutungen kurz zusammengefasst Alles in allem müssen also mindestens die folgenden Bedeutungen unterschieden werden (Prediger 2010). Gelingt das den Lernenden nicht, sind Verwirrungen und Missverständnisse unvermeidlich. 1. Operation Hier kommt die Antwort : 24 : 6-3 = 1 2. Relation Man kann das so oder so rechnen (symmetrische arithmetische ): 5 x 7 = 7 x 5 Für beliebige Zahlen erhält man auf beiden Seiten dasselbe Resultat (formale ): (a-b)(a+b)=a²-b² Zwischen bestimmten Grössen/Messwerten gilt ( ): Rechtwinkliges Dreieck, c Hypotenuse, a²+b²=c² In diesem konkreten Fall gilt zwischen bestimmten Grössen/Messwerten (spezifische kontextgebundene ): Ein bestimmter Stromkreis, U Spannung, R Widerstand, I Stromstärke, 220 V = 100 Ω x I Die gesuchte Grösse muss folgende Bedingungen erfüllen (Bedingungen für eine Unbekannte): gesucht x; es gilt x²=6-x 3. Definition Eine bestimmte Grösse ist wie folgt definiert : m = y/x (m: Steigung; y: Höhendifferenz; x: horizontale Distanz) fachrechnen.ch
6 6 Anhang: Wechselnde Bedeutungen - Ein Beispiel Prediger untersucht in ihrem Artikel (2010), wie im Verlauf der Bearbeitung einer Aufgabe das ständig die Bedeutung wechselt. Die Aufgabe ist eine klassische Aufgabe, wie sie im Mathematikunterricht am Gymnasium kurz vor der Matura vorkommt. Zeige, dass von allen Rechtecken mit demselben Umfang das Quadrat (also das Rechteck mit vier gleich langen Seiten) die grösste Fläche hat. b=q-x a=q+x q (1) In einem Quadrat mit der Seitenlänge q ist U = 4q (U: Umfang) (2) In jedem Rechteck mit diesem Umfang gilt für die beiden Seiten a und b: a=q+x und b=q-x (3) Die Fläche F dieser Rechtecke ist jeweils F=(q+x)(q-x) (4) F = q 2 -x 2 formale (5) Sei F(x) die Funktion F(x)= q 2 -x 2 Definition (6) Erste Ableitung F (x) = -2x Operation (7) Zweite Ableitung F (x) = -2 Operation (8) Für jedes lokale Maximum ist F (x e )=0 und F (x e )<0 (9) Sei F (x e ) = -2x e = 0 Bedingungen für eine Unbekannte (10) mögliches Maximum x e = 0 Operation (11) F (0) = -2 Operation (12) Also hat F(x) tatsächlich bei x e =0 ein Maximum, d.h. das Quadrat hat die grösste Fläche von allen Rechtecken mit dem gleichen Umfang q fachrechnen.ch
7 7 Anhang: Untersuchen formaler - ein Beispiel Die folgende Aufgabe stammt aus dem Buch von Hirt & Wälti (2008, S. 86ff) und ist für die dritte bis sechste Klasse gedacht: Startzahl: 1 Pluszahl: 2 Zielzahl: = 25 i) Wähle die Startzahl und die Pluszahl so, dass die Zielzahl möglichst nahe an 50 herankommt. ii) Finde möglichst viele Beispiele mit der Zielzahl 50. Vergleiche die Beispiele und beschreibe deine Feststellungen. Beim Bearbeiten dieser Aufgabe kann man beispielsweise folgendes herausfinden: Ist a die Startzahl und b die Pluszahl, dann lässt sich die Berechnung der Zielzahl beschreiben als Das ist formal gleich mit a + (a+b) + (a+b+b) + (a+b+b+b) + (a+b+b+b+b) = Zielzahl 5a + 10b = Zielzahl 5 (a+2b) = Zielzahl Und daraus kann man beispielsweise ablesen, dass die Zielzahl immer durch 5 teilbar ist, gleichgültig wie man a und b wählt. 8 Literatur Hirt, U., & Wälti, B. (2008). Lernumgebungen im Mathematikunterricht. Natürliche Differenzierung für Rechenschwache bis Hochbegabte. Seelze-Velber: Kallmeyer. Prediger, S. (2010). How to Develop Mathematics for Teaching and for Understanding. The Case of Meanings of the Equal Sign Journal for Mathematics Teacher Education, 13(1), fachrechnen.ch
1 Drei Verwendungen des Minuszeichens. Es lassen sich mindestens die drei folgenden Verwendungen des Minuszeichens unterscheiden
 Dieser Text wurde heruntergeladen von der Website fachrechnen.ch. Verweise mit fachrechnen: beziehen sich auf weitere Texte, die dort gefunden werden können. Hansruedi Kaiser Fachrechnen vom Kopf auf die
Dieser Text wurde heruntergeladen von der Website fachrechnen.ch. Verweise mit fachrechnen: beziehen sich auf weitere Texte, die dort gefunden werden können. Hansruedi Kaiser Fachrechnen vom Kopf auf die
Übungen zu gewöhnlichen Differentialgleichungen Lösungen zu Übung 23
 Übungen zu gewöhnlichen Differentialgleichungen Lösungen zu Übung 3 3.1 Gegeben sei die Anfangswertaufgabe (AWA) Zeigen Sie, dass die Funktion y (x) = x y(x) mit y(0) = 1 die einzige Lösung dieser AWA
Übungen zu gewöhnlichen Differentialgleichungen Lösungen zu Übung 3 3.1 Gegeben sei die Anfangswertaufgabe (AWA) Zeigen Sie, dass die Funktion y (x) = x y(x) mit y(0) = 1 die einzige Lösung dieser AWA
1 Mengen und Aussagen
 $Id: mengen.tex,v 1.2 2010/10/25 13:57:01 hk Exp hk $ 1 Mengen und Aussagen Der wichtigste Grundbegriff der Mathematik ist der Begriff einer Menge, und wir wollen damit beginnen die klassische, 1878 von
$Id: mengen.tex,v 1.2 2010/10/25 13:57:01 hk Exp hk $ 1 Mengen und Aussagen Der wichtigste Grundbegriff der Mathematik ist der Begriff einer Menge, und wir wollen damit beginnen die klassische, 1878 von
Beispiellösungen zu Blatt 77
 µathematischer κorrespondenz- zirkel Mathematisches Institut Georg-August-Universität Göttingen Aufgabe 1 Beispiellösungen zu Blatt 77 Die Zahl 9 ist sowohl als Summe der drei aufeinanderfolgenden Quadratzahlen,
µathematischer κorrespondenz- zirkel Mathematisches Institut Georg-August-Universität Göttingen Aufgabe 1 Beispiellösungen zu Blatt 77 Die Zahl 9 ist sowohl als Summe der drei aufeinanderfolgenden Quadratzahlen,
Mathematik: Mag. Schmid Wolfgang Arbeitsblatt Semester ARBEITSBLATT 11 GLEICHUNGEN UND ÄQUIVALENZUMFORMUNGEN
 ARBEITSBLATT 11 GLEICHUNGEN UND ÄQUIVALENZUMFORMUNGEN Mathematische Gleichungen ergeben sich normalerweise aus einem textlichen Problem heraus. Hier folgt nun ein zugegebenermaßen etwas künstliches Problem:
ARBEITSBLATT 11 GLEICHUNGEN UND ÄQUIVALENZUMFORMUNGEN Mathematische Gleichungen ergeben sich normalerweise aus einem textlichen Problem heraus. Hier folgt nun ein zugegebenermaßen etwas künstliches Problem:
f(x nk ) = lim y nk ) = lim Bemerkung 2.14 Der Satz stimmt nicht mehr, wenn D nicht abgeschlossen oder nicht beschränkt ist, wie man z.b.
 Proposition.13 Sei f : D R stetig und D = [a, b] R. Dann ist f(d) beschränkt. Außerdem nimmt f sein Maximum und Minimum auf D an, d.h. es gibt x max D und ein x min D, so dass f(x max ) = sup f(d) und
Proposition.13 Sei f : D R stetig und D = [a, b] R. Dann ist f(d) beschränkt. Außerdem nimmt f sein Maximum und Minimum auf D an, d.h. es gibt x max D und ein x min D, so dass f(x max ) = sup f(d) und
Einige Gedanken zur Fibonacci Folge
 Einige Gedanken zur Fibonacci Folge Im Folgenden gehe ich auf einige Aspekte von Aufgabe 4 auf Übungsblatt, d.h. auf Aufgabe 4 auf Seiten und 3 des Buches Hahn-Dzewas: Mathematik, ein. Die Aufgabe hat
Einige Gedanken zur Fibonacci Folge Im Folgenden gehe ich auf einige Aspekte von Aufgabe 4 auf Übungsblatt, d.h. auf Aufgabe 4 auf Seiten und 3 des Buches Hahn-Dzewas: Mathematik, ein. Die Aufgabe hat
Aufgabe S1 (4 Punkte) Wie lang ist die kürzeste Höhe in dem Dreieck mit den Seiten 5, 12 und 13? Das Dreieck ist rechtwinklig, da 13 2 =
 Aufgabe S1 (4 Punkte) Wie lang ist die kürzeste Höhe in dem Dreieck mit den Seiten 5, 12 und 13? Lösung Das Dreieck ist rechtwinklig, da 13 2 = 12 2 + 5 2 Also gilt für die gesuchte Höhe auf der Hypotenuse
Aufgabe S1 (4 Punkte) Wie lang ist die kürzeste Höhe in dem Dreieck mit den Seiten 5, 12 und 13? Lösung Das Dreieck ist rechtwinklig, da 13 2 = 12 2 + 5 2 Also gilt für die gesuchte Höhe auf der Hypotenuse
Brückenkurs. Beweise. Anja Haußen Brückenkurs, Seite 1/23
 Brückenkurs Beweise Anja Haußen 30.09.2016 Brückenkurs, 30.09.2016 Seite 1/23 Inhalt 1 Einführung 2 Sätze 3 Beweise 4 direkter Beweis Brückenkurs, 30.09.2016 Seite 2/23 Einführung Die höchste Form des
Brückenkurs Beweise Anja Haußen 30.09.2016 Brückenkurs, 30.09.2016 Seite 1/23 Inhalt 1 Einführung 2 Sätze 3 Beweise 4 direkter Beweis Brückenkurs, 30.09.2016 Seite 2/23 Einführung Die höchste Form des
Übungsaufgaben Mathematik - Aufgaben (Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen)
 40 cm Übungsaufgaben Mathematik - Aufgaben (Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen) 1. Zahlenarten und Rechnen b) ( ) 5 ( 2 8 ) ( 1,25) 25 1,8 5,2 ( ) Wie viel sind 20% von? 2. Kenntnisse der Elementargeometrie
40 cm Übungsaufgaben Mathematik - Aufgaben (Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen) 1. Zahlenarten und Rechnen b) ( ) 5 ( 2 8 ) ( 1,25) 25 1,8 5,2 ( ) Wie viel sind 20% von? 2. Kenntnisse der Elementargeometrie
Problem des Monats ( Januar 2012 )
 Schülerzirkel Mathematik Problem des Monats ( Januar 2012 ) Sauff-Zahlen Eine natürliche Zahl größer als 1 heiße Sauff-Zahl, wenn sie sich als Summe aufeinander folgender natürlicher Zahlen schreiben lässt.
Schülerzirkel Mathematik Problem des Monats ( Januar 2012 ) Sauff-Zahlen Eine natürliche Zahl größer als 1 heiße Sauff-Zahl, wenn sie sich als Summe aufeinander folgender natürlicher Zahlen schreiben lässt.
1 Zahlentheorie. 1.1 Kongruenzen
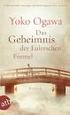 3 Zahlentheorie. Kongruenzen Der letzte Abschnitt zeigte, daß es sinnvoll ist, mit großen Zahlen möglichst einfach rechnen zu können. Oft kommt es nicht darauf, an eine Zahl im Detail zu kennen, sondern
3 Zahlentheorie. Kongruenzen Der letzte Abschnitt zeigte, daß es sinnvoll ist, mit großen Zahlen möglichst einfach rechnen zu können. Oft kommt es nicht darauf, an eine Zahl im Detail zu kennen, sondern
Arbeiten mit Funktionen
 Arbeiten mit Funktionen Wir wählen den Funktioneneditor (Ë W) und geben dort die Funktion f(x) = x³ - x² - 9x + 9 ein. Der TI 92 stellt uns eine Reihe von Funktionsbezeichnern zur Verfügung (y 1 (x), y
Arbeiten mit Funktionen Wir wählen den Funktioneneditor (Ë W) und geben dort die Funktion f(x) = x³ - x² - 9x + 9 ein. Der TI 92 stellt uns eine Reihe von Funktionsbezeichnern zur Verfügung (y 1 (x), y
3. Übung zum G8-Vorkurs Mathematik (WiSe 2011/12)
 Technische Universität München Zentrum Mathematik PD Dr. Christian Karpfinger http://www.ma.tum.de/mathematik/g8vorkurs 3. Übung zum G8-Vorkurs Mathematik (WiSe 0/) Aufgabe 3.: Gehen Sie die Inhalte der
Technische Universität München Zentrum Mathematik PD Dr. Christian Karpfinger http://www.ma.tum.de/mathematik/g8vorkurs 3. Übung zum G8-Vorkurs Mathematik (WiSe 0/) Aufgabe 3.: Gehen Sie die Inhalte der
Herbst b) Bestimmen Sie die Gleichung der Tangente t und Ihren Schnittpunkte A mit der x-achse. t geht durch B(1/2) und hat die Steigung m=-6 :
 Herbst 24 1. Gegeben ist eine Funktion f : mit den Parametern a und b. a) Bestimmen Sie a und b so, dass der Graph von f durch den Punkt B(1/2) verläuft und die Tangente t in B parallel ist zur Geraden
Herbst 24 1. Gegeben ist eine Funktion f : mit den Parametern a und b. a) Bestimmen Sie a und b so, dass der Graph von f durch den Punkt B(1/2) verläuft und die Tangente t in B parallel ist zur Geraden
Trigonometrie. Mag. DI Rainer Sickinger HTL. v 1 Mag. DI Rainer Sickinger Trigonometrie 1 / 1
 Trigonometrie Mag. DI Rainer Sickinger HTL v 1 Mag. DI Rainer Sickinger Trigonometrie 1 / 1 Verschiedene Winkel DEFINITION v 1 Mag. DI Rainer Sickinger Trigonometrie 2 / 1 Verschiedene Winkel Vermessungsaufgaben
Trigonometrie Mag. DI Rainer Sickinger HTL v 1 Mag. DI Rainer Sickinger Trigonometrie 1 / 1 Verschiedene Winkel DEFINITION v 1 Mag. DI Rainer Sickinger Trigonometrie 2 / 1 Verschiedene Winkel Vermessungsaufgaben
Analytische Lösung algebraischer Gleichungen dritten und vierten Grades
 Analytische Lösung algebraischer Gleichungen dritten und vierten Grades Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 2 Gleichungen dritten Grades 3 3 Gleichungen vierten Grades 7 1 Einführung In diesem Skript werden
Analytische Lösung algebraischer Gleichungen dritten und vierten Grades Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 2 Gleichungen dritten Grades 3 3 Gleichungen vierten Grades 7 1 Einführung In diesem Skript werden
Bogenmaß, Trigonometrie und Vektoren
 20 1 Einführung Bogenmaß: Bogenmaß, Trigonometrie und Vektoren Winkel können in Grad ( ) oder im Bogenmaß (Einheit: 1 Radiant, Abkürzung 1 rad) angegeben werden. Dabei gilt 2 rad 360. Die Einheit 1 rad
20 1 Einführung Bogenmaß: Bogenmaß, Trigonometrie und Vektoren Winkel können in Grad ( ) oder im Bogenmaß (Einheit: 1 Radiant, Abkürzung 1 rad) angegeben werden. Dabei gilt 2 rad 360. Die Einheit 1 rad
1.1. Geradengleichung aus Steigung und y-achsenabschnitt
 Version vom 4. Januar 2007 Gleichungen von Geraden in der Ebene 1999 Peter Senn * 1.1. Geradengleichung aus Steigung und y-achsenabschnitt In dieser Form lautet die Gleichung der Geraden wie folgt: g:
Version vom 4. Januar 2007 Gleichungen von Geraden in der Ebene 1999 Peter Senn * 1.1. Geradengleichung aus Steigung und y-achsenabschnitt In dieser Form lautet die Gleichung der Geraden wie folgt: g:
So viel wie möglich Extremwertaufgaben aus Geometrie
 So viel wie möglich Extremwertaufgaben aus Geometrie Andreas Ulovec 1 Einführung Die meisten Leute sind mit Extremwertaufgaben vertraut: Was ist das flächengrößte Dreieck, das man in einen Kreis einschreiben
So viel wie möglich Extremwertaufgaben aus Geometrie Andreas Ulovec 1 Einführung Die meisten Leute sind mit Extremwertaufgaben vertraut: Was ist das flächengrößte Dreieck, das man in einen Kreis einschreiben
Grundlagen der Mathematik
 Universität Hamburg Winter 2016/17 Fachbereich Mathematik Janko Latschev Lösungsskizzen 3 Grundlagen der Mathematik Präsenzaufgaben (P4) Wir betrachten die Menge M := P({1, 2, 3, 4}). Dann gilt 1 / M,
Universität Hamburg Winter 2016/17 Fachbereich Mathematik Janko Latschev Lösungsskizzen 3 Grundlagen der Mathematik Präsenzaufgaben (P4) Wir betrachten die Menge M := P({1, 2, 3, 4}). Dann gilt 1 / M,
KOMPETENZHEFT ZUR TRIGONOMETRIE, II
 KOMPETENZHEFT ZUR TRIGONOMETRIE, II 1. Aufgabenstellungen Aufgabe 1.1. Bestimme alle Winkel in [0 ; 360 ], die Lösungen der gegebenen Gleichung sind, und zeichne sie am Einheitskreis ein. 1) sin(α) = 0,4
KOMPETENZHEFT ZUR TRIGONOMETRIE, II 1. Aufgabenstellungen Aufgabe 1.1. Bestimme alle Winkel in [0 ; 360 ], die Lösungen der gegebenen Gleichung sind, und zeichne sie am Einheitskreis ein. 1) sin(α) = 0,4
Trigonometrie. 3. Kapitel aus meinem Lehrgang Geometrie. Ronald Balestra CH St. Peter
 Trigonometrie 3. Kapitel aus meinem Lehrgang Geometrie Ronald Balestra CH - 7028 St. Peter www.ronaldbalestra.ch 17. August 2008 Inhaltsverzeichnis 3 Trigonometrie 46 3.1 Warum Trigonometrie........................
Trigonometrie 3. Kapitel aus meinem Lehrgang Geometrie Ronald Balestra CH - 7028 St. Peter www.ronaldbalestra.ch 17. August 2008 Inhaltsverzeichnis 3 Trigonometrie 46 3.1 Warum Trigonometrie........................
Faktorisierung bei Brüchen und Bruchtermen
 Faktorisierung bei Brüchen und Bruchtermen Rainer Hauser Mai 2016 1 Einleitung 1.1 Rationale Zahlen Teilt man einen Gegenstand in eine Anzahl gleich grosse Stücke, so bekommt man gebrochene Zahlen, die
Faktorisierung bei Brüchen und Bruchtermen Rainer Hauser Mai 2016 1 Einleitung 1.1 Rationale Zahlen Teilt man einen Gegenstand in eine Anzahl gleich grosse Stücke, so bekommt man gebrochene Zahlen, die
Die Fläche eines Kreissegmentes (Version I) Eine Lernaufgabe zur Geometrie
 Beschreibung Die SchülerInnen leiten, geführt durch drei Aufgaben, selber die allgemeine Formel zur Berechnung der Kreissegmentfläche aus Radius r und Zentriwinkel her. Anschliessend wird die Umkehrfrage
Beschreibung Die SchülerInnen leiten, geführt durch drei Aufgaben, selber die allgemeine Formel zur Berechnung der Kreissegmentfläche aus Radius r und Zentriwinkel her. Anschliessend wird die Umkehrfrage
Teil (C) Beweisen am Gymnasium
 Teil (C) Beweisen am Gymnasium Mathematik ist die beweisende Wissenschaft. Der bekannte Mathematiker Albrecht Beutelspacher bemerkte gar einst, wer Mathematik sage, sage Beweis. Ohne Beweise ist Mathematik
Teil (C) Beweisen am Gymnasium Mathematik ist die beweisende Wissenschaft. Der bekannte Mathematiker Albrecht Beutelspacher bemerkte gar einst, wer Mathematik sage, sage Beweis. Ohne Beweise ist Mathematik
Rechnen mit Quadratwurzeln
 9. Grundwissen Mathematik Algebra Klasse 9 Rechnen mit Quadratwurzeln Die Quadratwurzel aus a ist diejenige nichtnegative Zahl aus R, deren Quadrat wieder a ergibt. a nennt man Radikand. Man schreibt dafür
9. Grundwissen Mathematik Algebra Klasse 9 Rechnen mit Quadratwurzeln Die Quadratwurzel aus a ist diejenige nichtnegative Zahl aus R, deren Quadrat wieder a ergibt. a nennt man Radikand. Man schreibt dafür
Dreiecke erkunden Rechter Winkel gesucht!
 Dreiecke erkunden Rechter Winkel gesucht! Jahrgangsstufe: 8-9 Zeitbedarf: Beschreibung: In einem Leserbrief wird ein rechter Winkel gesucht und die Schüler sollen sich mit dieser Realsituation auseinandersetzen.
Dreiecke erkunden Rechter Winkel gesucht! Jahrgangsstufe: 8-9 Zeitbedarf: Beschreibung: In einem Leserbrief wird ein rechter Winkel gesucht und die Schüler sollen sich mit dieser Realsituation auseinandersetzen.
5. Äquivalenzrelationen
 5. Äquivalenzrelationen 35 5. Äquivalenzrelationen Wenn man eine große und komplizierte Menge (bzw. Gruppe) untersuchen will, so kann es sinnvoll sein, zunächst kleinere, einfachere Mengen (bzw. Gruppen)
5. Äquivalenzrelationen 35 5. Äquivalenzrelationen Wenn man eine große und komplizierte Menge (bzw. Gruppe) untersuchen will, so kann es sinnvoll sein, zunächst kleinere, einfachere Mengen (bzw. Gruppen)
Ganzrationale Funktionen
 Eine Dokumentation von Sandro Antoniol Klasse 3f Mai 2003 Inhaltsverzeichnis: 1. Einleitung...3 2. Grundlagen...4 2.1. Symmetrieeigenschaften von Kurven...4 2.1.1. gerade Exponenten...4 2.1.2. ungerade
Eine Dokumentation von Sandro Antoniol Klasse 3f Mai 2003 Inhaltsverzeichnis: 1. Einleitung...3 2. Grundlagen...4 2.1. Symmetrieeigenschaften von Kurven...4 2.1.1. gerade Exponenten...4 2.1.2. ungerade
1 Körper. Wir definieren nun, was wir unter einem Körper verstehen, und sehen dann, dass es noch andere, ganz kleine Körper gibt:
 1 Körper Sie kennen bereits 2 Beispiele von Zahlkörpern: (Q, +, ) (R, +, ) die rationalen Zahlen mit ihrer Addition und Multiplikation die reellen Zahlen mit ihrer Addition und Multiplikation Vielleicht
1 Körper Sie kennen bereits 2 Beispiele von Zahlkörpern: (Q, +, ) (R, +, ) die rationalen Zahlen mit ihrer Addition und Multiplikation die reellen Zahlen mit ihrer Addition und Multiplikation Vielleicht
Definitions- und Formelübersicht Mathematik
 Definitions- Formelübersicht Mathematik Definitions- Formelübersicht Mathematik Mengen Intervalle Eine Menge ist eine Zusammenfassung von wohlunterschiedenen Elementen zu einem Ganzen. Dabei muss entscheidbar
Definitions- Formelübersicht Mathematik Definitions- Formelübersicht Mathematik Mengen Intervalle Eine Menge ist eine Zusammenfassung von wohlunterschiedenen Elementen zu einem Ganzen. Dabei muss entscheidbar
Bogenmaß und trigonometrische Funktionen
 Bogenmaß und trigonometrische Funktionen Was ist ein "Winkel"? Wir suchen eine tragfähige Definition. N Der "Winkel (zwischen von einem Punkt ausgehenden Halbgeraden)" beschreibt deren relative Lage zueinander
Bogenmaß und trigonometrische Funktionen Was ist ein "Winkel"? Wir suchen eine tragfähige Definition. N Der "Winkel (zwischen von einem Punkt ausgehenden Halbgeraden)" beschreibt deren relative Lage zueinander
Einführung in die linearen Funktionen. Autor: Benedikt Menne
 Einführung in die linearen Funktionen Autor: Benedikt Menne Inhaltsverzeichnis Vorwort... 3 Allgemeine Definition... 3 3 Bestimmung der Steigung einer linearen Funktion... 4 3. Bestimmung der Steigung
Einführung in die linearen Funktionen Autor: Benedikt Menne Inhaltsverzeichnis Vorwort... 3 Allgemeine Definition... 3 3 Bestimmung der Steigung einer linearen Funktion... 4 3. Bestimmung der Steigung
Mathematische Funktionen
 Mathematische Funktionen Viele Schüler können sich unter diesem Phänomen überhaupt nichts vorstellen, und da zusätzlich mit Buchstaben gerechnet wird, erzeugt es eher sogar Horror. Das ist jedoch gar nicht
Mathematische Funktionen Viele Schüler können sich unter diesem Phänomen überhaupt nichts vorstellen, und da zusätzlich mit Buchstaben gerechnet wird, erzeugt es eher sogar Horror. Das ist jedoch gar nicht
Lineare Funktion. Wolfgang Kippels 21. März 2011
 Lineare Funktion Wolfgang Kippels. März 0 Inhaltsverzeichnis Grundlegende Zusammenhänge. Aufbau der Linearen Funktion......................... Nullstellenbestimmung............................. Schnittpunktbestimmung............................
Lineare Funktion Wolfgang Kippels. März 0 Inhaltsverzeichnis Grundlegende Zusammenhänge. Aufbau der Linearen Funktion......................... Nullstellenbestimmung............................. Schnittpunktbestimmung............................
Studienmaterial Einführung in das Rechnen mit Resten
 Studienmaterial Einführung in das Rechnen mit Resten H.-G. Gräbe, Institut für Informatik, http://www.informatik.uni-leipzig.de/~graebe 12. April 2000 Die folgenden Ausführungen sind aus Arbeitsmaterialien
Studienmaterial Einführung in das Rechnen mit Resten H.-G. Gräbe, Institut für Informatik, http://www.informatik.uni-leipzig.de/~graebe 12. April 2000 Die folgenden Ausführungen sind aus Arbeitsmaterialien
Mathematische Theorien im kulturellen Kontext. Fläche eines Parabelsegments nach Archimedes
 Seminar: Mathematische Theorien im kulturellen Kontext Thema: Fläche eines Parabelsegments nach Archimedes von: Zehra Betül Koyutürk Studiengang Angewandte Mathematik 27.01.2016 ARCHIMEDES Über das Leben
Seminar: Mathematische Theorien im kulturellen Kontext Thema: Fläche eines Parabelsegments nach Archimedes von: Zehra Betül Koyutürk Studiengang Angewandte Mathematik 27.01.2016 ARCHIMEDES Über das Leben
23. DIFFERENTIALRECHNUNG VON FUNKTIONEN VON MEHREREN VARIABLEN
 204 Dieses Skript ist ein Auszug mit Lücken aus Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaften I von Hans Heiner Storrer, Birkhäuser Skripten. Als StudentIn sollten Sie das Buch auch
204 Dieses Skript ist ein Auszug mit Lücken aus Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaften I von Hans Heiner Storrer, Birkhäuser Skripten. Als StudentIn sollten Sie das Buch auch
Vorlesung Diskrete Strukturen Die natürlichen Zahlen
 Vorlesung Diskrete Strukturen Die natürlichen Zahlen Bernhard Ganter WS 2009/10 Alles ist Zahl? Wenn in der modernen Mathematik alles auf Mengen aufgebaut ist, woher kommen dann die Zahlen? Sind Zahlen
Vorlesung Diskrete Strukturen Die natürlichen Zahlen Bernhard Ganter WS 2009/10 Alles ist Zahl? Wenn in der modernen Mathematik alles auf Mengen aufgebaut ist, woher kommen dann die Zahlen? Sind Zahlen
6 Bestimmung linearer Funktionen
 1 Bestimmung linearer Funktionen Um die Funktionsvorschrift einer linearen Funktion zu bestimmen, muss man ihre Steigung ermitteln. Dazu sind entweder Punkte gegeben oder man wählt zwei Punkte P 1 ( 1
1 Bestimmung linearer Funktionen Um die Funktionsvorschrift einer linearen Funktion zu bestimmen, muss man ihre Steigung ermitteln. Dazu sind entweder Punkte gegeben oder man wählt zwei Punkte P 1 ( 1
Lineare Funktion. Wolfgang Kippels 3. November Inhaltsverzeichnis
 Lineare Funktion Wolfgang Kippels. November 0 Inhaltsverzeichnis Grundlegende Zusammenhänge. Aufbau der Linearen Funktion......................... Nullstellenbestimmung............................. Schnittpunktbestimmung............................
Lineare Funktion Wolfgang Kippels. November 0 Inhaltsverzeichnis Grundlegende Zusammenhänge. Aufbau der Linearen Funktion......................... Nullstellenbestimmung............................. Schnittpunktbestimmung............................
Wiederhole eigenständig: elementare Konstruktionen nach diesen Sätzen
 1/5 Erinnerung: Kongruenzsätze SSS, SWS, WSW, SsW Wiederhole eigenständig: elementare Konstruktionen nach diesen Sätzen Grundwissen: Elementare Sätze über Dreiecke: o Winkelsumme 180 0 o Dreiecksungleichung
1/5 Erinnerung: Kongruenzsätze SSS, SWS, WSW, SsW Wiederhole eigenständig: elementare Konstruktionen nach diesen Sätzen Grundwissen: Elementare Sätze über Dreiecke: o Winkelsumme 180 0 o Dreiecksungleichung
I. Reelle Zahlen GRUNDWISSEN MATHEMATIK - 9. KLASSE
 I. Reelle Zahlen 1. Die Menge der rationalen Zahlen und die Menge der irrationalen Zahlen bilden zusammen die Menge der reellen Zahlen. Nenne Beispiele für rationale und irrationale Zahlen.. Aus negativen
I. Reelle Zahlen 1. Die Menge der rationalen Zahlen und die Menge der irrationalen Zahlen bilden zusammen die Menge der reellen Zahlen. Nenne Beispiele für rationale und irrationale Zahlen.. Aus negativen
MATHEMATIK BASICS. Rainer Hofer, Marc Peter, Jean-Louis D Alpaos. Trigonometrie
 MATHEMATIK BASICS Rainer Hofer, Marc Peter, Jean-Louis D Alpaos Trigonometrie Vorwort In allen technisch-konstruktiven Berufen sind die Kenntnisse der Dreieckslehre von grosser Bedeutung. Für Lernende,
MATHEMATIK BASICS Rainer Hofer, Marc Peter, Jean-Louis D Alpaos Trigonometrie Vorwort In allen technisch-konstruktiven Berufen sind die Kenntnisse der Dreieckslehre von grosser Bedeutung. Für Lernende,
Vektorrechnung. 10. August Inhaltsverzeichnis. 1 Vektoren 2. 2 Grundlegende Rechenoperationen mit Vektoren 3. 3 Geometrie der Vektoren 5
 Vektorrechnung 0. August 07 Inhaltsverzeichnis Vektoren Grundlegende Rechenoperationen mit Vektoren 3 3 Geometrie der Vektoren 5 4 Das Kreuzprodukt 9 Vektoren Die reellen Zahlen R können wir uns als eine
Vektorrechnung 0. August 07 Inhaltsverzeichnis Vektoren Grundlegende Rechenoperationen mit Vektoren 3 3 Geometrie der Vektoren 5 4 Das Kreuzprodukt 9 Vektoren Die reellen Zahlen R können wir uns als eine
Grundaufgaben der Differenzialrechnung
 Grundaufgaben der Liebe Schülerin, lieber Schüler Ein Leitprogramm Oliver Riesen, Kantonsschule Zug Die Blätter, die du jetzt gerade zu lesen begonnen hast, sind ein sogenanntes Leitprogramm. In einem
Grundaufgaben der Liebe Schülerin, lieber Schüler Ein Leitprogramm Oliver Riesen, Kantonsschule Zug Die Blätter, die du jetzt gerade zu lesen begonnen hast, sind ein sogenanntes Leitprogramm. In einem
Tag der Mathematik 2016
 Tag der Mathematik 016 Mathematischer Wettbewerb, Klassenstufe 9 10 30. April 016, 9.00 1.00 Uhr Aufgabe 1 Der Mittelwert von 016 (nicht unbedingt verschiedenen) natürlichen Zahlen zwischen 1 und 0 16
Tag der Mathematik 016 Mathematischer Wettbewerb, Klassenstufe 9 10 30. April 016, 9.00 1.00 Uhr Aufgabe 1 Der Mittelwert von 016 (nicht unbedingt verschiedenen) natürlichen Zahlen zwischen 1 und 0 16
1 Umkehrfunktionen und implizite Funktionen
 Mathematik für Physiker III WS 2012/2013 Freitag 211 $Id: implizittexv 18 2012/11/01 20:18:36 hk Exp $ $Id: lagrangetexv 13 2012/11/01 1:24:3 hk Exp hk $ 1 Umkehrfunktionen und implizite Funktionen 13
Mathematik für Physiker III WS 2012/2013 Freitag 211 $Id: implizittexv 18 2012/11/01 20:18:36 hk Exp $ $Id: lagrangetexv 13 2012/11/01 1:24:3 hk Exp hk $ 1 Umkehrfunktionen und implizite Funktionen 13
Folgen und Reihen. 1. Folgen
 1. Folgen Aufgabe 1.1. Sie kennen alle die Intelligenztests, bei welchen man zu einer gegebenen Folge von Zahlen die nächsten herausfinden soll. Wie lauten die nächsten drei Zahlen bei den folgenden Beispielen?
1. Folgen Aufgabe 1.1. Sie kennen alle die Intelligenztests, bei welchen man zu einer gegebenen Folge von Zahlen die nächsten herausfinden soll. Wie lauten die nächsten drei Zahlen bei den folgenden Beispielen?
ADDIEREN UND SUBTRAHIEREN VON TERMEN POTENZSCHREIBWEISE
 ADDIEREN UND SUBTRAHIEREN VON TERMEN UND DIE POTENZSCHREIBWEISE ) VARIABLE Beispiel: Ein Rechteck habe einen Umfang von 0 cm. Gib Länge und Breite des Rechtecks in einer Formel an. Es ist natürlich leicht
ADDIEREN UND SUBTRAHIEREN VON TERMEN UND DIE POTENZSCHREIBWEISE ) VARIABLE Beispiel: Ein Rechteck habe einen Umfang von 0 cm. Gib Länge und Breite des Rechtecks in einer Formel an. Es ist natürlich leicht
10 Extremwerte mit Nebenbedingungen
 10 Extremwerte mit Nebenbedingungen 49 10 Extremwerte mit Nebenbedingungen Wir betrachten nun Extremwertaufgaben, bei denen nach dem Extremwert einer fx 1,, x n gesucht wird, aber die Menge der zulässigen
10 Extremwerte mit Nebenbedingungen 49 10 Extremwerte mit Nebenbedingungen Wir betrachten nun Extremwertaufgaben, bei denen nach dem Extremwert einer fx 1,, x n gesucht wird, aber die Menge der zulässigen
( ) Dann gilt f(x) g(x) in der Nähe von x 0, das heisst. Für den Fehler r(h) dieser Näherung erhält man unter Verwendung von ( )
 64 Die Tangente in x 0 eignet sich also als lokale (lineare) Näherung der Funktion in der Nähe des Punktes P. Oder gibt es eine noch besser approximierende Gerade? Satz 4.9 Unter allen Geraden durch den
64 Die Tangente in x 0 eignet sich also als lokale (lineare) Näherung der Funktion in der Nähe des Punktes P. Oder gibt es eine noch besser approximierende Gerade? Satz 4.9 Unter allen Geraden durch den
Regiomontanus - Gymnasium Haßfurt - Grundwissen Mathematik Jahrgangsstufe 9
 Regiomontanus - Gymnasium Haßfurt - Grundwissen Mathematik Jahrgangsstufe 9 Wissen und Können. Zahlenmengen Aufgaen, Beispiele, Erläuterungen N Z Q R natürliche ganze rationale reelle Zahlen Zahlen Zahlen
Regiomontanus - Gymnasium Haßfurt - Grundwissen Mathematik Jahrgangsstufe 9 Wissen und Können. Zahlenmengen Aufgaen, Beispiele, Erläuterungen N Z Q R natürliche ganze rationale reelle Zahlen Zahlen Zahlen
Mathematik II für Studierende der Informatik. Wirtschaftsinformatik (Analysis und lineare Algebra) im Sommersemester 2016
 und Wirtschaftsinformatik (Analysis und lineare Algebra) im Sommersemester 2016 5. Juni 2016 Definition 5.21 Ist a R, a > 0 und a 1, so bezeichnet man die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion x a x als
und Wirtschaftsinformatik (Analysis und lineare Algebra) im Sommersemester 2016 5. Juni 2016 Definition 5.21 Ist a R, a > 0 und a 1, so bezeichnet man die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion x a x als
Die Erweiterung vom Satz des Pythagoras anhand der resultierenden Kraft FR
 Michael B. H. Middendorf 1 Die Erweiterung vom Satz des Pthagoras anhand der resultierenden Kraft FR Bei meinen Überlegungen als Maschinenbauer bzgl. eines Impulsantriebes, stieß ich auf das Problem, ständig
Michael B. H. Middendorf 1 Die Erweiterung vom Satz des Pthagoras anhand der resultierenden Kraft FR Bei meinen Überlegungen als Maschinenbauer bzgl. eines Impulsantriebes, stieß ich auf das Problem, ständig
Aufgabe S 1 (4 Punkte)
 Aufgabe S 1 (4 Punkte) Der fünfstelligen Zahl F = 3ab1 sind die Zehner- und die Tausenderstelle abhanden gekommen Alles, was man von a, b {0, 1,, 9} weiß, sind die beiden folgenden unabhängigen Bedingungen:
Aufgabe S 1 (4 Punkte) Der fünfstelligen Zahl F = 3ab1 sind die Zehner- und die Tausenderstelle abhanden gekommen Alles, was man von a, b {0, 1,, 9} weiß, sind die beiden folgenden unabhängigen Bedingungen:
Lineare Gleichungssysteme mit 2 Variablen
 Lineare Gleichungssysteme mit 2 Variablen Lineare Gleichungssysteme mit 2 Variablen Einzelne lineare Gleichungen mit zwei Variablen Bis jetzt haben wir nur lineare Gleichungen mit einer Unbekannten (x)
Lineare Gleichungssysteme mit 2 Variablen Lineare Gleichungssysteme mit 2 Variablen Einzelne lineare Gleichungen mit zwei Variablen Bis jetzt haben wir nur lineare Gleichungen mit einer Unbekannten (x)
1.4 Sachrechnen in den Bildungsstandards
 1.4 Sachrechnen in den Bildungsstandards http://www.kmk.org/fileadmin/veroe ffentlichungen_beschluesse/2004/20 04_10_15-Bildungsstandards-Mathe- Primar.pdf Mathematikunterricht in der Grundschule Allgemeine
1.4 Sachrechnen in den Bildungsstandards http://www.kmk.org/fileadmin/veroe ffentlichungen_beschluesse/2004/20 04_10_15-Bildungsstandards-Mathe- Primar.pdf Mathematikunterricht in der Grundschule Allgemeine
Funktionen. 1. Einführung René Descartes Cartesius (Frankreich, )
 Mathematik bla Funktionen 1. Einführung 167 René Descartes Cartesius (Frankreich, 1596-1650)...führt das kartesische Koordinatensystem ein. Er beschreibt einen Punkt als ein Paar von reellen Zahlen und
Mathematik bla Funktionen 1. Einführung 167 René Descartes Cartesius (Frankreich, 1596-1650)...führt das kartesische Koordinatensystem ein. Er beschreibt einen Punkt als ein Paar von reellen Zahlen und
Analytische Geometrie I
 Analytische Geometrie I Rainer Hauser Januar 202 Einleitung. Geometrie und Algebra Geometrie und Algebra sind historisch zwei unabhängige Teilgebiete der Mathematik und werden bis heute von Laien weitgehend
Analytische Geometrie I Rainer Hauser Januar 202 Einleitung. Geometrie und Algebra Geometrie und Algebra sind historisch zwei unabhängige Teilgebiete der Mathematik und werden bis heute von Laien weitgehend
Einführung. Ablesen von einander zugeordneten Werten
 Einführung Zusammenhänge zwischen Größen wie Temperatur, Geschwindigkeit, Lautstärke, Fahrstrecke, Preis, Einkommen, Steuer etc. werden mit beschrieben. Eine Zuordnung f, die jedem x A genau ein y B zuweist,
Einführung Zusammenhänge zwischen Größen wie Temperatur, Geschwindigkeit, Lautstärke, Fahrstrecke, Preis, Einkommen, Steuer etc. werden mit beschrieben. Eine Zuordnung f, die jedem x A genau ein y B zuweist,
= 7! = 6! = 0, 00612,
 Die Wahrscheinlichkeit, dass Prof. L. die Wette verliert, lässt sich wie folgt berechnen: Ω = {(i 1,..., i 7 ) : i j {1... 7}, j = 1... 7}, wobei i, j für den Wochentag steht, an dem die Person j geboren
Die Wahrscheinlichkeit, dass Prof. L. die Wette verliert, lässt sich wie folgt berechnen: Ω = {(i 1,..., i 7 ) : i j {1... 7}, j = 1... 7}, wobei i, j für den Wochentag steht, an dem die Person j geboren
3 Mengen und Abbildungen
 $Id: mengen.tex,v 1.2 2008/11/07 08:11:14 hk Exp hk $ 3 Mengen und Abbildungen 3.1 Mengen Eine Menge fasst eine Gesamtheit mathematischer Objekte zu einem neuen Objekt zusammen. Die klassische informelle
$Id: mengen.tex,v 1.2 2008/11/07 08:11:14 hk Exp hk $ 3 Mengen und Abbildungen 3.1 Mengen Eine Menge fasst eine Gesamtheit mathematischer Objekte zu einem neuen Objekt zusammen. Die klassische informelle
Terme und Aussagen und
 1 Grundlagen Dieses einführende Kapitel besteht aus den beiden Abschnitten Terme und Aussagen und Bruchrechnung. Die Erfahrung zeigt, dass diese Dinge zwar in der Schule gelehrt und gelernt werden, dass
1 Grundlagen Dieses einführende Kapitel besteht aus den beiden Abschnitten Terme und Aussagen und Bruchrechnung. Die Erfahrung zeigt, dass diese Dinge zwar in der Schule gelehrt und gelernt werden, dass
Dynamische Systeme und Zeitreihenanalyse // Komplexe Zahlen 3 p.2/29
 Dynamische Systeme und Zeitreihenanalyse Komplexe Zahlen Kapitel 3 Statistik und Mathematik WU Wien Michael Hauser Dynamische Systeme und Zeitreihenanalyse // Komplexe Zahlen 3 p.0/29 Motivation Für die
Dynamische Systeme und Zeitreihenanalyse Komplexe Zahlen Kapitel 3 Statistik und Mathematik WU Wien Michael Hauser Dynamische Systeme und Zeitreihenanalyse // Komplexe Zahlen 3 p.0/29 Motivation Für die
Erzeugende Funktionen
 Hallo! Erzeugende Funktionen sind ein Mittel um lineare Rekursionen schneller ausrechnen zu können. Es soll die Funktion nicht mehr als Rekursion angeschrieben werden, sondern so, dass man nur n einsetzen
Hallo! Erzeugende Funktionen sind ein Mittel um lineare Rekursionen schneller ausrechnen zu können. Es soll die Funktion nicht mehr als Rekursion angeschrieben werden, sondern so, dass man nur n einsetzen
Elementare Geometrie. Inhaltsverzeichnis. info@mathenachhilfe.ch. Fragen und Antworten. (bitte nur für den Eigengebrauch verwenden)
 fua0306070 Fragen und Antworten Elementare Geometrie (bitte nur für den Eigengebrauch verwenden) Inhaltsverzeichnis 1 Geometrie 1.1 Fragen............................................... 1.1.1 Rechteck.........................................
fua0306070 Fragen und Antworten Elementare Geometrie (bitte nur für den Eigengebrauch verwenden) Inhaltsverzeichnis 1 Geometrie 1.1 Fragen............................................... 1.1.1 Rechteck.........................................
Zahlentheorie I - Tipps & Lösungen. Aktualisiert: 15. Oktober 2016 vers Teilbarkeit
 Schweizer Mathematik-Olympiade smo osm Zahlentheorie I - Tipps & Lösungen Aktualisiert: 15. Oktober 2016 vers. 1.2.0 1 Teilbarkeit Einstieg 1.1 Zeige, dass 900 ein Teiler von 10! ist. Tipp: Schreibe 900
Schweizer Mathematik-Olympiade smo osm Zahlentheorie I - Tipps & Lösungen Aktualisiert: 15. Oktober 2016 vers. 1.2.0 1 Teilbarkeit Einstieg 1.1 Zeige, dass 900 ein Teiler von 10! ist. Tipp: Schreibe 900
Kreis - Tangente. 2. Vorbemerkung: Satz des Thales Eine Möglichkeit zur Bestimmung der Tangente benutzt den Satz des Thales.
 Kreis - Tangente 1. Allgemeines 2. Satz des Thales 3. Tangente an einem Punkt auf dem Kreis 4. Tangente über Analysis (an einem Punkt eines Ursprungkreises) 5. Tangente von einem Punkt (Pol) an den Kreis
Kreis - Tangente 1. Allgemeines 2. Satz des Thales 3. Tangente an einem Punkt auf dem Kreis 4. Tangente über Analysis (an einem Punkt eines Ursprungkreises) 5. Tangente von einem Punkt (Pol) an den Kreis
Inhaltsverzeichnis. 1 Flächen 2. 2 Klammern auflösen 4. 3 Prozentrechnung 6. 4 Zinsrechnung 7. 5 Funktionen 8
 Inhaltsverzeichnis 1 Flächen Klammern auflösen 4 3 Prozentrechnung 6 4 Zinsrechnung 7 5 Funktionen 8 1 Flächen Quadrat Alle Seiten sind gleich lang und alle Winkel sind rechte Winkel. - 4 Symmentriachsen
Inhaltsverzeichnis 1 Flächen Klammern auflösen 4 3 Prozentrechnung 6 4 Zinsrechnung 7 5 Funktionen 8 1 Flächen Quadrat Alle Seiten sind gleich lang und alle Winkel sind rechte Winkel. - 4 Symmentriachsen
A.22 Schnittwinkel zwischen Funktionen
 A.22 Schnittwinkel 1 A.22 Schnittwinkel zwischen Funktionen A.22.01 Berühren und senkrecht schneiden ( ) Wenn sich zwei Funktionen berühren, müssen sie im Berührpunkt den gleichen y-wert haben. Wenn sich
A.22 Schnittwinkel 1 A.22 Schnittwinkel zwischen Funktionen A.22.01 Berühren und senkrecht schneiden ( ) Wenn sich zwei Funktionen berühren, müssen sie im Berührpunkt den gleichen y-wert haben. Wenn sich
2. Die Satzgruppe des Pythagoras
 Grundwissen Mathematik 9. Klasse Seite von 17 1.4 Rechnen mit reellen Zahlen a) Multiplizieren und Dividieren von reellen Zahlen + Es gilt: a b = a b mit ab R, 0 Beispiele: 18 = 36 = 6 14 14 7 = = a a
Grundwissen Mathematik 9. Klasse Seite von 17 1.4 Rechnen mit reellen Zahlen a) Multiplizieren und Dividieren von reellen Zahlen + Es gilt: a b = a b mit ab R, 0 Beispiele: 18 = 36 = 6 14 14 7 = = a a
Beispiellösungen zu Blatt 27
 µathematischer κorrespondenz- zirkel Mathematisches Institut Georg-August-Universität Göttingen Aufgabe 1 Beispiellösungen zu Blatt 27 Welche reellen Zahlen x erfüllen die Gleichung 2003x = 2003? 2003
µathematischer κorrespondenz- zirkel Mathematisches Institut Georg-August-Universität Göttingen Aufgabe 1 Beispiellösungen zu Blatt 27 Welche reellen Zahlen x erfüllen die Gleichung 2003x = 2003? 2003
Mathematik - 1. Semester. folgenden Zahlenpaare die gegebene Gleichung erfüllen:
 Mathematik -. Semester Wi. Ein Beispiel Lineare Funktionen Gegeben sei die Gleichung y x + 3. Anhand einer Wertetabelle sehen wir; daß die folgenden Zahlenpaare die gegebene Gleichung erfüllen: x 0 6 8
Mathematik -. Semester Wi. Ein Beispiel Lineare Funktionen Gegeben sei die Gleichung y x + 3. Anhand einer Wertetabelle sehen wir; daß die folgenden Zahlenpaare die gegebene Gleichung erfüllen: x 0 6 8
Näherungsverfahren zur Berechnung von Pi Umfangberechnung von regelmässigen n-ecken KP-E2 Burhan Yildiz, Carim Dreyfuss, Cedric Kroos, Philipp Lenz
 Näherungsverfahren zur Berechnung von Pi Umfangberechnung von regelmässigen n-ecken KP-E2 Burhan Yildiz, Carim Dreyfuss, Cedric Kroos, Philipp Lenz 2009 Zusammenfassung Wenn es dich schon immer interessiert
Näherungsverfahren zur Berechnung von Pi Umfangberechnung von regelmässigen n-ecken KP-E2 Burhan Yildiz, Carim Dreyfuss, Cedric Kroos, Philipp Lenz 2009 Zusammenfassung Wenn es dich schon immer interessiert
Brückenkurs Mathematik. Mittwoch Freitag
 Brückenkurs Mathematik Mittwoch 5.10. - Freitag 14.10.2016 Vorlesung 4 Dreiecke, Vektoren, Matrizen, lineare Gleichungssysteme Kai Rothe Technische Universität Hamburg-Harburg Montag 10.10.2016 0 Brückenkurs
Brückenkurs Mathematik Mittwoch 5.10. - Freitag 14.10.2016 Vorlesung 4 Dreiecke, Vektoren, Matrizen, lineare Gleichungssysteme Kai Rothe Technische Universität Hamburg-Harburg Montag 10.10.2016 0 Brückenkurs
Lösungen Prüfung Fachmaturität Pädagogik
 Fachmaturität Mathematik 7.0.009 Lösungen Prüfung Lösungen Prüfung Fachmaturität Pädagogik. (7 min,7.5 P.) Brüche Forme so um, dass im Ergebnis maximal ein Bruchstrich vorkommt und nicht mehr weiter gekürzt
Fachmaturität Mathematik 7.0.009 Lösungen Prüfung Lösungen Prüfung Fachmaturität Pädagogik. (7 min,7.5 P.) Brüche Forme so um, dass im Ergebnis maximal ein Bruchstrich vorkommt und nicht mehr weiter gekürzt
Kurvendiskussion. Nun Schritt für Schritt. Nehmen wir an, wir haben eine Funktion f(x) = x². Das Bild dazu kennen wir, es ist die Normalparabel.
 Kurvendiskussion Wozu braucht man eigentlich eine Kurvendiskussion und vor allem: Wie wird sie durchgeführt und wozu macht man Ableitungen und setzt sie dann 0 und so weiter und so fort... Es gibt viele
Kurvendiskussion Wozu braucht man eigentlich eine Kurvendiskussion und vor allem: Wie wird sie durchgeführt und wozu macht man Ableitungen und setzt sie dann 0 und so weiter und so fort... Es gibt viele
Cassini-Kurven Lemniskate
 Cassini-Kurven Lemniskate Text Nr. 510 Stand 1. April 016 FRIEDRICH W. BUCKEL INTERNETBIBLIOTHEK FÜR SCHULMATHEMATIK 510 Cassini-Kurven und Lemniskate Vorwort Der Namen Lemniskate ist sicher bekannter
Cassini-Kurven Lemniskate Text Nr. 510 Stand 1. April 016 FRIEDRICH W. BUCKEL INTERNETBIBLIOTHEK FÜR SCHULMATHEMATIK 510 Cassini-Kurven und Lemniskate Vorwort Der Namen Lemniskate ist sicher bekannter
Algebraische Gleichungen. Martin Brehm February 2, 2007
 Algebraische Gleichungen Martin Brehm February, 007 1. Der Begriff Algebra Algebraische Gleichungen Durch das herauskristalisieren von mehreren Teilgebieten der Algebra ist es schwer geworden eine einheitliche
Algebraische Gleichungen Martin Brehm February, 007 1. Der Begriff Algebra Algebraische Gleichungen Durch das herauskristalisieren von mehreren Teilgebieten der Algebra ist es schwer geworden eine einheitliche
Grundlagen der Mathematik
 Universität Hamburg Winter 2016/17 Fachbereich Mathematik Janko Latschev Grundlagen der Mathematik Lösungsskizzen 2 Präsenzaufgaben (P2) Wir betrachten drei Teilmengen der natürlichen Zahlen: - A = {n
Universität Hamburg Winter 2016/17 Fachbereich Mathematik Janko Latschev Grundlagen der Mathematik Lösungsskizzen 2 Präsenzaufgaben (P2) Wir betrachten drei Teilmengen der natürlichen Zahlen: - A = {n
Mathematik 1 für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker Wintersemester 07/08 (Winkler) Musterprüfung mit Lösungen
 Mathematik für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker Wintersemester 07/08 (Winkler Musterprüfung mit Lösungen. Sei T N. (a Unter welchen beiden Voraussetzungen an T garantiert das Induktionsaxiom (nach
Mathematik für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker Wintersemester 07/08 (Winkler Musterprüfung mit Lösungen. Sei T N. (a Unter welchen beiden Voraussetzungen an T garantiert das Induktionsaxiom (nach
Differentialgleichungen sind überall!
 Differentialgleichungen sind überall! Helmut Abels Fakultät für Mathematik Universität Regensburg Folien und Co.: http://www.uni-r.de/fakultaeten/nat Fak I/abels/Aktuelles.html Tag der Mathematik am Albrecht-Altdorfer-Gymnasium
Differentialgleichungen sind überall! Helmut Abels Fakultät für Mathematik Universität Regensburg Folien und Co.: http://www.uni-r.de/fakultaeten/nat Fak I/abels/Aktuelles.html Tag der Mathematik am Albrecht-Altdorfer-Gymnasium
ZAHLENDREIECKE DURCH VERGLEICHEN UND PROBIEREN
 ZAHLENDREIECKE DURCH VERGLEICHEN UND PROBIEREN Zahlendreiecke, die innen leer sind und aussen durch drei Zahlen aus 0, 1, 2,... gegeben sind, lassen sich nicht durch direktes Rechnen lösen. Auch kann es
ZAHLENDREIECKE DURCH VERGLEICHEN UND PROBIEREN Zahlendreiecke, die innen leer sind und aussen durch drei Zahlen aus 0, 1, 2,... gegeben sind, lassen sich nicht durch direktes Rechnen lösen. Auch kann es
Potentialfelder und ihre Bedeutung für Kurvenintegrale
 Potentialfelder und ihre Bedeutung für Kurvenintegrale Gegeben sei ein Vektorfeld v, entweder im Zweidimensionalen, also von der Gestalt ( ) v1 (x,y), v 2 (x,y) oder im Dreidimensionalen, also von der
Potentialfelder und ihre Bedeutung für Kurvenintegrale Gegeben sei ein Vektorfeld v, entweder im Zweidimensionalen, also von der Gestalt ( ) v1 (x,y), v 2 (x,y) oder im Dreidimensionalen, also von der
UND MOSES SPRACH AUCH DIESE GEBOTE
 UND MOSES SPRACH AUCH DIESE GEBOTE 1. Gebot: Nur die DUMMEN kürzen SUMMEN! Und auch sonst läuft bei Summen und Differenzen nichts! 3x + y 3 darfst Du NICHT kürzen! x! y. Gebot: Vorsicht bei WURZELN und
UND MOSES SPRACH AUCH DIESE GEBOTE 1. Gebot: Nur die DUMMEN kürzen SUMMEN! Und auch sonst läuft bei Summen und Differenzen nichts! 3x + y 3 darfst Du NICHT kürzen! x! y. Gebot: Vorsicht bei WURZELN und
(x x j ) R m [x] (3) x x j x k x j. R m [x]. (4)
![(x x j ) R m [x] (3) x x j x k x j. R m [x]. (4) (x x j ) R m [x] (3) x x j x k x j. R m [x]. (4)](/thumbs/67/57224748.jpg) 33 Interpolation 147 33 Interpolation In vielen praktischen Anwendungen der Mathematik treten Funktionen f auf, deren Werte nur näherungsweise berechnet werden können oder sogar nur auf gewissen endlichen
33 Interpolation 147 33 Interpolation In vielen praktischen Anwendungen der Mathematik treten Funktionen f auf, deren Werte nur näherungsweise berechnet werden können oder sogar nur auf gewissen endlichen
$Id: linabb.tex,v /01/09 13:27:34 hk Exp hk $
 Mathematik für Ingenieure I, WS 8/9 Freitag 9. $Id: linabb.tex,v.3 9//9 3:7:34 hk Exp hk $ II. Lineare Algebra 9 Lineare Abbildungen 9. Lineare Abbildungen Der folgende Satz gibt uns eine einfachere Möglichkeit
Mathematik für Ingenieure I, WS 8/9 Freitag 9. $Id: linabb.tex,v.3 9//9 3:7:34 hk Exp hk $ II. Lineare Algebra 9 Lineare Abbildungen 9. Lineare Abbildungen Der folgende Satz gibt uns eine einfachere Möglichkeit
Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck
 1. Geschichtliches Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck Die Trigonometrie ein Teilgebiet der Geometrie, welches sich mit Dreiecken beschäftigt. Sie entstand vor allem aus der frühen stronomie 1, hat
1. Geschichtliches Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck Die Trigonometrie ein Teilgebiet der Geometrie, welches sich mit Dreiecken beschäftigt. Sie entstand vor allem aus der frühen stronomie 1, hat
Aufgaben zu den Themen: Rechtwinkliges Dreieck und Sinus, Cosinus und Tangens im Einheitskreis
 Aufgaben zu den Themen: Rechtwinkliges Dreieck und Sinus, Cosinus und Tangens im Einheitskreis 1. Eine Rampe hat eine Steigung von 5%. Wie groß ist der Steigungswinkel? 2. Gegeben ist ein rechtwinkliges
Aufgaben zu den Themen: Rechtwinkliges Dreieck und Sinus, Cosinus und Tangens im Einheitskreis 1. Eine Rampe hat eine Steigung von 5%. Wie groß ist der Steigungswinkel? 2. Gegeben ist ein rechtwinkliges
Lineare Algebra I 5. Tutorium Die Restklassenringe /n
 Lineare Algebra I 5. Tutorium Die Restklassenringe /n Fachbereich Mathematik WS 2010/2011 Prof. Dr. Kollross 19. November 2010 Dr. Le Roux Dipl.-Math. Susanne Kürsten Aufgaben In diesem Tutrorium soll
Lineare Algebra I 5. Tutorium Die Restklassenringe /n Fachbereich Mathematik WS 2010/2011 Prof. Dr. Kollross 19. November 2010 Dr. Le Roux Dipl.-Math. Susanne Kürsten Aufgaben In diesem Tutrorium soll
Station Trigonometrie Teil 1. Hilfeheft
 Station Trigonometrie Teil 1 Hilfeheft Liebe Schülerinnen und Schüler! Dies ist das Hilfeheft zur Station Trigonometrie Teil 1. Ihr könnt es nutzen, wenn ihr bei einer Aufgabe Schwierigkeiten habt. Falls
Station Trigonometrie Teil 1 Hilfeheft Liebe Schülerinnen und Schüler! Dies ist das Hilfeheft zur Station Trigonometrie Teil 1. Ihr könnt es nutzen, wenn ihr bei einer Aufgabe Schwierigkeiten habt. Falls
Aufgabenblatt 5 (Schnellübung)
 Frühlingssemester 0, Aufgabenblatt (Schnellübung) Aufgabenblatt (Schnellübung) 30 Punkte Aufgabe (Kettenbrüche) a) Bestimme [b 0, b,..., b ] = [,... ], die Kettenbruchentwicklung von r = 3/9. b) Bestimme
Frühlingssemester 0, Aufgabenblatt (Schnellübung) Aufgabenblatt (Schnellübung) 30 Punkte Aufgabe (Kettenbrüche) a) Bestimme [b 0, b,..., b ] = [,... ], die Kettenbruchentwicklung von r = 3/9. b) Bestimme
Reduktion. 2.1 Abstrakte Reduktion
 2 Reduktion In diesem Kapitel studieren wir abstrakte Eigenschaften von Regeln. In den ersten beiden Abschnitten betrachten wir nicht einmal die Regeln selbst, sondern nur abstrakte Reduktionssysteme,
2 Reduktion In diesem Kapitel studieren wir abstrakte Eigenschaften von Regeln. In den ersten beiden Abschnitten betrachten wir nicht einmal die Regeln selbst, sondern nur abstrakte Reduktionssysteme,
Aufgaben für die Klassenstufen 11/12
 Aufgaben für die Klassenstufen 11/12 mit Lösungen Einzelwettbewerb Gruppenwettbewerb Speedwettbewerb Aufgaben OE1, OE2, OE3 Aufgaben OG1, OG2, OG3, OG4 Aufgaben OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7, OS8 Aufgabe
Aufgaben für die Klassenstufen 11/12 mit Lösungen Einzelwettbewerb Gruppenwettbewerb Speedwettbewerb Aufgaben OE1, OE2, OE3 Aufgaben OG1, OG2, OG3, OG4 Aufgaben OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7, OS8 Aufgabe
Explizite Formeln für rekursiv definierte Folgen
 Schweizer Mathematik-Olympiade Explizite Formeln für rekursiv definierte Folgen Aktualisiert: 6 Juni 014 In diesem Skript wird erklärt, wie man explizite Formeln für rekursiv definierte Folgen findet Als
Schweizer Mathematik-Olympiade Explizite Formeln für rekursiv definierte Folgen Aktualisiert: 6 Juni 014 In diesem Skript wird erklärt, wie man explizite Formeln für rekursiv definierte Folgen findet Als
Die Barth-Sextik ein ewiger Weltrekord. 3D-Skulptur von Oliver Labs
 Die Barth-Sextik ein ewiger Weltrekord 3D-Skulptur von Oliver Labs Auch in der Mathematik gibt es Weltrekorde und die Barth-Sextik, entdeckt um 1996 vom Erlanger Professor Wolf Barth, stellt einen solchen
Die Barth-Sextik ein ewiger Weltrekord 3D-Skulptur von Oliver Labs Auch in der Mathematik gibt es Weltrekorde und die Barth-Sextik, entdeckt um 1996 vom Erlanger Professor Wolf Barth, stellt einen solchen
