Schadensminderung als Selbstverständlichkeit?
|
|
|
- Kathrin Kerner
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Soziale Arbeit Schadensminderung als Selbstverständlichkeit? Die gegensätzliche Entwicklung der Drogenpolitik in der Schweiz und in Schweden Bachelorarbeit Selina Schlumpf Bachelorstudiengang Zürich, Frühlingssemester 2017 Zürcher Fachhochschule
2 Abstract Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der gegensätzlichen Entwicklung der Drogenpolitik in der Schweiz und in Schweden mit dem Fokus auf die Schadensminderung. Es wird der Frage nachgegangen, anhand welcher Problemdefinition sozialer Probleme die Drogenpolitik in der Schweiz und in Schweden in Bezug auf die Schadensminderung entwickelt wurde und welche Rolle bei der Problemdefinition die Soziale Arbeit spielte. Das Ziel ist, die Relevanz der Problemdefinition sozialer Probleme für die Entwicklung sozialpolitischer Konzepte und Gesetzgebungen aufzuzeigen und Erkenntnisse für die weitere fachpolitische Einflussnahme durch Sozialarbeitende in der Drogenpolitik in Bezug auf die Schadensminderung zu gewinnen. Die Fragestellung wird in dieser Arbeit anhand von Fachliteratur, Zeitungsartikeln, Rechtsquellen und offiziellen Informationen der jeweiligen Regierungen bearbeitet. Es wird die Theorie sozialer Probleme des systemischen Paradigmas Sozialer Arbeit (SPSA) beigezogen und eine Vergleichsanalyse anhand der allgemeinen normativen Handlungstheorie (W-Fragen) erstellt. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die sozialen Probleme in der Drogenpolitik der Schweiz und Schweden unterschiedlich definiert wurden und sich dementsprechend eine gegensätzliche Drogenpolitik mit, respektive ohne Schadensminderung entwickelte. Sozialarbeitende nahmen in beiden Staaten Einfluss auf die Problemdefinition der sozialen Probleme und prägten dadurch die Praxis der Sozialen Arbeit im Drogenbereich. 2
3 Inhaltsverzeichnis Abstract... 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung Problem- und Fragestellung Thematische Eingrenzung Zielsetzung Vorgehen und Aufbau der Arbeit Begriffsdefinitionen und theoretischer Rahmen Begfriffsdefinitionen Theoretischer Rahmen Berufskodex Sozialer Arbeit Schweiz Die Theorie sozialer Probleme im SPSA Allgemeine normative Handlungstheorie (W-Fragen) Schadensminderung Begriffsdefinition der Schadensminderung Schadensminderung aus Sicht der Wissenschaft Schadensminderung aus Sicht der Menschenrechte Aktuelle Drogenpolitik Die aktuelle Drogenpolitik der Schweiz Schadensminderung in der Schweizer Drogenpolitik Angebote der Schadensminderung in der Schweiz Die aktuelle Drogenpolitik Schwedens Schadensminderung in der Schwedischen Drogenpolitik Angebote der Schadensminderung in Schweden Ein Vergleich der aktuellen Drogenpolitik der Schweiz und Schwedens Die Entwicklung der Drogenpolitik Die Entwicklung der Drogenpolitik in der Schweiz Die Problemdefinition der sozialen Probleme in der Schweizer Drogenpolitik Die Rolle der Sozialen Arbeit in der Schweiz bei der Problemdefinition der sozialen Probleme Die Entwicklung der Drogenpolitik in Schweden
4 Die Problemdefinition der sozialen Probleme in der Schwedischen Drogenpolitik Die Rolle der Sozialen Arbeit in Schweden bei der Problemdefinition der sozialen Probleme Ein Vergleich der Entwicklung der Drogenpolitik der Schweiz und Schwedens Ein Vergleich der Entwicklung der Drogenpolitik der Schweiz und Schwedens in Bezug auf die Problemdefinition der sozialen Probleme Ein Vergleich der Entwicklung der Drogenpolitik in der Schweiz und in Schweden in Bezug auf die Rolle der Sozialen Arbeit Fazit Beantwortung der Fragestellung Schlussfolgerungen für die Soziale Arbeit Reflexion der Ergebnisse und des Vorgehens Ausblick und weiterführende Fragen Literaturverzeichnis Anhang: Persönliche Erklärung Einzelarbeit
5 1. Einleitung Die Wissenschaft und Menschenrechte sind, seit dem Wechsel vom beruflichen Doppel- zum professionellen Trippelmandat, die Begründungsbasis der Profession Soziale Arbeit (vgl. Staub-Bernasconi, 2007, S ). Die Angebote der Sozialen Arbeit entstehen jeweils im Rahmen der nationalen und lokalen Gesetzgebungen und innerhalb von sozialpolitischen Konzepten eines Staates. Diese unterscheiden sich zum Teil stark von Staat zu Staat. Für die Praxis der Sozialen Arbeit bedeutet dies, dass Sozialarbeitende in ihrer Arbeit an die Gesetzgebung des jeweiligen Staates gebunden sind und ihr professionelles Handeln nicht immer nach der Basis ihrer Profession, den Menschenrechten und der Wissenschaft, richten können. Menschen erhalten daher je nach Land, in dem sie leben, nicht die Unterstützung, welche ihnen aus professionstheoretischer Sicht zustehen würde. Wie Martin (2014, S. 155) erwähnt, sollen Professionelle sich nicht (hauptsächlich) nach den Fakten des IST-Zustands einer partikulären, lokalen Praxis ausrichten, um ihrer Profession und dem damit verbundenen hohen moralischen Anspruch gerecht zu werden. Aus dieser Aussage lässt sich schliessen, dass Sozialarbeitenden die lokale Praxis mitgestalten und gegebenenfalls verändern sollen, um dem professionellen Trippelmandat gerecht zu werden. Um dies zu erreichen, ist fachpolitisches Engagement nötig. Staub-Bernasconi (2014, S.26-27) wirft die Frage auf, was Studierende der Sozialen Arbeit über die notwendigen Unterschiede zwischen legalem und legitimem Recht und der darauf basierenden Gesetzgebung im Studium erfahren. Weiter fragt sie, wie den Sozialarbeitenden die Gefahr ihrer politischen Instrumentalisierung über eine legale, aber illegitime Gesetzgebung bewusst gemacht wird und wie ihnen Instrumente für eine öffentliche, fachpolitische Einflussnahme aufgezeigt werden. Staub-Bernasconi greift dadurch die Thematik der fachpolitischen Einflussnahme durch Sozialarbeitende bewusst auf. Um eine solche fachpolitische Einflussnahme auszuüben, ist es für Sozialarbeitende wichtig, überhaupt zu verstehen, wie es zu unterschiedlichen sozialpolitischen Konzepten und Gesetzgebungen kommen kann. In sozialpolitischen Diskursen spielt die Definition der sozialen Probleme, welche anhand von sozialpolitischen Konzepten und Gesetzgebungen gelöst werden sollen, eine bedeutende Rolle (vgl. Olsson, 2011a). Was durch die Sozialpolitik als soziales Problem definiert wird, ist ausschlaggebend für den sozialpolitischen Diskurs und die an- 5
6 schliessende Entstehung sozialpolitischer Konzepte und Gesetzgebungen. In anderen Worten, der Entscheid, ob ein Sachverhalt überhaupt als soziales Problem gewertet wird und was genau am bestehenden Sachverhalt als soziales Problem gewertet wird, führt zu unterschiedlichen Zielformulierungen und folglich zu unterschiedlichen Lösungswegen. Die daraus folgenden sozialpolitischen Konzepte und Gesetzgebungen bilden die Rahmenbedingungen, in welchen die Sozialarbeitenden die sozialen Probleme bearbeiten können. Wie Geiser (2013, S. 66) schreibt, stehen soziale Probleme im Zentrum Sozialer Arbeit. Die Theorie sozialer Probleme im systemtheoretischen Paradigma Sozialer Arbeit (SPSA) bietet transdisziplinäre, mehrniveaunale Erklärungen sozialer Probleme und ist Bestandteil der Sozialarbeitswissenschaft (vgl. Geiser, 2013, S ; Staub- Bernasconi, 2007, S ). Die allgemeine normative Handlungstheorie (W- Fragen) dient in der Sozialen Arbeit unter Einbezug von weiteren relevanten Theorien und Wertewissen zur Problemdefinition sozialer Probleme (vgl. Geiser, 2013, S ; Martin, 2014, S. 165). Sozialarbeitende verfügen anhand der oben genannten Theorien über relevantes Wissen zur Problemdefinition sozialer Probleme und sind in ihrer Praxis mit der Bearbeitung sozialer Probleme konfrontiert. Sozialarbeitende sollten sich im fachpolitischen Diskurs, in Bezug auf die Problemdefinition sozialer Probleme, einbringen und auf soziale Probleme aufmerksam machen. Dadurch kann, anhand fachpolitischer Einflussnahme, dem Trippelmandat der Profession Sozialer Arbeit gerecht und möglichst optimale Rahmenbedingungen für die Praxis der Sozialen Arbeit geschaffen werden. Um in einem konkreten sozialpolitischen Bereich Einfluss auf die Problemdefinition sozialer Probleme zu nehmen, benötigt es Wissen darüber, wie und aufgrund welcher Faktoren die sozialen Probleme in diesem Bereich bis anhin definiert wurden. Dieses Wissen ist essenziell, um eine öffentliche fachpolitische Einflussnahme auszuüben, wie sie Staub-Bernasconi (vgl. 2014, S ) anspricht. In dieser Arbeit wird die Problemdefinition sozialer Probleme im Bereich der Drogenpolitik mit Fokus auf die Schadensminderung genauer betrachtet. 6
7 1.1. Problem- und Fragestellung In der Drogenpolitik werden die sozialpolitischen Konzepte und Gesetzgebungen festgelegt, welche die Rahmenbedingungen für die Drogenarbeit bilden. Der Bereich der Drogenarbeit ist ein interdisziplinäres Arbeitsfeld, in welchem die Sozialarbeitenden ebenfalls tätig sind. Ein Teilbereich der Drogenarbeit ist die Schadensminderung (vgl. Bundesamt für Gesundheit, BAG, 2015, 2016a, 2016b; Herzig, 2015; Olsson 2011a; Socialdepartementet, 2016). In der Schweiz hat sich die Schadensminderung als fester Bestandteil der Drogenpolitik etabliert. Die Drogenpolitik der Schweiz basiert seit 1991 auf den vier Säulen: Prävention, Therapie, Schadensminderung und Repression (Hansjakob & Killias, 2012, S. 65). Die Schadensminderung nimmt dabei einen wichtigen Platz ein. Es finden sich in der Schweiz diverse Angebote im Bereich der Schadensminderung, wie zum Beispiel die Spritzenabgabe, Kontakt- und Anlaufstellen oder Wohnheime mit akzeptanzorientiertem Ansatz (vgl. Infodrog, 2016). Die Positionen der Schweiz punkto Schadensminderung konnten auf europäischer Ebene nach anfänglicher Skepsis relativ schnell überzeugen. In vielen europäischen Städten wurden Angebote der Schadensminderung übernommen (Büchli, Grossmann & Dreifuss, 2012, S. 99). Jann (2005) hält fest: Die Erfolge dieses drogenpolitischen Kurswechsels sind beachtlich: Drogentodesfälle, HIV-Infektionen durch Spritzentausch sowie Beschaffungskriminalität gingen zurück und die Gesundheit der Abhängigen wurde besser. Die grossen, offenen Drogenszenen sind mittlerweile verschwunden. (S. 3) Im gleichen Bericht konstatiert Jann (2005): Geschwunden ist aber auch der öffentliche Handlungsdruck. Viele Angebote kämpfen zudem mit finanziellen Schwierigkeiten. Wird die Schadensminderung ein Opfer ihres Erfolges? Die Schadensminderung ist gesellschaftlich exponiert und hat kaum eine Lobby. (S. 3) Auch Akeret (2014, S.4) merkt an, dass die Schadensminderung Gefahr läuft, Opfer ihrer Erfolge zu werden und zunehmend wieder einem Legitimationsdruck ausgesetzt ist. Hervorzuheben ist an dieser Feststellung durch Jann und Akeret, dass der Druck auf die Angebote der Schadensminderung in der Schweiz zunimmt, obwohl die Schadensminderung aus Sicht der Menschenrechte und der Wissenschaft ein wichtiger Teil der Drogenpolitik darstellt (vgl. Kapitel 3). 7
8 Wie Herzig (2015, S.340) aufzeigt, belasten drogenpolitische Fragen die Schweizer Bevölkerung in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts kaum mehr. Herzig (ebd., S. S ) behauptet weiter, die Entwicklung der Drogenpolitik in der Schweiz befinde sich in einer Stagnationsphase, in welcher wesentliche Herausforderungen nicht angegangen werden und Konzepte für eine neue Drogenpolitik von der Legislative nicht berücksichtigt worden sind. Die stärkste Partei in der Schweiz, die Schweizerische Volkspartei (vgl. SVP, 2008), lehnt die aktuelle Drogenpolitik ab und kämpft dafür, dass die Abstinenz wieder als oberstes Ziel der Drogenpolitik formuliert wird. Damit würde die Drogenpolitik in der Schweiz nach einem restriktiven Ansatz gestaltet. Die Schadensminderung und ihre Angebote werden in einer restriktiven Drogenpolitik nicht unterstützt. Aus professionstheoretischer Sicht zeigt sich diese Entwicklung als Problem, da die Schadensminderung als wichtiger Teil der Drogenpolitik beibehalten und weiterentwickelt werden soll. Gemäss dem Berufskodex der Sozialen Arbeit Schweiz (Avenir Social, 2010, S.6) hat die Soziale Arbeit die Aufgabe Lösungen für soziale Probleme zu erfinden, zu entwickeln und zu vermitteln. Sozialarbeitende sollten, durch fachpolitische Einflussnahme, ihren Beitrag zur Beibehaltung und Weiterentwicklung der Schadensminderung leisten. Dazu ist es wichtig, zu verstehen, wo bei einer restriktiven beziehungsweise einer liberalen Drogenpolitik die sozialen Probleme verortet werden. Weiter können Erkenntnisse, über die Einflussnahme durch Sozialarbeitende auf die Problemdefinition bis anhin, genutzt werden. In dieser Arbeit wird anhand eines Vergleichs zweier Staaten analysiert, wo bei einem Staat mit einer restriktiven Drogenpolitik ohne Schadensminderung, respektive einer liberalen Drogenpolitik mit Schadensminderung, die sozialen Probleme verortet wurden. Weiter wird untersucht, welchen Einfluss die Soziale Arbeit auf die Problemdefinition der sozialen Probleme im Drogenbereich hatte. Dadurch sollen Schlüsse für die weitere politische Einflussnahme gezogen werden. Die Entwicklung der Drogenpolitik in der Schweiz dient als konkretes Beispiel für einen Staat mit einer liberalen Drogenpolitik mit Schadensminderung. Für den Vergleich wird die Entwicklung der Drogenpolitik in Schweden gewählt. Schweden ist ein Staat, in dem eine restriktive Drogenpolitik verfolgt wird. Schweden bildet eine Ausnahme in Europa, da es als einer von wenigen Staaten die Positionen der Schweiz punkto Schadensminderung ablehnt (Büchli et al., 2012, S.99). 8
9 Die schwedische Drogenpolitik verfolgt im Gegensatz zur Schweiz strikte Nulltoleranz (vgl. Socialdepartementet, 2016, S.5). Angebote im Bereich der Schadensminderung gehören nicht zur Strategie der schwedischen Drogenpolitik und sind nur minimal vorhanden (vgl. Lenke & Olsson, 2002, S. 64; Olsson, 2011b, S ; Socialdepartementet, 2016, S. 9). Die zwei Staaten haben eine gegensätzliche Drogenpolitik entwickelt, welche bedeutende Unterschiede für die Praxis der Sozialen Arbeit und folglich für ihre Adressatinnen und Adressaten im Drogenbereich zur Folge hat (vgl. Kapitel 4). In dieser Arbeit wird der Hypothese nachgegangen, dass diese gegensätzliche Entwicklung auf die unterschiedliche Problemdefinition sozialer Probleme im Drogenbereich zurückzuführen ist. Die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Problemdefinition sozialer Probleme im Drogenbereich wird in der Vergleichsanalyse speziell berücksichtigt. Aus der Problemstellung ergibt sich folgende Hauptfrage: Anhand welcher Problemdefinition sozialer Probleme wurde die Drogenpolitik in der Schweiz und in Schweden in Bezug auf die Schadensminderung entwickelt und welche Rolle spielte dabei die Soziale Arbeit? Um die Hauptfrage zu beantworten, wird folgenden Teilfragen nachgegangen: Was wird unter Schadensminderung verstanden und wieso wird sie als wichtiger Teil der Drogenpolitik angesehen? Wie sehen die aktuelle Drogenpolitik und die Angebote der Schadensminderung, in der Schweiz und in Schweden aus? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich durch den Vergleich der aktuellen Drogenpolitik und der Angebote der Schadensminderung in der Schweiz und in Schweden feststellen und wie sind diese fachlich einzuordnen? Wie verlief die Entwicklung der Drogenpolitik in der Schweiz und in Schweden in den letzten fünfzig Jahren ( )? Wie lassen sich anhand eines Vergleichs der Entwicklung der Drogenpolitik in der Schweiz und in Schweden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Drogenpolitik beider Staaten erklären? 9
10 1.2. Thematische Eingrenzung Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der gegensätzlichen Entwicklung der Drogenpolitik in der Schweiz und in Schweden. Der Fokus liegt dabei auf der Schadensminderung. Eine weitere Eingrenzung findet statt, indem bei der Entwicklung der jeweiligen Drogenpolitik auf die Problemdefinition der sozialen Probleme und auf die Rolle der Sozialen Arbeit fokussiert wird. Die Entwicklung der Drogenpolitik wird im Zeitraum der letzten fünzig Jahren betrachtet. In diesen Zeitraum fallen die bedeutesten Entwicklungsschritte, welche zur aktuellen Drogenpolitik der Schweiz und Schwedens führten Zielsetzung Anhand dieser Arbeit soll aufgezeigt werden, wie die Problemdefinition sozialer Probleme die Entwicklung sozialpolitischer Konzepte und Gesetzgebungen in der Drogenpolitik, in Bezug auf die Schadensminderung, beeinflusste und wie diese durch Sozialarbeitende mitgestaltet werden konnte. Es soll ersichtlich werden, welche Problemdefinition sozialer Probleme zu einer repressiven beziehungsweise liberalen Drogenpolitik führt und wie diese fachlich einzuordnen ist. Diese Erkenntnisse können für die weitere fachpolitische Einflussnahme durch Sozialarbeitende im Drogenbereich in Bezug auf die Schadensminderung genutzt werden. Die Relevanz der Problemdefinition sozialer Probleme soll ersichtlich werden, sowie die Wichtigkeit von fachpolitischer Einflussnahme in der Sozialpolitik durch Sozialarbeitende, um dem Trippelmandat ihrer Profession gerecht zu werden Vorgehen und Aufbau der Arbeit Im Hauptteil werden zuerst die relevanten Begriffe definiert und der theoretische Rahmen dieser Arbeit erläutert. Die relevanten Theorien und Wertesysteme, welche dargestellt werden, sind der Berufskodex der Sozialen Arbeit (vgl. AvenirSocial, 2010), sowie die Theorie sozialer Probleme im SPSA (vgl. Geiser, 2013, S ; Staub- Bernasconi, 2007, S ) und die allgemeine Handlungstheorie rationalen Handelns (W-Fragen) (vgl. Martin, 2014, S.165). Diese werden im weiteren Verlauf der Arbeit für die Vergleichsanalyse und die fachliche Einordnung beigezogen. Der Begriff der Schadensminderung wird diskutiert und als drogenpolitische Strategie fachlich eingeordnet. Dazu wird die Schadensminderung aus Sicht der Menschenrechte und der Wissenschaft betrachtet. In einem weiteren Schritt wird in einem zusammenfassenden Teil die allgemeine Drogenpolitik und der Bereich der Schadensminderung in der Schweiz und in Schweden beschrieben. Anschliessend werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der aktu- 10
11 ellen Drogenpolitik Schwedens und der Schweiz herausgearbeitet und fachlich eingeordnet. Zur fachlichen Einordnung wird der Berufskodex der Sozialen Arbeit beigezogen. In einem nächsten Schritt wird die Entwicklung der Drogenpolitik Schwedens und der Schweiz in den letzten fünfzig Jahren ( ) anhand der wichtigsten Entwicklungsschritte dargestellt. Nachfolgend wird aufgrund der Theorie sozialer Probleme des systemischen Paradigmas Sozialer Arbeit (SPSA) analysiert, wie die Problemdefinition der sozialen Probleme in der Drogenpolitik des jeweiligen Staates ausfiel und welchen Einfluss die Soziale Arbeit auf die Problemdefinition der sozialen Probleme hatte. Der Vergleich der Problemdefinition der sozialen Probleme in der Drogenpolitik beider Staaten wird anhand der allgemeinen normativen Handlungstheorie (W-Fragen) erstellt. Im abschliessenden Teil werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassend dargestellt und die gewonnenen Schlüsse für die weitere fachpolitische Einflussnahme durch Sozialarbeitende festgehalten. 11
12 2. Begriffsdefinitionen und theoretischer Rahmen Als Grundlage für die vorliegende Arbeit werden in diesem Kapitel die relevanten Begriffe definiert sowie die relevanten Theorien und Wertesysteme dargestellt Begfriffsdefinitionen Illegale Drogen Als Drogen werden jene Substanzen bezeichnet, die das zentrale Nervensystem (Wahrnehmung, Gefühle, Emotionen, Motorik) beeinflussen und das Bewusstsein verändern. Drogen sind psychoaktive Substanzen. Diese können körperliche und/oder psychische Abhängigkeit hervorrufen. Die illegalen Drogen umfassen alle psychoaktiven Substanzen, welche von Gesetz her verboten sind (Sucht Schweiz, 2017a). Risikoarmer Konsum Laut dem BAG (2015, S. 6) umschreibt der risikoarme Konsum den Umgang mit psychoaktiven Substanzen, welcher nicht schädlich ist für die Gesundheit und für das Umfeld, gesellschaftlich toleriert oder gar kulturell erwünscht ist. Risikoreicher Konsum / Missbrauch Der risikoreiche Konsum umschreibt gemäss dem BAG (2015, S.6) den Substanzkonsum, welcher zu körperlichen, psychischen oder sozialen Problemen oder Schäden für die einzelne Person oder das Umfeld führen kann. Abhängigkeit / Sucht Gemäss dem BAG (2015, S.6) beschreibt der ICD-10 folgende typischen Symptome für eine Abhängigkeit: zwanghafter Drang zum Konsum, verminderte oder fehlende Kontrollfähigkeit des Konsums, Entzugssymptome, Toleranzbildung, Vernachlässigung anderer Interessen und Weiterführen des Konsums trotz bekannter schädlicher Folgen. Abhängigkeit als Konsumform wird von Sucht Schweiz (2017b) als Kontrollverlust über den Konsum beschrieben. Drogenkonsumierende Unter Drogenkonsumierenden werden in dieser Arbeit Personen verstanden, die illegale Drogen konsumieren. Dabei werden alle Konsummuster miteinbezogen (vgl. Duden, 2017a). 12
13 Drogenmissbrauchende Unter Drogenmissbrauchenden werden Personen verstanden, welche einen risikoreichen Konsum von illegalen Drogen zeigen (vgl. Duden, 2017b). Drogenabhängige Unter Drogenabhängigen werden Personen verstanden, welche von illegalen Drogen abhängig sind (vgl. Duden, 2017c) Theoretischer Rahmen In diesem Kapitel werden die für diese Arbeit relevanten Theorien und Wertesysteme dargestellt Berufskodex Sozialer Arbeit Schweiz Der Berufskodex der Sozialen Arbeit Schweiz (vgl. AvenirSocial, 2010) dient in dieser Arbeit als Wertesystem für die fachliche Einordnung der aktuellen Drogenpolitik in der Schweiz und in Schweden (vgl. Kapitel 5). Im Berufskodex sind nicht verhandelbare berufsethische Normen formuliert, die auf den Menschrechten beruhen. Anhand der formulierten Normen kann eine Wertung eines Sachverhalts aus berufsethischer Sicht vorgenommen werden. Daher dient der Berufskodex als geeignetes Instrument, um die Drogenpolitik in der Schweiz und Schweden auf diesem Hintergrund zu vergleichen. Der Berufskodex hat unter anderem zum Zweck, ethische Richtlinien für das moralische berufliche Handeln in der Sozialen Arbeit darzulegen. Unter dem Kapitel Menschenwürde und Menschenrechte des Berufskodex der Sozialen Arbeit Schweiz (vgl. AvenirSocial, 2010) werden folgende wesentliche Grundsätze festgehalten: Grundsatz der Gleichbehandlung: Menschenrechte sind jeder Person zu gewähren, unabhängig von ihrer Leistung, ihrem Verdienst, moralischen Verhalten, oder dem Erfüllen von Ansprüchen, dessen Einforderung ihre Grenze an der Verweigerung der in den Menschenrechten begründeten Minimalnormen hat. (S. 8) Grundsatz der Selbstbestimmung: Das Anrecht der Menschen, im Hinblick auf ihr Wohlbefinden, ihre eigene Wahl und Entscheidung zu treffen, geniesst höchste Achtung, vorausgesetzt, dies gefährdet weder sie selbst noch die Rechte und legitimen Interessen Anderer. (S. 8) Grundsatz der Partizipation: Die für den Lebensvollzug der Menschen notwendige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, sowie Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit, verpflichtet zu Mitein- 13
14 bezug und Beteiligung der Klientinnen und Klienten, Adressatinnen und Adressaten. (S. 9) Grundsatz der Integration: Die Verwirklichung des Menschseins in demokratisch verfassten Gesellschaften bedarf der integrativen Berücksichtigung und Achtung der physischen, psychischen, spirituellen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Menschen, sowie ihrer natürlichen, sozialen und kulturellen Umwelt. (S. 9) Grundsatz der Ermächtigung: Die eigenständige und autonome Mitwirkung an der Gestaltung der Sozialstruktur setzt voraus, dass Individuen, Gruppen und Gemeinwesen ihre Stärken entwickeln und zur Wahrung ihrer Rechte befähigt und ermächtigt sind. (S. 9) Die Theorie sozialer Probleme im SPSA In Kapitel 4 wird untersucht, anhand welcher Problemdefinition sozialer Probleme die Drogenpolitik in der Schweiz und in Schweden entwickelt wurde. Dazu wird die Theorie sozialer Probleme im SPSA beigezogen. Die Problemdefinition der sozialen Probleme in der Drogenpolitik soll aus Sicht der Sozialen Arbeit bewertet werden, daher wird eine Theorie sozialer Probleme der Sozialarbeitswissenschaften gewählt. Der Bereich der Drogenarbeit ist ein interdisziplinäres Arbeitsfeld, da neben sozialen auch weitere Problemklassen in der Drogenarbeit zentral sind, welche sich gegenseitig beeinflussen. Durch eine Analyse anhand der Theorie sozialer Probleme im SPSA kann diesem Aspekt Rechnung getragen werden. Es werden im SPSA, gemäss Geiser (2013, S.63), die Problemklassen der sozialen Probleme, der psychischen Probleme, der biologischen Probleme und der physikalisch-chemischen / nicht humanbiologischen Probleme unterschieden. Die gegenseitige Beeinflussung der unterschiedlichen Problemklassen wird im SPSA berücksichtigt. So weist Geiser (ebd., S. 63) daraufhin, dass alle Problemklassen ihren Beginn in jeweils anderen haben können, bzw. ein Problem einer bestimmten Klasse zu einem solchen einer anderen führen kann. Wie Staub-Bernasconi (2007, S ) schreibt, wird im SPSA nach Erklärungsbeiträgen aller Grundlagen- und Bezugsdisziplinen zu sozialen Problemen gefragt. Insofern werden soziale Probleme im SPSA inter- und transdisziplinär erklärt und alle Wirklichkeitsebenen berücksichtigt. Weiter führt Staub-Bernasconi (ebd., S ) aus, dass einerseits das individualistische Paradigma, in welchem soziale Probleme als rein individuelle Angelegenheiten gesehen werden, in der Theorie sozialer Probleme des SPSA integriert. Andererseits wird ebenfalls das soziozentrische Paradigma, in welchem soziale Probleme als Ab- 14
15 weichung von Wert-, Norm- oder Gesetzesvorgaben und die damit einhergehende Sanktion sowie der Ausschluss oder verweigerte Einschluss verstanden werden, miteinbezogen. Anhand von Bottom-up- und Top-down-Erklärungen wird im individualistische Paradigma die Entstehung problematischer Gesellschaftsstrukturen aufgrund von Merkmalen und Interaktionsmustern von Individuen erklärt. Im soziozentrischen Paradigma wird der Einfluss von Merkmalen und Gesetzmässigkeiten der Gesellschaftsstruktur und -kultur von sozialen Systemen, auf die strukturelle Lage, das Wohlbefinden und Verhalten von Individuen ermittelt (Staub-Bernasconi, ebd., S ). Die sozialen Probleme werden im SPSA durch Geiser (2013, S. 59) weiter differenziert als Probleme in Bezug auf die soziale Interaktion und Probleme in Bezug auf die soziale Position. Die durch Staub-Bernasconi (2007, S ) beschriebenen individuellen Ausstattungsprobleme, die sozial problematischen Austauschbeziehungen und die problematischen Regeln der Sozial- bzw. Machtstruktur lassen sich in Geisers Differenzierung erkennen. Laut Geiser (2013, S. 58) sind Probleme eine andauernde Abweichung von einem Wert. Werte beschreiben gemäss Staub-Bernasconi (2007, S. 189) wünschbare Fakten und sind damit Bilder des Wünschbaren und als Kehrseite Abzulehnenden. Staub-Bernasconi (2007, S. 181) hebt hervor, dass die Beschreibungen sozialer Probleme zum einen Aussagen über Fakten sind, zum anderen Aussagen über das, was Menschen als soziale Probleme bezeichnen. Diese Problemdefinitionen sozialer Probleme können übereinstimmen oder nicht. Sachverhalte werden in bestimmten sozialen Kontexten als soziale Probleme gewertet und in anderen nicht. Es stellt sich, laut Staub-Bernasconi, (ebd., S. 189) die Frage, welche problematischen Sachverhalte überhaupt als negativ zu bewerten sind und was die Legitimation wäre, sie im Hinblick auf einen wünschbaren Zustand oder Prozess zu verändern. Als Wertesysteme für soziale Probleme nennt Staub-Bernasconi (2007) die individuellen und die sozialen Werte: Die individuellen Freiheitswerte und rechte sind daran ausgerichtet, das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, die Fähigkeit zur Selbstbestimmung und Selbstgesetzgebung, zur Gestaltung und Steuerung der bedürfnisrelevanten Umwelt im Hinblick auf individuelles und familiäres Wohlbefinden zu schützen; sie sollen des Weiteren vor Unterdrückung, willkürlichen Gerichtsverfahren, Diskriminierung oder Verfolgung bei Strukturkritik (z. B. Regime-, Religionskritik) (Gedankenfreiheit) schützen. (S. 193) 15
16 Die Solidar-, Gerechtigkeitswerte und Sozialrechte sind daran orientiert, die bedürfnisgerechte Teilhabe an den gesellschaftlichen Ressourcen zu ermöglichen; dadurch schützen sie vor Armut, Unwissenheit, Erwerblosigkeit, Obdachlosigkeit, aber auch vor struktureller Diskriminierung, kultureller Kolonialisierung, Ausbeutung, usw. (S. 193) Im SPSA wird davon ausgegangen, dass keines der beiden Wertesysteme priorisiert werden sollte. Soziale Probleme sind aus Sicht des SPSA konkret und werden wie folgt definiert (Staub-Bernasconi, 2007): Soziale Probleme auf der Grundlage des systemischen Paradigmas sind sowohl Probleme von Individuen als auch Probleme einer Sozialstruktur und Kultur in ihrer Beziehung zueinander. Allgemein formuliert sind:... soziale Probleme jenes Bündel von praktischen Problemen, die sich für ein Individuum im Zusammenhang mit der Befriedigung seiner Bedürfnisse nach einer befriedigenden Form der Einbindung in die sozialen Systeme seiner Umwelt ergeben (Obrecht, 2005, S. 132f). Mit anderen Worten, das Individuum ist vorübergehend oder dauernd unfähig, seine Bedürfnisse und Wünsche aufgrund seiner unbefriedigenden Einbindung in die sozialen Systeme seiner Umwelt, im Genaueren: aufgrund eigener Kompetenzen, Austauschbeziehungen im Sinne von Unterstützungsnetzwerken oder der Verfügung über Machtquellen zur Einlösung oder Erzwingung legitimer Ansprüche, zu befriedigen. (S. 182) Der Konsum illegaler Drogen als soziales Problem In dieser Arbeit wird die Problemdefinition sozialer Probleme in der Drogenpolitik betrachtet. Die Problemdefinition des Konsums illegaler Drogen als soziales Problem spielt dabei eine wichtige Rolle. Aufgrund dessen wird in diesem Abschnitt vorab der Konsum illegaler Drogen als soziales Problem genauer betrachtet und anhand des SPSA fachlich eingeordnet. Hoffmann (2012) untersuchte in ihrer Arbeit, wie sich die Wahrnehmung des genussorientierten Drogengebrauchs im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts als ein problematisches und zu bekämpfendes Phänomen entwickelte. Dabei betont Hoffmann (2012, S. 304) die Wichtigkeit der expliziten Differenzierung zwischen sozialen Sachverhalten, dessen Deutung als Problem und der Anerkennung dieser Problemwahrnehmung. Weiter hält Hoffmann (ebd., S ) folgende Erkenntnisse fest: Betäubungsmittelkonsum wurde im Laufe des ersten Drittel des 20. Jahrhunderts als inakzeptables und abweichendes Verhalten definiert. Hoffmann zeigt auf, dass die Problemdefinition des Betäubungsmittelkonsums als soziales Problem aufgrund von moralischen Wertvorstellungen entstand. Es wurde von einer Bedrohung durch Drogen und ihrer Konsumentinnen und Konsumenten ausgegangen. Der Betäubungsmittelkonsum wurde Gruppen zugeschrieben, die gesellschaftlichen Idealvorstellungen und Normen nicht entsprachen. Die Wandlung der Wahrnehmung hin zur Auffassung des 16
17 Konsums illegaler Drogen als soziales Problem wurde stark durch die Medizinerinnen und Mediziner, die Tagespresse und nicht staatliche Organisationen geprägt. Der Sachverhalt, dass Personen illegale Drogen konsumieren, wird bis heute als soziales Problem gewertet. Die Definition des Konsums illegaler Drogen als soziales Problem ist anhand der Definition sozialer Probleme des SPSA nicht gerechtfertigt. Der Konsum an sich behindert ein Individuum nicht in der Befriedigung seiner Bedürfnisse. Wie bereits erwähnt schreibt Staub-Bernasconi (2007, S. 181), dass die Beschreibungen sozialer Probleme zum einen Aussagen über Fakten, zum anderen Aussagen über das, was Menschen als soziale Probleme bezeichnen, sind. Bezogen auf die Problemdefinition des Konsums illegaler Drogen als soziales Problem, zeigt sich, dass diese eine von Menschen als soziales Problem bezeichnete Aussage ist. Die Problemdefinition des Konsums illegaler Drogen als soziales Problem beruht nicht auf Fakten sondern auf Moralvorstellungen. Bei Zugrundelegung der Theorie sozialer Probleme des SPSA zeigt sich, dass der Konsum von illegalen Drogen zu Folgeproblemen in den Problemklassen der sozialen, biologischen und psychischen Problemen führen kann. Es kann durch den Konsum illegaler Drogen zu gesundheitlichen Schädigungen kommen und somit zu biologischen Problemen (z. B. ein Herz-Kreislauf-Kollaps). Der Konsum illegaler Drogen kann zu einer Suchterkrankung führen und somit zu einem psychischen Problem. Weiter kann es durch den Konsum illegaler Drogen zu Problemen in der sozialen Interaktion kommen (z. B. durch Gewalt in Beziehungen) und somit zu sozialen Problemen. Es ist jedoch nicht zwingend, dass der Konsum von illegalen Drogen zu Folgeproblemen führen muss (vgl. Hoffmann, S. 306). Aus professionstheoretischer Sicht muss zwischen dem Konsum an sich und den ihm zugeschriebenen Folgeproblemen differenziert werden. Erst der risikoreiche Konsum und/oder eine Suchterkrankung führen zu sozialen Folgeproblemen. Die sozialen Folgeprobleme können aus Sicht des SPSA im Bereich der sozialen Interaktion der Betroffenen verortet werden, welche durch ihren risikoreichen Konsum und/oder ihre Suchterkrankung von individuellen Ausstattungsproblemen und sozial problematischen Austauschbeziehungen betroffen sind. Dass der Konsum illegaler Drogen an sich als soziales Problem definiert wird, basiert auf der starken Koppelung von illegalen Drogen mit risikoreichem Konsum und Sucht. In der Problemdefinition des Konsums illegaler Drogen an sich als soziales Problem wird der risikoarme Konsum nicht berücksichtigt. 17
18 Durch die grundsätzliche Definition des Konsums illegaler Drogen als soziales Problem und durch die Kriminalisierung des Drogenkonsums, ergeben sich weitere soziale Folgeprobleme. Auf das Abweichen der Wertvorstellung Abstinenz von illegalen Drogen wird durch die Gesellschaft mit Sanktion und Ausschluss reagiert. Die Drogenkonsumierenden werden stigmatisiert. Der Wert der Abstinenz besteht, um mögliche Folgeprobleme des Konsums illegaler Drogen zu verhindern. Das Festhalten an diesem Wert führt jedoch gleichzeitig zu weiteren Folgeproblemen für die Betroffenen. Es entstehen soziale Probleme in Bezug auf die soziale Position der Betroffenen. Durch problematische Regeln der Sozial- bzw. Machtstruktur erfahren die Betroffenen zum Beispiel Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Aufgrund der möglichen Folgeprobleme des Konsums illegaler Drogen, ist der Ansatz, den Konsum an sich als soziales Problem zu definieren, verständlich, aus professionstheoretischer Sicht aber nicht vertretbar. Es ist der Gefahr der Stigmatisierung Rechnung zu tragen. Die professionelle Definition der sozialen Probleme sollte sich auf den risikoreichen Konsum und die Sucht und die damit einhergehenden sozialen Folgeprobleme beziehen. 18
19 Allgemeine normative Handlungstheorie (W-Fragen) Anhand der Tabelle der W-Fragen wird in Kapitel 4.3 die Problemdefinition sozialer Probleme der Drogenpolitik in der Schweiz und in Schweden verglichen. In der Tabelle werden die fünf Phasen einer rationalen Handlung dargestellt, welche Professionelle durchlaufen wenn sie wissenschaftlich und methodisch arbeiten. Die Struktur zwischen wissenschaftlichem Wissen und Fragen wird anhand dieser Gliederung ersichtlich. Die Entstehung der Problemdefinition sozialer Probleme der Drogenpolitik in der Schweiz und in Schweden wird anhand dieser fünf Phasen betrachtet und verglichen. Wissensformen als Antwort auf W-Fragen Phase I : Situationsanalyse 1. Bilder (Beschreibungen, Beschreibungswissen) 1.a Gegenwartsbilder 1.b Vergangenheitsbilder 1.c Zukunftsbilder (vgl. Punkt 4) Was-, Wann-, Wo-, Woher-Fragen Was-, Wann-, Wo-Fragen Woher-Fragen (Wohin-Fragen) 2. Theorien (Erklärungen, Erklärungswissen) 2.a Beschreibungstheorien 2.a.1 nomologische Theorien 2.a.2 nomopragmatische Theorien 2.b Erklärungstheorien Warum- (oder Weshalb-)Fragen (Aufgrund welcher Gesetzmässigkeiten?) - Allgemeine Gesetzmässigkeiten - Handlungsgesetze (Aufgrund welcher Mechanismen?) Phase II: Bewertung, Prognose und Problemermittlung 3. Werte (Wertewissen) Was-ist-gut-Fragen 4. Zukunftsbilder (Trends, Prognosen) Wohin-Fragen 5. Probleme (Problemwissen) Was-ist-nicht-gut-Fragen (Was ist das Problem? Was geht nicht?) 19
20 Phase III: Zielsetzung und Planung 6. Ziele (Zielwissen) Im Zusammenhang mit Problem Woraufhin-Fragen 7. Interventionswissen 7.a Interventionstheorien (Handlungstheorien, Technologien) 7.b Pläne 7.c Fertigkeiten (Skills) 8. Wissen über materielle Ressourcen 9. Wissen über Handelnde Wie-Fragen - Allg./wertbezogene Wie-Fragen - zielbezogene Wie-Fragen - planbezogene Wie-Fragen Womit-Fragen Wer-Fragen Phase IV: Entscheidung und Implementierung des Plans 10. Wissen über Entscheidungen (geordnete Abfolgen motorischer Operationen) Welche-Fragen Phase V: Evaluation 11. Evaluationswissen 11.a Wissen über Wirksamkeit von konkreten Interventionen 11.b Wissen über die Wirtschaftlichkeit von konkreten Interventionen 11.c Wissen über die Wünschbarkeit von konkreten Interventionen Wirksamkeits-, Wirtschaftlichkeits-, Wünschbarkeits-Fragen Wirksamkeits-Fragen (Effektivität, instrumentelle Rationalität) Wirtschaftlichkeits-Fragen (Effizienz, ökonomische Rationalität) Wünschbarkeits-Fragen (Wertrationalität) Tab. 1: Wissensformen und W-Fragen von Wissenschaft und Technologie (Obrecht, 1996; zit. nach Martin, 2014, S. 165) 20
21 3. Schadensminderung In diesem Kapitel wird die Schadensminderung definiert und dargelegt, wieso die Schadensminderung aus fachlicher Sicht ein wichtiger Teil der Drogenpolitik darstellt. Dazu wird die Schadensminderung anhand von Fachliteratur aus Sicht der Menschenrechte und der Wissenschaft bewertet Begriffsdefinition der Schadensminderung Der Begriff der Schadensminderung (engl. Harm reduction) ist nach wie vor nicht einheitlich definiert (vgl. Elliot, Csete, Wood & Kerr, 2005; Riley, Sawka, Conley, Hewitt, Mitic, Poulin, Room, Single & Topp,1999; Socialdepartementet, 2016). Mitte der 80er Jahre kam der Begriff der Schadensminderung in der Drogenarbeit auf, nachdem die HIV-Epidemie ausbrach. Schon Riley et al. (1999) wiesen darauf hin, dass sowohl unter Befürworterinnen und Befürwortern als auch unter Gegnerinnen und Gegnern der Schadensminderung Verwirrung über die Definition der Schadensminderung besteht. Der Hauptunterschied bestehe darin, ob Schadensminderung als Ziel oder als Strategie gesehen werde: As a general goal, all drug policies and programs aim to reduce the harm associated with drug use. As a general goal, harm reduction is a very broad term. Virtually all drug policies and programs - including criminalization of users and abstinence-oriented programs - have a goal of harm reduction. As a specific strategy, the term harm reduction generally refers to only those policies and programs which aim at reducing drug-related harm without requiring abstention from drug use. In other words, all drug policies and programs aim at reducing drug-related harm, but not all policies and programs with a goal of harm reduction are harm-reduction strategies. (S. 11) In dieser Arbeit wird die Schadensminderung als eine Strategie verstanden. Es wird die Begriffsdefinition von der International Harm Reduction Association (IHRA, 2010) verwendet: Harm Reduction bezieht sich auf Maßnahmen, Programme und Praktiken, die in erster Linie darauf abzielen, die negativen gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Konsequenzen des Gebrauches von legalen und illegalen Drogen zu reduzieren, ohne dabei zwangsläufig das Ziel einer Reduzierung des Drogenkonsums zu verfolgen. Harm Reduction hilft Menschen, die Drogen konsumieren, aber auch deren Familien und dem Gemeinwesen. (S. 1) Die Substitution wird international als Teil der Schadensminderung gesehen. In Schweden und in der Schweiz wird die Substitution der Therapie zugeteilt (vgl. Akeret, 2014; Socialdepartementet, 2016). In dieser Arbeit liegt der Fokus auf der Schadensminderung in der Schweiz und in Schweden, daher wird die Substitution nicht als Teil der Schadensminderung verstanden. 21
22 3.2. Schadensminderung aus Sicht der Wissenschaft Die positive Wirkung der Schadensminderung wird anhand diverser Studien wissenschaftlich belegt (vgl. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2010; Hunt, Trace & Bewley-Taylor, 2006; Pauly, 2008; Ritter & Cameron, 2006; Wodak, 2007). Ritter und Cameron (2006) zeigen auf, inwiefern Angebote der Schadensminderung evidenzbasiert sind: In the area of illicit drugs there is solid efficacy, effectiveness and economic data to support needle syringe programmes and outreach programmes. There is limited published evidence to date for other harm reduction interventions such as non-injecting routes of administration, brief interventions and emerging positive evidence for supervised injecting facilities. There is sufficient evidence to support the wide-spread adoption of harm reduction interventions and to use harm reduction as an overarching policy approach in relation to illicit drugs. (S. S. 611) Wie Ritter und Cameron hervorheben, ist die Schadensminderung ausreichend evidenzbasiert. Auch Fry (2010, S. 105) verweist auf die umfassende Evidenzbasis der Schadensminderung und hält in seinem Bericht fest harm reduction works. Wie empirische Untersuchungen gezeigt haben, können unter anderem folgende positive Effekte durch Angebote der Schadensminderung auf die soziale wie auch gesundheitliche Situation von Drogenkonsumierenden wissenschaftlich nachgewiesen werden: Die Drogentodesfälle können reduziert und die Ausbreitung von Infektionen verhindert werden. Zu schwer erreichbaren Drogenkonsumierenden kann Kontakt hergestellt werden. Dadurch können sie unter anderem darin unterstützt werden, ihren riskanten Lebensstil aufzugeben (vgl. Hunt et al., 2006). Die Effekte der Schadensminderung in der Schweiz werden von Fachleuten als positiv gewertet. Sie verweisen dabei auf die verbesserten Lebensumstände und Lebenschancen von Drogenkonsumierenden. Wie Akeret (2004, S. 4) und das BAG (2005, S. 4) festhalten, konnten folgende Effekte durch Angebote der Schadensminderung erzielt werden: Die soziale und gesundheitliche Situation der Drogenkonsumierenden konnte verbessert werden. Stark marginalisierte und von Verelendung bedrohte Drogenkonsumierende, die zuvor schlecht oder gar nicht erreichbar waren, konnten durch diese Angebote erreicht werden und ihr physischer und psychischer Gesundheitszustand verbessert werden. Ihre Chancen zur sozialen Integration wurden dadurch erhöht und Verelendungs- und Verwahrlosungstendenzen stark reduziert. Die Drogentodesfälle in der Schweiz sind um mehr als die Hälfte gesunken und die HIV-Infektionen bei intravenös 22
23 Drogenkonsumierenden gingen zurück. Die offene Drogenszene verschwand und die Beschaffungskriminalität ging stark zurück. Die Strategie der Schadensminderung ist evidenzbasiert und führt zu positiven Effekten. Somit ist die Schadensminderung aus Sicht der Wissenschaft als wichtiger Teil der Drogenpolitik zu werten Schadensminderung aus Sicht der Menschenrechte Laut Elliot et al. (2005, S. 115) sind die Menschenrechte ein fundamentaler Teil der Schadensminderung: Harm reduction s raison d être is the fulfillment of the human right to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health. Wie Elliot et al. (ebd., S. 106) betonen zeichnet das Engagement für die Menschenrechte von Drogenkonsumierenden das Denken und den Einsatz von Vertreterinnen und Vertretern der Schadensminderung aus: Harm reductionists, therefore, in effect, are human rights advocates, contributing to a larger effort aimed at securing universal respect for, and observance of, fundamental human rights. Elliot et al. schlussfolgern, dass unter Einbezug der Menschenrechte die politische Antwort auf den Drogenkonsum die Schadensminderung sein muss. Auch die Definitionen der Schadensminderung des International Harm Reduction Development Program (2004; zit. nach Elliot et al., 2005, S. 115) bezieht sich explizit auf die Verknüpfung der Schadensminderung mit den Menschenrechten: Harm reduction is a pragmatic and humanistic approach to diminishing the individual and social harms associated with drug use, especially the risk of HIV infection. It seeks to lessen the problems associated with drug use through methodologies that safeguard the dignity, humanity and human rights of people who use drugs. Anhand der Aussage von Elliot et al. und der Definitionen der Schadensminderung des International Harm Reduction Development Program bleibt offen, inwiefern die Menschenrechte durch die Schadensminderung berücksichtigt werden. Pauly (vgl. 2008, S. 4-10) hingegen präzisiert die Berücksichtigung der Menschenrechte durch die Schadensminderung. Laut ihm sind die humanistischen Werte, im Speziellen die Werte des Respekts und der Würde aller Personen, eingeschlossen denjenigen, welche Drogen konsumieren, ein Prinzip der Schadensminderung. Aus Sicht der Schadensminderung sollen Personen, welche Drogen konsumieren, nicht moralisch verurteilt werden, sondern als gleichwertige und respektable Personen betrachtet werden, wie diejenigen, welche keine Drogen konsumieren. Der Fokus liegt in der Schadensminderung gemäss Pauly (2008, S. 6) auf der Reduzierung der negativen Konse- 23
24 quenzen des Drogenkonsums für die Individuen, die Gemeinschaft und die Gesellschaft. Aus Paulys Aussage lässt sich schliessen, dass Drogenkonsumierende durch die Schadensminderung Zugang zur benötigten Gesundheitsversorgung und Unterstützungsangeboten erhalten, ohne, dass weitere Ansprüche an sie gestellt werden. Dadurch wird anhand der Schadensminderung das Menschenrecht auf Gesundheit und das Verbot von Diskriminierung berücksichtigt (vgl. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 1948). Die ehemalige UN-Hochkommissarin Pansieri (United Nations News Service, 2015) betonte ebenfalls die Bedeutung der Schadensminderung in der Drogenarbeit, um den Menschenrechten gerecht zu werden: On the right to health,... the report therefore encourages States to embrace harm reduction approaches when dealing with drug dependent persons. Abschliessend ist festzuhalten, dass die Schadensminderung aus menschenrechtsorientierter Perspektive als ein wichtiger Teil der Drogenpolitik einzuschätzen ist, da durch die Schadensminderung die Menschenrechte der Drogenkonsumierenden geschützt werden. 24
25 4. Aktuelle Drogenpolitik In diesem Kapitel wird die aktuelle Drogenpolitik der Schweiz und Schwedens beschrieben. Die Schadensminderung wird in zwei Unterkapitel speziell berücksichtigt. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der aktuellen Drogenpolitik Schwedens und der Schweiz herausgearbeitet und fachlich eingeordnet. Zur fachlichen Einordnung wird der Berufskodex der Sozialen Arbeit beigezogen Die aktuelle Drogenpolitik der Schweiz Drogenpolitisches Modell der Schweiz Die aktuelle Drogenpolitik der Schweiz ist in der Nationalen Strategie Sucht (vgl. BAG, 2015, 2016b) festgehalten. Die Nationale Strategie Sucht basiert auf dem Würfel-Modell, welches auf dem Vier- Säulen-Modell beruht. Das Vier-Säulen-Modell ist im Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe gesetzlich verankert. Zuerst wird das Vier-Säulen-Modell und anschliessend das Würfel-Modell und die aktuelle Nationale Strategie Sucht erläutert. Das Vier-Säulen-Modell Das BAG (2016a) präsentiert die Schweizer Drogenpolitik wie folgt: Zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und der öffentlichen Sicherheit entwickelten Fachleute und Politiker einen breit abgestützten Ansatz, um mit den Drogenproblemen umzugehen: die Vier-Säulen-Politik mit den Pfeilern Prävention, Therapie, Schadensminderung und Repression. Dabei steht die Prävention für Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung und Früherkennung. Mit Prävention werden alle Strategien und Massnahmen bezeichnet, die dazu beitragen, den Einstieg zu verhindern sowie Drogenkonsum und Suchtentwicklung zu verringern. Die Therapie steht für verschiedene Behandlungsoptionen und die soziale Integration. Die Therapie und Beratung umfassen all jene Strategien und Massnahmen zur Verbesserung der körperlichen und psychischen Verfassung sowie der gesundheitlichen Rehabilitation. Die Schadensminderung steht für individuelle und gesellschaftliche Schadensminderung. Sie umfasst alle Strategien und Massnahmen zur Verringerung der negativen Folgen des Drogenkonsums auf die Konsumierenden sowie auf die Gesellschaft. Die Repression steht für die Marktregulierung und den Jugendschutz. Zudem trägt sie durch regulative Massnahmen und Verbote zur Durchsetzung der gesetzlichen Regelungen bei. 25
26 Folgende Ziele sollen durch das Vier-Säulen-Modell erreicht werden: Verringerung der negativen Auswirkungen auf die Konsumierenden Verringerung des Drogenkonsums Verringerung der negativen Konsequenzen für die Gesellschaft Die wichtigsten Indikatoren für die Wirkung der Vier-Säulen- Politik sind: die Anzahl Drogenkonsumierender, die Anzahl der drogen- und/oder aidsbedingten Todesfälle, das Ausmass der Beschaffungskriminalität und die Wahrnehmung der öffentlichen Sicherheit. Folgende Wirkung hat das Vier-Säulen-Modell bis anhin gezeigt: Rückgang der Anzahl Aidstodesfälle bei Drogenkonsumierenden Rückgang der Beschaffungskriminalität Rückgang der Anzahl Neuansteckungen mit HIV bei Drogenkonsumierenden Verbesserung der öffentlichen Sicherheit Rückgang der drogenbedingten Todesfälle Erhöhtes Sicherheitsgefühl dank dem Verschwinden der offenen Drogenszenen In der internationalen Drogenpolitik positionierte sich die Schweiz indem sie die drei internationalen Konventionen der Vereinten Nationen zum Thema Drogen ratifizierte. Dies sind das Einheits-Übereinkommen von 1961 über die Betäubungsmittel, das Übereinkommen über psychotrope Stoffe von 1971 und das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen von Weiter setzt sich die Schweiz im Bereich der illegalen Drogen international ein für den Schutz der fundamentalen Menschenrechte, die internationale Kooperation zur Verminderung drogenbedingter Kriminalität und Korruption, wie Finanzkriminalität und die Förderung sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung in den Drogenanbaugebieten. Das Würfel-Modell Das Würfle-Modell ist eine Weiterentwicklung des Vier-Säulen-Modells und soll die Mängel des Vier-Säulen-Modells aufheben. Vom BAG (2005b, S. 1) werden die fehlende Abstimmung der Massnahmen und die Fokussierung auf die illegalen psychoaktiven Substanzen als Mängel am Vier-Säulen-Modell genannt. Durch das Würfel-Modell soll eine kohärente Politik aller psychoaktiven Substanzen erreicht werden. Neu wird die Drogenpolitik von einer auf drei Dimensionen erweitert. 26
27 Die Differenzierung der einzelnen Säulen bildet die erste Dimension. Die Säulen werden neu unterteilt in die psychoaktiven Substanzen, um die Massnahmen auf die jeweilige psychoaktive Substanz abzustimmen. Dabei werden als Erweiterung neben den illegalen neu auch alle legalen psychoaktiven Substanzen integriert. Diese Unterteilung bildet die zweite Dimension des Würfel-Modells. Die dritte Dimension bildet der Einbezug der Konsummuster: risikoarmer Konsum, problematischer Konsum, Abhängigkeit. Abb. 1: Das Würfel-Modell (BAG, 2005b) Die Stärke des drogenpolitischen Würfels liegt darin eine differenzierte Analyse der Suchtpolitik durchzuführen. Dadurch ist es möglich Massnahmen der Suchtpolitik einzuordnen, zu vergleichen und aufeinander abzustimmen, sowie Lücken zu identifizieren. Der Würfel dient als Denkmodell für die Entwicklung einer sachlichen, in sich stimmigen, wirksamen und glaubwürdigen Suchtpolitik, welche alle psychoaktiven Substanzen erfasst. Nationale Strategie Sucht Die Nationale Strategie Sucht (BAG, 2015, 2016b) baut auf dem Würfel-Modell und dem Vier-Säulen-Modell auf: 27
Dokumentation und Evaluation im Case Management. Prof. (FH) Dr. Michael Klassen FHS Soziale Arbeit Management Center Innsbruck
 Dokumentation und Evaluation im Case Management Prof. Dr. Michael Klassen FHS Soziale Arbeit Management Center Innsbruck Folie 1 Welche Fragen müssen Sie für sich und Ihre Mitarbeiter beantworten? Was
Dokumentation und Evaluation im Case Management Prof. Dr. Michael Klassen FHS Soziale Arbeit Management Center Innsbruck Folie 1 Welche Fragen müssen Sie für sich und Ihre Mitarbeiter beantworten? Was
DAS WÜRFEL-MODELL. Bisher: Vier-Säulen-Modell. Erste Dimension. Prävention Therapie Schadensminderung Repression
 Bisher: Vier-Säulen-Modell Erste Dimension Prävention Therapie Schadensminderung Repression Mängel Fehlende Abstimmung der Massnahmen Nicht alle psychoaktiven Substanzen berücksichtigt Ziel Kohärente Politik
Bisher: Vier-Säulen-Modell Erste Dimension Prävention Therapie Schadensminderung Repression Mängel Fehlende Abstimmung der Massnahmen Nicht alle psychoaktiven Substanzen berücksichtigt Ziel Kohärente Politik
Arbeitstagung Heimerziehung: Qualität, Standards, Umsetzung
 Charel Schmit Die Bedeutung berufsethischer Standards in der Heimerziehung: Elemente für einen nationalen ethischen Kodex Arbeitstagung Heimerziehung: Qualität, Standards, Umsetzung Montag 10.03.07, 14h00-18h30,
Charel Schmit Die Bedeutung berufsethischer Standards in der Heimerziehung: Elemente für einen nationalen ethischen Kodex Arbeitstagung Heimerziehung: Qualität, Standards, Umsetzung Montag 10.03.07, 14h00-18h30,
Inhalt. Vorwort Einleitung... 15
 Inhalt Vorwort... 13 Einleitung... 15 1 Kinderrechte sind Menschenrechte eine Entwicklungsperspektive... 21 1.1 Internationale Dokumente vor 1945... 21 1.2 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte... 22
Inhalt Vorwort... 13 Einleitung... 15 1 Kinderrechte sind Menschenrechte eine Entwicklungsperspektive... 21 1.1 Internationale Dokumente vor 1945... 21 1.2 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte... 22
Schweizer 4-Säulen-Modell
 März 2016 Schweizer 4-Säulen-Modell Alexander Bücheli, M.A. Selbständiger Berater in Präventions- und Schadensminderungsanliegen Projektmitarbeiter Safer Nightlife Schweiz/Safer Dance Swiss 22.03.2016,
März 2016 Schweizer 4-Säulen-Modell Alexander Bücheli, M.A. Selbständiger Berater in Präventions- und Schadensminderungsanliegen Projektmitarbeiter Safer Nightlife Schweiz/Safer Dance Swiss 22.03.2016,
Einleitung. 1. Untersuchungsgegenstand und Relevanz. Gegenstand der hier vorliegenden Arbeit ist die Mediation als Instrument der Konfliktlösung
 Einleitung 1. Untersuchungsgegenstand und Relevanz Gegenstand der hier vorliegenden Arbeit ist die Mediation als Instrument der Konfliktlösung 1 und damit v.a. als Mittel außergerichtlicher Konfliktbeilegung
Einleitung 1. Untersuchungsgegenstand und Relevanz Gegenstand der hier vorliegenden Arbeit ist die Mediation als Instrument der Konfliktlösung 1 und damit v.a. als Mittel außergerichtlicher Konfliktbeilegung
Welche Rolle spielt die Ergotherapie in Public Health? Julie Page & Birgit Stüve Zürcher Hochschule Winterthur Forschung & Entwicklung
 Welche Rolle spielt die Ergotherapie in Public Health? Julie Page & Birgit Stüve Zürcher Hochschule Winterthur Forschung & Entwicklung Agenda Public Health / Ergotherapie International Classification of
Welche Rolle spielt die Ergotherapie in Public Health? Julie Page & Birgit Stüve Zürcher Hochschule Winterthur Forschung & Entwicklung Agenda Public Health / Ergotherapie International Classification of
Zum Wandel der Fremd- und Selbstdarstellung in Heirats- und Kontaktanzeigen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine empirische Untersuchung
 Zum Wandel der Fremd- und Selbstdarstellung in Heirats- und Kontaktanzeigen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine empirische Untersuchung Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung
Zum Wandel der Fremd- und Selbstdarstellung in Heirats- und Kontaktanzeigen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine empirische Untersuchung Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung
Stratégie nationale Addictions
 Département fédéral de l intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Santé publique Stratégie nationale Addictions 2017 2024 Schadensminderung mögliche Entwicklungsschritte
Département fédéral de l intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Santé publique Stratégie nationale Addictions 2017 2024 Schadensminderung mögliche Entwicklungsschritte
Probleme und Ressourcen bestimmen und begründen
 Probleme und Ressourcen bestimmen und begründen Kaspar Geiser, Prof. FH, Zürich Katja Schlüter, MSA, Sozialreferat München Ausführungen anlässlich der Tagung Soziale Diagnostik und Klassifikation 6. und
Probleme und Ressourcen bestimmen und begründen Kaspar Geiser, Prof. FH, Zürich Katja Schlüter, MSA, Sozialreferat München Ausführungen anlässlich der Tagung Soziale Diagnostik und Klassifikation 6. und
Das inklusive Konzept der Montessori-Pädagogik und das Menschenrecht auf Bildung für Behinderte
 Pädagogik Eva Herrmann Das inklusive Konzept der Montessori-Pädagogik und das Menschenrecht auf Bildung für Behinderte Ein mögliches Vorbild für ein deutsches inklusives Bildungssystem Studienarbeit Inhalt
Pädagogik Eva Herrmann Das inklusive Konzept der Montessori-Pädagogik und das Menschenrecht auf Bildung für Behinderte Ein mögliches Vorbild für ein deutsches inklusives Bildungssystem Studienarbeit Inhalt
Wieviel Gesundheitsförderung macht das Präventionsgesetz möglich?
 Wieviel Gesundheitsförderung macht das Präventionsgesetz möglich? Kritische Anmerkungen aus der Perspektive von Public Health Kassel 06.07.2016 Prof. Dr. Beate Blättner Kritische Anmerkungen aus Public
Wieviel Gesundheitsförderung macht das Präventionsgesetz möglich? Kritische Anmerkungen aus der Perspektive von Public Health Kassel 06.07.2016 Prof. Dr. Beate Blättner Kritische Anmerkungen aus Public
Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld
 Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Rasmus Beckmann, M.A. Universität zu Köln. Liberalismus. Lehrstuhl für Internationale Politik und Außenpolitik Prof. Dr.
 Rasmus Beckmann, M.A. Liberalismus Lehrstuhl für Internationale Politik und Außenpolitik Prof. Dr. Thomas Jäger Leitfragen 1. Nennen Sie drei theoretische Perspektiven zur Analyse der internationalen Beziehungen?
Rasmus Beckmann, M.A. Liberalismus Lehrstuhl für Internationale Politik und Außenpolitik Prof. Dr. Thomas Jäger Leitfragen 1. Nennen Sie drei theoretische Perspektiven zur Analyse der internationalen Beziehungen?
Die Wirksamkeit von Verhaltens- und Verhältnisprävention in verschiedenen Settings
 Die Wirksamkeit von Verhaltens- und Verhältnisprävention in verschiedenen Settings Dipl.-Psych. Daniela Piontek 4. Nordrhein-Westfälischer Kooperationstag Sucht und Drogen Dortmund, 12. 09. 2007 Gliederung
Die Wirksamkeit von Verhaltens- und Verhältnisprävention in verschiedenen Settings Dipl.-Psych. Daniela Piontek 4. Nordrhein-Westfälischer Kooperationstag Sucht und Drogen Dortmund, 12. 09. 2007 Gliederung
Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung)
 Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung) Recht auf Bildung Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Bildung soll auf die volle Entfaltung der Persönlichkeit, der
Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung) Recht auf Bildung Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Bildung soll auf die volle Entfaltung der Persönlichkeit, der
Entstehung und Verlauf des Forschungsprojekts...7
 Inhaltsverzeichnis 1. Entstehung und Verlauf des Forschungsprojekts...7 2. Der Elternfragebogen... 10 2.1 Das methodische Vorgehen... 10 2.2 Die Ergebnisse des Elternfragebogens... 12 2.2.1 Trägerschaft
Inhaltsverzeichnis 1. Entstehung und Verlauf des Forschungsprojekts...7 2. Der Elternfragebogen... 10 2.1 Das methodische Vorgehen... 10 2.2 Die Ergebnisse des Elternfragebogens... 12 2.2.1 Trägerschaft
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die Herausforderungen an Unterstützung für Menschen mit Behinderungen
 Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die Herausforderungen an Unterstützung für Menschen mit Behinderungen --------------------------------------------------------------------------
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die Herausforderungen an Unterstützung für Menschen mit Behinderungen --------------------------------------------------------------------------
DAS PROGRAMM VON DZO ZAJEDNICA SUSRET
 DAS PROGRAMM VON DZO ZAJEDNICA SUSRET DAS PROGRAMM Das Programm von DZO Zajednica Susret ist auf den therapeutishen Programm Projekt Mensch basiert. Die Wörter Projekt und Mensch bringen den Kern des Programmes
DAS PROGRAMM VON DZO ZAJEDNICA SUSRET DAS PROGRAMM Das Programm von DZO Zajednica Susret ist auf den therapeutishen Programm Projekt Mensch basiert. Die Wörter Projekt und Mensch bringen den Kern des Programmes
Gesundheit von Menschen mit Behinderung Die Menschenrechtsperspektive. Vergessene Patienten, Düsseldorf, 17. April 2013 Susanne Schwalen 1
 Vergessene Patienten, Düsseldorf, 17. April 2013 Susanne Schwalen 1 Vergessene Patienten, Düsseldorf, 17. April 2013 Susanne Schwalen 2 Prof. Dr. med. Susanne Schwalen Geschäftsführende Ärztin der Ärztekammer
Vergessene Patienten, Düsseldorf, 17. April 2013 Susanne Schwalen 1 Vergessene Patienten, Düsseldorf, 17. April 2013 Susanne Schwalen 2 Prof. Dr. med. Susanne Schwalen Geschäftsführende Ärztin der Ärztekammer
Stadt Luzern. Leitsätze. Kinder-, Jugend- und Familienpolitik. Stadtrat
 Stadt Luzern Stadtrat Leitsätze Kinder-, Jugend- und Familienpolitik Juni 2014 Leitsätze der Kinder-, Jugend- und Familienpolitik Die Stadt Luzern setzt sich mit ihrer Kinder-, Jugend- und Familienpolitik
Stadt Luzern Stadtrat Leitsätze Kinder-, Jugend- und Familienpolitik Juni 2014 Leitsätze der Kinder-, Jugend- und Familienpolitik Die Stadt Luzern setzt sich mit ihrer Kinder-, Jugend- und Familienpolitik
Optionaler QB Inklusion Arbeitshilfe LKQT / Juli 2016
 Optionaler QB Arbeitshilfe LKQT / Juli 2016 Definition ist ein Konzept, das allen Personen eine gleichberechtigte und gleichwertige Teilhabe an allen gesellschaftlichen Prozessen ermöglichen soll. ist
Optionaler QB Arbeitshilfe LKQT / Juli 2016 Definition ist ein Konzept, das allen Personen eine gleichberechtigte und gleichwertige Teilhabe an allen gesellschaftlichen Prozessen ermöglichen soll. ist
Vorlage für eine individuelle Lernzielvereinbarung im Modul zur Erlangung der staatlichen Anerkennung
 Vorlage für eine individuelle Lernzielvereinbarung im Modul zur Erlangung der staatlichen Anerkennung Name der Einrichtung Träger Name der Praxisanleitung Name des / der Studierenden Der vorliegende Entwurf
Vorlage für eine individuelle Lernzielvereinbarung im Modul zur Erlangung der staatlichen Anerkennung Name der Einrichtung Träger Name der Praxisanleitung Name des / der Studierenden Der vorliegende Entwurf
S o S Sozialraumorientierte Suchthilfe
 S o S Sozialraumorientierte Suchthilfe Findet der Mensch nicht das System, so muss das System die Menschen finden! Modellprojekt mit Unterstützung des Landes Hessen Sucht/Abhängigkeit Die Weltgesundheitsorganisation
S o S Sozialraumorientierte Suchthilfe Findet der Mensch nicht das System, so muss das System die Menschen finden! Modellprojekt mit Unterstützung des Landes Hessen Sucht/Abhängigkeit Die Weltgesundheitsorganisation
Erklärung von Hermann Gröhe, Gesundheitsminister Mitglied des Deutschen Bundestags
 Erklärung von Hermann Gröhe, Gesundheitsminister Mitglied des Deutschen Bundestags anlässlich des Hochrangigen Ministertreffens auf VN-Ebene zu HIV/AIDS vom 8. 10. Juni 2016 in New York - 2 - - 2 - Sehr
Erklärung von Hermann Gröhe, Gesundheitsminister Mitglied des Deutschen Bundestags anlässlich des Hochrangigen Ministertreffens auf VN-Ebene zu HIV/AIDS vom 8. 10. Juni 2016 in New York - 2 - - 2 - Sehr
Handbuch für das Erstellen einer Diplomarbeit an Höheren Fachschulen
 Handbuch für das Erstellen einer Diplomarbeit an Höheren Fachschulen Autorin Monika Urfer-Schumacher Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abstract 4 Eigenständigkeitserklärung 5 Begriffsklärungen 6 1
Handbuch für das Erstellen einer Diplomarbeit an Höheren Fachschulen Autorin Monika Urfer-Schumacher Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abstract 4 Eigenständigkeitserklärung 5 Begriffsklärungen 6 1
Theorie und Geschichte der Gestaltung 2.
 Theorie und Geschichte der Gestaltung 2. Von Louisa Wettlaufer Design und Verantwortung Design umgibt uns überall, nie war es mehr im Trend und hatte einen höheren Stellenwert als heute. Verständlich,
Theorie und Geschichte der Gestaltung 2. Von Louisa Wettlaufer Design und Verantwortung Design umgibt uns überall, nie war es mehr im Trend und hatte einen höheren Stellenwert als heute. Verständlich,
Bedeutungen und Sinnzusammenhänge von Teilhabe
 15 Bedeutungen und Sinnzusammenhänge von Teilhabe Im Jahr 2001 wurde im Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) der Begriff Teilhabe eingeführt. Wie in Gesetzen üblich, wurde der neue Begriff Teilhabe nicht
15 Bedeutungen und Sinnzusammenhänge von Teilhabe Im Jahr 2001 wurde im Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) der Begriff Teilhabe eingeführt. Wie in Gesetzen üblich, wurde der neue Begriff Teilhabe nicht
Soll es ein Menschenrecht auf Demokratie geben?
 Soll es ein Menschenrecht auf Demokratie geben? ASAE Alumni Ethik-Höck im Zentrum Karl der Grosse Zürich, 8. Februar 2016 Anita Horn (anita.horn@philos.uzh.ch) 2/9/16 Page 1 Ablauf ² Demokratische Übung
Soll es ein Menschenrecht auf Demokratie geben? ASAE Alumni Ethik-Höck im Zentrum Karl der Grosse Zürich, 8. Februar 2016 Anita Horn (anita.horn@philos.uzh.ch) 2/9/16 Page 1 Ablauf ² Demokratische Übung
Inklusion als (Menschen-)Recht?! Input bei der Netzwerkversammlung des Bundesforums Familie 19. September 2014
 Inklusion als (Menschen-)Recht?! Input bei der Netzwerkversammlung des Bundesforums Familie 19. September 2014 Inklusion als Rechtsbegriff Rechtsbegriffe im engeren Sinn sind juristisch unmittelbar von
Inklusion als (Menschen-)Recht?! Input bei der Netzwerkversammlung des Bundesforums Familie 19. September 2014 Inklusion als Rechtsbegriff Rechtsbegriffe im engeren Sinn sind juristisch unmittelbar von
LBISucht seit 1972 und AKIS seit 2000 beide am Anton-Proksch-Institut in Wien Kalksburg Zielsetzungen: Forschung in allen Bereichen der Sucht Wissensc
 Pubertät und Suchtprävention Ulrike Kobrna Gym. Wieden Suchtprävention 1 Kobrna 18.05.2009 LBISucht seit 1972 und AKIS seit 2000 beide am Anton-Proksch-Institut in Wien Kalksburg Zielsetzungen: Forschung
Pubertät und Suchtprävention Ulrike Kobrna Gym. Wieden Suchtprävention 1 Kobrna 18.05.2009 LBISucht seit 1972 und AKIS seit 2000 beide am Anton-Proksch-Institut in Wien Kalksburg Zielsetzungen: Forschung
Vielfalt gestalten - Behindert uns unsere Vorstellung von Behinderung?
 Harms, 06.05.2013 Vielfalt gestalten - Behindert uns unsere Vorstellung von Behinderung? A. Schwager/22.04.2016 Behinderung Wer oder Was behindert? Gliederung: Zum Menschenbild behinderter Menschen in
Harms, 06.05.2013 Vielfalt gestalten - Behindert uns unsere Vorstellung von Behinderung? A. Schwager/22.04.2016 Behinderung Wer oder Was behindert? Gliederung: Zum Menschenbild behinderter Menschen in
Inklusion - nur ein Märchen?
 Pädagogik Regina Weber Inklusion - nur ein Märchen? Examensarbeit Inklusion nur ein Märchen? Schriftliche Hausarbeit mit Video-Anhang im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für Sonderpädagogik,
Pädagogik Regina Weber Inklusion - nur ein Märchen? Examensarbeit Inklusion nur ein Märchen? Schriftliche Hausarbeit mit Video-Anhang im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für Sonderpädagogik,
Die Textilbranche als Teil der Konsumgesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung: Eine Analyse. Bachelorarbeit
 Die Textilbranche als Teil der Konsumgesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung: Eine Analyse Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft
Die Textilbranche als Teil der Konsumgesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung: Eine Analyse Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft
Schritte zu einer kohärenten Suchtpolitik
 Schritte zu einer kohärenten Suchtpolitik Bundesdrogenkongress Bremen, 14. Mai 2012 Markus Jann, Bundesamt für Gesundheit, Schweiz Überblick >> Sucht davon ist die Rede >> Suchtformen >> Von der Drogenpolitik
Schritte zu einer kohärenten Suchtpolitik Bundesdrogenkongress Bremen, 14. Mai 2012 Markus Jann, Bundesamt für Gesundheit, Schweiz Überblick >> Sucht davon ist die Rede >> Suchtformen >> Von der Drogenpolitik
IFW Symposium Inklusion oder Illusion?!
 Vortrag zum IFW Symposium oder Illusion?! Freitag, 21.03.2014 17:00 19:00 Uhr Annika Bohn Sozialwissenschaftlerin M.A. Annika Bohn 26 Jahre alt, verheiratet und Mutter einer Tochter Sozialwissenschaftlerin
Vortrag zum IFW Symposium oder Illusion?! Freitag, 21.03.2014 17:00 19:00 Uhr Annika Bohn Sozialwissenschaftlerin M.A. Annika Bohn 26 Jahre alt, verheiratet und Mutter einer Tochter Sozialwissenschaftlerin
Junge Menschen für das Thema Alter interessieren und begeistern Lebenssituation von älteren, hochaltrigen und pflegebedürftigen Menschen verbessern
 Stefanie Becker Vorgeschichte Die Geschichte der Gerontologie ist eine lange und von verschiedenen Bewegungen gekennzeichnet Das Leben im (hohen) Alter wird mit steigender Lebenserwartung komplexer und
Stefanie Becker Vorgeschichte Die Geschichte der Gerontologie ist eine lange und von verschiedenen Bewegungen gekennzeichnet Das Leben im (hohen) Alter wird mit steigender Lebenserwartung komplexer und
Diagnostik zwischen Disziplin, Profession und Organisation, oder:
 Diagnostik zwischen Disziplin, Profession und Organisation, oder: Diagnostik zwischen Professionalisierung und Management Petra Gregusch, Kaspar Geiser Einleitend... Professionelle Mindestanforderungen
Diagnostik zwischen Disziplin, Profession und Organisation, oder: Diagnostik zwischen Professionalisierung und Management Petra Gregusch, Kaspar Geiser Einleitend... Professionelle Mindestanforderungen
Vorgehensweise bei der Erstellung. von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten)
 Leuphana Universität Lüneburg Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen Abt. Rechnungswesen und Steuerlehre Vorgehensweise bei der Erstellung von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten) I. Arbeitsschritte
Leuphana Universität Lüneburg Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen Abt. Rechnungswesen und Steuerlehre Vorgehensweise bei der Erstellung von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten) I. Arbeitsschritte
Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement
 Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Mitbestimmt geht s mir besser! Seite 1 Leitlinien für Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Beteiligung: Marginalisierten Gruppen eine Stimme geben!
Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Mitbestimmt geht s mir besser! Seite 1 Leitlinien für Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Beteiligung: Marginalisierten Gruppen eine Stimme geben!
«Gesundheitskompetenz. Die Fakten» Wissenswerte Fakten von der WHO Dr. Jörg Haslbeck, Kompetenzzentrum Patientenbildung, Careum Forschung, Zürich
 «Gesundheitskompetenz. Die Fakten» Wissenswerte Fakten von der WHO Dr. Jörg Haslbeck, Kompetenzzentrum Patientenbildung, Careum Forschung, Zürich Fakten-Reihe der WHO «Quelle von Erkenntnissen zu Public-Health-Themen»
«Gesundheitskompetenz. Die Fakten» Wissenswerte Fakten von der WHO Dr. Jörg Haslbeck, Kompetenzzentrum Patientenbildung, Careum Forschung, Zürich Fakten-Reihe der WHO «Quelle von Erkenntnissen zu Public-Health-Themen»
Motorische Förderung von Kindern im Schulsport
 Sport Andreas Berkenkamp Motorische Förderung von Kindern im Schulsport Unter besonderer Berücksichtigung der offenen Ganztagsschule Examensarbeit Thema: Motorische Förderung von Kindern im Schulsport
Sport Andreas Berkenkamp Motorische Förderung von Kindern im Schulsport Unter besonderer Berücksichtigung der offenen Ganztagsschule Examensarbeit Thema: Motorische Förderung von Kindern im Schulsport
«Das neue Konzept definiert ein Entwicklungsmodell, mit welchem sich das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren in Bezug auf Behinderung
 12 «Das neue Konzept definiert ein Entwicklungsmodell, mit welchem sich das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren in Bezug auf Behinderung abbilden und erklären lässt.» 2Geschichte des Konzepts
12 «Das neue Konzept definiert ein Entwicklungsmodell, mit welchem sich das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren in Bezug auf Behinderung abbilden und erklären lässt.» 2Geschichte des Konzepts
Der normative Ansatz in der Stakeholder-Theorie
 Wirtschaft Marcus Habermann Der normative Ansatz in der Stakeholder-Theorie Studienarbeit Semesterarbeit Der normative Ansatz in der Stakeholder-Theorie Institut für Strategie und Unternehmensökonomik
Wirtschaft Marcus Habermann Der normative Ansatz in der Stakeholder-Theorie Studienarbeit Semesterarbeit Der normative Ansatz in der Stakeholder-Theorie Institut für Strategie und Unternehmensökonomik
Spannungsverhältnis Demokratie. Menschenrechte versus Volksrechte in der Schweiz
 Politik Mehran Zolfagharieh Spannungsverhältnis Demokratie. Menschenrechte versus Volksrechte in der Schweiz Studienarbeit Universität Potsdam Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Professur
Politik Mehran Zolfagharieh Spannungsverhältnis Demokratie. Menschenrechte versus Volksrechte in der Schweiz Studienarbeit Universität Potsdam Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Professur
Drogenkrieg in den Anden
 Kai Ambos Drogenkrieg in den Anden Rahmenbedingungen und Wirksamkeit der Drogenpolitik in den Anbauländern mit Alternativen Inhalt I. Drogen, Koka und Kokain 11 1. Drogen, Drogenproblem, -politikund -gesetzgebung
Kai Ambos Drogenkrieg in den Anden Rahmenbedingungen und Wirksamkeit der Drogenpolitik in den Anbauländern mit Alternativen Inhalt I. Drogen, Koka und Kokain 11 1. Drogen, Drogenproblem, -politikund -gesetzgebung
Erfahrungen und Herausforderungen bei der Implementation von Diagnostikinstrumenten
 Präsentation an der Jahrestagung 2013 des Vereins klinische Sozialarbeit Schweiz, Zürich, 13. November 2013 Cornelia Rüegger, Joel Gautschi Präsentation am Kolloquium Institut Kinder- und Jugendhilfe Hochschule
Präsentation an der Jahrestagung 2013 des Vereins klinische Sozialarbeit Schweiz, Zürich, 13. November 2013 Cornelia Rüegger, Joel Gautschi Präsentation am Kolloquium Institut Kinder- und Jugendhilfe Hochschule
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung
 Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
Definitionen Konflikte Probleme
 Definitionen Konflikte Probleme Definitionen haben die Aufgabe, festzulegen/abzugrenzen, was mit einem Sachverhalt gemeint ist Definitionen führen Begriffe auf bekannte Begriffe zurück Z.B. Schimmel =
Definitionen Konflikte Probleme Definitionen haben die Aufgabe, festzulegen/abzugrenzen, was mit einem Sachverhalt gemeint ist Definitionen führen Begriffe auf bekannte Begriffe zurück Z.B. Schimmel =
Soziale Arbeit mit Drogenabhängigen im Rahmen der Aids-Hilfe
 Geisteswissenschaft Michael Herwig Soziale Arbeit mit Drogenabhängigen im Rahmen der Aids-Hilfe Studienarbeit 1 1. Inhalt der Problemstellung... 3 2. Aids-Hilfe Osnabrück e.v... 5 2.1. Überblick über
Geisteswissenschaft Michael Herwig Soziale Arbeit mit Drogenabhängigen im Rahmen der Aids-Hilfe Studienarbeit 1 1. Inhalt der Problemstellung... 3 2. Aids-Hilfe Osnabrück e.v... 5 2.1. Überblick über
Die entwicklungslogische Didaktik statt Aussonderung. Simon Valentin, Martin Teubner
 Die entwicklungslogische Didaktik statt Aussonderung Simon Valentin, Martin Teubner Inhalt Begriffsdefinition Exklusion Separation Integration Inklusion Zahlen zur Integration Georg Feuser Entwicklungslogische
Die entwicklungslogische Didaktik statt Aussonderung Simon Valentin, Martin Teubner Inhalt Begriffsdefinition Exklusion Separation Integration Inklusion Zahlen zur Integration Georg Feuser Entwicklungslogische
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse
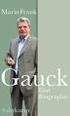 Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
Gerontologie in 25 Jahren
 Wissenschaftliches Symposium Gerontologie in 25 Jahren anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Studiengangs (Psycho)Gerontologie der Universität Erlangen-Nürnberg Hartmut Meyer-Wolters, Geragogik: Von
Wissenschaftliches Symposium Gerontologie in 25 Jahren anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Studiengangs (Psycho)Gerontologie der Universität Erlangen-Nürnberg Hartmut Meyer-Wolters, Geragogik: Von
TEIL A GRUNDLAGENTHEORETISCHER BEZUGSRAHMEN.. 9
 Inhaltsverzeichnis TEIL A GRUNDLAGENTHEORETISCHER BEZUGSRAHMEN.. 9 I Einleitung... 9 1 Prolog Ausgangsüberlegungen... 9 1.1 Inhaltliche Vorüberlegungen... 9 1.2 Paradigmatische Vorüberlegungen... 14 2
Inhaltsverzeichnis TEIL A GRUNDLAGENTHEORETISCHER BEZUGSRAHMEN.. 9 I Einleitung... 9 1 Prolog Ausgangsüberlegungen... 9 1.1 Inhaltliche Vorüberlegungen... 9 1.2 Paradigmatische Vorüberlegungen... 14 2
Arche Fachstelle für Integration. Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags
 Arche Fachstelle für Integration Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags Inhaltsverzeichnis 1 // EINLEITUNG 2 // ZIELGRUPPE 3 // Ziele 4 // Angebote 5 // ORGANISATION, STEUERUNG UND
Arche Fachstelle für Integration Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags Inhaltsverzeichnis 1 // EINLEITUNG 2 // ZIELGRUPPE 3 // Ziele 4 // Angebote 5 // ORGANISATION, STEUERUNG UND
Fachtagung des Caritasverbands in Frankfurt
 Fachtagung des Caritasverbands in Frankfurt 11.03.2014 1 zur Aktualität von Prävention und Gesundheitsförderung zwei unterschiedliche Wirkprinzipien zur Erzielung von Gesundheitsgewinn Krankheitsprävention
Fachtagung des Caritasverbands in Frankfurt 11.03.2014 1 zur Aktualität von Prävention und Gesundheitsförderung zwei unterschiedliche Wirkprinzipien zur Erzielung von Gesundheitsgewinn Krankheitsprävention
Unterschiede in der Lesemotivation bei Jungen und Mädchen in der Grundschule
 Pädagogik Larissa Drewa Unterschiede in der Lesemotivation bei Jungen und Mädchen in der Grundschule Examensarbeit Unterschiede in der Lesemotivation bei Jungen und Mädchen in der Grundschule Schriftliche
Pädagogik Larissa Drewa Unterschiede in der Lesemotivation bei Jungen und Mädchen in der Grundschule Examensarbeit Unterschiede in der Lesemotivation bei Jungen und Mädchen in der Grundschule Schriftliche
NGOs - normatives und utilitaristisches Potenzial für das Legitimitätsdefizit transnationaler Politik?
 Politik Sandra Markert NGOs - normatives und utilitaristisches Potenzial für das Legitimitätsdefizit transnationaler Politik? Studienarbeit Universität Stuttgart Institut für Sozialwissenschaften Abteilung
Politik Sandra Markert NGOs - normatives und utilitaristisches Potenzial für das Legitimitätsdefizit transnationaler Politik? Studienarbeit Universität Stuttgart Institut für Sozialwissenschaften Abteilung
Integration - ein hehres Ziel
 Geisteswissenschaft Anonym Integration - ein hehres Ziel Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Grundlagen zur Thematisierung und Behandlung von Menschen mit Behinderung... 3 2.1 Definition
Geisteswissenschaft Anonym Integration - ein hehres Ziel Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Grundlagen zur Thematisierung und Behandlung von Menschen mit Behinderung... 3 2.1 Definition
Die Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union (1997)
 Die Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union (1997) Diese Deklaration wurde von allen Mitgliedern des Europäischen Netzwerkes für betriebliche Gesundheitsförderung
Die Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union (1997) Diese Deklaration wurde von allen Mitgliedern des Europäischen Netzwerkes für betriebliche Gesundheitsförderung
Das Würfel-Modell kurz erklärt Ergänzung zum Foliensatz
 Das Würfel-Modell kurz erklärt Ergänzung zum Foliensatz 2005, www.psychoaktiv.ch 1. Der Aufbau des Würfel-Modells Folie 1 Bisher: Vier-Säulen-Modell Erste Dimension Die Schweizerische Drogenpolitik stützt
Das Würfel-Modell kurz erklärt Ergänzung zum Foliensatz 2005, www.psychoaktiv.ch 1. Der Aufbau des Würfel-Modells Folie 1 Bisher: Vier-Säulen-Modell Erste Dimension Die Schweizerische Drogenpolitik stützt
Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen
 Zeno Kupper Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen PABST SCIENCE PUBLISHERS Lengerich, Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Riga, Scottsdale (USA), Wien, Zagreb Inhaltsverzeichnis Einleitung und
Zeno Kupper Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen PABST SCIENCE PUBLISHERS Lengerich, Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Riga, Scottsdale (USA), Wien, Zagreb Inhaltsverzeichnis Einleitung und
LEITBILD DER JUGENDARBEIT REGENSDORF
 LEITBILD DER JUGENDARBEIT REGENSDORF 2013 2017 Präambel: Zur Zielgruppe der Jugendarbeit Regensdorf gehören Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 25 Jahren. Die Jugendarbeit ist ein freiwilliges
LEITBILD DER JUGENDARBEIT REGENSDORF 2013 2017 Präambel: Zur Zielgruppe der Jugendarbeit Regensdorf gehören Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 25 Jahren. Die Jugendarbeit ist ein freiwilliges
Schullehrplan Sozialwissenschaften BM 1
 Schullehrplan Sozialwissenschaften BM 1 1. Semester Wahrnehmung Emotion und Motivation Lernen und Gedächtnis Kommunikation - den Begriff der Wahrnehmung und ihre verschiedenen Dimensionen erklären (Sinneswahrnehmung,
Schullehrplan Sozialwissenschaften BM 1 1. Semester Wahrnehmung Emotion und Motivation Lernen und Gedächtnis Kommunikation - den Begriff der Wahrnehmung und ihre verschiedenen Dimensionen erklären (Sinneswahrnehmung,
Der Labeling Approach
 Geisteswissenschaft Feryal Kor Der Labeling Approach Studienarbeit 1. Einleitung In jeglichen Gesellschaftsformen leben die unterschiedlichsten Individuen, welche vielfältige und unterschiedliche Verhaltensweisen
Geisteswissenschaft Feryal Kor Der Labeling Approach Studienarbeit 1. Einleitung In jeglichen Gesellschaftsformen leben die unterschiedlichsten Individuen, welche vielfältige und unterschiedliche Verhaltensweisen
voja Projekt ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung
 1 voja Projekt ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung Wie kommt die voja dazu ein Projekt zu Ernährung und Bewegung zu machen? Wieso sollte das Thema Ernährung und Bewegung nun für die OKJA relevant
1 voja Projekt ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung Wie kommt die voja dazu ein Projekt zu Ernährung und Bewegung zu machen? Wieso sollte das Thema Ernährung und Bewegung nun für die OKJA relevant
Wirkung zeigen. Anna Hegedüs
 U N I V E R S I TÄRE P S YCHIATRISCHE D I E N S TE B E R N ( U P D ) U N I V E R S I TÄTSKLINIK F Ü R P S YCHIATRIE U N D P S YCHOTHERAPIE D I R E K T I O N P F L E G E U N D P ÄD AGOGIK Abteilung Forschung/Entwicklung
U N I V E R S I TÄRE P S YCHIATRISCHE D I E N S TE B E R N ( U P D ) U N I V E R S I TÄTSKLINIK F Ü R P S YCHIATRIE U N D P S YCHOTHERAPIE D I R E K T I O N P F L E G E U N D P ÄD AGOGIK Abteilung Forschung/Entwicklung
Der Neorealismus von K.Waltz zur Erklärung der Geschehnisse des Kalten Krieges
 Politik Manuel Stein Der Neorealismus von K.Waltz zur Erklärung der Geschehnisse des Kalten Krieges Studienarbeit Inhalt 1. Einleitung 1 2. Der Neorealismus nach Kenneth Waltz 2 3. Der Kalte Krieg 4 3.1
Politik Manuel Stein Der Neorealismus von K.Waltz zur Erklärung der Geschehnisse des Kalten Krieges Studienarbeit Inhalt 1. Einleitung 1 2. Der Neorealismus nach Kenneth Waltz 2 3. Der Kalte Krieg 4 3.1
Selbstorganisation und Empowerment im Alter
 Selbstorganisation und Empowerment im Alter Roger Keller und Esther Kirchhoff, PH Zürich Martina Rissler und Jessica Schnelle, MGB Netzwerk-Tagung vom 15. Oktober 2013, Zürich Ein typischer Satz zum Selbstverständnis
Selbstorganisation und Empowerment im Alter Roger Keller und Esther Kirchhoff, PH Zürich Martina Rissler und Jessica Schnelle, MGB Netzwerk-Tagung vom 15. Oktober 2013, Zürich Ein typischer Satz zum Selbstverständnis
Probleme und Folgen der Prohibition aus strafrechtlicher Sicht. Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf Universität Würzburg
 Probleme und Folgen der Prohibition aus strafrechtlicher Sicht Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf Universität Würzburg Resolution deutscher Strafrechtsprofessorinnen und professoren an die Abgeordneten des
Probleme und Folgen der Prohibition aus strafrechtlicher Sicht Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf Universität Würzburg Resolution deutscher Strafrechtsprofessorinnen und professoren an die Abgeordneten des
Erfahrungen im Handlungsfeld Gerontopsychiatrie
 Direktion Pflege, Therapien und Soziale Arbeit Klinik für Alterspsychiatrie Erfahrungen im Handlungsfeld Gerontopsychiatrie Workshop ANP Kongress Linz Freyer, Sonja M.Sc. APN Gliederung Vorstellung Begriffsdefinitionen
Direktion Pflege, Therapien und Soziale Arbeit Klinik für Alterspsychiatrie Erfahrungen im Handlungsfeld Gerontopsychiatrie Workshop ANP Kongress Linz Freyer, Sonja M.Sc. APN Gliederung Vorstellung Begriffsdefinitionen
Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft. Wahlpflichtbereich Soziale Arbeit. Modul-Handbuch
 Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft Wahlpflichtbereich Soziale Arbeit Modul-Handbuch Stand 01.02.2014 Modul I: Einführung und Grundlagen Soziale Arbeit 1 Semester 3. Semester 6 180 h 1 Einführung
Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft Wahlpflichtbereich Soziale Arbeit Modul-Handbuch Stand 01.02.2014 Modul I: Einführung und Grundlagen Soziale Arbeit 1 Semester 3. Semester 6 180 h 1 Einführung
Geschichtliche Entwicklung und aktuelle Situation in der Substitutionsbehandlung Opioidabhängiger? Thomas Lüddeckens
 Geschichtliche Entwicklung und aktuelle Situation in der Substitutionsbehandlung Opioidabhängiger? Thomas Lüddeckens Gliederung 1. Einleitung 2. Entwicklung der Drogenpolitik in der Schweiz 3. Das Vier-Säulen-Modell
Geschichtliche Entwicklung und aktuelle Situation in der Substitutionsbehandlung Opioidabhängiger? Thomas Lüddeckens Gliederung 1. Einleitung 2. Entwicklung der Drogenpolitik in der Schweiz 3. Das Vier-Säulen-Modell
Unterstützung von Angehörigen von Menschen mit Behinderungen
 Unterstützung von Angehörigen von Menschen mit Behinderungen Zusammenfassung In der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen geht es um die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen.
Unterstützung von Angehörigen von Menschen mit Behinderungen Zusammenfassung In der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen geht es um die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen.
Landwirtschaftliche Exportproduktion in Entwicklungsländern
 Geographie Larissa Glück Landwirtschaftliche Exportproduktion in Entwicklungsländern Studienarbeit Gliederung 1 Einleitung... 1 1.1 Abstrakt... 1 1.2 Der Begriff Entwicklung... 1 2 Exportproduktion von
Geographie Larissa Glück Landwirtschaftliche Exportproduktion in Entwicklungsländern Studienarbeit Gliederung 1 Einleitung... 1 1.1 Abstrakt... 1 1.2 Der Begriff Entwicklung... 1 2 Exportproduktion von
Leitbild Pflege Uniklinik Balgrist Forchstrasse Zürich Tel Fax
 Leitbild Pflege Leitbild Pflege In Bewegung auf dem Weg. Der Pflegedienst der Uniklinik Balgrist orientiert sich an der Unternehmensstrategie der Gesamtklinik. Wir verstehen uns als gleichwertigen Partner
Leitbild Pflege Leitbild Pflege In Bewegung auf dem Weg. Der Pflegedienst der Uniklinik Balgrist orientiert sich an der Unternehmensstrategie der Gesamtklinik. Wir verstehen uns als gleichwertigen Partner
Kapitel 2, Führungskräftetraining, Kompetenzentwicklung und Coaching:
 Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom
 Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 20.04.2016 zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsrechts GKV-Spitzenverband Reinhardtstraße 28, 10117 Berlin Telefon 030
Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 20.04.2016 zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsrechts GKV-Spitzenverband Reinhardtstraße 28, 10117 Berlin Telefon 030
Nachhaltigkeitsökonomik: Prinzipien
 Nachhaltigkeitsökonomik: Prinzipien What is sustainabilty economics? - Baumgärtner/ Quass Towards sustainability economics: principles and values - Söderbaum Eden Asfaha und Vera Fuchs 11.11.2014 Gliederung
Nachhaltigkeitsökonomik: Prinzipien What is sustainabilty economics? - Baumgärtner/ Quass Towards sustainability economics: principles and values - Söderbaum Eden Asfaha und Vera Fuchs 11.11.2014 Gliederung
Eine Pädagogik der Inklusion
 Dr. Gabriele Knapp Eine Pädagogik der Inklusion die Prämisse der Vielfalt als pädagogischer Ansatz in der Jugendsozialarbeit Impulsreferat in FORUM 4 auf der Fachtagung Thüringen braucht dich 20 Jahre
Dr. Gabriele Knapp Eine Pädagogik der Inklusion die Prämisse der Vielfalt als pädagogischer Ansatz in der Jugendsozialarbeit Impulsreferat in FORUM 4 auf der Fachtagung Thüringen braucht dich 20 Jahre
Evidenzbasierte Pflegegespräche in der Frührehabilitation- Erfahrungen aus der Praxis
 Evidenzbasierte Pflegegespräche in der Frührehabilitation- Erfahrungen aus der Praxis SAR-Forum 19. 5. 2011 Anita Stooss BScN Pflegeexpertin Frührehabilitation Rehabilitationszentrum Kinderspital Zürich
Evidenzbasierte Pflegegespräche in der Frührehabilitation- Erfahrungen aus der Praxis SAR-Forum 19. 5. 2011 Anita Stooss BScN Pflegeexpertin Frührehabilitation Rehabilitationszentrum Kinderspital Zürich
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
 Prof. Dr. Fritz Unger Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre November 2015 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IM FERNSTUDIENGANG UNTERNEHMENSFÜHRUNG Modul 1 Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen 1.1
Prof. Dr. Fritz Unger Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre November 2015 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IM FERNSTUDIENGANG UNTERNEHMENSFÜHRUNG Modul 1 Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen 1.1
3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung
 Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
Code of Conduct Compliance. Verhaltensrichtlinien für die Vöhringer GmbH & Co. KG. und. ihre Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner
 Code of Conduct Compliance Verhaltensrichtlinien für die Vöhringer GmbH & Co. KG und ihre Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner. 31.03.2012 1. Einleitung Vöhringer ist ein international tätiges Unternehmen
Code of Conduct Compliance Verhaltensrichtlinien für die Vöhringer GmbH & Co. KG und ihre Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner. 31.03.2012 1. Einleitung Vöhringer ist ein international tätiges Unternehmen
Suchtpräventive Aufgaben in der Drogenpolitik
 Brennpunkt Drogenpolitik Suchtpräventive Aufgaben in der Drogenpolitik Fachtagung 2005 (Schloss Seggau) Dr. Rainer Schmidbauer Aufbau des Impulsreferats Definitionen Zusammenhang zwischen Suchtprävention
Brennpunkt Drogenpolitik Suchtpräventive Aufgaben in der Drogenpolitik Fachtagung 2005 (Schloss Seggau) Dr. Rainer Schmidbauer Aufbau des Impulsreferats Definitionen Zusammenhang zwischen Suchtprävention
Europäische Netzwerke für psychische Gesundheit
 Europäische Netzwerke für psychische Gesundheit Darstellung an Hand von Mental Health Europe Rita Donabauer Voraussetzung für psychische Gesundheit In Kontakt sein Kommunikation Teil eines sozialen Ganzen
Europäische Netzwerke für psychische Gesundheit Darstellung an Hand von Mental Health Europe Rita Donabauer Voraussetzung für psychische Gesundheit In Kontakt sein Kommunikation Teil eines sozialen Ganzen
Stefan Müller-Teusler
 und wozu brauchen wir sie? meint das Nachdenken über Handlungen und Sitten beschäftigt sich mit der Reflexion sittlicher Phänomene und damit mit Fragen nach dem SOLLEN im Blickpunkt: die rechte Normierung
und wozu brauchen wir sie? meint das Nachdenken über Handlungen und Sitten beschäftigt sich mit der Reflexion sittlicher Phänomene und damit mit Fragen nach dem SOLLEN im Blickpunkt: die rechte Normierung
Diversifikation und Kernkompetenzen
 Wirtschaft Markus Klüppel Diversifikation und Kernkompetenzen Masterarbeit RheinAhrCampus Remagen Fachbereich: Betriebs- und Sozialwirtschaft Studiengang: MBA Masterthesis Diversifikation und Kernkompetenzen
Wirtschaft Markus Klüppel Diversifikation und Kernkompetenzen Masterarbeit RheinAhrCampus Remagen Fachbereich: Betriebs- und Sozialwirtschaft Studiengang: MBA Masterthesis Diversifikation und Kernkompetenzen
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Soziale Arbeit am Limit - Über konzeptionelle Begrenzungen einer Profession
 Soziale Arbeit am Limit - Über konzeptionelle Begrenzungen einer Profession Prof. Dr. phil. habil. Carmen Kaminsky FH Köln 1. Berufskongress des DBSH, 14.11.2008 Soziale Arbeit am Limit? an Grenzen stossen
Soziale Arbeit am Limit - Über konzeptionelle Begrenzungen einer Profession Prof. Dr. phil. habil. Carmen Kaminsky FH Köln 1. Berufskongress des DBSH, 14.11.2008 Soziale Arbeit am Limit? an Grenzen stossen
2. Theoretische Grundlagen der Sozialstrukturanalyse
 2. Theoretische Grundlagen der Sozialstrukturanalyse 2.1. Sozialstruktur und soziale Ungleichheit - Soziologie ist eine Wissenschaft, die kollektive (agreggierte) soziale Phänomene beschreiben und erklären
2. Theoretische Grundlagen der Sozialstrukturanalyse 2.1. Sozialstruktur und soziale Ungleichheit - Soziologie ist eine Wissenschaft, die kollektive (agreggierte) soziale Phänomene beschreiben und erklären
Vom Morphin zur Substitution
 Diplomica Verlag Gerhard Haller Vom Morphin zur Substitution Die historische und gesellschaftliche Kontroverse zur Substitution Opiatabhängiger Gerhard Haller Vom Morphin zur Substitution Die historische
Diplomica Verlag Gerhard Haller Vom Morphin zur Substitution Die historische und gesellschaftliche Kontroverse zur Substitution Opiatabhängiger Gerhard Haller Vom Morphin zur Substitution Die historische
Was ist Gesundheit? Teil 1a: Theorien von
 Was ist Gesundheit? Teil 1a: Theorien von von Gesundheit und Krankheit VO SS 2009, 24.3.2009 Univ.Doz. Mag. Dr. Wolfgang Dür W. Dür, VO SS 2009 Gesundheit Gesundheit/Krankheit in verschiedenen Perspektiven
Was ist Gesundheit? Teil 1a: Theorien von von Gesundheit und Krankheit VO SS 2009, 24.3.2009 Univ.Doz. Mag. Dr. Wolfgang Dür W. Dür, VO SS 2009 Gesundheit Gesundheit/Krankheit in verschiedenen Perspektiven
Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern
 Geographie Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern Noch geprägt vom Erbe der DDR? Studienarbeit RWTH Aachen 6.4.2011 Geographisches Institut Lehrstuhl für Wirtschaftgeographie Regionalseminar:
Geographie Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern Noch geprägt vom Erbe der DDR? Studienarbeit RWTH Aachen 6.4.2011 Geographisches Institut Lehrstuhl für Wirtschaftgeographie Regionalseminar:
Interkulturelles Marketing - Werbesprache in Deutschland und Frankreich
 Sprachen Steffen Plutz Interkulturelles Marketing - Werbesprache in Deutschland und Frankreich Bachelorarbeit Justus-Liebig-Universität Gießen Institut für Romanistik Bachelorarbeit zur Erlangung des
Sprachen Steffen Plutz Interkulturelles Marketing - Werbesprache in Deutschland und Frankreich Bachelorarbeit Justus-Liebig-Universität Gießen Institut für Romanistik Bachelorarbeit zur Erlangung des
Reflexionsmodul Interdisziplinarität IV
 Reflexionsmodul Interdisziplinarität IV Kristin Maria Käuper, M.Sc. Linda Cording, M.Sc. Aisha Boettcher, M.Sc. Reflexionsmodul Interdisziplinarität IV 16.12.2015 Querschnittsmodul RI Termin Diskussion
Reflexionsmodul Interdisziplinarität IV Kristin Maria Käuper, M.Sc. Linda Cording, M.Sc. Aisha Boettcher, M.Sc. Reflexionsmodul Interdisziplinarität IV 16.12.2015 Querschnittsmodul RI Termin Diskussion
Soziale Unterstützung
 Soziale Unterstützung Professor Dr. Dr. Wolfgang Schneider Medizinische Fakultät der Universität Rostock Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Institut für Psychotherapie,
Soziale Unterstützung Professor Dr. Dr. Wolfgang Schneider Medizinische Fakultät der Universität Rostock Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Institut für Psychotherapie,
Kinder- und Jugend- Gesundheitsbericht 2010 für die Steiermark
 Kinder- und Jugend- Gesundheitsbericht 2010 für die Steiermark Gesundheitsziel: Rahmenbedingungen für ein gesundes Leben schaffen Bewusstsein im Umgang mit Alkohol in der Steiermark fördern Kapitel 17:
Kinder- und Jugend- Gesundheitsbericht 2010 für die Steiermark Gesundheitsziel: Rahmenbedingungen für ein gesundes Leben schaffen Bewusstsein im Umgang mit Alkohol in der Steiermark fördern Kapitel 17:
