Just-in-Time Teaching: Vorbereitete Studierende, maßgeschneiderte Lehre geht das?
|
|
|
- Dominic Kaufer
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Hoechstetter, Karsten: Just-in-Time Teaching: Vorbereitete Studierende, maßgeschneiderte Lehre geht das? In: MINTTENDRIN Lehre erleben Tagungsband zum 1. HDMINT Symposium (Nürnberg, 07./ ), DiNa Didaktiknachrichten (ISSN ), Sonderausgabe November 2013, Seiten Workshop-Beiträge Just-in-Time Teaching: Vorbereitete Studierende, maßgeschneiderte Lehre geht das? Karsten Hoechstetter, Projekt HD MINT, Hochschule München, Abstract Die Methode Just-in-Time Teaching (JiTT) bringt in verschiedener Hinsicht Vorteile für Studierende und Dozierende mit sich: Studierende trainieren durch das eigenständige Stoffaneignen vor der Präsenzveranstaltung die Fähigkeit zum selbstständigen Lernen. Die Studierenden erhalten die Möglichkeit, dem Dozierenden Feedback über verbliebene Fragen zu geben. Der Dozierende erhält bereits vor der Lehrveranstaltung Rückmeldung darüber, zu welchen Stoffinhalten und Fragestellungen noch Klärungsbedarf besteht. Die Präsenzveranstaltung kann jenseits bloßer Stoffvermittlung gezielt Fehlvorstellungen korrigieren und tiefergehende Inhalte behandeln. Dozierende stehen der Einführung dieser Methode trotz dieser positiven Aspekte oft zunächst skeptisch gegenüber. Meine Studenten werden nie freiwillig Zeit zur Vorlesungsvorbereitung verwenden ist ein oft vorgebrachter Zweifel. In diesem Workshop sollen daher verschiedene Themen beleuchtet werden, die für eine erfolgreiche Anwendung der Methode relevant sind: Wie motiviere ich meine Studierenden zur Teilnahme? Worauf gilt es bei der Durchführung der Methode zu achten was für Tipps und Tricks gibt es, welche Fehler gilt es zu vermeiden? Gibt es rechtliche Rahmenbedingungen, die es zu beachten gibt? Gibt es aufgrund von JiTT einen zeitlichen Mehraufwand für Studierende bzw. Dozierende, und wenn ja, wie hoch ist er in etwa? Welche Erfahrungen haben Studierende und Dozierende mit der Methode gemacht? Zur Beantwortung dieser Fragen wird im Workshop zum einen über Erfahrungen aus dem laufenden HD-MINT-Projekt berichtet und Ergebnisse externer Studien angesprochen. Zum anderen soll Raum sein zum Austausch eigener Erfahrungen sowie zur Diskussion untereinander. 80
2 Was ist Just-in-Time Teaching? Die Idee Studierende, die gut vorbereitet im Hörsaal erscheinen, erwartet dort eine Präsenzveranstaltung, die auf ihre aktuellen fachlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist das ist das Szenario, das in einer auf Just-in-Time Teaching (JiTT)basierenden Lehrveranstaltung angestrebt wird. Die Methode wurde in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt [1]. Sie basiert zum einen auf der Überzeugung, dass Studierende in der Lage sind, sich neuen Stoff selbstständig anzueignen. Zum anderen ist sie das Ergebnis einer Suche nach effizienter Nutzung der Präsenzzeit, die mehr bieten soll als bloßes Vorlesen neuen Lehrstoffs im Frontalstil. Der Nutzen der Methode lässt sich in folgenden Punkten zusammenfassen: Die Studierenden trainieren die Fähigkeit zum selbstständigen Lernen, indem sie sich eigenständig in den Tagen vor der Präsenzveranstaltung vorgegebenen neuen Lernstoff aneignen. Die Studierenden erhalten die Möglichkeit, der Lehrperson bereits vor der Präsenzveranstaltung Verständnisprobleme zu signalisieren und Rückfragen zu den Lerninhalten zu stellen. Die Präsenzveranstaltung erhält für die Studierenden einen Mehrwert, denn der Dozierende kann sie nun maßgeschneidert ihrem Wissensstand und ihren Anforderungen anpassen. Die Präsenzzeit kann damit gezielt dazu verwendet werden, interaktiv Fehlvorstellungen zu korrigieren, Fragen zu klären und weiterführende Inhalte zu behandeln. Der Ablauf Just-in-Time Teaching beinhaltet zwei Kernelemente: Zum einen eigenständiges Lernen der Studierenden vor der Präsenzveranstaltung, zum anderen das kurzfristige Anpassen dieser Veranstaltung durch den Dozierenden. Eine JiTT-Einheit, die diese beiden Elemente enthält, erstreckt sich dabei typischerweise über eine Woche. Da JiTT für gewöhnlich ein Teil der Gesamtstruktur einer Lehrveranstaltung ist, schließen mehrere dieser Einheiten fortwährend über ein Semester hinweg nahtlos aneinander an. Eine Einheit besteht im Einzelnen aus folgenden Teilen (vgl. Abb. 1): Eine Woche vor der Präsenzveranstaltung stellt die Lehrperson den Studierenden Arbeitsmaterial mit neuem Lernstoff zur Verfügung. Das Arbeitsmaterial kann ein Abschnitt des Vorlesungsskripts sein, ein Kapitel eines Lehrbuchs; es sind aber auch andere Medien wie z. B. Videos verwendbar. Das Material kann entweder direkt (z. B. als Datei oder in Druckform) oder als Literaturverweis zur Verfügung gestellt werden. Zeitgleich mit dem Arbeitsmaterial erhalten die Studierenden eine Reihe von Begleitfragen, die sie bis zu einem festgelegten Abgabetermin vor der Präsenzveranstaltung (typi scherweise am Tag vorher) beantworten sollen. Diese Fragen prüfen einerseits, ob 81
3 Workshop-Beiträge Just-in-Time Teaching: Vorbereitete Studierende, maßgeschneiderte Lehre geht das? Abb. 1: Schematischer Ablauf einer JiTT-Einheit (links Ablauf ) und Detailseines konkreten Umsetzungsbeispiels (rechts Detailbeispiel, Vorlesung Technische Optik I an der Hochschule München). Tage Ablauf Arbeitsmaterial und Begleitfragen Bearbeitungszeit Abgabetermin Anpassung der Lehrveranstaltung Lehrveranstaltung Detailbeispiel 3 Lesefragen: Einfach, nah am Lesematerial Multiple Choice, automatische Bewertung durch Moodle 3 5 Verständnisfragen: Test des Stoffverständnisses Multiple Choice, Rechnung, Freitext Keine Bewertung, Auflösung in Moodle nach Bearbeitung Freitextfeld für Fragen, Kommentare, Anregungen: Beantwortung durch Dozenten in der Präsenzveranstaltung Interaktive Lehrveranstaltung: Besprechung und Diskussion von JiTT-Begleitfragen (ca. 30 min) Peer-Instruction-Einheiten zum Behandeln von aufgezeigten Fehlkonzepten (ca. 4 x 10 min) Präsentation neuer / ergänzender Stoffinhalte (ca. 20 min) das Arbeitsmaterial wirklich bearbeitet, andererseits, ob der Inhalt auf dem angestrebten Niveau verstanden wurde. Darüber hinaus erhalten die Studierenden die Möglichkeit, der Lehrperson bis zum Abgabetermin in freier Form konkrete Fragen zum Inhalt des Arbeitsmaterials zu stellen. Nach dem Abgabetermin ist es Aufgabe des Dozierenden, die folgende Präsenzveranstaltung auf Grundlage der studentischen Rückmeldungen und Fragen inhaltlich und methodisch anzupassen. Dazu gehört es beispielsweise, in der Lehrveranstaltung auf häufig geäußerte Verständnisprobleme einzugehen, einzelne Rückfragen aufzugreifen und zu beantworten, sowie mit geeigneten interaktiven Lehrmethoden (z. B. Peer Instruction) eventuell noch existierende Fehlvorstellungen und Unklarheiten zu beseitigen. Die Präsenzzeit kann damit für die Vertiefung des Verständnisses sowie für die Vermittlung weiterführender Themen verwendet werden. Worauf gilt es zu achten? 82 Wie bei jeder didaktischen Methode gibt es auch bei der Durchführung von Just-in-Time Teaching einige wichtige Dos &Don ts. Die folgenden Tipps gründen auf Erfahrungswerten und können zu einer erfolgreichen Umsetzung der Methode beitragen: Der Sinn der Methode sollte den Studierenden transparent gemacht werden: Gerade weil JiTT für Studierende auf den ersten Blick den Eindruck von Hausaufgaben und zeitlichem Mehraufwand erweckt, ist es enorm wichtig, den Studierenden den Nutzen und Mehrwert der Methode deutlich aufzuzeigen und zu kommunizieren und das am besten nicht nur zu Beginn der Lehrveranstaltung, sondern auch wiederholt während des Semesters, um die Motivation zur Teilnahme aufrecht zu erhalten:
4 JiTT bedeutet während des Semesters zwar einen gewissen zeitlichen Aufwand, führt aber dazu, dass bereits während der Vorlesungszeit aktiv gelernt wird es wird also Vorbereitungszeit vor der (üblicherweise stressbehafteten) Prüfungsphase eingespart. Durch JiTT erhält die Präsenzveranstaltung einen deutlichen Mehrwert für die Studierenden: Anstelle von bloßer Stoffpräsentation kann gezielt auf Fragen und Probleme eingegangen werden es entsteht interaktive Lehre! Internationale Studien (z. B. [2], [3])belegen den Erfolg der Methode und verweisen auf einen erhöhten Lernzuwachs und ein tieferes, besseres Verständnis der Inhalte. JiTT basiert auf gegenseitigem Feedback: Der Dozierende erfährt, wo die Verständnisprobleme der Studierenden liegen, diese wiederum erhalten Antworten auf ihre inhaltlichen Fragen. Die wechselseitige Kommunikation trägt dazu bei, dass weniger Studierende im Laufe des Semesters inhaltlich abgehängt werden. Konsequenz: Der Stoff des Arbeitsmaterials sollte nicht noch einmal im frontalen Vorlesungsstil wiederholt werden. Die Motivation, den JiTT-Auftrag (Arbeitsmaterial und Fragen) zu bearbeiten, ginge bei den Studierenden dadurch verloren, denn das vorherige eigenständige Lernen würde so aus Sicht der Studierenden unnötig werden. Es geht in der Lehrveranstaltung vielmehr darum, auf konkrete JiTT-Rückmeldungen und offengelegte Verständnisprobleme einzugehen, und darüber hinaus den durch JiTT geschaffenen zeitlichen Freiraum mit interaktiven Lehreinheiten zu füllen, um das Stoffverständnis weiter zu vertiefen. Hohe fachliche und didaktische Qualität des Arbeitsmaterials: Art und Umfang sind ein entscheidender Erfolgsfaktor der Methode: Das Material sollte angemessenes Niveau haben und detailliert genug sein, um den Studierenden zu ermöglichen, sich den Lerninhalt daraus selbstständig anzueignen. Gibt es ein gutes Lehrbuch zum Thema, kann es als Lesematerial dienen. Ist dies nicht der Fall, kann ein selbstverfasstes Vorlesungsskript verwendet werden dies sollte aber qualitativ hochwertig sein (d. h. unter anderem inhaltlich korrekt, klar formuliert, sinnvoll strukturiert, selbsterklärend). Den Studierenden erleichtert es den Umgang mit dem Arbeitsmaterial, wenn dazu explizite Lernziele formuliert sind. Der Umfang des Arbeitsmaterials sollte nicht zu hoch sein: Je nach Gewicht der Lehrveranstaltung im Semesterplan der Studierenden sowie Anzahl der ECTS-Punkte sollte als grober Richtwert für die Zeit zum Durcharbeiten inklusive Beantworten der JiTT- Testfragen ca. 45 Minuten bis max. 2 Stunden angestrebt werden. Der JiTT-Auftrag ist eine beidseitige Verpflichtung: Kernstück der Methode ist neben der studentischen Vorbereitung das Versprechen der Lehrperson an die Studierenden, auf rückgemeldete Fragen und Probleme Antworten zu geben. Dies sollte explizit während der Präsenzveranstaltung geschehen, zum Beispiel indem typische Rückmeldungen anonymisiert vorgestellt und diskutiert werden oder einzelne Fragen der Studierenden herausgegriffen und dann umfassend beantwortet werden. Nur mit der Erkenntnis, dass 83
5 Workshop-Beiträge Just-in-Time Teaching: Vorbereitete Studierende, maßgeschneiderte Lehre geht das? 84 auf ihre JiTT-Rückmeldungen eingegangen wird, ihre Arbeit also Wertschätzung erfährt, wird die Motivation der Studierenden zur Bearbeitung der wöchentlichen Aufgaben aufrechterhalten werden. Angstfreies Lernumfeld: Den Studierenden sollte die Gewissheit vermittelt werden, dass es keine dummen Fragen gibt Lernen startet immer mit Unkenntnis, jede Frage an den Dozierenden wird ernst genommen, JiTT-Teilnahme sollte keinem Studierenden einen Nachteil bringen. Den Studierenden sollten konkrete Rückmeldungen abverlangt werden und nur auf diese eingegangen werden. Allgemeine Kommentare wie Ich habe den Stoff nicht verstanden sollten nicht beantwortet werden. Ein Ziel der Methode ist es, die Studierenden dazu anzuregen, ihre Fragen und Probleme konkret zu erkennen und zu formulieren. Die folgenden Punkte sind Anregungen, die nicht den Charakter allgemeingültiger Empfehlungen haben. Sie zeigen aber Möglichkeiten auf, die sich in der praktischen Anwendung bewährt haben: Online-Lernplattform: Obwohl eine prinzipielle Umsetzung der JiTT-Prozedur auch anders denkbar ist (beispielsweise durch Verwendung von ), stellt die Verwendung einer Online-Lernplattform (z. B. Moodle, Blackboard, OLAT, LON-CAPA) eine große Vereinfachung für die Umsetzung dar, mit der eine deutliche Zeit- und Aufwandsersparnis für die Lehrperson einhergeht. Lernplattformen können Fragen automatisch korrigieren, bewerten, die Ergebnisse archivieren und in übersichtlicher Form aufbereiten. Zudem können die Studierenden nach der Abgabe ihrer Antworten unmittelbar Rückmeldung zur Richtigkeit erhalten. Art der Begleitfragen: Es kann hilfreich sein, die Begleitfragen für die Studierenden implizit oder explizit in folgende Kategorien zu unterteilen: 1. Lesekontrollfragen: Diese einfach gehaltenen Fragen testen lediglich, ob das JiTT- Arbeitsmaterial tatsächlich bearbeitet wurde. Sie können auch ohne tieferes Stoffverständnis beantwortet werden, setzen aber dennoch voraus, dass der Text gelesen (bzw. das Videomaterial angesehen etc.) wurde. Oft werden hierfür Multiple-Choice- Fragen verwendet, die von einer Lernplattform automatisch korrigiert und bewertet werden können. 2. Verständnisfragen: Hier wird tieferes Verständnis des bearbeiteten Stoffes getestet. Es kann sich sowohl um Multiple-Choice-Fragen handeln als auch um Freitext-Fragen ( Erklären Sie in eigenen Worten, warum ) oder Rechenaufgaben. Die Antworten darauf legen dem Dozierenden dar, ob der Lesestoff verstanden wurde bzw. an welcher Stelle es noch Fehlvorstellungen gibt, die es in der Präsenzveranstaltung zu beheben gilt. Insbesondere die Verständnisfragen sollten die formulierten Lernziele abfragen und damit einen relevanten Test des Stoffverständnisses für die Studierenden darstellen. 3. Offene Frage/Freitext: Die offenen Fragen Was haben Sie beim Durcharbeiten des Lesematerials noch nicht gut verstanden? Welche Fragen haben Sie an den Dozenten, was hätten Sie gern noch ausführlicher erklärt? bieten den Studierenden die
6 Möglichkeit Rückmeldung zu geben, bei welchen Inhalten noch Schwierigkeiten bestehen und welche Fragen ungeklärt geblieben sind. Wie auch die Antworten auf die Verständnisfragen bilden diese Rückmeldungen die Basis für Ihre kurzfristige Anpassung der Präsenzveranstaltung. Der Zusatz Wenn Sie keine Fragen haben, erläutern Sie bitte kurz einen Aspekt des Arbeitsmaterials, den Sie besonders interessant fanden. erfordert auch von Studierenden ohne Verständnisprobleme eine Reflexion des neu angeeigneten Stoffes. Extrinsische Motivation: Im besten Fall resultiert die Motivation der Studierenden, an den wöchentlichen JiTT-Einheiten teilzunehmen, aus der Überzeugung, dass die Methode ihnen einen Mehrwert bringt oder aus der Begeisterung und dem Interesse für das jeweilige Fachgebiet. Ein zusätzlicher extrinsischer Anreiz wie z. B. der Erwerb von Bonuspunkten für die Klausur durch die Bearbeitung des JiTT-Auftrags kann aber die Teilnahmequote erhöhen. Eine andere bewährte Variante stellt die aktive Beteiligung am JiTT als Zulassungsvoraussetzung für eine Klausur dar. Ob die jeweilige Prüfungsordnung ein entsprechendes Szenario zulässt, muss dabei allerdings im Einzelfall geprüft werden. Es kann entweder die bloße Teilnahme, d. h. die Abgabe von Antworten, als auch deren Richtigkeit bewertet werden. Letzteres empfiehlt sich aber nur bei den einfachen Lesekontrollfragen: Sie soll jeder beantworten können, der den Text gelesen hat. Richtige Beantwortung der Verständnisfragen sollte jedoch nicht verlangt werden schließlich ist die Korrektur von Fehlvorstellungen in der Präsenzveranstaltung noch Teil des Lehrkonzepts. Rahmenbedingungen Teilnehmerzahl JiTT kann in beliebig großen Lehrveranstaltungen eingesetzt werden. Natürlich wächst mit der Teilnehmerzahl die Anzahl der Rückmeldungen, die der Dozierende bei der Planung der Lehrveranstaltung berücksichtigen muss. Dennoch lässt sich selbst bei mehreren hundert Studierenden der Grundtenor des JiTT-Feedbacks recht schnell und gegebenenfalls stichprobenartig erfassen es muss nicht jede einzelne rückgemeldete Frage der Studierenden beantwortet werden. Zeitaufwand Den Zeitaufwand für die Studierenden für das Durcharbeiten des Arbeitsmaterials sowie die Beantwortung der Begleitfragen kann die Lehrperson jederzeit steuern und den spezifischen Gegebenheiten anpassen, indem sie den Umfang des Arbeitsmaterials und Anzahl sowie Schwierigkeit der Begleitfragen verändert. Wie oben erwähnt können ca. 45 Minu - ten bis 2 Stunden pro Woche als Richtwert dienen. Bei der Angabe des Zeitaufwands sollte aber auch erwähnt werden, dass sich die Studierenden durch die aktive Auseinandersetzung mit dem Lehrstoff in der Selbstlernzeit in der stressbehafteten Phase vor den Prüfungen Lernzeit sparen, denn durch die Methode wird ein Großteil des Lernstoffs bereits während des Semesters verinnerlicht. 85
7 Workshop-Beiträge Just-in-Time Teaching: Vorbereitete Studierende, maßgeschneiderte Lehre geht das? Der Mehraufwand für den Dozierenden resultiert aus der Erstellung des Arbeitsmaterials, der Erstellung geeigneter Begleitfragen, der Auswertung des JiTT-Feedbacks nach dem Abgabetermin und der inhaltlichen und didaktischen Anpassung der darauf folgenden Präsenzveranstaltung. Mit zunehmender praktischer Erfahrung mit der Methode verkürzt sich diese Zeit. Im ersten Semester kann man als Lehrperson aber sicher mit bis zu einem Arbeitstag Aufwand pro Lehrveranstaltung und Woche rechnen. Ein Anwendungsbeispiel aus dem HD-MINT-Projekt 86 Im Rahmen des Projekts HD MINT wurde JiTT an mehreren Hochschulen für angewandte Wissenschaften (Nürnberg, Rosenheim, Weihenstephan-Triesdorf, München) angewandt. Exemplarisch wird im Folgenden von den Erfahrungen bei der Umsetzung der Methode in der Veranstaltung Technische Optik I (Dozierende Prof. Ines Nikolaus) an der Hochschule München im Sommersemester 2013 berichtet. Dabei handelt es sich um eine Lehrveranstaltung für Studierende im zweiten Semester der Bachelor-Studiengänge Mechatronik/Feinwerktechnik sowie Augenoptik und Optometrie. Die Details des JiTT-Ablaufs entsprechen dem Detailbeispiel in Abb. 1 rechts. Die Vorlesung wurde von einem Moodle-Kurs begleitet, zu dem 208 Studierende eingeschrieben waren. Darunter befanden sich auch Studierende höherer Semester, die als Wiederholer nicht aktiv am Vorlesungsbetrieb teilnahmen, sondern lediglich die Klausur am Ende des Semesters mitschrieben. Die Studierenden hatten nach ca. zwei Dritteln des Semesters einen schriftlichen Leistungsnachweis zu absolvieren, der zu 25 % in die Gesamtnote einging, während die schriftliche Klausur am Semesterende die verbleibenden 75 % beitrug. Auf der Moodle-Plattform wurden den Studierenden einmal pro Woche Lesematerial (Ausschnitte aus dem Vorlesungsskript) sowie Begleitfragen zur Verfügung gestellt. Dabei handelte es sich sowohl um Lesekontrollfragen (Multiple Choice), Verständnisfragen und die Möglichkeit zum Freitext- Feedback (siehe oben). Die richtige Beantwortung der Lesekontrollfragen wurde mit dem Erwerb von Bonuspunkten im Leistungsnachweis belohnt: 5 Bonuspunkte wurden bei 80 % richtig beantworteten Lesekontrollfragen über das Semester hinweg vergeben, während 40 % richtige Antworten noch mit einem Bonuspunkt honoriert wurden. Diese Punkte wurden auf die Grundpunktzahl des Leistungsnachweises (72 Punkte) addiert, sodass die Studierenden durch die Bonuspunkte im optimalen Fall eine Verbesserung um zwei Notenstufen (z. B. von 2,7 auf 2,0) erreichen konnten. Mit den Antworten auf die etwas anspruchsvolleren Verständnisfragen konnten keine Bonuspunkte erworben werden. Die Quote derjenigen Studierenden, die die wöchentlichen Begleitfragen bearbeiteten, ist in Abb. 2 über das Semester hinweg dargestellt. Es sind zwei Trends zu beobachten: Zum einen war die Beteiligung an beiden Fragetypen über das Semester hinweg leicht rückläufig. Dies ging einher mit einem (auch in anderen Lehrveranstaltungen und Semestern beobachteten) leichten Rückgang an Anwesenden in der Präsenzzeit. Zum anderen lag die Anzahl beantworteter Verständnisfragen kontinuierlich ca. 15 % unter der der beantworteten Lesekontrollfragen. Dies mag zwar zum einen in der Tatsache begründet liegen, dass
8 die Lesekontrollfragen ein geringeres Anforderungsniveau hatten. Die Auswertung eines am Ende des Semesters ausgeteilten Fragebogens ergab aber auch, dass zahlreiche Studierende im Erwerb der Bonuspunkte eine wesentliche Motivation zur JiTT-Teilnahme sahen und sich wohl deshalb einige Studierende auf die Beantwortung der Lesekontrollfragen beschränkten. Dennoch zeigt das Ergebnis auch die grundsätzliche Bereitschaft zur Bearbeitung der zeitaufwändigeren Verständnisfragen, auf die während der jeweils anschließenden Präsenzveranstaltung explizit eingegangen wurde. Die extrinsische Motivation durch die Bonuspunkte stellte in dieser Vorlesung also lediglich einen zusätzlichen, nicht aber den einzigen Grund zur JiTT- Teilnahme dar. Die Studienleistungen in dieser Lehrveranstaltung wurden verglichen mit den Ergebnissen der äquivalenten Veranstaltung im Jahr 2011, die von der gleichen Dozentin ohne Verwendung von JiTT und Peer Instruction gehalten wurde. Dabei zeigte sich ein signifikant besseres Ergebnis im Leistungsnachweis im Jahr 2013 (p<0.001, Verbesserung von im Mittel 37,1 Punkten auf 43,1 Punkte [gerechnet ohne die erworbenen JiTT-Zusatzpunkte]). Die Ergebnisse der schriftlichen Klausur am Semesterende waren dagegen nicht signifikant verschieden. Eine genaue Analyse der Ursachen hierfür wird in der kommenden Zeit vorgenommen. Ein möglicher Unterschied für die ungleichen Auswirkungen von JiTT und Peer Instruction könnte aber in der unterschiedlichen Qualität der Testfragen liegen: Während die Fragen im Leistungsnachweis eher verständnisorientiert sind, liegt in der schriftlichen Klausur ein weiterer Fokus auf komplexere Rechnungen und Formelanwendungen. Die Rückmeldungen der Studierenden zur Methode waren grundsätzlich überwiegend positiv ( JiTT hilft, kontinuierlich zu lernen., Durch die Bearbeitung des Lesematerials bleibt man während des Semesters immer am Ball., Ich konnte durch die wöchentliche Vorbereitung der Vorlesung besser folgen. ). Gleichzeitig gaben einige Studierenden aber an, aufgrund der hohen zeitlichen Anforderungen in anderen Lehrveranstaltungen nicht immer die Zeit für die Bearbeitung des JiTT-Materials gefunden zu haben. Als durchschnittliche Bearbeitungszeit des JiTT-Arbeitsauftrags gaben die Studierenden im Mittel 1,4 Stunden pro Woche an. Die Dozentin bezifferte ihren eigenen Mehraufwand für die Integration von JiTT und Peer Instruction in die Vorlesung auf insgesamt rund 10 Stunden pro Woche. Im folgenden Studienjahr soll JiTT weiterhin in der Vorlesung eingesetzt werden. Der zu erwartende Vorbereitungsaufwand für die Dozentin ist dann entsprechend geringer; die noch laufende Analyse der Klausurergebnisse und studentischen Rückmeldungen soll dann dazu verwendet werden, das JiTT-Material (Lesetext sowie Begleitfragen) sowie die Struktur der Präsenzveranstaltung gegebenenfalls zu modifizieren, um studentische Zufriedenheit sowie Studienergebnisse noch weiter zu verbessern. Abb. 2: Verlauf der Teilnahmequoten an den Lesefragen und den Verständnisfragen in der Vorlesung Technische Optik I (Hoch schule München) über das Semester hinweg. 87
9 Workshop-Beiträge Just-in-Time Teaching: Vorbereitete Studierende, maßgeschneiderte Lehre geht das? Zusammenfassung und Ausblick Just-in-Time Teaching stellt einen vielversprechenden Ansatz dar, um die Effizienz von Lehrveranstaltungen, insbesondere den Nutzen der Präsenzzeit für die Studierenden, zu optimieren. Erste Anwendungen an den bayerischen Hochschulen im Rahmen des HD- MINT-Projekts zeigen ermutigende Ergebnisse, weswegen die Methode in den kommenden Semestern in weiteren Lehrveranstaltungen integriert wird. Der Einsatz wird kontinuierlich von quantitativer Forschung begleitet (Studierendenbefragungen, Analyse von Klausurergebnissen u. a.), die im Laufe der Projektzeit zur Optimierung der Anwendung der Methode und zur Dokumentation ihrer Auswirkungen führen soll. Danksagung Mein besonderer Dank gilt Frau Prof. Ines Nikolaus für die Zusammenarbeit innerhalb des HD-MINT-Projekts. Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter den Förderkennzeichen 01PL12023A bis 01PL12023G gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren. Dieser Beitrag basiert zum Teil auf dem Kapitel zum Thema Just-in-Time Teaching der Neuauflage des Buchs didaktisch und praktisch: Ideen und Methoden für die Hochschullehre (Franz Waldherr, Claudia Walter; Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart), die voraussichtlich Anfang 2014 erscheinen wird. Literatur [1] Novak, G. M., Patterson, E. T., Gavrin, A. D., Christian, W. (1999). Just-in-Time Teaching: Blending active Learning and Web Technology. Upper Saddle River, NJ, U.S.A.: Prentice Hall. [2] Formica, S. P., Easley, J. L., Spraker, M. C. (2010). Transforming common-sense beliefs into Newtonian thinking through Just-In-Time Teaching. In: Physical Review Special Topics Physics Education Research 2010, Band 6, Artikel [3] Marrs, K. A., Novak, G. (2004). Just-in-time teaching in biology: Creating an active learner classroom using the internet. In: Cell Biology Education 2004, Band 3, S
Flipped Classroom. 20 -Webinar. Jasmine Fux, 20. April 2016
 Flipped Classroom 20 -Webinar Jasmine Fux, 20. April 2016 Stellen Sie sich bitte vor Sie sind Dozent/Dozentin an einer Hochschule und betreten den Unterrichtsraum. Sie gehen an Ihr Pult, installieren Ihren
Flipped Classroom 20 -Webinar Jasmine Fux, 20. April 2016 Stellen Sie sich bitte vor Sie sind Dozent/Dozentin an einer Hochschule und betreten den Unterrichtsraum. Sie gehen an Ihr Pult, installieren Ihren
Fragebogen zur Lehrveranstaltungsevaluation Seminar
 Fragebogen zur Lehrveranstaltungsevaluation Seminar Liebe Studentinnen und Studenten, die Universität Oldenburg möchte die Situation der Lehre kontinuierlich verbessern. Dieser Fragebogen ist ein wichtiger
Fragebogen zur Lehrveranstaltungsevaluation Seminar Liebe Studentinnen und Studenten, die Universität Oldenburg möchte die Situation der Lehre kontinuierlich verbessern. Dieser Fragebogen ist ein wichtiger
Wie erleben Studierende PBL? Erfahrungen aus dem Projekt HD MINT
 Wie erleben Studierende PBL? Erfahrungen aus dem Projekt HD MINT Projekt HD MINT Erfahrungen mit PBL - Praxisbeispiele Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung Informationen Welche Struktur hat
Wie erleben Studierende PBL? Erfahrungen aus dem Projekt HD MINT Projekt HD MINT Erfahrungen mit PBL - Praxisbeispiele Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung Informationen Welche Struktur hat
Prof. Dr. Vera Meyer. Angewandte und Molekulare Mikrobiologie () Erfasste Fragebögen = 20. Auswertungsteil der geschlossenen Fragen
 Prof. Dr. Vera Meyer Angewandte und Molekulare Mikrobiologie () Erfasste Fragebögen = 0 Prof. Dr. Vera Meyer, Angewandte und Molekulare Mikrobiologie Auswertungsteil der geschlossenen Fragen Legende Relative
Prof. Dr. Vera Meyer Angewandte und Molekulare Mikrobiologie () Erfasste Fragebögen = 0 Prof. Dr. Vera Meyer, Angewandte und Molekulare Mikrobiologie Auswertungsteil der geschlossenen Fragen Legende Relative
Ergebnisse der Umfrage zur Gestaltung der Übungen
 Ergebnisse der Umfrage zur Gestaltung der Übungen 24. - 28. November 214 Universität Koblenz-Landau Fachschaftsvertretung Mathematik c/o Institut für Mathematik Fortstaße 7 76829 Landau 1. Januar 21 24.
Ergebnisse der Umfrage zur Gestaltung der Übungen 24. - 28. November 214 Universität Koblenz-Landau Fachschaftsvertretung Mathematik c/o Institut für Mathematik Fortstaße 7 76829 Landau 1. Januar 21 24.
Fortgeschrittene Programmiertechniken
 FERNSTUDIUM INFORMATIK an Fachhochschulen Fortgeschrittene Programmiertechniken Studienplan SS 2016 Inhalt Der Modulablauf im Überblick... 1 Ihre Kursbetreuer... 1 Wo finde ich das Lehrmaterial?... 2 Zusatzaufgaben...
FERNSTUDIUM INFORMATIK an Fachhochschulen Fortgeschrittene Programmiertechniken Studienplan SS 2016 Inhalt Der Modulablauf im Überblick... 1 Ihre Kursbetreuer... 1 Wo finde ich das Lehrmaterial?... 2 Zusatzaufgaben...
Auswertung zur Veranstaltung Ausgew. Themen aus d. Bereich Künstliche Intelligenz u. Robotik - Visuelle Navigation f. Flugroboter
 Auswertung zur Veranstaltung Ausgew. Themen aus d. Bereich Künstliche Intelligenz u. Robotik - Visuelle Navigation f. Flugroboter Liebe Dozentin, lieber Dozent, anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation
Auswertung zur Veranstaltung Ausgew. Themen aus d. Bereich Künstliche Intelligenz u. Robotik - Visuelle Navigation f. Flugroboter Liebe Dozentin, lieber Dozent, anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation
Auswertungsbericht Lehrveranstaltungsbewertung Physik (fuer Bauingenieure) ( )
 RWTH Aachen Dez. 6.0 - Abt. 6. Templergraben 06 Aachen Tel.: 0 80 967 E-Mail: verena.thaler@zhv.rwth-aachen.de RWTH Aachen - Dez. 6.0/Abt. 6. Herr Univ.-Prof. Dr.rer.nat. Thomas Hebbeker (PERSÖNLICH) harm.fesefeldt@physik.rwth-aachen.de
RWTH Aachen Dez. 6.0 - Abt. 6. Templergraben 06 Aachen Tel.: 0 80 967 E-Mail: verena.thaler@zhv.rwth-aachen.de RWTH Aachen - Dez. 6.0/Abt. 6. Herr Univ.-Prof. Dr.rer.nat. Thomas Hebbeker (PERSÖNLICH) harm.fesefeldt@physik.rwth-aachen.de
Im zweiten Teil des Berichts werden die Ergebnisse in Form von Profillinien dargestellt (Schnellüberblick).
 TU Darmstadt Hochschuldidaktische Arbeitsstelle Hochschulstr. 689 Darmstadt An Herr M. Sc. Christian Wolff persönlich Auswertungsbericht Lehrveranstaltungsevaluation an die Lehrenden Sehr geehrte/r Herr
TU Darmstadt Hochschuldidaktische Arbeitsstelle Hochschulstr. 689 Darmstadt An Herr M. Sc. Christian Wolff persönlich Auswertungsbericht Lehrveranstaltungsevaluation an die Lehrenden Sehr geehrte/r Herr
Unterstützungsangebote in. Mathematik: Maßnahmen und Erkenntnisse
 Unterstützungsangebote in Mathematik: Maßnahmen und Erkenntnisse Susanne Bellmer Februar 2015 Überblick 1. Problematik und Motivation 2. Maßnahmen und Erkenntnisse 3. Zusammenfassung und Fazit 2 1. Problematik
Unterstützungsangebote in Mathematik: Maßnahmen und Erkenntnisse Susanne Bellmer Februar 2015 Überblick 1. Problematik und Motivation 2. Maßnahmen und Erkenntnisse 3. Zusammenfassung und Fazit 2 1. Problematik
Richtlinien und Hinweise für. Seminararbeiten
 Richtlinien und Hinweise für Seminararbeiten Lehrstuhl für VWL (Wirtschaftspolitik, insbes. Industrieökonomik) Ökonomie der Informationsgesellschaft Prof. Dr. Peter Welzel Gliederung Die folgenden Richtlinien
Richtlinien und Hinweise für Seminararbeiten Lehrstuhl für VWL (Wirtschaftspolitik, insbes. Industrieökonomik) Ökonomie der Informationsgesellschaft Prof. Dr. Peter Welzel Gliederung Die folgenden Richtlinien
Angewandte Mathematik: Stochastik Prof. Dr. Reinhard Klein
 Angewandte Mathematik: Stochastik Prof. Dr. Reinhard Klein Veranstaltungsbewertung der Fachschaft Informatik 4. September 2015 Abgegebene Fragebögen: 38 1 Bewertung der Vorlesung 1.1 Bitte beurteile die
Angewandte Mathematik: Stochastik Prof. Dr. Reinhard Klein Veranstaltungsbewertung der Fachschaft Informatik 4. September 2015 Abgegebene Fragebögen: 38 1 Bewertung der Vorlesung 1.1 Bitte beurteile die
Konzept E-teaching Scenario 2012/2013. Thema der Lehrveranstaltung Statistik eine Einführung in R
 Januar 2013 Konzept E-teaching Scenario 2012/2013 Thema der Lehrveranstaltung Statistik eine Einführung in R Dozent: Dr. Thilo Liesenjohann Tierökologie / IBB Universität Potsdam 1 1. Hintergrund der Lehrveranstaltung
Januar 2013 Konzept E-teaching Scenario 2012/2013 Thema der Lehrveranstaltung Statistik eine Einführung in R Dozent: Dr. Thilo Liesenjohann Tierökologie / IBB Universität Potsdam 1 1. Hintergrund der Lehrveranstaltung
Blended Learning Arrangements
 10th ILIAS Conference 2011 Blended Learning Arrangements Zwei Praxisbeispiele Prof. Dr. Armin Hollenstein Lea Beyeler, BA Universität Bern, Institut für Erziehungswissenschaft Inhalt Zwei Praxisbeispiele
10th ILIAS Conference 2011 Blended Learning Arrangements Zwei Praxisbeispiele Prof. Dr. Armin Hollenstein Lea Beyeler, BA Universität Bern, Institut für Erziehungswissenschaft Inhalt Zwei Praxisbeispiele
Auswertung zur Veranstaltung Website-Gestaltung zur Ingenieurpsychologie
 Auswertung zur Veranstaltung Website-Gestaltung zur Ingenieurpsychologie Zu dieser Veranstaltung wurden 6 Bewertungen abgegeben. Erläuterungen zu den Diagrammen befinden sich am Ende dieses Dokuments.
Auswertung zur Veranstaltung Website-Gestaltung zur Ingenieurpsychologie Zu dieser Veranstaltung wurden 6 Bewertungen abgegeben. Erläuterungen zu den Diagrammen befinden sich am Ende dieses Dokuments.
Studiengang Medienwirtschaft Forschungsprojekte WiSe 2015/16
 : Copter Communication Camp II Dozenten: Max Ruppert Thomas Maier Max. 12 Das "Copter Communication Camp" ist ein fakultäts- und studiengangsübergreifendes Lehr-/Forschungsprojekt an der HdM. In diesem
: Copter Communication Camp II Dozenten: Max Ruppert Thomas Maier Max. 12 Das "Copter Communication Camp" ist ein fakultäts- und studiengangsübergreifendes Lehr-/Forschungsprojekt an der HdM. In diesem
Projektbericht: ALLSport - Aktivierende Lehr- und Lehrformen in der Sportwissenschaft
 Projektbericht: ALLSport - Aktivierende Lehr- und Lehrformen in der Sportwissenschaft TU-Online plus III Projekt im Sommersemester 2012 Projektverantwortliche: Prof. Dr. Josef Wiemeyer Trainingswissenschaften
Projektbericht: ALLSport - Aktivierende Lehr- und Lehrformen in der Sportwissenschaft TU-Online plus III Projekt im Sommersemester 2012 Projektverantwortliche: Prof. Dr. Josef Wiemeyer Trainingswissenschaften
Weitere Informationen zur Evaluation an der Universität Leipzig finden Sie unter
 Liebe Studentinnen und Studenten, im nachfolgenden Fragebogen bitten wir Sie um die Bewertung des von Ihnen besuchten Moduls XXX und gehöriger Lehrveranstaltungen. Der Balken oben rechts im Bild zeigt
Liebe Studentinnen und Studenten, im nachfolgenden Fragebogen bitten wir Sie um die Bewertung des von Ihnen besuchten Moduls XXX und gehöriger Lehrveranstaltungen. Der Balken oben rechts im Bild zeigt
Einführung in die Schulpädagogik. Wissenswertes zur Klausur
 Einführung in die Schulpädagogik Wissenswertes zur Klausur Klausurtermin Für alle Studierenden der Prüfungsordnung (PStO 2010 und 2016) wird eine Abschlussklausur der Veranstaltung "Einführung in die Schulpädagogik"
Einführung in die Schulpädagogik Wissenswertes zur Klausur Klausurtermin Für alle Studierenden der Prüfungsordnung (PStO 2010 und 2016) wird eine Abschlussklausur der Veranstaltung "Einführung in die Schulpädagogik"
Aufbau und Beurteilung der Prüfung (Gültig für Prüfungstermine vor dem 1.1.2016)
 Aufbau und Beurteilung der Prüfung (Gültig für Prüfungstermine vor dem 1.1.2016) Die Prüfung zur VO Rechnungswesen findet in EDV-gestützter Form unter Verwendung des Softwaretools Questionmark Perception
Aufbau und Beurteilung der Prüfung (Gültig für Prüfungstermine vor dem 1.1.2016) Die Prüfung zur VO Rechnungswesen findet in EDV-gestützter Form unter Verwendung des Softwaretools Questionmark Perception
Algorithmen und Berechnungskomplexität II Prof. Dr. Rolf Klein
 Algorithmen und Berechnungskomplexität II Prof. Dr. Rolf Klein Veranstaltungsbewertung der Fachschaft Informatik 29. November 2016 Abgegebene Fragebögen: 61 1 Bewertung der Vorlesung 1.1 Bitte beurteile
Algorithmen und Berechnungskomplexität II Prof. Dr. Rolf Klein Veranstaltungsbewertung der Fachschaft Informatik 29. November 2016 Abgegebene Fragebögen: 61 1 Bewertung der Vorlesung 1.1 Bitte beurteile
Lehrveranstaltungstypen im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft
 Lehrveranstaltungstypen im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft Im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft werden sechs Lehrveranstaltungstypen angeboten, die jeweils durch eine spezifische Gewichtung der
Lehrveranstaltungstypen im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft Im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft werden sechs Lehrveranstaltungstypen angeboten, die jeweils durch eine spezifische Gewichtung der
Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Studiensemester. Leistungs -punkte 8 LP
 Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEd EHRGeM 1 Workload 240 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur
Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEd EHRGeM 1 Workload 240 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur
Qualifizierung zum Prozesscoach. in der ambulanten und stationären Altenhilfe
 Qualifizierung zum Prozesscoach in der ambulanten und stationären Altenhilfe Qualifizierung zum Prozesscoach Qualifizierung zum Prozesscoach in der ambulanten und stationären Altenhilfe Langfristig erfolgreiche
Qualifizierung zum Prozesscoach in der ambulanten und stationären Altenhilfe Qualifizierung zum Prozesscoach Qualifizierung zum Prozesscoach in der ambulanten und stationären Altenhilfe Langfristig erfolgreiche
Wissenschaftliches Schreiben in die Lehre integrieren - Hochschuldidaktische
 Wissenschaftliches Schreiben in die Lehre integrieren - Hochschuldidaktische Kurzinformation 1 zum Text von Wingate, Andon & Cogo (2011) Eva S. Fritzsche & Tobias Durant Origingalquelle: Wingate, U., Andon,
Wissenschaftliches Schreiben in die Lehre integrieren - Hochschuldidaktische Kurzinformation 1 zum Text von Wingate, Andon & Cogo (2011) Eva S. Fritzsche & Tobias Durant Origingalquelle: Wingate, U., Andon,
Hinweise 1. für pädagogische Institutionen. zum Professionalisierungspraktikum (PP) im Rahmen des Lehramtsstudiums
 Hinweise 1 für pädagogische Institutionen zum Professionalisierungspraktikum (PP) im Rahmen des Lehramtsstudiums an der Pädagogischen Hochschule Weingarten Schulpraxisamt PH Weingarten Kirchplatz 2 88250
Hinweise 1 für pädagogische Institutionen zum Professionalisierungspraktikum (PP) im Rahmen des Lehramtsstudiums an der Pädagogischen Hochschule Weingarten Schulpraxisamt PH Weingarten Kirchplatz 2 88250
Umgang mit interkultureller Diversität und leistungsbezogener Diversität von Studierenden
 Umgang mit interkultureller Diversität und leistungsbezogener Diversität von Studierenden Dipl.-Päd. Katharina Hombach Wandelwerk Zentrum für Qualitätsentwicklung Robert-Koch-Straße 30 fon +49 (0)251.83
Umgang mit interkultureller Diversität und leistungsbezogener Diversität von Studierenden Dipl.-Päd. Katharina Hombach Wandelwerk Zentrum für Qualitätsentwicklung Robert-Koch-Straße 30 fon +49 (0)251.83
Semester: -- Workload: 300 h ECTS Punkte: 10
 Modulbezeichnung: Personalwesen Spezialisierung Modulnummer: BWPW Semester: -- Dauer: Minimaldauer 1 Semester Modultyp: Pflicht, Wahlpflicht Zu Details beachte bitte das Curriculum des jeweiligen Studiengangs
Modulbezeichnung: Personalwesen Spezialisierung Modulnummer: BWPW Semester: -- Dauer: Minimaldauer 1 Semester Modultyp: Pflicht, Wahlpflicht Zu Details beachte bitte das Curriculum des jeweiligen Studiengangs
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Inhalte erschließen und wiedergeben - Lesen mit der 5-Schritt- Methode
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Inhalte erschließen und wiedergeben - Lesen mit der 5-Schritt- Methode Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Inhalte erschließen und wiedergeben - Lesen mit der 5-Schritt- Methode Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von
Auswertungsbericht Lehrveranstaltungsevaluation an die Lehrenden
 Universität Erfurt Nordhäuser Strasse 6 99089 Erfurt Stabsstelle Qualitätsmanagement in Studium und Lehre Prof. Dr. Kai Brodersen Hans-Georg Roth (Persönlich) Auswertungsbericht Lehrveranstaltungsevaluation
Universität Erfurt Nordhäuser Strasse 6 99089 Erfurt Stabsstelle Qualitätsmanagement in Studium und Lehre Prof. Dr. Kai Brodersen Hans-Georg Roth (Persönlich) Auswertungsbericht Lehrveranstaltungsevaluation
II. Zeitlicher Ablauf und Fernbleiben an einem Praktikumstermin
 Hinweise für die Praktika Physik I, Physik II I. Voraussetzungen zur Teilnahme Die Zugangsvoraussetzungen sind in den Prüfungsordnungen vom 08.06.2011 (bei Studienbeginn ab WS 2011/2012) und 15.09.2015
Hinweise für die Praktika Physik I, Physik II I. Voraussetzungen zur Teilnahme Die Zugangsvoraussetzungen sind in den Prüfungsordnungen vom 08.06.2011 (bei Studienbeginn ab WS 2011/2012) und 15.09.2015
Praktikumsvorbereitung mit LON-CAPA. M.Ed. Dennis Kubin Institut für Neurophysiologie
 Praktikumsvorbereitung mit LON-CAPA M.Ed. Dennis Kubin Rahmenbedingungen Modul: Physikalische und Physiologische Grundlagen der Medizin Ca. 350-400 Studierende pro Jahrgang LON-CAPA seit 2010 (Kurse auf
Praktikumsvorbereitung mit LON-CAPA M.Ed. Dennis Kubin Rahmenbedingungen Modul: Physikalische und Physiologische Grundlagen der Medizin Ca. 350-400 Studierende pro Jahrgang LON-CAPA seit 2010 (Kurse auf
PRAKTIKUMSABLAUF PRAKTIKUM PHYSIKALISCHE SCHULEXPERIMENTE
 Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Physik, Professur Didaktik der Physik PRAKTIKUMSABLAUF PRAKTIKUM PHYSIKALISCHE SCHULEXPERIMENTE Technische Universität Dresden, Fakultät Mathematik und
Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Physik, Professur Didaktik der Physik PRAKTIKUMSABLAUF PRAKTIKUM PHYSIKALISCHE SCHULEXPERIMENTE Technische Universität Dresden, Fakultät Mathematik und
Kompetenzorientiertes Prüfen
 PROGRAMM Kompetenzorientiertes Prüfen Eine Tagung des Projekts nexus in Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen Fotos: UDE 12. Juli 2016 Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg Stand: 30.03.2016
PROGRAMM Kompetenzorientiertes Prüfen Eine Tagung des Projekts nexus in Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen Fotos: UDE 12. Juli 2016 Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg Stand: 30.03.2016
Studienplan für das Bachelor- und Masterstudium im Studiengang Erziehungswissenschaft
 Studienplan für das Bachelor- und Masterstudium im Studiengang Erziehungswissenschaft Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Bern Muesmattstrasse 7 301 Bern URL: www.edu.unibe.ch 1 Die Philosophisch-humanwissenschaftliche
Studienplan für das Bachelor- und Masterstudium im Studiengang Erziehungswissenschaft Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Bern Muesmattstrasse 7 301 Bern URL: www.edu.unibe.ch 1 Die Philosophisch-humanwissenschaftliche
Grundlagen Mikrobiologie / Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene (0335 L 020)
 Dr. Müller-Hagen Fak III: Prozesswissenschaften DozentInnen-Auswertung: Grundlagen Mikrobiologie / Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene (0335 L 020) Auswertung zur Veranstaltung Grundlagen Mikrobiologie
Dr. Müller-Hagen Fak III: Prozesswissenschaften DozentInnen-Auswertung: Grundlagen Mikrobiologie / Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene (0335 L 020) Auswertung zur Veranstaltung Grundlagen Mikrobiologie
Studierende der Wirtschaftswissenschaften nach Geschlecht
 Universität Konstanz: Arbeitsgruppe Hochschulforschung Randauszählung Studienqualitätsmonitor 2007 Studierende der Wirtschaftswissenschaften nach Geschlecht Online-Befragung Studierender im Sommersemester
Universität Konstanz: Arbeitsgruppe Hochschulforschung Randauszählung Studienqualitätsmonitor 2007 Studierende der Wirtschaftswissenschaften nach Geschlecht Online-Befragung Studierender im Sommersemester
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Klausur mit Erwartungshorizont: Wohlstand und Staatsverschuldung in der DDR
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klausur mit Erwartungshorizont: Wohlstand und Staatsverschuldung in der DDR Das komplette Material finden Sie hier: Titel: Quellenanalyse
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klausur mit Erwartungshorizont: Wohlstand und Staatsverschuldung in der DDR Das komplette Material finden Sie hier: Titel: Quellenanalyse
Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor of Science (B.Sc.)
 Vom 31. August 2010 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 41, Nr. 72, S. 401 503) Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor of Science (B.Sc.) Anlage B. Fachspezifische Bestimmungen der Prüfungsordnung für
Vom 31. August 2010 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 41, Nr. 72, S. 401 503) Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor of Science (B.Sc.) Anlage B. Fachspezifische Bestimmungen der Prüfungsordnung für
Einführung zur Kurseinheit Interview
 Interview 3 Einführung zur Kurseinheit Interview Bitte lesen Sie diese Einführung sorgfältig durch! Der Kurs 03420 umfasst zwei Kurseinheiten: die vorliegende Kurseinheit zur Interview-Methode und eine
Interview 3 Einführung zur Kurseinheit Interview Bitte lesen Sie diese Einführung sorgfältig durch! Der Kurs 03420 umfasst zwei Kurseinheiten: die vorliegende Kurseinheit zur Interview-Methode und eine
Studienordnung. Bachelorstudiengang Medientechnik
 Studienordnung für den Bachelorstudiengang Medientechnik an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) (StudO-MTB) vom 30. April 2008 Aufgrund von 21 Absatz 1 des Gesetzes über die
Studienordnung für den Bachelorstudiengang Medientechnik an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) (StudO-MTB) vom 30. April 2008 Aufgrund von 21 Absatz 1 des Gesetzes über die
Die Kombination von Vorlesungen und Gruppenlernphasen ( Interteaching )
 Die Kombination von Vorlesungen und Gruppenlernphasen ( Interteaching ) Hochschuldidaktische Kurzinfos 36.2015 Schriften zur Hochschuldidaktik Beiträge und Empfehlungen des Fortbildungszentrums Hochschullehre
Die Kombination von Vorlesungen und Gruppenlernphasen ( Interteaching ) Hochschuldidaktische Kurzinfos 36.2015 Schriften zur Hochschuldidaktik Beiträge und Empfehlungen des Fortbildungszentrums Hochschullehre
Ein Blended Learning-Konzept zu Health Technology Assessment
 Ein Blended Learning-Konzept zu Health Technology Assessment Dr. Annette Zentner, MPH Fachgebiet Management im Gesundheitswesen Technische Universität Berlin Überblick Was ist HTA? Was ist HTA online?
Ein Blended Learning-Konzept zu Health Technology Assessment Dr. Annette Zentner, MPH Fachgebiet Management im Gesundheitswesen Technische Universität Berlin Überblick Was ist HTA? Was ist HTA online?
EDi Evaluation im Dialog
 EDi Evaluation im Dialog Wintersemester 2010/11 Veranstaltung Die kulturelle Dimension der Nachhaltigkeit Davide Brocchi Befragung der Studierenden am 16.01.2011 (N=23) Fragebogen für Seminare und Lehrveranstaltungen
EDi Evaluation im Dialog Wintersemester 2010/11 Veranstaltung Die kulturelle Dimension der Nachhaltigkeit Davide Brocchi Befragung der Studierenden am 16.01.2011 (N=23) Fragebogen für Seminare und Lehrveranstaltungen
1. Angaben zur Ihrer Person: Studiengang: Hauptfächer: Nebenfächer : Fachsemester: 2. allgemeiner Lernerfolg:
 Fragebogen zur Evaluation der Lehrveranstaltung Mädchen mögen Deutsch Jungen können Mat he? Interdisziplinäre Sichtweisen auf Genderaspekte in der Schule (WS 2013/14) Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit,
Fragebogen zur Evaluation der Lehrveranstaltung Mädchen mögen Deutsch Jungen können Mat he? Interdisziplinäre Sichtweisen auf Genderaspekte in der Schule (WS 2013/14) Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit,
Kommunikation. Leseprobe
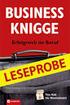 Kommunikation Kapitel 4 - Angrenzende Gebiete der Kommunikation 4.1 Fragetechniken 4.2 Zuhörtechniken 4.3 Feedback 4.4 Gesprächsführung Seite 51 von 96 Lernorientierung Nach Bearbeitung dieses Kapitels
Kommunikation Kapitel 4 - Angrenzende Gebiete der Kommunikation 4.1 Fragetechniken 4.2 Zuhörtechniken 4.3 Feedback 4.4 Gesprächsführung Seite 51 von 96 Lernorientierung Nach Bearbeitung dieses Kapitels
Tutorielle Arbeit am Institut für Pädagogik Bestandsaufnahme und Ideen aus Sicht der Prozessbegleitung und Qualifizierung von TutorenInnen
 Tutorielle Arbeit am Institut für Pädagogik Bestandsaufnahme und Ideen aus Sicht der Prozessbegleitung und Qualifizierung von TutorenInnen Idee zur Zukunftswerkstatt Weiterbildungs- und Reflexionsworkshop
Tutorielle Arbeit am Institut für Pädagogik Bestandsaufnahme und Ideen aus Sicht der Prozessbegleitung und Qualifizierung von TutorenInnen Idee zur Zukunftswerkstatt Weiterbildungs- und Reflexionsworkshop
Amtliche Mitteilungen Nr. 10/
 Amtliche Mitteilungen Nr. 10/2009 06.10.2009 Praktikumsordnung für den Bachelor-Studiengang Europäisches Management an der Technischen Hochschule Wildau (FH) Auf der Grundlage von 18, 21 und 70 Abs. 2
Amtliche Mitteilungen Nr. 10/2009 06.10.2009 Praktikumsordnung für den Bachelor-Studiengang Europäisches Management an der Technischen Hochschule Wildau (FH) Auf der Grundlage von 18, 21 und 70 Abs. 2
Dieser Fragebogen dient als Instrument, um einerseits erstmals mit Ihnen in Kontakt zu kommen und andererseits einen ersten Überblick zu erhalten.
 Sehr geehrte Eltern, liebe Betroffene! Bei Menschen mit schulischen Teilleistungsschwächen sind die Lernerfolge in bestimmten Bereichen wie z.b. Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen trotz ausreichender Intelligenz
Sehr geehrte Eltern, liebe Betroffene! Bei Menschen mit schulischen Teilleistungsschwächen sind die Lernerfolge in bestimmten Bereichen wie z.b. Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen trotz ausreichender Intelligenz
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Klassenarbeit mit Erwartungshorizont: Konjunktiv I und II
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klassenarbeit mit Erwartungshorizont: Konjunktiv I und II Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Konjunktiv
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klassenarbeit mit Erwartungshorizont: Konjunktiv I und II Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Konjunktiv
 Bearbeiten einschalten anklicken, um Inhalte zu gestalten Navigieren: Über den Pfad oben oder den Block Navigation Dieser moodle-kurs ist in Themen strukturiert. Eine Variante ist die Darstellung nach
Bearbeiten einschalten anklicken, um Inhalte zu gestalten Navigieren: Über den Pfad oben oder den Block Navigation Dieser moodle-kurs ist in Themen strukturiert. Eine Variante ist die Darstellung nach
HYDROLOGIE I EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG ASSISTENZ
 HYDROLOGIE I EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG ASSISTENZ Ellen Cerwinka cerwinka@ifu.baug.ethz.ch Juliane Kneisler kneisler@ifu.baug.ethz.ch HIL D 21.3 Kontaktdaten Sprechzeiten Dienstag: 14.30 16.30 Uhr und nach
HYDROLOGIE I EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG ASSISTENZ Ellen Cerwinka cerwinka@ifu.baug.ethz.ch Juliane Kneisler kneisler@ifu.baug.ethz.ch HIL D 21.3 Kontaktdaten Sprechzeiten Dienstag: 14.30 16.30 Uhr und nach
Universität Hamburg S TUDIENORDNUNG. für den Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (4. 10.
 Universität Hamburg Fachbereich Wirtschaftswissenschaften S TUDIENORDNUNG für den Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre (4. 10. 1996) 2 Die Studienordnung konkretisiert die Prüfungsordnung und regelt
Universität Hamburg Fachbereich Wirtschaftswissenschaften S TUDIENORDNUNG für den Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre (4. 10. 1996) 2 Die Studienordnung konkretisiert die Prüfungsordnung und regelt
Syllabus MEN1282 Einführung in die Konstruktionslehre WS 16/17
 Lehrveranstaltung: Einführung in die Konstruktionslehre für Wirtschaftsingenieure (MEN 1282) Deutsch, 3 SWS, 3 Credits Niveau: fortgeschritten Termin und Raum: siehe LSF Lehrende: Prof. Dr. Gerd Eberhardt
Lehrveranstaltung: Einführung in die Konstruktionslehre für Wirtschaftsingenieure (MEN 1282) Deutsch, 3 SWS, 3 Credits Niveau: fortgeschritten Termin und Raum: siehe LSF Lehrende: Prof. Dr. Gerd Eberhardt
Auswertung der Lehrveranstaltungsevaluation 2011
 Universität Potsdam Philosophische Fakultät Auswertung der Lehrveranstaltungsevaluation 2011 Auswertung der Lehrveranstaltungsevaluation 2011 der Philosophischen Fakulta t der Universita t Potsdam Michael
Universität Potsdam Philosophische Fakultät Auswertung der Lehrveranstaltungsevaluation 2011 Auswertung der Lehrveranstaltungsevaluation 2011 der Philosophischen Fakulta t der Universita t Potsdam Michael
Der -Online- Ausbilderkurs
 Der -Online- Ausbilderkurs Machen Sie Ihren Ausbilderschein mit 70% weniger Zeitaufwand Flexibel & mit 70% Zeitersparnis zu Ihrem Ausbilderschein Mit Videos auf Ihre Ausbilderprüfung (IHK) vorbereiten
Der -Online- Ausbilderkurs Machen Sie Ihren Ausbilderschein mit 70% weniger Zeitaufwand Flexibel & mit 70% Zeitersparnis zu Ihrem Ausbilderschein Mit Videos auf Ihre Ausbilderprüfung (IHK) vorbereiten
Lehrmethoden, Sozialformen, Arbeitsauftrag
 Lehrmethoden, Sozialformen, Arbeitsauftrag Lehrmethoden Wenn die Voraussetzungen des didaktischen Handelns strategisch geklärt sind, geht es darum, es methodisch zu gestalten. Zentrale Funktion des methodischen
Lehrmethoden, Sozialformen, Arbeitsauftrag Lehrmethoden Wenn die Voraussetzungen des didaktischen Handelns strategisch geklärt sind, geht es darum, es methodisch zu gestalten. Zentrale Funktion des methodischen
2) VORBEREITUNGEN VOR ANTRITT DES AUSLANDSAUFANTHALTS
 1) ZUSAMMENFASSUNG Fassen Sie Ihren Auslandsaufenthalt kurz zusammen. Haben sich Ihre Erwartungen an das Studium im Ausland erfüllt? Wie würden Sie Ihr Auslandsstudium bewerten? Wie haben Sie die Zusammenarbeit
1) ZUSAMMENFASSUNG Fassen Sie Ihren Auslandsaufenthalt kurz zusammen. Haben sich Ihre Erwartungen an das Studium im Ausland erfüllt? Wie würden Sie Ihr Auslandsstudium bewerten? Wie haben Sie die Zusammenarbeit
Master Musikpädagogik: Elementare Musikpädagogik
 Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung (FSPO) für den Studiengang Master Musikpädagogik: Elementare Musikpädagogik mit der Abschlussbezeichnung Master of Music (M.Mus.) an der Hochschule für Musik
Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung (FSPO) für den Studiengang Master Musikpädagogik: Elementare Musikpädagogik mit der Abschlussbezeichnung Master of Music (M.Mus.) an der Hochschule für Musik
Vorgehensweise bei der Erstellung. von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten)
 Leuphana Universität Lüneburg Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen Abt. Rechnungswesen und Steuerlehre Vorgehensweise bei der Erstellung von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten) I. Arbeitsschritte
Leuphana Universität Lüneburg Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen Abt. Rechnungswesen und Steuerlehre Vorgehensweise bei der Erstellung von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten) I. Arbeitsschritte
Inverted Classroom Konferenz 26. Februar 2014. Fotoprotokoll des Workshops: Videos erstellt. Und dann?
 Fotoprotokoll des Workshops: Videos erstellt. Und dann? Herzlich Willkommen zum Workshop Videos erstellt. Und dann? im Rahmen der Inverted Classroom Tagung in Marburg. Mein Name ist Athanasios Vassiliou
Fotoprotokoll des Workshops: Videos erstellt. Und dann? Herzlich Willkommen zum Workshop Videos erstellt. Und dann? im Rahmen der Inverted Classroom Tagung in Marburg. Mein Name ist Athanasios Vassiliou
EINFÜHRUNG IN DIE SCHULPÄDAGOGIK. Wintersemester
 EINFÜHRUNG IN DIE SCHULPÄDAGOGIK Wintersemester 2014-15 Die Einführung in die Schulpädagogik basiert auf dem aktuellen Erkenntnisstand zu wirksamen Lehrveranstaltungen. Grundprinzip ist die kognitive Aktivierung.
EINFÜHRUNG IN DIE SCHULPÄDAGOGIK Wintersemester 2014-15 Die Einführung in die Schulpädagogik basiert auf dem aktuellen Erkenntnisstand zu wirksamen Lehrveranstaltungen. Grundprinzip ist die kognitive Aktivierung.
Berner Fachhochschule Gesundheit. Hochschuldidaktische Leitsätze im Bachelor of Science in Pflege
 Berner Fachhochschule Gesundheit Hochschuldidaktische Leitsätze im Bachelor of Science in Pflege Ausgangslage Das Leitbild der Berner Fachhochschule (BFH) vom 17. November 2009 bildet die Grundlage und
Berner Fachhochschule Gesundheit Hochschuldidaktische Leitsätze im Bachelor of Science in Pflege Ausgangslage Das Leitbild der Berner Fachhochschule (BFH) vom 17. November 2009 bildet die Grundlage und
Eva S. Fritzsche. Hochschuldidaktische Kurzinformationen des ZiLL Kurzinfos Seite 1
 Förderung des Wissenserwerbs Studierender durch die Integration kognitiver Lernstrategien in die Lehre - Hochschuldidaktische Kurzinformation 1 zum Text von Roediger & Pyc (2012) Eva S. Fritzsche Originalquelle:
Förderung des Wissenserwerbs Studierender durch die Integration kognitiver Lernstrategien in die Lehre - Hochschuldidaktische Kurzinformation 1 zum Text von Roediger & Pyc (2012) Eva S. Fritzsche Originalquelle:
Kommentar für Lehrpersonen
 Kommentar für Lehrpersonen Überblick über das Projekt Überblick Im Herbst 2005 lanciert die «Neue Zürcher Zeitung» mit dem «Lernset Eigene Meinung» eine elektronische, interaktive Unterrichtseinheit, die
Kommentar für Lehrpersonen Überblick über das Projekt Überblick Im Herbst 2005 lanciert die «Neue Zürcher Zeitung» mit dem «Lernset Eigene Meinung» eine elektronische, interaktive Unterrichtseinheit, die
Freizeit versus Arbeitszeit
 Freizeit versus Arbeitszeit Thema mit Inhalten Jahrgangsstufe Dauer Freizeit versus Arbeitszeit 11-12 PC, OHP, Folien + 2 Unterrichtsstunden Stifte, Wandtafel Benötigtes Vorwissen:./. Vorbereitende Hausaufgabe:
Freizeit versus Arbeitszeit Thema mit Inhalten Jahrgangsstufe Dauer Freizeit versus Arbeitszeit 11-12 PC, OHP, Folien + 2 Unterrichtsstunden Stifte, Wandtafel Benötigtes Vorwissen:./. Vorbereitende Hausaufgabe:
Informationen zur Modulklausur Unternehmensführung (BWL IV) Modul (Kurse ) Stand SS 2016
 Informationen zur Modulklausur Unternehmensführung (BWL IV) (Kurse 40610 40612) Stand SS 2016 Allgemeiner Hinweis Die nachfolgenden Informationen vermitteln keine Stoffinhalte! Es handelt sich um allgemeine
Informationen zur Modulklausur Unternehmensführung (BWL IV) (Kurse 40610 40612) Stand SS 2016 Allgemeiner Hinweis Die nachfolgenden Informationen vermitteln keine Stoffinhalte! Es handelt sich um allgemeine
Gottlieb Duttweiler Lehrstuhl für Internationales Handelsmanagement. Für die Erstellung von Bachelor-Arbeiten massgeblich ist das allgemeine Merkblatt
 Gottlieb Duttweiler Lehrstuhl für Internationales Handelsmanagement Für die Erstellung von Bachelor-Arbeiten massgeblich ist das allgemeine Merkblatt für Bachelor-Arbeiten, das unter http://www.unisg.ch
Gottlieb Duttweiler Lehrstuhl für Internationales Handelsmanagement Für die Erstellung von Bachelor-Arbeiten massgeblich ist das allgemeine Merkblatt für Bachelor-Arbeiten, das unter http://www.unisg.ch
Bachelorarbeit. Was ist zu tun?
 Bachelorarbeit Was ist zu tun? Titelseite Zusammenfassung/Summary Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Einleitung Material und Methoden Ergebnisse Diskussion Ausblick Literaturverzeichnis Danksagung
Bachelorarbeit Was ist zu tun? Titelseite Zusammenfassung/Summary Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Einleitung Material und Methoden Ergebnisse Diskussion Ausblick Literaturverzeichnis Danksagung
Aufgabeneinheit 4: In 3 Runden zum Erfolg! Ein Gruppenwettbewerb!
 Aufgabeneinheit 4: In 3 Runden zum Erfolg! Ein Gruppenwettbewerb! Franz-Josef Göbel / Ralf Nagel / Helga Schmidt / Armin Baeger Die im Folgenden beschriebene Unterrichtseinheit, die als Wettbewerb zwischen
Aufgabeneinheit 4: In 3 Runden zum Erfolg! Ein Gruppenwettbewerb! Franz-Josef Göbel / Ralf Nagel / Helga Schmidt / Armin Baeger Die im Folgenden beschriebene Unterrichtseinheit, die als Wettbewerb zwischen
Selbstlernen im hybriden Lernformat- Wieviel Betreuung brauchen Studierende?
 Selbstlernen im hybriden Lernformat- Wieviel Betreuung brauchen Studierende? Panel 1: Selbstlernangebote und Studienunterstützung Vortragender: Dr. Michael Lakatos Hochschule Projektleitung: Prof. Dr.
Selbstlernen im hybriden Lernformat- Wieviel Betreuung brauchen Studierende? Panel 1: Selbstlernangebote und Studienunterstützung Vortragender: Dr. Michael Lakatos Hochschule Projektleitung: Prof. Dr.
Modul. Empirische Forschungsmethoden. Lehrveranstaltung 1: Empirische Sozialforschung und Alter. Studienbrief. (Lehrstuhl Renn Lehrstuhl Gabriel)
 Modul Empirische Forschungsmethoden Lehrveranstaltung 1: Empirische Sozialforschung und Alter Studienbrief (Lehrstuhl Renn Lehrstuhl Gabriel) Autoren: Jürgen Bauknecht 1 Lehrveranstaltung 1: Empirische
Modul Empirische Forschungsmethoden Lehrveranstaltung 1: Empirische Sozialforschung und Alter Studienbrief (Lehrstuhl Renn Lehrstuhl Gabriel) Autoren: Jürgen Bauknecht 1 Lehrveranstaltung 1: Empirische
Syllabus: FIN6041 Financial Engineering
 Syllabus: FIN6041 Financial Engineering WP/StB Dipl.-Kffr./CINA Heike Hartenberger Hochschule Pforzheim / Pforzheim University Lehrveranstaltung: Workload: Level: Voraussetzungen: FIN6041 - Financial Engineering
Syllabus: FIN6041 Financial Engineering WP/StB Dipl.-Kffr./CINA Heike Hartenberger Hochschule Pforzheim / Pforzheim University Lehrveranstaltung: Workload: Level: Voraussetzungen: FIN6041 - Financial Engineering
Kursstruktur und Kursbeschreibungen Gastprofessur International Management
 Kursstruktur und Kursbeschreibungen Gastprofessur International Management No. Kurs Level Art SoSe 2015 WiSe 2015/16 SoSe 2016 WiSe 2016/17 1 International Business BA VL x x 2 Asian Business & Economics
Kursstruktur und Kursbeschreibungen Gastprofessur International Management No. Kurs Level Art SoSe 2015 WiSe 2015/16 SoSe 2016 WiSe 2016/17 1 International Business BA VL x x 2 Asian Business & Economics
Projektbericht: Aufzeichnung von
 Projektbericht: Aufzeichnung von Kosten- und Leistungsrechnung Internationale Rechnungslegung Wirtschaftsprüfung I TU Online plus Projekt im Sommersemester 2011 Projektverantwortliche: Prof. Dr. Reiner
Projektbericht: Aufzeichnung von Kosten- und Leistungsrechnung Internationale Rechnungslegung Wirtschaftsprüfung I TU Online plus Projekt im Sommersemester 2011 Projektverantwortliche: Prof. Dr. Reiner
E-Learning-Einführung für Studierende des ersten Semesters in Form eines Online-Seminars
 Raphael Zender (Hrsg.): Proceedings of DeLFI Workshops 2016 co-located with 14th e-learning Conference of the German Computer Society (DeLFI 2016) Potsdam, Germany, September 11, 2016 125 E-Learning-Einführung
Raphael Zender (Hrsg.): Proceedings of DeLFI Workshops 2016 co-located with 14th e-learning Conference of the German Computer Society (DeLFI 2016) Potsdam, Germany, September 11, 2016 125 E-Learning-Einführung
Abbildung 1 zeigt, wie verständlich die Inhalte des Seminars für die Studierenden waren. Wie verständlich wurden die Inhalte vermittelt?
 Psychologie der Geschlechter: Perspektiven auf die Identitätsentwicklung von Mädchen und Jungen Veranstaltungsnummer: 224 Dozentin: Prof. Dr. Gisela Steins Zunächst finden Sie die Angaben zur Zusammensetzung
Psychologie der Geschlechter: Perspektiven auf die Identitätsentwicklung von Mädchen und Jungen Veranstaltungsnummer: 224 Dozentin: Prof. Dr. Gisela Steins Zunächst finden Sie die Angaben zur Zusammensetzung
Merkblatt zu Wahlpflichtmodulen und Wahlmodulen in den Studiengängen Stadt- und Raumplanung der FH Erfurt. Wahlfächer SR
 Merkblatt zu Wahlpflichtmodulen und Wahlmodulen in den Studiengängen Stadt- und Raumplanung der FH Erfurt Stand: 07. März 2012 Grundlagen Die Grundlagen der Wahlfächer des Studiengangs Stadt- und Raumplanung
Merkblatt zu Wahlpflichtmodulen und Wahlmodulen in den Studiengängen Stadt- und Raumplanung der FH Erfurt Stand: 07. März 2012 Grundlagen Die Grundlagen der Wahlfächer des Studiengangs Stadt- und Raumplanung
Universitäre Prüfungen im Licht der neuen ÄAppO
 Universitäre Prüfungen im Licht der neuen ÄAppO Prof. Dr. F. Resch Studiendekan der Medizinischen Fakultät Heidelberg und Leiter des Studienganges MME, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Lieber Herr
Universitäre Prüfungen im Licht der neuen ÄAppO Prof. Dr. F. Resch Studiendekan der Medizinischen Fakultät Heidelberg und Leiter des Studienganges MME, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Lieber Herr
Leistungsbewertung im Fach Latein Sekundarstufe I/II
 Leistungsbewertung im Fach Latein Sekundarstufe I/II Inhalt: 1. Allgemeine Vorbemerkung 2. Schriftliche Leistungsüberprüfung: Klassenarbeiten 3. Sonstige Leistungen im Unterricht 4. Bildung der Zeugnisnote
Leistungsbewertung im Fach Latein Sekundarstufe I/II Inhalt: 1. Allgemeine Vorbemerkung 2. Schriftliche Leistungsüberprüfung: Klassenarbeiten 3. Sonstige Leistungen im Unterricht 4. Bildung der Zeugnisnote
MyLab Deutsche Version. Leitfaden für Studenten
 MyLab Deutsche Version Leitfaden für Studenten Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis...2 Willkommen bei MyLab Deutsche Version...3 Grundlegende Informationen zur Navigation...4 Mein Arbeitsplatz...5 Zeitplan...6
MyLab Deutsche Version Leitfaden für Studenten Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis...2 Willkommen bei MyLab Deutsche Version...3 Grundlegende Informationen zur Navigation...4 Mein Arbeitsplatz...5 Zeitplan...6
Kapitel 2, Führungskräftetraining, Kompetenzentwicklung und Coaching:
 Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
SYLLABUS Grundlagen der Allgemeinen BWL II GMT 1022
 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre-Syllabus SoSe16_GMT1022_ABWLII_Trauzettel 1/7 SYLLABUS Grundlagen der Allgemeinen BWL II GMT 1022 Betriebswirtschaftliche Prozesse, Funktionen und Entscheidungen II
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre-Syllabus SoSe16_GMT1022_ABWLII_Trauzettel 1/7 SYLLABUS Grundlagen der Allgemeinen BWL II GMT 1022 Betriebswirtschaftliche Prozesse, Funktionen und Entscheidungen II
2. Klassenarbeiten Im Fach Biologie werden in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten geschrieben.
 1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
Inhaltsübersicht. Anhang: Exemplarischer Studienplan
 Studienordnung für den Studiengang Soziologie als Ergänzungsfach im Bachelor-Kernfachstudium der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf vom 22.06.05 Aufgrund des 2 Abs. 4 und
Studienordnung für den Studiengang Soziologie als Ergänzungsfach im Bachelor-Kernfachstudium der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf vom 22.06.05 Aufgrund des 2 Abs. 4 und
Teil B Anlage V zur Studien- und Prüfungsordnung. Besonderer Teil für den Bachelorstudiengang. Energie- und Ressourcenmanagement
 Teil B Anlage V zur Studien- und Prüfungsordnung Besonderer Teil für den Bachelorstudiengang Energie- und Ressourcenmanagement ZPA/Ba-ERM 1 1. Einzelregelungen 1.1 Studienaufbau Besonderer Teil für den
Teil B Anlage V zur Studien- und Prüfungsordnung Besonderer Teil für den Bachelorstudiengang Energie- und Ressourcenmanagement ZPA/Ba-ERM 1 1. Einzelregelungen 1.1 Studienaufbau Besonderer Teil für den
Grundlagen des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens
 Vorlesung und Tutorien BWL 2 Sommersemester 2015 Grundlagen des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens Organisatorisches Prof. Dr. Wolfgang Berens insb. Controlling Vorlesung» Immer mittwochs: 7.30 10.00
Vorlesung und Tutorien BWL 2 Sommersemester 2015 Grundlagen des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens Organisatorisches Prof. Dr. Wolfgang Berens insb. Controlling Vorlesung» Immer mittwochs: 7.30 10.00
oder Klausur (60-90 Min.) Päd 4 Päd. Arbeitsfelder und Handlungsformen*) FS Vorlesung: Pädagogische Institutionen und Arbeitsfelder (2 SWS)
 Module im Bachelorstudium Pädagogik 1. Überblick 2. Modulbeschreibungen (ab S. 3) Modul ECTS Prüfungs- oder Studienleistung Päd 1 Modul Einführung in die Pädagogik *) 10 1. FS Vorlesung: Einführung in
Module im Bachelorstudium Pädagogik 1. Überblick 2. Modulbeschreibungen (ab S. 3) Modul ECTS Prüfungs- oder Studienleistung Päd 1 Modul Einführung in die Pädagogik *) 10 1. FS Vorlesung: Einführung in
Leitfaden für das Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräch Spitex Burgdorf-Oberburg
 Leitfaden für das Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräch Spitex Burgdorf-Oberburg Das Jahresgespräch ist ein ergebnisorientierter Dialog. Einleitung Das Mitarbeiterinnengespräch ist ein zentraler Baustein
Leitfaden für das Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräch Spitex Burgdorf-Oberburg Das Jahresgespräch ist ein ergebnisorientierter Dialog. Einleitung Das Mitarbeiterinnengespräch ist ein zentraler Baustein
Erfahrungen mit Moodle-Tests zur Verbesserung des Lernverhaltens im Grundstudium der Elektrotechnik
 Erfahrungen mit Moodle-Tests zur Verbesserung des Lernverhaltens im Grundstudium der Elektrotechnik am Beispiel der Module Grundlagen der Elektrotechnik und Elektrische Messtechnik 2. AALE-Konferenz 205,
Erfahrungen mit Moodle-Tests zur Verbesserung des Lernverhaltens im Grundstudium der Elektrotechnik am Beispiel der Module Grundlagen der Elektrotechnik und Elektrische Messtechnik 2. AALE-Konferenz 205,
Prof. Dr. Theresia Theurl. UK: Aktuelle M&A-Fälle (042398 WS 2015/16) Erfasste Fragebögen = 10. Auswertungsteil der geschlossenen Fragen
 UK: Aktuelle M&AFälle (098 WS 0/) Erfasste Fragebögen = 0 Globalwerte mw=, s=, Zusatzmodul Schriftliche Ausarbeitungen und Referate mw=, s=,9 Auswertungsteil der geschlossenen Fragen Legende Relative Häufigkeiten
UK: Aktuelle M&AFälle (098 WS 0/) Erfasste Fragebögen = 0 Globalwerte mw=, s=, Zusatzmodul Schriftliche Ausarbeitungen und Referate mw=, s=,9 Auswertungsteil der geschlossenen Fragen Legende Relative Häufigkeiten
Junge Menschen für das Thema Alter interessieren und begeistern Lebenssituation von älteren, hochaltrigen und pflegebedürftigen Menschen verbessern
 Stefanie Becker Vorgeschichte Die Geschichte der Gerontologie ist eine lange und von verschiedenen Bewegungen gekennzeichnet Das Leben im (hohen) Alter wird mit steigender Lebenserwartung komplexer und
Stefanie Becker Vorgeschichte Die Geschichte der Gerontologie ist eine lange und von verschiedenen Bewegungen gekennzeichnet Das Leben im (hohen) Alter wird mit steigender Lebenserwartung komplexer und
Gender und Interkulturalität
 ECTS-Bogen: Gender und Interkulturalität Studienrichtung: Spezialisierung: Seminar/Kurs: Studienpunkte (ECTS): 3 Sprache: Pflichtfach/Wahlfach: Lehrerausbildung/ BA und MA Erziehungswissenschaften Nicht
ECTS-Bogen: Gender und Interkulturalität Studienrichtung: Spezialisierung: Seminar/Kurs: Studienpunkte (ECTS): 3 Sprache: Pflichtfach/Wahlfach: Lehrerausbildung/ BA und MA Erziehungswissenschaften Nicht
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: "Tschick" von Wolfgang Herrndorf - Lesetagebuch für die Klassen 7-10
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Tschick" von Wolfgang Herrndorf - Lesetagebuch für die Klassen 7-10 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Tschick" von Wolfgang Herrndorf - Lesetagebuch für die Klassen 7-10 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel:
Die vorliegenden Unterlagen wurden im Rahmen des
 Die vorliegenden Unterlagen wurden im Rahmen des Bund-Länder-Wettbewerbs Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen 1. Wettbewerbsrunde 01.10.2011-30.09.2017 als Teil des Vorhabens der Gottfried Wilhelm
Die vorliegenden Unterlagen wurden im Rahmen des Bund-Länder-Wettbewerbs Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen 1. Wettbewerbsrunde 01.10.2011-30.09.2017 als Teil des Vorhabens der Gottfried Wilhelm
Online-Algorithmen Prof. Dr. Heiko Röglin
 Online-Algorithmen Prof. Dr. Heiko Röglin Veranstaltungsbewertung der Fachschaft Informatik 12. Oktober 2015 Abgegebene Fragebögen: 8 1 Bewertung der Vorlesung 1.1 Bitte beurteile die Gestaltung der Vorlesung.
Online-Algorithmen Prof. Dr. Heiko Röglin Veranstaltungsbewertung der Fachschaft Informatik 12. Oktober 2015 Abgegebene Fragebögen: 8 1 Bewertung der Vorlesung 1.1 Bitte beurteile die Gestaltung der Vorlesung.
Integration von Schulungsveranstaltungen der Bibliothek ins Curriculum
 Integration von Schulungsveranstaltungen der Bibliothek ins Curriculum -am Beispiel der Fakultät für klinische Medizin Mannheim der Universität Heidelberg -Jutta Bräunling (Dipl.-Bibl.) Voraussetzungen
Integration von Schulungsveranstaltungen der Bibliothek ins Curriculum -am Beispiel der Fakultät für klinische Medizin Mannheim der Universität Heidelberg -Jutta Bräunling (Dipl.-Bibl.) Voraussetzungen
EDi Evaluation im Dialog
 iskussion Ei Evaluation im ialog Sommersemester 2014 Veranstaltung Seminar Immunologie ipl.-biochemiker Franziska Weber Befragung der Studierenden am 26.06.2014 (N=12) Fragebogen für Seminare und Veranstaltungen
iskussion Ei Evaluation im ialog Sommersemester 2014 Veranstaltung Seminar Immunologie ipl.-biochemiker Franziska Weber Befragung der Studierenden am 26.06.2014 (N=12) Fragebogen für Seminare und Veranstaltungen
Keine Angst vorm Text!
 Lektürekurs zur Vorlesung Wissens- und Anwendungsbereiche der Kultur- und Sozialanthropologie : Keine Angst vorm Text! - Lesen und Verstehen von wissenschaftlicher Lektüre, Verfassen themenorientierter
Lektürekurs zur Vorlesung Wissens- und Anwendungsbereiche der Kultur- und Sozialanthropologie : Keine Angst vorm Text! - Lesen und Verstehen von wissenschaftlicher Lektüre, Verfassen themenorientierter
