Die geschlossene Volkswirtschaft: Ein Oberblick fiber einige grundlegende Konzepte
|
|
|
- Werner Fried
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Anhang Die geschlossene Volkswirtschaft: Ein Oberblick fiber einige grundlegende Konzepte Eine autarke Volkswirtschaft, die oft alsgeschlossene Volkswirtschaft bezeichnet wird, stellt aile im Inland konsumierten Guter selbst her. Wir benutzen das Modell der geschlossenen Volkswirtschaft, urn die einzelnen Konzepte und Instrumente darzulegen, die wir bei der Analyse der offenen Volkswirtschaft, d.h. einer Volkswirtschaft, die sich am internationalen Handel beteiligt, verwenden. Selbstverstiindlich kann ein solcher Anhang keinen vollstiindigen Oberblick tiber die relevanten Modelle geben. Der Leser sei deshalb an die verschiedenen Lehrbucher verwiesen, die sich mit den einzelnen Themen befassen. Produktion Die Transformationskurve. Der Bestand an Produktivkriiften, der einem Land zu einem bestimmten Zeitpunkt zur VerfUgung steht, ist in der Regel fixiert. Es gibt nur eine bestimmte Bodenmenge, eine bestimmte Bev6lkerungszahl - womit das Arbeitsangebot gegeben ist - und einen bestirnmten Bestand an Sachkapital1 ). Mit Hilfe dieser Produktivkriifte oder Produktionsfaktoren lassen sich die Guter herstellen, die von der Bev6lkerung gewiinscht werden. Da die Faktoren in ihrem Bestand begrenzt sind, kann auch nur eine begrenzte Gutermenge produziert werden. Solange die Bedurfnisse der Konsumenten nicht vollstiindig befriedigt sind, werden immer mehr Guter nachgefragt, als mit den verfiigbaren Produktionsfaktoren hergestellt werden k6nnen. Foiglich m u ~ eine Wahl zwischen den verschiedenen Produkten getroffen werden, die ein Land unter Einsatz aller vorhandenen Ressourcen erzeugen kann. Zur Vereinfachung nehmen wir an, es gebe nur zwei Guter in unserem Land, Tuch und Weizen. (Man kann sich bier auch Robinson Crusoe auf seiner In- 1) Diese Annahme gilt natiirlich nur begrenzt. Bei steigenden Bodenpreisen ist eine zunehmende Nutzung von "Grcnzboden" zu erwarten: Wiistenland kann bewassert, Siimpfe trocken gelegt, Seen oder Meeresbuchten aufgeflillt werden. Analog konnen Lohnsteigerungen das Arbcitsangebot erhohen; die Bereitschaft zu Uberstunden nimmt zu, Hausfrauen werden beruflich tatig, der Pensionseintritt wird hinausgezogert. Dennnoch ist es flir einen ersten Ansatz angebracht, von einem gegebenen Bestand an Produktionsfaktoren auszugehen.
2 Produktion 233 sel vorstellen.) Werden alie Faktoren in der Tuchproduktion eingesetzt, gibt es eine bestimmte Menge Tuch, die beim gegebenen technischen Wissen maximal erzeugt werden kann. EbenfalIs existiert eine maximale Weizenrnenge, die unter Einsatz alier verfligbaren Ressourcen produziert werden kann. Davon abgesehen konnen nattirlich Tuch und Weizen zusammen in verschiedenen Kombinationen hergesteut werden. Urn eine zusatzliche Einheit Weizen zu produzieren, m u die ~ Tuchproduktion reduziert werden, damit die erforderlichen Produktionsfaktoren freigesetzt werden konnen. Die Tuch-Weizen-Kombinationen, die maximal erzeugt werden konnen, zeigen die Produktionsmoglichkeiten des Landes an. Diese Produktionsmoglichkeiten lassen sich graphisch darstellen. In Abb. A-I sind die Weizenrnengen entlang der Abszisse und die Tuchmengen entlang der Ordinate abgetragen. Tuch A ~ - _ 8E Erreichbare Kombinationen 8F Unerreichbare Kombinationen Abb.A-l o In dieses Koordinatensystem werden nun alle Tuch-Weizen-Kombinationen eingezeichnet, die maximal produziert werden konnen. Die Gesam theit dieser Punkte beschreibt die Produktionsmoglichkeitenkurve (production possibility curve) oder Transformationskurve AB unseres Landes. Technische Effizienz. AIle Punkte auf der Transformationskurve sind effizient im technischen Sinn, d.h. mit den gegebenen Ressourcen und der gegebenen Produktionstechnik kann keine grobere Menge des einen Gutes produziert werden, ohne zugleich die Erzeugung des anderen Gutes einzuschranken. Aus dieser Definition technischer Effizienz folgt, dab alle Punkte wie E, die unterhalb der Transformationskurve AB liegen, technisch inefflziente Produktionspunkte sind.
3 234 Die geschlossene Volkswirtschaft Die Giiterbiindel, die unter Einsatz der verftigbaren Produktionsfaktoren und mit dem vorhandenen technischen Wissen erzeugt werden konnen, bezeichnet man auch als die realisierbaren Giiterkombinationen. Die Gesamtheit aller realisierbaren Giiterkombinationen s c h l alle i e technisch ~ t efflzienten (d.h. Punkte auf der Kurve) wie technisch inefflzienten (Punkte unterhalb der Kurve) Giiterkombinationen ein. Selbstverstandlich interessiert uns vor allem der Tell der realisierbaren Giiterbiindel, der maximal erzeugt werden kann, d.h. die Giiterbiindel auf der Transformationskurve. Es gibt im wesentlichen zwei Griinde, weshalb ein technisch efflzienter Produktionspunkt nicht verwirklicht wird. Der erste Grund ist der, d ein ~ Tell der Produktionsfaktoren nicht beschliftigt oder unterbeschliftigt ist: Betriebe arbeiten unterhalb ihrer Kapazitlitsgrenze, Arbeitskrlifte sind ohne Beschliftigung, natiirliche Ressourcen liegen ungenutzt. Aber auch bei vollem Einsatz aller Ressourcen ist es moglich, d kein ~ Punkt auf der Transformationskurve realisiert wird. Der Grund ist ein falscher Ressourceneinsatz: Produktionsfaktoren werden nicht dort eingesetzt, wo ihre Produktivitlit am g r o ~ ist, t so e n d die ~ Gesamtausbringung unter ihr maximales Niveau rallt. Zum Beispiel konnen wir uns vorstellen, d hochqualiftzierte ~ Ingenieure Lastwagen fahren und die Lastwagenfahrer am R e i ~ bstehen. r e t t Offensichtlich l i e sich ~ e durch einen Beschliftigungswechsel die Gesamtproduktivitlit steigern. Giiterkombinationen, die oberhalb der Transformationskurve liegen wie F, bezeichnet man als nicht-realisierbar. Unter den gegebenen Voraussetzungen, d.h. dem Bestand an Produktivkrliften und dem technischen Wissen, ist es unmoglich, Giiterbiindel zu produzieren, die oberhalb der Transformationskurve liegen. Opportunitiitskosten und Grenzrate der Transformation. Wie wir bereits ausfiihrten, l l i sich ~ t die Produktion eines Gutes nur bei entsprechender Einschrlinkung der Produktion des anderen Gutes ausdehnen. Die Menge Weizen, die aufgegeben werden m u urn ~, eine zuslitzliche Einheit Tuch herstellen zu konnen, stellt die Opportunitiitskosten (opportunity cost) oder Alternativkosten einer Einheit Tuch dar. Die Bezeichnung Opportunitlits- oder Alternativkosten weist darauf hin, d die ~ Produktion eines Gutes nur bei Aufgabe von Alternativproduktionen anderer Giiter moglich ist. Die Opportunitlitskosten konnen unterschiedlich hoch sein, wenn wir uns entlang der Transformationskurve bewegen. Die Grenzrate der Transformation (GRT) ist defmiert als die Rate, urn die die Produktion des einen Gutes eingeschrlinkt wird, urn eine zuslitzliche Einheit des anderen Gutes zu erhalten. Graphisch entspricht die Grenzrate der
4 Produktion 235 Transformation der negativen Steigung der Transformationskurve. Betrachten wir Abb. A-2. In Punkt A produziert das Land 4 Einheiten Tuch und 10 Einheiten Weizen. Urn eine Weizeneinheit mehr herstellen zu kannen, mlill an dieser Stelle auf 2 Einheiten Tuch verzichtet werden. Anders ausgedriickt: die Opportunitatskosten der elf ten Einheit Weizen betragen 2 Einheiten Tuch, oder in der neuen Terminologie, die Grenzrate der Transformation von Tuch zu Weizen ist gleich 2. Dies entspricht der negativen Steigung der Transformationskurve zwischen den Punkten A und B2). Tuch II Tuch r 2 Abb. A-2 o Weizen Wir kannen folglich schreiben GRT = - f, T u ~ h f, WelZen (A-I) Zunehmende, abnehmende und konstante Opportunitiitskosten. Die einzelnen Faktoren, die die Form der Transformationskurve beeinflussen, werden ausftihrlich im Kapitel4 behandelt. Hier wollen wir nur kurz der Frage nachgehen, welche Implikationen sich aus den verschiedenen Verlaufen der Transformationskurve ergeben. Vom Ursprung betrachtet, kann die Transformationskurve konkav (Abb. A-3); konvex (Abb. A-4) oder gerade (Abb. A-S) verlaufen. Ein konkaver Verlaufindiziert zunehmende Opportunitatskosten, 2) Tatsachlich andert sich die Steigung der Transforrnationskurve zwischen den Punkten A und B. Wir rnessen hier nur die Steigung der Geraden zwischen beiden Punkten. Wird der Abstand zwischen beiden Punkten irnrner kleiner, bis es sich nur noch urn eine inrmitesirnal kleine Verschiebung handelt. wird die Gerade zur Tangente an die Transforrnationskurve.
5 236 Die geschlossene Volkswirtschaft Tuch Tuch Fallende Alternativkosten Tuch Konstante Alternativkosten Weizen 0 Weizen Abb.A-3 Abb.A-4 Abb.A-S d.h. je mehr die Produktion des einen Gutes erweitert wird, desto g r a ~ e r e Mengen des anderen Gutes miissen zur Erzeugung einer zusatzlichen Einheit des ersten Gutes aufgegeben werden. Zusatzliche Weizeneinheiten werden also ausgedriickt in Tucheinheiten, immer kostspieliger, was besagt, dafl die Altemativkosten wachsen. Der gleiche P r o zl e a sich ~ t auch in umgekehrter Richtung zeigen: um weitere Tucheinheiten zu erzeugen, m auf ~ die Produktion immer g r a ~ Weizenmengen e r e r verzichtet werden. Der Fall abnehmender Opportunitatskosten ist in Abb. A-4 illustriert. Hier kannen zusatzliche Weizeneinheiten durch den Verzicht auf immer kleinere Tuchmengen produziert werden. Abbildung A-5 zeigt konstante Opportunitatskosten. Die Menge eines Gutes, die aufgegeben werden m u um ~, eine zusatzliche Einheit des anderen Gutes herstellen zu kannen, bleibt die gleiche. Die Opportunitatskosten der Weizenproduktion in Einheiten von Tuch sind also fur den gesamten Bereich der Transformationskurve konstant, so d die ~ Transformationskurve die Form einer Gerade annimmt. Der Zwei-Faktoren-Fall 1. /soquanten. Die graphische Darstellung einer Produktionsfunktion fur den Fall von 2 Faktoren erfolgt mit Hilfe von Isoquanten. Eine Isoquante ist detiniert als der geometrische Ort aller Faktorkombinationen, die die gleiche Ausbringung erzielen. Die Faktoreinsatzmengen werden entlang der Achsen gemessen. In Abbildung A-6 ist Arbeit (L) auf der Abszisse und Kapital (K) auf der Ordinate abgetragen. Aus den Informationen tiber die Art der Produktionsfunktion l ~ sich t eine ganze Schar von Isoquanten flir verschiedene Ausbringungsniveaus ableiten, wie Abb. A-6 illustriert. Die Steigung einer Isoquante entspricht der technischen Grenzrate der Substitution (TGRS) der beiden Faktoren. Die technische Grenzrate der Substitution ist defmiert als die Menge eines Faktors, auf die unter Beibehaltung des A u s s t o ~ verzichtet n i v e a werden u s kann, wenn der Einsatz des anderen
6 Produktion 237 Produktionsfaktor Kapital Abb.A-6 Produktionsfaktor Arbeit Faktors um eine Einheit erhoht wird. Damit die Produktionsmenge konstant bleibt, m folglich ~ der Produktionsfall auf Grund kleinerer Einsatzmengen des einen Faktors durch eine Produktionssteigerung kompensiert werden, die durch den v e r g r o Einsatz ~ e r t des e n ersten Faktors erzielt wird. Die Steigung der Isoquante zeigt die Mengen von K an, die aufgegeben werden konnen, wenn eine zusatzliche Einheit von L hinzugefligt wird. Die technische Grenzrate der Substitution ist also gleich der negativen Steigung (- tl K / tl L). TGRS KA = - ~ ~ (A-2) Um die okonornisch efflzienteste Faktorkombination fur einen gegebenen A u s szu tbestimmen, o ~ mussen wir relative Faktorpreise in unsere Analyse einflihren. Sie sind in Abb. A-6 durch die Steigung der Preisgeraden - tl K / /j, L angegeben. Der Faktoreinsatz ist in dem Punkt optimal, in dem die Preisgerade die Isoquante mit dem gewtinschten Produktionsniveau tangiert. In unserer Zeichnung ist dies der Punkt P, in dem die folgenden Bedingungen erflillt sind. tlk PA TGRS KA = - tl A = P A (A-3) Die technische Grenzrate der Substitution von Kapital durch Arbeit ist gleich dem umgekehrten Preisverhiiltnis. Ein Isoquantensystem ist durch folgende vier Eigenschaften charakterisiert: (1) Isoquanten haben eine negative Steigung. Das h e i ~ d t, die ~ Abnahme eines Faktors durch die Zunahme des anderen Faktors kompensiert werden m ~ wenn, die Gesamtausbringung konstant bleiben soli.
7 238 Die geschlossene Volkswirtschaft (2) Isoquanten sind konvex zum Ursprung. Ein zunehmender Verzicht auf den einen Faktor erfordert immer gr6bere zusatzliche Einheiten des anderen Faktors. Anders ausgedriickt, die Rate, mit der die Faktoren substituiert werden k6nnen, nimmt ab (Gesetz der abnehmenden Grenzrate der Substitution). (3) Isoquanten k6nnen sich nicht schneiden. Dies 11i.Bt sich leicht an Hand von Abbildung A-7 demonstrieren. Die Faktorkombinationen A und C liegen auf der gleichen Isoquante 10 und erbringen somit die gleiche Ausbringung. Analoges gilt fur A und B, die beide auf der Isoquante II liegen. Wenn gilt, dab A die gleiche Ausbringung wie B anzeigt und femer A die gleiche Ausbringungwie C anzeigt, mtissen auch B und C die gleiche Ausbringung an- Tuch o Abb. A-7 Weizen zeigen. Da eine Isoquante als der geometrische Ort gleicher Ausbringungsniveaus definiert ist, mtissen B und C auf der gleichen Isoquante liegen. Dies ist jedoch in unserer Zeichnung nicht der Fall. Auch ist in B der Einsatz beider Faktoren gr6ber als in C, wonach die Produktion in B gr6ber als in C sein millhe. Der Widerspruch ist nur zu 16sen, wenn postuliert wird, dab Isoquanten sich nicht schneiden k6nnen. (4) Isoquanten, die weiter vom Ursprung entfemt sind, geben ein h6heres AusstoBniveau an. Jeder Punkt des nordostlichen Quadranten wird von einer Isoquante bedeckt. Neben der Bestimmung des optimalen Faktoreinsatzes fur eine gegebene Ausbringung gilt es, die optimalen Faktorkombinationen fur alle Ausbringungsniveaus zu ermitteln. Das heibt, die Tangentialpunkte der Faktorpreisgeraden mit allen Isoquanten sind zu bestimmen. Der geometrische Ort aller Op-
8 Produktion 239 timalpunkte wird der Expansionspfad genannt. Er beschreibt die bei gegebenen relativen Faktorpreisen jeweils optimalen Faktorkombinationen fur jedes Produktionsniveau. Zur illustration des Expansionspfades vergleiche Abbildung A-8. Produktionsfaktor Kapital _ Expansionspfad Preis Linien Abb.A-8 Produktionsfaktor Arbeit 2. Homogene und homothetische Funktionen. Unter den verschiedenen Isoquantensystemen kommt den homothetischen und homogenen Isoquanten die meiste Bedeutung fur die okonomische Analyse zu. Homothetische Isoquanten sind dadurch charakterisiert, d die ~ technischen Grenzraten der Substitution entlang eines StraWs vom Ursprung konstant sind. Das heist, die Isoquanten haben in den Schnittpunkten mit einem beliebigen Strahl vom Ursprung die gleiche Steigung. Vergleiche Abb. A-9. Flir homothetische Isoquanten gilt: F (bx) ~ Ijt (b) F (x) (A-4) fur alle Werte von b > 0 und fur alle Vektoren x, fur die die Funktion F (x) defmiert ist. Homogene Isoquanten bilden eine Untergruppe der homothetischen Isoquanten, bei der die Beziehung Ijt (b) die Form br annimmt. Fiir alle homogenen Isoquanten gilt die Beziehung: F (bx) ~ br F (x) (A-S) Der Exponent r gibt den Homogenitiitsgrad an. Funktionen, bei denen r ~ 1 ist, heisen homogen vom Grade eins oder linear-homogen. In diesem Fall fiihrt eine Verdoppelung aller Einsatzmengen zu einer Verdoppelung des Out-
9 240 Die geschlossene Volkswirtschaft Kapital Homothetische Isoquanten o Arbeit Abb.A-9 put. Anders ausgedriickt, werden alle Inputfaktoren in einem bestimmten Verhiiltnis erhoht, steigt der Output im gleichen VerhlHtnis, und zwar unabhiingig von der Hohe des Produktionsniveaus. Die Skalenertdige sind also konstant. Graphisch zeichnen sich linear-homogene Funktionen dadurch aus, d Isoquanten ~ mit einem doppelt so hohen Produktionsniveau genau doppelt so weit yom Ursprung entfemt sind. 3. Faktorintensitiit. Abbildung A-lO zeigt die Isoquantensysteme fur zwei GUter, Tuch und Weizen. Beim gegebenen Faktorpreisverhiiltnis setzt die Tuchindustrie im Vergleich zur Weizenindustrie beijedem Produktionsniveau relativ mehr Kapital und relativ weniger Arbeit ein. Andererseits verwendet der Weizensektor im Vergleich zur Tuchindustrie relativ mehr Arbeit als Kapital. Die Tuchproduktion ist folglich als relativ kapitalintensiv und die Weizenproduktion als relativ arbeitsintensiv zu bezeichnen, ohne d die ~ absoluten Faktoreinsatzmengen in beiden Bereichen angegeben werden mussen. Was nur ziihlt, sind die relativen und nicht die absoluten Faktorintensitaten. Damit liilllt sich die schwierige Aufgabe umgehen, einen gemeinsamen M ~ stab fur die ungleichen Faktoren zu finden. 4. Das Edgeworth-Box-Diagramm. Zur Darstellung der optimalen Faktorkombinationen bei der Produktion zweier GUter dient das Edgeworth-Box Diagramm. In Abb. A-ii ist das Isoquantensystem fur Weizen in der \iblichen Lage und das Isoquantensystem fur Tuch in umgekehrter Lage eingezeichnet. Der Ursprung des Tuch-Koordinatensystems liegt in dei oberen
10 Produktion 241 Produktionsfaktor Kapital Expansionspfad fur Tuch Isoquanten fur Tuch Expansionspfad fur Weizen \ I'w } Isoquanten fur Weizen Abb.A-10 Produktionsfaktor Arbeit Arbeit in Tuch Produktion Kapital in Produktion Weizen Tuchausgangspunkt Weizenausgangspunkt Abb.A-ll Arbeit in Weizenproduktion Kapital in Tuchproduktion rechten Ecke des Diagramms. Die Seiten des Rechtecks repriisentieren die Faktormengen, die dem Land zur Verftigung stehen. In vertikaler Richtung ist der Bestand an Sachkapital, in horizontaler Richtung der Bestand an Arbeit abgetragen. Es gilt nun, den optimalen Faktoreinsatz zu bestimmen. Die Faktorverteilung i ~ optimal, t wenn durch eine Reallokation der Faktoren die Produktion
11 242 Die gcschlosscne Volkswirtschaft des einen Gutes nicht weiter erhoht werden kann, ohne zugleich die Erzeugung des anderen Gutes einzuschranken. Die Orte optimaler Faktorverteilung liegen dort, wo sich jeweils eine Tuch- und Weizenisoquante tangieren. Die Verbindungslinie aller Optimalpunkte U, V, Wist die Kontraktkurve. In allen ihren Punkten ist die Bedingung erftillt, d die ~ technischen Grenzraten der Substitution von Kapital durch Arbeit in der Produktion beider Giiter iibereinstimmen. In der Gleichungsform gilt: TGRS T = TGRSw (A-6) 1st diese Bedingung nicht erftillt, l a sich ~ t durch eine Umverteilung der Faktoren die Produktion eines Gutes bei g1eichzeitiger Konstanz der Produktion des anderen Gutes ausweiten. Punkt X, der nicht auf der Kontraktkurve liegt, ist hierftir ein Beispiel. Bewegen wir uns von X nach V, andert sich das Ausbringungsniveau der Tuchproduktion nicht, da sich beide Punkte auf der gleichen Tuchisoquante befinden. Die Weizenerzeugung steigt jedodl auf das Niveau der hoher gelegenen Weizenisoquante I'. Durch eine Reallokation der Ressourcen l a sich ~ t also die Weizengesamtausbringung v e r g r o Erst ~ e r n. wenn ein Punkt auf der Kontraktkurve erreicht ist, ist es nicht mehr moglich, mehr von einem Gut herzustellen, ohne zugleich die Erzeugung des anderen Gutes zu drosseln. Konsum Giiter werden produziert, damit sie konsumiert werden konnen. Durch den Konsum realisiert der Konsument einen bestimmten Nutzen, und es wird unterstellt, d a der f ~ Konsument seinen Nutzen aus dem Konsum zu maximieren versucht. Urn dieses liel zu erreichen, m u er ~ sich rational verhalten, was unter anderem e i n s c h ldi a e seine ~ t, Entscheidungen transitiv sein miissen. Transitivitat der Entscheidungen liegt dann VOf, wenn ein Konsument, der die Situation X der Situation Y und die Situation Y der Situation l vorzieht, bei der Wahl zwischen X und l eindeutig X bevorzugt. Ein solches Verhalten macht es moglich, eine genaue Praferenzskala flir alle Giiter oder Giiterbiindel aufzustellen. Diese Praferenzskala bezieht sich nur auf den ordinalen Nutzen. Es wird nicht erwartet, d a der ~ Konsument angeben kann, urn wieviel mehr er ein Gut einem anderen vorzieht. Auch ist die M6glichkeit e i n z u s c h 1 i e ~ e d der ~ Konsument zwischen zwei Giiterbiindeln indifferent ist, wenn ihm beide den g1eichen Nutzen stiften. Indifferenzkurven. Der Umstand, d a ~ verschiedene Giiterbiindel dem Konsumenten einen g1eich hohen Nutzen stiften k6nnen, soli nun genauer untersucht werden. Wird der Konsumeines Gutes eingeschrankt, ist es in der Re-
12 Konsurn 243 gel maglich, den dadurch bedingten Nutzenabgang dutch vermehrten Verbrauch eines anderen Gutes zu kompensieren. Stimmen Nutzenzugang infolge erhohten Konsums des anderen Gutes und Nutzenabgang genau Uberein, ist anzunehmen, d a der ~ Konsument beiden Situationen gegenuber indifferent ist, da sein Nutzenniveau insgesamt konstant geblieben ist. Zeichnen wir alle verschiedenen GUterkombinationen, die dem Konsumenten den gleichen Nutzen bringen, in ein Koordinatensystem ein, erhalten wir die sogenannte Indifferenzkurve. Die Bezeichnung "Indifferenzkurve" weist darauf hin, d der ~ Konsument zwischen den verschiedenen GUterbUndeln, die einen gleich hohen Nutzen beinhalten, indifferent ist. Abb. A-12 zeigt eine solche Indifferenzkurve fur die GUter Tuch und Weizen. Tuch Bevorzugte Guter KombIOstlonen Untergeordnele GUlerkombinSlionen Indifferenz ----Kurve o Abb. A-12 Weizen Indifferenzkurven haben iihnliche Eigenschaften wie Isoquanten: (1) Sie haben eine negative Steigung. (2) Sie sind konvex zum Ursprung. (3) Sie konnen sich nicht schneiden. (4) Je weiter sie yom Ursprung entfernt liegen, desto haher ist ihr Nutzenindex. Der wesentliche Unterschied zum Isoquantensystem besteht jedoch darin, d a Indifferenzkurven ~ nicht die Hohe des jeweiligen Nutzenniveaus in numerischen Werten anzeigen. Sie geben nur eine Priiferenzskala flir die betreffenden GUterbUndel an, ohne anzuzeigen, wie g r die o ~ Priiferenz flir eine bestimmte GUterkombination im Vergleich zu einer anderen ist. Diese Art der Nutzenmessung, die allein auf einen
13 244 Die geschlossene Volkswirtschaft Vergleich zwischen "besser oder schlechter als" abstellt, bezeichnet man als ordinale Nutzenmessung. U i sich ~ t die H6he des Nutzen numerisch messen, spricht man von kardinaler Nutzenmessung. lndifferenzkurven, deren Steigung entlang eines StraWs vom Ursprung die gleiche ist, heffien homothetische lndifferenzkurven, analog den homothetischen Isoquanten. Die Grenzrate der Substitution. Zum A b s c wollen h l u wir ~ noch etwas tiber die Steigung der Indifferenzkurve aussagen. Wie wir schon sagten, beschreibt eine Indifferenzkurve die Gesamtheit aller Tuch-Weizen-Kombinationen, die dem Konsumenten den gleichen Nutzen stiften. Wenn wir uns entlang einer Indifferenzkurve bewegen, bedeutet das, d a einige ~ Einheiten Weizen aufgegeben werden, urn zusatzliche Einheiten Tuch zu erhalten (oder umgekehrt). Das Verhiiltnis, in dem beide Gtiter gegeneinander ausgetauscht werden k6nnen, ohne das Nutzenniveau zu veriindem, wird die Grenzrate der Substitution (GRS) g e n Graphisch ~ t. ist die Steigung der Indifferenzkurve durch den Quotienten von Xnderung der Tuchmenge /::, T durch Xnderung der Weizenmenge /::, W gegeben und der negative Wert dieser Steigung (- /::,T//::,W) ist als die Grenzrate der Substitution von Tuch durch Weizen definiert. Es gilt also: GRS WT = - /::,T /::, W Bestimmung des Gleichgewichts Mit Hilfe der oben abgeleiteten Instrumente l a sich ~ t nun die optimale Produktions- und Konsumstruktur eines Landes bestimmen. Wir beginnen mit einer gegebenen Transformationskurve, die die Produktionsmoglichkeiten des Landes beschreibt und einer gegebenen Schar von Indifferenzkurven, die die Konsumgewohnheiten der Bevolkerung reflektieren (vgl. Abb. A-13). 1m Ausgangszustand produziert das Land im Punkt P der Transformationskurve. Da es sich urn eine geschlossene Volkswirtschaft handelt, zeigt P zugleich die fur den Konsum bereitstehenden Tuch- und Weizenmengen an. Bei diesem Gtiterbtindel erzielen die Konsumenten einen Nutzen entsprechend der Indifferenzkurve 11' die durch Punkt P geht. Wird nun die Produktionsstruktur so umgestellt, d mehr ~ Weizen und weniger Tuch erzeugt werden, lassen sich nacheinander hohere Indifferenzkurven erreichen. 1m Punkt P' ist die bei den gegebenen Produktionsmoglichkeiten hochste Indifferenzkurve 13 erreicht. Hier tangieren sich Transformationskurve und Indifferenzkurve; sie haben also in P' die gleiche Steigung. Da nun die Steigung der Transfor-
14 Bestimmung des Gleichgewichts 245 Tuch o Abb. A-13 mationskurve gleich der Grenzrate der Transformation und die Steigung der Indifferenzkurve gleich der Grenzrate der Substitution ist, folgt daraus, dafj die Produktions- und Konsumstruktur dann optimal ist, wenn die Grenzrate der Transformation in der Produktion und die Grenzrate der Substitution im Konsum iibereinstimmen. Der Tangentialpunkt von Transformations- und Indifferenzkurve wird auch als der okonomisch effiziente Punkt bezeichnet. Wie wir uns erinnem, sind aile Punkte auf der Transformationskurve effizient im technischen Sinne. Unter diesen technisch effizienten Produktionspunkten, die die maximale Ausbringung bei gegebenem technischen Wissen und gegebenem Faktorbestand anzeigen, gibt es einen Punkt, der okonomisch optimal ist, da er dem Land das hochste Nutzenniveau garantiert. Das Austauschverhiiltnis 1m Punkt P' der Abb. A-14 werden Tuch und Weizen im Verhiiltnis IJ. T / IJ. W getauscht. Dieses reaze AustauschverhaZtnis wird oft die terms of trade genannt. Sind erst einmal die Austauschmengen beider Guter fixiert, lassen sich die relativen Preise leicht ermitteln. So sind die relativen Preise zweier GUter umgekehrt proportional den Mengen, in denen die beiden Guter getauscht werden. Steigt der Preis des einen Gutes in Relation zum ande-
15 246 Die geschlossene Volkswirtschaft Tuch o Weizen Abb.A-14 ren Gut, bedeutet das, d man ~ im Austausch gegen letzteres Gut eine kleinere Menge des ersten Gutes als zuvor erhlilt. Die am heimischen Markt geltenden terms of trade sind gleich der Steigung der Tangente im Beriihrungspunkt von Transformations- und Indifferenzkurve. In diesem Tangentialpunkt, dem Punkt P' der Abbildung A-14 sind die Gleichgewichtsbedingungen fur eine geschlossene Volkswirtschaft erftillt: Die Grenzrate der Transformation in der Produktion stimmt mit der Grenzrate der Substitution im Konsum tiberein und beide sind gleich dem realen Austauschverhliltnis bzw. dem umgekehrten Preisverhliltnis. GRSTW = :; = - ~ = ~ GRTTW Somit sind die Produktions- und Konsummengen fur beide GUter, ihre relatiyen Preise und ihr reales Austauschverhliltnis (terms of trade) eindeutig determiniert. In einer geschlossenen Volkswirtschaft ist die optimale Produktions- und Konsumstruktur erreicht, wenn die Grenzrate der Transformation [iir zwei beliebige Gilter gleich der Grenzrate der Substitution dieser beiden Gilter ist.
16 Sachverzeichnis Aggregationsprobleme 33 Analytischer Rahmen 11 Annahmen 15 Arbeitswerttheorie 44 Arrow, K., 80f., IS3f., 231f. Austauschverhiiltnis 245 Gleichgewichtsaustauschverhiiltnis 92 intemationales - 98 reales und U n d e r 126 g r o ~ e Autarkie (Wohlstand unter -) 220 Balassa, B., 58f., 196f., 211f. Basevi, G., 196f. Bhagwati, J., 175f. Bharadwaj, R., 83f. Chenery. H., 80f., 153f., 177f. Deutsch, K., 176f. Eckstein, A., 176f. Economies of scale s. Skalenertrage Edgeworth-Box-Diagramm 63, 241 Effektivzolll91, 194 Eft]zienz 233 okonomische technische Einkommenselastizitat Einkommensverteilung 89 Elastizitat Empirische Bestatigungen 12 Empirische Schatzungen, Probleme 31 Europaische Freihandelszone 199 Europiiische Wirtschaftsgemeinschaft 177, 199,211,212 Expansionspfad 239 Export - Angebot 29 - Studien 57 Faktorangebot und Transformationskurve 150 variables Faktorausstattung 75, und Heckscher-Ohlin-Theorem 81 Faktorbestandsanderungen autonome Faktorintensitaten 70, 77, 81, und Reversibilitat 145, 153 Faktorknappheit 133 Faktorpreis 132, 237 -anderungen und realisierbarer Bereich 137 Argumente gegen vollstandigen Faktorpreisausgleich 142 -ausgleich 138 -gerade 134 Umkehr des a ~ e n h a n d e l s i n d u z i e r t e F a k t o r i 132 i b e r f l ~ Freihandelszone 199 Funktionen homogene homothetische - 239, 244 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 178 Gesamtangebot 25 Gesamtnachfrage 26 Geschlossene Volkswirtschaft Gesellschaftliche Indifferenzkurven 85 Ableitung 85 Argumente fur - 89 Probleme 87 Steigung 86 Gleichgewicht Bestimmung des generelles - 24 multiples partielles - 24 Stabilitatskriterien fur Grenzrate - der Substitution 242, der technischen Substitution - der Transformation 234 Giiterkombinationen, realisierbar 234
17 248 Sachverzeichnis Haberler, G., 50f. Handelsablenkende Wirkungen 23 Handelsgewinn 217 Handelsindifferenzkurven 103 S t e i g uder n -g 105 s m ~ Handelsschaffende Vlirkungen 201 Heckscher, E., 77f. Heckscher-Ohlin-Theorem 77, 81, 131 Heller, H.R., 202f. Houthakker, H.S., 35f., 100f. Hypothesen 11 Ichimura, S., 83f. Immizerizing growth 175 Importnachfrage 29 Indifferenzkurven 85, 243 Infant industry 180 Input-Output Tabelle 82 Integration Wohlfahrtseffekte der Internationales Austauschverhiiltnis 93 Gleichgewicht des Gleichgewichtsbedingungen des - 48 Grenzen des - 47 Unbestimmtheitsregion des und Zolle 183 Isoquanten 236 Johnson, H.G., 204f., 212f. Kapital-Arbeits-Verhii1tnis 82, Komparativer Vorteil45 Kompensationszahlungen Konsum , Konsumeffekt - aufwachstum auf Produktion Konsummoglichkeitskurve Kontraktkurve Kosten komparative - 45, 47, 57 konstante - 42, 121, 235 sinkende - 56, 235 steigende - 40, 54, 67, 235 m-giiter, n-uinder Fall MacDougall, G.D.A., 58f.. Magee, S., 35f. Mengenanpasser 53 MefUehler 33 Methodologie 11 Mill, J.S., 39 Minhas, B., 80f., 153f. Modell 12 n-liinder, m-giiter Nachfrage 26 - und inverser Handel 96, 114, 140 Neutralitiit des Geides 15 Nominalzoll180 Normative Okonomik 12 Nutzenmoglichkeitskurve 228 Offene Volkswirtschaft 232 Ohlin, B., 77f. Okonomisch efflzienter Punkt 245 Opportunitiitskosten 50, 66, 234 Optimale Faktorverteilung 64 Optimalzolll85,220 Partielles Gleichgewicht 24 Positive Okonomik 11 Potentieller Wohlstand 222 Priiferenzstrukturen 85 Prais, S., 100f. Preiselastizitlit Preisgerade 134 Produktion 62-84, optimale und Wachstum 155 Produktionsfaktor , 232 Mobilitiit des Spezialisierung des Produktionsfunktion 79, 153, 239 Produktionsmoglichkeitskurve 40, 232 globale und Faktorangebot 150 Punkt-Nutzenmoglichkeitskurve 229 (point utility possibility curve) Liindergrofl>e 28-29, 51, 123 Reciprocal demand curve 109 Lateinamerikanische Freihandelszone 178 Retorsionszoll 188 Leontief, W., 81 Ricardo, D., 39,44,50
18 Sachverzeichnis 249 Richtung des Handels 46,92, 97, 114 Roskamp, K., 83f. Samuelson, P., 92f., 202f., 223f. Selbstversorgung 179 Situations-Moglichkeitskurve 229 (situation possibility curve) Skalenertrage 80,153 abnehmende - 65 konstante - 63 unterschiedliche - 67 zunehmende - 67 Smith, A., 39 Solow, R., 80f., 153f. Spezialisierung 39 - der Produktionsfaktoren und Gewinn 217 vollstandige - 52,143 Spezialisierungsstruktur 123 Stabilitatskriterien 116 Stern, R., 58 Stolper, W., 83, 223 Stolper-Samuelson-Theorem 223 Tatemoto, M., 83f. Tauschkurve 109 Elastizitat der Marshallsche - 97 Meadesche Tauschverhiiltnis 45, 245 Tauschwirtschaft 15 Taussig, F., 39f., 50 Technischer Fortschritt 168 neutraler nicht neutraler und Wachstum 168 Theorem der Unmoglichkeit 231 Theorie 13 Thompson, E., 81f. Transformationskurve s. Produktionsmoglichkeitskurve Transitivitat 242 UberschuJ1 -angebot 28 -nachfrage 28 -tauschkurve 207 Verdoorn, P.I., 212f. Vorhersage 12 Wahl, D.F., 83f. Walters, A.A., 80f. Welthandel20-21 Volumendes Welthandelsmatrix 20 Wilford, W.T., 211f. Wohlstand der Welt eines Landes einzelner Wirtschaftsobjekte 223 Wohlstandseffekt des internationalen Handels 213 Wohlstandsfunktion 231 Zeitlicher Anpassungspfad 34 Zeitperiode 31 Zeitreihen 31 Zentralamerikanische Wirtschaftsgemeinschaft 211 Zoll einfluj1 auf Faktorpreise 226 -einnahmen 184 Retorsions-188 -schutzargumente 179 -struktur 191 -wirkungen 180 -zyklen 190 Zollunion 199 Wirkllngen einer handelsschaffende Wirkungen einer handelsablenkende Wirkungen einer und allgemeine Gleichgewichtsanalyse 207
IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte ( )
 IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte (239.255) SS 2008 LVA-Leiter: Andrea Kollmann Einheit 5: Kapitel 4.3-4.4, 6 Administratives Fragen zum IK??? Fragen zum Kurs??? Die Marktnachfrage Die Marktnachfragekurve
IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte (239.255) SS 2008 LVA-Leiter: Andrea Kollmann Einheit 5: Kapitel 4.3-4.4, 6 Administratives Fragen zum IK??? Fragen zum Kurs??? Die Marktnachfrage Die Marktnachfragekurve
IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte
 LVA-Leiter: Martin Halla Einheit 6: Die Produktion (Kapitel 6) Einheit 6-1 - Theorie der Firma - I In den letzten beiden Kapiteln: Genaue Betrachtung der Konsumenten (Nachfrageseite). Nun: Genaue Betrachtung
LVA-Leiter: Martin Halla Einheit 6: Die Produktion (Kapitel 6) Einheit 6-1 - Theorie der Firma - I In den letzten beiden Kapiteln: Genaue Betrachtung der Konsumenten (Nachfrageseite). Nun: Genaue Betrachtung
2.3 Kriterien der Entscheidungsfindung: Präferenzen
 .3 Kriterien der Entscheidungsfindung: Präferenzen Der Einfachheit halber beschränken wir uns auf n = ( zwei Güter). Annahme: Konsumenten können für sich herausfinden, ob sie x = ( x, ) dem Güterbündel
.3 Kriterien der Entscheidungsfindung: Präferenzen Der Einfachheit halber beschränken wir uns auf n = ( zwei Güter). Annahme: Konsumenten können für sich herausfinden, ob sie x = ( x, ) dem Güterbündel
Das Heckscher-Ohlin-Modell. Wintersemester 2013/2014
 Das Heckscher-Ohlin-Modell Wintersemester 2013/2014 Ressourcen und Außenhandel unterschiedliche Ausstattungen mit Produktionsfaktoren einzige Ursache für Unterschiede in Autarkiepreisen zwischen zwei Ländern
Das Heckscher-Ohlin-Modell Wintersemester 2013/2014 Ressourcen und Außenhandel unterschiedliche Ausstattungen mit Produktionsfaktoren einzige Ursache für Unterschiede in Autarkiepreisen zwischen zwei Ländern
Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Michael Alpert Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Übung 2 Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Michael Alpert Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Übung 2 Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion
Grundzüge der VWL III: Einführung in die Wirtschaftspolitik Übung 2 Markteffizienz
 Grundzüge der VWL III: Einführung in die Wirtschaftspolitik Übung 2 Markteffizienz Sonja Jovicic / Alexander Halbach Aufgabe 1 WS 2015/2016 Jovicic/Halbach Übung WiPol Seite 2 Aufgabe 1 a) Was meinen Ökonomen
Grundzüge der VWL III: Einführung in die Wirtschaftspolitik Übung 2 Markteffizienz Sonja Jovicic / Alexander Halbach Aufgabe 1 WS 2015/2016 Jovicic/Halbach Übung WiPol Seite 2 Aufgabe 1 a) Was meinen Ökonomen
Einschub: Kurze Einführung in die Außenhandelstheorie : (Widerholung für Studenten die Theorie des internationalen Handels bereits gehört haben)
 Einschub: Kurze Einführung in die Außenhandelstheorie : (Widerholung für Studenten die Theorie des internationalen Handels bereits gehört haben) 1. Aufgabe Im Inland werden mit Hilfe des Faktors Arbeit
Einschub: Kurze Einführung in die Außenhandelstheorie : (Widerholung für Studenten die Theorie des internationalen Handels bereits gehört haben) 1. Aufgabe Im Inland werden mit Hilfe des Faktors Arbeit
sie entspricht dem Verhältnis von Input zu Output sie entspricht der Grenzrate der Substitution die Steigung einer Isoquante liegt stets bei 1
 20 Brückenkurs 3. Welche drei Produktionsfunktionen sollten Sie kennen?, und Produktionsfunktion 4. Was ist eine Isoquante? alle Kombinationen von Inputmengen, die den gleichen Output erzeugen sie entspricht
20 Brückenkurs 3. Welche drei Produktionsfunktionen sollten Sie kennen?, und Produktionsfunktion 4. Was ist eine Isoquante? alle Kombinationen von Inputmengen, die den gleichen Output erzeugen sie entspricht
Grundzüge der Mikroökonomie. Kapitel 7 P-R Kap. 6 (Mikro I) Produktion
 Grundzüge der Mikroökonomie Kapitel 7 P-R Kap. 6 (Mikro I) Produktion 1 Produktionsfunktion Beziehung zwischen Input und Output Die Produktionsfunktion für zwei Inputs lautet: Q = F(K,L) Q = Output, K
Grundzüge der Mikroökonomie Kapitel 7 P-R Kap. 6 (Mikro I) Produktion 1 Produktionsfunktion Beziehung zwischen Input und Output Die Produktionsfunktion für zwei Inputs lautet: Q = F(K,L) Q = Output, K
Die Arbeitsteilung ist die Mutter unseres Wohlstandes
 Die Arbeitsteilung ist die Mutter unseres Wohlstandes 3.1 Hauptthema des Kapitels......................... 20 3.2 Aufgaben........................................ 21 3.2.1 Übungen.....................................
Die Arbeitsteilung ist die Mutter unseres Wohlstandes 3.1 Hauptthema des Kapitels......................... 20 3.2 Aufgaben........................................ 21 3.2.1 Übungen.....................................
IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte
 LVA-Leiter: Martin Halla Einheit 4: Das Verbraucherverhalten (Kapitel 3) Einheit 4-1 - Verbraucherverhalten Budgetbeschränkung: Man kann nicht alles haben, was man sich wünscht! Konsumentenpräferenzen:
LVA-Leiter: Martin Halla Einheit 4: Das Verbraucherverhalten (Kapitel 3) Einheit 4-1 - Verbraucherverhalten Budgetbeschränkung: Man kann nicht alles haben, was man sich wünscht! Konsumentenpräferenzen:
Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion
 Dipl.-WiWi Michael Alpert Wintersemester 2006/2007 Institut für Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 03 Tel. 0731 50 24264 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Dipl.-WiWi Michael Alpert Wintersemester 2006/2007 Institut für Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 03 Tel. 0731 50 24264 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Einführung in die Wirtschaftswissenschaften für Nicht-ÖkonomInnen. Teil 2: Haushaltstheorie
 Einführung in die Wirtschaftswissenschaften für Nicht-ÖkonomInnen Teil 2: Haushaltstheorie Dieses Werk ist unter einem Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen
Einführung in die Wirtschaftswissenschaften für Nicht-ÖkonomInnen Teil 2: Haushaltstheorie Dieses Werk ist unter einem Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen
10AllgemeinesGleichgewicht. 10.1Pareto-OptimalitätundFaktoreinsatz
 0AllgemeinesGleichgewicht In diesem Kapitel werden wir uns zunächst die klassische normative Frage der Allokationstheoriestellen:WelcheGütersollteninwelchenMengenproduziertwerden? WiesolltendieProduktionsfaktorenzuihrerProduktioneingesetztwerden?Wiesolltedas
0AllgemeinesGleichgewicht In diesem Kapitel werden wir uns zunächst die klassische normative Frage der Allokationstheoriestellen:WelcheGütersollteninwelchenMengenproduziertwerden? WiesolltendieProduktionsfaktorenzuihrerProduktioneingesetztwerden?Wiesolltedas
Regionalökonomik (BA) Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung
 Regionalökonomik (BA) Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Prof. Dr. Falko Jüßen 30. Oktober 2014 1 / 33 Einleitung Rückblick Ricardo-Modell Das Ricardo-Modell hat die potentiellen Handelsgewinne
Regionalökonomik (BA) Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Prof. Dr. Falko Jüßen 30. Oktober 2014 1 / 33 Einleitung Rückblick Ricardo-Modell Das Ricardo-Modell hat die potentiellen Handelsgewinne
Musterlösungen Mikroökonomie II
 Musterlösungen Mikroökonomie II Kardinaler Nutzen Aufgabe 1 Man hält den Nutzen, der aus dem Konsum von Gütern entsteht für meßbar. Konkret wird angenommen, daß man den Nutzenabstand zwischen zwei Güterbündeln
Musterlösungen Mikroökonomie II Kardinaler Nutzen Aufgabe 1 Man hält den Nutzen, der aus dem Konsum von Gütern entsteht für meßbar. Konkret wird angenommen, daß man den Nutzenabstand zwischen zwei Güterbündeln
Aufgabenblatt 1: Grundlagen der Wohlfahrtsökonomik
 Prof. Dr. Rainald Borck Lösungshinweise zu den Übungen WS 07/08 1 Aufgabenblatt 1: Grundlagen der Wohlfahrtsökonomik Zum Begriff Allokationspolitik Unter Allokationspolitik versteht man die Einflussnahme
Prof. Dr. Rainald Borck Lösungshinweise zu den Übungen WS 07/08 1 Aufgabenblatt 1: Grundlagen der Wohlfahrtsökonomik Zum Begriff Allokationspolitik Unter Allokationspolitik versteht man die Einflussnahme
Produktion und Organisation VL 8: Produktion Die neoklassische Produktionsfunktion
 JProf. Dr. T. Kilian [kilian@uni-koblenz.de] Produktion und Organisation VL 8: Produktion Die neoklassische Produktionsfunktion WS 00/0 JProf. Dr. T. Kilian 0 Inhalt I. Grundbegriffe II. Produktionsfunktionen
JProf. Dr. T. Kilian [kilian@uni-koblenz.de] Produktion und Organisation VL 8: Produktion Die neoklassische Produktionsfunktion WS 00/0 JProf. Dr. T. Kilian 0 Inhalt I. Grundbegriffe II. Produktionsfunktionen
Mietinteressent A B C D E F G H Vorbehaltspreis a) Im Wettbewerbsgleichgewicht beträgt der Preis 250.
 Aufgabe 1 Auf einem Wohnungsmarkt werden 5 Wohnungen angeboten. Die folgende Tabelle gibt die Vorbehaltspreise der Mietinteressenten wieder: Mietinteressent A B C D E F G H Vorbehaltspreis 250 320 190
Aufgabe 1 Auf einem Wohnungsmarkt werden 5 Wohnungen angeboten. Die folgende Tabelle gibt die Vorbehaltspreise der Mietinteressenten wieder: Mietinteressent A B C D E F G H Vorbehaltspreis 250 320 190
6. Die Produktion. Literatur: Pindyck und Rubinfeld, Kapitel 6 Varian, Kapitel 18 Frambach, Kapitel 3
 6. Die Produktion Literatur: Pindyck und Rubinfeld, Kapitel 6 Varian, Kapitel 18 Frambach, Kapitel 3 Themen in diesem Kapitel Die Produktionstechnologie Die Produktion mit einem variablen Input (Arbeit)
6. Die Produktion Literatur: Pindyck und Rubinfeld, Kapitel 6 Varian, Kapitel 18 Frambach, Kapitel 3 Themen in diesem Kapitel Die Produktionstechnologie Die Produktion mit einem variablen Input (Arbeit)
Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft
 Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Einführung Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Wachstum und Wohlfahrt Zölle und Exportsubventionen 1 Einführung Die bisher besprochenen
Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Einführung Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Wachstum und Wohlfahrt Zölle und Exportsubventionen 1 Einführung Die bisher besprochenen
Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft
 Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Einführung Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Wachstum und Wohlfahrt Zölle und Exportsubventionen 1 Einführung Die bisher besprochenen
Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Einführung Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Wachstum und Wohlfahrt Zölle und Exportsubventionen 1 Einführung Die bisher besprochenen
Universität Ulm SS 2007 Institut für Betriebswirtschaft Hellwig/Meuser Blatt 5. w l = W. q l = l=1. l=1
 Universität Ulm SS 2007 Institut für Betriebswirtschaft 27.06.2007 Hellwig/Meuser Blatt 5 Lösungen zu AVWL III Aufgabe 20 Wir betrachten hier eine reine Tauschökonomie ohne Produktion mit m Konsumenten
Universität Ulm SS 2007 Institut für Betriebswirtschaft 27.06.2007 Hellwig/Meuser Blatt 5 Lösungen zu AVWL III Aufgabe 20 Wir betrachten hier eine reine Tauschökonomie ohne Produktion mit m Konsumenten
Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 2. Grundzüge der Mikroökonomik. WiMa und andere (AVWL I) WS 2007/08
 I 2. Grundzüge der Mikroökonomik 1 2. Grundzüge der Mikroökonomik 2.1 Arbeitsteilung, Spezialisierung und 2 Warum spielen Märkte eine so große Rolle? Fast alle Menschen betreiben Arbeitsteilung! Arbeitsteilung:
I 2. Grundzüge der Mikroökonomik 1 2. Grundzüge der Mikroökonomik 2.1 Arbeitsteilung, Spezialisierung und 2 Warum spielen Märkte eine so große Rolle? Fast alle Menschen betreiben Arbeitsteilung! Arbeitsteilung:
Was versteht man unter Konsumenten- und Produzentenrente? Zeigen Sie diese Größen in einem Preis-Mengen-Diagramm.
 Klausuraufgaben für das Mikro 1 Tutorium Sitzung 1 WS 03/04 Aufgabe 1 Was versteht man unter Konsumenten- und Produzentenrente? Zeigen Sie diese Größen in einem Preis-Mengen-Diagramm. WS 04/05 Aufgabe
Klausuraufgaben für das Mikro 1 Tutorium Sitzung 1 WS 03/04 Aufgabe 1 Was versteht man unter Konsumenten- und Produzentenrente? Zeigen Sie diese Größen in einem Preis-Mengen-Diagramm. WS 04/05 Aufgabe
IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA
 IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA LVA-Leiter: Michael Noldi Einheit 4: Das Verbraucherverhalten (Kap. 3) Verbraucherverhalten IK WS 2014/15 1 Verbraucherverhalten Bugetbeschränkung: Einkommen,
IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA LVA-Leiter: Michael Noldi Einheit 4: Das Verbraucherverhalten (Kap. 3) Verbraucherverhalten IK WS 2014/15 1 Verbraucherverhalten Bugetbeschränkung: Einkommen,
Was versteht man unter Konsumenten- und Produzentenrente? Zeigen Sie diese Größen in einem Preis-Mengen-Diagramm.
 Klausuraufgaben für das Mikro 1 Tutorium Sitzung 1 WS 03/04 Aufgabe 1 Was versteht man unter Konsumenten- und Produzentenrente? Zeigen Sie diese Größen in einem Preis-Mengen-Diagramm. WS 04/05 Aufgabe
Klausuraufgaben für das Mikro 1 Tutorium Sitzung 1 WS 03/04 Aufgabe 1 Was versteht man unter Konsumenten- und Produzentenrente? Zeigen Sie diese Größen in einem Preis-Mengen-Diagramm. WS 04/05 Aufgabe
Allgemeine Volkswirtschaftslehre I für WiMA und andere (AVWL I)
 I WiMA und andere WS 007/08 Institut Wirtschaftswissenschaften www.mathematik.uni-ulm.de/wiwi/ . Grundzüge der Mikroökonomik WS 007/08.6 Theorie des Haushalts .6 Theorie des Haushalts WS 007/08 Haushaltstheorie
I WiMA und andere WS 007/08 Institut Wirtschaftswissenschaften www.mathematik.uni-ulm.de/wiwi/ . Grundzüge der Mikroökonomik WS 007/08.6 Theorie des Haushalts .6 Theorie des Haushalts WS 007/08 Haushaltstheorie
IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte
 M. Lackner (JKU Linz) IK ÖE&M E4, WS 2015/16 1 / 44 IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte Mario Lackner JKU Linz Einheit 4, WS 2015/16 Das Verbraucherverhalten (Kap. 3) Verbraucherverhalten Bugetbeschränkung:
M. Lackner (JKU Linz) IK ÖE&M E4, WS 2015/16 1 / 44 IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte Mario Lackner JKU Linz Einheit 4, WS 2015/16 Das Verbraucherverhalten (Kap. 3) Verbraucherverhalten Bugetbeschränkung:
IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA
 IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA LVA-Leiter: Michael Noldi Einheit 7: Die Kosten der Produktion (Kap. 7.1.-7.4.) Kosten der Produktion IK WS 2014/15 1 Produktionstheorie Kapitel 6: Produktionstechnologie
IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA LVA-Leiter: Michael Noldi Einheit 7: Die Kosten der Produktion (Kap. 7.1.-7.4.) Kosten der Produktion IK WS 2014/15 1 Produktionstheorie Kapitel 6: Produktionstechnologie
Annahmen und Bezeichnungen: Tabelle 4-1: Definitionen zur Produktionstechnologie a LC a LF A TC A TF
 4. Das Heckscher-Ohlin Modell Es wird die Ausstattung (Faktorabundanz) mit Ressourcen (Kapital, Boden, Arbeit in verschiedenen Skillgruppen, etc.) als einzige Ursache des Außenhandels analysiert. Komparative
4. Das Heckscher-Ohlin Modell Es wird die Ausstattung (Faktorabundanz) mit Ressourcen (Kapital, Boden, Arbeit in verschiedenen Skillgruppen, etc.) als einzige Ursache des Außenhandels analysiert. Komparative
Institut für Theoretische Volkswirtschaftslehre Makroökonomik. Angewandte Probleme der. Übung. Dr. Andreas Schäfer WS 10/11
 Angewandte Probleme der Volkswirtschaftslehre: l h Entwicklungsökonomik ik Übung Dr. Andreas Schäfer WS 0/ Dr. Andreas Schäfer Angewandte Probleme der Volkswirtschaftslehre: l h Entwicklungsökonomik Übung.
Angewandte Probleme der Volkswirtschaftslehre: l h Entwicklungsökonomik ik Übung Dr. Andreas Schäfer WS 0/ Dr. Andreas Schäfer Angewandte Probleme der Volkswirtschaftslehre: l h Entwicklungsökonomik Übung.
IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte
 IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA-Leiterin: Ana-Maria Vasilache Einheit 2: Haushaltstheorie (Kapitel 3) Verbraucherverhalten KonsumentInnen erwerben jene Güter,. die bei gegebenem Einkommen
IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA-Leiterin: Ana-Maria Vasilache Einheit 2: Haushaltstheorie (Kapitel 3) Verbraucherverhalten KonsumentInnen erwerben jene Güter,. die bei gegebenem Einkommen
Mikroökonomie I Kapitel 3 Das Käuferverhalten WS 2004/2005
 Mikroökonomie I Kapitel 3 Das Käuferverhalten WS 2004/2005 Die Themen in diesem Kapitel Konsumentenpräferenzen Budgetbeschränkungen Verbraucherentscheidung Die Grenznutzen und die Verbraucherentscheidung
Mikroökonomie I Kapitel 3 Das Käuferverhalten WS 2004/2005 Die Themen in diesem Kapitel Konsumentenpräferenzen Budgetbeschränkungen Verbraucherentscheidung Die Grenznutzen und die Verbraucherentscheidung
Die möglichen Kombinationen X1 und X2 lassen sich durch die Verbindung der beiden Achsenpunkte veranschaulichen (Budgetgerade).
 Folie 3.. - Die Budgetgerade Die Budgetgerade kennzeichnet die Wahlmöglichkeiten des Haushaltes bei gegebenem Einkommen () und gegebenen Preisen P und für die beiden Güter (-bündel) X und. Das kann für
Folie 3.. - Die Budgetgerade Die Budgetgerade kennzeichnet die Wahlmöglichkeiten des Haushaltes bei gegebenem Einkommen () und gegebenen Preisen P und für die beiden Güter (-bündel) X und. Das kann für
Theorie des Außenhandels
 Theorie des Außenhandels Das Konzept des komparativen Vorteils Faktorausstattung und Handelsmuster Intra-industrieller Handel Freihandel und die Gewinne aus Außenhandel K. Morasch 2008 Außenhandel und
Theorie des Außenhandels Das Konzept des komparativen Vorteils Faktorausstattung und Handelsmuster Intra-industrieller Handel Freihandel und die Gewinne aus Außenhandel K. Morasch 2008 Außenhandel und
2. Wohlfahrtstheorie
 2. Wohlfahrtstheorie Prof. Dr. Christian Holzner LMU München WS 2011/2012 2. Wohlfahrtstheorie 2.1 Grundlagen 2.2 Die optimale Güterverteilung 2.3 Der optimale Faktoreinsatz 2.4 Die optimale Produktionsstruktur
2. Wohlfahrtstheorie Prof. Dr. Christian Holzner LMU München WS 2011/2012 2. Wohlfahrtstheorie 2.1 Grundlagen 2.2 Die optimale Güterverteilung 2.3 Der optimale Faktoreinsatz 2.4 Die optimale Produktionsstruktur
IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA
 IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA LVA-Leiter: Michael Noldi Einheit 6: Die Produktion (Kap. 6) Produktionstheorie IK WS 2014/15 1 Haushaltstheorie vs. Produktionstheorie Die Haushaltstheorie
IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA LVA-Leiter: Michael Noldi Einheit 6: Die Produktion (Kap. 6) Produktionstheorie IK WS 2014/15 1 Haushaltstheorie vs. Produktionstheorie Die Haushaltstheorie
5. Ursachen und Wirkungen internationalen Handelns. 5.1 Faktorausstattungen und inter-industrieller Handel: Das Heckscher-Ohlin-Modell
 5. Ursahen und Wirkungen internationalen Handelns 5. Faktorausstattungen und inter-industrieller Handel: Das Heksher-Ohlin-Modell Das Riardo-Modell reiht zur Erklärung von Handel niht mehr aus, wenn mit
5. Ursahen und Wirkungen internationalen Handelns 5. Faktorausstattungen und inter-industrieller Handel: Das Heksher-Ohlin-Modell Das Riardo-Modell reiht zur Erklärung von Handel niht mehr aus, wenn mit
Haushaltstheorie. Ökonomische Entscheidungen und Märkte IK. Alexander Ahammer. Institut für Volkswirtschaftslehre Johannes Kepler Universität Linz
 Haushaltstheorie Ökonomische Entscheidungen und Märkte IK Alexander Ahammer Institut für Volkswirtschaftslehre Johannes Kepler Universität Linz Letztes Update: 31. Oktober 2017, 13:15 Alexander Ahammer
Haushaltstheorie Ökonomische Entscheidungen und Märkte IK Alexander Ahammer Institut für Volkswirtschaftslehre Johannes Kepler Universität Linz Letztes Update: 31. Oktober 2017, 13:15 Alexander Ahammer
Übung 3: Unternehmenstheorie
 Übung 3: Unternehmenstheorie Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Intermediate Microeconomics HS 11 Unternehmenstheorie 1 / 42 Produktion Zur Erinnerung: Grenzprodukt
Übung 3: Unternehmenstheorie Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Intermediate Microeconomics HS 11 Unternehmenstheorie 1 / 42 Produktion Zur Erinnerung: Grenzprodukt
Regionale wirtschaftliche Integration, Ziele und Wirkungen
 Wirkungen von FT, CU, CM: Gemeinsamer Markt (CM): Vorbemerkung 1: Mobilität von Produktionsfaktoren rbeit und Kapital Faktorpreisausgleichstheorem (unter bestimmten edingungen kommt es bei freiem Güterhandel
Wirkungen von FT, CU, CM: Gemeinsamer Markt (CM): Vorbemerkung 1: Mobilität von Produktionsfaktoren rbeit und Kapital Faktorpreisausgleichstheorem (unter bestimmten edingungen kommt es bei freiem Güterhandel
Kapitel 19: Technologie. moodle.tu-dortmund.de. Wirtschaftstheorie I: Mikroökonomie SoSe 2017, Lars Metzger 1 / 52
 Wirtschaftstheorie I: Mikroökonomie SoSe 2017, Lars Metzger 1 / 52 Kapitel 19: Technologie moodle.tu-dortmund.de Wirtschaftstheorie I: Mikroökonomie SoSe 2017, Lars Metzger 2 / 52 Outline Technologie mit
Wirtschaftstheorie I: Mikroökonomie SoSe 2017, Lars Metzger 1 / 52 Kapitel 19: Technologie moodle.tu-dortmund.de Wirtschaftstheorie I: Mikroökonomie SoSe 2017, Lars Metzger 2 / 52 Outline Technologie mit
Ricardo: Zusammenfassung
 Kapitel 1 Einführung Schluß Kapitel 2 Arbeitsproduktivität und komparativer Vorteil: das Ricardo-Modell Internationale Wirtschaft, 6. Auflage von Paul R. Krugman und Maurice Obstfeld Folie 20041117-1 Ricardo:
Kapitel 1 Einführung Schluß Kapitel 2 Arbeitsproduktivität und komparativer Vorteil: das Ricardo-Modell Internationale Wirtschaft, 6. Auflage von Paul R. Krugman und Maurice Obstfeld Folie 20041117-1 Ricardo:
3 Das totale Gleichgewicht bei vollkommener Konkurrenz
 3 Das totale Gleichgewicht bei vollkommener Konkurrenz 3.1 llgemeines Tauschgleichgewicht Literatur: Schöler (2004), Varian (2006) und auf sehr hohem Niveau Mas-Colell et al. (1995). Ziel: Darstellung
3 Das totale Gleichgewicht bei vollkommener Konkurrenz 3.1 llgemeines Tauschgleichgewicht Literatur: Schöler (2004), Varian (2006) und auf sehr hohem Niveau Mas-Colell et al. (1995). Ziel: Darstellung
Klausur Mikroökonomik I. Wichtige Hinweise
 Prof. Dr. Anke Gerber Klausur Mikroökonomik I 2. Termin Sommersemester 2014 22.09.2014 Wichtige Hinweise 1. Lösen Sie nicht die Heftung der ausgeteilten Klausur. 2. Verwenden Sie nur das ausgeteilte Papier.
Prof. Dr. Anke Gerber Klausur Mikroökonomik I 2. Termin Sommersemester 2014 22.09.2014 Wichtige Hinweise 1. Lösen Sie nicht die Heftung der ausgeteilten Klausur. 2. Verwenden Sie nur das ausgeteilte Papier.
Außenwirtschaftspolitik Modul 1 Theorie des internationalen Handels (I) 1. April 2008
 Prof. Dr. Thomas Straubhaar Universität Hamburg Sommersemester 2008 Vorlesung 21-60.376 Außenwirtschaftspolitik Modul 1 Theorie des internationalen Handels (I) 1. April 2008 1 Arbeitsteilung POSITIVE EFFEKTE
Prof. Dr. Thomas Straubhaar Universität Hamburg Sommersemester 2008 Vorlesung 21-60.376 Außenwirtschaftspolitik Modul 1 Theorie des internationalen Handels (I) 1. April 2008 1 Arbeitsteilung POSITIVE EFFEKTE
Klausur AVWL 1. Klausurtermin: Ich studiere nach: Bachelor-Prüfungsordnung Diplom-Prüfungsordnung. Bitte beachten Sie:
 Klausur AVWL 1 Klausurtermin: 25.07.2014 Dieses Deckblatt bitte vollständig und deutlich lesbar ausfüllen! Vom Prüfer Vom Prüfer Name: auszufüllen: auszufüllen: Aufg.1: / 25 Vorname: Punkte: Aufg.2: /
Klausur AVWL 1 Klausurtermin: 25.07.2014 Dieses Deckblatt bitte vollständig und deutlich lesbar ausfüllen! Vom Prüfer Vom Prüfer Name: auszufüllen: auszufüllen: Aufg.1: / 25 Vorname: Punkte: Aufg.2: /
Kapitel 1 Einführung Kapitel 4: Ressourcen, komparativer Vorteil und Einkommensverteilung
 Kapitel 1 Einführung Kapitel 4: Ressourcen, komparativer Vorteil und Einkommensverteilung Folie 4-1 Kapitelübersicht Einführung Modell einer Volkswirtschaft Wirkungen des internationalen Handels auf Volkswirtschaften
Kapitel 1 Einführung Kapitel 4: Ressourcen, komparativer Vorteil und Einkommensverteilung Folie 4-1 Kapitelübersicht Einführung Modell einer Volkswirtschaft Wirkungen des internationalen Handels auf Volkswirtschaften
Lösungsskizze zur Probeklausur Einführung in die Mikroökonomie
 Lösungsskizze zur Probeklausur Einführung in die Mikroökonomie Prof. Dr. Dennis A. V. Dittrich, Universität Erfurt Aufgaben 1. Ein Konsument habe die Nutzenfunktion U(x, y) = x + y. Der Preis von x ist
Lösungsskizze zur Probeklausur Einführung in die Mikroökonomie Prof. Dr. Dennis A. V. Dittrich, Universität Erfurt Aufgaben 1. Ein Konsument habe die Nutzenfunktion U(x, y) = x + y. Der Preis von x ist
Ertrag Kartoffeln (dt/ha) Einsatz Stickstoff
 An der Erzeugung von Speisekartoffeln (Y) seien zwei variable Produktionsfaktoren (Düngemittel) Stickstoff (N) und Phosphor (P) beteiligt. Die Beziehung zwischen Faktoreinsatz (N und P) und der Produktmenge
An der Erzeugung von Speisekartoffeln (Y) seien zwei variable Produktionsfaktoren (Düngemittel) Stickstoff (N) und Phosphor (P) beteiligt. Die Beziehung zwischen Faktoreinsatz (N und P) und der Produktmenge
Kapitel 5: Ressourcen und Handel: Das Heckscher-Ohlin-Modell
 Kapitel 5: Ressourcen und Handel Das Heckscher-Ohlin-Modell 1 Kapitelübersicht Einführung Modell einer Volkswirtschaft mit zwei Faktoren Wirkungen des internationalen Handels auf Volkswirtschaften mit
Kapitel 5: Ressourcen und Handel Das Heckscher-Ohlin-Modell 1 Kapitelübersicht Einführung Modell einer Volkswirtschaft mit zwei Faktoren Wirkungen des internationalen Handels auf Volkswirtschaften mit
IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte
 M. Lackner (JKU Linz) IK ÖE&M E6, WS 2014/15 1 / 25 IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte Mario Lackner JKU Linz Einheit 6, WS 2014/15 Die Produktion (Kap. 6) M. Lackner (JKU Linz) IK ÖE&M E6, WS 2014/15
M. Lackner (JKU Linz) IK ÖE&M E6, WS 2014/15 1 / 25 IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte Mario Lackner JKU Linz Einheit 6, WS 2014/15 Die Produktion (Kap. 6) M. Lackner (JKU Linz) IK ÖE&M E6, WS 2014/15
Internationale Ökonomie I. Vorlesung 4: Das Heckscher-Ohlin-Modell: Ressourcen, komparative Vorteile und Einkommen. Dr.
 Internationale Ökonomie I Vorlesung 4: Das Heckscher-Ohlin-Modell: Ressourcen, komparative Vorteile und Einkommen Dr. Dominik Maltritz Vorlesungsgliederung 1. Einführung 2. Der Welthandel: Ein Überblick
Internationale Ökonomie I Vorlesung 4: Das Heckscher-Ohlin-Modell: Ressourcen, komparative Vorteile und Einkommen Dr. Dominik Maltritz Vorlesungsgliederung 1. Einführung 2. Der Welthandel: Ein Überblick
IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte
 LVA-Leiterin: Ana-Maria Vasilache Einheit 6: Produktionstheorie (Kapitel 6 & 7) Haushaltstheorie versus Produktionstheorie Die Haushaltstheorie beschäftigt sich mit der Konsumentscheidung der Haushalte.
LVA-Leiterin: Ana-Maria Vasilache Einheit 6: Produktionstheorie (Kapitel 6 & 7) Haushaltstheorie versus Produktionstheorie Die Haushaltstheorie beschäftigt sich mit der Konsumentscheidung der Haushalte.
A 2. Terms of trade-effekte in großen offenen Volkswirtschaften
 A 2. Terms of trade-effekte in großen offenen Volkswirtschaften islang wurde angenommen, dass die Zollunionsländer kleine offene Volkswirtschaften sind und auch die Zollunion insgesamt den Weltmarktpreis
A 2. Terms of trade-effekte in großen offenen Volkswirtschaften islang wurde angenommen, dass die Zollunionsländer kleine offene Volkswirtschaften sind und auch die Zollunion insgesamt den Weltmarktpreis
VO Grundlagen der Mikroökonomie SWM. Statistics and Mathematical Methods in Economics
 VO 105.620 Grundlagen der Mikroökonomie SWM Statistics and Mathematical Methods in Economics Die Produktion (Kapitel 6) ZIEL: Die Produktionstechnologie Die Produktion mit einem variablen Input (Arbeit)
VO 105.620 Grundlagen der Mikroökonomie SWM Statistics and Mathematical Methods in Economics Die Produktion (Kapitel 6) ZIEL: Die Produktionstechnologie Die Produktion mit einem variablen Input (Arbeit)
Das (einfache) Solow-Modell
 Kapitel 3 Das (einfache) Solow-Modell Zunächst wird ein Grundmodell ohne Bevölkerungswachstum und ohne technischen Fortschritt entwickelt. Ausgangspunkt ist die Produktionstechnologie welche in jeder Periode
Kapitel 3 Das (einfache) Solow-Modell Zunächst wird ein Grundmodell ohne Bevölkerungswachstum und ohne technischen Fortschritt entwickelt. Ausgangspunkt ist die Produktionstechnologie welche in jeder Periode
Klausur AVWL 1. Klausurtermin:
 Klausur AVWL 1 Klausurtermin: 25.02.2015 Dieses Deckblatt bitte vollständig und deutlich lesbar ausfüllen! Vom Prüfer Vom Prüfer Name: auszufüllen: auszufüllen: Aufg.1: / 25 Vorname: Punkte: Aufg.2: /
Klausur AVWL 1 Klausurtermin: 25.02.2015 Dieses Deckblatt bitte vollständig und deutlich lesbar ausfüllen! Vom Prüfer Vom Prüfer Name: auszufüllen: auszufüllen: Aufg.1: / 25 Vorname: Punkte: Aufg.2: /
Die Produktion eines bestimmten Outputs zu minimalen Kosten
 Einführung in die Mikroökonomie Produktion und die Kosten der Produktion Universität Erfurt Wintersemester 07/08 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Die Produktion Winter 1 / 20 Übersicht Die Kostenfunktion
Einführung in die Mikroökonomie Produktion und die Kosten der Produktion Universität Erfurt Wintersemester 07/08 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Die Produktion Winter 1 / 20 Übersicht Die Kostenfunktion
IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte
 LVA-Leiter: Martin Halla Einheit 7: Die Kosten der Produktion (Kapitel 7.1-7.4.) Einheit 7-1 - Die Kosten der Produktion Kapitel 6: Produktionstechnologie (Inputs Output) Kapitel 7: Preis der Produktionsfaktoren
LVA-Leiter: Martin Halla Einheit 7: Die Kosten der Produktion (Kapitel 7.1-7.4.) Einheit 7-1 - Die Kosten der Produktion Kapitel 6: Produktionstechnologie (Inputs Output) Kapitel 7: Preis der Produktionsfaktoren
IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte. Produktionstheorie. (Kapitel 6) Nicole Schneeweis (JKU Linz) IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte 1 / 25
 IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte Produktionstheorie (Kapitel 6) Nicole Schneeweis (JKU Linz) IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte 1 / 25 Haushaltstheorie versus Produktionstheorie Die Haushaltstheorie
IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte Produktionstheorie (Kapitel 6) Nicole Schneeweis (JKU Linz) IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte 1 / 25 Haushaltstheorie versus Produktionstheorie Die Haushaltstheorie
Teil II: Produzententheorie
 Teil II: Produzententheorie 1 Kapitel 6: Produktion und Technologie Hauptidee: Eine Firma verwandelt Inputs in Outputs. Dieser Transformationsprozess wird beschrieben durch die Produktionsfunktion. 6.1
Teil II: Produzententheorie 1 Kapitel 6: Produktion und Technologie Hauptidee: Eine Firma verwandelt Inputs in Outputs. Dieser Transformationsprozess wird beschrieben durch die Produktionsfunktion. 6.1
Außenhandelstheorie und internationaler Wettbewerb
 Außenhandelstheorie und internationaler Wettbewerb Das Konzept des komparativen Vorteils Faktorausstattung und Handelsmuster Intra industrieller Handel Freihandel und die Gewinne aus Außenhandel K. Morasch
Außenhandelstheorie und internationaler Wettbewerb Das Konzept des komparativen Vorteils Faktorausstattung und Handelsmuster Intra industrieller Handel Freihandel und die Gewinne aus Außenhandel K. Morasch
positive vs. normative Analyse der sozialen Präferenzen
 Einführung in die Wirtschaftspolitik 2-1 Prof Andreas Haufler (SoSe 2010) 2 Das Pareto Prinzip 21 Grundfragen der Wohlfahrtsökonomie positive vs normative Analyse der sozialen Präferenzen positiver Ansatz:
Einführung in die Wirtschaftspolitik 2-1 Prof Andreas Haufler (SoSe 2010) 2 Das Pareto Prinzip 21 Grundfragen der Wohlfahrtsökonomie positive vs normative Analyse der sozialen Präferenzen positiver Ansatz:
Die kurzfristigen Kosten eines Unternehmens (Euro)
 Einführung in die Mikroökonomie Produktion und die Kosten der Produktion Universität Erfurt Wintersemester 08/09 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Die Produktion Winter 1 / 24 Übersicht Kosten in der
Einführung in die Mikroökonomie Produktion und die Kosten der Produktion Universität Erfurt Wintersemester 08/09 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Die Produktion Winter 1 / 24 Übersicht Kosten in der
Klausur Mikroökonomie I Diplom SS 06 Lösungen
 Universität Lüneburg Prüfer: Prof. Dr. Thomas Wein Fakultät II Prof. Dr. Joachim Wagner Institut für Volkswirtschaftslehre Datum: 17.7.2006 Klausur Mikroökonomie I Diplom SS 06 Lösungen 1. Eine neue Erfindung
Universität Lüneburg Prüfer: Prof. Dr. Thomas Wein Fakultät II Prof. Dr. Joachim Wagner Institut für Volkswirtschaftslehre Datum: 17.7.2006 Klausur Mikroökonomie I Diplom SS 06 Lösungen 1. Eine neue Erfindung
Produktionswirtschaft Kostentheorie und Minimalkostenkombination. 9 / 96 Aufgabe 2 (Kostentheorie) 20 Punkte
 Produktionswirtschaft 450 Kostentheorie und Minimalkostenkombination 9 / 96 Aufgabe (Kostentheorie) 0 Punkte Entspricht Aufgabe 4. im Übungsbuch, Seite 4ff. Gegeben sei folgende Produktionsfunktion: (
Produktionswirtschaft 450 Kostentheorie und Minimalkostenkombination 9 / 96 Aufgabe (Kostentheorie) 0 Punkte Entspricht Aufgabe 4. im Übungsbuch, Seite 4ff. Gegeben sei folgende Produktionsfunktion: (
Von. Avinash Dixit. Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Warwick und. Victor Norman
 Außenhandelstheorie Von Avinash Dixit Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Warwick und Victor Norman Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Norwegischen Wirtschaftsuniversität
Außenhandelstheorie Von Avinash Dixit Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Warwick und Victor Norman Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Norwegischen Wirtschaftsuniversität
Vorlesung 2: Risikopräferenzen im Zustandsraum
 Vorlesung 2: Risikopräferenzen im Zustandsraum Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Versicherungsökonomie VL 2, FS 12 Risikopräferenzen im Zustandsraum 1/29 2.1 Motivation
Vorlesung 2: Risikopräferenzen im Zustandsraum Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Versicherungsökonomie VL 2, FS 12 Risikopräferenzen im Zustandsraum 1/29 2.1 Motivation
Einführung in die Wirtschaftswissenschaften für Nicht-ÖkonomInnen. Teil 3: Unternehmenstheorie
 Einführung in die Wirtschaftswissenschaften für Nicht-ÖkonomInnen Teil 3: Unternehmenstheorie Dieses Werk ist unter einem Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen
Einführung in die Wirtschaftswissenschaften für Nicht-ÖkonomInnen Teil 3: Unternehmenstheorie Dieses Werk ist unter einem Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen
Mikroökonomik für Wirtschaftsingenieure. Dr. Christian Hott
 Mikroökonomik für Wirtschaftsingenieure Agenda 1. Einführung 2. Analyse der Nachfrage 3. Analyse des s 3.1 Marktgleichgewicht 3.2 Technologie und Gewinnmaximierung 3.3 Kostenkurven 3.4 Monopolmarkt 4.
Mikroökonomik für Wirtschaftsingenieure Agenda 1. Einführung 2. Analyse der Nachfrage 3. Analyse des s 3.1 Marktgleichgewicht 3.2 Technologie und Gewinnmaximierung 3.3 Kostenkurven 3.4 Monopolmarkt 4.
Zwischenklausur 2006 VWL C. Gruppe B
 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Zwischenklausur 006 VWL C Gruppe B Name, Vorname: Fakultät: Matrikelnummer Prüfer: Datum: Anleitung Die Klausur besteht aus
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Zwischenklausur 006 VWL C Gruppe B Name, Vorname: Fakultät: Matrikelnummer Prüfer: Datum: Anleitung Die Klausur besteht aus
Übung zu Mikroökonomik II
 Prof. Dr. G. Rübel SS 2005 Dr. H. Möller-de Beer Dipl.-Vw. E. Söbbeke Übung zu Mikroökonomik II Aufgabe 1: Eine gewinnmaximierende Unternehmung produziere ein Gut mit zwei kontinuierlich substituierbaren
Prof. Dr. G. Rübel SS 2005 Dr. H. Möller-de Beer Dipl.-Vw. E. Söbbeke Übung zu Mikroökonomik II Aufgabe 1: Eine gewinnmaximierende Unternehmung produziere ein Gut mit zwei kontinuierlich substituierbaren
Kapitel 4. Kapitel 1 Einführung. Ressourcen, komparativer Vorteil und Einkommensverteilung. Internationale Wirtschaft, 8. Auflage
 Kapitel 1 Einführung Folie: 1 Kapitelübersicht Folie: 2 Einführung Modell einer Volkswirtschaft mit zwei Faktoren Wirkungen des internationalen Handels auf Volkswirtschaften mit zwei Faktoren Die politische
Kapitel 1 Einführung Folie: 1 Kapitelübersicht Folie: 2 Einführung Modell einer Volkswirtschaft mit zwei Faktoren Wirkungen des internationalen Handels auf Volkswirtschaften mit zwei Faktoren Die politische
Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2004/05. Klausur Mikroökonomik. Matrikelnummer: Studiengang:
 Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2004/05 Klausur Mikroökonomik Matrikelnummer: Studiengang: Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2004/05 Klausur Mikroökonomik Bitte bearbeiten Sie alle zehn
Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2004/05 Klausur Mikroökonomik Matrikelnummer: Studiengang: Prof. Dr. Ulrich Schwalbe Wintersemester 2004/05 Klausur Mikroökonomik Bitte bearbeiten Sie alle zehn
VO Grundlagen der Mikroökonomie
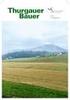 Institut für Wirtschaftsmathematik Ökonomie VO 105.620 Grundlagen der Mikroökonomie Die Kosten der Produktion (Kapitel 7) ZIEL: Die Messung von Kosten Die Kosten in der kurzen Frist Die Kosten in der langen
Institut für Wirtschaftsmathematik Ökonomie VO 105.620 Grundlagen der Mikroökonomie Die Kosten der Produktion (Kapitel 7) ZIEL: Die Messung von Kosten Die Kosten in der kurzen Frist Die Kosten in der langen
Kapitel 6: Produktion und Technologie
 Kapitel 6: Produktion und Technologie Hauptidee: Die Firma verwandelt Inputs in Outputs. Dieser Transformationsprozess wird beschrieben durch die Produktionsfunktion. 6.1 Die Firma und ihre Technologie
Kapitel 6: Produktion und Technologie Hauptidee: Die Firma verwandelt Inputs in Outputs. Dieser Transformationsprozess wird beschrieben durch die Produktionsfunktion. 6.1 Die Firma und ihre Technologie
Mikroökonomik. Das erste Wohlfahrtstheorem. Harald Wiese. Universität Leipzig. Harald Wiese (Universität Leipzig) Das erste Wohlfahrtstheorem 1 / 25
 Mikroökonomik Das erste Wohlfahrtstheorem Harald Wiese Universität Leipzig Harald Wiese (Universität Leipzig) Das erste Wohlfahrtstheorem 1 / 25 Gliederung Einführung Haushaltstheorie Unternehmenstheorie
Mikroökonomik Das erste Wohlfahrtstheorem Harald Wiese Universität Leipzig Harald Wiese (Universität Leipzig) Das erste Wohlfahrtstheorem 1 / 25 Gliederung Einführung Haushaltstheorie Unternehmenstheorie
Probeklausur zur Mikroökonomik I
 Prof. Dr. Robert Schwager Sommersemester 2004 Probeklausur zur Mikroökonomik I 09. Juni 2004 Name/Kennwort: Bei Multiple-Choice-Fragen ist das zutreffende Kästchen (wahr bzw. falsch) anzukreuzen. Für eine
Prof. Dr. Robert Schwager Sommersemester 2004 Probeklausur zur Mikroökonomik I 09. Juni 2004 Name/Kennwort: Bei Multiple-Choice-Fragen ist das zutreffende Kästchen (wahr bzw. falsch) anzukreuzen. Für eine
Kapitel 4 der neuen Auflage: Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung
 Kapitel 1 Einführung Kapitel 4 der neuen Auflage: Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Folie 4-1 4: Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Das Modell spezifischer Faktoren Außenhandel im
Kapitel 1 Einführung Kapitel 4 der neuen Auflage: Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Folie 4-1 4: Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Das Modell spezifischer Faktoren Außenhandel im
Mikroökonomie Allgemeine Gleichgewichtstheorie
 Mikroökonomie Allgemeine Gleichgewichtstheorie Universität Erfurt Wintersemester 08/09 Dittrich (Universität Erfurt) Preisbildung bei Marktmacht Winter 1 / 32 Übersicht Die Algebra der allgemeinen Gleichgewichtsanalyse
Mikroökonomie Allgemeine Gleichgewichtstheorie Universität Erfurt Wintersemester 08/09 Dittrich (Universität Erfurt) Preisbildung bei Marktmacht Winter 1 / 32 Übersicht Die Algebra der allgemeinen Gleichgewichtsanalyse
Neoklassische Produktions- und Kostenfunktion Mathematische Beschreibung zu einer Modellabbildung mit Excel
 Neoklassische Produktions- und Kostenfunktion Mathematische Beschreibung zu einer Modellabbildung mit Excel Dieses Skript ist die allgemeine Basis eines Modells zur Simulation der ökonomischen Folgen technischer
Neoklassische Produktions- und Kostenfunktion Mathematische Beschreibung zu einer Modellabbildung mit Excel Dieses Skript ist die allgemeine Basis eines Modells zur Simulation der ökonomischen Folgen technischer
Kapitelübersicht. Weltagrarmärkte (74064) Kapitel 2 Theorie des internationalen Handels Why Do We trade? 2.6: Internationale Faktorbewegungen
 Kapitelübersicht Weltagrarmärkte (74064) Kapitel 2 Theorie des internationalen Handels Why Do We trade? 2.6: Internationale Faktorbewegungen Einführung und Kreditvergabe und multinationale Unternehmen
Kapitelübersicht Weltagrarmärkte (74064) Kapitel 2 Theorie des internationalen Handels Why Do We trade? 2.6: Internationale Faktorbewegungen Einführung und Kreditvergabe und multinationale Unternehmen
Kosten der Produktion
 IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte Kosten der Produktion (Kapitel 7) Nicole Schneeweis (JKU Linz) IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte 1 / 28 Produktionstheorie Kapitel 6: Produktionstechnologie
IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte Kosten der Produktion (Kapitel 7) Nicole Schneeweis (JKU Linz) IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte 1 / 28 Produktionstheorie Kapitel 6: Produktionstechnologie
VWL 3: Mikroökonomie Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 2
 Georg Nöldeke Frühjahrssemester 2009 VWL 3: Mikroökonomie Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 2 1. (a) Die Grenzprodukte der Produktionsfaktoren sind: MP 1 (x 1, x 2 ) = f(x 1, x 2 ) x 1 MP 2 (x 1, x 2 )
Georg Nöldeke Frühjahrssemester 2009 VWL 3: Mikroökonomie Lösungshinweise zu Aufgabenblatt 2 1. (a) Die Grenzprodukte der Produktionsfaktoren sind: MP 1 (x 1, x 2 ) = f(x 1, x 2 ) x 1 MP 2 (x 1, x 2 )
5 Grundlagen der Differentialrechnung
 VWA-Mathematik WS 2003/04 1 5 Grundlagen der Differentialrechnung 5.1 Abbildungen Unter einer Abbildung f, f:d W, y= f( ) von einer Menge D (Definitionsbereich) in eine Menge W (Wertemenge) versteht man
VWA-Mathematik WS 2003/04 1 5 Grundlagen der Differentialrechnung 5.1 Abbildungen Unter einer Abbildung f, f:d W, y= f( ) von einer Menge D (Definitionsbereich) in eine Menge W (Wertemenge) versteht man
IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte
 LVA-Leiterin: Ana-Maria Vasilache Einheit 4: Produktionstheorie (Kapitel 6 & 7) Die Produktionstheorie - Zusammenfassung Kapitel 6: Produktionstechnologie (Inputs Output) Produktionsfunktion, Isoquanten
LVA-Leiterin: Ana-Maria Vasilache Einheit 4: Produktionstheorie (Kapitel 6 & 7) Die Produktionstheorie - Zusammenfassung Kapitel 6: Produktionstechnologie (Inputs Output) Produktionsfunktion, Isoquanten
Kapitel 3 Die Konsumententheorie
 Kapitel 3 Die Konsumententheorie Lekt. Dr. Irina-Marilena Ban Pearson Studium 2014 2014 Literatur Pindyck, Robert S; Rubinfeld, Daniel L., Mikroökonomie, 7. Auflage, Pearson Studium, 2009, S. 104-132;
Kapitel 3 Die Konsumententheorie Lekt. Dr. Irina-Marilena Ban Pearson Studium 2014 2014 Literatur Pindyck, Robert S; Rubinfeld, Daniel L., Mikroökonomie, 7. Auflage, Pearson Studium, 2009, S. 104-132;
Mikroökonomik für Wirtschaftsingenieure
 Mikroökonomik für Wirtschaftsingenieure Organisatorisches: Folien: Lehrstuhl für Politische Ökonomik & Empirische Wirtschaftsforschung: http://www.hsu-hh.de/berlemann/index_rmzpwqkjagkmopaq.html Agenda
Mikroökonomik für Wirtschaftsingenieure Organisatorisches: Folien: Lehrstuhl für Politische Ökonomik & Empirische Wirtschaftsforschung: http://www.hsu-hh.de/berlemann/index_rmzpwqkjagkmopaq.html Agenda
Klausur Mikroökonomik I. Wichtige Hinweise
 Prof. Dr. Anke Gerber Klausur Mikroökonomik I 1. Termin Sommersemester 2015 14.07.2015 Wichtige Hinweise 1. Lösen Sie nicht die Heftung der ausgeteilten Klausur. 2. Verwenden Sie nur das ausgeteilte Papier.
Prof. Dr. Anke Gerber Klausur Mikroökonomik I 1. Termin Sommersemester 2015 14.07.2015 Wichtige Hinweise 1. Lösen Sie nicht die Heftung der ausgeteilten Klausur. 2. Verwenden Sie nur das ausgeteilte Papier.
Kapitel 3 Rationales Konsumentenverhalten
 Kapitel 3 Rationales Konsumentenverhalten Vor- und Nachbereitung: Varian, Chapter 2, 3 und 5 Frank, Chapter 3 (mit Appendix) Übungsblatt 3 Achtung: Es wird anspruchsvoller! Klaus M. Schmidt, 2008 3.1 Die
Kapitel 3 Rationales Konsumentenverhalten Vor- und Nachbereitung: Varian, Chapter 2, 3 und 5 Frank, Chapter 3 (mit Appendix) Übungsblatt 3 Achtung: Es wird anspruchsvoller! Klaus M. Schmidt, 2008 3.1 Die
Lösungen zu den Übungsbeispielen aus Einheit
 Lösungen zu den Übungsbeispielen aus Einheit Haushaltstheorie Haushaltstheorie IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte (239.120) Sommerssemester 2010 Übung 1: Die Budgetbeschränkung Gegeben sind das Einkommen
Lösungen zu den Übungsbeispielen aus Einheit Haushaltstheorie Haushaltstheorie IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte (239.120) Sommerssemester 2010 Übung 1: Die Budgetbeschränkung Gegeben sind das Einkommen
5. Vollkommene Konkurrenz und Effizienz. Prof. Dr. Michael Berlemann (HSU) Vorlesung: Einführung in die Volkswirtschaftslehre HT / 193
 5. Vollkommene Konkurrenz und Effizienz Prof. Dr. Michael Berlemann (HSU) Vorlesung: Einführung in die Volkswirtschaftslehre HT 2009 134 / 193 5.1 Pareto-Effizienz Prof. Dr. Michael Berlemann (HSU) Vorlesung:
5. Vollkommene Konkurrenz und Effizienz Prof. Dr. Michael Berlemann (HSU) Vorlesung: Einführung in die Volkswirtschaftslehre HT 2009 134 / 193 5.1 Pareto-Effizienz Prof. Dr. Michael Berlemann (HSU) Vorlesung:
5. Das Standardmodell der realen Außenhandelstheorie
 5. Das Standardmodell der realen Außenhandelstheorie 1) Ricardo-Modell: komparativer Vorteil als Ursache der Spezialisierung; keine Aussagen über die Einkommensverteilung. 2) Das modifizierte Ricardo-Modell:
5. Das Standardmodell der realen Außenhandelstheorie 1) Ricardo-Modell: komparativer Vorteil als Ursache der Spezialisierung; keine Aussagen über die Einkommensverteilung. 2) Das modifizierte Ricardo-Modell:
Präferenzen und Nutzen. Kapitel 3. Präferenzrelationen. Präferenzrelationen. Präferenzen und Nutzen. Darstellung individueller Präferenzen
 Präferenzen und Nutzen Kapitel 3 Präferenzen und Nutzen Darstellung individueller Präferenzen Ordinale Ordnung vom Besten zum Schlechtesten Charakterisierung von Nutzenfunktionen Kardinale Ordnung, Alternativen
Präferenzen und Nutzen Kapitel 3 Präferenzen und Nutzen Darstellung individueller Präferenzen Ordinale Ordnung vom Besten zum Schlechtesten Charakterisierung von Nutzenfunktionen Kardinale Ordnung, Alternativen
41531 Klassische Produktionsfunktionen. Produktionstheorie. a) Von welchen Annahmen geht die klassische Produktionsfunktion aus?
 Produktionstheorie Vgl. März 003 Aufgabe 5 a) Von welchen Annahmen geht die klassische Produktionsfunktion aus? b) Skizzieren Sie den Verlauf der klassischen Produktionsfunktion und beschreiben Sie ausführlich
Produktionstheorie Vgl. März 003 Aufgabe 5 a) Von welchen Annahmen geht die klassische Produktionsfunktion aus? b) Skizzieren Sie den Verlauf der klassischen Produktionsfunktion und beschreiben Sie ausführlich
Warum Transitivität? A B, B C, aber C A verunmöglicht Entscheidung Geldpumpen -Paradox Condorcet - Paradox. GMF WS08/09 Grundzüge: Mikro
 Warum Transitivität? A B, B C, aber C A verunmöglicht Entscheidung Geldpumpen -Paradox Condorcet - Paradox 4. Theorie des privaten Haushalts Private Haushalte entscheiden über die Verwendung ihres (verfügbaren)
Warum Transitivität? A B, B C, aber C A verunmöglicht Entscheidung Geldpumpen -Paradox Condorcet - Paradox 4. Theorie des privaten Haushalts Private Haushalte entscheiden über die Verwendung ihres (verfügbaren)
Einführung in die Mikroökonomie Das Verbraucherverhalten
 Einführung in die Mikroökonomie as Verbraucherverhalten Universität Erfurt Wintersemester 07/08 rof. ittrich (Universität Erfurt) as Verbraucherverhalten Winter 1 / 30 Übersicht Offenbarte räferenzen und
Einführung in die Mikroökonomie as Verbraucherverhalten Universität Erfurt Wintersemester 07/08 rof. ittrich (Universität Erfurt) as Verbraucherverhalten Winter 1 / 30 Übersicht Offenbarte räferenzen und
