Einleitung 1. Tabelle 1: Zeitplan (in Tagen) der Nierenentwicklung in einigen Vertebraten (nach Saxén, 1987)
|
|
|
- Lars Kirchner
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Einleitung 1 1. Einleitung Die Niere ist ein lebenswichtiges Organ, deren wesentliche Funktion in der Kontrolle der Salz- und Wasserausscheidung des Körpers liegt. Zusätzlich hat sie die Aufgabe Endprodukte des Stoffwechsels und Fremdstoffe wie z.b. Harnstoff bzw. Medikamente zu eliminieren und gleichzeitig wertvolle Blutbestandteile wie z.b. Glukose zu konservieren. Die funktionelle Einheit dieses komplexen Organs ist das Nephron, welches in Glomerulus und Bowmanscher Kapsel das Blut filtert und über das Harnkanälchen - bestehend aus proximalem Tubulus, Henlescher Schleife und distalem Tubulus - in die Sammelrohre leitet. Während dieser Passage werden viele lösliche Stoffe des Filtrats über die Tubuluswand zurück ins Blut transportiert und nur der Rest über den Harnleiter mit dem Urin ausgeschieden. Die menschliche Niere besteht aus etwa 1,2 Millionen Nephrone, die über Sammelrohre mit Nierenbecken und Ureter sowie über ein Netzwerk von Kapillaren mit dem Blutgefäßsystem verknüpft sind. 1.1 Entwicklung der Niere Der Einsatz exkretorischer Tubuli als Ausscheidungsorgane ist ein phylogenetisch alter Mechanismus und Nephron-ähnliche Strukturen werden auch in primitiveren Organismen verwendet (Vize et al., 1997). Der einfachste dieser Nierentypen, der Pronephros (Vorniere), existiert nur in einigen der niedersten Fischarten als funktionelles exkretorisches Organ. In allen höheren Fischarten und den Amphibien übernimmt der Mesonephros (Urniere), der caudal zum Pronephros entsteht, diese Funktion. Der Metanephros, oder die definitive Niere, entwickelt sich wiederum caudal zum Mesonephros und ist das Harnorgan der Reptilien, Vögel und Säugetiere. Interessanterweise wird diese phylogenetische Entwicklung von einfachen zu komplexeren Nierensystemen während der Embryonalentwicklung der Vertebraten wiederholt. Es entstehen von cranial nach caudal fortschreitend alle drei sich zeitlich etwas überlappende Nierensysteme: die Vorniere, die Urniere und die Nachniere. Tabelle 1: Zeitplan (in Tagen) der Nierenentwicklung in einigen Vertebraten (nach Saxén, 1987) Pronephros Mesonephros Metanephros Mensch Maus 8 9,5 11 Ratte 10 11,5 12,5 Huhn 1,5 2,3 6 Die exkretorischen Nierenkanälchen aller dieser Systeme entwickeln sich aus einer paarigen mesodermalen Leiste (intermediäres Mesoderm) auf beiden Seiten des Körpers an der hinteren Wand der Bauchhöhle. Aus dieser mesodermalen Leiste entstehen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Urniere die Gonaden, weshalb sie auch als Urogenitalleiste bezeichnet wird. Sie grenzt an den Urnierengang (Wolffscher Gang), der einerseits als abführender Kanal von Vorniere und Urniere (soweit funktionell) dient, andererseits eine induktive Rolle bei der Entwicklung von Urniere und definitiver Niere spielt.
2 Einleitung 2 Die Vorniere besteht aus wenigen rudimentären, nicht funktionellen Paaren von Kanälchen, die am cranialen Ende des Urnierengang aus dem benachbarten intermediären Mesenchym gebildet werden. Bevor die letzten Kanälchen entstanden sind, bilden sich bereits die ersten cranialen wieder zurück. Auch die Urnierenkanälchen werden nach diesem Schema gebildet und wieder abgebaut (etwa 20 bis 30 Paare). Sie entwickeln sich aus mesenchymalen Kondensaten, die in epitheliale Kanälchen umgeformt werden und sich S-förmig krümmen. Sie bilden an ihrem distalen Ende einen Glomerulus, münden am entgegengesetzten Ende in den Urnierengang und ähneln damit in Entwicklung und Struktur sehr stark den Nephronen des Metanephros. Während mesonephrische Tubuli beim Menschen vorübergehend Harn ausscheiden, sind sie in der Maus wahrscheinlich nicht funktionsfähig (Kaufmann and Bard, 1999). In weiblichen Embryonen bildet sich der Mesonephros komplett zurück, während im männlichen Embryo der Urnierengang sowie einige der caudalen Kanälchen erhalten bleiben und Teile der männlichen Genitalwege (Ductus deferens und Ductuli efferentes) bilden. Während der Degeneration der mesonephrischen Tubuli sproßt am caudalen Ende des Urnierengangs die sogenannte Ureterknospe. Dieser blind endende Epithelschlauch wächst in eine Gruppe mesenchymaler Zellen ein, die als metanephrogenes Blastem oder Mesenchym bezeichnet wird. Anschließend beginnt sich die Ureterknospe dichitom zu verzweigen. Aus ihr entsteht das gesamte ableitende System des Metanephros aus Sammelrohren, Nierenkelchen und Nierenbecken. Die Ausscheidungskanälchen oder Nephrone dagegen entwickeln sich aus dem metanephrogenen Mesenchym. Abb. 1: Schematischer Überblick der Nierenentwicklung (nach Saxén 1987). (A) Die pronephrischen Tubuli werden im intermediären Mesenchym vom Nierengang induziert während dieser caudal auswächst. (B) Der Pronephros degeneriert und mesonephrische Tubuli bilden sich. (C) Die definitive Niere, der Metanephros, entsteht am caudalen Ende des Nierengangs durch Auswachsen der Ureterknospe.
3 Einleitung Entwicklung der Nephrone Die Verzweigung der Ureterknospe wird vom metanephrogenen Mesenchym induziert. An den Spitzen dieser Verzweigungen induziert wiederum der Ureter die Bildung von Nephronen im metanephrogenen Blastem. Es handelt sich hier also um eine klassische epitheliale-mesenchymale Interaktion und eine reziproke Induktion. Induzierte mesenchymale Zellen, die die Ureterspitzen umgeben, beginnen sich zu teilen und zu differenzieren. Dabei werden sie zuerst in Stammzellen umgeformt, aus welchen zum einen die Nephrone, zum andern aber Stromazellen entstehen. Die Zellen der nephrogenen Linie kondensieren zunächst zu Aggregaten, die sich in Epithelzellen umformen. Diese Epithelzellen bilden kugelförmige Nierenbläschen, die sich zu einer Komma-förmigen Struktur verlängern und dann zu einem S- förmigen Kanälchen krümmen. Die Zellen des Kanälchens differenzieren in die regional unterschiedlichen Zelltypen der Nephrone wie z.b. die Zellen der Bowmannschen Kapsel, die Podozyten, die distalen und proximalen Tubuluszellen. Gleichzeitig entsteht eine Verbindung zwischen Nephron und ableitendem System. An jeder neuen Verzweigungsstelle des Ureters werden neue Nephrone induziert, so daß die sich entwickelnde Niere in späteren Entwicklungsstadien unterschiedlich weit differenzierte Nephrone besitzt. Die marknahen Nephrone sind die zuerst gebildeten und damit am weitesten differenzierten, während die Nephrone im Cortex jünger sind und an der Peripherie fortlaufend neue gebildet werden. In der Maus setzt sich die Nephrogenese noch etwa sieben bis zehn Tage nach der Geburt fort, zu einem Zeitpunkt also, an dem die Niere bereits ihre Funktion aufgenommen hat. Abb. 2: Entwicklung der Nephrone (nach Drews, 1995). An den Spitzen der einwachsenden und sich baumartig verzweigenden Ureterknospe kondensieren die Mesenchymzellen. Nach einer Reihe von Differenzierungsschritten bildet sich schließlich das Nephron. Diese kurze Zusammenfassung der Nierenentwicklung beschreibt eine Vielzahl von Mechanismen, die auch bei der Entwicklung anderer Organe eine Rolle spielen: Sprossung einer epithelialen Struktur, gerichtetes Auswachsen in Richtung Mesenchym, mesenchymale-epitheliale Interaktion, Induktion, mesenchymale-epitheliale Umformung, epitheliale Morphogenese und Fusion, terminale Differenzierung. Ein Grund für das Studium der Nierenentwicklung ist also ihre Modellfunktion für andere Organe. Darüber hinaus ist ihre Morphogenese gut untersucht und in einem relativ einfachen Kultursystem nachvollziehbar (Grobstein, 1956). In solchen Organkulturen können
4 Einleitung 4 Ureterverzweigung, Nephronbildung und Differenzierung der Niere beobachtet und analysiert werden. Die Nierenanlage wird dadurch zugänglich für äußere Behandlung z.b mit Antikörpern, Oligonukleotiden oder LiCl. Somit können Entwicklungsmechanismen und congenitale Nierenfehlfunktionen des Menschen an der Niere der Maus oder an Mausmodellen untersucht werden (Überblick der Nierenentwicklung in Davies and Bard, 1998). 1.3 Congenitale Nierenfehlbildungen Es gibt eine ganze Reihe von Nierenerkrankungen, die auf eine fehlerhafte Entwicklung der Niere zurückzuführen sind. So kann z.b. eine frühzeitige Aufspaltung der Ureterknospe zu einer Verdopplung des Ureters führen. Die sogenannte Hufeisenniere entsteht durch Verwachsung beider Nieren am unteren Pol zu einer. Viele Fehlbildungen der Niere führen zu einer Zystenbildung in den epithelialen Strukturen sowohl der Nephrone als auch des Ableitungssystems. In anderen Fällen fehlt die Niere ganz (Aplasie), ist mißgebildet (Dysplasie) oder es entwickeln sich bereits im Embryo oder Kleinkind Nierentumore (Wilms Tumor). In einigen Fällen sind bereits Kandidatengene oder zumindest die chromosomale Region bekannt, die zu der Erkrankung führen. So wurden Mutationen in drei Genen gefunden, die bei Ausbildung der Autosomalen Dominanten Polyzystischen Nierenerkrankung beteiligt sind. Das erste dieser Gene Polycystin (PKD1) ist ein Transmembranprotein, das in der embryonalen Niere stark, in der adulten Niere aber nur schwach exprimiert ist und vermutlich eine Rolle bei der Zelladhäsion spielt (Palsson et al., 1996). Das zweite dieser Gene, PKD2, ist ebenfalls ein Membranprotein und verwandt mit der Familie der Spannungs-aktivierten Kalziumkanäle (Mochizuki et al., 1994). Es gibt Hinweise auf ein drittes Gen, ADPKD, das aber noch nicht kloniert ist (Daoust et al., 1995). Ein Kandidatengen für die autosomal rezessiv vererbte Nephronophthisis, die sehr früh zur Zystenbildung und schließlich zu einem kompletten Nierenversagen führt, wurde in der chromosomalen Region 2q13 lokalisiert (Hildebrandt et al., 1996). Neben den polyzystischen Nieren ist der Wilms Tumor eine häufig auftretende Fehlentwicklung (1 in ). Dieser Tumor, der der häufigste solide Tumor bei Kindern ist, zeigt typischerweise eine große Anzahl proliferierender Blastemzellen mit kleinen Inseln differenzierter Epithel- oder Stromazellen. Genetische Studien führten zur Identifizierung des Tumorsuppressorgens WT1 in der Region 11p13, das allerdings nur in 15% der Fälle mutiert ist (Call et al., 1990; Gessler et al., 1990). Auch das Denys-Drash- und das Frasier-Syndrom werden durch Mutationen im WT1-Locus ausgelöst und führen unter anderem durch mesangiale Sklerose bzw. glomeruläre Sklerose zu Nierenversagen (Klamt et al., 1998; Pelletier et al., 1991). Darüber hinaus ist das Denys-Drash-Syndrom durch eine Prädisposition für Wilms -Tumor gekennzeichnet. Bei Patienten mit Alport-Syndrom, ist die Basalmembran der Glomeruli zerstört, was auf eine Mutation in einem Gen, das für die Kollagen- Kette α5 der Basalmembran codiert, zurückzuführen ist (Zhou et al., 1991). Die genetische Analyse der Nierenfehlbildungen zeigt also, daß ganz unterschiedliche Genklassen betroffen und für die korrekte Entwicklung der Niere essentiell sind. Das wird auch durch das Studium der Nierenentwicklung in der Maus klar, die ein gut untersuchtes und damit ideales Modellsystem der Säugetier-Embryogenese ist. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Mausmutanten mit Deletionen in Genen, die während der Nierenentwicklung exprimiert werden. Einige, aber nicht alle, zeigten
5 Einleitung 5 tatsächlich Nierendefekte, wie z.b. polyzystische Nieren (bcl2) oder Nierenaplasie (c-ret, GDNF, WT1). 1.4 Molekulare Mechanismen der Nierenentwicklung Das Verständnis der morphologischen Grundlagen der Nierenentwicklung bildet die Basis für die Untersuchungen der molekularen Prinzipien. Viele der morphogenetischen Abläufe wurden mit Hilfe der Organkultur von Maus-Nierenanlagen studiert. Die Entwicklung molekularbiologischer Methoden führte dann zu einer explosionsartigen Vermehrung der Zahl neu entdeckter Gene, die während der Nierenentwicklung in den verschiedenen Zellpopulationen zu unterschiedlichen Zeitpunkten exprimiert sind. Insbesondere die Entwicklung der in situ Hybridisierung ermöglichte die genaue Lokalisation dieser Gene oder Genprodukte. Das sogenannte Gene targeting - also die gezielte Veränderung von Genen und Erzeugung genetisch veränderter Mäuse - schaffte eine wesentliche Voraussetzung zur Untersuchung der Funktion dieser Gene. Die Organkultur blieb ebenfalls ein wichtiges Werkzeug für funktionelle Studien. Mit ihrer Hilfe können die Ursachen für einen bestimmten mutanten Nierenphänotyp im Detail untersucht werden. Darüber hinaus kann die Behandlung normaler Nierenanlagen mit antisense Oligonukleotiden oder Antikörpern Hinweise auf die Funktion der entsprechenden Gene/Proteine geben. Reziproke Induktion Die weitaus größte Aufmerksamkeit wurde dem Prozeß der reziproken Induktion geschenkt. Schon vor mehr als 40 Jahren postulierte Grobstein, daß es ein vom Mesenchym ausgesandtes induktives Signal für das gerichtete Auswachsen der Ureterknospe und ein vom Ureter ausgesandtes Signal für die Differenzierung des Mesenchyms geben muß. Mittlerweile ist klar, daß diese Prozesse komplexer sind und viele Signale mit entsprechenden Rezeptoren zur Zellkommunikation bei den frühen Induktionsvorgängen beitragen. Die Suche nach Molekülen, die das Auswachsen der Ureterknospe und ihre Morphogenese regulieren, führte zur Identifizierung eines Signalkomplexes aus der epithelialen Rezeptor-Tyrosinkinase c-ret, dem Corezeptor GDNFR-α und dem mesenchymalen Liganden GDNF (glial cell line derived neurotrophic factor). Der Rezeptor c-ret ist in der Maus zwischen den Tagen 8 und 11,5 der Embryonalentwicklung (E8 - E11,5) im Wolffschen Gang und der auswachsenden Ureterknospe exprimiert (Pachnis et al., 1993). Später (E13,5 - E17,5) ist die Expression auf die Spitzen des sich verzweigenden Ureters beschränkt. Gezieltes Ausschalten des c-ret-gens in Mäusen führte zu Nierenaplasie und Hypodysplasie (Schuchardt et al., 1994). Der eigentliche Defekt in der Nierenentwicklung homozygoter c-ret-knockout-mäuse besteht darin, daß die Ureterknospe nicht auswächst und nicht auf Signale des metanephrogenen Mesenchyms reagieren kann (Schuchardt et al., 1996). Während Uretergewebe von c-ret-mutanten in vitro auch nicht auf Wildtyp-Nierenmesenchym regieren kann, wird mutantes Mesenchym in Kultur von Wildtyp-Uretergewebe induziert Nephrone zu bilden. Somit ist nur die Entwicklung der Ureterknospe in c-ret-defizienten Nierenanlagen gestört. Das sezernierte Glykoprotein GDNF ist ab E11,5 im metanephrogenen Mesenchym und später in den Nephronvorläufern exprimiert (Hellmich et al., 1996). Mausmutanten, welchen GDNF fehlt, zeigen
6 Einleitung 6 einen den c-ret-mutanten sehr ähnlichen Phänotyp: mesonephrische Tubuli und der Wolffsche Gang entwickeln sich normal, aber es wächst keine Ureterknospe aus (Moore et al., 1996; Pichel et al., 1996; Sanchez et al., 1996). Das metanephrogene Blastem wird zwar gebildet, aber wegen ausbleibender Induktion durch Apoptose abgebaut. Mit rekombinantem GDNF getränkte Kügelchen können ein Auswachsen des Ureters in GDNF- aber nicht in c-ret-defizienten Nierenanlagen induzieren (Durbec et al., 1996; Pichel et al., 1996). Diese Knockout- und Kulturexperimente deuten darauf hin, daß der vom Mesenchym sezernierte Faktor GDNF an den c-ret-rezeptor des Ureterepithels bindet und das Auswachsen sowie die Morphogenese der Ureterknospe reguliert. Für eine stabile Bindung ist zusätzlich der Corezeptor GDNFR-α erforderlich (Treanor et al., 1996). Der Phänotyp der c-ret- und GDNF-Mutanten ist sehr variabel und es entwickeln sich in den c-ret- Mutanten doch einige Ureterknospen, die sich in vitro verzweigen können (Schuchardt et al., 1994; Schuchardt et al., 1996). Das deutet darauf hin, daß noch andere Signalkomplexe neben c-ret/gdnfrα/gndf für das Auswachsen der Ureterknospe eine Rolle spielen. c-ros und c-met sind ebenfalls Rezeptoren, die im Ureterepithel exprimiert sind, aber sie zeigen keinen Nierenphänotyp im Knockout-Experiment. Ebenso konnten in vitro Experimente mit Antikörpern gegen den c-met Liganden HGF/SF (hepatocyte growth factor/scatter factor), die zur Hemmung der Ureterentwicklung führten, in vivo nicht bestätigt werden(schmidt et al., 1995; Uehara et al., 1995; Woolf et al., 1995). Für die Induktion des metanephrogenen Mesenchyms an den Spitzen der Ureterverzweigungen konnte bislang kein entsprechender Signalkomplex identifiziert werden. Wnt-Proteine - sezernierte Glykoproteine, die bei verschiedenen Musterbildungsprozessen während der Vertebraten Morphogenese eine Rolle spielen - sind derzeit die besten Kandidaten als Induktoren des Nierenblastems. Die Wnt-Gene der Vertebraten sind Homologe des Drosophila wingless-proteins, das für die korrekte Ausbildung der Flügel verantwortlich ist. In vitro Experimente zeigten, daß Wnt1 exprimierende Zellen die Nephronbildung in isoliertem metanephrogenen Mesenchym induzieren können (Herzlinger et al., 1994). Allerdings ist Wnt1 nicht im Ureter exprimiert, so daß wahrscheinlich andere Vertreter dieser mittlerweile fast zwanzig Mitglieder umfassenden Genfamilie die Induktions-Funktion in der Niere übernehmen. Interessanterweise wird Wnt1 im dorsalen Rückenmark transkribiert, das als effektivster heterologer Induktor des Nierenmesenchyms anstelle der Ureterknospe in Kultur verwendet wird. In der Niere sind Wnt11, Wnt7b und Wnt4 exprimiert. Während Wnt7b im gesamten Sammelrohr-System zu finden ist, markiert Wnt11 nur die Spitzen des sich verzweigenden Ureters, also die für die Mesenchyminduktion entscheidende Stelle (Kispert et al., 1996). In Organkultur wurde jedoch gezeigt, daß Wnt11 exprimierende Zellen die Nephronbildung nicht induzieren können (Kispert et al., 1998). Wnt4, welches während der normalen Entwicklung im kondensierenden metanephrogenen Mesenchym und in den daraus entstehenden Nephronvorläufern exprimiert ist, kann dagegen die Nephrogenese in isoliertem Mesenchym induzieren und vorantreiben. Knockout-Studien in Mäusen zeigten, daß Wnt4 essentiell für die Nierenentwicklung ist: homozygote Wnt4-Knockout-Mäuse sterben bei Geburt an Nierenaplasie (Stark et al., 1994). Obwohl eine Kondensation des Mesenchyms stattfindet, bleibt eine weitere Differenzierung aus. Überraschenderweise kann die Nephrogenese in Mesenchym von Wnt4-Knockout-Mäusen durch dorsales Rückenmark ausgelöst werden, was dafür spricht, daß dieser heterologe Induktor die Funktion von Wnt4 und nicht eines anderen vom Ureter ausgehenden Signals ersetzt. Wnt4 ist demnach ein entscheidender Autoregulator der Mesenchym-Induktion und der mesenchymalenepithelialen Umformung. Allerdings bleibt unklar, welches vom Ureter sezernierte Molekül die
7 Einleitung 7 Expression von Wnt4 auslöst. Ein weiteres Indiz für die Beteiligung eines Wnt-Moleküls am Induktionsprozeß, ist die Funktion von Lithiumchlorid als Induktor der Nephrogenese in vitro. Es konnte gezeigt werden, daß Lithium die Glykogen-Synthase- Kinase 3 (GSK3) inhibiert, die auch ein Zielmolekül des Wnt-Signaltransduktionsweges ist (Klein and Melton, 1996). Homologe des Drosophila frizzled (fz) Proteins fungieren wahrscheinlich als Rezeptoren der Wnt- Signalmoleküle. Es sind Membranproteine mit sieben Transmembrandomänen und einer extrazellulären Cystein-reichen Domäne (CRD), die für die Bindung der Wnt-Liganden verantwortlich ist (Bhanot et al., 1996; Wang et al., 1996; Yang-Snyder et al., 1996). Bislang wurden acht fz- Rezeptoren in Säugetieren identifiziert, über deren Expression und Funktion in der Niere allerdings wenig bekannt ist. Darüber hinaus wurde vor kurzem eine Klasse von Proteinen entdeckt, die zwar die CRD aber nicht die Transmembrandomänen der fz-rezeptoren besitzen: die sfrps (secreted frizzled related proteins) (Finch et al., 1997; Leyns et al., 1997; Rattner et al., 1997; Shirozu et al., 1996; Wang et al., 1997a). Obwohl in einigen Fällen eine Bindung von sfrp-molekülen an wingless oder Wnts und in Xenopus eine antagonostische Wirkung von frz-b durch Bindung an XWnt-8 gezeigt wurde, ist die Funktion dieser potentiellen Wnt-Modulatoren noch unklar. Der Prozeß der mesenchymalen Induktion erhält weitere Komplexität durch die die Entdeckung, daß sulfatierte Glykosaminoglykane (S-GAG) die Bindung von Wnt-Molekülen und anderen Wachstumsfaktoren an die entsprechenden Rezeptoren regulieren bzw. ermöglichen. In Drosophila wurde gezeigt, daß Heparin-ähnliche Glykosaminoglykane die wingless Signalübertragung beeinflussen (Binari et al., 1997; Hacker et al., 1997; Haerry et al., 1997). Darüber hinaus wurde in früheren in vitro Analysen der Nierenentwicklung demonstriert, daß die Hemmung der de novo Sulfatierung von Glykosaminoglykanen durch Chlorat Wachstum und Verzweigung des Ureters aber nicht die Nephrogenese reversibel hemmt (Davies et al., 1995). Hemmung der Proteoglykansynthese führt auch zu einem Verlust der Wnt11-Expression an den Spitzen des Ureters (Kispert et al., 1996). Weitere Hinweise für die Bedeutung der Gykosaminoglykane in der Nierenentwicklung ergab die Untersuchung von Mäusen mit einer gene trap -Mutation in der Heparansulfat-2-Sulfotransferase (Hs2st), einem für die Synthese der Heparansulfate benötigten Enzym (Bullock et al., 1998). In Hs2st Knockout-Mäusen wächst die Ureterknospe zwar vom Wolffschen Gang aus, aber verzweigt sich nicht. Dadurch bleibt auch die Kondensation von metanephrogenem Mesenchym um die Ureterknospe aus. Neben den Wnt-Proteinen binden Wachstumsfaktoren der FGF-Familie (fibroblast growth factor) an Heparansulfat-Proteoglykane. FGF2 wurde als das Molekül eines Hypophysenextrakts identifiziert, das die Kondensation des metanephrogenen Mesenchyms in Kultur induzieren kann (Perantoni et al., 1995). Allerdings zeigen FGF2-Knockout-Mäuse keinen Nierenphänotyp, was vermutlich mit der Expression weiterer FGF-Mitglieder in der sich entwickelnden Niere zu erklären ist (Finch et al., 1995). Weitere Signalmoleküle Neben Wnt-4 und GDNF ist auch Shh (sonic hedgehog) ein Faktor, der im Knockout-Experiment zum Verlust der Nieren führt (Chiang et al., 1996). Allerdings kann das Fehlen der Nieren auch ein sekundärer Effekt sein, der durch die ebenfalls gestörte Entwicklung der Körperachse und damit des intermediären Mesoderms hervorgerufen wird.
8 Einleitung 8 Die Faktoren BMP7 (bone morphogenic protein 7) und PDGF-B (platelet-derived growth factor-b) sind für die spätere Entwicklung der Niere essentiell. In der normalen Entwicklung ist das BMP7-Gen sowohl im Ureter als auch im metanephrogenen Mesenchym und den daraus entstehenden Tubuli exprimiert. BMP7-defiziente Nierenanlagen zeigen weniger Verzweigungen des Ureters und zusätzlich ein Absterben des metanephrogenen Blastems durch Apoptose (Dudley et al., 1995; Dudley and Robertson, 1997; Luo et al., 1995). Dieser Wachstumsfaktor scheint also für kontinuierliches Wachstum in der späteren Entwicklung essentiell zu sein. PDGF-B und der entsprechende Rezeptor PDGF-Rβ sind für die Bildung von Mesangiumzellen im Glomerulus verantwortlich, da diese Zellpopulation in Mausmutanten, welchen eines dieser Gene fehlt, nicht vorhanden ist (Leveen et al., 1994; Soriano, 1994). Transkriptionsfaktoren Transkriptionsfaktoren koordinieren die Expression aller an der Nierenentwicklung beteiligter Gene und regulieren damit nicht nur die Induktion, sondern auch die Differenzierung in verschiedene Zellpopulationen. Pax-Gene codieren für Transkriptionsfaktoren mit einer charakteristischen Paired-Box als DNA- Bindungsdomäne. Mutationen in Pax-Genen beim Menschen und der Maus verdeutlichen die entwicklungsbiologische Relevanz dieser Genfamilie für die Morphogenese des Skeletts (Pax1), von Auge und Nase (Pax6), der Schilddrüse (Pax8), der Kiementaschen-Derivate und Zähne (Pax9), der Wanderung von Neuralleistenzellen und Prä-Myoblasten (Pax3), der Entwicklung von B-Zellen und Mittelhirn (Pax5), sowie der Entwicklung der Niere (Pax2) (Mansouri et al., 1999). In der sich entwickelnden Niere ist zunächst Pax2 und später auch Pax8 exprimiert. Pax2 ist schon sehr früh während der Urogenitalentwicklung im Wolffschen Gang, den mesonephrischen Tubuli und später im kondensierenden metanephrogenen Mesenchym und in Komma-förmigen Strukturen zu finden. Die Expression wird allerdings schon in den S-förmigen Nephronvorläufern gedrosselt und ist im reifen Nephron nicht mehr nachweisbar (Dressler et al., 1990). Der Verlust des Pax2-Gens führt zur Degeneration von Wolffschem und Müllerschem Gang. Es werden weder mesonephrische Tubuli gebildet, noch wächst die Ureterknospe aus, wodurch die Induktion des Mesenchyms ausbleibt und es apoptotisch degradiert. In Pax2-Mutanten ist also die Entwicklung des gesamten intermediären Mesenchyms gestört. Pax8 ist etwas später als Pax2 in Nierenvesikeln exprimiert und es ist auch in späteren Differenzierungsstadien zu finden. Von Pax8-Knockout-Mäusen wird kein Nierendefekt berichtet (Mansouri et al., 1998). Es gibt Hinweise auf die Aktivierung des WT1-Tumor-Suppressorgens durch Pax-Proteine (Dehbi et al., 1996; Dehbi and Pelletier, 1996). Darüber hinaus wird für Pax2 und WT1 eine gegenseitige Regulierung postuliert, indem Pax2 die WT1-Expression aktiviert und anschließend WT1 die Pax2- Expression reprimiert. WT1 ist bereits im nicht-induzierten metanephrogenen Mesenchym exprimiert und wird nach Induktion verstärkt transkribiert. In WT1-Knockout-Mausmutanten wächst wie in Pax2-Mutanten die Ureterknospe nicht aus und das Mesenchym stirbt apoptotisch ab (Kreidberg et al., 1993). Durch Verlust des WT1-Gens kann das Signal für das Auswachsen der Ureterknospe nicht gebildet werden und das metanephrogene Mesenchym reagiert in vitro nicht auf dorsales Rückenmark. Auch für einige Homeobox-Transkriptionsfaktoren - Proteine mit Homeo-DNA-Bindungsdomäne - konnte eine bedeutende Funktion in der Nierenentwicklung gezeigt werden. Lim1 ist schon für die
9 Einleitung 9 Entwicklung von Pronephros und Mesonephros verantwortlich. Da Mausmutanten bereits am Embryonaltag 10 sterben, kann die Funktion von Lim1 für die Entwicklung des Metanephros an diesem Modell nicht untersucht werden (Shawlot and Behringer, 1995). Expression in Wolffschem Gang und induzierten Nierentubuli lassen aber auf eine Bedeutung von Lim1 in der frühen Nierenentwicklung schließen. Emx2 ist wie Pax2 im Wolffschen Gang und in der Ureterknospe exprimiert. Im Nierenmesenchym ist es allerdings erst in den epithelialen Nephronvorläufern zu finden. In Emx2-Knockout-Mäusen fehlt wie in Pax2-Mutanten der Genitaltrakt und die Nieren (Miyamoto et al., 1997). Die Ureterknospe wächst aus, aber verzweigt sich nicht, was auf eine dem Pax2-Gen nachgeschaltete Funktion des Emx2-Gens hinweist. Mutationen der klassischen Hox-Gene führen zu keinem Nieren-Phänotyp. Doppelmutanten der Hoxa11- und Hoxd11-Gene - beide normalerweise im metanephrogenen Mesenchym exprimiert - fehlen dagegen eine oder beide Nieren (Davis et al., 1995). Nach Induktion durch die Ureterknospe entstehen aus dem Nierenmesenchym nicht nur nephrogene, sondern auch interstitielle oder Stromazellen, die in der Peripherie der Niere und später zwischen Nephron- und Ureterzellen lokalisiert sind. Durch die gezielte Ausschaltung des in Stroma-Zellen exprimierten BF2-Winged-Helix-Transkriptionsfaktors in Mäusen, wurde eine Funktion des Stromas für die Morphogenese von Ureter und Mesenchym über eine reine Stützfunktion hinaus offenbar (Hatini et al., 1996). In BF2-Knockout-Mäusen sind zwar Stromazellen vorhanden, aber die Entwicklung von Ureter und nephrogenem Mesenchym ist gestört. Die Mausmutanten sterben kurz nach der Geburt und haben kleine, fusionierte Nieren. Sie bilden weder Komma- noch S-förmige Nephronvorläufer. Neben Transkriptionsfaktoren, die bei der reziproken Induktion oder der Entwicklung der verschiedenen Zellpopulationen mitwirken, kontrollieren andere die Zellproliferation (z.b. p53) oder den Zelltod (z.b. bcl2). Adhäsionsmoleküle und Extrazelluläre Matrix Proteine Nach Induktion des metanephrogenen Mesenchyms spielen Zellaggregation, Zellwanderung und Polarisation der neu gebildeten Epithelzellen eine große Rolle. Das erfordert auch eine Umbildung der Extrazellulären Matrix (ECM) und der Zelladhäsionsmoleküle. Untersuchungen der Cadherin- Expression zeigten, daß unterschiedliche Vertreter dieser Genfamilie in Ureter und den verschiedenen Abschnitten des Nephrons exprimiert sind (Cho et al., 1998). E-Cadherin wird in der Ureterknospe, den Sammelrohren und den reifen distalen Nierentubuli beobachted. Cadherin-11 ist im nichtinduzierten Mesenchym, Cadherin-6 in den mesenchymalen Aggregaten, den Nierenbläschen und den proximalen Tubulusvorläuferzellen exprimiert. P-Cadherin schließlich markiert den Glomerulus und die Podozyten. Bereits im primitiven Nierenbläschen ist ein Teil dieses Musters festgelegt, indem die proximale Hälfte Cadherin-6 und die distale Hälfte E-Cadherin exprimiert. Anhand der Cadherin- Genexpression kann nicht nur die Entwicklung der einzelnen Zelltypen der Niere verfolgt werden; die Expression verschiedener Cadherinmoleküle mit unterschiedlicher Adhäsionsspezifität könnte auch einen wichtigen regulatorischen Mechanismus repräsentieren. Cadherine binden intrazellulär an Catenine, die eine Verbindung zum Aktinfilament-Netzwerk oder zu anderen Transmembran- und Cytoplasmaproteinen herstellen. So bildet z.b. β-catenin intrazellulär einen Komplex mit APC (Adenomatous Poliposis Coli), und diese Bindung wird reguliert durch die GSK3 - einer Komponente
10 Einleitung 10 des Wnt-Signaltransduktionswegs. Damit bekommen die Cadherine über die reine Adhäsionsfunktion hinaus eine neue regulatorische Bedeutung in der Kontrolle der epithelialen Morphogenese, was auch im dominant-negativen Versuchsansatz oder in Knockout-Experimenten gezeigt wurde (Huber et al., 1996). Laminine - extrazelluläre Adhäsions-Glykoproteine - sind für die Bildung der Basalmembran und damit für die epitheliale Entwicklung essentiell. Sie binden an Rezeptoren auf epithelialen oder mesenchymalen Oberflächen wie z.b. Integrine. Nieren-Organkultur Experimente gaben Hinweise auf die Bedeutung dieser Rezeptoren und ihrer Liganden für die mesenchymale-epitheliale Transformation des metanephrogenen Mesenchyms nach Induktion (Ekblom, 1996). Das wurde in vivo durch Zerstörung der Integrin-α 8 -Untereinheit in Mäusen, in welchen Wachstum und Verzweigung des Ureters sowie die Nephrogenese gestört ist, bestätigt (Muller et al., 1997). Entscheidung zwischen nephrogener Linie und Stroma Die Induktion des metanephrogenen Mesenchyms führt zunächst zur Bildung von Stammzellen, die sich anschließend entweder zu nephrogenen Zellen oder zu Stromazellen differenzieren. Ein Mechanismus für die gegensätzliche Determinierung einzelner Zellschicksale wurde in Untersuchungen der Neurogenese in Drosophila beschrieben. Das System der sogenannten lateralen Inhibition, welches durch den Delta-Notch-Signaltransduktionsweg vermittelt wird, bestimmt in benachbarten ektodermalen Zellen die Entwicklung entweder zur Nervenzelle oder zur Epidermiszelle. Der Ligand Delta bindet an den Rezeptor Notch der Nachbarzelle, der das Signal an den Zellkern übermittelt. Dadurch werden Gene des Enhancer of Split-Komplexes angeschalten, die als Repressoren neuronaler Gene fungieren und somit den neuronalen Phänotyp unterdrücken. Dieser Mechanismus spielt außerdem bei anderen Prozessen wie z.b. der Segmentierung eine Rolle und Homologe von Delta und Notch wurden auch in Vertebraten identifiziert (Fisher and Caudy, 1998). Ihre Funktion bei der Bestimmung von Zellschicksalen und Zellgrenzen wird derzeit intensiv untersucht. In der sich entwickelnden Niere der Maus sind Notch1 und Notch2, sowie Dll1 (Deltalike1) und Jag1 (Jagged1, ein weiterer Notch Ligand homolog zu Drosophila serrate) exprimiert und möglicherweise an der Entscheidung zwischen Stroma- und Nephronzelle beteiligt (Mitsiadis et al., 1997; Weinmaster et al., 1991; Weinmaster et al., 1992). Allerdings sterben die entsprechenden Knockout-Mutanten zu früh um diese Beteiligung untersuchen zu können (Conlon et al., 1995; Hrabe de Angelis et al., 1997; Xue et al., 1999). Die hier beschriebenen und auch die meisten bisher bekannten Gene, die während der Nierenentwicklung exprimiert sind, wurden in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren entdeckt. Eine Aufstellung dieser Gene, die ständig aktualisiert wird, ist in der Kidney Development Database unter http// zu finden.
11 Einleitung Zielsetzung Die Aufklärung der molekularen Grundlagen der Nephrogenese ist nicht nur für die Ursachenforschung von Fehlbildungen oder pathologischen Veränderungen der Niere von Bedeutung. Sie trägt auch zum Verständnis von allgemeinen Entwicklungsprozessen bei, wie z.b. Induktion, mesenchymale-epitheliale Transformation oder terminale Differenzierung, die in der Entwicklung anderer Gewebe ebenfalls eine Rolle spielen. Der derzeitige Kenntnisstand zeigt, daß noch viele Bestandteile der komplexen regulatorischen Netzwerke und deren Zielgene fehlen. Zur Identifizierung von Genen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Nierenentwicklung exprimiert sind, bieten sich Methoden wie subtraktive Hybridisierung oder die sogenannte Differential Display PCR an. Dabei wird beispielsweise die Genexpression von zwei Entwicklungsstadien verglichen und somit gezielt nach Veränderungen in einem Gewebe zu einer bestimmten Zeit gesucht. Ziel dieser Arbeit war die Identifizierung und Charakterisierung von Genen, deren Transkription im metanephrogenen Mesenchym der Maus durch Induktion reguliert wird. Mit Hilfe der Transfilter- Organkultur sollte dieses Mesenchym getrennt von Uretergewebe kultiviert und induziert werden. Die Genexpression von induziertem versus nicht-induziertem metanephrogenem Blastem sollte mit Hilfe der Differential Display PCR verglichen und induzierte sowie reprimierte Gene identifiziert werden. Ähnlichkeiten zu bereits bekannten Sequenzen sollten durch Sequenzierung und anschließendem Vergleich mit Gen-Datenbanken überprüft werden. Da die Differential Display Methode auf der Amplifizierung von 3 -Enden aller in einem Gewebe exprimierter mrnas beruht, mußten längere oder vollständige cdnas neuer Gene ausgehend von diesen Gen-Endsequenzen erst isoliert werden. Diese sollten Auskunft über Art des Gens/Proteins und etwaige Sequenzhomologien geben. Anschließend sollte die Expression der isolierten Gene während der Embryonal- und insbesondere der Nierenentwicklung untersucht werden.
Strategie zur Isolierung transkriptionell regulierter Gene des metanephrogenen Mesenchyms
 Diskussion 82 5. Diskussion Seit mehr als 50 Jahren wird die Niere als Modellsystem für Untersuchungen von Gewebe- Interaktionen und Organogenese in Vertebraten studiert. Obwohl die morphologischen Abläufe
Diskussion 82 5. Diskussion Seit mehr als 50 Jahren wird die Niere als Modellsystem für Untersuchungen von Gewebe- Interaktionen und Organogenese in Vertebraten studiert. Obwohl die morphologischen Abläufe
Konversion von Mesenchym zu Epithel durch Zelladhäsionsmoleküle
 Konversion von Mesenchym zu Epithel durch Zelladhäsionsmoleküle Entwicklung des Harnapparats Phylogenese Vorniere Pronephros Zyklostoma Urniere Mesonephros Fische, Amphibien Nachniere Metanephros Kriechtiere,
Konversion von Mesenchym zu Epithel durch Zelladhäsionsmoleküle Entwicklung des Harnapparats Phylogenese Vorniere Pronephros Zyklostoma Urniere Mesonephros Fische, Amphibien Nachniere Metanephros Kriechtiere,
Übung 8. Vorlesung Bio-Engineering Sommersemester Kapitel Zellkommunikation
 1. Zellkommunikation 1.1. G-Proteine Unsere Geruchsempfindung wird ausgelöst wenn ein Geruchsstoff an einen G-Protein-verknüpften Rezeptor bindet und dieses Signal dann weitergeleitet wird. a) Was passiert
1. Zellkommunikation 1.1. G-Proteine Unsere Geruchsempfindung wird ausgelöst wenn ein Geruchsstoff an einen G-Protein-verknüpften Rezeptor bindet und dieses Signal dann weitergeleitet wird. a) Was passiert
Übung 8. 1. Zellkommunikation. Vorlesung Bio-Engineering Sommersemester 2008. Kapitel 4. 4
 Bitte schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf das Übungsblatt. Falls Sie mehr Platz brauchen verweisen Sie auf Zusatzblätter. Vergessen Sie Ihren Namen nicht! Abgabe der Übung bis spätestens 05. 05. 08
Bitte schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf das Übungsblatt. Falls Sie mehr Platz brauchen verweisen Sie auf Zusatzblätter. Vergessen Sie Ihren Namen nicht! Abgabe der Übung bis spätestens 05. 05. 08
Entwicklungs /gewebespezifische Genexpression. Coexpression funktional überlappender Gene
 Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Entwicklungs /gewebespezifische Genexpression Coexpression funktional überlappender Gene Positive Genregulation Negative Genregulation cis /trans Regulation
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Entwicklungs /gewebespezifische Genexpression Coexpression funktional überlappender Gene Positive Genregulation Negative Genregulation cis /trans Regulation
3.3 Wt1 ist notwendig für die Entwicklung der Milz
 3.3 Wt1 ist notwendig für die Entwicklung der Milz Während der Embryogenese wird WT1 in verschiedenen Organen exprimiert. Dazu gehören Nieren, Gonaden, die stromalen Zellen der Milz sowie mesotheliale
3.3 Wt1 ist notwendig für die Entwicklung der Milz Während der Embryogenese wird WT1 in verschiedenen Organen exprimiert. Dazu gehören Nieren, Gonaden, die stromalen Zellen der Milz sowie mesotheliale
Signaltransduktion durch Zell-Zell und Zell-Matrix Kontakte
 Signaltransduktion durch Zell-Zell und Zell-Matrix Kontakte - Integrine als zentrale Adhäsionsrezeptoren - - Focal Adhesion Kinase (FAK) als zentrales Signalmolekül - Regulation von Zellfunktionen durch
Signaltransduktion durch Zell-Zell und Zell-Matrix Kontakte - Integrine als zentrale Adhäsionsrezeptoren - - Focal Adhesion Kinase (FAK) als zentrales Signalmolekül - Regulation von Zellfunktionen durch
10. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Schlußfolgerungen
 10. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Schlußfolgerungen Ziel der Arbeit war die Etablierung von Methoden und Strategien zur Differenzierung von embryonalen Stamm(ES)-Zellen der Maus in Insulin-produzierende
10. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Schlußfolgerungen Ziel der Arbeit war die Etablierung von Methoden und Strategien zur Differenzierung von embryonalen Stamm(ES)-Zellen der Maus in Insulin-produzierende
Neurale Entwicklung und Plastizität I
 Neurale Entwicklung und Plastizität I 1. Neurogenese 1.1 Proliferation 1.2 Zelldetermination und Zellstammbäume 2. Molekulare Kontrolle der neuralen Entwicklung 2.1 Mechanismen der Genregulation 2.1.1
Neurale Entwicklung und Plastizität I 1. Neurogenese 1.1 Proliferation 1.2 Zelldetermination und Zellstammbäume 2. Molekulare Kontrolle der neuralen Entwicklung 2.1 Mechanismen der Genregulation 2.1.1
C SB. Genomics Herausforderungen und Chancen. Genomics. Genomic data. Prinzipien dominieren über Detail-Fluten. in 10 Minuten!
 Genomics Herausforderungen und Chancen Prinzipien dominieren über Detail-Fluten Genomics in 10 Minuten! biol. Prin cip les Genomic data Dr.Thomas WERNER Scientific & Business Consulting +49 89 81889252
Genomics Herausforderungen und Chancen Prinzipien dominieren über Detail-Fluten Genomics in 10 Minuten! biol. Prin cip les Genomic data Dr.Thomas WERNER Scientific & Business Consulting +49 89 81889252
Immunologie. Entwicklung der T- und B- Lymphozyten. Vorlesung 4: Dr. Katja Brocke-Heidrich. Die Entwicklung der T-Lymphozyten
 Immunologie Vorlesung 4: Entwicklung der T- und B- Lymphozyten T-Zellen entwickeln sich im Thymus B-Zellen entwickeln sich im Knochenmark (engl. bone marrow, aber eigentlich nach Bursa fabricius) Dr. Katja
Immunologie Vorlesung 4: Entwicklung der T- und B- Lymphozyten T-Zellen entwickeln sich im Thymus B-Zellen entwickeln sich im Knochenmark (engl. bone marrow, aber eigentlich nach Bursa fabricius) Dr. Katja
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten
 Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Differentielle Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis-/trans-regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation stattfinden? Definition
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Differentielle Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis-/trans-regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation stattfinden? Definition
Spezielle Pathologie des Harntraktes. 2. Teil
 Spezielle Pathologie des Harntraktes 2. Teil Embryologie der Niere (1): - es existieren drei aufeinander folgende Anlagen: - Vorniere (Pronephros) beim Säuger funktionslos - Urniere (Mesonephros) - Nachniere
Spezielle Pathologie des Harntraktes 2. Teil Embryologie der Niere (1): - es existieren drei aufeinander folgende Anlagen: - Vorniere (Pronephros) beim Säuger funktionslos - Urniere (Mesonephros) - Nachniere
Die Entwicklung von B Lymphozyten
 Die Entwicklung von B Lymphozyten Die Entwicklung von B Lymphozyten Übersicht Gliederung I II III IV Stammzellen im Knochenmark VDJ Rekombination Positive Selektion Negative Selektion I Stammzellen im
Die Entwicklung von B Lymphozyten Die Entwicklung von B Lymphozyten Übersicht Gliederung I II III IV Stammzellen im Knochenmark VDJ Rekombination Positive Selektion Negative Selektion I Stammzellen im
Adresse Pauwelsstraße Aachen Deutschland Telefon Telefax Internet Zur Homepage
 Universitätsklinikum Aachen, AÖR Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, Rheumatologische und Immunologische Erkrankungen (Medizinische Klinik II) Adresse Pauwelsstraße 30 52074 Aachen Deutschland
Universitätsklinikum Aachen, AÖR Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, Rheumatologische und Immunologische Erkrankungen (Medizinische Klinik II) Adresse Pauwelsstraße 30 52074 Aachen Deutschland
3 Ergebnisse. 3.1 Die Speckling-Domäne von Wt1 umfaßt die Aminosäuren
 3 Ergebnisse 3.1 Die Speckling-Domäne von Wt1 umfaßt die Aminosäuren 76-120 Die Existenz verschiedener Isoformen von WT1 ist unter anderem auf die Verwendung einer für die Aminosäuren KTS kodierenden alternativen
3 Ergebnisse 3.1 Die Speckling-Domäne von Wt1 umfaßt die Aminosäuren 76-120 Die Existenz verschiedener Isoformen von WT1 ist unter anderem auf die Verwendung einer für die Aminosäuren KTS kodierenden alternativen
Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten. lymphatische Organe. Erkennungsmechanismen. Lymphozytenentwicklung
 Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten lymphatische Organe Erkennungsmechanismen Lymphozytenentwicklung Entstehung und Verlauf adaptiver Immunantworten 142 Basale Aufgabe
Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten lymphatische Organe Erkennungsmechanismen Lymphozytenentwicklung Entstehung und Verlauf adaptiver Immunantworten 142 Basale Aufgabe
Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten. lymphatische Organe. Erkennungsmechanismen. Lymphozytenentwicklung
 Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten lymphatische Organe Erkennungsmechanismen Lymphozytenentwicklung Entstehung und Verlauf adaptiver Immunantworten 159 Basale Aufgabe
Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten lymphatische Organe Erkennungsmechanismen Lymphozytenentwicklung Entstehung und Verlauf adaptiver Immunantworten 159 Basale Aufgabe
Genetische Kontrolle der Entwicklung mehrzelliger Eukaryonten
 1. Was sind maternale Effektgene, wann entstehen aus diesen Genen Genprodukte und wo sind diese lokalisiert? Welche Aspekte der Entwicklung steuern maternale Effektgene? Übung 12 Entwicklungsgenetik Genetische
1. Was sind maternale Effektgene, wann entstehen aus diesen Genen Genprodukte und wo sind diese lokalisiert? Welche Aspekte der Entwicklung steuern maternale Effektgene? Übung 12 Entwicklungsgenetik Genetische
Grundlagen der Immunologie
 Grundlagen der Immunologie 9. Vorlesung Die zentrale (thymische) T-Zell-Entwicklung Alle Blutzellen stammen von der multipotenten hämatopoetischen Stammzelle des Knochenmarks Figure 1-3 Zentrale Lymphozytenentwicklung
Grundlagen der Immunologie 9. Vorlesung Die zentrale (thymische) T-Zell-Entwicklung Alle Blutzellen stammen von der multipotenten hämatopoetischen Stammzelle des Knochenmarks Figure 1-3 Zentrale Lymphozytenentwicklung
Cadherine und Wnt-Signale - Zusammenhalt im Gewebe oder Wachstum und Dispersion?
 Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/cadherine-und-wnt-signalezusammenhalt-im-gewebe-oder-wachstum-und-dispersion/ Cadherine und Wnt-Signale - Zusammenhalt
Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/cadherine-und-wnt-signalezusammenhalt-im-gewebe-oder-wachstum-und-dispersion/ Cadherine und Wnt-Signale - Zusammenhalt
3.2 Posttranslationelle Modifikation von Wt1 durch Phosphorylierung
 3.2 Posttranslationelle Modifikation von Wt1 durch Phosphorylierung Transkriptionsfaktoren erfahren oft eine posttranslationelle Modifikation in Form von Phosphorylierung und werden dadurch in ihrer Aktivität
3.2 Posttranslationelle Modifikation von Wt1 durch Phosphorylierung Transkriptionsfaktoren erfahren oft eine posttranslationelle Modifikation in Form von Phosphorylierung und werden dadurch in ihrer Aktivität
Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten. lymphatische Organe. Erkennungsmechanismen. Lymphozytenentwicklung
 Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten lymphatische Organe Erkennungsmechanismen Lymphozytenentwicklung Entstehung und Verlauf adaptiver Immunantworten 1 Basale Aufgabe eines
Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten lymphatische Organe Erkennungsmechanismen Lymphozytenentwicklung Entstehung und Verlauf adaptiver Immunantworten 1 Basale Aufgabe eines
In dieser Doktorarbeit wird eine rezeptorvermittelte Signalkaskade für Thrombin
 Diskussion -33-4. Diskussion In dieser Doktorarbeit wird eine rezeptorvermittelte Signalkaskade für Thrombin beschrieben, die zur Differenzierung von neonatalen glatten Gefäßmuskelzellen führt. Thrombin
Diskussion -33-4. Diskussion In dieser Doktorarbeit wird eine rezeptorvermittelte Signalkaskade für Thrombin beschrieben, die zur Differenzierung von neonatalen glatten Gefäßmuskelzellen führt. Thrombin
Stand von letzter Woche
 RUB ECR1 AXR1 Stand von letzter Woche E2 U? E1-like AXR1 Repressor ARF1 Proteasom AuxRE Repressor wird sehr schnell abgebaut notwendig für Auxinantwort evtl. Substrat für SCF Identifikation des SCF-Ubiquitin
RUB ECR1 AXR1 Stand von letzter Woche E2 U? E1-like AXR1 Repressor ARF1 Proteasom AuxRE Repressor wird sehr schnell abgebaut notwendig für Auxinantwort evtl. Substrat für SCF Identifikation des SCF-Ubiquitin
Hypothetische Modelle
 Hypothetische Modelle Heutiges Paper Vorgehensweise: Screening nach neuen Mutanten mit neuen Phänotyp Neuer Phänotyp: CPD, NPA- Resistenz (CPD, NPA: Wachstumshemmung durch Inhibierung des Auxin- Transport
Hypothetische Modelle Heutiges Paper Vorgehensweise: Screening nach neuen Mutanten mit neuen Phänotyp Neuer Phänotyp: CPD, NPA- Resistenz (CPD, NPA: Wachstumshemmung durch Inhibierung des Auxin- Transport
Signale und Signalwege in Zellen
 Signale und Signalwege in Zellen Zellen müssen Signale empfangen, auf sie reagieren und Signale zu anderen Zellen senden können Signalübertragungsprozesse sind biochemische (und z.t. elektrische) Prozesse
Signale und Signalwege in Zellen Zellen müssen Signale empfangen, auf sie reagieren und Signale zu anderen Zellen senden können Signalübertragungsprozesse sind biochemische (und z.t. elektrische) Prozesse
Transkription und Translation sind in Eukaryoten räumlich und zeitlich getrennt. Abb. aus Stryer (5th Ed.)
 Transkription und Translation sind in Eukaryoten räumlich und zeitlich getrennt Die Initiation der Translation bei Eukaryoten Der eukaryotische Initiationskomplex erkennt zuerst das 5 -cap der mrna und
Transkription und Translation sind in Eukaryoten räumlich und zeitlich getrennt Die Initiation der Translation bei Eukaryoten Der eukaryotische Initiationskomplex erkennt zuerst das 5 -cap der mrna und
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten
 Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Differentielle Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis-/trans-regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation stattfinden? Definition
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Differentielle Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis-/trans-regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation stattfinden? Definition
Elektronenmikroskopie zeigte die Existenz der A-, P- und E- trna-bindungsstellen. Abb. aus Stryer (5th Ed.)
 Elektronenmikroskopie zeigte die Existenz der A-, P- und E- trna-bindungsstellen Die verschiedenen Ribosomen-Komplexe können im Elektronenmikroskop beobachtet werden Durch Röntgenkristallographie wurden
Elektronenmikroskopie zeigte die Existenz der A-, P- und E- trna-bindungsstellen Die verschiedenen Ribosomen-Komplexe können im Elektronenmikroskop beobachtet werden Durch Röntgenkristallographie wurden
Inhalte unseres Vortrages
 Inhalte unseres Vortrages Vorstellung der beiden paper: Germ line transmission of a disrupted ß2 mirkroglobulin gene produced by homologous recombination in embryonic stem cells ß2 Mikroglobulin deficient
Inhalte unseres Vortrages Vorstellung der beiden paper: Germ line transmission of a disrupted ß2 mirkroglobulin gene produced by homologous recombination in embryonic stem cells ß2 Mikroglobulin deficient
kappa Gensegmente x J Segmente : 40 x 5 = 200 lambda Gensegmente x J Segmente : 30 x 4 = Vh x 27 Dh x 6 Jh Segmente : 65 x 27 x 6 = 11000
 Gene der variablen Regionen werden aus Gensegmenten e DJ-verknüpfte e VJ- oder VDJ-verküpfte aufgebaut leichte Ketten n Die Anzahl funktioneller Gensegmente für die variablen Regionen der schweren und
Gene der variablen Regionen werden aus Gensegmenten e DJ-verknüpfte e VJ- oder VDJ-verküpfte aufgebaut leichte Ketten n Die Anzahl funktioneller Gensegmente für die variablen Regionen der schweren und
Einleitung zu Pathologie der Niere
 Einleitung zu Pathologie der Niere Anteile der Niere: Pathologie Harntrakt Histologische Elemente der Niere: - Glomerulum (- a) Nephron (* - Tubulusapparat inkl. Sammelrohre - Gefäßsystem - Interstitium
Einleitung zu Pathologie der Niere Anteile der Niere: Pathologie Harntrakt Histologische Elemente der Niere: - Glomerulum (- a) Nephron (* - Tubulusapparat inkl. Sammelrohre - Gefäßsystem - Interstitium
Experimentelle Embryologie I
 Embryonale Stammzellen Totipotente Zellen nicht determiniert Pluripotente Zellen determiniert, aber nicht differenziert Gewinnung der Stammzellen: Möglichkeit A: im Blastozystenstadium nach dem Schlupf
Embryonale Stammzellen Totipotente Zellen nicht determiniert Pluripotente Zellen determiniert, aber nicht differenziert Gewinnung der Stammzellen: Möglichkeit A: im Blastozystenstadium nach dem Schlupf
Hypothetische Modelle
 Hypothetische Modelle Hypothetische Modelle Das Paper Identification of an SCF ubiquitin ligase complex required for auxin response in Arabidopsis thaliana William M. Gray,1,4 J. Carlos del Pozo,1,4 Loni
Hypothetische Modelle Hypothetische Modelle Das Paper Identification of an SCF ubiquitin ligase complex required for auxin response in Arabidopsis thaliana William M. Gray,1,4 J. Carlos del Pozo,1,4 Loni
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Tutorium SS 2016
 Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Tutorium SS 2016 Fragen für die Tutoriumsstunde 5 (27.06. 01.07.) Mendel, Kreuzungen, Statistik 1. Sie bekommen aus
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Tutorium SS 2016 Fragen für die Tutoriumsstunde 5 (27.06. 01.07.) Mendel, Kreuzungen, Statistik 1. Sie bekommen aus
RNA-binding proteins and micrornas in the mammalian embryo
 RNA-bindende Proteine und MikroRNAs im Säugetierembryo RNA-binding proteins and micrornas in the mammalian embryo Winter, Jennifer Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik, Freiburg Korrespondierender
RNA-bindende Proteine und MikroRNAs im Säugetierembryo RNA-binding proteins and micrornas in the mammalian embryo Winter, Jennifer Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik, Freiburg Korrespondierender
Liebe Studentinnen und Studenten Herzlich Willkommen im II. Semester!
 Liebe Studentinnen und Studenten Herzlich Willkommen im II. Semester! 1 Signalwege 2 Inhalt des Thema 1. Einleitung - 1. Vorlesung 2. Komponenten der Signalwegen 1. Vorlesung 3. Hauptsignalwege 2. Vorlesung
Liebe Studentinnen und Studenten Herzlich Willkommen im II. Semester! 1 Signalwege 2 Inhalt des Thema 1. Einleitung - 1. Vorlesung 2. Komponenten der Signalwegen 1. Vorlesung 3. Hauptsignalwege 2. Vorlesung
Susanne Kühl Michael Kühl Stammzellbiologie
 Susanne Kühl Michael Kühl Stammzellbiologie Ulmer 20 Grundlagen Apoptose: der programmierte Zelltod 1.4.4 Der Notch-Signalweg Von besonderer Bedeutung ist darüber hinaus der Notch/Delta-Signalweg (Abb.
Susanne Kühl Michael Kühl Stammzellbiologie Ulmer 20 Grundlagen Apoptose: der programmierte Zelltod 1.4.4 Der Notch-Signalweg Von besonderer Bedeutung ist darüber hinaus der Notch/Delta-Signalweg (Abb.
Die Distanz zur Quelle bei der Musterbildung im Embryo
 Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/die-distanz-zur-quelle-beider-musterbildung-im-embryo/ Die Distanz zur Quelle bei der Musterbildung im Embryo In
Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/die-distanz-zur-quelle-beider-musterbildung-im-embryo/ Die Distanz zur Quelle bei der Musterbildung im Embryo In
Molekularbiologie 6c Proteinbiosynthese. Bei der Proteinbiosynthese geht es darum, wie die Information der DNA konkret in ein Protein umgesetzt wird
 Molekularbiologie 6c Proteinbiosynthese Bei der Proteinbiosynthese geht es darum, wie die Information der DNA konkret in ein Protein umgesetzt wird 1 Übersicht: Vom Gen zum Protein 1. 2. 3. 2 Das Dogma
Molekularbiologie 6c Proteinbiosynthese Bei der Proteinbiosynthese geht es darum, wie die Information der DNA konkret in ein Protein umgesetzt wird 1 Übersicht: Vom Gen zum Protein 1. 2. 3. 2 Das Dogma
Kaninchen: 1 cagattgaggagagcaccaccatcgtcacctcgcagttggcggaggtcagcgcagccgag 60
 Ergebnisse 6 3. Ergebnisse 3. Charakterisierung der zelllinienspezifischen cdn Die Entwicklung zweier Zelllinien, des epithelialen Trophoblasten und des pluripotenten Embryoblasten, ist der erste Differenzierungsschritt
Ergebnisse 6 3. Ergebnisse 3. Charakterisierung der zelllinienspezifischen cdn Die Entwicklung zweier Zelllinien, des epithelialen Trophoblasten und des pluripotenten Embryoblasten, ist der erste Differenzierungsschritt
Untersuchungen zur Funktion von Stärke-Synthasen in der Kartoffel (Solanum tuberosum L.)
 Untersuchungen zur Funktion von Stärke-Synthasen in der Kartoffel (Solanum tuberosum L.) Inaugural-Dissertation Erlangung der Doktorwürde im Fachbereich Biologie der Freien Univeisität Berlin vorgelegt
Untersuchungen zur Funktion von Stärke-Synthasen in der Kartoffel (Solanum tuberosum L.) Inaugural-Dissertation Erlangung der Doktorwürde im Fachbereich Biologie der Freien Univeisität Berlin vorgelegt
The auxin-insensitive bodenlos mutation affects primary root formation and apicalbasal patterning in the Arabidopsis embryo
 The auxin-insensitive bodenlos mutation affects primary root formation and apicalbasal patterning in the Arabidopsis embryo Thorsten Hamann, Ulrike Mayer and Gerd Jürgens The Arabidopsis BODENLOS gene
The auxin-insensitive bodenlos mutation affects primary root formation and apicalbasal patterning in the Arabidopsis embryo Thorsten Hamann, Ulrike Mayer and Gerd Jürgens The Arabidopsis BODENLOS gene
Aus dem Johannes-Müller-Centrum für Physiologie der Medizinischen Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION
 Seite 1 Aus dem Johannes-Müller-Centrum für Physiologie der Medizinischen Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Mechanismen und pathophysiologische Konsequenzen einer hypoxievermittelten
Seite 1 Aus dem Johannes-Müller-Centrum für Physiologie der Medizinischen Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Mechanismen und pathophysiologische Konsequenzen einer hypoxievermittelten
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Theoretische Übungen SS 2016
 Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Theoretische Übungen SS 2016 Fragen für die Übungsstunde 4 (20.06. 24.06.) Regulation der Transkription II, Translation
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Theoretische Übungen SS 2016 Fragen für die Übungsstunde 4 (20.06. 24.06.) Regulation der Transkription II, Translation
Hypothetisches Modell
 Hypothetisches Modell Das Heutige Paper Inhalt: SCF bindet Auxin direkt TIR1 ist ein Auxin Rezeptor Auxin bindet direkt an TIR1, es sind keine zusätzlichen Komponenten nötig Methode Normales Pull down
Hypothetisches Modell Das Heutige Paper Inhalt: SCF bindet Auxin direkt TIR1 ist ein Auxin Rezeptor Auxin bindet direkt an TIR1, es sind keine zusätzlichen Komponenten nötig Methode Normales Pull down
Eukaryontische DNA-Bindedomänen
 1. Viele eukaryotische (und auch prokaryotische) Transkriptionsfaktoren besitzen eine DNA-bindende Domäne, die an eine ganz bestimmte DNA- Sequenz binden kann. Aufgrund von Ähnlichkeiten in der Struktur
1. Viele eukaryotische (und auch prokaryotische) Transkriptionsfaktoren besitzen eine DNA-bindende Domäne, die an eine ganz bestimmte DNA- Sequenz binden kann. Aufgrund von Ähnlichkeiten in der Struktur
5.7 Blütenentwicklung als Beispiel für kombinatorische Genfunktion
 160 Entwicklung Infloreszenzmeristem: Sprossmeristem nach Blühinduktion. Bildet an den Flanken statt Blatt-Blütenprimordien. TERMINAL FLOWER (TFL): Gen, welches nötig ist für die Identität des Infloreszenzmeristems,
160 Entwicklung Infloreszenzmeristem: Sprossmeristem nach Blühinduktion. Bildet an den Flanken statt Blatt-Blütenprimordien. TERMINAL FLOWER (TFL): Gen, welches nötig ist für die Identität des Infloreszenzmeristems,
Stammzellenmanipulation. Stammzellen können in Zellkultur manipuliert werden
 Stammzellenmanipulation Hämatopoietische Stammzellen können gebraucht werden um kranke Zellen mit gesunden zu ersetzen (siehe experiment bestrahlte Maus) Epidermale Stammzellpopulationen können in Kultur
Stammzellenmanipulation Hämatopoietische Stammzellen können gebraucht werden um kranke Zellen mit gesunden zu ersetzen (siehe experiment bestrahlte Maus) Epidermale Stammzellpopulationen können in Kultur
The Arabidopsis F-box protein TIR1 is an auxin receptor. Von Stefan Kepinski & Ottoline Leyser
 The Arabidopsis F-box protein TIR1 is an auxin receptor Von Stefan Kepinski & Ottoline Leyser Bekanntes Modell Was war bekannt? In der Zwischenzeit gefunden: - ABP1 kann große Mengen Auxin binden und ist
The Arabidopsis F-box protein TIR1 is an auxin receptor Von Stefan Kepinski & Ottoline Leyser Bekanntes Modell Was war bekannt? In der Zwischenzeit gefunden: - ABP1 kann große Mengen Auxin binden und ist
Zusammenfassung. Bei Patienten mit PAH zeigte sich in Lungengewebe eine erhöhte Expression von PAR-1 und PAR-2. Aktuelle Arbeiten weisen darauf
 Zusammenfassung Die pulmonal arterielle Hypertonie (PAH) ist eine schwerwiegende, vaskuläre Erkrankung, die mit einer hohen Sterblichkeit einhergeht. Die zugrundeliegenden Pathomechanismen sind multifaktoriell
Zusammenfassung Die pulmonal arterielle Hypertonie (PAH) ist eine schwerwiegende, vaskuläre Erkrankung, die mit einer hohen Sterblichkeit einhergeht. Die zugrundeliegenden Pathomechanismen sind multifaktoriell
Invasionsmechanismen und Metastasierung des Urothelkarzinoms. Dr. med. Karl-Ernst Ambs, Facharzt für Urologie, Parkstr.
 Invasionsmechanismen und Metastasierung des Urothelkarzinoms Dr. med. Karl-Ernst Ambs, Facharzt für Urologie, Parkstr. 6 65812 Bad Soden Allgemeines Hauptursachen der krebsspezifischen Mortalität sind
Invasionsmechanismen und Metastasierung des Urothelkarzinoms Dr. med. Karl-Ernst Ambs, Facharzt für Urologie, Parkstr. 6 65812 Bad Soden Allgemeines Hauptursachen der krebsspezifischen Mortalität sind
β2-microglobulin deficient mice lack CD4-8+cytolytic T cells
 β2-microglobulin deficient mice lack CD4-8+cytolytic T cells Mäuse mit einem Knock-out bezüglich ß-Microglobulin sind nicht in der Lage CD4-8+ cytotoxische T-Zellen zu bilden Nature,Vol 344, 19. April
β2-microglobulin deficient mice lack CD4-8+cytolytic T cells Mäuse mit einem Knock-out bezüglich ß-Microglobulin sind nicht in der Lage CD4-8+ cytotoxische T-Zellen zu bilden Nature,Vol 344, 19. April
5.Epigenetische Regulierung
 5.Epigenetische Regulierung Die Grundeinheit des Chromatins ist das Nukleosom DNA Linker DNA Nukleosom Kern DNS H1 10 nm 1. 30 nm Nukleosom Perle (4x2 Hyston Moleküle + 146 Paare Nukleotiden) 10 nm Strang
5.Epigenetische Regulierung Die Grundeinheit des Chromatins ist das Nukleosom DNA Linker DNA Nukleosom Kern DNS H1 10 nm 1. 30 nm Nukleosom Perle (4x2 Hyston Moleküle + 146 Paare Nukleotiden) 10 nm Strang
Immunbiologie. Teil 4
 Teil 4 Funktion der lymphatischen Organe: - es werden drei Arten von lymphatischen Organen unterschieden: - primäre, sekundäre und tertiäre lymphatische Organe - die Organe unterscheiden sich in ihrer
Teil 4 Funktion der lymphatischen Organe: - es werden drei Arten von lymphatischen Organen unterschieden: - primäre, sekundäre und tertiäre lymphatische Organe - die Organe unterscheiden sich in ihrer
Individualentwicklung
 Individualentwicklung Gestalten der Embryonen verschiedener Wirbeltiere Die Ontogenie ist die kurze und schnelle Rekapitulation der Phylogenie Keimesgeschichte ist ein Auszug der Stammesgeschichte Abb.
Individualentwicklung Gestalten der Embryonen verschiedener Wirbeltiere Die Ontogenie ist die kurze und schnelle Rekapitulation der Phylogenie Keimesgeschichte ist ein Auszug der Stammesgeschichte Abb.
Neurale Entwicklung und Plastizität II
 Neurale Entwicklung und Plastizität II 1. Zellwanderung 2. Axonale Wegfindung 3. Neurotrophine und Zelltod Literatur: Dudel et al., Neurowissenschaft (Springer) Kandel et al., Principles of Neural Science
Neurale Entwicklung und Plastizität II 1. Zellwanderung 2. Axonale Wegfindung 3. Neurotrophine und Zelltod Literatur: Dudel et al., Neurowissenschaft (Springer) Kandel et al., Principles of Neural Science
Personalisierte Medizin
 Personalisierte Medizin Möglichkeiten und Grenzen Prof. Dr. Friedemann Horn Universität Leipzig, Institut für Klinische Immunologie, Molekulare Immunologie Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie
Personalisierte Medizin Möglichkeiten und Grenzen Prof. Dr. Friedemann Horn Universität Leipzig, Institut für Klinische Immunologie, Molekulare Immunologie Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie
Rauben Sie dem Tumor seine Energie zum Wachsen
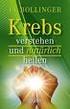 Rauben Sie dem Tumor seine Energie zum Wachsen Woher nimmt ein Tumor die Kraft zum Wachsen? Tumorzellen benötigen wie andere Zellen gesunden Gewebes auch Nährstoffe und Sauerstoff, um wachsen zu können.
Rauben Sie dem Tumor seine Energie zum Wachsen Woher nimmt ein Tumor die Kraft zum Wachsen? Tumorzellen benötigen wie andere Zellen gesunden Gewebes auch Nährstoffe und Sauerstoff, um wachsen zu können.
Das Zytoskelett. Intrazelluläre Mikrotubuliorganisation. Centrosomen. Mikrotubuli-bindende Proteine
 Das Zytoskelett Intrazelluläre Mikrotubuliorganisation Centrosomen Mikrotubuli-bindende Proteine Filamente des Zytoskeletts halten Zellen in Form Tubulin Aktin DNA Mikrotubuliaufbau in doppel oder dreifach
Das Zytoskelett Intrazelluläre Mikrotubuliorganisation Centrosomen Mikrotubuli-bindende Proteine Filamente des Zytoskeletts halten Zellen in Form Tubulin Aktin DNA Mikrotubuliaufbau in doppel oder dreifach
Tyrosinkinase- Rezeptoren
 Tyrosinkinase- Rezeptoren für bestimmte Hormone gibt es integrale Membranproteine als Rezeptoren Aufbau und Signaltransduktionsweg unterscheiden sich von denen der G- Protein- gekoppelten Rezeptoren Polypeptide
Tyrosinkinase- Rezeptoren für bestimmte Hormone gibt es integrale Membranproteine als Rezeptoren Aufbau und Signaltransduktionsweg unterscheiden sich von denen der G- Protein- gekoppelten Rezeptoren Polypeptide
Das Paper von heute. Samuel Grimm & Jan Kemna
 Das Paper von heute Samuel Grimm & Jan Kemna Bisheriges Modell Was bereits bekannt war - TIR1 ist an Auxinantwort (Zellteilung, Elongation, Differenzierung) beteiligt, im selben Signalweg wie AXR1 - TIR1
Das Paper von heute Samuel Grimm & Jan Kemna Bisheriges Modell Was bereits bekannt war - TIR1 ist an Auxinantwort (Zellteilung, Elongation, Differenzierung) beteiligt, im selben Signalweg wie AXR1 - TIR1
1. Welche Auswirkungen auf die Expression des lac-operons haben die folgenden Mutationen:
 Übung 10 1. Welche Auswirkungen auf die Expression des lac-operons haben die folgenden Mutationen: a. Eine Mutation, die zur Expression eines Repressors führt, der nicht mehr an den Operator binden kann.
Übung 10 1. Welche Auswirkungen auf die Expression des lac-operons haben die folgenden Mutationen: a. Eine Mutation, die zur Expression eines Repressors führt, der nicht mehr an den Operator binden kann.
Medizinische Embryologie
 BODO CHRIST FRANZ WACHTLER Medizinische Embryologie Molekulargenetik Morphologie Klinik Unter Mitarbeit von CHRISTIAN WILHELM UHLLSTEOM RflEOOCÄL Inhalt Vorwort i 1 Grundlagen der Entwicklungsbiologie
BODO CHRIST FRANZ WACHTLER Medizinische Embryologie Molekulargenetik Morphologie Klinik Unter Mitarbeit von CHRISTIAN WILHELM UHLLSTEOM RflEOOCÄL Inhalt Vorwort i 1 Grundlagen der Entwicklungsbiologie
Musterlösung - Übung 5 Vorlesung Bio-Engineering Sommersemester 2008
 Aufgabe 1: Prinzipieller Ablauf der Proteinbiosynthese a) Erklären Sie folgende Begriffe möglichst in Ihren eigenen Worten (1 kurzer Satz): Gen Nukleotid RNA-Polymerase Promotor Codon Anti-Codon Stop-Codon
Aufgabe 1: Prinzipieller Ablauf der Proteinbiosynthese a) Erklären Sie folgende Begriffe möglichst in Ihren eigenen Worten (1 kurzer Satz): Gen Nukleotid RNA-Polymerase Promotor Codon Anti-Codon Stop-Codon
Typ eines Gens oder jede Abweichung der DNA-Sequenz eines Gens. Heterozygot verschiedene Allele in der Zygote (= diploide Zelle)
 Die Klausur besteht aus insgesamt 11 Seiten (1 Deckblatt + 10 Seiten). Bitte geben Sie auf jeder Seite Ihren Namen oben rechts an. Bei der Korrektur können nur solche Seiten berücksichtigt werden, die
Die Klausur besteht aus insgesamt 11 Seiten (1 Deckblatt + 10 Seiten). Bitte geben Sie auf jeder Seite Ihren Namen oben rechts an. Bei der Korrektur können nur solche Seiten berücksichtigt werden, die
Der Haupthistokompatibilitätskomplex (MHC) AG-Erkennung von Ly. Doppelspezifität der T-Ly: AG-Spezifität und MHC-Spezifität
 Der Haupthistokompatibilitätskomplex (MHC) Major Histocompatibility Complex AG-Erkennung von Ly B-Ly: Erkennung unmittelbar der Determinanten von intakten AG T-Ly: in Komplex mit eigenen MHC- Molekülen
Der Haupthistokompatibilitätskomplex (MHC) Major Histocompatibility Complex AG-Erkennung von Ly B-Ly: Erkennung unmittelbar der Determinanten von intakten AG T-Ly: in Komplex mit eigenen MHC- Molekülen
Präsentiert von Christina Staudigl
 Präsentiert von Christina Staudigl Was bisher geschah 2 Was bisher geschah Neues aus der Signaltransduktion? - nichts wirklich grundlegendes Aber: mehr ARFs gefunden (10x) mit leichten Unterschieden in
Präsentiert von Christina Staudigl Was bisher geschah 2 Was bisher geschah Neues aus der Signaltransduktion? - nichts wirklich grundlegendes Aber: mehr ARFs gefunden (10x) mit leichten Unterschieden in
Biologie für Mediziner WS 2007/08
 Biologie für Mediziner WS 2007/08 Teil Allgemeine Genetik, Prof. Dr. Uwe Homberg 1. Endozytose 2. Lysosomen 3. Zellkern, Chromosomen 4. Struktur und Funktion der DNA, Replikation 5. Zellzyklus und Zellteilung
Biologie für Mediziner WS 2007/08 Teil Allgemeine Genetik, Prof. Dr. Uwe Homberg 1. Endozytose 2. Lysosomen 3. Zellkern, Chromosomen 4. Struktur und Funktion der DNA, Replikation 5. Zellzyklus und Zellteilung
Marianti Manggau. Untersuchungen zu Signalwegen von SPP in humanen Keratinozyten
 Marianti Manggau Untersuchungen zu Signalwegen von SPP in humanen Keratinozyten Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Manggau, Marianti: Untersuchungen zu Signalwegen von SPP in humanen Keratinozyten
Marianti Manggau Untersuchungen zu Signalwegen von SPP in humanen Keratinozyten Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Manggau, Marianti: Untersuchungen zu Signalwegen von SPP in humanen Keratinozyten
Das Zytoskelett (Gastvorlesung R. Brandt, Neurobiologie)
 Das Zytoskelett (Gastvorlesung R. Brandt, Neurobiologie) Inhalt: 1. Struktur und Dynamik der zytoskeletalen Filamentsysteme 2. Regulation der zytoskeletalen Komponenten 3. Molekulare Motoren 4. Zytoskelett
Das Zytoskelett (Gastvorlesung R. Brandt, Neurobiologie) Inhalt: 1. Struktur und Dynamik der zytoskeletalen Filamentsysteme 2. Regulation der zytoskeletalen Komponenten 3. Molekulare Motoren 4. Zytoskelett
Zelluläre Signaltransduktion II. TGF-ß, der Wachstumsfaktor, der das Wachstum hemmt?
 Zelluläre Signaltransduktion II TGF-ß, der Wachstumsfaktor, der das Wachstum hemmt? Transforming growth factor ß (TGF-ß) Growth factor Stimulation der Verankerungs-unabhängigen Zellproliferation von Tumorzellen
Zelluläre Signaltransduktion II TGF-ß, der Wachstumsfaktor, der das Wachstum hemmt? Transforming growth factor ß (TGF-ß) Growth factor Stimulation der Verankerungs-unabhängigen Zellproliferation von Tumorzellen
Transkription Teil 2. - Transkription bei Eukaryoten -
 Transkription Teil 2 - Transkription bei Eukaryoten - Inhalte: Unterschiede in der Transkription von Pro- und Eukaryoten Die RNA-Polymerasen der Eukaryoten Cis- und trans-aktive Elemente Promotoren Transkriptionsfaktoren
Transkription Teil 2 - Transkription bei Eukaryoten - Inhalte: Unterschiede in der Transkription von Pro- und Eukaryoten Die RNA-Polymerasen der Eukaryoten Cis- und trans-aktive Elemente Promotoren Transkriptionsfaktoren
Interspergierte Repetitive Elemente
 Interspergierte Repetitive Elemente SINEs = short interspersed nuclear elements LINES = long interspersed nuclear elements MIR = mammalian wide interspersed repeats (Säugerspezifisch?) DNA-Transposons
Interspergierte Repetitive Elemente SINEs = short interspersed nuclear elements LINES = long interspersed nuclear elements MIR = mammalian wide interspersed repeats (Säugerspezifisch?) DNA-Transposons
Embryologie des Urogenitaltraktes
 Kapitel 1 Embryologie des Urogenitaltraktes F. Seseke und R.-H. Ringert Abstract. Für das Verständnis einer Vielzahl kinderurologischer Erkrankungen sind ausreichende Kenntnisse über die embryonale Entwicklung
Kapitel 1 Embryologie des Urogenitaltraktes F. Seseke und R.-H. Ringert Abstract. Für das Verständnis einer Vielzahl kinderurologischer Erkrankungen sind ausreichende Kenntnisse über die embryonale Entwicklung
Praktikum Biochemie B.Sc. Water Science WS Enzymregulation. Marinja Niggemann, Denise Schäfer
 Praktikum Biochemie B.Sc. Water Science WS 2011 Enzymregulation Marinja Niggemann, Denise Schäfer Regulatorische Strategien 1. Allosterische Wechselwirkung 2. Proteolytische Aktivierung 3. Kovalente Modifikation
Praktikum Biochemie B.Sc. Water Science WS 2011 Enzymregulation Marinja Niggemann, Denise Schäfer Regulatorische Strategien 1. Allosterische Wechselwirkung 2. Proteolytische Aktivierung 3. Kovalente Modifikation
Spezielle Pathologie des Harntraktes. 1. Teil
 Spezielle Pathologie des Harntraktes 1. Teil Histologie und Physiologie der Niere Lage der Niere in der Bauchhöhle: Niere Lage der Niere: retroperitoneal d.h. die Niere ist einseitig von Serosa überzogen
Spezielle Pathologie des Harntraktes 1. Teil Histologie und Physiologie der Niere Lage der Niere in der Bauchhöhle: Niere Lage der Niere: retroperitoneal d.h. die Niere ist einseitig von Serosa überzogen
Posttranskriptionale Veränderungen der Genexpression bei hereditären Erkrankungen
 Posttranskriptionale Veränderungen der Genexpression bei hereditären Erkrankungen Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. nat. des Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität
Posttranskriptionale Veränderungen der Genexpression bei hereditären Erkrankungen Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. nat. des Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität
Kleine Moleküle mit großer Wirkung: micrornas und Mikrovesikel. Kerstin Junker Klinik für Urologie und Kinderurologie Homburg/Saar
 Kleine Moleküle mit großer Wirkung: micrornas und Mikrovesikel Kerstin Junker Klinik für Urologie und Kinderurologie Homburg/Saar Rejektion Hartono et al., 2009 Seite 2 Untersuchungsmaterial Nierengewebe
Kleine Moleküle mit großer Wirkung: micrornas und Mikrovesikel Kerstin Junker Klinik für Urologie und Kinderurologie Homburg/Saar Rejektion Hartono et al., 2009 Seite 2 Untersuchungsmaterial Nierengewebe
Neurobiologie des Lernens. Hebb Postulat Die synaptische Verbindung von zwei gleichzeitig erregten Zellen wird verstärkt
 Neurobiologie des Lernens Hebb Postulat 1949 Die synaptische Verbindung von zwei gleichzeitig erregten Zellen wird verstärkt Bliss & Lomo fanden 1973 langdauernde Veränderungen der synaptischen Aktivität,
Neurobiologie des Lernens Hebb Postulat 1949 Die synaptische Verbindung von zwei gleichzeitig erregten Zellen wird verstärkt Bliss & Lomo fanden 1973 langdauernde Veränderungen der synaptischen Aktivität,
2. An&asthma&ka Omalizumab Xolair /Novar&s CHO K1
 2. Antiasthmatika 2. An&asthma&ka Omalizumab Xolair /Novar&s CHO K1 Bei der Typ-I-Allergie oder der Überempfindlichkeit vom Soforttyp ist das zentrale Ereignis die Aktivierung von Mastzellen durch IgE.
2. Antiasthmatika 2. An&asthma&ka Omalizumab Xolair /Novar&s CHO K1 Bei der Typ-I-Allergie oder der Überempfindlichkeit vom Soforttyp ist das zentrale Ereignis die Aktivierung von Mastzellen durch IgE.
Basale Aufgabe eines Immunsystems
 Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten lymphatische Organe Erkennungsmechanismen Lymphozytenentwicklung Entstehung und Verlauf adaptiver Immunantworten 1 Basale Aufgabe eines
Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten lymphatische Organe Erkennungsmechanismen Lymphozytenentwicklung Entstehung und Verlauf adaptiver Immunantworten 1 Basale Aufgabe eines
Organisation von Pflanzen wird während der Embryogenese ausgebildet
 Organisation von Pflanzen wird während der Embryogenese ausgebildet Musterung: Apikal (Shootmeristem, Kotelydonen) Mitte (Hypokotyl, Wurzelmeristem) Basal (Wurzelmeristem) Ablauf der Embryogenese in Arabidopsis
Organisation von Pflanzen wird während der Embryogenese ausgebildet Musterung: Apikal (Shootmeristem, Kotelydonen) Mitte (Hypokotyl, Wurzelmeristem) Basal (Wurzelmeristem) Ablauf der Embryogenese in Arabidopsis
Das Komplementsystem. Membranangriffskomplex Regulation Komplementrezeptoren kleine C-Fragmente
 Das Komplementsystem Membranangriffskomplex Regulation Komplementrezeptoren kleine C-Fragmente Der Membranangriffskomplex C5 Konvertase alle 3 Aktivierungswege mit einem Ziel: Bildung einer C3-Konvertase
Das Komplementsystem Membranangriffskomplex Regulation Komplementrezeptoren kleine C-Fragmente Der Membranangriffskomplex C5 Konvertase alle 3 Aktivierungswege mit einem Ziel: Bildung einer C3-Konvertase
Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie
 Gerd Lehmkuhl Fritz Poustka Martin Holtmann Hans Steiner (Hrsg.) Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie Grundlagen und Störungsbilder Lehrbuch Kapitel 1 Zentralnervöse Entwicklungsprozesse Lars Wöckel,
Gerd Lehmkuhl Fritz Poustka Martin Holtmann Hans Steiner (Hrsg.) Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie Grundlagen und Störungsbilder Lehrbuch Kapitel 1 Zentralnervöse Entwicklungsprozesse Lars Wöckel,
Immunbiologie. Teil 3
 Teil 3 Haupthistokompatibilitätskomplex (1): - es gibt einen grundlegenden Unterschied, wie B-Lymphozyten und T-Lymphozyten ihr relevantes Antigen erkennen - B-Lymphozyten binden direkt an das komplette
Teil 3 Haupthistokompatibilitätskomplex (1): - es gibt einen grundlegenden Unterschied, wie B-Lymphozyten und T-Lymphozyten ihr relevantes Antigen erkennen - B-Lymphozyten binden direkt an das komplette
Fakten und Fragen zur Vorbereitung auf das Seminar Signaltransduktion
 Prof. Dr. KH. Friedrich, Institut für Biochemie II Fakten und Fragen zur Vorbereitung auf das Seminar Signaltransduktion Voraussetzung für einen produktiven und allseits erfreulichen Ablauf des Seminars
Prof. Dr. KH. Friedrich, Institut für Biochemie II Fakten und Fragen zur Vorbereitung auf das Seminar Signaltransduktion Voraussetzung für einen produktiven und allseits erfreulichen Ablauf des Seminars
Skript zum Thema Epigenetik
 Skript zum Thema Epigenetik Name: Seite! 2 von! 14 Worum geht s hier eigentlich? Zelle Erbgut im Zellkern Organismus 1 Die genetische Information, die jeder Mensch in seinen Zellkernen trägt, ist in jeder
Skript zum Thema Epigenetik Name: Seite! 2 von! 14 Worum geht s hier eigentlich? Zelle Erbgut im Zellkern Organismus 1 Die genetische Information, die jeder Mensch in seinen Zellkernen trägt, ist in jeder
Vorlesung Histologie. Die Studierenden sollen. die Niere in Mark und Rinde sowie in funktionelle Zonen gliedern können.
 Kurstag 18 Niere und ableitende Harnwege Themen Niere Ureter Harnblase Lernziele Prüfungsrelevante Lerninhalte Niere/ableitende Harnwege Rinde, Mark, Zonengliederung, Nephron, Glomerulum, Zelltypen, Filtrationsbarrieren
Kurstag 18 Niere und ableitende Harnwege Themen Niere Ureter Harnblase Lernziele Prüfungsrelevante Lerninhalte Niere/ableitende Harnwege Rinde, Mark, Zonengliederung, Nephron, Glomerulum, Zelltypen, Filtrationsbarrieren
Vorwärts /Rückwärts Mutationen. Somatische Zellen oder Keimzellen. Loss of function/gain of function. Mutagenese
 9. Mutationen Konzepte: Vorwärts /Rückwärts Mutationen Somatische Zellen oder Keimzellen Loss of function/gain of function Mutagenese 1. Loss of function Mutationen treten häufiger auf als gain of function
9. Mutationen Konzepte: Vorwärts /Rückwärts Mutationen Somatische Zellen oder Keimzellen Loss of function/gain of function Mutagenese 1. Loss of function Mutationen treten häufiger auf als gain of function
Aufbau eines Assays zur Optimierung einer Polymerase für die Generierung hochgradig fluoreszenz-markierter DNA
 Aufbau eines Assays zur Optimierung einer Polymerase für die Generierung hochgradig fluoreszenz-markierter DNA Von der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu
Aufbau eines Assays zur Optimierung einer Polymerase für die Generierung hochgradig fluoreszenz-markierter DNA Von der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu
Medizinische Immunologie. Vorlesung 6 Effektormechanismen
 Medizinische Immunologie Vorlesung 6 Effektormechanismen Effektormechanismen Spezifische Abwehrmechanismen Effektormechanismen der zellulären Immunantwort - allgemeine Prinzipien - CTL (zytotoxische T-Lymphozyten)
Medizinische Immunologie Vorlesung 6 Effektormechanismen Effektormechanismen Spezifische Abwehrmechanismen Effektormechanismen der zellulären Immunantwort - allgemeine Prinzipien - CTL (zytotoxische T-Lymphozyten)
Entwicklungsbiologie Master-Module. (bzw. 9 + 3)
 Entwicklungsbiologie Master-Module (bzw. 9 + 3) Entwicklungsbiologie Master-Module Block 3 Ebio I Evolution von Musterbildung und Gametogenese Mikroinjektion von Tribolium-Embryonen zur Proteinlokalisierung
Entwicklungsbiologie Master-Module (bzw. 9 + 3) Entwicklungsbiologie Master-Module Block 3 Ebio I Evolution von Musterbildung und Gametogenese Mikroinjektion von Tribolium-Embryonen zur Proteinlokalisierung
Niere, Affe, HE , 9-13 Niere, Glomerulus, EM... 7,8 Niere, Mark, quer, HE Ureter, HE Harnblase, HE... 18,19
 7 Niere, Harnwege Niere, Affe, HE... -6, 9- Niere, Glomerulus, EM... 7,8 Niere, Mark, quer, HE... 4 Ureter, HE... 5-7 Harnblase, HE... 8,9 Urethra, männlich, HE... 0- Niere - Übersicht (HE) 4 5 6 5 Rinde
7 Niere, Harnwege Niere, Affe, HE... -6, 9- Niere, Glomerulus, EM... 7,8 Niere, Mark, quer, HE... 4 Ureter, HE... 5-7 Harnblase, HE... 8,9 Urethra, männlich, HE... 0- Niere - Übersicht (HE) 4 5 6 5 Rinde
Beschreiben Sie in Stichworten zwei der drei Suppressormutationen, die man in Hefe charakterisiert hat. Starzinski-Powitz, 6 Fragen, 53 Punkte Name
 Starzinski-Powitz, 6 Fragen, 53 Punkte Name Frage 1 8 Punkte Nennen Sie 2 Möglichkeiten, wie der Verlust von Heterozygotie bei Tumorsuppressorgenen (Z.B. dem Retinoblastomgen) zum klompletten Funktionsverlust
Starzinski-Powitz, 6 Fragen, 53 Punkte Name Frage 1 8 Punkte Nennen Sie 2 Möglichkeiten, wie der Verlust von Heterozygotie bei Tumorsuppressorgenen (Z.B. dem Retinoblastomgen) zum klompletten Funktionsverlust
Autismus-Spektrum- Störung. von Dennis Domke & Franziska Richter
 Autismus-Spektrum- Störung von Dennis Domke & Franziska Richter Krankheitsbild Symptome können bereits direkt nach der Geburt auftreten Grad der Ausprägung variiert stark Geht oft mit weiteren psychischen
Autismus-Spektrum- Störung von Dennis Domke & Franziska Richter Krankheitsbild Symptome können bereits direkt nach der Geburt auftreten Grad der Ausprägung variiert stark Geht oft mit weiteren psychischen
