Die klinische Relevanz stiller Aspiration bei idiopathischem, sekundärem und atypischem Parkinsonsyndrom
|
|
|
- Dorothea Ritter
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 NeuroGeriatrie 2009; 6 (4): Die klinische Relevanz stiller Aspiration bei idiopathischem, sekundärem und atypischem Parkinsonsyndrom Eine retrospektive Analyse fiberendoskopischer Befunde in einer neurogeriatrischen Abteilung Abteilung Neurogeriatrie, St. Martinus-Krankenhaus, Düsseldorf Zusammenfassung Diese retrospektive Studie beinhaltet die Analyse von 52 fiberendoskopischen Befunden geriatrischer Patienten mit unterschiedlichen Parkinsonsyndromen aus den Jahren Es wird aufgezeigt, dass bei nahezu allen untersuchten Patienten dysphagische Symptome verschieden schwerer Ausprägungsgrade nachweisbar waren. Mehr als die Hälfte der Patienten zeigten neben hypopharyngealen Residuen auch deutliche endolaryngeale Penetration und tracheale Aspiration. Die klinische Relevanz des Problems wird durch die Beobachtung deutlich, dass der weit überwiegende Teil der fiberendoskopisch gesicherten Aspirationen»still«, das heißt ohne reflektorischen Husten, verlief. Vor diesem Hintergrund ist ein ähnlich engmaschiges Dysphagiemanagement, wie es für akute Schlaganfallpatienten seit langem gefordert und in weiten Teilen bereits etabliert wird, auch für Parkinsonerkankungen unterschiedlicher Genese zwingend erforderlich. Schlüsselwörter: Parkinsonsyndrome, FEES, Dysphagie-Symptome, stille Aspiration The clinical relevance of silent aspiration in different parkinsonian syndromes A retrospective analysis of fiberendoscopic exams in a neurogeriatric unit Abstract The retrospective study includes the analysis of 52 fiberendoscopic results of geriatric patients with different parkinsonian syndromes from 2005 to It is proved that almost all examined patients had had different types of dysphagic symptoms. In addition to hypophorayngeal residuals more than half of the examined patients also showed signs of endolaryngeal penetration as well as aspiration. The clinical relevance of the problem becomes evident in view of the fact that by far most of the aspirations shown in fiberendoscopic exams were»silent«which is to say without a reflexive cough. In view of this fact a similarly tight-knit management of dysphagia is definitely required for patients with different parkinsonian syndromes, very much as it has been demanded and actually established in many parts for patients who suffered a stroke. Key words: parkinsonian syndromes, EES, dysphagic symptoms, silent aspiration Hippocampus Verlag 2009 Einleitung Neben den akuten ischämischen Insulten sind die verschiedenen Parkinsonsyndrome ebenfalls häufig mit Dysphagien assoziiert. Beide Grunderkrankungen stellen typische Krankheitsbilder in neurogeriatrischen Abteilungen dar, wobei 50 % der akuten Schlaganfallpatienten dysphagisch sind (in der chronischen Phase immerhin noch 25 %). Das idiopathische Parkinsonsyndrom (IPS) ist ebenfalls zu ca. 50 % mit Dysphagien assoziiert. Für die atypischen Parkinsonsyndrome, wie beispielsweise die Multisystematrophien (MSA) und die progressive supranukleäre Blickparese (PSP) liegen bisher keine genauen Zahlen vor. Hier wird das Auftreten von Dysphagien als»im Verlauf sehr häufig«neurogeriatrie
2 angegeben [18]. Neben Komplikationen wie Malnutrition (Body Mass Index <18,5 kg/m²), Exsikkose und dem Verlust an Lebensqualität können Schluckstörungen zu schwerwiegenden Infekten der unteren Atemwege (Aspirationspneumonien) führen. Diese entstehen vor allem dann, wenn es zu Aspirationen kommt, die nicht von einem reflektorisch-protektiven Husten begleitet sind (sog.»silent aspirations«) und in vielen Fällen eine verzögerte Rekonvaleszenz, eine verlängerte stationäre Verweildauer oder gar den Tod zur Folge haben [5]. Daher ist ein systematisches Dysphagiemanagement zwingend erforderlich. Dieses sollte bereits unmittelbar nach stationärer Aufnahme des Patienten beginnen und die Sichtung der für Dysphagie kritischen Diagnosen und Symptome sowie ein ausreichend reliables und sensitives»schluckscreening«beinhalten. Dabei wäre zu klären, wie gefährdet neurogeriatrische Patienten sind, die in der Regel an meist fortgeschrittenen Formen des Parkinson leiden, und wie häufig es bei dieser Population zu stillen Aspirationen kommt. Ätiologie der verschiedenen Parkinsonsyndrome Unter den Parkinsonsyndromen unterscheidet man drei verschiedene Formen: n Das idiopathische Parkinsonsyndrom (IPS), welches mit einer Inzidenz von 20/ und einer Prävalenz von 150/ mit über 90 % am häufigsten ist. n Die sekundären Parkinsonsyndrome, welche entweder vaskulär, z. B. auf dem Boden einer SAE (subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie: lakunäre Infarkte kombiniert mit ischämisch bedingter Marklagererweichung des Großhirns [sog.»white matter lesions«]), Medikamenten-induziert (klassische Neuroleptika, Kalziumantagonisten etc.), posttraumatisch, entzündlich oder tumorbedingt sind. n Die atypischen Parkinsonsyndrome, mit den Subtypen Multisystematrophie (MSA), Parkinson-Typ (MSA-P) oder zerebellärer Typ (MSA-C), der progressiven supranukleären Blickparese (progessive supranuclear palsy, PSP, Steele-Richardson-Olszewski- Syndrom), der kortikobasalen Degeneration (CBD), spinozerebelläre Atrophien (nur einige Subtypen) sowie der Demenz vom Lewy-Body-Typ (DLB; Variante des IPS) Da an der hier vorliegenden Studie ausschließlich Patienten mit Morbus Parkinson, SAE sowie der progressiven supranukleären Blickparese teilnahmen, sei deren Pathogenese bezogen auf Dysphagie an dieser Stelle kurz exemplarisch beschrieben: Dem Krankheitsbild des Morbus Parkinson, auch»idiopathisches Parkinsonsyndrom«genannt, liegen degenerative Veränderungen in der Pars compacta der Substantia nigra (schwarze Substanz) des Mittelhirns mit Untergang dopaminerger Neuronen zugrunde. Pathologische Veränderungen, insbesondere sog.»lewy bodies«, können sich jedoch auch in anderen (nicht-dopaminergen) Kernen des Hirnstamms finden. Dies erklärt, dass Schluckstörungen hinsichtlich der medikamentösen Intervention schwerer zu beeinflussen sind als die klassischen Symptome wie Rigor, Tremor oder Akinese und posturale Instabilität [18]. Die vaskulär bedingten sog.»sekundären Parkinsonsyndrome«, entwickeln sich meist auf dem Boden einer subkortikalen arteriosklerotischen Enzephalopathie (SAE) und können ebenfalls zu parkinsonähnlichen Bewegungsstörungen führen, die mit entsprechenden Auffälligkeiten der einzelnen Schluckphasen assoziiert sind. Das Ausmaß der SAE korreliert dabei mit der Bolustransitzeit und mit Störungen der Aufmerksamkeit, wobei dies einen negativen Einflussfaktor bzgl. der Restitution von Dysphagien darstellt [17]. Die progressive supranukleäre Blickparese (PSP), auch Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom genannt, ist mit einer Prävalenz von 6/ deutlich seltener als das idiopathische Parkinsonsyndrom. Differentialdiagnostisch kommt es neben parkinsonähnlichen Symptomen zu einer axialen Dystonie und Rigidität (vor allem der Nackenregion), einer vertikalen Blickparese (vor allem nach unten) sowie pseudobulbären Symptomen [19]. Unserer Erfahrung nach wird die PSP im fortgeschrittenen Stadium sehr häufig von schweren Abschluckstörungen und erhöhter Penetrations-/Aspirationstendenz begleitet. Auffällig sind hier auch die deutlich reduzierten Schutzreflexe wie Räuspern und Husten. In diesem Zusammenhang werden folgende Fragen bedeutsam: Zu welchen deglutitiven Dysfunktionen kommt es bei parkinsonoiden Grunderkrankungen und wie ausgeprägt sind diese? Wie hoch ist dabei der Anteil stiller Aspirationen? Aber auch: Welche Ressourcen verbleiben schwer betroffenen Patienten zur Sicherung zumindest eines Teils an Lebensqualität? Nach einer Studie von Müller et al. [14] beträgt die mittlere Überlebenszeit nach Auftreten einer Dysphagie bei Patienten mit IPS, PSP und MSA zwischen 15 und 24 Monaten. Demnach stellen Dysphagien mit dem Zeitpunkt ihres Auftretens einen negativen prognostischen Indikator hinsichtlich der Überlebensdauer dar. Da bei vielen Patienten im Verlauf der Erkrankung die Anlage einer PEG notwendig wird, hat die Schluckdiagnostik im Hinblick auf ein Erhalten größtmöglicher Lebensqualität daher nicht nur zum Ziel, das Ausmaß der Aspirationsgefahr und die Schwere der Dysphagie zu evaluieren, sondern auch minimale Abschluckfähigkeiten zu berücksichtigen. So könnte in manchen Fällen die Möglichkeit oraler Beikost beispielsweise mittels kompensatorischer Schlucktechniken oder adaptierter Kostformen aufrecherhalten werden. Dysphagische Symptome bei unterschiedlichen Parkinsonsyndromen Schon Logemann [11] beobachtete bei der Auswertung videofluoroskopischer Untersuchungen an mehr als 100 Parkinsonpatienten spezifische dysphagische Symptome, die alle Phasen des Schluckens betrafen. So z. B. eine verlangsamte 158 NeuroGeriatrie
3 Die klinische Relevanz stiller Aspiration bei Morbus Parkinson Schwerpunktthema orale und pharyngeale Transitzeit sowie hypopharyngeales Pooling (vor allem in den Valleculae). Bei 46 % von 24 Patienten kam es zu trachealer Aspiration. Eine reduzierte Öffnung des oberen Ösophagussphinkters vor dem Hintergrund einer Relaxationsstörung wurde von Ali et al. [1] manometrisch bei 30 % der untersuchten Patienten festgestellt. Eine verlangsamte sequentielle Motilität vor allem der suprahyoidalen-submentalen Muskulatur fanden Ertekin et al. [6]. Des Weiteren kann es zu einem verlangsamten ösophagealen Bolustransport mit verzögerter primärer und sekundärer peristaltischer Welle kommen. In einigen Fällen sind auch ein gastroösophagealer Reflux aufgrund eines unzureichend relaxierenden unteren Ösophagussphinkters zu beobachten [22]. Wir sahen in der logopädisch-klinischen Diagnostik weitere Auffälligkeiten: n Störungen des Hand-Mund-Bezuges in der präoralen Phase (verlangsamtes Hinführen der Speise zum Mund, Tremor) n Schwierigkeiten in der Initiierung der pharyngealen Phase (»pumping motions of the tongue«) n Gestörter Glottisschluss und damit reduzierte laryngeale Schutzfunktion (Dysphonie) Methodik In einer deskriptiven Analyse wurden die fiberendoskopischen Befunde von insgesamt 52 geriatrischen Patienten (38 männl., 14 weibl.) mit unterschiedlichen Formen des M. Parkinson ausgewertet. Das Patientenkollektiv setzte sich wie folgt zusammen (s. Abb. 1): n idiopathisches Parkinsonsyndrom: 39 Patienten n vaskuläres Parkinsonsyndrom: 9 Patienten n progressive supranukleäre Blickparese: 4 Patienten Das mittlere Alter betrug 82,5 Jahre (68 97 Jahre). Keiner der Patienten erhielt vor dem Aufenthalt in unserer Klinik eine bildgebende Schluckdiagnostik. Die Identifikation der Patienten als»dysphagisch«erfolgte durch: 1. Ein logopädisch/klinisches Bedside-Screening (Wassertest nach Daniels), was die sukzessive Gabe von unterschiedlichen Mengen Flüssigkeit vorsieht und mit einer Sensitivität von 92 % eine mittel- bis schwergradige Dysphagie vorhersagt [4]. Der Test wird dabei als positiv gewertet, wenn zwei oder mehr der sechs distinkten klinischen Prädikatoren (Dysarthrie, Dysphonie, früh postdeglutitives Husten, abnormaler willkürlicher Husten, abnormaler Würgreflex, veränderte Stimmqualität nach Schluckversuchen) gemeinsam vorliegen. Obwohl die hohe Sensitivtät dieses Testes nur für akute Schlaganfallpatienten bestätigt werden konnte, wurde er im Rahmen dieser Studie auch bei dem hier untersuchten Patientenkollektiv analog durchgeführt, da die o. b. standardisierte Form die Vergleichbarkeit der Patienten miteinander ermöglichte. 2. Das Einbeziehen reliabler Parameter nach McCullough et al. [13], die in der Kombination der Items eine klinische Differenzierung zwischen leichten und mittel- bis schwergradigen Dysphagien erleichtern (s. Tab. 1). Reliable Parameter nach McCullough in einem Schluckscreening Pneumonie in der Anamnese Nutritionsstatus Gastrointestinale Probleme Zungenkraft/-reichweite Willkürlicher Husten Stimme nass/gurgelig Dysphonie/Aphonie Larynxelevation (nur bei Flüssigkeit) Stimmqualität nach Schluck Spontaner Husten/Clearance 75,0 % Idiopathisches Parkinsonsyndrom 17,30 % 7,69 % Patienten mit FEES (n=52) vaskuläres Parkinsonsyndrom progressive supranukleäre Blickparese Abb. 1: Prozentuale Verteilung der einzelnen Parkinsonsyndrome Tab. 1: McCullough-Kriterien (deutsche Übersetzung aus [2]) Die Patienten erhielten innerhalb der ersten 24 Stunden nach Schluckscreening, spätestens jedoch am dritten Tag des stationären Aufenthaltes, eine fiberendoskopische Untersuchung nach FEES -Standard [8]. Diese wurde in einer Tandem- Einheit von Arzt und Sprachtherapeut durchgeführt. Zur genaueren Beschreibung der Symptomatik nutzten wir ein vom Autor entwickeltes Befundschema, das sich im Wesentlichen an dem Evaluationsprotokoll von Langmore [8] orientiert. Es sieht die Ruhebeobachtung hypopharyngealer und laryngealer Strukturen, eine Funktionstestung laryngealer Verschlussmechanismen, der Velummotilität, der Pharynxkontraktion sowie Schluckversuche mittels unterschiedlicher Mengen und Konsistenzen vor. Da hier nur die Frage nach der Häufigkeit stiller Aspirationen im Vordergrund stand, wurde eine genauere Differenzierung in Bezug auf unterschiedliche Mengen und Konsistenzen in dieser Studie nicht vorgenommen. Für die Bestimmung des Penetrations-Aspirationsgrades (PA ) verwendeten wir die Penetrations-Aspirations-Skala (PAS) nach Rosenbek et al. [21], deren diagnostische Treffsicherheit in einer Studie von Colodny [3] aufgrund der guten Interrater-Übereinstimmung bestätigt wurde und sowohl die Tiefe der Bolusinvasion als auch die Suffizienz der protektiven Reaktion des Patienten berücksichtigt (vgl. Tab. 2). NeuroGeriatrie
4 PA 1 PA 2 PA 3 PA 4 PA 5 PA 6 PA 7 PA 8 Vorteile bildgebender Verfahren in der klinischen Diagnostik neurogener Dysphagien In den letzten Jahren wurde in mehreren Veröffentlichungen gezeigt, dass die herkömmliche logopädische Untersuchung des Schluckaktes, welche u. a. die Palpation der Larynxelevation, Supervision der Nahrungsaufnahme sowie die auditive Beurteilung der Stimmfunktion nach Schluckversuchen beinhaltet, zum einen erhebliche interindividuelle Unterschiede hinsichtlich der zu testenden Konsistenzen und Bolusgrößen aufweist, und zum anderen aufgrund der hohen Anzahl stiller Aspirationen nur gering sensitiv ist. Für eine genauere Analyse und das Erreichen höherer Sensitivität und Spezifität sind daher bildgebende Verfahren unverzichtbar. Einer der sog.»goldstandards«der Schluckdiagnostik ist die transnasale Endoskopie mit flexibler Fiberglasoptik, die als dynamisches, bildgebendes Verfahren vor allem für die Untersuchung geriatrischer Patienten folgende Vorteile bietet: n Sie bedarf nur eines geringen Maßes an Kooperation. n Sie lässt sich auch als»bedside-diagnostik«bei immobilen Patienten durchführen. n Eine genauere Analyse des Sekretstatus und -managements ist möglich. n Die Suffizienz von Clearingmanövern und Schutzreflexen sowie der Effekt von adaptiven und kompensatorischen Maßnahmen kann direkt beobachtet werden. n Die Überprüfung der Wirksamkeit von Anreichungsmethoden und Hilfsmitteln ist ebenfalls direkt möglich. n Da es zu keiner Strahlenexposition kommt, ist sie beliebig oft durchführbar und eignet sich zur Verlaufsdiagnostik. n Berichtet wird auch von guten Ergebnissen hinsichtlich der Effekte in der Nutzung der Fiberendoskopie als Biofeedback [16]. Ergebnis Material penetriert nicht Material penetriert, liegt oberhalb der Glottis und wird aus dem Aditus laryngis entfernt Material penetriert, liegt oberhalb der Glottis und wird nicht aus dem Aditus laryngis entfernt Material penetriert, liegt auf den Stimmbändern und wird aus dem Aditus laryngis entfernt Material penetriert, liegt auf den Stimmbändern und wird nicht aus dem Aditus laryngis entfernt. Material wird aspiriert, wird in den Aditus laryngis oder weiter nach oben befördert Material wird aspiriert, kann trotz Anstrengung nicht aus der Trachea herausbefördert werden. Material wird aspiriert, kein Versuch, es aus der Trachea zu entfernen Tab. 2: Penetrations-Aspirations-Skala nach Rosenbek et al. (deutsche Übersetzung: Keller, J. 2007). Die Mehrzahl der untersuchten Patienten (92,4 %) zeigten einen auffälligen endoskopischen Befund. Lediglich vier Patienten erhielten bei allen getesteten Mengen und Konsistenzen den PA 1. Schlucktherapeutische Interventionen i. S. adaptiver oder kompensatorischer Maßnahmen waren daher nicht angezeigt. Obwohl die deglutitiven Störungen bei Parkinsonsyndromen sehr vielschichtig sind, dominierten bei unserem Patientenkollektiv schwerpunktmäßig Aspirationen und hypopharyngeale Residuen unterschiedlichen Ausprägungsgrades. In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen dysphagischen Symptome dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei einigen Patienten beispielsweise sowohl Aspiration als auch hypopharyngeale Residuen gleichzeitig zu beobachten waren. Zum Dysphagie-Symptom»Aspiration«Nach einer Untersuchung von Langmore [9] sind entscheidende Prädiktoren für die Entstehung einer Aspirationspneumonie nicht allein dysphagische Symptome, sondern darüber hinaus noch andere Variablen wie beispielsweise»durchführen der Mundpflege durch andere Personen«,»Sondenernährung«sowie»das Essenreichen durch andere Personen«. Hier werden Variablen angesprochen, die für neurogeriatrische Patienten auch unabhängig von Dysphagie-Symptomen in besonderem Maße zutreffen sind diese doch häufig in den»aktivitäten des täglichen Lebens«auf externe Hilfen angewiesen. Es dürfte dennoch unbestritten sein, dass das Eindringen von Bolusmaterial in den endotrachealen Raum immer mit einem Risiko für den Patienten verbunden ist, insbesondere dann, wenn das Aspirat entweder nicht als solches gespürt wird oder die Protektivität des reflektorischen Hustens nicht ausreichend ist [15]. Während der hohe Anteil stiller Aspirationen bei Schlaganfallpatienten vor allem vor dem Hintergrund einer gestörten Sensibilität zu erklären ist, lässt sich dies nicht ohne Weiteres auf Parkinsonsyndrome übertragen, da diese zwar mit deutlichen motorischen, jedoch üblicherweise nicht mit sensiblen Störungen einhergehen. Patienten mit Aspirationspneumonie und still aspirierende Schlaganfallpatienten wiesen nach einem Übersichtsartikel von Ramsey et al. [20] einen geringen Level des Neurotransmitters»Substanz P«auf, der auch bei Parkinsonpatienten im fortgeschrittenen Stadium reduziert ist. Da»Substanz P«das Schlucken sowie reflektorisches Husten fazilitiert, kann eine geringe Konzentration auch ohne Sensibilitäteinschränkungen zu stillen Aspirationsepisoden führen. Die Wirksamkeit mancher gegen Dysphagien eingesetzter Pharmaka, wie z. B. ACE-Hemmer, Aspiration insgesamt (PA 6, 7 u. 8): 31 Patienten (59,6 %) endolaryngeale Penetration (PA 2, 3, 4 u.5): 11 Pa tienten (21,1 %) Residuen (Valleculae, Sinus piriformes): 27 Patienten (51,9 %) keine dysphagischen Symptome (PA 1): 4 Patienten ( 7,6 %) Tab. 3: Dysphagische Symptome in der FEES 160 NeuroGeriatrie
5 Die klinische Relevanz stiller Aspiration bei Morbus Parkinson Schwerpunktthema L-Dopa, Amantadin etc., beruht auf einer Steigerung der Konzentration von Substanz P. Dies führt damit sekundär zu einer verbesserten Protektivität reflektorischen Hustens sowie zur Fazilitation reflektorischen Schluckens. In dieser Studie verliefen 70,9 % der fiberendoskopisch gesicherten 31 Aspirationen still (PA 8). Ein weiterer Teil der Patienten zeigte zwar reflektorische Schutzreflexe, welche aber im Hinblick auf ihre Suffizienz als»nicht ausreichend protektiv«zu werten waren, da das Bolusmaterial nicht aus der Trachea entfernt werden konnte (PA 7) (s. Abb. 2). Die Patienten mit PSP zeigten besonders komplexe dysphagische Symptome wie stark reduzierte Abschluckfähigkeit und Aspiration. Drei der vier Patienten aspirierten still. Zum Dysphagie-Symptom»oro- und hypopharyngeale Residuen«Oro- und hypopharyngeale Residuen können Folge unterschiedlicher physiologischer Dysfunktionen sein [10], wobei ihre Lokalisation Hinweise auf die Art des muskulären Störungshintergrundes gibt. Eine eingeschränkte pharyngeale Kontraktion kann beispielsweise dazu führen, dass Bolusteile an den Pharynxwänden und in den Sinus piriformes retinieren. Bei einem Großteil der von uns untersuchten Patienten kam es schwerpunktmäßig zur Stasis in den Valleculae, was primär auf eine reduzierte Zungenbasisretraktion und somit einen zu schwachen Bolusschub zurückgeführt werden kann. In jedem Falle sind persistierende Bolusresiduen Ausdruck eines nur reduziert suffizienten Abschluckens und bilden, insbesondere in Kombination mit schwachen oder gar fehlenden Schutzreflexen, ein zusätzliches Gefährdungspotential für die Betroffenen. Daher sollte ihnen in Abhängigkeit vom Ausprägungsgrad auch eine wesentliche Bedeutung im Hinblick auf die Einschätzung des Schweregrades einer Dysphagie zukommen. Diskussion und Ausblick 5 4 Bei den verschiedenen Parkinsonsyndromen kann es zu Beeinträchtigungen aller Phasen des Schluckvorganges kommen. Während der wissenschaftliche Fokus in Bezug auf das Management neurogener Dysphagien bis vor einiger Zeit noch schwerpunktmäßig den akuten zerebrovaskulären Erkrankungen galt [12], macht diese Studie deutlich, wie wichtig die Etablierung eines evidenzbasierten klinischen Dysphagiemanagements gerade auch bei geriatrischen Patienten mit parkinsonoiden Grunderkrankungen ist. Im Hinblick auf die Versorgung akuter Schlaganfallpatienten wurde beispielsweise festgestellt, dass in Krankenhäusern, deren Schlucktestungsverfahren mangelhaft sind bzw. in denen ganz auf eine zeitnahe Schluckdiagnostik verzichtet wird, die Rate an Aspirationspneumonien doppelt so hoch war wie in Krankenhäusern, die sich an einem guten diagnostischen Standard orientierten [7]. Auch bei Patienten mit verschiedenen Formen des Parkinson demaskieren sich durch die bildgebende Schluckdiagnostik nicht selten rezidivierende stille Aspirationen. Deren klinische Relevanz ist, wie diese Untersuchung erstmalig zeigt, vor allem im neurogeriatrischen Bereich von herausragender Bedeutung. Vor diesem Hintergrund wäre auch bei diesen Patienten ein zeitnahes logopädisch-klinisches Schluckscreening in Kombination mit bildgebenden Verfahren wie z. B. der Fiberendoskopie zu fordern, um den negativen Folgen unentdeckter Aspirationen vorzubeugen und so die Lebensqualität, aber auch die Lebenserwartung der betroffenen Patienten zu optimieren. Literatur 22 Aspiration ohne reflektorischen Husten (PA 8) Aspiration mit zu schwachem reflektorischen Husten (PA 7) Aspiration mit suffizientem reflektorischen Husten (PA 6) Abb. 2: Relation der einzelnen Schweregrade der Aspiration 1. Ali GN, Wallace KL, Schwartz R, de Carle DJ, Zagami AS, Cook IJ. Mechanisms of oral-pharyngeal dysphagia in patients with parkinson's disease. Gastroenterology 1996; 110: Büßelberg N, Witscher-Hoving H, Stanschus S. Dysphagietherapie mittels Oberflächen-EMG Biofeedback (semg) nach Dissektion eines Glomustumors anhand von zwei Falldarstellungen. In: Stanschus S (Hrsg). Rehabilitation von Dysphagien. Idstein 2006, Colodny N. Interjudge and intrafudge reliabilities in fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing (FEES) using the penetration-aspiration scale: a replication study. Dysphagia 2002; 17: Daniels SK, McAdam CP, Brailey K, Foundas AL. Clinical assessment of swallowing and prediction of dysphagia severity. American Journal of Speech-Language Pathology 1997; 6: Doggett DL, Turkelson CM, Coates V. Recent developments in diagnosis and intervention for aspiration and dysphagia in stroke and other neuromuscular disorders. Current Atherosclerosis Reports 2002; 4: Ertekin C, Tarlaci S, Aydogdu I, Kiylioglu N, Yuceyar N, Turman AB, Secil Y, Esmeli F: Electrophysiological evaluation of pharyngeal phase of swallowing in patients with Parkinson's disease. Mov Disord 2002; 5: Hinchey JA, Shephard T, Furie K, Smitz D, Wang D, Tonn S. Formal dysphagia screening protocols prevent pneumonia. Stroke 2005; 36: Langmore S. Endoscopic evaluation and treatment of swallowing disorders. New York Langmore SE, Terpenning MS, Schork A, Chen Y, Murray JT, Lopatin D, Loesche WJ. Predictors of aspiration pneumonia: how important is dysphagia? Dysphagia 1998; 13: Logemann JA. Evaluation and treatment of swallowing disorders. 2 nd ed., Pro-ed, Austin, Texas Logemann JA, Blonsky E, Boshes B. Dsyphagia in parkinsonism. Dysphagia 1975; 231: Martino R, Foley N, Bhogal S, Diamant NE, Speechley M, Teasell R. Dysphagia after stroke: incidence, diagnosis, and pulmonary complications. Stroke 2005; 36: McCullough GH, Wertz RT, Rosenbek JC, Mills RH, Ross KB, Ashford JR. Inter- and Intrajudge reliability of a clinical examination of swallowing in adults. Dysphagia 2000; 15: NeuroGeriatrie
6 14. Müller J, Wenning GK, Verny M, McKee A, Chaudhuri KR, Jellinger K, Poewe W, Litvan I. Progression of dysarthria and dysphagia in postmortemconfirmed parkinsonian disorders. Arch Neurol 2001; 58: Nóbrega AC, Rodrigues B, Melo A. Is silent aspiration a risk factor for Respiratory infection in Parkinson's disease patients? Parkinsonism Relat Disord 2008, Abstract. 16. Pluschinski P. Die Videoendoskopie als Biofeedback-Verfahren in der Rehabilitation geriatrischer Dysphagiker. In: Stanschus S (Hrsg). Rehabilitation von Dysphagien. Idstein 2006, Prosiegel M. Neurologie von Schluckstörungen. In: Prosiegel M (Hrsg). Praxisleitfaden Dysphagie, Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen. Fresenius Kabi, Bad Homburg 2002, Prosiegel M. Qualitätskriterien und Standards für die Diagnostik und Therapie von Patienten mit neurologischen Schluckstörungen. Neurogene Dysphagien Leitlinien 2003 der DGNKN. Neurol Rehabil 2003; 9: Prosiegel M, Buchholz D. Mit Schluckstörungen assoziierte neurologische Erkrankungen. In: Bartolome G, Schröter-Morasch H (Hrsg). Schluckstörungen. Diagnostik und Rehabilitation. München 2006, Ramsey D, Smithard D, Kalra L. Silent Aspiration: What do we know? Dysphagia 2005; 20: Rosenbek JC, Robbins J, Roecker EB, Coyle JL, Wood JL. A Penetration-Aspiration Scale. Dysphagia 1996; 11: Schaupp U. Dysphagie im Alter. In: Kolb G (Hrsg). Dysphagie, Kompendium für Ärzte und Sprachtherapeuten in Klinik, Rehabilitation und Geriatrie. München 2000, Danksagung: Wir danken Herrn Dr. med. Mario Prosiegel, Herrn Dr. med. Dieter Schneider sowie Herrn Sönke Stanschus, M.A. für die freundliche Unterstützung und wertvollen Anregungen. Interessenvermerk: Es besteht kein Interessenkonflikt Korrespondenzadresse: Dipl.-Sprachheilpäd. J. Keller Abteilung Neurogeriatrie St. Martinus Krankenhaus Düsseldorf Gladbacherstraße Düsseldorf j.keller@martinus-duesseldorf.de G. Baller Neuauflage Kognitives Training Ein sechswöchiges Übungsprogramm für Senioren zur Verbesserung der Hirnleistung 144 Seiten, brosch., inkl. CD-ROM ISBN , 3., überarbeitete Auflage, Hippocampus Verlag 2009, 19,90 Das von der klinischen Neuropsychologin Gisela Baller konzipierte Übungsbuch umfasst ein Programm für ein sechswöchiges Eigentraining zur Förderung der kognitiven Leistungsfähigkeit. Ausgehend von fünf Trainingstagen pro Woche und drei bis vier Übungen pro Tag enthält es 100 Übungen zum Eigentraining. Die Zusammensetzung der Übungseinheiten für einen Tag ist so abgestimmt, dass die Trainingsdauer etwa Minuten beträgt. Die Art und Zusammensetzung der Übungen erfolgt in Anlehnung an die Symptome des»mild cognitive impairment«(leichte Hirnleistungsstörungen). Entsprechend liegt der Schwerpunkt der Übungen auf der Förderung der Merkfähigkeit, der Orientierung und des Urteilsvermögens. Die Übungen wurden dahingehend ausgewählt, dass sie einen möglichst alltags praktischen Bezug aufweisen. Auch motivationale Aspekte wurden bei der Zusammenstellung der Übungen berücksichtigt. So sind in regelmäßigen Abständen Langzeitgedächtnisübungen eingebaut, die für ältere Personen meistens leichter lösbar sind und so Erfolgserlebnisse vermitteln. Zum anderen informiert ein Zwischentext über die Bedeutung des regelmäßigen Hirnleistungstrainings. Dementsprechend besteht das Übungsbuch aus einem kurzen Einleitungsteil, dem Übungsteil und dem Lösungsteil. Des Weiteren enthält der Anhang einen»tageskalender«, der das zeitliche Orientierungsvermögen und die Planungskompetenz fördern soll und gegebenenfalls dem behandelnden Arzt als Rückmeldung vorgelegt werden kann. Zum wiederholenden Training können die Übungen von der beiliegenden CD ausgedruckt werden. 162 NeuroGeriatrie
Schluckdiagnostik in Partnerschaft mit der Neurologie
 Schluckdiagnostik in Partnerschaft mit der Neurologie Dr. med. Olaf Schwarz Stroke Unit der Neurologischen Klinik am Bürgerhospital, Klinikum Stuttgart 15. Geriatrietag 27. September 2006 Stuttgart Einleitung
Schluckdiagnostik in Partnerschaft mit der Neurologie Dr. med. Olaf Schwarz Stroke Unit der Neurologischen Klinik am Bürgerhospital, Klinikum Stuttgart 15. Geriatrietag 27. September 2006 Stuttgart Einleitung
Wie können wir in Zukunft diese Fragen beantworten?
 Parkinson Krankheit: Diagnose kommt sie zu spät? Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder Mannheim (23. September 2010) - Die Frage, ob derzeit die Diagnosestellung einer Parkinson-Erkrankung zu spät kommt,
Parkinson Krankheit: Diagnose kommt sie zu spät? Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder Mannheim (23. September 2010) - Die Frage, ob derzeit die Diagnosestellung einer Parkinson-Erkrankung zu spät kommt,
GERIATRIE. ÜBERRASCHEND VIELFÄLTIG
 GERIATRIE. ÜBERRASCHEND VIELFÄLTIG KASUISTIK Wiederkehrende Lungenentzündung bei einem 74-jährigen Mann Was steckt dahinter? Ein Fall von Dr. med. Gabriele Röhrig, Oberärztin Lehrstuhl für Geriatrie an
GERIATRIE. ÜBERRASCHEND VIELFÄLTIG KASUISTIK Wiederkehrende Lungenentzündung bei einem 74-jährigen Mann Was steckt dahinter? Ein Fall von Dr. med. Gabriele Röhrig, Oberärztin Lehrstuhl für Geriatrie an
Dysphagie Prävalenz-Bedeutung-Diagnose-Therapie
 GESKES Zertifikationskurs 2014 Dysphagie Prävalenz-Bedeutung-Diagnose-Therapie Esther Thür Physiotherapie Nord 1+2 Inhalt Dysphagieformen Bedeutung Dysphagie Erkennen Behandlungsmöglichkeiten Dysphagie
GESKES Zertifikationskurs 2014 Dysphagie Prävalenz-Bedeutung-Diagnose-Therapie Esther Thür Physiotherapie Nord 1+2 Inhalt Dysphagieformen Bedeutung Dysphagie Erkennen Behandlungsmöglichkeiten Dysphagie
Die vielen Gesichter des Parkinson
 Die vielen Gesichter des Parkinson Prof. Rudolf Töpper Asklepios Klinik Harburg Sylt Harburg (Hamburg) Falkenstein Ini Hannover Bad Griesbach Sichtweisen der Erkrankung Klinik Hamburg-Harburg typischer
Die vielen Gesichter des Parkinson Prof. Rudolf Töpper Asklepios Klinik Harburg Sylt Harburg (Hamburg) Falkenstein Ini Hannover Bad Griesbach Sichtweisen der Erkrankung Klinik Hamburg-Harburg typischer
M. Parkinson Ursache und Diagnose
 M. Parkinson Ursache und Diagnose Historisches Häufigkeit Diagnose Manifestationstypen Ähnliche Krankheiten Ursache(n) Zusatzuntersuchungen Prof. Dr. med. Helmut Buchner und klinische Neurophysiologie
M. Parkinson Ursache und Diagnose Historisches Häufigkeit Diagnose Manifestationstypen Ähnliche Krankheiten Ursache(n) Zusatzuntersuchungen Prof. Dr. med. Helmut Buchner und klinische Neurophysiologie
Die Multimodale Parkinsonkomplexbehandlung
 Die Multimodale Parkinsonkomplexbehandlung Carolin Stöber Parkinson Nurse Dr. Michael Ohms - Oberarzt Stadthalle Hiltrup 20.05.2015 Ziel der Komplexbehandlung für Parkinsonpatienten ist es, die Patienten
Die Multimodale Parkinsonkomplexbehandlung Carolin Stöber Parkinson Nurse Dr. Michael Ohms - Oberarzt Stadthalle Hiltrup 20.05.2015 Ziel der Komplexbehandlung für Parkinsonpatienten ist es, die Patienten
Methoden der Dysphagiediagnostik
 Methoden der Dysphagiemanagement in einer Akutgeriatrie Petra Pluschinski 1 & Christiane 2 1 Otto-Fricke-Krankenhaus, Fachklinik für Geriatrie 2 Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft Universität
Methoden der Dysphagiemanagement in einer Akutgeriatrie Petra Pluschinski 1 & Christiane 2 1 Otto-Fricke-Krankenhaus, Fachklinik für Geriatrie 2 Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft Universität
SOPs Dysphagiemanagement an der Stroke Unit
 Österreichische Schlaganfall-Gesellschaft www.oegsf.at SOPs Dysphagiemanagement an der Stroke Unit Zusammenfassung Definiert Standards des Dysphagiescreenings und Dysphagiemanagements bei PatientInnen
Österreichische Schlaganfall-Gesellschaft www.oegsf.at SOPs Dysphagiemanagement an der Stroke Unit Zusammenfassung Definiert Standards des Dysphagiescreenings und Dysphagiemanagements bei PatientInnen
Bewegungsstörungen. Demenzen. und. am Anfang war das Zittern. (movement disorders) und. Neuro-Geriatrie Fachtage in Haiger,,
 am Anfang war das Zittern Bewegungsstörungen (movement disorders) und Demenzen und Psycho-Neuro Neuro-Geriatrie Fachtage in Haiger,, 9.06.2009 Referent Alexander Simonow Neurologische Praxis, Herborn Bewegungsstörungen
am Anfang war das Zittern Bewegungsstörungen (movement disorders) und Demenzen und Psycho-Neuro Neuro-Geriatrie Fachtage in Haiger,, 9.06.2009 Referent Alexander Simonow Neurologische Praxis, Herborn Bewegungsstörungen
PATIENTENINFORMATION. Caregiver Burden bei betreuenden Angehörigen schwer betroffener Parkinsonpatienten
 Version 1.2 Neurologische Klinik mit Klinischer Neurophysiologie Kommissarischer Direktor: Prof. Dr. med. M. Stangel PD Dr. med. F. Wegner Telefon: (0511) 532-3110 Fax: (0511) 532-3115 Carl-Neuberg-Straße
Version 1.2 Neurologische Klinik mit Klinischer Neurophysiologie Kommissarischer Direktor: Prof. Dr. med. M. Stangel PD Dr. med. F. Wegner Telefon: (0511) 532-3110 Fax: (0511) 532-3115 Carl-Neuberg-Straße
Leitfaden zur Beurteilung einer sicheren Nahrungsaufnahme bei PatientInnen mit erworbenen Hirnschädigungen inkl. physiotherapeutischen Massnahmen
 Leitfaden zur Beurteilung einer sicheren Nahrungsaufnahme bei PatientInnen mit erworbenen Hirnschädigungen inkl. physiotherapeutischen Massnahmen Bettina von Bidder, Kaspar Herren, Marianne Schärer, Heike
Leitfaden zur Beurteilung einer sicheren Nahrungsaufnahme bei PatientInnen mit erworbenen Hirnschädigungen inkl. physiotherapeutischen Massnahmen Bettina von Bidder, Kaspar Herren, Marianne Schärer, Heike
Klinische Schluckuntersuchung und Aspirationsschnelltest
 Klinische Schluckuntersuchung und Aspirationsschnelltest Natascha Leisi, Logopädin MSc Neurorehabilitation Kantonsspital St. Gallen, Hals-Nasen-Ohrenklinik Definition Klinisch = stützt sich auf die von
Klinische Schluckuntersuchung und Aspirationsschnelltest Natascha Leisi, Logopädin MSc Neurorehabilitation Kantonsspital St. Gallen, Hals-Nasen-Ohrenklinik Definition Klinisch = stützt sich auf die von
Informations- und Wissensstand der Mütter von Kindern mit angeborenem Herzfehler
 Informations- und Wissensstand der Mütter von Kindern mit angeborenem Herzfehler A Löbel 1, U Grosser 2, A Wessel 2, S Geyer 1 1 Medizinische Soziologie, Medizinische Hochschule Hannover 2 Pädiatrische
Informations- und Wissensstand der Mütter von Kindern mit angeborenem Herzfehler A Löbel 1, U Grosser 2, A Wessel 2, S Geyer 1 1 Medizinische Soziologie, Medizinische Hochschule Hannover 2 Pädiatrische
Dysphagie in der Geriatrie
 Kreiskrankenhaus Mosbach Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg Geriatrischer Schwerpunkt des Neckar-Odenwald-Kreises Ltd. Arzt Dr. med. M. Jäger Dysphagie in der Geriatrie Jahrestagung
Kreiskrankenhaus Mosbach Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg Geriatrischer Schwerpunkt des Neckar-Odenwald-Kreises Ltd. Arzt Dr. med. M. Jäger Dysphagie in der Geriatrie Jahrestagung
Logopädie bei PSP. München am 27. Oktober 2012 Grit Mallien. Grit Mallien - Neurolinguistin
 Logopädie bei PSP München am 27. Oktober 2012 Grit Mallien Sprechen mit PSP Dysarthrie bei PSP? JA! Dysarthrien sind erworbene neurogene Sprechstörungen mit unterschiedlichen Symptomen (Ziegler et al.
Logopädie bei PSP München am 27. Oktober 2012 Grit Mallien Sprechen mit PSP Dysarthrie bei PSP? JA! Dysarthrien sind erworbene neurogene Sprechstörungen mit unterschiedlichen Symptomen (Ziegler et al.
NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen. Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten
 NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten Die Krankheit Parkinson ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die progredient verläuft
NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten Die Krankheit Parkinson ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die progredient verläuft
Malnutrition und Indikation von enteraler Ernährung über PEG-Sonden aus Sicht der Altersmedizin (Geriatrie)
 Malnutrition und Indikation von enteraler Ernährung über PEG-Sonden aus Sicht der Altersmedizin (Geriatrie) Fachtagung Ernährung in der stationären Altenpflege - zwischen Wunschkost und Sondennahrung -
Malnutrition und Indikation von enteraler Ernährung über PEG-Sonden aus Sicht der Altersmedizin (Geriatrie) Fachtagung Ernährung in der stationären Altenpflege - zwischen Wunschkost und Sondennahrung -
G U S S. 1. Voruntersuchung / Indirekter Schluckversuch. Datum: Zeit: Untersucher:
 Datum: Patientenetikett Zeit: Untersucher: 1. Voruntersuchung / Indirekter Schluckversuch VIGILANZ (Der Patient muss mindestens 15 Minuten wach sein können) 1 0 HUSTEN und/oder RÄUSPERN (Willkürlicher
Datum: Patientenetikett Zeit: Untersucher: 1. Voruntersuchung / Indirekter Schluckversuch VIGILANZ (Der Patient muss mindestens 15 Minuten wach sein können) 1 0 HUSTEN und/oder RÄUSPERN (Willkürlicher
Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters
 Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters J. Bufler Neurologische Klinik des ISK Wasserburg Präsentation, Stand November 2008, Martin Spuckti Seite 1 Vier Giganten der Geriatrie
Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters J. Bufler Neurologische Klinik des ISK Wasserburg Präsentation, Stand November 2008, Martin Spuckti Seite 1 Vier Giganten der Geriatrie
St. Vinzenz-Hospital Dinslaken
 St. Vinzenz-Hospital Dinslaken Klinik für Geriatrie - Altersmedizin Chefarzt Dr. Martin Jäger Neue DGEM-Leitlinie Neurologie Ernährungstherapie bei M. Parkinson edi 2011 Berlin, am 25.02.2011 Idiopathisches
St. Vinzenz-Hospital Dinslaken Klinik für Geriatrie - Altersmedizin Chefarzt Dr. Martin Jäger Neue DGEM-Leitlinie Neurologie Ernährungstherapie bei M. Parkinson edi 2011 Berlin, am 25.02.2011 Idiopathisches
Rolle von PET und SPECT in der Differentialdiagnose von Parkinson- Syndromen
 Rolle von PET und SPECT in der Differentialdiagnose von Parkinson- Syndromen Rüdiger Hilker Neurowoche und DGN 2006 20.09.2006 1. Methodik nuklearmedizinischer Bildgebung 2. Biomarker-Konzept bei Parkinson-
Rolle von PET und SPECT in der Differentialdiagnose von Parkinson- Syndromen Rüdiger Hilker Neurowoche und DGN 2006 20.09.2006 1. Methodik nuklearmedizinischer Bildgebung 2. Biomarker-Konzept bei Parkinson-
Schlucken, Dysphagie: Diagnostik und Therapie. A. Keilmann
 Schlucken, Dysphagie: Diagnostik und Therapie A. Keilmann Präorale Phase Auswahl der Nahrung Zubereitung (Kochen, Zerkleinern, Würzen) Löffeln, Zerschneiden, Abbeißen, Schlürfen, Blasen, Trinken Temperatur,
Schlucken, Dysphagie: Diagnostik und Therapie A. Keilmann Präorale Phase Auswahl der Nahrung Zubereitung (Kochen, Zerkleinern, Würzen) Löffeln, Zerschneiden, Abbeißen, Schlürfen, Blasen, Trinken Temperatur,
Einfache Bewegungsstörung im komplexen Alltag. wie können wir ihr begegnen. Ida Dommen Nyffeler, Ltg. Therapien Rehabilitation
 Einfache Bewegungsstörung im komplexen Alltag wie können wir ihr begegnen Ida Dommen Nyffeler, Ltg. Therapien Rehabilitation einfache Bewegungsstörung komplexer Alltag Akinese (Verlangsamung der Bewegungsabläufe)
Einfache Bewegungsstörung im komplexen Alltag wie können wir ihr begegnen Ida Dommen Nyffeler, Ltg. Therapien Rehabilitation einfache Bewegungsstörung komplexer Alltag Akinese (Verlangsamung der Bewegungsabläufe)
Der Schluckakt aus Sicht der Logopädin oder Schlucken ist ein komplizierter Ablauf
 05.09.2015: Ostschweizer MTRA Symposium Der Schluckakt aus Sicht der Logopädin oder Schlucken ist ein komplizierter Ablauf Marlise Müller-Baumberger Leitung Logopädie Was ist Logopädie? Logopädie = Lehre
05.09.2015: Ostschweizer MTRA Symposium Der Schluckakt aus Sicht der Logopädin oder Schlucken ist ein komplizierter Ablauf Marlise Müller-Baumberger Leitung Logopädie Was ist Logopädie? Logopädie = Lehre
Patient mit Husten: Klinische Unterscheidung von akuter Bronchitis und Pneumonie
 Alkoholmissbrauch Patient mit Husten: Klinische Unterscheidung von akuter Bronchitis und Pneumonie TGAM-Weiterbildung Bronchitis, 19. 11. 2014 Vortrag Herbert Bachler 1 Akute Bronchitis In den ersten Tagen
Alkoholmissbrauch Patient mit Husten: Klinische Unterscheidung von akuter Bronchitis und Pneumonie TGAM-Weiterbildung Bronchitis, 19. 11. 2014 Vortrag Herbert Bachler 1 Akute Bronchitis In den ersten Tagen
Früh- und Vorbotensymptome der Parkinsonerkrankung
 Früh- und Vorbotensymptome der Parkinsonerkrankung 5. Hiltruper Parkinson-Tag 20. Mai 2015 Referent: Dr. Christoph Aufenberg, Oberarzt der Klinik für Neurologie Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup Westfalenstraße
Früh- und Vorbotensymptome der Parkinsonerkrankung 5. Hiltruper Parkinson-Tag 20. Mai 2015 Referent: Dr. Christoph Aufenberg, Oberarzt der Klinik für Neurologie Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup Westfalenstraße
Ländlepflegetag, 15.November 2013 Panoramasaal im LKHF. Johannes Gächter, HNO-FA/Phoniater in Bregenz Karin Arzbacher, Logopädin im LKHR
 Ländlepflegetag, 15.November 2013 Panoramasaal im LKHF Johannes Gächter, HNO-FA/Phoniater in Bregenz Karin Arzbacher, Logopädin im LKHR Wir schlucken... hunderte Male pro Tag; >50 Muskelpaare, 4 Sinne!
Ländlepflegetag, 15.November 2013 Panoramasaal im LKHF Johannes Gächter, HNO-FA/Phoniater in Bregenz Karin Arzbacher, Logopädin im LKHR Wir schlucken... hunderte Male pro Tag; >50 Muskelpaare, 4 Sinne!
Schlucken und Sprechen Logopädische Therapie bei Menschen mit Amyotropher Lateralsklerose
 Schlucken und Sprechen Logopädische Therapie bei Menschen mit Amyotropher Lateralsklerose Marlise Müller - Baumberger Leiterin Logopädie Zusammenarbeit HNO Klinik / Logopädie mit Muskelzentrum / ALS clinic
Schlucken und Sprechen Logopädische Therapie bei Menschen mit Amyotropher Lateralsklerose Marlise Müller - Baumberger Leiterin Logopädie Zusammenarbeit HNO Klinik / Logopädie mit Muskelzentrum / ALS clinic
Dysphagie als Ursache für Aspirationspneumonien. Dipl. Heilpäd Ulrich Birkmann Fachlicher Leiter der Schluckambulanz im MVZ-Troisdorf-Sieglar
 Dysphagie als Ursache für Aspirationspneumonien Dipl. Heilpäd Ulrich Birkmann Fachlicher Leiter der Schluckambulanz im MVZ-Troisdorf-Sieglar Schluckambulanz im MVZ-Neurologie Fachbereiche: Trachealkanülen-Weaning
Dysphagie als Ursache für Aspirationspneumonien Dipl. Heilpäd Ulrich Birkmann Fachlicher Leiter der Schluckambulanz im MVZ-Troisdorf-Sieglar Schluckambulanz im MVZ-Neurologie Fachbereiche: Trachealkanülen-Weaning
Tiefe Hirnstimulation bei Bewegungsstörungen. Klinik für Neurologie Klinik für Neurochirurgie
 Tiefe Hirnstimulation bei Bewegungsstörungen Klinik für Neurologie Klinik für Neurochirurgie Bewegungsstörung Die Parkinson Krankheit (Morbus Parkinson) zählt zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen
Tiefe Hirnstimulation bei Bewegungsstörungen Klinik für Neurologie Klinik für Neurochirurgie Bewegungsstörung Die Parkinson Krankheit (Morbus Parkinson) zählt zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen
FIBEROPTISCHE UNTERSUCHUNG DES SCHLUCKENS Berliner Dysphagie Index. Name: geb.: Diagnosen:
 Name: geb.: Diagnosen: Datum: Etikett Fragestellung: Stat.: Amb.: Erstuntersuchung Verlaufskontrolle Videodokumentation Ernährung Oral Enteral PEG Enteral MS Parenteral Trachealkanüle Keine Sprechkanüle
Name: geb.: Diagnosen: Datum: Etikett Fragestellung: Stat.: Amb.: Erstuntersuchung Verlaufskontrolle Videodokumentation Ernährung Oral Enteral PEG Enteral MS Parenteral Trachealkanüle Keine Sprechkanüle
Zum Für F r und Wider einer künstlichen Ernährung
 Zum Für F r und Wider einer künstlichen Ernährung PEG-Sonde ja oder nein? Christian Kolb Krankenpfleger www.nahrungsverweigerung.de Milieugestaltung DAS ESSEN SOLL ZUERST DAS AUGE ERFREUEN UND DANN DEN
Zum Für F r und Wider einer künstlichen Ernährung PEG-Sonde ja oder nein? Christian Kolb Krankenpfleger www.nahrungsverweigerung.de Milieugestaltung DAS ESSEN SOLL ZUERST DAS AUGE ERFREUEN UND DANN DEN
Symptome und Diagnosestellung des Morbus Parkinson
 meine Hand zittert habe ich etwa Parkinson? Symptome und Diagnosestellung des Morbus Parkinson Dr. med. Sabine Skodda Oberärztin Neurologische Klinik Morbus Parkinson chronisch fortschreitende neurodegenerative
meine Hand zittert habe ich etwa Parkinson? Symptome und Diagnosestellung des Morbus Parkinson Dr. med. Sabine Skodda Oberärztin Neurologische Klinik Morbus Parkinson chronisch fortschreitende neurodegenerative
Patientinnen und Patienten mit Demenz im Allgemeinkrankenhaus
 Patientinnen und Patienten mit Demenz im Allgemeinkrankenhaus Workshop 1 Es schmeckt nicht Ernährung Demenzerkrankter im Krankenhaus Verena Frick Diätassistentin, Ernährungswissenschaftlerin Diagnostik:
Patientinnen und Patienten mit Demenz im Allgemeinkrankenhaus Workshop 1 Es schmeckt nicht Ernährung Demenzerkrankter im Krankenhaus Verena Frick Diätassistentin, Ernährungswissenschaftlerin Diagnostik:
Vernetzung der ambulanten und stationären Behandlung neurogener Schluckstörungen im Evangelischen Krankenhaus Oldenburg
 Vernetzung der ambulanten und stationären Behandlung neurogener Schluckstörungen im Evangelischen Krankenhaus Oldenburg Friedrich Bergen Logopäde im Evangelischen Krankenhaus und eigener Praxis Andreas
Vernetzung der ambulanten und stationären Behandlung neurogener Schluckstörungen im Evangelischen Krankenhaus Oldenburg Friedrich Bergen Logopäde im Evangelischen Krankenhaus und eigener Praxis Andreas
15. Informationstagung der Reha Rheinfelden. Pharmakotherapie des idiopathischen Parkinsonsyndroms
 15. Informationstagung der Reha Rheinfelden Pharmakotherapie des idiopathischen Parkinsonsyndroms Dr. med. Florian von Raison, assoziierter Arzt, Neurologische Klinik, Universitätsspital (USB) Donnerstag,
15. Informationstagung der Reha Rheinfelden Pharmakotherapie des idiopathischen Parkinsonsyndroms Dr. med. Florian von Raison, assoziierter Arzt, Neurologische Klinik, Universitätsspital (USB) Donnerstag,
Logopädische Therapie: Essen mit geblockter Kanüle?
 Logopädische Therapie: Essen mit geblockter Kanüle? Natascha Leisi, Logopädin MSc Neurorehabilitation Kantonsspital St. Gallen, Hals-Nasen-Ohrenklinik Indikationen für Tracheotomie Sicherung der Atmung
Logopädische Therapie: Essen mit geblockter Kanüle? Natascha Leisi, Logopädin MSc Neurorehabilitation Kantonsspital St. Gallen, Hals-Nasen-Ohrenklinik Indikationen für Tracheotomie Sicherung der Atmung
Erkennen der Mangelernährung bei alten Menschen
 AUGSBURGER ERNÄHRUNGSGESPRÄCH 11.02.2015 Erkennen der Mangelernährung bei alten Menschen Susanne Nau Ernährungswissenschaftlerin Ernährungsteam Prävalenz der Mangelernährung Augsburger Ernährungsgespräch
AUGSBURGER ERNÄHRUNGSGESPRÄCH 11.02.2015 Erkennen der Mangelernährung bei alten Menschen Susanne Nau Ernährungswissenschaftlerin Ernährungsteam Prävalenz der Mangelernährung Augsburger Ernährungsgespräch
Aktuelle Behandlung bei M. Parkinson: Update Früh - bis Spätphase. Prof. Dr. J. Kassubek Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum Ulm
 Aktuelle Behandlung bei M. Parkinson: Update Früh - bis Spätphase Prof. Dr. J. Kassubek Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum Ulm Hawkes et al., Parkinsonism Rel Dis 2010 Morbus Parkinson: Therapie-Prinzipien
Aktuelle Behandlung bei M. Parkinson: Update Früh - bis Spätphase Prof. Dr. J. Kassubek Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum Ulm Hawkes et al., Parkinsonism Rel Dis 2010 Morbus Parkinson: Therapie-Prinzipien
Physiologie und Pathophysiologie des Schluckens edi 2011 Workshop 3: Diagnostik und Therapie der Dysphagie
 Physiologie und Pathophysiologie des Schluckens edi 2011 Workshop 3: Diagnostik und Therapie der Dysphagie Guntram W. Ickenstein 25 Muskelpaare werden beim Schluckakt in zeitlichräumlicher Hinsicht koordiniert
Physiologie und Pathophysiologie des Schluckens edi 2011 Workshop 3: Diagnostik und Therapie der Dysphagie Guntram W. Ickenstein 25 Muskelpaare werden beim Schluckakt in zeitlichräumlicher Hinsicht koordiniert
Delir akuter Verwirrtheitszustand acute mental confusion
 akuter Verwirrtheitszustand acute mental confusion Störung von Bewusstsein und Wachheit Orientierung, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung Denken, Gedächtnis Wach-Schlaf-Rhythmus Psychomotorik Emotionalität Epidemiologie,
akuter Verwirrtheitszustand acute mental confusion Störung von Bewusstsein und Wachheit Orientierung, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung Denken, Gedächtnis Wach-Schlaf-Rhythmus Psychomotorik Emotionalität Epidemiologie,
Nutzen einer diagnostischen Tests in der Praxis: prädiktive Werte
 EbM-Splitter 11 Nutzen einer diagnostischen Tests in der Praxis: prädiktive Werte In den beiden letzten EbM-Splittern [6, 7] wurden die Maßzahlen Sensitivität (Wahrscheinlichkeit, eine kranke Person als
EbM-Splitter 11 Nutzen einer diagnostischen Tests in der Praxis: prädiktive Werte In den beiden letzten EbM-Splittern [6, 7] wurden die Maßzahlen Sensitivität (Wahrscheinlichkeit, eine kranke Person als
Rückbildung von Aphasien und Wirkung von Sprachtherapie
 Rückbildung von Aphasien und Wirkung von Sprachtherapie Medizinische Fakultät Basel 2. Jahreskurs, Major Clinical Medicine Wahlmodul 3 Gehirn und Sprache Dezember 2008 Seraina Locher Medical eduction,
Rückbildung von Aphasien und Wirkung von Sprachtherapie Medizinische Fakultät Basel 2. Jahreskurs, Major Clinical Medicine Wahlmodul 3 Gehirn und Sprache Dezember 2008 Seraina Locher Medical eduction,
Patientinformation Gastroösphageale Refluxkrankheit
 Patientinformation Gastroösphageale Refluxkrankheit KH Barmherzige Schwestern Linz Abteilung für Allgemein und Viszeralchirurgie Vorstand: Prof. Dr. Klaus Emmanuel Dr. Oliver Owen Koch Dr. Klemens Rohregger
Patientinformation Gastroösphageale Refluxkrankheit KH Barmherzige Schwestern Linz Abteilung für Allgemein und Viszeralchirurgie Vorstand: Prof. Dr. Klaus Emmanuel Dr. Oliver Owen Koch Dr. Klemens Rohregger
Daten bestätigen Bedeutung einer frühen Behandlung von Patienten mit Multipler Sklerose (MS)
 Europäischer Multiple-Sklerose-Kongress ECTRIMS: Daten bestätigen Bedeutung einer frühen Behandlung von Patienten mit Multipler Sklerose (MS) - Studienergebnisse belegen kognitive Funktionseinschränkungen
Europäischer Multiple-Sklerose-Kongress ECTRIMS: Daten bestätigen Bedeutung einer frühen Behandlung von Patienten mit Multipler Sklerose (MS) - Studienergebnisse belegen kognitive Funktionseinschränkungen
Dysphagie-Diagnostik in der Praxis
 Dysphagie-Diagnostik in der Praxis Die Ursachen einer Dysphagie können vielfältig sein. Sie sind häufig neurologischen Ursprungs und reichen hier von Schlaganfällen, Störungen der neuromuskulären Übertragung,
Dysphagie-Diagnostik in der Praxis Die Ursachen einer Dysphagie können vielfältig sein. Sie sind häufig neurologischen Ursprungs und reichen hier von Schlaganfällen, Störungen der neuromuskulären Übertragung,
Dysphagie: Diagnostik und Therapie
 Dysphagie: Diagnostik und Therapie Fokus Geriatrie Hans Schwegler Leiter Logopädie Schweizer Paraplegiker-Zentrum 6207 Nottwil Schlucken 600 2000 x pro Tag 1,5 Liter Speichel pro Tag mindestens 40 beteiligte
Dysphagie: Diagnostik und Therapie Fokus Geriatrie Hans Schwegler Leiter Logopädie Schweizer Paraplegiker-Zentrum 6207 Nottwil Schlucken 600 2000 x pro Tag 1,5 Liter Speichel pro Tag mindestens 40 beteiligte
2 Der Einfluss von Sport und Bewegung auf die neuronale Konnektivität 11
 I Grundlagen 1 1 Neurobiologische Effekte körperlicher Aktivität 3 1.1 Einleitung 3 1.2 Direkte Effekte auf Neurone, Synapsenbildung und Plastizität 4 1.3 Indirekte Effekte durch verbesserte Hirndurchblutung,
I Grundlagen 1 1 Neurobiologische Effekte körperlicher Aktivität 3 1.1 Einleitung 3 1.2 Direkte Effekte auf Neurone, Synapsenbildung und Plastizität 4 1.3 Indirekte Effekte durch verbesserte Hirndurchblutung,
Dysphagie-Kost-Formen: Worauf kommt es an?
 Dysphagie-Kost-Formen: Worauf kommt es an? Christina Grimm-Einhoff Akademische Sprachtherapeutin 9. November 2016 Bausteine der funktionellen Dysphagietherapie Kompensatorische Verfahren (z.b. Haltungsänderung)
Dysphagie-Kost-Formen: Worauf kommt es an? Christina Grimm-Einhoff Akademische Sprachtherapeutin 9. November 2016 Bausteine der funktionellen Dysphagietherapie Kompensatorische Verfahren (z.b. Haltungsänderung)
Evaluation eines Bioimpedanz-EMG-Messsystems zur Schluckerkennung während der pharyngealen Schluckphase
 Spektrum Patholinguistik 6 (2013) 225 231 Evaluation eines Bioimpedanz-EMG-Messsystems zur Schluckerkennung während der pharyngealen Schluckphase Corinna Schultheiss 1, Holger Nahrstaedt 2, Thomas Schauer
Spektrum Patholinguistik 6 (2013) 225 231 Evaluation eines Bioimpedanz-EMG-Messsystems zur Schluckerkennung während der pharyngealen Schluckphase Corinna Schultheiss 1, Holger Nahrstaedt 2, Thomas Schauer
Diagnose und Therapie neurologisch bedingter Schluckstörungen. Holger Grötzbach, M. A. Asklepios Klinik Schaufling D 94571 Schaufling
 Diagnose und Therapie neurologisch bedingter Schluckstörungen Holger Grötzbach, M. A. Asklepios Klinik Schaufling D 94571 Schaufling integra Fachmesse Wels 22.09.2006 Agenda Anatomie und Physiologie des
Diagnose und Therapie neurologisch bedingter Schluckstörungen Holger Grötzbach, M. A. Asklepios Klinik Schaufling D 94571 Schaufling integra Fachmesse Wels 22.09.2006 Agenda Anatomie und Physiologie des
Schlucktraining bei Essstörung
 Schlucktraining bei Essstörung Schlucktraining bei Essstörung Herzlich willkommen zur Schulung! Thema: Dauer: Ziel: Schlucktraining bei Essstörung ca. 30 Minuten Fachgerechte Durchführung eines Schlucktrainings
Schlucktraining bei Essstörung Schlucktraining bei Essstörung Herzlich willkommen zur Schulung! Thema: Dauer: Ziel: Schlucktraining bei Essstörung ca. 30 Minuten Fachgerechte Durchführung eines Schlucktrainings
Leichte kognitive Beeinträchtigung (mild cognitive impairment) und Differentialdiagnosen
 Leichte kognitive Beeinträchtigung (mild cognitive impairment) und Differentialdiagnosen Thomas Duning Andreas Johnen Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität
Leichte kognitive Beeinträchtigung (mild cognitive impairment) und Differentialdiagnosen Thomas Duning Andreas Johnen Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität
Herausforderungen für Klinik und Praxis
 Therapie des Morbus Parkinson Herausforderungen für Klinik und Praxis Würzburg (15. März 2013) - Das idiopathische Parkinson Syndrom ist weit mehr als nur eine Bewegungsstörung. Nicht-motorische Symptome
Therapie des Morbus Parkinson Herausforderungen für Klinik und Praxis Würzburg (15. März 2013) - Das idiopathische Parkinson Syndrom ist weit mehr als nur eine Bewegungsstörung. Nicht-motorische Symptome
kontrolliert wurden. Es erfolgte zudem kein Ausschluss einer sekundären Genese der Eisenüberladung. Erhöhte Ferritinkonzentrationen wurden in dieser S
 5.8 Zusammenfassung Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse dieser Studie erscheint die laborchemische Bestimmung der Transferrinsättigung zur Abklärung einer unklaren Lebererkrankung und Verdacht
5.8 Zusammenfassung Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse dieser Studie erscheint die laborchemische Bestimmung der Transferrinsättigung zur Abklärung einer unklaren Lebererkrankung und Verdacht
Evidenzbasiertes Vorgehen bei Schluckstörungen
 Evidenzbasiertes Vorgehen bei Schluckstörungen Unser Ziel im Dysphagienetzwerk Südsachsen Vorstellung Roy Eike Logopäde, Geschäftsführer der Logopädischen Praxis R. Eike GmbH mit Praxen in - Marienberg
Evidenzbasiertes Vorgehen bei Schluckstörungen Unser Ziel im Dysphagienetzwerk Südsachsen Vorstellung Roy Eike Logopäde, Geschäftsführer der Logopädischen Praxis R. Eike GmbH mit Praxen in - Marienberg
INHALT TEIL 1 ALLGEMEINER TEIL... 17
 TEIL 1 ALLGEMEINER TEIL... 17 DEFINITION... 18 Was ist die Parkinson-Krankheit?... 18 Was sind die ersten Anzeichen?... 19 Wer diagnostiziert Parkinson?... 19 Seit wann kennt man Parkinson?... 20 SYMPTOME...22
TEIL 1 ALLGEMEINER TEIL... 17 DEFINITION... 18 Was ist die Parkinson-Krankheit?... 18 Was sind die ersten Anzeichen?... 19 Wer diagnostiziert Parkinson?... 19 Seit wann kennt man Parkinson?... 20 SYMPTOME...22
Andrea Hofmayer Sönke Stanschus (Hrsg.) Evidenzentwicklung in der Dysphagiologie: Von der Untersuchung in die klinische Praxis
 Andrea Hofmayer Sönke Stanschus (Hrsg.) Evidenzentwicklung in der Dysphagiologie: Von der Untersuchung in die klinische Praxis Reihe DYSPHAGIEFORUM herausgegeben von Sönke Stanschus Band 5 Andrea Hofmayer
Andrea Hofmayer Sönke Stanschus (Hrsg.) Evidenzentwicklung in der Dysphagiologie: Von der Untersuchung in die klinische Praxis Reihe DYSPHAGIEFORUM herausgegeben von Sönke Stanschus Band 5 Andrea Hofmayer
Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen Diagnose
 Morbus Fabry - Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen - Vom unklaren Sympto Morbus Fabry Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen
Morbus Fabry - Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen - Vom unklaren Sympto Morbus Fabry Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen
Psychische Komorbidität und Syndrome bei radioonkologischen Patienten - gibt es Unterschiede bei den einzelnen Tumorentitäten?
 16. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie Magdeburg 3.-6. Juni 2010 Psychische Komorbidität und Syndrome bei radioonkologischen Patienten - gibt es Unterschiede bei den einzelnen
16. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie Magdeburg 3.-6. Juni 2010 Psychische Komorbidität und Syndrome bei radioonkologischen Patienten - gibt es Unterschiede bei den einzelnen
Dysphagiemanagement in der außerklinischen Intensivpflege aus therapeutischer Sicht.
 Dysphagiemanagement in der außerklinischen Intensivpflege aus therapeutischer Sicht Schlucktherapeutischer Rehabilitationsverlauf Klinik Ambulante Therapie Klinik Klinische Diagnostik Apparative Diagnostik
Dysphagiemanagement in der außerklinischen Intensivpflege aus therapeutischer Sicht Schlucktherapeutischer Rehabilitationsverlauf Klinik Ambulante Therapie Klinik Klinische Diagnostik Apparative Diagnostik
Vaskuläre Demenz G. Lueg Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster
 Vaskuläre Demenz G. Lueg Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Verteilung der Demenz 3-10% LewyKörperchenDemenz 3-18% Frontotemporale Demenz
Vaskuläre Demenz G. Lueg Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Verteilung der Demenz 3-10% LewyKörperchenDemenz 3-18% Frontotemporale Demenz
Angina pectoris: I. Angina pectoris bei koronarer Herzerkrankung
 Angina pectoris: Zur Diagnose der Angina pectoris werden technische Geräte nicht benötigt, allein ausschlaggebend ist die Anamnese. Der Begriff Angina pectoris beinhaltet nicht jedes "Engegefühl in der
Angina pectoris: Zur Diagnose der Angina pectoris werden technische Geräte nicht benötigt, allein ausschlaggebend ist die Anamnese. Der Begriff Angina pectoris beinhaltet nicht jedes "Engegefühl in der
Multiple Sklerose (MS)
 Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Multiple Sklerose 2 Multiple Sklerose (MS) Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Multiple Sklerose 4 Multiple Sklerose 3 Klinischer Fall..\3) Sammlung\Klinischer
Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Multiple Sklerose 2 Multiple Sklerose (MS) Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Multiple Sklerose 4 Multiple Sklerose 3 Klinischer Fall..\3) Sammlung\Klinischer
Akademie für medizinische Fortbildung ANR Bonn
 Ambulantes Zentrum für neurologische Komplexbehandlung und Rehabilitation Leitende Ärztin: Priv. Doz. Dr. med. M. Lippert-Grüner PhD Praxen für Physiotherapie, Ergotherapie & Logopädie Graurheindorfer
Ambulantes Zentrum für neurologische Komplexbehandlung und Rehabilitation Leitende Ärztin: Priv. Doz. Dr. med. M. Lippert-Grüner PhD Praxen für Physiotherapie, Ergotherapie & Logopädie Graurheindorfer
Neurologische Krankheitsbilder in der Palliative Care Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. habil. Stefan Lorenzl, Dipl. Pall. Med. (Univ.
 Neurologische Krankheitsbilder in der Palliative Care Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. habil. Stefan Lorenzl, Dipl. Pall. Med. (Univ. Cardiff) Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Salzburg und Krankenhaus
Neurologische Krankheitsbilder in der Palliative Care Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. habil. Stefan Lorenzl, Dipl. Pall. Med. (Univ. Cardiff) Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Salzburg und Krankenhaus
Leben nach erworbener Hirnschädigung
 Leben nach erworbener Hirnschädigung Akutbehandlung und Rehabilitation Prim. Univ. Prof. Dr. Andreas Kampfl Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried Abteilung für f Neurologie mit Stroke Unit Schlaganfall
Leben nach erworbener Hirnschädigung Akutbehandlung und Rehabilitation Prim. Univ. Prof. Dr. Andreas Kampfl Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried Abteilung für f Neurologie mit Stroke Unit Schlaganfall
langjährige TätigkeitT als Logopäde im Klinikum MünchenM GmbH-Klinikum München Bogenhausen in der Abteilung fürf r Neuropsychologie (Prof. Dr. G. Gold
 Neue Aspekte zur Diagnostik und Therapie von Dysphagiepatienten Aktuelle Versorgungssituation in Deutschland und SÜDSACHSEN Mirko Hiller, MSc Logopäde / Dysphagietherapeut kontakt@das-dysphagiezentrum.de
Neue Aspekte zur Diagnostik und Therapie von Dysphagiepatienten Aktuelle Versorgungssituation in Deutschland und SÜDSACHSEN Mirko Hiller, MSc Logopäde / Dysphagietherapeut kontakt@das-dysphagiezentrum.de
Das Alter hat nichts Schönes oder doch. Depressionen im Alter Ende oder Anfang?
 Das Alter hat nichts Schönes oder doch Depressionen im Alter Ende oder Anfang? Depressionen im Alter Gedanken zum Alter was bedeutet höheres Alter Depressionen im Alter Häufigkeit Was ist eigentlich eine
Das Alter hat nichts Schönes oder doch Depressionen im Alter Ende oder Anfang? Depressionen im Alter Gedanken zum Alter was bedeutet höheres Alter Depressionen im Alter Häufigkeit Was ist eigentlich eine
Hirnparenchymsonographie bei Parkinson-Syndromen. Hirnsonographie (B-Bild) Hirnblutungen Seidel et al. Stroke 1993
 Hirnparenchymsonographie bei Parkinson-Syndromen Uwe Walter Halbtageskurs Klinisch relevante Neurosonologie Neurowoche, Mannheim, 23. September 2010 Klinik für Neurologie Universität Rostock Hirnsonographie
Hirnparenchymsonographie bei Parkinson-Syndromen Uwe Walter Halbtageskurs Klinisch relevante Neurosonologie Neurowoche, Mannheim, 23. September 2010 Klinik für Neurologie Universität Rostock Hirnsonographie
Phonetische Auswirkungen elektro-neurologischer Therapie-Ansätze bei MS- und Parkinson-Patienten
 Phonetische Auswirkungen elektro-neurologischer Therapie-Ansätze bei MS- und Parkinson-Patienten William J. Barry Institut für Phonetik, Universität des Saarlandes IPUS Zusammenarbeit mit der neurologischen
Phonetische Auswirkungen elektro-neurologischer Therapie-Ansätze bei MS- und Parkinson-Patienten William J. Barry Institut für Phonetik, Universität des Saarlandes IPUS Zusammenarbeit mit der neurologischen
Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme
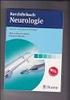 Morbus Parkinson 2 Morbus Parkinson Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Eigene Bilder Morbus Parkinson 4 Morbus Parkinson 3 Was ist Parkinson?» Die
Morbus Parkinson 2 Morbus Parkinson Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Eigene Bilder Morbus Parkinson 4 Morbus Parkinson 3 Was ist Parkinson?» Die
Der chronische Schlaganfall: eine Herausforderung für die ambulante sozialmedizinische Versorgung
 Symposium & Workshop Kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze in der Pflegeberatung Der chronische Schlaganfall: eine Herausforderung für die ambulante sozialmedizinische Versorgung R.H. van Schayck Neurologisches
Symposium & Workshop Kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze in der Pflegeberatung Der chronische Schlaganfall: eine Herausforderung für die ambulante sozialmedizinische Versorgung R.H. van Schayck Neurologisches
Patienten können von früherem Behandlungsbeginn profitieren
 Morbus Parkinson Patienten können von früherem Behandlungsbeginn profitieren Düsseldorf (24. September 2015) - Erhaltung der Selbstständigkeit in den Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) und der gesundheitsbezogenen
Morbus Parkinson Patienten können von früherem Behandlungsbeginn profitieren Düsseldorf (24. September 2015) - Erhaltung der Selbstständigkeit in den Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) und der gesundheitsbezogenen
K. Müller 1, P. Wagner 1 & N. Kotschy-Lang 2. Universität Leipzig, 2 BG-Klinik Falkenstein
 Erfassung von Selbstwirksamkeitserwartungen bei pneumologischen Berufskrankheiten mit der deutschen Version der COPD Self-Efficacy Scale Zusammenhänge zur körperlichen Aktivität und Depressivität 1, P.
Erfassung von Selbstwirksamkeitserwartungen bei pneumologischen Berufskrankheiten mit der deutschen Version der COPD Self-Efficacy Scale Zusammenhänge zur körperlichen Aktivität und Depressivität 1, P.
Zusammenfassung. Einleitung: Studienkollektiv und Methoden: Ergebnisse:
 Zusammenfassung Einleitung: Bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz werden duplexsonographisch bestimmte intrarenale Widerstandsindices zur Prognoseeinschätzung des Voranschreitens der Niereninsuffizienz
Zusammenfassung Einleitung: Bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz werden duplexsonographisch bestimmte intrarenale Widerstandsindices zur Prognoseeinschätzung des Voranschreitens der Niereninsuffizienz
Bachelorarbeit Sport mit Schlaganfallpatienten: Ein neuer Ansatz - Der Gehweg von SpoMobil
 Universität Paderborn Fakultät der Naturwissenschaften Department Sport und Gesundheit Angewandte Sportwissenschaften Betreuer: Prof. Dr. med. Weiß Zweitprüfer: PD Dr. med. Baum Bachelorarbeit Sport mit
Universität Paderborn Fakultät der Naturwissenschaften Department Sport und Gesundheit Angewandte Sportwissenschaften Betreuer: Prof. Dr. med. Weiß Zweitprüfer: PD Dr. med. Baum Bachelorarbeit Sport mit
"licht.blicke - demenz.hilfe.tirol" Wie weit ist die Medizin? Kann Demenz verhindert werden? Innsbruck,
 "licht.blicke - demenz.hilfe.tirol" Wie weit ist die Medizin? Kann Demenz verhindert werden? Univ.-Prof. Dr. Hartmann Hinterhuber Innsbruck, 21.1.2008 Mein Sohn, nimm dich deines Vaters an in seinem Alter
"licht.blicke - demenz.hilfe.tirol" Wie weit ist die Medizin? Kann Demenz verhindert werden? Univ.-Prof. Dr. Hartmann Hinterhuber Innsbruck, 21.1.2008 Mein Sohn, nimm dich deines Vaters an in seinem Alter
Dysphagie. Neurogene Schluckstörung. Referentin: Anja Sauer-Egner 28. Juni Anja Sauer-Egner, Klinische Linguistin, M.A. 2006
 Dysphagie Neurogene Schluckstörung Referentin: Anja Sauer-Egner 28. Juni 2006 I. Physiologie des Schluckvorganges II. Phasen des Schluckvorganges III.Pathophysiologie IV.Diagnostik V. Therapie Schluckfrequenz
Dysphagie Neurogene Schluckstörung Referentin: Anja Sauer-Egner 28. Juni 2006 I. Physiologie des Schluckvorganges II. Phasen des Schluckvorganges III.Pathophysiologie IV.Diagnostik V. Therapie Schluckfrequenz
Evidenzbasierte Physiotherapie aktueller Stand und Perspektiven
 In Zeiten der evidenzbasierten Medizin muss eine Versorgung, die auf empirischer Grundlage steht, kritisch hinterfragt werden NVL - (A = starke Empfehlung, B = Empfehlung, 0 = Option) Akuter nichtspezifischer
In Zeiten der evidenzbasierten Medizin muss eine Versorgung, die auf empirischer Grundlage steht, kritisch hinterfragt werden NVL - (A = starke Empfehlung, B = Empfehlung, 0 = Option) Akuter nichtspezifischer
Das unterschätzte Problem
 Mangelernährung im Alter Das unterschätzte Problem Bonn (13. September 2012) - Bei der Diskussion um die Ernährung geht es häufig um Übergewicht und seine schädlichen Folgen für Herz, Kreislauf und Gelenke.
Mangelernährung im Alter Das unterschätzte Problem Bonn (13. September 2012) - Bei der Diskussion um die Ernährung geht es häufig um Übergewicht und seine schädlichen Folgen für Herz, Kreislauf und Gelenke.
Das Zusammenspiel von Ess- und Schlucktraining praxisnah veranschaulicht. Nahrungsaufnahme zielgerichtet in der Ergotherapie einsetzen
 Das Zusammenspiel von Ess- und Schlucktraining praxisnah veranschaulicht Nahrungsaufnahme zielgerichtet in der Ergotherapie einsetzen Über den Tellerrand schauen Zusammenspiel Interdisziplinarität Planung
Das Zusammenspiel von Ess- und Schlucktraining praxisnah veranschaulicht Nahrungsaufnahme zielgerichtet in der Ergotherapie einsetzen Über den Tellerrand schauen Zusammenspiel Interdisziplinarität Planung
Logopädie - Dysphagie. Luzia Berger;, Logopädin A.ö. Krankenhaus der Elisabethinen Linz Tel.Nr.: 0732/
 Logopädie - Dysphagie Luzia Berger;, Logopädin A.ö. Krankenhaus der Elisabethinen Linz Tel.Nr.: 0732/7676 63932 Definition - Schlucken Schlucken ist ein/e : geordneter Nahrungstransport von Mundraum in
Logopädie - Dysphagie Luzia Berger;, Logopädin A.ö. Krankenhaus der Elisabethinen Linz Tel.Nr.: 0732/7676 63932 Definition - Schlucken Schlucken ist ein/e : geordneter Nahrungstransport von Mundraum in
Dysphagie Ursachen, Diagnostik und Behandlung
 11. Aachener Diätetik Fortbildung 109 Dysphagie Ursachen, Diagnostik und Behandlung Melanie Weinert, Manuela Motzko Der Schluckvorgang eines jeden Menschen ist ein hoch komplexer physiologischer Prozess,
11. Aachener Diätetik Fortbildung 109 Dysphagie Ursachen, Diagnostik und Behandlung Melanie Weinert, Manuela Motzko Der Schluckvorgang eines jeden Menschen ist ein hoch komplexer physiologischer Prozess,
Der Schlaganfall wenn jede Minute zählt. Andreas Kampfl Abteilung Neurologie und Stroke Unit Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried im Innkreis
 Der Schlaganfall wenn jede Minute zählt Andreas Kampfl Abteilung Neurologie und Stroke Unit Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried im Innkreis Aufgaben des Großhirns Bewegung Sensibilität Sprachproduktion
Der Schlaganfall wenn jede Minute zählt Andreas Kampfl Abteilung Neurologie und Stroke Unit Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried im Innkreis Aufgaben des Großhirns Bewegung Sensibilität Sprachproduktion
Peer Review Aspiration im St. Josef Krankenhaus Moers
 Peer Review Aspiration im St. Josef Krankenhaus Moers von Michaela Weigelt und Oliver Wittig, Pflegedienstleitung Köln, 06. November 2009 Was ist ein Peer Review? Ein Peer Review ist eine kontinuierliche,
Peer Review Aspiration im St. Josef Krankenhaus Moers von Michaela Weigelt und Oliver Wittig, Pflegedienstleitung Köln, 06. November 2009 Was ist ein Peer Review? Ein Peer Review ist eine kontinuierliche,
AVWS Diagnostik aus sprachtherapeutischer Sicht
 AVWS Diagnostik aus sprachtherapeutischer Sicht Birke Peter, Klinische Sprechwissenschaftlerin Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde Universitätsmedizin Leipzig Direktor: Univ.-Prof.
AVWS Diagnostik aus sprachtherapeutischer Sicht Birke Peter, Klinische Sprechwissenschaftlerin Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde Universitätsmedizin Leipzig Direktor: Univ.-Prof.
Kann lebenslanges Lernen das Demenzrisiko verringern?
 Kann lebenslanges Lernen das Demenzrisiko verringern? Prof. Dr. Daniel Zimprich Universität Ulm IN FORM-Symposium Gesunder und aktiver Lebensstil ein Beitrag zur Prävention von Demenz? Bundesministerium
Kann lebenslanges Lernen das Demenzrisiko verringern? Prof. Dr. Daniel Zimprich Universität Ulm IN FORM-Symposium Gesunder und aktiver Lebensstil ein Beitrag zur Prävention von Demenz? Bundesministerium
Anlage zur Vereinbarung gemäß 118 Abs. 28GB V vom
 Anlage zur Vereinbarung gemäß 118 Abs. 28GB V vom 30.04.2010 Spezifizierung der Patientengruppe gemäß 3 der Vereinbarung: 1. Einschlusskriterien für die Behandlung Erwachsener in der Psychiatrischen Institutsambulanz
Anlage zur Vereinbarung gemäß 118 Abs. 28GB V vom 30.04.2010 Spezifizierung der Patientengruppe gemäß 3 der Vereinbarung: 1. Einschlusskriterien für die Behandlung Erwachsener in der Psychiatrischen Institutsambulanz
Die Parkinson Krankheit. Diagnostik und Therapie
 Die Parkinson Krankheit Diagnostik und Therapie Was bedeutet eigentlich Parkinson? James Parkinson stellte bei seinen Patienten ein auffälliges Zittern der Hände fest und bezeichnete die Krankheit als
Die Parkinson Krankheit Diagnostik und Therapie Was bedeutet eigentlich Parkinson? James Parkinson stellte bei seinen Patienten ein auffälliges Zittern der Hände fest und bezeichnete die Krankheit als
Neurologisch bedingte Schluckstörungen. Corinna Rolf & Dr. phil. Uta Lürßen Dipl. Sprachheilpädagoginnen
 Neurologisch bedingte Schluckstörungen Corinna Rolf & Dr. phil. Uta Lürßen Dipl. Sprachheilpädagoginnen Inhalt Begrüßung und Vorstellung Die Bedeutung des Schluckens Häufigkeit von Schluckstörungen Das
Neurologisch bedingte Schluckstörungen Corinna Rolf & Dr. phil. Uta Lürßen Dipl. Sprachheilpädagoginnen Inhalt Begrüßung und Vorstellung Die Bedeutung des Schluckens Häufigkeit von Schluckstörungen Das
Neurologische Rehabilitation II. PD.Dr.H.Gerhard Philippusstift KKENW SS 2011
 Neurologische Rehabilitation II PD.Dr.H.Gerhard Philippusstift KKENW SS 2011 Ohne Neuroplastizität keine Rehabilitation Planung der Rehabilitation Die Planung der Rehabilitation beginnt auf der Stroke
Neurologische Rehabilitation II PD.Dr.H.Gerhard Philippusstift KKENW SS 2011 Ohne Neuroplastizität keine Rehabilitation Planung der Rehabilitation Die Planung der Rehabilitation beginnt auf der Stroke
Leitsymptome von Dysphagien
 3 Leitsymptome von Dysphagien 3.1 Leaking, Pooling 30 3.1.1 Ursachen von Leaking/Pooling 30 3.1.2 Folgen von Leaking/Pooling 30 3.2 Residuen 31 3.2.1 Lokalisation von Residuen und zugehörige Ursachen 31
3 Leitsymptome von Dysphagien 3.1 Leaking, Pooling 30 3.1.1 Ursachen von Leaking/Pooling 30 3.1.2 Folgen von Leaking/Pooling 30 3.2 Residuen 31 3.2.1 Lokalisation von Residuen und zugehörige Ursachen 31
AKTUELLES ZUR DEMENZDIAGNOSTIK
 AKTUELLES ZUR DEMENZDIAGNOSTIK GHF am Medizinische Diagnostik 2 Biomarker Cerebrale Atrophien (MRT) Cerebraler Hypometabolismus (PET) Liquor Erhöhte Konzentration Abeta 42 (Amyloidprotein) Erhöhte Konzentraion
AKTUELLES ZUR DEMENZDIAGNOSTIK GHF am Medizinische Diagnostik 2 Biomarker Cerebrale Atrophien (MRT) Cerebraler Hypometabolismus (PET) Liquor Erhöhte Konzentration Abeta 42 (Amyloidprotein) Erhöhte Konzentraion
2 Terminologie Tatjana Schütz Einleitung Screening und Assessment Ernährungsbedingtes Risiko Literatur...
 6 Inhalt Inhalt Vorwort... 11 Sabine Bartholomeyczik 1 Gesellschaftliche und gesundheitspolitische Relevanz von Mangelernährung Die Bedeutung von Essen und Trinken in gesellschaftlicher Hinsicht... 13
6 Inhalt Inhalt Vorwort... 11 Sabine Bartholomeyczik 1 Gesellschaftliche und gesundheitspolitische Relevanz von Mangelernährung Die Bedeutung von Essen und Trinken in gesellschaftlicher Hinsicht... 13
Impulse für die Leitlinienentwicklung aus der Genderperspektive am Beispiel von internationalen Leitlinien zur Depression
 Impulse für die Leitlinienentwicklung aus der Genderperspektive am Beispiel von internationalen Leitlinien zur Depression Jahrestagung des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin DNebM, Berlin 25.
Impulse für die Leitlinienentwicklung aus der Genderperspektive am Beispiel von internationalen Leitlinien zur Depression Jahrestagung des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin DNebM, Berlin 25.
Palliative Care in der LZP:
 Palliative Care in der LZP: Grundversorgung oder spezialisiertes Angebot? Dr. med. Roland Kunz Chefarzt Geriatrie + Palliative Care 1 Grundsatzfragen Ist der Betreuungsansatz in der LZP per se immer Palliative
Palliative Care in der LZP: Grundversorgung oder spezialisiertes Angebot? Dr. med. Roland Kunz Chefarzt Geriatrie + Palliative Care 1 Grundsatzfragen Ist der Betreuungsansatz in der LZP per se immer Palliative
COPD - Outcome IPS Symposium St. Gallen, 12. Januar 2016
 COPD - Outcome IPS Symposium St. Gallen, 12. Januar 2016 Dr. med. Lukas Kern COPD 5. häufigste Todesursache im Jahr 2002! Voraussichtlich 3. häufigste Todesursache im Jahr 2030! (WHO) Prävalenz weltweit
COPD - Outcome IPS Symposium St. Gallen, 12. Januar 2016 Dr. med. Lukas Kern COPD 5. häufigste Todesursache im Jahr 2002! Voraussichtlich 3. häufigste Todesursache im Jahr 2030! (WHO) Prävalenz weltweit
