Gutachten zur Erschütterungsentwicklung während des Grubenwasseranstiegs auf -320 mnn in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel
|
|
|
- Lucas Meyer
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Gutachten zur Erschütterungsentwicklung während des Grubenwasseranstiegs auf -320 mnn in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel Auftraggeber: RAG AG Shamrockring Herne Erstellt von: Prof. Dr. - Ing. Michael Alber von der IHK zu Dortmund öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Ingenieurgeologie und Felsmechanik Alber Geomechanik Brögerstr Dortmund 50 Seiten 40 Abbildungen 15 Tabellen Datum: 22. März Anlage
2 Inhalt 1. Veranlassung 2. Aufbau des Gutachtens 3. Verwendete Unterlagen 4. Felsmechanische Grundlagen 4.1 Eigenschaften von Trennflächen in-situ 5. Betrachtungsraum 6. Grubenwasseranstieg bis ca mnn in der Wasserprovinz Duhamel bis Erschütterungen während des Grubenwasseranstiegs im Zeitraum Geologisches Modell im Nahbereich des Abbaugebiets Primsmulde 7.1 Gebirgsmechanisches Modell im Abbaubereich Primsmulde Beurteilungen der abbaubedingten Erschütterungen Versagensmechanismen bei Grubenwasseranstieg 9. Abschätzung der Magnituden und Schwinggeschwindigkeiten aus Auslösungsmechanismen durch Grubenwasseranstieg in der Umgebung der Primsmulde 10. Abschätzung der Magnituden und Schwinggeschwindigkeiten aus Auslösungsmechanismen durch Grubenwasseranstieg in der Umgebung von Feld Dilsburg 11. Abschätzung der Magnituden und Schwinggeschwindigkeiten aus Auslösungsmechanismen durch Grubenwasseranstieg in der Umgebung des Nordfelds des ehemaligen Bergwerks Saar 12. Abschätzung der Magnituden und Schwinggeschwindigkeiten aus Auslösungsmechanismen durch Grubenwasseranstieg in der Umgebung des Sprungs 13. Abschätzung der Magnituden und Schwinggeschwindigkeiten aus Auslösungsmechanismen durch Grubenwasseranstieg der nicht zugeordneten und nicht lokalisierten Ereignisse 14. Erschütterungen während des Grubenwasseranstiegs auf -320 mnn in der Wasserprovinz Reden 15. Zusammenfassung Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 2 von 50
3 1. Veranlassung Der Unterzeichnende wurde am 3. August 2016 von der RAG AG beauftragt, ein Gutachten zu den möglichen Erschütterungen während des Grubenwasseranstiegs auf -320 mnn in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel zu erstellen. Zu behandelnde Fragestellungen waren: Ist das Auftreten von Erschütterungen an den Grubenwasseranstieg gekoppelt? Welche Schwinggeschwindigkeiten durch Erschütterung können beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel erwartet werden? Ist nach Beendigung des Grubenwasseranstiegs auf -320 mnn in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel das Auftreten weiterer Erschütterungen ausgeschlossen? 2. Aufbau des Gutachtens Das Gutachten beschreibt in Abschnitt 4 die felsmechanischen Grundlagen. Hier wird v.a. auf die Wirkung von Wasserdruck auf Gestein/Gebirge und auf Trennflächen eingegangen. Abschnitt 5 betrachtet den Betrachtungsraum und in Abschnitt 6 wird der bisherige Grubenwasseranstieg in der Wasserprovinz Duhamel und die dabei aufgetretenen Erschütterungen behandelt. In Abschnitt 7 werden die Erschütterungen beim Strebbau in der Primsmulde diskutiert und eine geologisch-geotechnisches Modell vorgestellt. Hier werden Gesteins- und Gebirgsfestigkeiten definiert und die in-situ Gebirgsspannungen beschrieben. In Abschnitt 7.2 werden die Erschütterungen während des Abbaus in 2008 analysiert und es wird festgestellt, dass geogene Schwächezonen im Gebirge (Trennflächen oder Störungen) überbeansprucht wurden. In Abschnitt 8 werden die Versagensmechanismen im Gebirge bei Grubenwasseranstieg dargelegt und in Abschnitt 9 die Erschütterungen in der Primsmulde aus dem Grubenwasseranstieg analysiert. Es wird festgestellt, dass auch in dieser Situation geogene Schwächezonen im Gebirge (Trennflächen oder Störungen) überbeansprucht werden und zu den Erderschütterungen führen. Ein Vergleich der Größen der Bruchflächen ohne und mit Grubenwasser erlaubt die Abschätzung eines mutmaßlich aktivierten Anteils einer bestehenden Schwächezone. Hieraus werden entsprechende Magnituden und Schwinggeschwindigkeiten beim weiteren Grubenwasseranstieg auf -320 mnn prognostiziert. Derselbe Ansatz wird in den Abschnitten 10 bis 13 für die jeweiligen Bereiche in der Wasserprovinz Duhamel angewendet. In Abschnitt 14 werden mögliche Erschütterungen durch Grubenwasseranstieg in der Wasserprovinz Reden qualitativ betrachtet. Abschnitt 15 fasst das Gutachten zusammen und beantwortet abschließend die in Abschnitt 1 gestellten Fragen. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 3 von 50
4 3. Verwendete Unterlagen Alber, M. and R. Fritschen (2011). Rock mechanical analysis of a Ml= 4.0 seismic event induced by mining in the Saar District, Germany. Geophysical Journal International, 186 (1), pp DMT (2016). Begutachtung und sicherheitstechnische Begleitung des Grubenwasseranstiegs in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel bis zu einem Niveau -320 mnn im Hinblick auf Fragen der Ausgasung. 81 S; 29. Anlagen. Fritschen (2010). Mining-Induced Seismicity in the Saarland, Germany. Pure and Applied Geophysics 167, pp Gay, N.C and W.D. Ortlepp (1979). Anatomy of a mining-induced fault zone. Geological Society of America Bulletin, Part 1, pp IHS Ingenieurbüro Heitfeld-Schetelig GmbH (2016). Gutachten zu den Bodenbewegungen im Rahmen des stufenweisen Grubenwasseranstiegs in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel. Bewertung des Einwirkungspotentials und Monitoringkonzept Anstieg bis -320 mnhn. 123 S., 5 Anhänge und 13 Anlagen. Kahlen, E. und M. Alber (2008) Untersuchung des unterschiedlichen Bruchverhaltens fester Gesteinsschichten unter Abbauwirkung. Abschlussbericht der RUB zum Forschungsvorhaben an die DMT GmbH & Co. KG. 50 S. Knoll, P. (2016). Induzierte seismische Ereignisse beim Anstieg des Grubenwassers in stillgelegten Bergwerken Geomechanische Charakteristika. Leibnitz Online, Nr. 24. ISSN National Research Council (2013). Induced Seismicity Potential in Energy Technologies. US National Academy of Sciences. Rummel, F. (2008). MeSy-Endbericht zur Durchführung von Frac-Versuchen im Liegenden von Flöz Schwalbach, Feld Primsmulde. Wells, D.L and K.J. Coppersmith (1994). New Empirical Relationships among Magnitude, Rupture Length, Rupture Width, Rupture Area, and Surface Displacement. Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 84, No. 4, pp Wikipedia: Zugriff am Weiterhin wurden die Messdaten aus dem seismischen Monitoring von der DMT (Dr. Fritschen) kontinuierlich zur Verfügung gestellt. Die Grubenwasserstände im Nordschacht wurden von der RAG Aktiengesellschaft zur Verfügung gestellt. 4. Felsmechanische Grundlagen Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 4 von 50
5 Wenn (verbundene) Poren im Gestein mit Wasser gefüllt sind und ein biaxiales Spannungsfeld P1 und P3 angesetzt wird, dann sind die effektiven Spannungen im Gestein geringer, da ein Teilbetrag des externen Spannungsfeldes vom inkompressiblen Wasser übernommen wird. Dieses Porenwasser erzeugt dann einen Porenwasserdruck p. Die effektiven Hauptnormalspannungen 1 und 3 sind dann 1 = P1 p (1) 3 = P3 p (2) Durch die Verminderung der Hauptnormalspannungen kann die Festigkeit des Gebirges / Gesteins überschritten werden und Versagen findet statt. Diese Situation ist in Abbildung 1 beschrieben. Abb. 1 Auswirkung von Porenwasserdruck. Die effektiven Spannungen werden um den Porenwasserdruck p vermindert. Bei genügend hohem Porenwasserdruck kann es zum Gesteins- / Gebirgsversagen kommen (der Spannungskreis berührt die Linie der Festigkeit). Der Einfluss von Wasserdruck auf Trennflächen wirkt sich hingegen selektiv auf die Normalspannung aus. Die felsmechanischen Grundlagen werden nachfolgend am Beispiel der fluidbedingten Veränderung von Normal- und Scherspannungen auf einer Fläche mit dem Winkel zu 1 erläutert. Die Bezeichnungen sind in Abbildung 2 erläutert. Zur Erläuterung werden die Mohr schen Formeln benutzt: Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 5 von 50
6 σ1 σ3 σ σ N 2 σ1 σ3 τ sin2θ 2 1 σ 2 3 cos2θ (3) (4) daraus wird (P1 p) (P3 p) (P σ N 2 (P1 p) (P3 p) τ sin2θ 2 1 p) (P 2 3 p) cos2θ (5) (6) d.h. N eff = N-p (7) eff = (8) Abb. 2 Spannungen auf einer Bezugsfläche. Die in-situ Gebirgsspannungen 1 und 3 führen zu einer Normalspannung N und einer Scherspannung auf der Bezugsfläche. Unter Berücksichtigung des Reibungswinkels weist die Fläche eine Spitzenscherfestigkeit P auf. Wasserdruck p auf der Fläche reduziert die Normalspannung N und führt zu einer geringeren Scherfestigkeit P. Die Normalspannung N auf einer Bezugsebene wird also durch den Porenwasserdruck p zur effektiven Normalspannung N eff reduziert. Die Scherspannung auf einer Bezugsfläche bleibt unbeeinflusst vom Porenwasserdruck p, so dass eff = ist. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 6 von 50
7 Die Scherfestigkeit einer Trennfläche (Kluft, Störung, Bankungsfuge ) wird in den Geowissenschaften durch das Mohr-Coulomb Kriterium beschrieben: P = c + N eff tan (9) Hierbei sind P die Spitzenscherfestigkeit, c die Kohäsion, N eff die effektive Normalspannung und der Reibungswinkel. Eine völlig durchtrennte, singuläre Fläche ohne Materialbrücken weist keine Kohäsion c auf. Für der Scherfestigkeit gilt: P = N eff tan. (10) Gleichungen (9) und (10) für die Festigkeit zeigen, dass wenn die Normalspannung N durch Wasserdruck heruntergesetzt wird, auch die Scherfestigkeit vermindert wird. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei Vorhandensein von Wasserdruck die Scherspannung unverändert bleibt, die Scherfestigkeit aber heruntergesetzt wird. Nimmt der Wasserdruck genügend zu, so wird die Scherfestigkeit immer geringer, bis sie kleiner als die unveränderte Scherspannung ist: die Trennfläche versagt und ein seismisches Ereignis kann ausgelöst werden. Die Mechanik des Versagens einer Trennfläche ist in Abb. 3 dargestellt. Wird die Spitzenfestigkeit P einer Trennfläche überschritten, kommt es zu Spannungsabbau durch die Verschiebung auf der Trennfläche. Dabei kann es zu einem messbaren seismischen Ereignis kommen. Dieser Versagensprozess kann mehrmals vorkommen, bis die Trennfläche nur noch eine Restfestigkeit R aufweist. Hierbei wird der Spannungsabfall und damit die an der Tagesoberfläche messbare maximale Schwinggeschwindigkeit abnehmen, je häufiger der Versagensprozess stattfindet. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 7 von 50
8 Abb. 3 Scherfestigkeit einer Trennfläche mit Spitzen- und Restscherfestigkeit. 4.1 Eigenschaften von Trennflächen in-situ Die in Abbildung 2 dargestellte Trennfläche sowie das mechanische Verhalten (Abb. 3) stellen eine Idealisierung der realen Verhältnisse dar. Die Vorstellung, dass nur eine singuläre Trennfläche im Gebirge eine exakt definierte Schwächezone im Gebirge darstellt, entspricht nicht geowissenschaftlichen Beobachtungen. Es können drei Grundtypen von Schwächebereichen im Gebirge definiert werden: Die oben angesprochene singuläre Trennflächen können im Gebirge vereinzelt auftreten. Die Scherfestigkeit dieser Trennfläche ist durch Gleichung (10) beschrieben. Solche ebenen und relativ glatten Trennflächen weisen nach dem Erreichen der Spitzenscherfestigkeit einen geringen Spannungsabfall (Siehe Abb. 3) auf und werden in der Regel als aseismisch angenommen. Trennflächen im Gebirge weisen normalerweise Materialbrücken auf. Somit weisen solche Trennflächen eine Kohäsion auf und Gleichung (9) wird angewendet. Kommt es durch Überbeanspruchung einer kohäsiven Trennfläche zu deren Versagen, dann werden die Materialbrücken abgeschert und es kommt zu einem vollständigen Verlust der Kohäsion. Damit ist der Spannungsabfall (siehe Abb. 3) beim Überschreiten der Scherfestigkeit größer als bei glatten Trennflächen und es können seismische Ereignisse registriert werden. Im realen Gebirge sind jedoch selten einzelne, dominante Trennflächen mit und ohne Materialbrücken zu finden. Gay und Ortlepp (1979) dokumentierten Störungszonen um aktive Bergwerke und fanden Strukturen in Form von ausgeprägten Schwächezonen. Diese Schwächezonen bestehen aus einzelnen Trennflächen mit variierenden Raumlagen und unvollständiger Durchtrennung. Diese Schwächezonen Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 8 von 50
9 weisen somit auch eine Kohäsion auf und Gleichung (9) wird angewendet. Kommt es durch Überbeanspruchung einer Schwächezone zu deren Versagen, dann werden die Materialbrücken abgeschert, einzelne, echte Trennflächen können sich verbinden und es kommt zu einem vollständigen Verlust der Kohäsion. Damit ist der Spannungsabfall (siehe Abb. 3) beim Überschreiten der Scherfestigkeit groß und es können seismische Ereignisse auftreten. Die drei Grundtypen sind in folgender Abbildung 4 schematisch dargestellt. Abb. 4 Drei Grundtypen von Trennflächen im Gebirge (modifiziert nach Gay & Ortlepp, 1997): a) glatte, ebene und persistente Trennfläche mit geringen Erschütterungspotential; b) Trennfläche mit Materialbrücken, die beim Versagen Erschütterungspotential aufweisen; c) Schwächezone mit mehreren versetzten Trennflächen und Materialbrücken, die beim Versagen Erschütterungspotential aufweisen. 5. Betrachtungsraum Das Gutachten behandelt den Bereich des Kohlenabbaus im Saarland, das durch den Grubenwasseranstieg bis -320 mnn in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel betroffen ist. Der Betrachtungsraum ist in Abbildung 5 dargestellt und umfasst in der Wasserprovinz Duhamel die Abbaubereiche Nord- und Ostfeld und Primsmulde / Dilsburgfeld. In der Wasserprovinz Reden sind die Bereiche (Box-Modell der DMT) Dilsburgfeld, Göttelborn, Maybach, Reden, Dechen, Schiffweiler, Kohlwald, König und Frankenholz betroffen. In grüner Farbe sind Umrisse der Abbaue eingezeichnet, die oberhalb des Grubenwasserniveaus -320 mnn liegen. In blauer Farbe sind die Umrisse der bereits abgesoffenen Abbaue dargestellt. Das Gutachten beurteilt zuerst die die Auswirkungen des Grubenwasseranstiegs bis -320 mnn in der Wasserprovinz Duhamel, die Beurteilung der Auswirkungen im der Wasserprovinz Reden erfolgt in einem separaten Abschnitt. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 9 von 50
10 Abb. 5 Betrachtungsraum, Wasserprovinzen, Abbaubereiche und betroffene Baufelder (Anlage 5 aus Ingenieurbüro Heitfeld und Schetelig, 2016). 6. Bisheriger Grubenwasseranstieg bis ca mnn in der Wasserprovinz Duhamel bis 2016 Diese Wasserprovinz umfasst die Abbaubereiche Nord- und Ostfeld sowie Primsmulde / Dilsburgfeld. In dieser Wasserprovinz erfolgte ein Grubenwasseranastieg seit dem Abbildung 6 zeigt den Grubenwasserstand im Nordschacht. Es können grob vier unterschiedliche Geschwindigkeiten des Grubenwasseranstiegs unterschieden werden. Im ersten Schritt stieg das Grubenwasser mit einer Durchschnittsrate 0,2 m/tag, danach wurde im zweiten Schritt mit 1,7 m/tag der schnellste Anstieg beobachtet. Der Anstieg verlangsamte sich dann im Schritt 3 auf 0,3 m/tag. Danach kam es durch den ausschließlichen Eintrag von Oberflächenwasser zu einer durchschnittlichen Anstiegsrate vom 3 cm pro Tag. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 10 von 50
11 cm/d Grubenwasserstand im Nordschacht Grubenwasserstand mnn ,7 m/d 3 0,3 m/d ,2 m/d Datum Abb. 6 Grubenwasseranstieg am Messpunkt Nordschacht mit vier Phasen des Anstiegs. Für die folgenden Betrachtungen muss davon ausgegangen werden, dass der Wasserstand in den verschiedenen Abbaubereichen auf der gleichen Höhe wie im Nordschacht vorliegt. Damit wird angenommen, dass der Grubenwasserstand im Nordschacht auch gleichzeitig das Druckpotential auf Schwächezonen in einem tieferen Niveau definiert. Im realen Gebirge wird es auf Grund der vermutlich geringen Gebirgspermeabilität kurzfristig immer eine Potentialdifferenz geben. Dies bedeutet, dass eine zeitverzögerte Druckbeaufschlagung z.b. auf einer Schwächezone vorliegt und ein eventuelles Versagen dieser Schwächezone nicht direkt aus der Druckhöhe im Nordschacht berechnet werden kann. Dieser Aspekt der zeitlichen Verzögerung wird in einem Report des National Research Council (2013) betont. 6.1 Erschütterungen während des Grubenwasseranstiegs im Zeitraum bis Während des Grubenwasseranstiegs (Abb. 6) kam es im Zeitraum bis zu 383 Erschütterungen. Die Erschütterungen wurden durch seismische Stationen erfasst, die die Lokalisierung von Ereignissen in der Ebene aber nicht in der Tiefe erlaubt. Gemessen werden Schwinggeschwindigkeiten vs in den Einheiten mm/s. In Abbildung 7 sind der zeitliche Verlauf des Grubenwasseranstiegs und die gemessenen maximalen Schwinggeschwindigkeiten gezeigt. Mit dem Anstieg des Grubenwassers traten auch die Erschütterungen auf. Die Erschütterungen lagen bis auf eine Ausnahme unterhalb der Schwinggeschwindigkeit von 1 mm/s. Die höchste Schwinggeschwindigkeit wurde am Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 11 von 50
12 mit vs,max = 7, 521 mm/s registriert. Tabelle 1 fasst die Ereignisse zusammen und die Häufigkeitsverteilung ist in Abbildung 8 dargestellt. 0,025 Grubenwasserstand mnn Grubenwasserstand im Nordschacht 0,020 0,015 0,010 0,005 berechnete Bruchflächen (km 2 ) Abb ,000 Datum Grubenwasserstand im Nordschacht und max. Schwinggeschwindigkeiten in allen Bereichen im Zeitraum bis Tab. 1 Schwinggeschwindigkeiten vs,max (mm/s) vom bis in der Wasserprovinz Duhamel. Datensätze 383 Mittelwert 0,052 Median 0,011 Minimum 0,002 Maximum 7,521 Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 12 von 50
13 Häufigkeit ,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 7,2 7,4 7,6 7,8 v s,max (mm/s) Abb. 8 Häufigkeitsverteilung der max. Schwinggeschwindigkeiten während des Grubenwasseranstiegs vom bis Viele der 383 registrierten Ereignissen (Abb. 9) konnten lokalisiert werden und den einzelnen Abbaubereichen (Nordfeld 5 Ereignisse, Primsmulde 81 Ereignisse und Dilsburg 53 Ereignisse) zugeordnet werden. Weitere 65 Ereignisse wurden in einem Bereich zwischen der Primsmulde und Dilsburg-Ost lokalisiert. In diesem Bereich liegt eine geologische Störung (Sprung) mit Versätzen von 5 m bis mindestens 30 m. Der Sprung fiedert nach Süden auf. Die restlichen 179 Ereignisse wurden entweder nicht lokalisiert (169 Ereignisse) oder konnten keinem Abbaubereich zugeordnet werden (10 Ereignisse). Abbildung A1 im Anhang zeigt die Bereiche der Zuordnungen. Tabelle 2 zeigt die maximalen Schwinggeschwindigkeiten und deren Zuordnung zu den oben genannten Bereichen. Tab. 2 Max. Schwinggeschwindigkeiten vs,max (mm/s) vom bis und Zuordnung zu einzelnen Bereichen. ohne Zuordnung / o. Lokalisierung Dilsburg Sprung Primsmulde Nordfeld Alle Bereiche Datensätze Mittelwert 0,020 0,034 0,047 0,124 0,291 0,052 Median 0,009 0,011 0,012 0,015 0,327 0,011 Minimum 0,002 0,003 0,003 0,003 0,053 0,002 Maximum 0,508 0,308 0,790 7,521 0,616 7,521 Die Lage der Ereignisse und deren Stärken sind in Abbildung 9 dargestellt. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 13 von 50
14 Abb. 9 Lage und Schwinggeschwindigkeiten der Ereignisse während des Grubenwasseranstiegs im Zeitraum bis Die räumliche Lage der Ereignisse kann nicht festgelegt werden, da die Teufenlage der Ereignisse nicht bestimmt werden konnte. In den Anlagen B und C sind Grundrisse und perspektivische Abbildungen verschiedener Höhenlagen des Grubenwasseranstiegs, der Abbaubereiche und der Ereignislagen dargestellt. Hierbei wurden die Ereignisse zum Zwecke der Visualisierung in den perspektivischen Abbildungen auf die Höhe des jeweiligen Grubenwasserstandes gelegt. Aus diesen Abbildungen wird deutlich, dass viele Erschütterungsereignisse in der Nähe der einzelnen Abbaubereiche und des Sprungs auftraten und ein kausaler Zusammenhang zwischen Abbauen bzw. Sprung und den Ereignissen während des Grubenwasseranstiegs zu vermuten ist. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 14 von 50
15 Für die Beurteilung möglicher Ereignisse während des geplanten Anstiegs auf -320 mnn in der Wasserprovinz Duhamel wird daher folgende Vorgehensweise angewandt: In den Bereichen Nordfeld, Dilsburg und Primsmulde wurden schon während des Kohlenabbaus ohne Beeinflussung durch Grubenwasser Erschütterungen registriert. In diesen Bereichen wurden mittels eines seismischen Netzwerks bergbauinduzierte Erschütterungen gemessen. Damit ist es möglich, die Erschütterungen durch den Kohleabbau mit Erschütterungen aus dem Grubenwasseranstieg zu vergleichen und somit Prognosen zu Erschütterungen während des weiteren Grubenwasseranstiegs zu formulieren. Der Strebbau in der Primsmulde führte zu vielen Erschütterungen und kulminierte in dem Ereignis am mit einer maximalen Schwinggeschwindigkeit vs,max = 93,5 mm/s. Daraufhin wurde Forschungsarbeiten initiiert, um den Mechanismus der Ereignisse zu klären. Bohrungen wurden gestossen, um aus den gewonnen Bohrkernen relevante geomechanische Kennwerte zu erhalten und somit ein geologisch-geotechnisches Modell aufzustellen. 7. Geologisches Modell im Nahbereich des Abbaugebietes Primsmulde Im Rahmen des Projektes Untersuchung des unterschiedlichen Bruchverhaltens fester Gesteinsschichten unter Abbauwirkung (Kahlen und Alber, 2008) wurden umfassende Untersuchungen der geomechanischen Parameter im Baufeld Primsmulde durchgeführt. Dazu wurden vom Bergwerk Saar zwei Bohrkerne zu Verfügung gestellt, die sowohl als Quelle für Informationen über das Gebirge und auch als Probenmaterial benutzt wurden. Die durch das Bergwerk Saar zur Verfügung gestellten Bohrungen 33/06 und 34/06 wurden an der Ruhr-Universität nochmals aufgenommen. Diese beiden Bohrungen stammen aus dem Baufeld Primsmulde und wurden im August 2006 in der Bandstrecke Prims 1 abgeteuft (siehe Abb. 10). Die Bohrung 33/06 erstreckt sich 50 m ins Liegende und die Bohrung 34/ m ins Hangende von Flöz Schwalbach. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 15 von 50
16 Abb. 10 Ausschnitt aus der Übersichtsrisskarte des Bergwerks Saar für das Feldr Primsmulde. Verzeichnet sind sowohl bekannte als auch vermutete Störungen. Die Bohrungen 34/06 und 33/06 stammen aus der Bandstrecke Prims 1. Quelle: DSK. Die angetroffenen Gesteine in den Bohrkernen umfassen Tonsteine, Siltsteine, Sandsteine und Konglomerat (Abb. 11). Die lithologische Abfolge über und unter Flöz Schwalbach ist in Abbildung 12 dargestellt. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 16 von 50
17 Abb. 11 Beispiele der sechs auftretenden Gesteinstypen aus den Bohrungen 33/06 und 34/06. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 17 von 50
18 Abb. 12 Übersichtsprofile der Bohrungen 33/06 und 34/06. Bohrung 33/06 durchstößt im Liegenden von Flöz Schwalbach die Dilsburg-Formation, während sich 34/06 im Hangenden des Flözes 150 m in die Heusweiler-Formation erstreckt. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 18 von 50
19 7.1 Gebirgsmechanisches Modell im Abbaubereich Primsmulde 2008 Die vertikale Spannung (Teufendruck) ergibt sich aus der Dichte des Gesteins, der Erdbeschleunigung (g) und der betrachteten Teufe (z): Dichte: = 2600 kg/m³ Erdbeschleunigung: g = 9,81 (m/s²) Teufe: z (m) v [MPa] = g z (11) Aus den Hydro-Frac Daten von Rummel (2008) wurden die größte und kleinste Horizontalspannung folgendermaßen berechnet. h [MPa] = -6,3 + 0,018 h H [MPa] = -10,8 + 0,036 h h = Mächtigkeit des Deckgebirges (m) h = Mächtigkeit des Deckgebirges (m) Unter der Annahme, dass das Gebirge trocken ist und der Porenwasserdruck P0 = 0 Pa beträgt, ergeben sich die in Tabelle 3 zusammengefasste Werte für eine Teufe von 1500 m im Baufeld Primsmulde. Tab. 3 Ermittelte Horizontalspannungen im Bereich des Bergwerks Saar. Sv [MPa] SH [MPa] Sh [MPa] Richtung von SH Datensatz Rummel 2008, Hydro-Frac Lokalität Bandstrecke Prims 3, Liegendes von Flöz Schwalbach Die größte Horizontalspannung ist demnach doppelt so groß wie die kleinste. Außerdem erweist sich die vertikale Spannung nicht als größte Spannungskomponente. Dieser Spannungszustand führt nach der Theorie von Anderson zur Bildung von Blattverschiebungen. Die Richtung der größten Horizontalspannung beträgt 147. Dies entspricht dem in Mitteleuropa vorherrschenden variszischen Spannungsregime (Rummel, 2008). Die Größe der Spannungen nimmt mit zunehmender Tiefe zu. Dies gilt sowohl für die vertikale Spannungskomponente v, als auch für die beiden Horizontalspannungen h und H. Der Verlauf der Spannungen über die Teufe ist in der folgenden Abbildung 13 dargestellt. Im Verlauf des Forschungsprojektes (Kahlen und Alber, 2008) wurden an den Gesteinen aus den Bohrungen zahlreiche felsmechanische Versuche durchgeführt (13 Zugversuche, 85 einaxiale Druckversuche, 39 triaxiale Druckversuche sowie 39 triaxiale Druckversuche zur Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 19 von 50
20 Bestimmung der Restfestigkeit). An den Bohrkernen wurden das Gebirge klassifiziert und Gebirgsfestigkeiten abgeschätzt. Abbildung 14 zeigt die Festigkeitslinien von Gestein und Gebirge als Funktion von der kleinsten Hauptnormalspannung 3. Abb. 13 Zunahme der vertikalen Spannung V und der kleinsten ( h) und größten ( H) Horizontalspannung mit der Tiefe. Daten von Rummel (2008). Die Berechnungen erfolgten unter der Annahme, dass der Porenfluiddruck P0 = 0 ist. Für die Dichte des Gebirges wurde = 2600 kg/m³ angenommen. Abb. 14 Festigkeit von Gestein und Gebirge im Nahfeld des Baufelds Primsmulde. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 20 von 50
21 7.2 Beurteilung der abbaubedingten Erschütterungen Seismische Ereignisse stammen aus Versagensprozessen im Gebirge. Dabei sind grundsätzlich zwei unterschiedliche Prozesse zu betrachten: (1) Versagen von Gebirge auf Grund der Überschreitung der Gebirgsfestigkeit. (2) Versagen einer Schwächezone durch Überschreiten der Scherfestigkeit. Die Erderschütterungen während des Abbaus des Doppelstrebs Prims 1 und 2 wurden in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung von Alber und Fritschen (2011) bearbeitet. Zuerst wurde geprüft, ob ein Versagen des Gebirges durch Spannungsumlagerungen um den Doppelstreb die Erderschütterungen verursacht haben. Zwar wird die Gebirgsfestigkeit direkt im Hangenden und Liegenden des Doppelstrebs überschritten. Die Schichten in den Bereichen, in denen ein Großteil der seismischen Ereignisse lokalisiert wurden (50 m unterhalb und mehrere 100 m oberhalb Flöz Schwalbach sowie teilweise mehr als 300 m vor dem Streb) weisen höhere Festigkeiten als die Beanspruchungen aus (Abb. 15). Somit ist Gebirgsversagen (Versagensprozess 1) als Auslöser der Erderschütterungen auszuschließen. 100 Größte Hauptnormalspannung 1 (MPa) Festigkeit (MPa) Hauptnormalspannungen 350 m über Streb Hauptnormalspannungen 300 m über Streb Hauptnormalspannungen 250 m über Streb Untere Grenze der Gesteinsfestigkeit Untere Grenze für Restfestigkeit des Gesteins Kleinste Hauptnormalspannung 3 (MPa) Abb. 15 Abgeschätzte Festigkeiten (schwarze Linien) und numerisch ermittelte Beanspruchungen (Punkte) für verschieden Bereiche über Flöz Schwalbach, in denen die seismischen Ereignisse lokalisiert wurden. Die Festigkeit des Gebirges wurde danach nicht überschritten. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 21 von 50
22 Die seismischen Ereignisse wurden analysiert und es konnten bevorzugte Richtungen von Bruchflächen festgestellt werden. Die Richtungen der Bruchflächen, oder besser, deren Orientierungen stimmen mit den Orientierungen der existierenden Trennflächen überein. Dies bedeutet, dass die während der variskischen Gebirgsbildung im Karbon angelegten Trennflächen oder Schwächezonen durch den Strebbau aktiviert wurden. Der oben erwähnte Versagensprozess 2 ist somit als Mechanismus für Erschütterungen anzusehen. Eine Rückrechnung der Spannungen beim Versagen der Schwächezonen führte zu Reibungswinkeln zwischen 8 und 32 (Abb. 16). Diese ermittelten Reibungswinkel sind als Ersatzreibungswinkel, da die Kohäsion nicht rückgerechnet werden kann, zu Vergleichszwecken zu verstehen. Abb. 16 Herdflächenlösungen für die seismischen Ereignisse im Baufeld Primsmulde. Die Orientierung der Bruchflächen ist ähnlich der tektonisch angelegten Trennflächen. Die rückgerechneten (Ersatz-)Reibungswinkel der Bruchflächen liegt zwischen 8 und 32 (aus: Alber und Fritschen, 2011). Die Untersuchungen führten zu folgenden Aussagen: Gebirgsversagen (d.h. die Bildung neuer Bruchflächen) ist unwahrscheinlich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit existieren kritisch gespannte Schwächezonen. Die Scherfestigkeit dieser Schwächezonen ist z. T. gering. Die Normalspannung auf diesen Schwächezonen wurde durch den herannahenden Doppelstreb vermindert. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 22 von 50
23 Die Scherfestigkeit wurde dadurch soweit reduziert, dass Schwächezonen versagten und Erderschütterung ausgelöst werden. 8. Versagensmechanismen bei Grubenwasseranstieg Wie im vorigen Abschnitt erläutert stammen seismische Ereignisse aus zwei möglichen Versagensprozessen im Gebirge: (1) Versagen von Gebirge auf Grund der Überschreitung der Gebirgsfestigkeit. (2) Versagen einer Schwächezone durch Überschreiten der Scherfestigkeit. Nachfolgend werden diese beiden Versagensmechanismen bei Grubenwasseranstieg im Feld Primsmulde erläutert und bewertet. Ein Versagen des Gebirges durch den Einfluss von Wasser würde entsprechend hohe Wasserdrücke nach Abbildung 1 voraussetzen. Eine Abschätzung der Festigkeit des unverritzten Gebirges wurde in Abbildung 14 gezeigt. Unter Berücksichtigung des in-situ Spannungsfelds (Tab. 3) muss ein Wasserdruck von ca. 8,5 MPa herrschen (Abb. 17), um das Gebirge zum Versagen zu bringen. Dieser Wasserdruck entspricht einer Wassersäule von 850 m Höhe. Die maximale Wassersäule im Nordschacht beträgt lt. Abbildung 7 (Grubenwasseranstieg vom bis ) 354,9 m. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 23 von 50
24 Abb. 17 Festigkeit und Beanspruchung des Gebirges im Baufeld Primsmulde. Der in-situ Spannungszustand (schwarzer Halbkreis) muss um einen Porendruck p = 8,5 MPa vermindert werden, um ein Versagen des Gebirges zu verursachen. Der Versagensmechanismus (1) Überschreitung der Gebirgsfestigkeit durch Wasserdruck kann nicht die Erschütterungen aus dem Grubenwasseranstieg erklären. Die im vorigen Abschnitt begründete Annahme, dass ausschließlich Schwächezonen die Ursache von Erderschütterungen sind, bildet den Ausgangspunkt der folgenden Betrachtungen. Wie in Abschnitt 4 gezeigt wurde, führt ein Wasserdruck auf einer Trennfläche oder Schwächezone zu einer gleich großen Verminderung der Normalspannung auf dieser Fläche oder Zone, während die Scherspannung konstant bleibt. Bei genügend hohem Wasserdruck und somit genügend großer Verminderung der Normalspannung wird die Scherfestigkeit schließlich geringer als die Scherspannung - die Trennfläche / Schwächezone versagt und eine Erderschütterung ist möglich. Ein Beispiel mag die Situation verdeutlichen: Eine senkrechte Trennfläche wird von unten bis auf 100 m Höhe geflutet. Der Wasserdruck in 100 m Höhe ist 0 bar und in 0 m Höhe 10 bar. Der durchschnittliche Wasserdruck auf der Trennfläche oder Schwächezone ist (0 + 10)/2 = Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 24 von 50
25 5 bar. Die Normalspannung N auf der Trennfläche wird um den Wasserdruck p = 5 bar (0,5 MPa) auf die effektive Normalspannung Neff reduziert. Die Scherfestigkeit P der Trennfläche beträgt nun P =c + ( N-p) tan, sie wurde also um den Betrag p tan reduziert. 9. Abschätzung der Magnituden und Schwinggeschwindigkeiten aus Auslösungsmechanismen durch Grubenwasseranstieg in der Umgebung der Primsmulde Bei den abbaubedingten Erschütterungen im Feld Primsmulde in wurden die Magnituden bestimmt. Nach der Methode von Wells und Coppersmith (1994) können die dazugehörigen Bruchflächen mit der Formel ML = 4,07 + 0,98 log(a) (12) abgeschätzt werden, wobei ML die Magnitude und A die Bruchfläche in km 2 sind. Diese Beziehung ist grafisch in Abbildung 18 dargestellt. Am trat während der aktiven Abbauphase im Hangenden von Flöz Schwalbach ein seismisches Ereignis mit der Magnitude ML = 4 auf, das zu einer maximalen Schwinggeschwindigkeit von 93,5 mm/s an der Tagesoberfläche führte. Aus Gleichung (12) ist zu erkennen, dass diesem Ereignis eine Bruchfläche von ungefähr 1 km 2 entspricht. Abb. 18 Beziehung zwischen Magnitude und Größe der Bruchfläche nach Wells und Coppersmith (1994). Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 25 von 50
26 Für die 191 Erschütterungen in aus dem Abbau Prims 1 und 2 sind Magnituden (Abb. 19) und die mit Formel (12) daraus berechneten Bruchflächen in Abbildung 20 zusammengefasst. Abb. 19 Häufigkeitsverteilung der Magnituden in den Jahren Abb. 20 Mit Formel (12) abgeleitete Häufigkeiten der Größe der Bruchflächen der Ereignisse aus Solche potentielle Bruchflächen oder anders ausgedrückt Schwächezonen stellen potentielle Versagensflächen beim Grubenwasseranstieg dar. Wie in Abschnitt 4.1. dargelegt weisen schon beim Abbau versagte und somit schon abgescherte Schwächezonen geringere Scherfestigkeit durch Verlust der Köhasion auf. Ein Versagen während des Grubenwasseranstiegs würde wahrscheinlich zu keinen oder sehr geringen Erschütterungen Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 26 von 50
27 führen. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass es sich bei den Ereignissen aus den Jahren um das Versagen von weiteren Schwächezonen (mit Kohäsion) im Umfeld des Abbaus Primsmulde handelt. Insgesamt 383 Erderschütterungen im Bereich Saar wurden im Zeitraum vom durch seismologische Messungen erfasst. Davon sind 81 Ereignisse der Primsmulde zuzuordnen. Tabelle 4 stellt die maximalen Schwinggeschwindigkeiten während des Abbaus und während des Grubenwasseranstiegs zusammen. Tab. 4 Max. Schwinggeschwindigkeiten vs,max (mm/s) während des Abbaus und während des Grubenwasseranstiegs in der Primsmulde. Primsmulde Abbau Primsmulde Grubenwasseranstieg Datensätze Zeitdauer 458 d 1321 d Mittelwert 3,796 0,124 Median 0,666 0,015 Minimum 0,127 0,003 Maximum 93,542 7,521 Diese Schwinggeschwindigkeiten können nach Alber & Fritschen (2011) mit folgender Formel (13) in Magnituden umgerechnet werden:1 ML = 0,3506 ln(vmax) + 2,1089 (13) Daraus ergeben sich für die Ereignisse im Zeitraum Magnituden von 0,07 < ML < 2,8 und nach Formel (12) ergeben sich daraus Bruchflächen 83 m 2 < A < 0,05 km 2. Die Häufigkeit der Magnituden ML aus dem Zeitraum sowie der Magnituden aus dem Zeitraum des Grubenwasseranstiegs sind in Abbildung 21 dargestellt. Die Häufigkeit der mit Formel (12) berechneten Bruchflächen für den Zeitraum des aktiven Strebbaus im Baufeld Primsmulde sowie der Bruchflächen aus dem Zeitraum des Grubenwasseranstiegs sind in Abbildung 22 dargestellt. 1 Diese Formel zur Umrechnung von maximalen Schwinggeschwindigkeiten in Magnituden basiert auf der Korrelation von Ereignissen im Bereich des Bergwerkes Saar aus den Jahren 2007 und Werden Magnituden direkt aus den entsprechenden Seismogrammen ermittelt, kann es zu leichten Abweichungen von bis zu ca. 10 % kommen, da die Magnitude kein direkter Messwert ist, sondern immer aus direkten Messwerten rückgerechnet wird. In diesem Gutachten wird aus Gründen der Datenkonsistenz nur die Beziehung (13) zur Umrechnung von maximalen Schwinggeschwindigkeiten in Magnituden verwendet. Die Formel gilt natürlich nur für seismische Ereignisse, die im Bereich des Bergwerkes Saar auftreten. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 27 von 50
28 Deutlich zu erkennen ist, dass sowohl Magnituden als auch Bruchflächen während des Zeitraums des Grubenwasseranstiegs ( ) geringer sind als im Zeitraum während des Abbaus ( ) während Abbau während Grubenwasseranstieg Häufigkeit ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Magnitude M L Abb. 21 Häufigkeit von Magnituden im Bereich Primsmulde während des Abbaus (schwarze Balken) und während des Grubenwasseranstiegs bis (rote Balken) Häufigkeit während Abbau während Grubenwasseranstieg ,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 berechnete Bruchflächen (km 2 ) Abb. 22 Häufigkeit von (berechneten) Bruchflächen während des Abbaus (schwarze Balken) und während des Grubenwasseranstiegs bis zum im Bereich Primsmulde (rote Balken). Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 28 von 50
29 Die Ereignisse, die in den Jahren während des Grubenwasseranstiegs auftraten, sind vermutlich durch Reaktivierung von Schwächezonen unterhalb des Flöz Schwalbach verursacht worden, da nur hier ein entsprechender Porendruck zur Verminderung der Scherfestigkeit zur Verfügung stand. Der Grubenwasserstand im Nordschacht war beim größten Ereignis im Feld Primsmulde (vs,max = 7,521 mm/s am , siehe Abb. 7) bei ,6 mnn. Flöz Schwalbach im Feld Primsmulde liegt an dieser Stelle bei mnn. Das Flöz war an dieser Stelle ca. 42 m überstaut. Damit wird die Annahme unterstützt, dass die Ereignisse im von Wasserdruck beeinflussten Bereich unterhalb des Flözes stattfanden. Hiermit lässt sich eine Abschätzung von Bruchflächen und Magnituden für den weiteren Grubenwasseranstieg vornehmen, indem die bisher während des Grubenwasseranstiegs aufgetretenen Erschütterungen ausschließlich mit denen korreliert werden, die während des aktiven Abbaus im Liegenden auftraten. Die hierdurch ermittelte statistische Beziehung wird anschließend verwendet, um die durch Grubenwasseranstieg im Hangenden erwartete Seismizität zu berechnen. Während des Abbaus wurde die größte Erderschütterung unterhalb des Flözes am mit einer Magnitude ML = 3,6 und einer Schwinggeschwindigkeit von 29 mm/s dokumentiert. Dies entspricht nach Formel (12) einer Versagensfläche von 0,33 km 2. Während des Grubenwasseranstiegs wurde die größte Erderschütterung am mit einer Schwinggeschwindigkeit von 7,5 mm/s dokumentiert, dies entspricht nach Formel (13) einer Magnitude ML = 2,8 und nach Formel (12) einer Versagensfläche von 0,05 km 2. Diese Daten und der daraus abgeleitete aktivierte Bruchflächenanteil sind in Tabelle 6 aufgeführt. Tab. 6 Größtes Ereignis unterhalb Flöz Schwalbach im Bereich Primsmulde während des Strebbaus und des Grubenwasseranstiegs sowie daraus abgeschätzter aktivierter Flächenanteil einer versagten, seismogenen Schwächezone. Größtes Ereignis unterhalb Flöz während Abbau Größtes Ereignis während Grubenwasseranstieg Datum vs,max (mm/s) Mutmaßlich maximaler aktivierter Anteil einer bestehenden Schwächezone ML Bruchfläche A (km 2 ) ,6 0, ,5 2,8 0,05 15,8 % ( 1/6) Dies bedeutet, dass durch den Grubenwasseranstieg ca. 1/6 der Fläche einer existierenden Schwächezone reaktiviert wurde und versagte. Mit diesem Wert wurden die möglichen Bruchflächengrößen auf Grund des Grubenwasseranstiegs oberhalb von Flöz Schwalbach abgeschätzt. D.h. hier wird als Datenbasis die Gesamtheit der Ereignisse verwendet, die Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 29 von 50
30 während des aktiven Abbaus im Hangenden des Flözes Schwalbach auftrat, insbesondere auch unter Einbeziehung des größten damals aufgetretenen seismischen Ereignisses mit einer maximalen Schwinggeschwindigkeit von rund 94 mm/s und einer Magnitude von 4,0. Unter dieser Annahme sind die Erschütterungen beim Grubenwasseranstieg in entsprechenden Niveaus über dem Flöz Schwalbach in Abbildung 23 dargestellt. Zur Berechnung der in Abbildung 23 gezeigten Datenpunkte wurden zunächst aus den 191 Hangendereignissen aus Bruchflächengrößen nach Formel (12) berechnet. Diese wurden mit dem empirisch ermittelten Skalierungsfaktor von 1/6 multipliziert und danach wieder in Magnituden rückgerechnet. Als Ergebnis erhält man die Prognose der zukünftig zu erwartenden seismischen Ereignisse, quantifiziert als sog. Boxplot. Abbildung 23 beschreibt die Verteilung der geschätzten Magnituden aus Grubenwasseranstieg. Dieser sogenannte Boxplot visualisiert anschaulich den Bereich, in dem Daten liegen. Mit dem grauen Kasten werden 50 % aller geschätzten Magnituden beschrieben, im Bereich der Antennen (10% und 90 % Fraktile) liegen 80 % aller geschätzten Magnituden. Die einzelnen Punkte in Abbildung 27 beschreiben die minimalen und maximalen geschätzten Ereignisse. Aus Abbildung 23 kann entnommen werden, dass wenn 1/6 der bestehenden Schwächezonen im Hangenden von Flöz Schwalbach durch Grubenwasseranstieg aktiviert werden, von Magnituden 0,9 < ML < 3,2 auszugehen ist. Abb. 23 Boxplot der geschätzten Magnituden durch Grubenwasseranstieg bei 15,8 %, d.h. ca. 1/6, Aktivierung der bestehenden Schwächezonen im Bereich Primsmulde (Erläuterung der Grafik rechts oben). Das seismische Netzwerk ist nicht dazu ausgelegt, um die sicherlich zahlreichen kleinen Schwinggeschwindigkeiten aufzunehmen. Damit sind diese kleinen Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 30 von 50
31 Schwinggeschwindigkeiten (oder Magnituden) unterrepräsentiert und die Daten in Abbildung 23 können annähernd als normalverteilt angesehen werden. Unter dieser Annahme können Mittelwert und Standardabweichung der 191 geschätzten Magnituden aus Grubenwasseranstieg im Hangenden von Flöz Schwalbach berechnet werden (Tab. 7). Tab. 7 Mittelwert und Standardabweichung der geschätzten Magnituden aus Grubenwasseranstieg im Hangenden von Flöz Schwalbach, Bereich Primsmulde. Datenbasis n = 191 Mittelwert ML = 1,69 Standardabweichung 0,437 Mit den in Tabelle 7 dargestellten statistischen Maßzahlen, dem empirischer Mittelwert von ML = 1,69 und der empirischen Standardabweichung = 0,437 können die Eigenschaften der geschätzten Magnituden aus Grubenwasseranstieg oberhalb von Flöz Schwalbach beschrieben werden. Für normalverteilte Daten können mit Mittelwert und Standardabweichung die erwarteten Magnituden statistische quantifiziert werden (Abb. 24). Abb. 24 Intervalle um dem Mittelwert bei einer Normalverteilung (Wikipedia, ) Bei einer solchen Normalverteilung sind innerhalb von ± 1 Standardabweichung ca. 68 % aller Prozessergebnisse ± 2 Standardabweichungen ca. 95 % aller Prozessergebnisse ± 3 Standardabweichungen ca. 99,7 % aller Prozessergebnisse zu finden. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 31 von 50
32 Für die in Tabelle 7 angegeben statistischen Maßzahlen der geschätzten Magnituden aus Grubenwasseranstieg oberhalb von Flöz Schwalbach können folgende Eintrittswahrscheinlichkeiten berechnet werden: ca. 68 % aller erwarteten Magnituden liegen zwischen 1,26 < ML < 2,13 ca. 95 % aller erwarteten Magnituden liegen zwischen 0,82 < ML < 2,57 ca. 99,7% aller erwarteten Magnituden liegen zwischen 0,38 < ML < 3,0 Da hohe Magnituden von Interesse sind wurden aus den statistischen Maßzahlen in Tabelle 7 kumulative Verteilungsfunktionen berechnet und in Abbildung 25 dargestellt. Damit ist es möglich, Eintrittswahrscheinlichkeiten für die zu erwartenden Magnituden abzuschätzen. Kumulative Häufigkeit (%) ca. 16 % Aktivierung einer bestehenden Schwächezone 0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Magnituden M L durch Grubenwasseranstieg Abb. 25 Kumulative Verteilungsfunktion von Magnituden beim Grubenwasseranstieg in im Bereich Primsmulde bei einer Aktivierung von 1/6 der bestehenden Bruchflächen. Aus Abbildung 25 ist zu entnehmen, dass 20 % aller Magnituden < ML = 1,3 40 % aller Magnituden < ML = 1,6 60 % aller Magnituden < ML = 1,8 80 % aller Magnituden < ML = 2,1 und 99,9 % aller Magnituden < ML = 3,2 durch den Grubenwasseranstieg in Bereiche oberhalb des Flöz Schwalbach zu erwarten sind. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis mit einer Magnitude ML > 3,2 eintritt, 0,1 %. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 32 von 50
33 Dementsprechend sind nach Formel (13) 20 % aller Schwinggeschwindigkeiten < vs,max = 0,1 mm/s 40 % aller Schwinggeschwindigkeiten < vs,max = 0,23 mm/s 60 % aller Schwinggeschwindigkeiten < vs,max = 0,41 mm/s 80 % aller Schwinggeschwindigkeiten < vs,max = 0,97 mm/s und 99,9 % aller Schwinggeschwindigkeiten < vs,max = 22,5 mm/s zu erwarten. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis mit einer Schwinggeschwindigkeit vs,max > 22,5 mm/s eintritt, 0,1 %. Diese hier vorgestellte Vorgehensweise wird auch zur Prognose der zu erwartenden Erschütterungen durch weiteren Grubenwasseranstieg in den Feldern Dilsburg, Nordfeld und im vom Bergbau nicht beeinflussten Gebiet des Sprungs angewendet. 10. Abschätzung der Magnituden und Schwinggeschwindigkeiten aus Auslösungsmechanismen durch Grubenwasseranstieg in der Umgebung von Feld Dilsburg Während des Grubenwasseranstiegs wurden im Bereich Dilsburg 53 Erschütterungen registriert (Tab. 2). Während des Abbaus wurden im Bereich Dilsburg-Ost ( ) 1334 Erschütterungen und im Bereich Dilsburg-West ( ) 46 Erschütterungen registriert. Die Daten sind in Tabelle 8 zusammengestellt. Eine ausführliche Analyse der Erschütterungen während des Abbaus liefert Fritschen (2010). Tab. 8 Max. Schwinggeschwindigkeiten vs,max (mm/s) während des Abbaus und während des Grubenwasseranstiegs im Bereich Dilsburg Dilsburg Abbau Dilsburg Grubenwasseranstieg Datensätze Zeitdauer 5166 d 1322 d Mittelwert 1,625 0,034 Median 0,654 0,011 Minimum 0,149 0,003 Maximum 71,280 0,308 Die mit Formeln (12) und (13) umgerechneten Magnituden ML und die Bruchflächen A sind in Abbildungen 26 und 27 als Häufigkeitsverteilungen dargestellt. Das größte Ereignis während des Grubenwasseranstiegs wurde am mit einer Schwinggeschwindigkeit vs,max = 0,3 mm/s im Bereich der geplanten Bauhöhe 8.11 Ost Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 33 von 50
34 gemessen. Das Flöz Schwalbach liegt in diesem Bereich bei mnn. Der Grubenwasserstand im Nordschacht am lag bei -1415,9 mnn. Somit ist davon auszugehen, dass das durch Grubenwasseranstieg ausgelöste Ereignis unterhalb des Flöz Schwalbach lag. Das größte Ereignis vs,max = 28,60 (mm/s) während des Abbaus trat nach Fritschen (2011) unterhalb des Flöz Schwalbach am im Bereich der Bauhöhe 8.9 Ost auf während Abbau während Grubenwasseranstieg Häufigkeit ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Magnituden M L Abb. 26 Häufigkeit der Magnituden während des Abbaus und des Grubenwasseranstiegs im Feld Dilsburg. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 34 von 50
35 währeng Abbau während Grubenwasseranstieg Häufigkeit ,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 berechnete Bruchflächen (km 2 ) Abb. 27 Häufigkeit der berechneten Bruchflächen während des Abbaus und des Grubenwasseranstiegs im Feld Dilsburg. Tab. 9 Größtes Ereignis im Bereich Dilsburg unterhalb Flöz Schwalbach während des Strebbaus und des Grubenwasseranstiegs sowie daraus abgeschätzter aktivierter Flächenanteil einer bestehenden Schwächezone. Größtes Ereignis unterhalb Flöz während Abbau Größtes Ereignis während Grubenwasseranstieg Datum vmax (mm/s) Mutmaßlich maximaler aktivierter Anteil einer bestehenden Schwächezone ML Bruchfläche A (km 2 ) ,60 3,2 0, ,3 1,7 0,004 2,4 % ( 1/42) Das größte Ereignis während des Abbaus im Feld Dilsburg wurde am mit einer Schwinggeschwindigkeit vs,max = 71,3 mm/s registriert. Nach Fritschen (2010) wurde das Ereignis ca. 150 m über Flöz Schwalbach lokalisiert. Wie beim Feld Primsmulde werden mit diesem Wert die möglichen Bruchflächengrößen auf Grund des Grubenwasseranstiegs oberhalb von Flöz Schwalbach im Dilsburgfeld abgeschätzt. D.h. hier wird als Datenbasis die Gesamtheit der Ereignisse verwendet, die während des aktiven Abbaus im Hangenden des Flözes Schwalbach auftrat, insbesondere auch unter Einbeziehung des größten damals Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 35 von 50
36 aufgetretenen seismischen Ereignisses mit einer maximalen Schwinggeschwindigkeit von rund 71,3 mm/s und einer Magnitude von 3,6. In Tabelle 10 sind die Ergebnisse zusammengefasst. Bei einem aktivierten Flächenanteil einer Schwächezone von 2,4 % würde ein Ereignis mit Magnitude ML = 2,0 und einer maximalen Schwinggeschwindigkeit von vs,max =0,9 mm/s beim Grubenwasseranstieg bis auf -320 mnn auftreten können. Wird wie beim Feld Primsmulde von einem aktivierten Flächenanteil einer Schwächezone von 16 % ausgegangen, so wären Erschütterungen im Bereich Dilsburg mit einer maximalen Schwinggeschwindigkeit vs,max =7,7 mm/s beim Grubenwasseranstieg bis auf -320 mnn zu erwarten Tab. 10 Größtes Ereignis im Hangenden während des Strebbaus in Bereich Dilsburg und Abschätzung der Schwinggeschwindigkeit durch Grubenwasseranstieg bis auf -320 mnn. Bruchfläche A (km 2 ) Schwinggeschwindigkeit vs,max (mm/s) Größtes Ereignis oberhalb Flöz während Abbau am Geschätztes, größtes Ereignis während Grubenwasseranstieg bei einem aktivierten Anteil von 2,4% Geschätztes, größtes Ereignis während Grubenwasseranstieg bei einem aktivierten Anteil von 16% 0,36 3,6 71,3 Bruchfläche A (km 2 ) Berechnete ML (Gl. 12) Berechnete vs,max (mm/s) (Gl. 13) 0,009 2,0 0,9 0,05 2,8 7,7 11. Modellrechnung der Magnituden und Schwinggeschwindigkeiten aus Auslösungsmechanismen durch Grubenwasseranstieg in der Umgebung des Nordfelds Während des Grubenwasseranstiegs wurden im Bereich Nordfeld 5 Erschütterungen registriert (Tab. 2). Während des Abbaus wurden im Bereich Nordfeld ( ) 85 Erschütterungen registriert. Die Daten sind in Tabelle 11 zusammengestellt. Die Häufigkeitsverteilungen der Schwinggeschwindigkeiten und der nach Gleichung (11) berechneten Magnituden sind in Abbildungen 28 und 29 dargestellt. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 36 von 50
37 Tab. 11 Max. Schwinggeschwindigkeiten vs,max (mm/s) während des Abbaus und während des Grubenwasseranstiegs im Bereich Nordfeld. Nordfeld Abbau Nordfeld Grubenwasseranstieg Datensätze 85 5 Zeitdauer 1755 d 1322 d Mittelwert 3,584 0,291 Median 1,258 0,327 Minimum 0,267 0,053 Maximum 23,431 0, während Abbau während Grubenwasseranstieg Häufigkeit maximale Schwinggeschwindigkeit v s,max (mm/s) Abb. 28 Häufigkeit der Magnituden während des Abbaus und des Grubenwasseranstiegs im Nordfeld. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 37 von 50
38 während Abbau während Grubenwasseranstieg Häufigkeit ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Magnitude M L Abb. 29 Häufigkeit der berechneten Bruchflächen während des Abbaus und des Grubenwasseranstiegs im Nordfeld. Das größte Ereignis im Bereich Nordfeld während des Grubenwasseranstiegs wurde am mit einer Schwinggeschwindigkeit vs,max = 0,616 mm/s registriert. Das Flöz Grangeleisen liegt in diesem Bereich zwischen -700 und -900 mnn. Der Grubenwasserstand im Nordschacht am lag bei -1144,7 mnn. Somit ist davon auszugehen, dass das durch Grubenwasseranstieg ausgelöste Ereignis unterhalb des Flöz lag. Das größte Ereignis vs,max = 23,4 (mm/s) während des Abbaus trat unterhalb oder nahe des Flöz Grangeleisen am im Bereich der Bauhöhe 20.5 Ost auf. Die Lokalisierung des Ereignisses legte nahe, dass durch Spannungsumlagerungen in einem Pfeiler dieses Ereignis unterhalb von Flöz Grangeleisen stattfand. Die fünf Ereignisse aus dem Grubenwasseranstieg wurden (s. Abb. 9) ausserhalb der Bauhöhen lokalisiert. Ein Vergleich der Ereignisse während des Abbaus und des Grubenwassersanstiegs ist deshalb nicht möglich. Zudem erlaubt die geringe Anzahl von Ereignissen während des Grubenwassersanstiegs (n = 5) keine statistisch fundierten Aussagen. Wird jedoch wie in Abschnitt 8 (Primsmulde) ein aktivierter Flächenanteil von Schwächezonen von 16 % angesetzt, dann sind die in Tabelle 12 gezeigten Schwinggeschwindigkeiten beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn möglich. Wird wie beim Feld Primsmulde von einem aktivierten Flächenanteil einer Schwächezone von 16 % ausgegangen, so berechnen sich Erschütterungen im Bereich Nordfeld mit einer maximalen Schwinggeschwindigkeit vs,max =2,5 mm/s beim Grubenwasseranstieg bis auf -320 mnn. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 38 von 50
39 Tab. 12 Größtes Ereignis im Bereich Nordfeld während des Strebbaus und Abschätzung der Schwinggeschwindigkeit durch Grubenwasseranstieg bis auf -320 mnn. Größtes Ereignis während Abbau am Geschätztes, größtes Ereignis während Grubenwasseranstieg bei einem aktivierten Anteil von 16 % Bruchfläche A (km 2 ) Abgeschätzte ML (Gl. 12) Abgeschätzte vs,max (mm/s) (Gl. 13) 0,134 3,2 23,4 Bruchfläche A (km 2 ) Berechnete ML (Gl. 12) Berechnete vs,max (mm/s) (Gl. 13) 0,021 2,4 2,5 12. Abschätzung der Magnituden und Schwinggeschwindigkeiten aus Auslösungsmechanismen durch Grubenwasseranstieg in der Umgebung des Sprungs Die Ereignisse in der Umgebung des Sprungs stellen eine Besonderheit dar, da während des aktiven Bergbaus in der Wasserprovinz Duhamel keine Ereignisse in diesem Bereich registriert wurden. Deshalb ist es möglich, aus den Ereignissen während des Grubenwasseranstiegs Rückschlusse auf mögliche weitere Ereignisse bei weiterem Anstieg bis auf -320 mnn im nicht vom Bergbau beeinflussten Gebirge zu ziehen. Im Bereich Sprung wurden 65 Ereignisse im Zeitraum bis registriert. Die Messdaten sind in Tabelle 13 dargestellt und in Abbildung 30 bis 32 visualisiert. Tab. 13 Max. Schwinggeschwindigkeiten (mm/s) vom bis im Bereich des Sprungs. Sprung Datensätze 65 Mittelwert 0,047 Median 0,012 Minimum 0,003 Maximum 0,790 Der Grubenwasserstand im Nordschacht stieg im Ereigniszeitraum von ca mnn ( ) auf mnn ( ). Nur zu Beginn des Anstiegs trat ein einzelnes Ereignis mit vs,max = 0,79 mm/s auf, sonst lagen alle Ereignisse unter vs,max = 0,2 mm/s. Eine geringe Anzahl von Ereignissen wurde direkt am Sprung lokalisiert (Abb. 9). Die meisten Ereignisse erstrecken in Richtung WSW - ENE und folgten vermutlich Schwächezonen im variskischem Streichen SW - NE. Diese bevorzugte Ausrichtung von seismischen Ereignissen wurde schon beim Abbau der Primsmulde festgestellt (Alber und Fritschen, 2011) und scheint sich im nicht vom Bergbau beeinflussten Gebiet zu bestätigen. Die geringe Anzahl Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 39 von 50
40 von Ereignissen in direkter Nähe zum Sprung bestätigt die in Abschnitt 4.1 getätigte Aussage, dass nur Schwächezone mit mehreren versetzten Trennflächen und Materialbrücken Erschütterungspotential aufweisen. maximale Schwinggeschwindigkeit v s,max (mm/s) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Schwinggeschwindigkeit Grubenwasserstand Grubenwasserstand Nordschacht (mnn) Datum Abb. 30 Verlauf des Grubenwasseranstiegs im Nordschacht und Schwinggeschwindigkeiten im Bereich des Sprungs Häufigkeit ,0 0,2 0,4 0,6 0,8 maximale Schwinggeschwindigkeiten v s,max (mm/s) Abb. 31 Häufigkeitsverteilung der maximalen Schwinggeschwindigkeiten in der Umgebung des Sprungs beim Grubenwasseranstieg Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 40 von 50
41 Häufigkeit ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Magnituden M L Abb. 32 Häufigkeitsverteilung der Magnituden in der Umgebung des Sprungs beim Grubenwasseranstieg Die Analyse der Ereignisse im Bereich des Sprungs legt den Schluss nahe, dass kritisch gespannte Schwächezonen im vom Bergbau unbeeinflussten Bereich bei Wasserdruckerhöhung mit Ereignissen bis zu einer Grössenordnung vs,max = 1 mm/s reagieren. 13. Magnituden und Schwinggeschwindigkeiten aus Auslösungsmechanismen durch Grubenwasseranstieg der nicht zugeordneten und nicht lokalisierten Ereignisse Tabelle 2 weist 179 Ereignisse aus, die entweder nicht in unmittelbarer Umgebung der Baufelder oder des Sprungs waren (10 Ereignisse) oder nicht lokalisiert werden konnten (169 Ereignisse). Die Verteilungen von Schwinggeschwindigkeiten und Magnituden sind in Abildungen 33 und 34 dargestellt. Diese Ereignisse weisen keine ungewöhnlichen Eigenschaften auf (z.b. Extrema) und folgen den Verteilungen der zugeordneten Ereignisse (Abb. 35 und 36). Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 41 von 50
42 Häufigkeit ,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 maximale Schwinggeschwindigkeit v s,max (mm/s) Abb. 33 Häufigkeitsverteilung der max. Schwinggeschwindigkeiten der nicht zugeordneten oder nicht lokalisierten Ereignisse Häufigkeit ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Magnitude M L Abb. 34 Häufigkeitsverteilung der Magnituden der nicht zugeordneten oder nicht lokalisierten Ereignisse. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 42 von 50
43 Häufigkeit Nordfeld Primsmulde Dilsburg Sprung o. Zuordnung / o. Lokalisierung ,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 7,5 maximale Schwinggeschwindigkeit v s,max (mm/s) Abb. 35 Häufigkeiten von maximalen Schwinggeschwindigkeiten aller Bereich in der Wasserprovinz Duhamel während Grubenwasseranstiegs im Zeitraum Nordfeld Primsmulde Dilsburg Sprung o. Zuordnung / o. Lokalisierung Häufigkeit ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Magnitude M L Abb. 36 Häufigkeiten der Magnituden aller Bereich in der Wasserprovinz Duhamel während Grubenwasseranstiegs im Zeitraum Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 43 von 50
44 14. Erschütterungen während des Grubenwasseranstiegs auf -320 mnn in der Wasserprovinz Reden In der Wasserprovinz Reden sind die Bereiche (Box-Modell der DMT) Dilsburgfeld, Göttelborn, Maybach, Reden, Dechen, Schiffweiler, Kohlwald, König und Frankenholz vom Grubenwasseranstieg bis -320 mnn betroffen (siehe Abb. 5). Der Kohlenbergbau entwickelte sich von tages- und oberflächennahen Bergbau im SE Bereich der Wasserprovinz Reden hin zu größeren Teufen (bis ca mnn) in NW und N Teil der Wasserprovinz. Zechenstilllegungen fanden seit 1930 statt und in den SE Bereichen wurde seit 1969 nicht mehr Kohlen abgebaut. Das Verbundbergwerk Göttelborn / Reden schloss 2000 und die Privatgrube der Dr. A. Schäfer GmbH in Die abgebaute Mächtigkeit ist für den Bergbau ab 1969 bekannt und Durchbauungsgrade von 1 bis 20 werden von DMT (2016) beschrieben (Abb. 37). Während des aktiven Kohlenbergbaus wurden kein Monitoring bezüglich Erschütterungen durchgeführt und es sind weder aus dem Bergbau vor 1969 oder bis 2002 schriftliche oder mündliche Überlieferungen zu Erschütterungen bekannt. Dier bezogenen Grubenwasserstände (Januar 2016) sind in der Wasserprovinz Reden heterogen (Abb. 38). So sind schon zahlreiche Baufelder abgesoffen und weitere werden durch den Grubenwasseranstieg bis -320 mnn betroffen sein. Abbildung 39 stellt die schon vom Grubenwasseranstieg betroffenen und vom Grubenwasseranstieg bis -320 mnn noch betroffenen Baufelder dar. Bei dem bisherigen Anstieg des Grubenwassers auf die in Abbildung 38 gezeigten Grubenwasserstände sind keine schriftlichen oder mündlichen Überlieferungen zu Erschütterungen bekannt. Abb. 37 Durchbauungsgrad in der Wasserprovinz Reden. Veränderter Auszug aus DMT (2016), Anlage 4. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 44 von 50
45 Abb. 38 Grubenwasserniveau in der Wasserprovinz Reden (Stand Januar 2016).Veränderter Auszug aus IHS (2016), Anlage 8. Abb. 39 Schon vom Grubenwasseranstieg betroffene (blaue Linien) oder noch von Anstieg bis auf -320 mnn betroffene Baufelder (rote Linien). Die grünen Linien umgrenzen die einzelnen Bereichen im hydraulischen Box-Modell der DMT. Veränderter Auszug aus IHS (2016), Anlage 5. Im Folgenden wird die Möglichkeit von Erschütterungen für die in Abbildung 38 gezeigten Boxen diskutiert. Zur Bewertung des Erschütterungspotentials gehen zwei Merkmale ein: Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 45 von 50
46 Durchbauungsgrad: Eine Durchbauung beeinflusst das Gebirge und lockert dieses auf. Bei einem hohen Durchbauungsgrad ist das Gebirge stark aufgelockert und es wird somit kaum Schwächezonen beinhalten, die noch zu seismogenem Versagen fähig sind. Grubenwasserstand bzw. weitere Anstiegshöhe bis zur Zielhöhe: Je größer der Anstiegsbetrag, desto höher sind die wirkenden Wasserdrücke im Gebirge. Aus beiden Merkmalen wird der Quotient Anstiegshöhe / Durchbauungsgrad berechnet. Damit wird ein numerischer Wert für das Erschütterungspotential festgelegt. Die Bewertung des Erschütterungspotentials für die Wasserprovinz Reden ist in Tabelle 14 zusammengefasst. Tab. 14 Erschütterungspotential beim Grubenwasseranstieg in der Wasserprovinz Reden. Wasserstand (1.2016) A Weiterer Anstieg B durchschn. Durchbauung Quotient A/B Box (mnn) (m) ( - ) ( - ) Erschütterungspotential Frankenholz kein Schiffweiler kein König gering Kohlwald kein Dechen kein Reden gering Maybach sehr gering Göttelborn E Teil sehr gering Göttelborn NW Teil gering Das Gebirge in der Wasserprovinz Reden ist durch zahlreiche Störungen gekennzeichnet (IHS 2016, Anhang 1). Durch ihre meist hohen Versatzbeträge weisen die Störungen wahrscheinlich keine Materialbrücken sowie geringe Reibungswinkel auf und Verschiebungen auf diesen Störungen werden vermutlich aseismisch sein (vgl. Abschnitt 4.1). Vor allem im E Bereich der Wasserprovinz Reden ist auf Grund der hohen Durchbauungsgrade und der großen Anzahl an tektonischen Elementen von meist gering beanspruchten Störungen auszugehen. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 46 von 50
47 15. Zusammenfassung Die erste Fragestellung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn in den Wasserprovinzen Duhamel und Reden lautet: Ist das Auftreten von Erschütterungen an den Grubenwasseranstieg gekoppelt? Für die Wasserprovinz Duhamel besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Grubenwasseranstieg und Erschütterungen. Aus Abbildung 7 ist ersichtlich, dass das Gebirge sofort mit seismischen Ereignissen auf Grubenwasseranstieg im Nordschacht reagiert. Dabei scheint die Anstiegsrate (s. Abb. 7) selbst keine Rolle zu spielen. Auch in Phase 4 in Abbildung 6, dem Anstieg des Grubenwasserstands um ca. 3 cm/tag im Nordschacht durch Infiltration von Oberflächenwasser, wurden Erschütterungen, wenn auch sehr geringe, registriert. In der Wasserprovinz Reden sind beim bisherigen Grubenwasseranstieg keine Erschütterungen bekannt geworden. Die zweite Fragestellung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn in den Wasserprovinzen Duhamel und Reden lautet: Welche Schwinggeschwindigkeiten durch Erschütterung können beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel erwartet werden? In der Wasserprovinz Duhamel ist beim Anstieg des Grubenwassers (von -1072,7 mnn im Nordschacht, Stand ) auf -320 mnn mit Erschütterungen zu rechnen. Beim bisherigen Grubenwasseranstieg von -1427,6 mnn ( ) auf -1072,7 mnn ( ) wurden 383 Erschütterungen registriert (Tab. 1, Abb. 8). Viele dieser Erschütterungen konnten Abbaubereichen zugeordnet werden (Tab. 2, Abb. 9). Während des Abbaus in der Primsmulde wurden durch Spannungsumlagerungen Schwächezonen im Gebirge beansprucht und führten zu Erschütterungen. Erschütterungen in diesem Bereich während des Grubenwasseranstiegs legen den Schluss nahe, dass wieder Schwächezonen aktiviert wurden. Die Erschütterungen beim Grubenwasseranstieg bis auf mnn waren deutlich geringer als beim Abbau. Die Größe der berechneten Versagensflächen beim Grubenwasseranstieg liegt bei ca. 1/6 der Größe der Versagensflächen beim Abbau. Die erwartete Erschütterungsentwicklung in den Abbaubereichen der Wasserprovinz Duhamel beim Grubenwasseranstieg bis auf -320 mnn ist in Tabelle 15 zusammengefasst. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 47 von 50
48 Tab. 15 Erwartete Erschütterungsentwicklung in der Wasserprovinz Duhamel beim Grubenwasseranstieg bis auf -320 mnn. Stärkstes Ereignis während Abbau Erwartetes maximales Erwartete maximale Schwinggeschwindigkeit beim Gruben- Ereignis beim Grubenwasseranstiewasseranstieg Bereich Primsmulde ML = 4,0 ML = 3,2 23 mm/s Dilsburg ML = 3,6 ML = 2 2,8 1 8 mm/s Nordfeld ML = 3,2 ML = 2,4 2,5 mm/s Sprung - ML = 1,9 0,5 mm/s Aus den Analysen der abbaubedingten Erschütterungen ( ) und der Erschütterungen aus dem Anstieg des Grubenwassers bis -1072,7 mnn ( ) beziehen sich die oben genannten Aussagen auf das Verhalten von Schwächezonen im Teufenbereich von 1600 mnn bis ca mnn. Der geplante Grubenwasseranstieg bis auf -320 m NN wird bisher inaktive Schwächezonen in diesem seichteren Teufenbereich beanspruchen und ggf. zum Versagen bringen. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass Schwächezonen in diesem Teufenbereich mit höheren Magnituden und Schwinggeschwindigkeiten versagen. Die in-situ Gebirgsspannungen werden mit geringerer Teufe abnehmen und die für Scherspannungen verantwortlichen Differenzspannungen werden somit geringer. Weiterhin sind Schwächezonen in geringeren Teufen meist kohäsionslos und versagen meist aseismisch. Knoll (2016, S. 14) arbeitete die Erfahrungen mit Erschütterungen aus dem gut dokumentierten Grubenwasseranstieg in der Lagerstätte Schlema/Alberoda auf und folgert, dass flutungsbedingte Ereignisse etwa eine Magnitudeneinheit unterhalb jener der rein bergbaulichen Ereignisse..lagen. Diese Aussage kann aus den Erfahrungen und Analysen beim Abbau und dem Grubenwasseranstieg im der Wasserprovinz Duhamel in Abbildung 40 quantitativ belegt werden. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 48 von 50
49 beim Abbau beim Grubenwasseranstieg Magnituden M L Abb. 40 Boxplots der Magnituden aller Erschütterungen beim Abbau und beim Grubenwasseranstieg in der Wasserprovinz Duhamel. In der Wasserprovinz Reden sind beim bisherigen Grubenwasseranstieg keine Erschütterungen wahrgenommen geworden. In dieser Wasserprovinz werden vermutlich ausschließlich aseismische Störungen angetroffen. Es ist daher davon auszugehe, dass keine Erschütterungen beim weiteren Grubenwasseranstieg auftreten werden bzw. dass das Potential für Erschütterungen gering ist. Die dritte Fragestellung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn in den Wasserprovinzen Duhamel und Reden lautet: Ist nach Beendigung des Grubenwasseranstiegs auf -320 mnn in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel das Auftreten weiterer Erschütterungen ausgeschlossen? In der Wasserprovinz Duhamel wurde der Grubenwasserstand im Zeitraum vom bis gezielt bis auf -1092,2 mnn erhöht. Bis zum erhöhte sich durch Infiltration von Oberflächenwasser im Gebirgskörper der Grubenwasserstand im Nordschacht auf -1072,7 mnn. In diesem Zeitraum traten noch 13 weitere Erschütterungen (vgl. Abb. 7) mit Schwinggeschwindigkeiten bis vs,max = 0,3 mm/s auf. Nach dem Erreichen des Grubenwasserstandes auf einem Niveau von -320 mnn in der Wasserprovinz Duhamel ist ohne technische Maßnahmen ein langsamer Anstieg des Wasserstands gemäß Abbildung 7 zu erwarten. Dabei sind Erschütterungen in der Größenordnung vs,max < 1 mm/s gemäß Abbildung 7 zu erwarten. Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 49 von 50
50 Der Grubenwasserstand auf Niveau von -320 mnn in der Wasserprovinz Reden wird durch technische Maßnahmen gehalten. In der Wasserprovinz Reden sind beim bisherigen Grubenwasseranstieg keine Erschütterungen wahrgenommen geworden. Es ist davon auszugehen, dass keine wahrnehmbaren Erschütterungen selbst bei einem weiteren Grubenwasseranstieg auftreten. Dortmund, den 22. März 2017 Prof. Dr.-Ing. Michael Alber Gutachten zur Erschütterungsentwicklung beim Grubenwasseranstieg auf -320 mnn Seite 50 von 50
Fachliche Plausibilitätsprüfung
 Fachliche Plausibilitätsprüfung der Begutachtung der Erschütterungsproblematik im Rahmen des bergrechtlichen Planfeststellungsverfahrens mit Umweltverträglichkeitsprüfung zum Ansteigenlassen des Grubenwasserspiegels
Fachliche Plausibilitätsprüfung der Begutachtung der Erschütterungsproblematik im Rahmen des bergrechtlichen Planfeststellungsverfahrens mit Umweltverträglichkeitsprüfung zum Ansteigenlassen des Grubenwasserspiegels
Übungen mit dem Applet
 Übungen mit dem Applet 1. Visualisierung der Verteilungsform... 1.1. Normalverteilung... 1.. t-verteilung... 1.3. χ -Verteilung... 1.4. F-Verteilung...3. Berechnung von Wahrscheinlichkeiten...3.1. Visualisierung
Übungen mit dem Applet 1. Visualisierung der Verteilungsform... 1.1. Normalverteilung... 1.. t-verteilung... 1.3. χ -Verteilung... 1.4. F-Verteilung...3. Berechnung von Wahrscheinlichkeiten...3.1. Visualisierung
Konkretes Durchführen einer Inferenzstatistik
 Konkretes Durchführen einer Inferenzstatistik Die Frage ist, welche inferenzstatistischen Schlüsse bei einer kontinuierlichen Variablen - Beispiel: Reaktionszeit gemessen in ms - von der Stichprobe auf
Konkretes Durchführen einer Inferenzstatistik Die Frage ist, welche inferenzstatistischen Schlüsse bei einer kontinuierlichen Variablen - Beispiel: Reaktionszeit gemessen in ms - von der Stichprobe auf
Prof. Dr. -Ing. habil. Heinz Konietzky, Dipl.-Geophys. Reinhard Mittag, Dipl.-Geophys. Holger Schütz
 EP 7: Prognose der möglichen induzierten / getriggerten Seismizität im Kristallin in Auswertung der flutungsbedingten seismischen Ereignisse im Bergbaurevier Aue/Schlema Prof. Dr. -Ing. habil. Heinz Konietzky,
EP 7: Prognose der möglichen induzierten / getriggerten Seismizität im Kristallin in Auswertung der flutungsbedingten seismischen Ereignisse im Bergbaurevier Aue/Schlema Prof. Dr. -Ing. habil. Heinz Konietzky,
Anpassungstests VORGEHENSWEISE
 Anpassungstests Anpassungstests prüfen, wie sehr sich ein bestimmter Datensatz einer erwarteten Verteilung anpasst bzw. von dieser abweicht. Nach der Erläuterung der Funktionsweise sind je ein Beispiel
Anpassungstests Anpassungstests prüfen, wie sehr sich ein bestimmter Datensatz einer erwarteten Verteilung anpasst bzw. von dieser abweicht. Nach der Erläuterung der Funktionsweise sind je ein Beispiel
Bergamt Moers Rheinbergerstr Moers
 Bergamt Moers Rheinbergerstr. 194 47445 Moers 24. 3. 2003 Bergwerk West Sonderbetriebsplan über Abbaueinwirkungen auf das Oberflächeneigentum Anbei übersenden wir Ihnen in dreifacher Ausfertigung den geänderten
Bergamt Moers Rheinbergerstr. 194 47445 Moers 24. 3. 2003 Bergwerk West Sonderbetriebsplan über Abbaueinwirkungen auf das Oberflächeneigentum Anbei übersenden wir Ihnen in dreifacher Ausfertigung den geänderten
1. Induzierte Seismizität in Deutschland 2. Fluid-induzierte Seismizität 3. Maßnahmen zur Begrenzung der Seismizität
 Induzierte Seismizität im Oberrheingraben: Beispiele, Methoden und Konzepte eines Warnsystems Ulrich Wegler, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 1. Induzierte Seismizität in Deutschland 2.
Induzierte Seismizität im Oberrheingraben: Beispiele, Methoden und Konzepte eines Warnsystems Ulrich Wegler, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 1. Induzierte Seismizität in Deutschland 2.
Forschungsstatistik I
 Psychologie Prof. Dr. G. Meinhardt 6. Stock, TB II R. 06-206 (Persike) R. 06-321 (Meinhardt) Sprechstunde jederzeit nach Vereinbarung Forschungsstatistik I Dr. Malte Persike persike@uni-mainz.de http://psymet03.sowi.uni-mainz.de/
Psychologie Prof. Dr. G. Meinhardt 6. Stock, TB II R. 06-206 (Persike) R. 06-321 (Meinhardt) Sprechstunde jederzeit nach Vereinbarung Forschungsstatistik I Dr. Malte Persike persike@uni-mainz.de http://psymet03.sowi.uni-mainz.de/
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung
 Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung 3. Vorlesung Dr. Jochen Köhler 1 Inhalte der heutigen Vorlesung Ziel: Daten Modellbildung Probabilistisches Modell Wahrscheinlichkeit von Ereignissen Im ersten
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung 3. Vorlesung Dr. Jochen Köhler 1 Inhalte der heutigen Vorlesung Ziel: Daten Modellbildung Probabilistisches Modell Wahrscheinlichkeit von Ereignissen Im ersten
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung
 Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Übung 7 1 Inhalt der heutigen Übung Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Vorrechnen der Hausübung D.9 Gemeinsames Lösen der Übungsaufgaben D.10: Poissonprozess
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Übung 7 1 Inhalt der heutigen Übung Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Vorrechnen der Hausübung D.9 Gemeinsames Lösen der Übungsaufgaben D.10: Poissonprozess
Deskriptive Statistik
 Deskriptive Statistik Deskriptive Statistik: Ziele Daten zusammenfassen durch numerische Kennzahlen. Grafische Darstellung der Daten. Quelle: Ursus Wehrli, Kunst aufräumen 1 Modell vs. Daten Bis jetzt
Deskriptive Statistik Deskriptive Statistik: Ziele Daten zusammenfassen durch numerische Kennzahlen. Grafische Darstellung der Daten. Quelle: Ursus Wehrli, Kunst aufräumen 1 Modell vs. Daten Bis jetzt
Phallosan-Studie. Statistischer Bericht
 Phallosan-Studie Statistischer Bericht Verfasser: Dr. Clemens Tilke 15.04.2005 1/36 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 Einleitung... 3 Alter der Patienten... 4 Körpergewicht... 6 Penisumfang...
Phallosan-Studie Statistischer Bericht Verfasser: Dr. Clemens Tilke 15.04.2005 1/36 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 Einleitung... 3 Alter der Patienten... 4 Körpergewicht... 6 Penisumfang...
BOXPLOT 1. Begründung. Boxplot A B C
 BOXPLOT 1 In nachstehender Tabelle sind drei sortierte Datenreihen gegeben. Zu welchem Boxplot gehört die jeweilige Datenreihe? Kreuze an und begründe Deine Entscheidung! Boxplot A B C Begründung 1 1 1
BOXPLOT 1 In nachstehender Tabelle sind drei sortierte Datenreihen gegeben. Zu welchem Boxplot gehört die jeweilige Datenreihe? Kreuze an und begründe Deine Entscheidung! Boxplot A B C Begründung 1 1 1
Physik 4 Praktikum Auswertung Hall-Effekt
 Physik 4 Praktikum Auswertung Hall-Effekt Von J.W., I.G. 2014 Seite 1. Kurzfassung......... 2 2. Theorie.......... 2 2.1. Elektrischer Strom in Halbleitern..... 2 2.2. Hall-Effekt......... 3 3. Durchführung.........
Physik 4 Praktikum Auswertung Hall-Effekt Von J.W., I.G. 2014 Seite 1. Kurzfassung......... 2 2. Theorie.......... 2 2.1. Elektrischer Strom in Halbleitern..... 2 2.2. Hall-Effekt......... 3 3. Durchführung.........
Hypothesen: Fehler 1. und 2. Art, Power eines statistischen Tests
 ue biostatistik: hypothesen, fehler 1. und. art, power 1/8 h. lettner / physik Hypothesen: Fehler 1. und. Art, Power eines statistischen Tests Die äußerst wichtige Tabelle über die Zusammenhänge zwischen
ue biostatistik: hypothesen, fehler 1. und. art, power 1/8 h. lettner / physik Hypothesen: Fehler 1. und. Art, Power eines statistischen Tests Die äußerst wichtige Tabelle über die Zusammenhänge zwischen
Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel II Statistische Verfahren I. WS 2009/2010 Kapitel 2.0
 Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel II Statistische Verfahren I WS 009/010 Kapitel.0 Schritt 1: Bestimmen der relevanten Kenngrößen Kennwerte Einflussgrößen Typ A/Typ B einzeln im ersten Schritt werden
Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel II Statistische Verfahren I WS 009/010 Kapitel.0 Schritt 1: Bestimmen der relevanten Kenngrößen Kennwerte Einflussgrößen Typ A/Typ B einzeln im ersten Schritt werden
1) Warum ist die Lage einer Verteilung für das Ergebnis einer statistischen Analyse von Bedeutung?
 86 8. Lageparameter Leitfragen 1) Warum ist die Lage einer Verteilung für das Ergebnis einer statistischen Analyse von Bedeutung? 2) Was ist der Unterschied zwischen Parametern der Lage und der Streuung?
86 8. Lageparameter Leitfragen 1) Warum ist die Lage einer Verteilung für das Ergebnis einer statistischen Analyse von Bedeutung? 2) Was ist der Unterschied zwischen Parametern der Lage und der Streuung?
Schwierigkeiten und Probleme bei der Bestimmung physikalischer Laborwerte in der Felsmechanik
 Vortrag am 20.10. 2000 15:00-15:30 Schwierigkeiten und Probleme bei der Bestimmung physikalischer Laborwerte in der Felsmechanik von E. Werthmann* Der innere Reibungswinkel und die Kohäsion sind in der
Vortrag am 20.10. 2000 15:00-15:30 Schwierigkeiten und Probleme bei der Bestimmung physikalischer Laborwerte in der Felsmechanik von E. Werthmann* Der innere Reibungswinkel und die Kohäsion sind in der
WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG
 WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG Mathematischer Teil In der Wahrscheinlichkeitsrechnung haben wir es mit Zufallsexperimenten zu tun, d.h. Ausgang nicht vorhersagbar. Grundbegriffe Zufallsexperiment und Ergebnisse
WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG Mathematischer Teil In der Wahrscheinlichkeitsrechnung haben wir es mit Zufallsexperimenten zu tun, d.h. Ausgang nicht vorhersagbar. Grundbegriffe Zufallsexperiment und Ergebnisse
Kapitel 2. Mittelwerte
 Kapitel 2. Mittelwerte Im Zusammenhang mit dem Begriff der Verteilung, der im ersten Kapitel eingeführt wurde, taucht häufig die Frage auf, wie man die vorliegenden Daten durch eine geeignete Größe repräsentieren
Kapitel 2. Mittelwerte Im Zusammenhang mit dem Begriff der Verteilung, der im ersten Kapitel eingeführt wurde, taucht häufig die Frage auf, wie man die vorliegenden Daten durch eine geeignete Größe repräsentieren
Tabelle 1: Altersverteilung der Patienten (n = 42) in Jahren
 3. Ergebnisse Die 42 Patienten (w= 16, m= 26) hatten ein Durchschnittsalter von 53,5 Jahren mit einem Minimum von und einem Maximum von 79 Jahren. Die 3 Patientengruppen zeigten hinsichtlich Alters- und
3. Ergebnisse Die 42 Patienten (w= 16, m= 26) hatten ein Durchschnittsalter von 53,5 Jahren mit einem Minimum von und einem Maximum von 79 Jahren. Die 3 Patientengruppen zeigten hinsichtlich Alters- und
Die erhobenen Daten werden zunächst in einer Urliste angeschrieben. Daraus ermittelt man:
 Die erhobenen Daten werden zunächst in einer Urliste angeschrieben. Daraus ermittelt man: a) Die absoluten Häufigkeit: Sie gibt an, wie oft ein Variablenwert vorkommt b) Die relative Häufigkeit: Sie erhält
Die erhobenen Daten werden zunächst in einer Urliste angeschrieben. Daraus ermittelt man: a) Die absoluten Häufigkeit: Sie gibt an, wie oft ein Variablenwert vorkommt b) Die relative Häufigkeit: Sie erhält
- Normalverteilung (Gaußverteilung) kann auf sehr viele Zufallsprozesse angewendet werden.
 Normalverteilung und Standardnormalverteilung als Beispiel einer theoretischen Verteilung - Normalverteilung (Gaußverteilung) kann auf sehr viele Zufallsprozesse angewendet werden. - Stetige (kontinuierliche),
Normalverteilung und Standardnormalverteilung als Beispiel einer theoretischen Verteilung - Normalverteilung (Gaußverteilung) kann auf sehr viele Zufallsprozesse angewendet werden. - Stetige (kontinuierliche),
1 Lambert-Beersches Gesetz
 Physikalische Chemie II Lösung 6 23. Oktober 205 Lambert-Beersches Gesetz Anhand des idealen Gasgesetzes lässt sich die Teilchenkonzentration C wie folgt ausrechnen: C = N V = n N A V pv =nrt = N A p R
Physikalische Chemie II Lösung 6 23. Oktober 205 Lambert-Beersches Gesetz Anhand des idealen Gasgesetzes lässt sich die Teilchenkonzentration C wie folgt ausrechnen: C = N V = n N A V pv =nrt = N A p R
Grubenwasserkonzept Saar
 Grubenwasserkonzept Saar 26. 1 Zentrale Wasserhaltungen Grubenwassersituation 2013 0,2 650 Köllerbach Viktoria 1,9 400 Fischbach 13,9 900 Camphausen 1,7 750 Blies Luisenthal 0,3 350 Saar 13,9 900 Zentrale
Grubenwasserkonzept Saar 26. 1 Zentrale Wasserhaltungen Grubenwassersituation 2013 0,2 650 Köllerbach Viktoria 1,9 400 Fischbach 13,9 900 Camphausen 1,7 750 Blies Luisenthal 0,3 350 Saar 13,9 900 Zentrale
Meteoroid von Tscheljabinsk: Bahnberechnung im Unterricht
 Meteoroid von Tscheljabinsk: Bahnberechnung im Unterricht In Bezug auf Aktuelles am Himmel: Das Sonnensystem / Meteore: Mai-Aquariden in der Zeitschrift»Sterne und Weltraum«5/2015. (Die Mai-Aquariden (19.
Meteoroid von Tscheljabinsk: Bahnberechnung im Unterricht In Bezug auf Aktuelles am Himmel: Das Sonnensystem / Meteore: Mai-Aquariden in der Zeitschrift»Sterne und Weltraum«5/2015. (Die Mai-Aquariden (19.
Wahrscheinlichkeitsverteilungen
 Universität Bielefeld 3. Mai 2005 Wahrscheinlichkeitsrechnung Wahrscheinlichkeitsrechnung Das Ziehen einer Stichprobe ist die Realisierung eines Zufallsexperimentes. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung betrachtet
Universität Bielefeld 3. Mai 2005 Wahrscheinlichkeitsrechnung Wahrscheinlichkeitsrechnung Das Ziehen einer Stichprobe ist die Realisierung eines Zufallsexperimentes. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung betrachtet
Um die Güte die EZMW Prognosen abzuschätzen, wurden 2 Datensätze verwendet:
 Kapitel 3 Niederschlagsdaten und Niederschlagsstatistik Um die Güte die EZMW Prognosen abzuschätzen, wurden 2 Datensätze verwendet: Beobachtungsdaten von der Niederschlagsstationen im ganzen Iran EZMW-Niederschlagsprognosen
Kapitel 3 Niederschlagsdaten und Niederschlagsstatistik Um die Güte die EZMW Prognosen abzuschätzen, wurden 2 Datensätze verwendet: Beobachtungsdaten von der Niederschlagsstationen im ganzen Iran EZMW-Niederschlagsprognosen
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung
 Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Übung 3 1 Inhalt der heutigen Übung Vorrechnen der Hausübung B.7 Beschreibende Statistik Gemeinsames Lösen der Übungsaufgaben C.1: Häufigkeitsverteilung C.2: Tukey
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Übung 3 1 Inhalt der heutigen Übung Vorrechnen der Hausübung B.7 Beschreibende Statistik Gemeinsames Lösen der Übungsaufgaben C.1: Häufigkeitsverteilung C.2: Tukey
PRAKTIKUM Grundlagen der Messtechnik. VERSUCH GMT 01 Auswertung von Messreihen
 1 Fachbereich: Fachgebiet: Maschinenbau Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Kaufmann PRAKTIKUM Grundlagen der Messtechnik VERSUCH GMT 01 Auswertung von Messreihen Version
1 Fachbereich: Fachgebiet: Maschinenbau Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Kaufmann PRAKTIKUM Grundlagen der Messtechnik VERSUCH GMT 01 Auswertung von Messreihen Version
Übungen mit dem Applet x /s-regelkarte nach Shewhart
 x /s-regelkarte nach Shewhart 1 Übungen mit dem Applet x /s-regelkarte nach Shewhart 1 Statistischer Hintergrund... 2 1.1 Ziel und Vorgehensweise der x /s-regelkarte nach Shewhart...2 1.2 Kurzbeschreibung
x /s-regelkarte nach Shewhart 1 Übungen mit dem Applet x /s-regelkarte nach Shewhart 1 Statistischer Hintergrund... 2 1.1 Ziel und Vorgehensweise der x /s-regelkarte nach Shewhart...2 1.2 Kurzbeschreibung
Demokurs. Modul Grundlagen der Wirtschaftsmathematik Grundlagen der Statistik
 Demokurs Modul 31101 Grundlagen der Wirtschaftsmathematik und Statistik Kurs 40601 Grundlagen der Statistik 13. Juli 2010 KE 1 2.4 Schiefe und Wölbung einer Verteilung Seite: 53 2.4 Schiefe und Wölbung
Demokurs Modul 31101 Grundlagen der Wirtschaftsmathematik und Statistik Kurs 40601 Grundlagen der Statistik 13. Juli 2010 KE 1 2.4 Schiefe und Wölbung einer Verteilung Seite: 53 2.4 Schiefe und Wölbung
1 Grundprinzipien statistischer Schlußweisen
 Grundprinzipien statistischer Schlußweisen - - Grundprinzipien statistischer Schlußweisen Für die Analyse zufallsbehafteter Eingabegrößen und Leistungsparameter in diskreten Systemen durch Computersimulation
Grundprinzipien statistischer Schlußweisen - - Grundprinzipien statistischer Schlußweisen Für die Analyse zufallsbehafteter Eingabegrößen und Leistungsparameter in diskreten Systemen durch Computersimulation
Protokoll Grundpraktikum: O1 Dünne Linsen
 Protokoll Grundpraktikum: O1 Dünne Linsen Sebastian Pfitzner 22. Januar 2013 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Jannis Schürmer (552892) Arbeitsplatz: 3 Betreuer: A. Ahlrichs Versuchsdatum: 16.01.2013
Protokoll Grundpraktikum: O1 Dünne Linsen Sebastian Pfitzner 22. Januar 2013 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Jannis Schürmer (552892) Arbeitsplatz: 3 Betreuer: A. Ahlrichs Versuchsdatum: 16.01.2013
Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 14
 Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 14 Dr. Andreas Wünsche TU Bergakademie Freiberg Institut für Stochastik 13. Juli 017 Dr. Andreas Wünsche Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 14 Version: 8. Juli
Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 14 Dr. Andreas Wünsche TU Bergakademie Freiberg Institut für Stochastik 13. Juli 017 Dr. Andreas Wünsche Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 14 Version: 8. Juli
Byerlee s Law, Heterogenitäten, Energiedichten und die Reduzierung geothermisch verursachter Brüche
 Byerlee s Law, Heterogenitäten, Energiedichten und die Reduzierung geothermisch verursachter Brüche Dr. Winfried Kessels GEO-TIP GmbH; Burgdorf; (geo-tip@t-online.de) Der Geothermiekongress 2010 GTV Jahrestagung
Byerlee s Law, Heterogenitäten, Energiedichten und die Reduzierung geothermisch verursachter Brüche Dr. Winfried Kessels GEO-TIP GmbH; Burgdorf; (geo-tip@t-online.de) Der Geothermiekongress 2010 GTV Jahrestagung
Ergebnisse VitA und VitVM
 Ergebnisse VitA und VitVM 1 Basisparameter... 2 1.1 n... 2 1.2 Alter... 2 1.3 Geschlecht... 5 1.4 Beobachtungszeitraum (von 1. Datum bis letzte in situ)... 9 2 Extraktion... 11 3 Extraktionsgründe... 15
Ergebnisse VitA und VitVM 1 Basisparameter... 2 1.1 n... 2 1.2 Alter... 2 1.3 Geschlecht... 5 1.4 Beobachtungszeitraum (von 1. Datum bis letzte in situ)... 9 2 Extraktion... 11 3 Extraktionsgründe... 15
Probematura Jänner/Februar 2016 Seite 1 / 7
 Probematura Jänner/Februar 2016 Seite 1 / 7 1. Im Casino (20 Punkte) (a) Bei einem Glücksrad beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit 0,3. (3 P) i. Geben Sie eine Formel an, mit der man die Wahrscheinlichkeit
Probematura Jänner/Februar 2016 Seite 1 / 7 1. Im Casino (20 Punkte) (a) Bei einem Glücksrad beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit 0,3. (3 P) i. Geben Sie eine Formel an, mit der man die Wahrscheinlichkeit
Übungen (HS-2010): Urteilsfehler. Autor: Siegfried Macho
 Übungen (HS-2010): Urteilsfehler Autor: Siegfried Macho Inhaltsverzeichnis i Inhaltsverzeichnis 1. Übungen zu Kapitel 2 1 Übungen zu Kontingenz- und Kausalurteile 1 Übung 1-1: 1. Übungen zu Kapitel 2 Gegeben:
Übungen (HS-2010): Urteilsfehler Autor: Siegfried Macho Inhaltsverzeichnis i Inhaltsverzeichnis 1. Übungen zu Kapitel 2 1 Übungen zu Kontingenz- und Kausalurteile 1 Übung 1-1: 1. Übungen zu Kapitel 2 Gegeben:
Die Familie der χ 2 (n)-verteilungen
 Die Familie der χ (n)-verteilungen Sind Z 1,..., Z m für m 1 unabhängig identisch standardnormalverteilte Zufallsvariablen, so genügt die Summe der quadrierten Zufallsvariablen χ := m Z i = Z 1 +... +
Die Familie der χ (n)-verteilungen Sind Z 1,..., Z m für m 1 unabhängig identisch standardnormalverteilte Zufallsvariablen, so genügt die Summe der quadrierten Zufallsvariablen χ := m Z i = Z 1 +... +
7 Ergebnisse der Untersuchungen zur Sprungfreudigkeit der Rammler beim Absamen und zu den spermatologischen Parametern
 Ergebnisse 89 7 Ergebnisse der Untersuchungen zur Sprungfreudigkeit der Rammler beim Absamen und zu den spermatologischen Parametern 7.1 Einfluß des Lichtregimes 7.1.1 Verhalten der Rammler beim Absamen
Ergebnisse 89 7 Ergebnisse der Untersuchungen zur Sprungfreudigkeit der Rammler beim Absamen und zu den spermatologischen Parametern 7.1 Einfluß des Lichtregimes 7.1.1 Verhalten der Rammler beim Absamen
8. Statistik Beispiel Noten. Informationsbestände analysieren Statistik
 Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
Versuch 17: Kennlinie der Vakuum-Diode
 Versuch 17: Kennlinie der Vakuum-Diode Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Theorie 3 2.1 Prinzip der Vakuumdiode.......................... 3 2.2 Anlaufstrom.................................. 3 2.3 Raumladungsgebiet..............................
Versuch 17: Kennlinie der Vakuum-Diode Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Theorie 3 2.1 Prinzip der Vakuumdiode.......................... 3 2.2 Anlaufstrom.................................. 3 2.3 Raumladungsgebiet..............................
Bestimmte Zufallsvariablen sind von Natur aus normalverteilt. - naturwissenschaftliche Variablen: originär z.b. Intelligenz, Körpergröße, Messfehler
 6.6 Normalverteilung Die Normalverteilung kann als das wichtigste Verteilungsmodell der Statistik angesehen werden. Sie wird nach ihrem Entdecker auch Gaußsche Glockenkurve genannt. Die herausragende Stellung
6.6 Normalverteilung Die Normalverteilung kann als das wichtigste Verteilungsmodell der Statistik angesehen werden. Sie wird nach ihrem Entdecker auch Gaußsche Glockenkurve genannt. Die herausragende Stellung
Statistische Auswertung in der Betriebsprüfung
 Dr. Harald Krehl Der Einsatz verteilungsbezogener Verfahren Der Einsatz verteilungsbezogener Verfahren etwa des Benford- Newcomb Verfahrens oder der Normalverteilung bzw. der LogNormalverteilung in der
Dr. Harald Krehl Der Einsatz verteilungsbezogener Verfahren Der Einsatz verteilungsbezogener Verfahren etwa des Benford- Newcomb Verfahrens oder der Normalverteilung bzw. der LogNormalverteilung in der
Sonnenstand abschätzen
 Sonnenstand abschätzen 1. Himmelsrichtung der Sonne 2. Uhrzeit bestimmen 3. Höhenwinkel- und Zenitbestimmung 4. Zeitraum einschränken 5. Fehlerbetrachtung 6. Gesamtergebnis 1. Himmelsrichtung der Sonne
Sonnenstand abschätzen 1. Himmelsrichtung der Sonne 2. Uhrzeit bestimmen 3. Höhenwinkel- und Zenitbestimmung 4. Zeitraum einschränken 5. Fehlerbetrachtung 6. Gesamtergebnis 1. Himmelsrichtung der Sonne
3 Ergebnisse. 3.1 Biegefestigkeit und E-Modul Biegefestigkeit
 differenz zur letzten Wiegung 0,2 mg nicht überschritt (m 3 ). Aus diesen Werten wurden im Anschluss die Wasseraufnahme (W sp ) und die Wasserlöslichkeit (W sl ) berechnet. 3 Ergebnisse Die nachfolgenden
differenz zur letzten Wiegung 0,2 mg nicht überschritt (m 3 ). Aus diesen Werten wurden im Anschluss die Wasseraufnahme (W sp ) und die Wasserlöslichkeit (W sl ) berechnet. 3 Ergebnisse Die nachfolgenden
1.1 Graphische Darstellung von Messdaten und unterschiedliche Mittelwerte. D. Horstmann: Oktober
 1.1 Graphische Darstellung von Messdaten und unterschiedliche Mittelwerte D. Horstmann: Oktober 2014 4 Graphische Darstellung von Daten und unterschiedliche Mittelwerte Eine Umfrage nach der Körpergröße
1.1 Graphische Darstellung von Messdaten und unterschiedliche Mittelwerte D. Horstmann: Oktober 2014 4 Graphische Darstellung von Daten und unterschiedliche Mittelwerte Eine Umfrage nach der Körpergröße
STATISTISCHE MUSTERANALYSE - DARSTELLUNGSVORSCHLAG
 STATISTISCHE MUSTERANALYSE - DARSTELLUNGSVORSCHLAG Statistische Methoden In der vorliegenden fiktiven Musterstudie wurden X Patienten mit XY Syndrom (im folgenden: Gruppe XY) mit Y Patienten eines unauffälligem
STATISTISCHE MUSTERANALYSE - DARSTELLUNGSVORSCHLAG Statistische Methoden In der vorliegenden fiktiven Musterstudie wurden X Patienten mit XY Syndrom (im folgenden: Gruppe XY) mit Y Patienten eines unauffälligem
Parametrische vs. Non-Parametrische Testverfahren
 Parametrische vs. Non-Parametrische Testverfahren Parametrische Verfahren haben die Besonderheit, dass sie auf Annahmen zur Verteilung der Messwerte in der Population beruhen: die Messwerte sollten einer
Parametrische vs. Non-Parametrische Testverfahren Parametrische Verfahren haben die Besonderheit, dass sie auf Annahmen zur Verteilung der Messwerte in der Population beruhen: die Messwerte sollten einer
DMT Fachstelle für Erschütterungsmessungen
 DMT Fachstelle für Erschütterungsmessungen Dr. R. Fritschen Dipl.-Geophys. Leiter der DMT Fachstelle für Erschütterungsmessungen DMT GmbH & Co. KG Exploration & Geosurvey Am Technologiepark 1 45307 Essen
DMT Fachstelle für Erschütterungsmessungen Dr. R. Fritschen Dipl.-Geophys. Leiter der DMT Fachstelle für Erschütterungsmessungen DMT GmbH & Co. KG Exploration & Geosurvey Am Technologiepark 1 45307 Essen
Fadenpendel (M1) Ziel des Versuches. Theoretischer Hintergrund
 Fadenpendel M1) Ziel des Versuches Der Aufbau dieses Versuches ist denkbar einfach: eine Kugel hängt an einem Faden. Der Zusammenhang zwischen der Fadenlänge und der Schwingungsdauer ist nicht schwer zu
Fadenpendel M1) Ziel des Versuches Der Aufbau dieses Versuches ist denkbar einfach: eine Kugel hängt an einem Faden. Der Zusammenhang zwischen der Fadenlänge und der Schwingungsdauer ist nicht schwer zu
73 Hypothesentests Motivation Parametertest am Beispiel eines Münzexperiments
 73 Hypothesentests 73.1 Motivation Bei Hypothesentests will man eine gewisse Annahme über eine Zufallsvariable darauf hin überprüfen, ob sie korrekt ist. Beispiele: ( Ist eine Münze fair p = 1 )? 2 Sind
73 Hypothesentests 73.1 Motivation Bei Hypothesentests will man eine gewisse Annahme über eine Zufallsvariable darauf hin überprüfen, ob sie korrekt ist. Beispiele: ( Ist eine Münze fair p = 1 )? 2 Sind
Cox-Regression. Ausgangspunkt Ansätze zur Modellierung von Einflussgrößen Das Cox-Modell Eigenschaften des Cox-Modells
 Cox-Regression Ausgangspunkt Ansätze zur Modellierung von Einflussgrößen Das Cox-Modell Eigenschaften des Cox-Modells In vielen Fällen interessiert, wie die Survivalfunktion durch Einflussgrößen beeinflusst
Cox-Regression Ausgangspunkt Ansätze zur Modellierung von Einflussgrößen Das Cox-Modell Eigenschaften des Cox-Modells In vielen Fällen interessiert, wie die Survivalfunktion durch Einflussgrößen beeinflusst
Ozonsituation 2009 in der Bundesrepublik Deutschland
 Ozonsituation 2009 in der Bundesrepublik Deutschland Umweltbundesamt, Dezember 2009 Jahresbericht Ozon 2009 1 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Einleitung 2 1.1 Informationen zu Schwellen- und Zielwerten 2 1.2
Ozonsituation 2009 in der Bundesrepublik Deutschland Umweltbundesamt, Dezember 2009 Jahresbericht Ozon 2009 1 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Einleitung 2 1.1 Informationen zu Schwellen- und Zielwerten 2 1.2
Deskription, Statistische Testverfahren und Regression. Seminar: Planung und Auswertung klinischer und experimenteller Studien
 Deskription, Statistische Testverfahren und Regression Seminar: Planung und Auswertung klinischer und experimenteller Studien Deskriptive Statistik Deskriptive Statistik: beschreibende Statistik, empirische
Deskription, Statistische Testverfahren und Regression Seminar: Planung und Auswertung klinischer und experimenteller Studien Deskriptive Statistik Deskriptive Statistik: beschreibende Statistik, empirische
Fehlerfortpflanzung. M. Schlup. 27. Mai 2011
 Fehlerfortpflanzung M. Schlup 7. Mai 0 Wird eine nicht direkt messbare physikalische Grösse durch das Messen anderer Grössen ermittelt, so stellt sich die Frage, wie die Unsicherheitsschranke dieser nicht-messbaren
Fehlerfortpflanzung M. Schlup 7. Mai 0 Wird eine nicht direkt messbare physikalische Grösse durch das Messen anderer Grössen ermittelt, so stellt sich die Frage, wie die Unsicherheitsschranke dieser nicht-messbaren
Bericht zu Gutachten der BKW FMB Energie AG Für das Wasserkraftwerk Mühleberg
 Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Geotechnik Vorstand: Univ. Prof. Dr.-Ing. Wei Wu Feistmantelstraße 4 1180 Wien 1. Ausgangslage Bericht zu Gutachten der BKW FMB Energie AG Für das
Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Geotechnik Vorstand: Univ. Prof. Dr.-Ing. Wei Wu Feistmantelstraße 4 1180 Wien 1. Ausgangslage Bericht zu Gutachten der BKW FMB Energie AG Für das
Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:
 18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
Datenanalyse Klausur SS 2014 (nicht wortwörtlich) Lösung (aus einer Nachbesprechung mit Elsenbeer)
 1. Ist das folgende Argument gültig? Datenanalyse Klausur SS 2014 (nicht wortwörtlich) Lösung (aus einer Nachbesprechung mit Elsenbeer) Wenn minderjährige Mörder für ihr Vergehen genauso verantwortlich
1. Ist das folgende Argument gültig? Datenanalyse Klausur SS 2014 (nicht wortwörtlich) Lösung (aus einer Nachbesprechung mit Elsenbeer) Wenn minderjährige Mörder für ihr Vergehen genauso verantwortlich
7.5 Erwartungswert, Varianz
 7.5 Erwartungswert, Varianz Def. 7.5.: a) X sei eine diskrete ZV, die bei unendl. vielen Werten x k folgende Zusatzbedingung erfüllt: x k p k
7.5 Erwartungswert, Varianz Def. 7.5.: a) X sei eine diskrete ZV, die bei unendl. vielen Werten x k folgende Zusatzbedingung erfüllt: x k p k
1 Dichte- und Verteilungsfunktion
 Tutorium Yannick Schrör Klausurvorbereitungsaufgaben Statistik Lösungen Yannick.Schroer@rub.de 9.2.26 ID /455 Dichte- und Verteilungsfunktion Ein tüchtiger Professor lässt jährlich 2 Bücher drucken. Die
Tutorium Yannick Schrör Klausurvorbereitungsaufgaben Statistik Lösungen Yannick.Schroer@rub.de 9.2.26 ID /455 Dichte- und Verteilungsfunktion Ein tüchtiger Professor lässt jährlich 2 Bücher drucken. Die
Wichtige Definitionen und Aussagen
 Wichtige Definitionen und Aussagen Zufallsexperiment, Ergebnis, Ereignis: Unter einem Zufallsexperiment verstehen wir einen Vorgang, dessen Ausgänge sich nicht vorhersagen lassen Die möglichen Ausgänge
Wichtige Definitionen und Aussagen Zufallsexperiment, Ergebnis, Ereignis: Unter einem Zufallsexperiment verstehen wir einen Vorgang, dessen Ausgänge sich nicht vorhersagen lassen Die möglichen Ausgänge
Endbericht. Untersuchungen von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung eines Luftreinhalteplans für Balingen
 Endbericht Untersuchungen von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung eines Luftreinhalteplans für Balingen Ergänzung Trendprognose 2017 mit Wirkung der Umweltzone für das Regierungspräsidium Tübingen Postfach
Endbericht Untersuchungen von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung eines Luftreinhalteplans für Balingen Ergänzung Trendprognose 2017 mit Wirkung der Umweltzone für das Regierungspräsidium Tübingen Postfach
Biomathematik für Mediziner, Klausur WS 1999/2000 Seite 1
 Biomathematik für Mediziner, Klausur WS 1999/2000 Seite 1 Aufgabe 1: Wieviele der folgenden Variablen sind quantitativ stetig? Schulnoten, Familienstand, Religion, Steuerklasse, Alter, Reaktionszeit, Fahrzeit,
Biomathematik für Mediziner, Klausur WS 1999/2000 Seite 1 Aufgabe 1: Wieviele der folgenden Variablen sind quantitativ stetig? Schulnoten, Familienstand, Religion, Steuerklasse, Alter, Reaktionszeit, Fahrzeit,
Zeigen Sie mittles vollständiger Induktion, dass für jede natürliche Zahl n 1 gilt: k = n (n + 1) 2
 Aufgabe 1. (5 Punkte) Zeigen Sie mittles vollständiger Induktion, dass für jede natürliche Zahl n 1 gilt: n k = k=1 n (n + 1). 2 Aufgabe 2. (5 Punkte) Bestimmen Sie das folgende Integral mithilfe partieller
Aufgabe 1. (5 Punkte) Zeigen Sie mittles vollständiger Induktion, dass für jede natürliche Zahl n 1 gilt: n k = k=1 n (n + 1). 2 Aufgabe 2. (5 Punkte) Bestimmen Sie das folgende Integral mithilfe partieller
Zugstab
 Bisher wurde beim Zugstab die Beanspruchung in einer Schnittebene senkrecht zur Stabachse untersucht. Schnittebenen sind gedankliche Konstrukte, die auch schräg zur Stabachse liegen können. Zur Beurteilung
Bisher wurde beim Zugstab die Beanspruchung in einer Schnittebene senkrecht zur Stabachse untersucht. Schnittebenen sind gedankliche Konstrukte, die auch schräg zur Stabachse liegen können. Zur Beurteilung
Übungen mit dem Applet Zentraler Grenzwertsatz
 Zentraler Grenzwertsatz 1 Übungen mit dem Applet Zentraler Grenzwertsatz 1 Statistischer Hintergrund... 1.1 Zentraler Grenzwertsatz... 1. Beispiel Würfeln... 1.3 Wahrscheinlichkeit und relative Häufigkeit...3
Zentraler Grenzwertsatz 1 Übungen mit dem Applet Zentraler Grenzwertsatz 1 Statistischer Hintergrund... 1.1 Zentraler Grenzwertsatz... 1. Beispiel Würfeln... 1.3 Wahrscheinlichkeit und relative Häufigkeit...3
4.1. Körperkondition zum Zeitpunkt der Kalbung
 4. Ergebnisse Es werden die Datensätze von 318 Tieren, die in dem Versuchszeitraum abkalben, ausgewertet. Zur Frage nach dem Einfluß der Körperkondition zum Zeitpunkt der Kalbung auf das Fruchtbarkeitsgeschehen
4. Ergebnisse Es werden die Datensätze von 318 Tieren, die in dem Versuchszeitraum abkalben, ausgewertet. Zur Frage nach dem Einfluß der Körperkondition zum Zeitpunkt der Kalbung auf das Fruchtbarkeitsgeschehen
Berechnung von W für die Elementarereignisse einer Zufallsgröße
 R. Albers, M. Yanik Skript zur Vorlesung Stochastik (lementarmathematik) 5. Zufallsvariablen Bei Zufallsvariablen geht es darum, ein xperiment durchzuführen und dem entstandenen rgebnis eine Zahl zuzuordnen.
R. Albers, M. Yanik Skript zur Vorlesung Stochastik (lementarmathematik) 5. Zufallsvariablen Bei Zufallsvariablen geht es darum, ein xperiment durchzuführen und dem entstandenen rgebnis eine Zahl zuzuordnen.
Lösungen zu den Übungsaufgaben in Kapitel 10
 Lösungen zu den Übungsaufgaben in Kapitel 10 (1) In einer Stichprobe mit n = 10 Personen werden für X folgende Werte beobachtet: {9; 96; 96; 106; 11; 114; 114; 118; 13; 14}. Sie gehen davon aus, dass Mittelwert
Lösungen zu den Übungsaufgaben in Kapitel 10 (1) In einer Stichprobe mit n = 10 Personen werden für X folgende Werte beobachtet: {9; 96; 96; 106; 11; 114; 114; 118; 13; 14}. Sie gehen davon aus, dass Mittelwert
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS. Fahrleistungen eines Motorrades
 Fahrleistungen eines Motorrades Stand: 15.01.2018 Jahrgangsstufen FOS 11, BOS 12 Fach/Fächer Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele Benötigtes Material Physik Technische Bildung, Verkehrserziehung
Fahrleistungen eines Motorrades Stand: 15.01.2018 Jahrgangsstufen FOS 11, BOS 12 Fach/Fächer Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele Benötigtes Material Physik Technische Bildung, Verkehrserziehung
Physik 4 Praktikum Auswertung Zustandsdiagramm Ethan
 Physik 4 Praktikum Auswertung Zustandsdiagramm Ethan Von J.W., I.G. 2014 Seite 1. Kurzfassung......... 2 2. Theorie.......... 2 2.1. Zustandsgleichung....... 2 2.2. Koexistenzgebiet........ 3 2.3. Kritischer
Physik 4 Praktikum Auswertung Zustandsdiagramm Ethan Von J.W., I.G. 2014 Seite 1. Kurzfassung......... 2 2. Theorie.......... 2 2.1. Zustandsgleichung....... 2 2.2. Koexistenzgebiet........ 3 2.3. Kritischer
Zeigen Sie mittles vollständiger Induktion, dass für jede natürliche Zahl n 1 gilt: n (2k 1) = n 2.
 Aufgabe 1. (5 Punkte) Zeigen Sie mittles vollständiger Induktion, dass für jede natürliche Zahl n 1 gilt: n k=1 (2k 1) = n 2. Aufgabe 2. (7 Punkte) Gegeben sei das lineare Gleichungssystem x + 2z = 0 ay
Aufgabe 1. (5 Punkte) Zeigen Sie mittles vollständiger Induktion, dass für jede natürliche Zahl n 1 gilt: n k=1 (2k 1) = n 2. Aufgabe 2. (7 Punkte) Gegeben sei das lineare Gleichungssystem x + 2z = 0 ay
Übungen mit dem Applet Vergleich von zwei Mittelwerten
 Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Übungen mit dem Applet Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Statistischer Hintergrund... 2 1.1 Typische Fragestellungen...2 1.2 Fehler 1. und 2. Art...2 1.3 Kurzbeschreibung
Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Übungen mit dem Applet Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Statistischer Hintergrund... 2 1.1 Typische Fragestellungen...2 1.2 Fehler 1. und 2. Art...2 1.3 Kurzbeschreibung
Deskriptivstatistik a) Univariate Statistik Weiters zum Thema der statistischen Informationsverdichtung
 20 Weiters zum Thema der statistischen Informationsverdichtung M a ß z a h l e n Statistiken bei Stichproben Parameter bei Grundgesamtheiten Maßzahlen zur Beschreibung univariater Verteilungen Maßzahlen
20 Weiters zum Thema der statistischen Informationsverdichtung M a ß z a h l e n Statistiken bei Stichproben Parameter bei Grundgesamtheiten Maßzahlen zur Beschreibung univariater Verteilungen Maßzahlen
TEILPRÜFUNG ZUR BERUFSREIFEPRÜFUNG. Themenstellung für die schriftliche Berufsreifeprüfung. aus dem Fach Mathematik und angewandte Mathematik
 TEILPRÜFUNG ZUR BERUFSREIFEPRÜFUNG Themenstellung für die schriftliche Berufsreifeprüfung aus dem Fach Mathematik und angewandte Mathematik Termin: Frühjahr 2017 Prüfer: Andreas Aschbacher Nikolaus Ettel
TEILPRÜFUNG ZUR BERUFSREIFEPRÜFUNG Themenstellung für die schriftliche Berufsreifeprüfung aus dem Fach Mathematik und angewandte Mathematik Termin: Frühjahr 2017 Prüfer: Andreas Aschbacher Nikolaus Ettel
6.6 Poisson-Verteilung
 6.6 Poisson-Verteilung Die Poisson-Verteilung ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die zur Modellierung der Anzahl von zufälligen Vorkommnissen in einem bestimmten räumlichen oder zeitlichen Abschnitt
6.6 Poisson-Verteilung Die Poisson-Verteilung ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die zur Modellierung der Anzahl von zufälligen Vorkommnissen in einem bestimmten räumlichen oder zeitlichen Abschnitt
5. Spezielle stetige Verteilungen
 5. Spezielle stetige Verteilungen 5.1 Stetige Gleichverteilung Eine Zufallsvariable X folgt einer stetigen Gleichverteilung mit den Parametern a und b, wenn für die Dichtefunktion von X gilt: f x = 1 für
5. Spezielle stetige Verteilungen 5.1 Stetige Gleichverteilung Eine Zufallsvariable X folgt einer stetigen Gleichverteilung mit den Parametern a und b, wenn für die Dichtefunktion von X gilt: f x = 1 für
Mathematische und statistische Methoden II
 Statistik & Methodenlehre e e Prof. Dr. G. Meinhardt 6. Stock, Wallstr. 3 (Raum 06-206) Sprechstunde jederzeit nach Vereinbarung und nach der Vorlesung. Mathematische und statistische Methoden II Dr. Malte
Statistik & Methodenlehre e e Prof. Dr. G. Meinhardt 6. Stock, Wallstr. 3 (Raum 06-206) Sprechstunde jederzeit nach Vereinbarung und nach der Vorlesung. Mathematische und statistische Methoden II Dr. Malte
Der Weg eines Betrunkenen
 Der Weg eines Betrunkenen 2 Hätte es damals schon Computer gegeben, wäre es für unseren Mathematiker um einiges leichter gewesen, den Weg des Betrunkenen zu bestimmen. Er hätte nicht nur eine beliebige
Der Weg eines Betrunkenen 2 Hätte es damals schon Computer gegeben, wäre es für unseren Mathematiker um einiges leichter gewesen, den Weg des Betrunkenen zu bestimmen. Er hätte nicht nur eine beliebige
Station 1 Das Galtonbrett, Realmodelle
 Station 1 Das Galtonbrett, Realmodelle Zeit zur Bearbeitung: 10 Minuten 1.1 Versuch:. Münzwurf mit dem Galtonbrett Betrachtet wird folgendes Zufallsexperiment: Fünf identische Münzen werden zehn-mal geworfen.
Station 1 Das Galtonbrett, Realmodelle Zeit zur Bearbeitung: 10 Minuten 1.1 Versuch:. Münzwurf mit dem Galtonbrett Betrachtet wird folgendes Zufallsexperiment: Fünf identische Münzen werden zehn-mal geworfen.
Die seismische Struktur der Arava-Störung, Totes-Meer-Transform
 Die seismische Struktur der Arava-Störung, Totes-Meer-Transform Nils Maercklin Disputation an der Universität Potsdam 2. Juli 2004 Dissertation: Seismic structure of the Arava Fault, Dead Sea Transform
Die seismische Struktur der Arava-Störung, Totes-Meer-Transform Nils Maercklin Disputation an der Universität Potsdam 2. Juli 2004 Dissertation: Seismic structure of the Arava Fault, Dead Sea Transform
Fadenpendel (M1) Ziel des Versuches. Theoretischer Hintergrund
 Fadenpendel M) Ziel des Versuches Der Aufbau dieses Versuches ist denkbar einfach: eine Kugel hängt an einem Faden. Der Zusammenhang zwischen der Fadenlänge und der Schwingungsdauer ist nicht schwer zu
Fadenpendel M) Ziel des Versuches Der Aufbau dieses Versuches ist denkbar einfach: eine Kugel hängt an einem Faden. Der Zusammenhang zwischen der Fadenlänge und der Schwingungsdauer ist nicht schwer zu
Institut für Allgemeine Mechanik der RWTH Aachen
 Prof Dr-Ing D Weichert 1Übung Mechanik II SS 28 21428 1 Aufgabe An einem ebenen Element wirken die Spannungen σ 1, σ 2 und τ (Die Voreichen der Spannungen sind den Skien u entnehmen Geg: Ges: 1 σ 1 = 5
Prof Dr-Ing D Weichert 1Übung Mechanik II SS 28 21428 1 Aufgabe An einem ebenen Element wirken die Spannungen σ 1, σ 2 und τ (Die Voreichen der Spannungen sind den Skien u entnehmen Geg: Ges: 1 σ 1 = 5
Beispiel 2 (Einige Aufgaben zu Lageparametern) Aufgabe 1 (Lageparameter)
 Beispiel (Einige Aufgaben zu Lageparametern) Aufgabe 1 (Lageparameter) 1 Ein Statistiker ist zu früh zu einer Verabredung gekommen und vertreibt sich nun die Zeit damit, daß er die Anzahl X der Stockwerke
Beispiel (Einige Aufgaben zu Lageparametern) Aufgabe 1 (Lageparameter) 1 Ein Statistiker ist zu früh zu einer Verabredung gekommen und vertreibt sich nun die Zeit damit, daß er die Anzahl X der Stockwerke
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung
 Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Dr. Jochen Köhler 1 Inhalt der heutigen Vorlesung Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Zusammenfassung der vorherigen Vorlesung Übersicht über Schätzung und
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Dr. Jochen Köhler 1 Inhalt der heutigen Vorlesung Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Zusammenfassung der vorherigen Vorlesung Übersicht über Schätzung und
Fähigkeitsnachweis bei Spritzgießmaschinen VDMA Teil 2: Nachweis der Kurzzeitfähigkeit. Bedienungsanleitung zum Excel-Programm
 Fähigkeitsnachweis bei Spritzgießmaschinen VDMA 24470 Teil 2: Nachweis der Kurzzeitfähigkeit Bedienungsanleitung zum Excel-Programm Inhalt Seite 1 Einleitung... 2 2 Die Oberfläche... 3 2.1 Einteilung der
Fähigkeitsnachweis bei Spritzgießmaschinen VDMA 24470 Teil 2: Nachweis der Kurzzeitfähigkeit Bedienungsanleitung zum Excel-Programm Inhalt Seite 1 Einleitung... 2 2 Die Oberfläche... 3 2.1 Einteilung der
Grundbau und Bodenmechanik Übung Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit 1. G Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit. Inhaltsverzeichnis
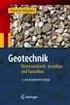 Übung Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit Lehrstuhl für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Tunnelbau G Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit Inhaltsverzeichnis G. Allgemeiner Spannungszustand
Übung Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit Lehrstuhl für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Tunnelbau G Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit Inhaltsverzeichnis G. Allgemeiner Spannungszustand
Erläuterungen und Ergänzungen zum Konzept zur langfristigen Optimierung der Grubenwasserhaltung der RAG Aktiengesellschaft für das Saarland
 Erläuterungen und Ergänzungen zum Konzept zur langfristigen Optimierung der Grubenwasserhaltung der RAG Aktiengesellschaft für das Saarland Herne, im Juli 2014 Gliederung Vorbemerkung... 2 Reststoffverwertung
Erläuterungen und Ergänzungen zum Konzept zur langfristigen Optimierung der Grubenwasserhaltung der RAG Aktiengesellschaft für das Saarland Herne, im Juli 2014 Gliederung Vorbemerkung... 2 Reststoffverwertung
Praktikum Physikalische Chemie I 30. Januar Aktivierungsenergie. Guido Petri Anastasiya Knoch PC111/112, Gruppe 11
 Praktikum Physikalische Chemie I 30. Januar 2016 Aktivierungsenergie Guido Petri Anastasiya Knoch PC111/112, Gruppe 11 1 Aufgabenstellung Für die Reaktion von Saccharose mit Wasser zu Glucose und Fructose
Praktikum Physikalische Chemie I 30. Januar 2016 Aktivierungsenergie Guido Petri Anastasiya Knoch PC111/112, Gruppe 11 1 Aufgabenstellung Für die Reaktion von Saccharose mit Wasser zu Glucose und Fructose
swiss marketing academy GmbH Seite 1 von 11
 AUFGABE 1a Nennen Sie 3 fallbezogene Gliederungszahlen und beschreiben Sie pro Gliederungszahl die Aussagekraft. 6 Punkte Gliederungszahl = Verhältnis eines Teiles zum gleichartigen Ganzen. Nennung Beschreibung
AUFGABE 1a Nennen Sie 3 fallbezogene Gliederungszahlen und beschreiben Sie pro Gliederungszahl die Aussagekraft. 6 Punkte Gliederungszahl = Verhältnis eines Teiles zum gleichartigen Ganzen. Nennung Beschreibung
SBP Mathe Aufbaukurs 1 # 0 by Clifford Wolf. SBP Mathe Aufbaukurs 1
 SBP Mathe Aufbaukurs 1 # 0 by Clifford Wolf SBP Mathe Aufbaukurs 1 # 0 Antwort Diese Lernkarten sind sorgfältig erstellt worden, erheben aber weder Anspruch auf Richtigkeit noch auf Vollständigkeit. Das
SBP Mathe Aufbaukurs 1 # 0 by Clifford Wolf SBP Mathe Aufbaukurs 1 # 0 Antwort Diese Lernkarten sind sorgfältig erstellt worden, erheben aber weder Anspruch auf Richtigkeit noch auf Vollständigkeit. Das
Pressekonferenz. Thema: Vorstellung des Geburtenbarometers - Eine neue Methode zur Messung der Geburtenentwicklung
 Pressekonferenz mit Bundesministerin Ursula Haubner, Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz und Prof. Dr. Wolfgang Lutz, Direktor des Instituts für Demographie der
Pressekonferenz mit Bundesministerin Ursula Haubner, Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz und Prof. Dr. Wolfgang Lutz, Direktor des Instituts für Demographie der
Club Apollo 13, 14. Wettbewerb Aufgabe 1.
 Club Apollo 13, 14. Wettbewerb Aufgabe 1. (1) a) Grundlagenteil: Basteln und Experimentieren Wir haben den Versuchsaufbau entsprechend der Versuchsanleitung aufgebaut. Den Aufbau sowie die Phase des Bauens
Club Apollo 13, 14. Wettbewerb Aufgabe 1. (1) a) Grundlagenteil: Basteln und Experimentieren Wir haben den Versuchsaufbau entsprechend der Versuchsanleitung aufgebaut. Den Aufbau sowie die Phase des Bauens
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend
 Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Einführung Fehlerrechnung
 Einführung Fehlerrechnung Bei jeder Messung, ob Einzelmessung oder Messreihe, muss eine Aussage über die Güte ( Wie groß ist der Fehler? ) des Messergebnisses gemacht werden. Mögliche Fehlerarten 1. Systematische
Einführung Fehlerrechnung Bei jeder Messung, ob Einzelmessung oder Messreihe, muss eine Aussage über die Güte ( Wie groß ist der Fehler? ) des Messergebnisses gemacht werden. Mögliche Fehlerarten 1. Systematische
Biomathematik für Mediziner, Klausur SS 2000 Seite 1
 Biomathematik für Mediziner, Klausur SS 2000 Seite 1 Aufgabe 1: Bei der Diagnose einer bestimmten Krankheit mit einem speziellen Diagnoseverfahren werden Patienten, die tatsächlich an der Krankheit leiden,
Biomathematik für Mediziner, Klausur SS 2000 Seite 1 Aufgabe 1: Bei der Diagnose einer bestimmten Krankheit mit einem speziellen Diagnoseverfahren werden Patienten, die tatsächlich an der Krankheit leiden,
Observatoriumspraktikum WS 2006/07. Teil 1 CCD-Kamera Dunkelstrombestimmung
 Observatoriumspraktikum WS 2006/07 Teil 1 CCD-Kamera Dunkelstrombestimmung Matr. Nr.: 04000944 Christoph Saulder Theorie Eine CCD (Charge-coupled Device) ist ein Photodetektor, welcher ein Signal, welches
Observatoriumspraktikum WS 2006/07 Teil 1 CCD-Kamera Dunkelstrombestimmung Matr. Nr.: 04000944 Christoph Saulder Theorie Eine CCD (Charge-coupled Device) ist ein Photodetektor, welcher ein Signal, welches
Anhang 5 INGENIEURBÜRO HEITFELD - SCHETELIG GMBH. im Auftrag der RAG Aktiengesellschaft, Herne. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen.
 Anhang 5 zum Gutachten zu den Bodenbewegungen im Rahmen des stufenweisen Grubenwasseranstiegs in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel Bewertung des Einwirkungspotenzials und Monitoringkonzept - Anstieg
Anhang 5 zum Gutachten zu den Bodenbewegungen im Rahmen des stufenweisen Grubenwasseranstiegs in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel Bewertung des Einwirkungspotenzials und Monitoringkonzept - Anstieg
