Prof. Dr. Stephan Laske, Dipl.-Oek. Claudia Meister-Scheytt Dr. Wendelin Küpers. Organisation und Führung
|
|
|
- Stanislaus Kaiser
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Prof. Dr. Stephan Laske, Dipl.-Oek. Claudia Meister-Scheytt Dr. Wendelin Küpers Organisation und Führung Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2012
2 Impressum Autoren: Herausgeber: Prof. Dr. Stephan Laske, Dipl.-Oek. Claudia Meister-Scheytt Dr. Wendelin Küpers Prof. Dr. Anke Hanft, Universität Oldenburg, Fakultät I Bildungs- und Sozialwissenschaften, Arbeitsbereich Weiterbildung und Bildungsmanagement (we.b) Auflage: 7. Auflage 2012 (Erstausgabe 2004) Redaktion: Layout, Gestaltung: Copyright: Uda Lübben, Sonja Lübben, Dr. Willi B. Gierke Andreas Altvater Vervielfachung oder Nachdruck auch auszugsweise zum Zwecke einer Veröffentlichung durch Dritte nur mit Zustimmung der Herausgeber, 2011 ISSN: Oldenburg, Februar 2012
3 Prof. Dr. Stephan Laske Fachliche Arbeitsschwerpunkte: Gründungsforschung Nachfolgeprozesse in Familienbetrieben Mitarbeiterführung Personal- und Organisationsentwicklung Gestaltung von Lernprozessen Führung von und in Universitäten Prof. Dr. rer. soc. oec. Stephan Laske (1944) ist o. Univ.-Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck Akademischer Werdegang Studium der Betriebswirtschaftslehre von an den Universitäten München und Hamburg. Promotion 1973 mit einer Arbeit über betriebliche Lohnpolitik. Nach Assistententätigkeit an den Universitäten München und Wuppertal 1977 Berufung als C 3-Professor für Betriebswirtschaftslehre an die Universität Hannover Berufung auf eine Professur für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik an die Universität Innsbruck. Lehr- und Forschungstätigkeit als Gastprofessor bzw. Visiting Scholar an den Universitäten Linz, Griffith University (Brisbane, Australien), Southern Cross University (Lismore, Australien), Handelshochschule Göteborg (Schweden). Leiter zweier umfangreicher Forschungsprojekte zur Organisationsreform von Universitäten Umfangreiche Erfahrungen in universitären Leitungsfunktionen und als Mitglied von Kommissionen, z. B. als Institutsvorstand, Dekan, Leiter von Habilitationsund Berufungskommissionen, Vorsitzender des Senats der Universität Innsbruck Erfahrungen in überuniversitären Gremien, z. B. als Sprecher der Senatsvorsitzenden der Österreichischen Universitäten, als stellvertretender Vorsitzender des Universitätsrats der Medizinischen Universität Innsbruck, als Vorsitzender der wissenschaftlichen Kommission Hochschulmanagement im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft, als Mitglied von Expertengruppen oder als Leiter zahlreicher Weiterbildungs-Universitätslehrgänge Seit 2004 Mitglied der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen Erfahrungen als Trainer und Berater in Profit- und Non-Profit-Organisationen (u. a. ein Jahr Auszeit von der Funktion als Hochschullehrer und Tätigkeit als Personalberater) Auszeichnungen Bifego-Gründungsforschungspreis 1988; Österreichischer Staatspreis für besondere Leistungen in der Hochschuldidaktik 1989; Innovationspreis der Sparkasse Innsbruck 1997 (jeweils mit Mitarbeitern des Instituts)
4 Dipl.-Oek. Claudia Meister-Scheytt Arbeitsschwerpunkte: Personalentwicklung Organisationsforschung Hochschulmanagementforschung Hochschulfinanzierung Claudia Meister-Scheytt, (1965) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Organisation und Lernen der Universität Innsbruck Akademischer Werdegang Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Frankfurt am Main und Wirtschaftswissenschaft an der Privaten Universität Witten/Herdecke ggmbh, seit 1997 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungs- und Lehrbetrieb am Institut für Organisation und Lernen der Universität Innsbruck Forschungsprojekte zu Veränderungsprozessen in Hochschulen und zur Tätigkeit von Hochschulräten; Beratungserfahrung in Hochschulen in den Bereichen Personalund Organisationsentwicklung; Tätigkeit als Trainerin in der Erwachsenenbildung in den Bereichen Hochschulsponsoring und Fundraising, Führung in Bildungsorganisationen Auszeichnungen Zweimalige Gewinnerin (2002, 2004) des Best Paper Award der wissenschaftlichen Kommission Hochschulmanagement im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.v. Mitarbeit in universitären und außeruniversitären Gremien Vorsitzende des Vorstands des Universitätsvereins Witten/Herdecke e.v. (Alumniorganisation der Universität Witten/Herdecke ggmbh) Mitglied im Center for Organizational Research (CORE), Innsbruck Mitglied im Patenschaftsmodell Innsbruck (PINN) Mitglied in der Society for Research into Higher Education (SRHE), Buckingham, UK Mitglied in der European Association of Institutional Research (EAIR), Twente (NL)
5 Dr. Wendelin Küpers Arbeitsschwerpunkte: Unternehmens- und Personalführung Organisationsforschung Personal- und Organisationsentwicklung Lernen in und von Organisationen Wissensmanagement Emotionen in Organisationen und Führung Akademischer Werdegang Nach Ausbildung und mehrjähriger Tätigkeit in der Industrie, Studium der Wirtschaftswissenschaft und Promotion an der Privaten Universität Witten/Herdecke ggmbh; anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Führung Personalmanagement an der Universität St. Gallen, bis 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungs- und Lehrbetrieb am Lehrstuhl für Betriebswirtschaft, insbesondere Personalführung und Organisation der FernUniversität in Hagen, seitdem am Department of Management and International Business der Massey University in Auckland (Neuseeland), Lehrtätigkeiten an den Universitäten St. Gallen, Lüneburg und Innsbruck. Forschungsprojekte Forschungsprojekte zur integralen Führung und Organisation, Integrale Kommunikation in Non-Profit-Organisationen, Organisationales Lernen, Emotionen in Organisationen und Führung Mitarbeit in universitären und außeruniversitären Gremien Research Fellow des Center for Social Enterprise, Universität St. Gallen Visiting Research Fellow, Imagination Laboratory Foundation, Lausanne Reviewer der European Academy of Management (EURAM) Mitglied des Integral Leadership Review Councils Mitglied der Academy of Management (AoM) und der European Group of Organisation Studies (EGOS) Partner des transdiziplinären Forschungsschwerpunkt Organization Studies der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
6 INHALTSVERZEICHNIS EINFÜHRUNG ORGANISATION Was sind Organisationen? Der instrumentelle (oder: funktionale) Organisationsbegriff Der institutionelle Organisationsbegriff Der prozessuale Organisationsbegriff Grundelemente der Organisation/des Organisierens ORGANISATIONS- UND FÜHRUNGS- THEORETISCHE ZUGÄNGE Klassische Managementlehre: Der Taylorismus oder Die wissenschaftliche Betriebsführung Die Human-Relations-Bewegung Das Webersche Bürokratiemodell Die verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie Der situative Ansatz Neoinstitutionalistische Organisationstheorie Organisation als Spiel und Mikropolitik ORGANISATIONSGESTALTUNG Grundtatbestände der Organisationsgestaltung Stellen und Instanzen Stellenbildung Organisationsformen Funktionale Organisation Diversifikation und divisionale Organisation... 58
7 4 MOTIVATION UND INTEGRATION VON INDIVIDUUM UND ORGANISATION Die Anreiz-Beitragstheorie als klassischer Integrationsversuch Integration menschlicher Bedürfnisse und der Motivation in die Organisation Begriffsklärung: Identifikation; Motiv, Motivation, Motivierung Maslows Bedürfnisansatz als Beispiel einer inhaltsorientierten Motivationstheorie Menschenbilder der Theorie X und Y sowie Perspektiven einer reifen Organisation Neuere motivationsorientierte Organisationsmodelle Ein Integrationsmodell zur Verknüpfung von Individuum und Organisation Grundstruktur und -dimensionen des Modells Inhalte und Bestimmungen der einzelnen Sphären Gestaltungsmöglichkeiten in den einzelnen Sphären Zusammenhang der vier Sphären BILDUNGSORGANISATIONEN ALS EXPERTENORGANISATIONEN Merkmale der Expertenorganisation Koordination und Kontrolle in Expertenorganisationen Die Gestaltung von Expertenorganisationen Bildungsorganisationen Besonderheiten von Bildungsorganisationen Logik von Bildungsorganisationen Zielvorstellungen von Bildungsorganisationen Wissen als Ziel und Gegenstand von Bildungsorganisationen
8 6 INTEGRALE FÜHRUNG IN BILDUNGS- ORGANISATIONEN Einführung Besonderheiten der Führung von Bildungsorganisationen Lose Kopplung und Widersprüchlichkeiten in der Führung Führung in Bildungsorganisationen zwischen symbolischer und materieller Ebene Führung als symbolisches Handeln in verschiedenen Logiken Führungsstile in Bildungseinrichtungen Autoritär-patriarchalische Führung Konsultative Führungskonzepte Kooperative Führung Delegative Führung Integrale Führung in Bildungseinrichtungen Intra-subjektive Selbstführung und -entwicklung (Sphäre I) Objektiviertes Führungshandeln (Sphäre II) Führung in sozio-kulturellen Lebenswelten (Sphäre III) Strukturell-systemische Führungssysteme (Sphäre IV) Interdependenzen der Bereiche integraler Führung ANHANG SCHLÜSSELWORTVERZEICHNIS GLOSSAR LITERATURVERZEICHNIS ZUSATZTEXT
9 EINFÜHRUNG EINFÜHRUNG Mit dem folgenden Text wollen wir Ihnen die grundsätzliche Problematik der Strukturierung und der Führung in Organisationen im Generellen und in Bildungsorganisationen im Speziellen näher bringen. Bildungsorganisationen unterscheiden sich nämlich in mehrfacher Hinsicht von anderen Unternehmen. Ein erster Unterschied besteht darin, dass die Tätigkeit der meisten Bildungsorganisationen nicht auf Gewinn ausgerichtet ist. Vielmehr geht es ihnen darum, Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlichen Vorwissens Bildung anzubieten (das heißt allerdings nicht, dass in diesen Organisationen wirtschaftliche Fragen keine Rolle spielen im Gegenteil: bei knappen Budgets ist auch dort sorgfältig zu haushalten). Einen zweiten Unterschied sehen wir in der Unterschiedlichkeit des Produktes : Während ein Konsumprodukt beispielsweise ohne jedes Zutun des Kunden vom Produzenten gefertigt werden kann, muss beim Produkt Bildung der Empfänger aktiv mittun, anderenfalls bleibt der Produktionsprozess ohne den gewünschten Erfolg. (Hieraus müssen wir eine erste wichtige Schlussfolgerung ziehen: Das notwendige Mittun der Adressaten ist ein zentraler Grund dafür, dass die Übertragung der Kunden-Metapher von Wirtschafts- auf Bildungsorganisationen ein falsches Bild und daraus resultierend auch falsche Erwartungen erzeugt!). Drittens macht es einen Unterschied, dass das Rohmaterial des Produktionsprozesses in Bildungsorganisationen, also das Know-how, sehr direkt an die Personen gekoppelt ist. Dies hat zur Konsequenz, dass mit deren Ausscheiden aus der Organisation auch deren besonderes Wissen verloren geht. Viertens haben die Träger dieses Wissens oft ein ausgeprägtes professionelles Selbstverständnis als Experten das macht es übrigens nicht immer einfach, sie in das Normensystem und in die Strukturen von Organisationen einzubinden. Bildungsorganisationen weisen also schon allein aufgrund dieser kurzen Überlegungen Besonderheiten auf, die einer einfachen Übertragbarkeit von Denkmustern oder Instrumenten aus anderen Organisationen deutliche Grenzen setzt. In Anlehnung an Gregory Bateson können wir auch sagen: Zwischen Bildungsorganisationen und Wirtschaftsorganisationen gibt es Unterschiede, die einen Unterschied machen. Wer diese Unterschiede ignoriert, zielt an der Praxis vorbei und wird wenig erfolgreich sein, wenn es um gelingende Führung in und die Steuerung von Bildungsorganisationen geht. Wir persönlich haben uns folgenden Leitsatz zurecht gelegt: Bildungsorganisationen sind Bildungsorganisationen sind Bildungsorganisationen... die Verknüpfung eines zentralen Begriffs der Aufklärung (nämlich Bildung ) mit einem ebensolchen der Ökonomie (nämlich Organisation ) bringt ein fundamentales Spannungsfeld zum Ausdruck, dessen produktive und reflektierte Bewältigung eine wesentliche Voraussetzung professioneller Steuerung von Bildungseinrichtungen ist (vgl. Gütl/Orthey/Laske 2006). Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (und deren Dynamik), denen auch Bildungsorganisationen unterworfen sind, ist die Bewältigung dieses Spannungsfeldes keine einfache Aufgabe: Zumindest entzieht sie sich einer schnellen instrumentellen Lösung und ist für Patentrezepte nicht zugänglich. ORGANISATION UND FÜHRUNG 9
10 EINFÜHRUNG Unsere Leitidee ist dem Gegenstand entsprechend die der lernenden Organisation: Wie kann eine Organisation so gestaltet werden, dass sie selbst Lernprozesse unterstützt und damit Fortschrittsfähigkeit gewährleistet ist? Daraus folgt auch die Frage, welche strukturellen Bedingungen zu schaffen sind, dass Bildungsorganisationen als relativ lose gekoppelte Systeme (Weick), d. h notwendigerweise ohne stramme Hierarchie und Anweisungssysteme, ihre eigene Weiterentwicklung ermöglichen und welche Organisations- und Führungsphilosophie dies befördern kann. Dabei wird schnell ersichtlich, dass Führung sich von engen great man -Konzepten zu lösen hat und an deren Stelle die Idee der Kontext- o- der Rahmensteuerung treten sollte, die der Logik (auch) von Bildungsorganisationen sehr viel angemessener erscheint. In dem folgenden Text wollen wir uns ganz allgemein mit zwei Themenbereichen auseinandersetzen: Zum einen wollen wir ausführlicher fragen, was eigentlich das Besondere von Bildungsorganisationen ausmacht, und welchen Einfluss dieses Besondere auf die interne Gestaltung und die Entwicklung von Bildungsorganisationen hat. Zum anderen geht es um die Frage, wie Führung in diesen Organisationen angemessen gestaltet werden kann. Angemessen meint dabei, wie in Führungsprozessen einerseits der Eigen-Art und der Kultur von Bildungsorganisationen Rechnung getragen und wie andererseits auch die Tatsache von (meist) begrenzten wirtschaftlichen Ressourcen berücksichtigt werden kann. Dies ist nur eines der Spannungsfelder, dem sich Führung grundsätzlich, besonders aber auch in Bildungsorganisationen zu stellen hat. Zudem wollen wir im Folgenden jeweils einen Überblick über grundsätzliche Modelle der Organisation und der Führung geben. Organisations- und Führungstheorie ist ein äußerst vielfältiges Gebiet, in dem es zahlreiche Ansätze gibt, die jeweils wichtige Elemente thematisieren. Daraus folgt auch, dass es keineswegs den one best way der Führung oder Organisation gibt, wie es manche Bücher aus der Manager-Ratgeber-Literatur uns glauben machen wollen. Es geht um komplexe Beziehungen, z.b. zwischen Individuum und Organisation oder zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, oder auch um komplexe Fragestellungen, wie z.b. die Gestaltung von Organisationen, die deshalb alle problematisch sind, weil sehr viele Faktoren die Situation bestimmen und wir oft nicht wissen, wie die Faktoren in ihren unterschiedlichen Ausprägungen auf das Ganze wirken. Eine besondere Sensibilität hinsichtlich dessen, was die jeweils konkrete Situation bestimmt, ist daher immer geboten. Von zentraler Bedeutung für die Auseinandersetzung mit den hier diskutierten Themen- und Fragestellungen ist es, dass die erarbeiteten Inhalte nicht auf Lager gelegt werden, sondern die Leser in die Lage versetzt werden, die entsprechenden Erkenntnisse mit den eigenen Erfahrungen zu konfrontieren und weiter zu entwickeln. Wir werden versuchen, Sie mit weiterführenden Fragen innerhalb bzw. am Ende der einzelnen Kapitel jeweils zu ermutigen, auch immer Ihren eigenen konkreten Kontext und Ihre Erfahrungen in die Überlegungen einzubeziehen. Der Text ist so gegliedert, dass Darstellungen der Grundlagen der Führungs- und Organisationstheorie einander abwechseln. Im ersten Kapitel wollen wir kurz auf ORGANISATION UND FÜHRUNG 10
11 EINFÜHRUNG das generelle Verständnis von Organisation eingehen und die Tatbestände vorstellen, die es überhaupt notwendig machen, warum man etwas organisieren muss. Kapitel 2 besteht aus einem Ausflug in die führungs- und organisationstheoretischen Ansätze Führen und Organisieren kann nämlich auf sehr verschiedene Weise betrieben und verstanden werden, und die unterschiedlichen Sichtweisen ermöglichen einen umfassenden Blick auf die Phänomene, wie sie uns im Alltag begegnen. Das dritte Kapitel stellt einführend dar, wie Organisationen praktisch gestaltet werden können und welche Aspekte bei der Gestaltung zu berücksichtigen sind. In dem umfangreichen Kapitel 4 diskutieren wir eine der Kernfragen jeglicher Führung, nämlich die nach den Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Individuum und Organisation. Es wird erörtert, wie in der Organisationstheorie das Zusammenspiel von Individuum und Organisation unter dem Aspekt motivationaler Wirkungen konzipiert werden kann. Dabei stellen wir auch ein Erklärungsmodell vor, das nach unserer Einschätzung wesentliche Anregungen für die Gestaltung von Führungsprozessen anbietet. Eines der zentralen Charakteristika von Bildungsorganisationen ist die Tatsache, dass in ihnen Experten, wie z.b. Lehrer, nebenberufliche Vortragende, Hochschullehrer, etc. arbeiten und natürlich auch an Prozessen der Führung und Organisation beteiligt sind. Die wesentlichsten Merkmale derartiger Expertenorganisationen werden im fünften Kapitel dargestellt. Das im vierten Kapitel erarbeitete Erklärungsmodell wird im abschließenden Kapitel 6 noch einmal aufgegriffen. Hier geht es darum, die Besonderheiten (auch die Schwierigkeiten!) der Führung von Expertinnen und Experten in Bildungsorganisationen herauszuarbeiten und die Grundzüge und Handlungsfelder von Führung entsprechend dem von uns entwickelten integralen Modell von Führung zu erklären. In diesem Zusammenhang wird auch die Angemessenheit verschiedener Führungsstile für die Steuerung in Bildungsorganisationen thematisiert. Ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Der folgende Text verwendet häufig der besseren Lesbarkeit wegen die männliche Formulierungsform; diese soll aber grundsätzlich geschlechtsneutral verstanden werden. Zitierte Literatur Gütl, B./Orthey, F.M./Laske, St. (Hg.) (2006): Bildungsmanagement: Differenzen bilden zwischen System und Umwelt. München/Mering. ORGANISATION UND FÜHRUNG 11
12 KAPITEL 1: DER BEGRIFF ORGANISATION Nach Bearbeitung dieses Kapitels sollten Sie in der Lage sein zwischen dem institutionellen und dem instrumentellen Verständnis von Organisation zu differenzieren und dennoch die Zusammenhänge zwischen beiden Lesarten zu erkennen, den Organisationsbegriff zu definieren, Organisationen als zielgerichtete und auf Dauerhaftigkeit angelegte Gebilde aufzufassen, Kriterien anzugeben, wonach sich die Einbindung von Menschen in Organisationen vollzieht, speziell die Kriterien für die Mitgliedschaft in Unternehmen als erwerbswirtschaftliche Organisationen nachzuvollziehen, zu beschreiben, warum formale Regeln eine solche Schlüsselrolle bei Organisationen und ihrer Gestaltung spielen, erste Beispiele für organisatorische Regeln zu benennen, darzustellen, auf welch unterschiedlichen Wegen organisatorische Regeln entstehen können, einzuschätzen, ob und inwieweit es überhaupt organisatorische Besonderheiten im kleinen und mittleren Unternehmen gibt bzw. einzuschätzen, worin diese im Einzelnen bestehen.
13 1 DER BEGRIFF ORGANISATION 1.1 Grundverständnis 1.1 GRUND- VERSTÄNDNIS In einem Lernmodul zur Organisation wird zu Recht erwartet, dass zunächst der Organisationsbegriff hinreichend abgeklärt wird. Der Begriff ist nämlich weder selbsterklärend, noch wird er in einer einheitlichen Art und Weise verwendet. Daher beschäftigen wir uns im Rahmen dieses ersten Kapitels mit dem Organisationsbegriff, der diesem Lernmodul zugrunde liegt. Im ersten Teilschritt wird dabei zwischen dem institutionellen und dem instrumentellen Begriffsverständnis differenziert. Anschließend wird eine gängige und inhaltlich treffende Lehrbuch-Definition dargestellt Das institutionelle und das instrumentelle Verständnis von Organisation Wenn wir fortan in diesem Modul mit dem Organisationsbegriff operieren und ihn näher zu definieren versuchen, müssen wir zunächst auf seine Doppeldeutigkeit zu sprechen kommen. Es gibt nämlich ein institutionelles und ein instrumentelles Verständnis der Organisation, wobei beide miteinander zusammenhängen. Institutioneller Organisationsbegriff: Das Unternehmen ist eine Organisation. Instrumenteller Organisationsbegriff: Das Unternehmen hat eine Organisation. Im institutionellen Sinne sind Unternehmen (wie auch Krankenhäuser, öffentliche Verwaltungen, Schulen oder Gefängnisse) zielgerichtete soziale Systeme mit einem mehr oder weniger ausgeprägten Regel- und Stellengefüge. Im instrumentellen Organisationsverständnis geht es darum, dass organisationskonstituierende Menschen (z. B. Unternehmensgründer) eine verbindliche Ordnung schaffen, und zwar idealtypischer Weise eine solche, die sie vorher in einem rationalen Denk- und Gestaltungsprozess zielorientiert entworfen haben. Das Ergebnis dieses Prozesses ist eine Struktur, eine Ordnung, die den anderen Beteiligten als Fremdorganisation entgegentritt. Mit dieser Ordnung hat das Unternehmen eine Organisation im Sinne eines dauerhaften Regelsystems, welches die Aufgabenteilung, die Abstimmung zwischen den Teilaufgaben, die Verteilung der Entscheidungsbefugnisse, ein System von Über- und Unterordnung usw. umfasst. ORGANISATION UND VERÄNDERUNGSMANAGEMENT 13
14 Damit sind die beiden Perspektiven des Organisationsbegriffs wie zwei Seiten einer Medaille. Schon einer der Klassiker der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre, Nordsieck (1955, S. 26) formulierte es so: Die Tätigkeit des Organisierens konstituiert die Erscheinung Organisation. 1.1 GRUNDVER- STÄNDNIS Oder noch einmal anders ausgedrückt: Das Unternehmen ist eine Organisation, weil es eine Organisation hat! Im Folgenden wird den Ausführungen sowohl das instrumentelle wie auch das institutionelle Verständnis zugrunde gelegt. Der jeweils konkrete Bezug erschießt sich den Lernenden aus dem situativen Zusammenhang. Schlüsselwörter: Organisation, Definition; Organisationsbegriff, institutioneller; Organisationsbegriff, instrumenteller Definition von Organisation Organisationen (im institutionellen Sinne) sind nach einer gängigen Definition soziale Gebilde, die dauerhaft ein Ziel verfolgen und eine formale Struktur aufweisen, mit deren Hilfe Aktivitäten der Mitglieder auf das verfolgte Ziel ausgerichtet werden sollen. (nach Kieser/Walgenbach 2003, S. 6) Um ein vertiefendes Verständnis dieser sozialen Gebilde zu gewinnen, müssen wir uns die einzelnen Komponenten dieser Definition noch genauer erschließen. Daher wird in den nachfolgenden Abschnitten näher geklärt, was es mit der Zielgerichtetheit, der Dauerhaftigkeit, den Mitgliedern, deren Aktivitäten und der formalen Struktur auf sich hat. Schlüsselwörter: Organisation, Definition; Ziele, Mitgliedschaft ORGANISATION UND VERÄNDERUNGSMANAGEMENT 14
15 Aufgaben zur Lernkontrolle: Interpretieren Sie den Satz: Das Unternehmen ist eine Organisation, weil es eine Organisation hat! Fassen Sie mit Ihren eigenen Worten die Standard-Definition von Organisation zusammen! Literatur zur Vertiefung: Kieser, A./Walgenbach, P. (2003): Organisation, 4. Aufl., Stuttgart (Kapitel 1.1) Schreyögg, G. (1996): Organisation, Wiesbaden (Kapitel 1.1; 1.2) 1.2 Wichtige Elemente des Organisationsbegriffs In diesem Kapitel sollen die einzelnen Bestandteile des Organisationsbegriffes konkretisiert werden Zielgerichtetheit Fast alle Definitionen in der Fachliteratur betonen, dass Organisationen zweckbezogen sind. Krankenhäuser heilen Menschen, Schulen bilden Kinder und Heranwachsende aus, in Unternehmen werden Güter und Dienstleistungen erstellt. Diese Leistungen stellen sie ihrer Umwelt zur Verfügung. Ziele gelten überhaupt als zentraler Beweggrund für die Organisationsbildung. Viele komplexere Ziele, wie z. B. die Herstellung und der Verkauf von PKWs, lassen sich individuell nicht erreichen. Daher versuchen Menschen, diese Ziele dauerhaft mit Hilfe anderer durch den Zusammenschluss in Organisationen zu verfolgen. Ziele (oder Zwecke) der Organisation sind Vorstellungen von einem zukünftigen Zustand, der herzustellen oder zu erhalten versucht wird. Es geht um angestrebte Zustände, die eine handlungsleitende Funktion im Rahmen von Entscheidungsprozessen einnehmen. Dabei ist die Unterscheidung von Zielen und Mitteln oft relativ. Mittel können im Zeitablauf selbst Zielcharakter annehmen (Verselbständigung von Mitteln). In diesem Sinne wird z. B. der Erhalt einer Organisation, ORGANISATION UND VERÄNDERUNGSMANAGEMENT 15
16 deren Bildung ursprünglich instrumentellen Charakter hatte, oft zu einem eigenständigen Ziel. Allerdings sind Organisationen zunächst seelenlose Gebilde. Sie haben keine Ziele; vielmehr haben Menschen Ziele, die sie durch Organisationen zu verwirklichen gedenken (z. B. den Lebensunterhalt verdienen, ein neues Produkt herstellen und vermarkten). 1.2 WICHTIGE ELE- MENTE DES ORGANI- SATIONSBEGRIFFS Wir können erst dann von Zielen der Organisationen sprechen, wenn Mitglieder solche Zielvorstellungen in einem formalen, legitimierten Prozess zu Zielen der Organisation entwickelt haben. Diese kann man dann ggf. in Geschäftsberichten, Unternehmensgrundsätzen, Presseerklärungen oder anderen Dokumenten nachlesen. Oder wir können versuchen, die Ziele aus dem Verhalten von Organisationsmitgliedern zu erschließen, sie zu rekonstruieren. Natürlich haben nicht alle Mitglieder einer Organisation gleichermaßen Einfluss auf die Fixierung der Organisationsziele. Dieser ist bei dem Vorstand einer Aktiengesellschaft ungleich höher als bei einem Arbeiter, der in der Produktion am Fließband steht. Der Einfluss hängt ab von Machtgrundlagen einzelner Mitglieder bzw. Gruppen, die wiederum teilweise von Rechtsvorschriften geprägt sind. Im kleinen und mittleren (Familien-) Unternehmen hat vor allem der Unternehmer den mit Abstand größten Einfluss auf die Organisationsziele. Diese werden häufig schriftlich festgehalten und als strategische Entscheidung alljährlich als Ausgangspunkt in die Unternehmensplanung eingebracht. Allerdings gibt es begründete Zweifel daran, dass sich vor allem das Gros der Kleinbetriebe an diese Devise halten. Viele Kleinbetriebe funktionieren eher auf der Basis impliziter Ziele (z. B. Gewinn erzielen, den Mitarbeitern ein Auskommen ermöglichen) und verzichten auf eine eindeutige und offizielle Festlegung (vgl. auch Zander 1990, S. 12). Schlüsselwörter: Ziele, Zielbildung, Ziele und Mittel Dauerhaftigkeit Ein weiteres entscheidendes Merkmal von Organisationen ist ihre Dauerhaftigkeit. Immer wieder können wir z. B. in Katastrophenfällen (etwa bei einem Erdbeben) beobachten, wie sich eine Vielzahl von Menschen spontan, aber dennoch zielgerichtet zusammenfindet, um Opfern zu helfen und die Folgen der Katastrophe zu beseitigen. Auch ein solches soziales Gebilde ist ein zweckgerichteter Zusammenschluss, aber keine Organisation, weil es ihm an Dauerhaftigkeit (und womöglich auch an einer formalen Struktur) fehlt. ORGANISATION UND VERÄNDERUNGSMANAGEMENT 16
17 In auf Dauer angelegten Zusammenschlüssen stellen wir nämlich oft fest, dass die Erhaltung des Zusammenschlusses zu einem eigenständigen Ziel einer Reihe von Mitgliedern wird oder dass das Interesse am Bestand des Systems zumindest das Verhalten der Mitglieder beeinflusst und Verfestigungstendenzen hervorbringt. (Kieser/Walgenbach 2003, S. 11) 1.2 WICHTIGE ELE- MENTE DES ORGANI- SATIONSBEGRIFFS In Organisationen als dauerhafte Zusammenschlüsse wird also ihre Erhaltung oft zum eigenständigen Ziel (zumindest vieler Mitglieder). Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Rahmen der Definition des Gewerbes mit dem Begriff der Dauerhaftigkeit auseinandergesetzt. Das Kriterium der Dauerhaftigkeit wird erfüllt bei nachhaltigen, planmäßigen Betätigungen, die durchaus unterbrochen werden können (bspw. saisonale Beschäftigungen), es muss allerdings eine Wiederholungs- und Fortsetzungsabsicht bestehen. Demnach ist jede gelegentliche, einmalige, zufällige oder vorrübergehende Tätigkeit nicht dauerhaft (BVerwG NJW 77, 772). Dauerhaftigkeit ist aber nicht gleichbedeutend mit Unabänderlichkeit. Im Laufe der Zeit können sich z. B. die Ziele erheblich verändern. Und selbst bei konstanten Zielen sind Strukturveränderungen denkbar bzw. erforderlich. Schlüsselwörter: Dauerhaftigkeit, Ziele, Zielwandel Mitglieder Personen gehören zunächst einmal zur Umwelt von sozialen Systemen. Organisationsbildung setzt daher eine Erkennungsregel voraus, die die Abgrenzung von systemrelevanten und externen Handlungen und Entscheidungen ermöglicht. Damit ist die oft nicht leicht zu beantwortende Frage aufgeworfen, wer Mitglied einer Organisation ist und wer nicht. Die Differenzierung zwischen der Mitgliedschaft und der Nicht-Mitgliedschaft bezeichnet zugleich die Grenze der Organisation zu ihrer Umwelt. In einem ganz weiten Sinne heißt Mitgliedschaft das Eingehen einer Beziehung mit der Organisation. Sie muss Menschen einbinden, damit diese Aktivitäten ergreifen, die der Erreichung der Organisationsziele dienlich sind, selbst wenn die persönlichen Ziele teilweise anders gelagert sind. Je nach Organisationstyp dominieren dabei ganz unterschiedliche Einbindungsmuster. Während beispielsweise die Einbindung der Mitglieder in Gefängnissen und geschlossenen psychiatrischen Anstalten auf Zwang beruht, fußt sie in normativen Organisationen wie Kirchen, Parteien oder Gewerkschaften in starkem Maße auf geteilten Überzeugungen und dem Wunsch nach Zusammenschluss und Kooperation mit Gleichgesinnten. ORGANISATION UND VERÄNDERUNGSMANAGEMENT 17
18 Erwerbswirtschaftliche Unternehmen stehen zwischen diesen Integrationsmustern. Etzioni (1961) bezeichnet sie treffend als utilitaristische Organisationen, weil die Eingliederung der Mitglieder überwiegend aus der vertraglich vereinbarten Aussicht auf materielle Belohnungen resultiert (was aber normativ-ideelle Mitgliedschaftsmotive keineswegs ausschließt). Entscheidend ist also die Mitgliedschaft aufgrund von Verträgen. 1.2 WICHTIGE ELE- MENTE DES ORGANI- SATIONSBEGRIFFS Im Konzept der marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung tritt der Unternehmer als nach individueller Nutzenmaximierung strebendes Wirtschaftssubjekt in Erscheinung, das für einen anonymen Markt produziert und die dafür erforderlichen Ressourcen, also auch Arbeitskraft, auf den Faktormärkten erwirbt. Die Integration des Faktors Arbeit in das Unternehmensgeschehen erfolgt über den Arbeitsvertrag, mit dessen Abschluss er über einen Grundstock an gekauftem Arbeitsvermögen verfügt. Systemtheoretisch interpretiert sichert sich der Unternehmer über den Arbeitsvertrag die generalisierte Anerkennung der Formalstruktur durch die vertraglich gebundenen Beschäftigten und macht sie zumindest einigermaßen unabhängig von deren individuellen Motiven. In arbeitsteiligen Kooperationszusammenhängen ist dieses am Arbeitsmarkt eingekaufte Arbeitsvermögen eine notwendige, aber nicht hinreichende Produktionsvoraussetzung. Es besteht ein sich ständig reaktualisierender Konkretisierungsbedarf, da die jeweils benötigte Form der Arbeit, in die das variable Arbeitsvermögen von ihren Trägern gebracht werden soll, mit dem Abschluss des Arbeitsvertrages noch nicht festgelegt ist. Um das unspezifische Arbeitsvermögen in reale Arbeit zu überführen (Transformationsproblem!), gibt es das Direktionsrecht des Arbeitgebers, um im Wege von Weisungen die Details von Situation zu Situation zu bestimmen. Das Transformationsproblem beschreibt den Umstand, dass durch die Unbestimmtheit von Arbeitsverträgen ein Unternehmen nur das Recht kauft, das Arbeitsvermögen eines Beschäftigten für die Dauer der Arbeitszeit zu nutzen, sprich: ein Leistungsversprechen und keine konkrete Arbeitsleistung (Lederle 2008, S. 255). Entsprechend muss der Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass der Arbeitnehmer sein Arbeitsvermögen im betrieblichen Sinne einsetzt. Soweit sich diese Weisungen in dem arbeitsvertraglich abgesteckten Rahmen bewegen und ihnen keine anderen gesetzlichen oder vertraglichen (z. B. tarifvertragliche) Regelungen entgegenstehen, bedarf es dazu keiner ausdrücklichen Zustimmung des Arbeitnehmers. Zu fragen ist aber, was mit dem Unternehmer ist, der keinen Arbeitsvertrag hat. Selbstverständlich ist auch er Organisationsmitglied, z. B. weil er durch einen Rechtsakt den Betrieb gegründet hat. Auch können mehrere Personen und/oder andere Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit ( juristische Personen ) durch Gesellschaftsverträge Unternehmen gründen. Ihnen stehen nach dem Handelsgesetzbuch dann Vertretungsrechte nach außen und Geschäftsführungsrechte ORGANISATION UND VERÄNDERUNGSMANAGEMENT 18
19 nach innen zu. Diese beinhalten auch die Möglichkeit, Verträge zu schließen, u.a. Arbeitsverträge. Das heißt mit anderen Worten: Sie sind damit auch Partei von Arbeitsverträgen. Es bleiben aber darüber hinaus eine Reihe von Grenz- und Zweifelsfragen, so dass es bei der Frage der Mitgliedschaft stets eine Grauzone geben wird. So arbeiten z. B. Menschen oft intensiv für ein Unternehmen auf der Basis von Werkoder Dienstverträgen ( freie Mitarbeiter ) oder als selbständige Handelsvertreter. 1.2 WICHTIGE ELE- MENTE DES ORGANI- SATIONSBEGRIFFS Solche Fälle wird man nur für den konkreten Einzelfall nach Maßgabe der Intensität der Beziehungen beantworten können. Wir können diese Grenze mit Kieser/Walgenbach (2003, S. 15 f.) dort ziehen, wo die Mitgliedschaft einer Person auf Verträgen dergestalt beruht, die der Organisation bzw. ihren legitimierten Vertretern das Recht gibt, dem Individuum verhaltenssteuernde und Vorgaben und Anforderungen aufzuerlegen. Sonstige Vertragsbeziehungen wie Kauf- oder Kreditverträge begründen in dieser hier vertretenen Interpretation jedoch keine Mitgliedschaft; selbst dann nicht, wenn die zugrunde liegenden Beziehungen sehr langfristiger Natur sind. Schlüsselwörter: Organisation, Grenzen der; Arbeitsvertrag, Direktionsrecht Aktivitäten der Mitglieder Die vertraglich begründete Mitgliedschaft bezieht sich nicht auf die gesamte Persönlichkeit eines Menschen, sondern auf bestimmte Handlungen oder Leistungen. Das Individuum wird nur in einer bestimmten Rolle (z. B. als Arbeitnehmer) eingebunden. Sehr treffend hat dies die klassische betriebswirtschaftliche Organisationslehre auch begrifflich zum Ausdruck gebracht, wenn sie anstatt von arbeitenden Menschen o.ä. zumeist von Aufgabenträgern spricht (vgl. z. B. Kosiol 1962). Begriffe wie gewerbliche Arbeitnehmer, leitender Angestellter, Vorstandsmitglied oder Eigentümer stehen für solche Handlungskomplexe oder -bündel. Organisationen zielen mit ihren strukturellen Regelungen auf die Kanalisierung und Steuerung der Mitgliederaktivitäten. So wird z. B. die Tätigkeit eines Fließbandarbeiters recht exakt durch das Maschinensystem und vermutlich ergänzende Anordnungen des Vorgesetzten gesteuert. Dies ist erforderlich, weil die Menschen als Ganzheiten mit all ihren Bedürfnissen, aber auch mit ihren Eigenheiten in den Betrieb kommen, die sie bildlich gesprochen - nicht am Werkstor zurücklassen. Die Kanalisierung bezieht sich auf die Aktivitäten, die direkt und indirekt in Bezug zum Zweck der Leistungssicherung stehen. Durch die Beschränkung auf bestimmte Aktivitäten werden auch Mehrfachmitgliedschaften in Organisationen möglich, die in unserer Gesellschaft eher die ORGANISATION UND VERÄNDERUNGSMANAGEMENT 19
20 Regel als die Ausnahme sind. So kann beispielsweise eine Person in einem Unternehmen als Arbeitskraft tätig, zugleich aber auch als Gewerkschaftsmitglied aktiv und in einer Fernuniversität zum nebenberuflichen Studium eingeschrieben sein. 1.2 WICHTIGE ELE- MENTE DES ORGANI- SATIONSBEGRIFFS Schlüsselwörter: Aufgabenträger, Mitgliederaktivitäten, Mehrfachmitgliedschaft Aufgaben zur Lernkontrolle: 1.2.1a Welche Rolle spielen Ziele für Organisationen? 1.2.1b Die Ziele eines Unternehmens sind selten einer direkten Beobachtung zugänglich. Bitte überlegen Sie sich verschiedene Techniken, wie man die Ziele des Unternehmens ermitteln kann und welche Probleme jeweils mit dieser Erfassungsform verbunden sind! 1.2.1c Wer hat in Wirklichkeit Ziele, Menschen oder Organisationen? Wie werden aus Zielen von Menschen Ziele der Organisation? Bitte überlegen Sie sich mindestens drei konkrete Beispiele für zielgerichtete Zusammenschlüsse von Menschen, denen aber das Merkmal der Dauerhaftigkeit fehlt und die daher keine Organisation darstellen! 1.2.3a Welche Mechanismen sind Ihnen bekannt, wie Organisationen (unterschiedlichen Typs) ihre Mitglieder einbinden? 1.2.3b Welche Rolle spielt das Direktionsrecht des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der vertraglichen Einbindung der Arbeitnehmer in die Organisation? 1.2.3c Welche der nachfolgenden Personen würden Sie als Mitglied einer Organisation Unternehmen bezeichnen und welche nicht? Unternehmer, Arbeitnehmer, Aktionäre, externe Aufsichtsratsmitglieder, Volontäre ohne Gehalt, Studenten, die eine Diplomarbeit im Unternehmen schreiben. ORGANISATION UND VERÄNDERUNGSMANAGEMENT 20
21 Aufgaben mit Bezug zur Berufstätigkeit Wenn Sie an Ihr Unternehmen denken, welche Ziele verfolgt diese Organisation? Gibt es überhaupt ein offizielles Zielsystem? Wenn ja, wie und wo ist es dokumentiert? Wie sieht es konkret aus?.. Literatur zur Vertiefung: Kieser, A./Walgenbach, P. (2003): Organisation, 4. Aufl., Stuttgart (Kapitel 1.1) Schreyögg, G. (1996): Organisation, Wiesbaden (Kapitel 1.1; 1.2) 1.3 Formale Struktur als Kernelement Die bisher behandelten Elemente unserer Organisationsdefinition waren allesamt wichtig, um das Phänomen Organisation einzuordnen und zu verstehen. Das letzte näher zu behandelnde Element, die formale Struktur, muss man aber als den zentralen Bestandteil des Organisationsverständnisses herausstellen. Entsprechend verdient die formale Struktur eine vertiefende Behandlung Regelhaftigkeit der Organisation Mit der angesprochenen Kanalisierungsfunktion der Organisation für die Mitgliederaktivitäten sind wir unmittelbar bei dem wohl auffallendsten Merkmal angelangt, der Existenz einer formalen Struktur. Vor allem Max Weber, der für viele mit seinem Idealtypus der Bürokratie als der Begründer der wissenschaftlichen Betrachtungen von Organisationen gilt, hat die Regelhaftigkeit von Organisationen betont. Genauso wie Mitglieder benötigen Organisationen formale Regeln, die wir schon im Alltagsverständnis als eng mit der Organisation verbunden erleben: Organisatorische Regeln kennen wir, auch wenn wir noch nicht in Organisationen gearbeitet haben, bereits aus dem Alltag: In Stellenanzeigen lesen wir, dass mit einer Stelle bestimmte Aufgaben verbunden sind; wenn wir als Kunde zu einer Organisation kommen und etwas ausgefallenere Wünsche haben, so können wir mitunter beobachten, dass die Angestellten in Handbüchern oder Verfahrensrichtlinien Rat suchen. Wir hören Organisationsmitglieder manchmal darüber klagen, dass andere Organisationsmitglieder ihre Kompetenzen überschreiten oder den Dienstweg nicht einhalten. Studenten machen schließlich ihre Erfahrungen mit den Regelungen der Universität von der Einschreibung bis zum Examen. Alle diese Erfahrungen führen uns vor Augen, dass Handlungen in Organisationen in einem hohen Maße durch formale Regeln vorgegeben sind. (Kieser/Walgenbach 2003, S. 16 f.) ORGANISATION UND VERÄNDERUNGSMANAGEMENT 21
22 So benötigen Organisationen zunächst und vor allem Regeln zur Festlegung der Arbeitsteilung. Man stelle sich vor, die Arbeitnehmer von BASF in Ludwigshafen, dem größten zusammenhängenden industriellen Komplex in Deutschland mit vielen Tausenden Beschäftigten, müssten jeden Morgen aufs Neue überlegen, wer welche Aufgabe zu übernehmen hat. Ein solcher Abstimmungsprozess wäre schlicht nicht zu arrangieren. Selbst wenn er in kleineren Einheiten als der BASF, also in einem mittleren Unternehmen mit sagen wir 200 Beschäftigten, theoretisch möglich wäre, so würde er einen immensen Zeitaufwand erfordern. Außerdem besitzen nicht alle Beteiligten die erforderlichen Qualifikationen, um alle relevanten Aufgaben erfüllen zu können. 1.3 FORMALE STRUK- TUR ALS KERNELE- MENT Aus Gründen der Effizienz drängt es sich daher auf, bestimmte Aufgabenbündel zusammenzufassen und zu Stellen zu verdichten (dies gilt auch durchaus schon für den Kleinbetrieb). Außerdem brauchen die Stelleninhaber nur ein entsprechend begrenztes Repertoire an Qualifikationen: Ein Buchhalter bei BASF braucht nicht zugleich die Forschung und Entwicklung im Bereich chemischer Prozesse zu beherrschen. Außerdem macht sich die Organisation dadurch von bestimmten Personen unabhängig. Wird die Stelle des Buchhalters frei, kann sie neu ausgeschrieben und wiederbesetzt werden, ohne die gesamte Aufgabenverteilung neu vornehmen zu müssen. Andere formale Regeln betreffen die Koordination von Aktivitäten der Mitglieder oder das Arrangement der Leistungserstellungsprozesse. Aber auch zu vielen anderen Zwecken benötigt die Organisation Regelungen wie etwa um noch ein Beispiel zu nennen Verfahrensrichtlinien (z. B. für Investitionsanträge). Andere Regelungen werden wir im weiteren Verlauf dieses Moduls noch kennen lernen. Die Gesamtheit aller formalen Regelungen, die für Organisationen konstitutiv sind, wird als die formale Organisationsstruktur (oder kürzer: Formalstruktur) bezeichnet. Der Sinn der Strukturierung ist die Standardisierung von bestimmten Beziehungen oder sich wiederholenden Prozessen, die sich als geeignete Problemlösungsmuster aufdrängen oder schon erwiesen haben. Dies verspricht Effizienzgewinne durch Entlastung und klare Rollenzuweisung. Jedoch ist bekannt, dass es besonders im schnell wachsenden kleinen oder mittleren Unternehmen oft Strukturdefizite gibt. Dies hängt damit zusammen, dass die Gegebenheiten und Abläufe stark auf die Persönlichkeit des Unternehmers zugeschnitten sind, von diesem bestimmt werden. Das Delegationsproblem des mittelständischen Unternehmers, der die Fäden nur ungern aus der Hand gibt, ist fast schon sprichwörtlich. Hinzu kommt, dass die Arbeitsbeziehungen, was Untersuchungen immer wieder bestätigen (z. B. Kotthoff/Reindl 1990, S. 354 ff.), stark von großem Einverständnis und spontaner Kooperation geprägt sind. Das heißt, viele Probleme der Arbeitsteilung und Handlungskoordination werden im Kleinbetrieb unmittelbar und spontan zwischen den Organisationsmitgliedern gelöst, ohne dass es einer ausgeprägten Struktur bedarf. Allerdings zeigt gerade das wachsende Unternehmen auch schnell die Grenzen dieser Kooperationsform ORGANISATION UND VERÄNDERUNGSMANAGEMENT 22
23 auf und unterstreicht die Effizienzvorteile der Verfestigung struktureller Regelungen. Dies haben auch nicht zuletzt die Erfahrungen mit den Unternehmen der New economy gezeigt, denen zum großen Teil ein Organisationsdefizit nachgesagt wurde und wird. 1.3 FORMALE STRUK- TUR ALS KERNELE- MENT Schüsselwörter: Regelhaftigkeit, Arbeitsteilung, Formalstruktur, Strukturdefizite Entstehung formaler Regeln Wie aber kommt die formale Organisationsstruktur in einem Unternehmen zustande? Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Bereits im Zusammenhang mit den Ausführungen zur Mitgliedschaft wurde deutlich, dass die Arbeitnehmer über (Arbeits-) Verträge in die Organisation eingebunden werden. Mit ihrer Unterschrift dokumentieren sie die Anerkennung des arbeitgeberseitigen Direktionsrechts. Damit wird klar, dass Unternehmen auch offene Herrschaftsverbände sind. Der Arbeitgeber oder der sog. dispositive Faktor (in der Terminologie eines der wohl bekanntesten deutschen Betriebswirte, Erich Gutenberg) wird durch sein Direktionsrecht legitimiert, einseitig Festlegungen zur Organisationsstruktur zu treffen, ohne dass es dazu des Einverständnisses der Arbeitnehmer bedarf. Dies wird in der oft beschriebenen autokratisch-patriarchalischen Struktur kleinerer und mittlerer Unternehmen natürlich besonders prägnant hervortreten. In größeren Unternehmen wird der Arbeitgeber in dieser Funktion von seinem Stab von Führungskräften unterstützt. Z.T. haben Großunternehmen auch spezifische Organisationsabteilungen, die sich mit Fragen der Strukturbildung eingehend beschäftigen, etwa indem sie untersuchen, analysieren, Vorschläge für Aufgabenverteilung oder Arbeitsabläufe machen usw. Diese Abteilungen sind aber in der Regel typische Stabsressorts, die die Entscheidungen vorbereiten, sie aber nicht selbst treffen. Eine solche Infrastruktur ist im kleineren Betrieb naturgemäß nicht vorhanden, so dass der Unternehmer hier selbst in der Strukturgestaltung Hand anlegen muss. Nach einer Untersuchung von Röthig/Thom 1988, S. 336) ist erst ab etwa einer Betriebsgröße von 500 Beschäftigten zu erwarten, dass es entscheidungsvorbereitende und -unterstützende hauptamtliche Organisatoren gibt. So kann der Arbeitgeber z. B. nach Maßgabe von Effizienzüberlegungen entscheiden, wie viele und welche Abteilungen gebildet werden und wie die Grobverteilung von Aufgaben und Kompetenzen vorzunehmen ist. Er kann festlegen, dass bestimmte Abläufe in einer spezifischen Form abzulaufen haben oder irgendwelche Verfahrensrichtlinien einführen. Allerdings würde man die Realität, gerade auch im kleineren Betrieb, grob verkennen mit der Behauptung, formale Regelungen kämen ausschließlich auf diese Weise zustande. Beispiele für andere Quellen sind: ORGANISATION UND VERÄNDERUNGSMANAGEMENT 23
24 Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats tangieren das Direktionsrecht (z. B. beim Einsatz der EDV und anderer Maschinensysteme; jedoch ist dieser Aspekt mangels Existenz einer Interessenvertretung in den meisten kleineren Unternehmen nicht so relevant). 1.3 FORMALE STRUK- TUR ALS KERNELE- MENT Regeln entstehen mikropolitisch, z. B. wegen der Expertenmacht der Menschen vor Ort (z. B. Gruppenleiter und Mitarbeiter einigen sich auf bestimmte Vorgehensweisen). Regeln entstehen als kollektiver Lernprozess: Organisationsmitglieder entwickeln Routineprogramme; sie wiederholen Handlungsmuster, die sich für die Lösung bestimmter Probleme als zweckmäßig erwiesen haben. Regeln existieren qua Tradition, wobei etwa generalisierte Berufsbilder eine wichtige Rolle spielen. So bekommen z. B. Handwerker, Ärzte oder auch EDV-Spezialisten eine Vielzahl von Regeln und Routineprogrammen bereits durch ihre Ausbildung vermittelt. Wichtig ist schließlich die Feststellung, dass formale Regeln nicht irgendwo am Reißbrett und erst recht nicht in einem Guss entworfen und dann umgesetzt werden. Bei den formalen Regelungen finden laufend Veränderungen statt. Eingeführte Verfahrensrichtlinien werden wieder zurückgenommen und durch andere ersetzt, weil sich die Problemstellungen verändert haben. Einzelne Stellen oder gar ganze Abteilungen werden hinzugefügt oder aufgelöst. Insofern ist die organisationale Realität durch ein kompliziertes Wechselspiel von Strukturen und Prozessen geprägt. Schlüsselwörter: Arbeitsvertrag, Direktionsrecht, Herrschaft Aufgaben zur Lernkontrolle: 1.3.1a Bitte erklären Sie, warum formale Regeln für eine Organisation so wichtig sind! Was genau sind die Effizienzvorteile formaler Regeln? 1.3.1b Überlegen sich bitte jeweils zwei bis drei Beispiele für formale Regeln, die in den folgenden Organisationstypen oft eine Rolle spielen: Schulen Krankenhäuser Gefängnisse Gewerkschaften Unternehmen! ORGANISATION UND VERÄNDERUNGSMANAGEMENT 24
25 1.3.2a Erörtern Sie die Standardform des Zustandekommens formaler Regeln in erwerbswirtschaftlichen Organisationen (Unternehmen)! Welche anderen Möglichkeiten sind Ihnen bekannt, wie Regeln entstehen können? 1.3.2b Halten Sie die Vorstellung, dass Strukturregelungen aufgrund von Rationalitätsannahmen zentral geplant werden sollten, für sinnvoll und realistisch? Aufgaben mit Bezug zur Berufstätigkeit: Bitte benennen und umschreiben Sie mindestens drei spezifische Elemente der Organisationsstruktur aus Ihrem Unternehmen! Literatur zur Vertiefung: Kieser, A./Walgenbach, P. (2003): Organisation, 4. Aufl., Stuttgart (Kapitel 1.1) Schreyögg, G. (1996): Organisation, Wiesbaden (Kapitel 1.1; 1.2) 1.4 Organisation in kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) Die industrielle Gesellschaft war/ist fraglos geprägt von der Tendenz zur bürokratischen Großorganisation. Der anhaltende Trend zur Schaffung immer größerer Einheiten durch mergers and acquisitions (Mega-Fusionen) zeigt, dass die Faszination der Großorganisation ungebrochen ist. Gleichwohl haben sich, wie einleitend zu diesem Modul gezeigt, historische Prognosen als irrig erwiesen, die von einem Ende kleinerer Betriebsgrößen im Zuge der Entwicklung der industriellen Gesellschaft ausgingen. Nachfolgend ist noch genauer abzuklären, welche organisatorischen Besonderheiten KMU aufweisen und ob es überhaupt eine speziell kleinbetriebliche Fachorientierung in der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre gibt. ORGANISATION UND VERÄNDERUNGSMANAGEMENT 25
26 1.4.1 Charakteristika von KMU Für die Organisation von KMU ist charakteristisch, dass sie oft stark von der Persönlichkeit des Unternehmers geprägt sind (Familienbetriebe), aufgrund der geringen Betriebsgröße eher als das Großunternehmen auf der Grundlage eines engen sozialen Beziehungsgefüges und alltäglicher persönlicher Kontakte zwischen Unternehmer, Führungskräften und Mitarbeitern funktionieren ( spontane Koordination ; vgl. Mugler 1999, S. 111), daher auch in der Regel ein relativ geringes Ausmaß an formalen Regelungen und Strukturen aufweisen, entsprechend eine flache, wenig ausgeprägte Hierarchie haben (z. B. im typischen Handwerksbetrieb erstreckt sie sich über zwei, höchstens drei Stufen; vgl. Kübler 1992, Sp. 775 f.), die Dienst- und Instanzenwege kurz sind und das Unternehmen aufgrund der überschaubaren Größe und des relativ geringen Strukturierungsgrades ein vergleichsweise höheres Maß an Flexibilität gegenüber Großbetrieben aufweist. Nach einer Schweizer Untersuchung von Conrad/Lang (1995) weisen KMU in Abhängigkeit von ihrer Größe in der Regel die folgenden Leitungsebenen auf: in der Klasse von 6-20 Beschäftigten eine Leitungsebene, in der Klasse von Beschäftigten zwei Leitungsebenen, in der Klasse von Beschäftigten ebenfalls zwei Leitungsebenen, in der Klasse von Beschäftigten drei Leitungsebenen. In der Organisationslehre wie auch in der Organisationstheorie existiert trotz dieser Besonderheiten keine spezifische Perspektive für KMU. Erkennbar ist lediglich, dass häufig auf spezielle organisatorische Fragestellungen von KMU hingewiesen wird. Dazu gehört insbesondere das Delegationsproblem (vgl. schon Grochla u. a. 1981): Gerade in gewachsenen Familienunternehmen kommt es schnell zu einer Überlastung in der Spitze des Unternehmens. Der Unternehmer selbst hat aber wegen der intimen Kenntnis der Details und der großen persönlichen Verwobenheit mit den Geschicken seines Betriebes nur geringe Neigungen, Aufgaben und vor allem Entscheidungskompetenzen nach unten zu delegieren. Außerdem werden, wenn (intensiv) delegiert wird, andere Führungsqualitäten benötigt, die er möglicherweise (noch) nicht besitzt bzw. die erst erworben werden müssen. 1.4 ORGANISATION IN KMU ORGANISATION UND VERÄNDERUNGSMANAGEMENT 26
Vorgehensweise bei der Erstellung. von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten)
 Leuphana Universität Lüneburg Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen Abt. Rechnungswesen und Steuerlehre Vorgehensweise bei der Erstellung von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten) I. Arbeitsschritte
Leuphana Universität Lüneburg Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen Abt. Rechnungswesen und Steuerlehre Vorgehensweise bei der Erstellung von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten) I. Arbeitsschritte
Organisation und Führung
 Organisation und Führung Studienreihe Bildungsund Wissenschaftsmanagement Herausgegeben von Anke Hanft Band 3 Die Studienreihe ist hervorgegangen aus dem berufsbegleitenden internetgestützten Masterstudiengang
Organisation und Führung Studienreihe Bildungsund Wissenschaftsmanagement Herausgegeben von Anke Hanft Band 3 Die Studienreihe ist hervorgegangen aus dem berufsbegleitenden internetgestützten Masterstudiengang
Prof. Dr. Stephan Laske Dipl.-Oek. Claudia Meister-Scheytt Prof. Dr. Wendelin Küpers Dr. Jürgen Deeg. Organisation und Führung
 Prof. Dr. Stephan Laske Dipl.-Oek. Claudia Meister-Scheytt Prof. Dr. Wendelin Küpers Dr. Jürgen Deeg Organisation und Führung Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2014 Impressum Autoren: Prof. Dr.
Prof. Dr. Stephan Laske Dipl.-Oek. Claudia Meister-Scheytt Prof. Dr. Wendelin Küpers Dr. Jürgen Deeg Organisation und Führung Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2014 Impressum Autoren: Prof. Dr.
Fragestellungen. 2 Unternehmensführung und Management 2.1 Grundfunktionen der Unternehmensführung
 Fragestellungen 1 Unternehmen und Umwelt Als Stakeholder bezeichnet man die Kapitalgeber einer Unternehmung. (R/F) Bitte begründen! Nennen Sie beispielhaft 3 Stakeholder und ihre Beziehungen zum Unternehmen!
Fragestellungen 1 Unternehmen und Umwelt Als Stakeholder bezeichnet man die Kapitalgeber einer Unternehmung. (R/F) Bitte begründen! Nennen Sie beispielhaft 3 Stakeholder und ihre Beziehungen zum Unternehmen!
Astrid Stahlberg-Kirschke. Personalführung. Die veränderten Bedingungen für Führungserfolg
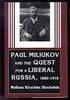 Astrid Stahlberg-Kirschke Personalführung Die veränderten Bedingungen für Führungserfolg Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen über http://dnb.ddb.de abrufbar. 7 www.weissensee-verlag.de
Astrid Stahlberg-Kirschke Personalführung Die veränderten Bedingungen für Führungserfolg Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen über http://dnb.ddb.de abrufbar. 7 www.weissensee-verlag.de
Wie führt eine Führungskraft?
 Wie führt eine Führungskraft? Überlegungen zur Rolle und zur Qualifikation von Führungskräften in Wirtschaft und Verwaltung Vortrag in der Reihe Wissenschaft trifft Wirtschaft Prof. Dr. rer. nat. Achim
Wie führt eine Führungskraft? Überlegungen zur Rolle und zur Qualifikation von Führungskräften in Wirtschaft und Verwaltung Vortrag in der Reihe Wissenschaft trifft Wirtschaft Prof. Dr. rer. nat. Achim
Modul: Betriebswirtschaftslehre BWL 1 A Veranstaltungsteil: Personal Themenbereich: Überblick Begriffliche Grundlagen
 Modul: Betriebswirtschaftslehre BWL 1 A Veranstaltungsteil: Personal Themenbereich: Überblick Begriffliche Grundlagen Fachhochschule Düsseldorf, Fachbereich Wirtschaft Personalmanagement im Überblick Personalbedarfsermittlung
Modul: Betriebswirtschaftslehre BWL 1 A Veranstaltungsteil: Personal Themenbereich: Überblick Begriffliche Grundlagen Fachhochschule Düsseldorf, Fachbereich Wirtschaft Personalmanagement im Überblick Personalbedarfsermittlung
Inhaltsübersicht Grundlagen der Organisation: Was ist unter Organisation zu verstehen?
 Inhaltsübersicht. 1 Grundlagen der Organisation: Was ist unter Organisation zu verstehen?... 1 1.1 Ein erster Blick in die Organisationspraxis: Organisation als Erfolgsfaktor... 1 1.2 Grundbegriffe der
Inhaltsübersicht. 1 Grundlagen der Organisation: Was ist unter Organisation zu verstehen?... 1 1.1 Ein erster Blick in die Organisationspraxis: Organisation als Erfolgsfaktor... 1 1.2 Grundbegriffe der
Kapitel 2, Führungskräftetraining, Kompetenzentwicklung und Coaching:
 Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Persönliches Beratungskonzept. Leitfaden zur Erarbeitung
 Persönliches Beratungskonzept Leitfaden zur Erarbeitung Inhaltsverzeichnis 1 Personale und fachliche Voraussetzungen: Qualifikation, Kernkompetenzen...4 2 Menschenbild Ethische Grundsätze rechtliche Grundlagen...4
Persönliches Beratungskonzept Leitfaden zur Erarbeitung Inhaltsverzeichnis 1 Personale und fachliche Voraussetzungen: Qualifikation, Kernkompetenzen...4 2 Menschenbild Ethische Grundsätze rechtliche Grundlagen...4
Ein gemeinsames Führungsverständnis aufbauen
 > Der Zweck und Ihr Nutzen Mit dem Bekenntnis zu einem einheitlichen Führungsverständnis ist beabsichtigt, das Führungsverhalten, das Erreichen der Unternehmensziele und die langfristige Unternehmenssicherung
> Der Zweck und Ihr Nutzen Mit dem Bekenntnis zu einem einheitlichen Führungsverständnis ist beabsichtigt, das Führungsverhalten, das Erreichen der Unternehmensziele und die langfristige Unternehmenssicherung
Feld, T. C. (2007): Volkshochschulen als lernende Organisationen. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
 Feld, T. C. (2007): n als lernende Organisationen. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. Im Zuge gesellschaftlicher Modernisierungsdynamiken verschieben sich für n politische, rechtliche, ökonomische und soziale
Feld, T. C. (2007): n als lernende Organisationen. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. Im Zuge gesellschaftlicher Modernisierungsdynamiken verschieben sich für n politische, rechtliche, ökonomische und soziale
Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren?
 Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Inhaltsverzeichnis. Vorwort der Herausgeber... V Vorwort des Verfassers zur 1. Auflage... VII Vorwort des Verfassers zur 5. Auflage...
 XI Vorwort der Herausgeber... V Vorwort des Verfassers zur 1. Auflage... VII Vorwort des Verfassers zur 5. Auflage... IX Abkürzungsverzeichnis... XVII Abbildungsverzeichnis... XX 1 Grundlagen der Organisation:
XI Vorwort der Herausgeber... V Vorwort des Verfassers zur 1. Auflage... VII Vorwort des Verfassers zur 5. Auflage... IX Abkürzungsverzeichnis... XVII Abbildungsverzeichnis... XX 1 Grundlagen der Organisation:
Dietmar Vahs. Organisation. Ein Lehr- und Managementbuch. 8., überarbeitete und erweiterte Auflage Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart
 Dietmar Vahs Organisation Ein Lehr- und Managementbuch 8., überarbeitete und erweiterte Auflage 2012 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart XIII Vorwort zur 8. Auflage Vorwort zur 1. Auflage Abkürzungsverzeichnis
Dietmar Vahs Organisation Ein Lehr- und Managementbuch 8., überarbeitete und erweiterte Auflage 2012 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart XIII Vorwort zur 8. Auflage Vorwort zur 1. Auflage Abkürzungsverzeichnis
Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld
 Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Insitutionalisierung - Eine Kulturtheorie am Beispiel des jagdlichen Brauchtums
 Geisteswissenschaft Deborah Falk Insitutionalisierung - Eine Kulturtheorie am Beispiel des jagdlichen Brauchtums Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung..3 2. Begriffsklärungen....4 2.1. Institution..4
Geisteswissenschaft Deborah Falk Insitutionalisierung - Eine Kulturtheorie am Beispiel des jagdlichen Brauchtums Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung..3 2. Begriffsklärungen....4 2.1. Institution..4
Handbuch Organisation gestalten
 Hans Glatz/Friedrich Graf-Götz Handbuch Organisation gestalten Für Praktiker aus Profit- und Non-Profit-Unternehmen, Trainer und Berater 2. Auflage Inhaltsverzeichnis 5 Inhaltsverzeichnis Wozu eine Beschäftigung
Hans Glatz/Friedrich Graf-Götz Handbuch Organisation gestalten Für Praktiker aus Profit- und Non-Profit-Unternehmen, Trainer und Berater 2. Auflage Inhaltsverzeichnis 5 Inhaltsverzeichnis Wozu eine Beschäftigung
Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik
 Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Publikationsanalyse zur Corporate Governance - Status Quo und Entwicklungsperspektiven
 Wirtschaft Kerstin Dittmann / Matthias Brockmann / Tobias Gödrich / Benjamin Schäfer Publikationsanalyse zur Corporate Governance - Status Quo und Entwicklungsperspektiven Wissenschaftlicher Aufsatz Strategisches
Wirtschaft Kerstin Dittmann / Matthias Brockmann / Tobias Gödrich / Benjamin Schäfer Publikationsanalyse zur Corporate Governance - Status Quo und Entwicklungsperspektiven Wissenschaftlicher Aufsatz Strategisches
Die Vertiefung Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement im Überblick. 1. Warum die Vertiefung?... Folie 2
 Die Vertiefung Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement im Überblick 1. Warum die Vertiefung?.... Folie 2 2. Was beinhaltet/leistet die Vertiefung Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement?..... Folie
Die Vertiefung Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement im Überblick 1. Warum die Vertiefung?.... Folie 2 2. Was beinhaltet/leistet die Vertiefung Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement?..... Folie
Personal und Führungsorganisation
 Personal Führungsorganisation Institut für Wirtschaftswissenschaft Prof. Dr. Wolfgang Pfau Julius-Albert-Str. 2, Zimmer 106 Tel. 05323-72-7620, wolfgang.pfau@tu-clausthal.de Wintersemester 2009/2010 Hinweise
Personal Führungsorganisation Institut für Wirtschaftswissenschaft Prof. Dr. Wolfgang Pfau Julius-Albert-Str. 2, Zimmer 106 Tel. 05323-72-7620, wolfgang.pfau@tu-clausthal.de Wintersemester 2009/2010 Hinweise
Leitbild. der Verwaltung der Universität zu Köln
 2 Leitbild der Verwaltung der Universität zu Köln Präambel Dieses Leitbild ist das Ergebnis von gründlichen Beratungen und lebendigen Diskussionen in der Dezernentenrunde unserer Verwaltung. Es bildet
2 Leitbild der Verwaltung der Universität zu Köln Präambel Dieses Leitbild ist das Ergebnis von gründlichen Beratungen und lebendigen Diskussionen in der Dezernentenrunde unserer Verwaltung. Es bildet
Organisation. Theorie, Gestaltung, Wandel. von Univ.-Prof. Dr. Ewald Scherm und Dr. Gotthard Pietsch. Mit Aufgaben und Fallstudien
 Organisation Theorie, Gestaltung, Wandel von Univ.-Prof. Dr. Ewald Scherm und Dr. Gotthard Pietsch Mit Aufgaben und Fallstudien Oldenbourg Verlag München Wien Vorwort Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis
Organisation Theorie, Gestaltung, Wandel von Univ.-Prof. Dr. Ewald Scherm und Dr. Gotthard Pietsch Mit Aufgaben und Fallstudien Oldenbourg Verlag München Wien Vorwort Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis
1. Gruppe: Organisationsbegriff Institutionell (Was ist die Organisation?)
 1. Gruppe: Organisationsbegriff Institutionell (Was ist die Organisation?) Situativer - die Organisation ist ein soziales Gebilde mit formaler Struktur und verfolgt dauerhaft ein Ziel (Maschine) - aber:
1. Gruppe: Organisationsbegriff Institutionell (Was ist die Organisation?) Situativer - die Organisation ist ein soziales Gebilde mit formaler Struktur und verfolgt dauerhaft ein Ziel (Maschine) - aber:
Managementwissen für eine innovative und lernende öffentliche Verwaltung
 Managementwissen für eine innovative und lernende öffentliche Verwaltung Grundlagen eines wirkungsorientierten, kreativen und ganzheitlichen Verwaltungsmanagements Bearbeitet von Sabine Zimmermann, Rüdiger
Managementwissen für eine innovative und lernende öffentliche Verwaltung Grundlagen eines wirkungsorientierten, kreativen und ganzheitlichen Verwaltungsmanagements Bearbeitet von Sabine Zimmermann, Rüdiger
Transitiver, intransitiver und reflexiver Bildungsbegriff
 Bildungsbegriff Transitiver, intransitiver und reflexiver Bildungsbegriff Werner Sesink Institut für Pädagogik. Technische Universität Darmstadt Pädagogisch gesehen geht es bei der Entwicklung eines Menschen
Bildungsbegriff Transitiver, intransitiver und reflexiver Bildungsbegriff Werner Sesink Institut für Pädagogik. Technische Universität Darmstadt Pädagogisch gesehen geht es bei der Entwicklung eines Menschen
Abbildungsverzeichnis...VI Tabellenverzeichnis... VII Abkürzungsverzeichnis...VIII
 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis...VI Tabellenverzeichnis... VII Abkürzungsverzeichnis...VIII 1 Einführung... 1 1.1 Problemstellung und Zielsetzung... 1 1.2 Aufbau und Vorgehensweise der Untersuchung...
Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis...VI Tabellenverzeichnis... VII Abkürzungsverzeichnis...VIII 1 Einführung... 1 1.1 Problemstellung und Zielsetzung... 1 1.2 Aufbau und Vorgehensweise der Untersuchung...
THEORETISCHE PERSPEKTIVEN DES PERSONALMANAGEMENTS
 Otto-von-Guericke Universität Magdeburg Fakultät für Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaft Institut für Berufs- und Betriebspädagogik THEORETISCHE PERSPEKTIVEN DES PERSONALMANAGEMENTS Proseminar:
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg Fakultät für Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaft Institut für Berufs- und Betriebspädagogik THEORETISCHE PERSPEKTIVEN DES PERSONALMANAGEMENTS Proseminar:
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1)
 Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
Führung und Ethik in Unternehmen
 Führung und Ethik in Unternehmen Christiane E. Theiss Workshop Teil I Führung und Ethik in Unternehmen WS Teil I 1. Einführung in Thematik Unternehmensethik 2. Ethik, Moral, Werte, Normen, Haltungen
Führung und Ethik in Unternehmen Christiane E. Theiss Workshop Teil I Führung und Ethik in Unternehmen WS Teil I 1. Einführung in Thematik Unternehmensethik 2. Ethik, Moral, Werte, Normen, Haltungen
Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten
 Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit
Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit
Entwicklungsberatung - wir begleiten und unterstützen Sie
 Entwicklungsberatung - wir begleiten und unterstützen Sie Eine umfassende Betreuung Ihrer Entwicklung im Rahmen einzelner PE/OE-Maßnahmen und integrierter, ganzheitlicher Entwicklungsprogramme ist uns
Entwicklungsberatung - wir begleiten und unterstützen Sie Eine umfassende Betreuung Ihrer Entwicklung im Rahmen einzelner PE/OE-Maßnahmen und integrierter, ganzheitlicher Entwicklungsprogramme ist uns
Vorlage für eine individuelle Lernzielvereinbarung im Modul zur Erlangung der staatlichen Anerkennung
 Vorlage für eine individuelle Lernzielvereinbarung im Modul zur Erlangung der staatlichen Anerkennung Name der Einrichtung Träger Name der Praxisanleitung Name des / der Studierenden Der vorliegende Entwurf
Vorlage für eine individuelle Lernzielvereinbarung im Modul zur Erlangung der staatlichen Anerkennung Name der Einrichtung Träger Name der Praxisanleitung Name des / der Studierenden Der vorliegende Entwurf
HERZLICH WILLKOMMEN. Revision der 9001:2015
 HERZLICH WILLKOMMEN Revision der 9001:2015 Volker Landscheidt Qualitätsmanagementbeauftragter DOYMA GmbH & Co 28876 Oyten Regionalkreisleiter DQG Elbe-Weser Die Struktur der ISO 9001:2015 Einleitung Kapitel
HERZLICH WILLKOMMEN Revision der 9001:2015 Volker Landscheidt Qualitätsmanagementbeauftragter DOYMA GmbH & Co 28876 Oyten Regionalkreisleiter DQG Elbe-Weser Die Struktur der ISO 9001:2015 Einleitung Kapitel
Lehrer als Beobachter schulischer Leistung
 Pädagogik Marco Schindler Lehrer als Beobachter schulischer Leistung Essay - CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITÄT - OLDENBURG FAKULTÄT II INSTITUT FÜR INFORMATIK, WIRTSCHAFTS- UND RECHTSWISSENSCHAFTEN Essay
Pädagogik Marco Schindler Lehrer als Beobachter schulischer Leistung Essay - CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITÄT - OLDENBURG FAKULTÄT II INSTITUT FÜR INFORMATIK, WIRTSCHAFTS- UND RECHTSWISSENSCHAFTEN Essay
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR KOMMUNIKATION, INFORMATIONSVERARBEITUNG UND ERGONOMIE FKIE UNSER FÜHRUNGSLEITBILD
 FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR KOMMUNIKATION, INFORMATIONSVERARBEITUNG UND ERGONOMIE FKIE UNSER FÜHRUNGSLEITBILD FÜHRUNG BEI FRAUNHOFER VISION UND STRATEGIE 2 »Wer seiner Führungsrolle gerecht werden will, muss
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR KOMMUNIKATION, INFORMATIONSVERARBEITUNG UND ERGONOMIE FKIE UNSER FÜHRUNGSLEITBILD FÜHRUNG BEI FRAUNHOFER VISION UND STRATEGIE 2 »Wer seiner Führungsrolle gerecht werden will, muss
Wissensbarrieren in kulturübergreifenden Unternehmenskooperationen. dargestellt am Beispiel deutsch-indischer Offshore Outsourcing-Projekte
 Wissensbarrieren in kulturübergreifenden Unternehmenskooperationen dargestellt am Beispiel deutsch-indischer Offshore Outsourcing-Projekte Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Wirtschaftswissenschaften
Wissensbarrieren in kulturübergreifenden Unternehmenskooperationen dargestellt am Beispiel deutsch-indischer Offshore Outsourcing-Projekte Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Wirtschaftswissenschaften
Förderung der Karrierechancen wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Konzept des Rektorats
 Förderung der Karrierechancen wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Konzept des Rektorats I. Einleitung Die Technische Universität Dortmund beschäftigt derzeit ca. 2.300 1 wissenschaftliche
Förderung der Karrierechancen wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Konzept des Rektorats I. Einleitung Die Technische Universität Dortmund beschäftigt derzeit ca. 2.300 1 wissenschaftliche
Organisation Theorie und Praxis aus ökonomischer Sicht
 Arnold Picot/ Helmut Dietl/ Egon Franck Marina Fiedler/ Susanne Royer Organisation Theorie und Praxis aus ökonomischer Sicht 6. Auflage Inhaltsübersicht 1 Zur Entstehung und Lösung des Organisationsproblems........
Arnold Picot/ Helmut Dietl/ Egon Franck Marina Fiedler/ Susanne Royer Organisation Theorie und Praxis aus ökonomischer Sicht 6. Auflage Inhaltsübersicht 1 Zur Entstehung und Lösung des Organisationsproblems........
Welche Professionalisierung des Hochschulmanagements?
 Welche Professionalisierung des Hochschulmanagements? Berinfor Hochschulevent 2016 «Modernes Hochschulmanagement Adaptation betriebswirtschaftlicher Konzepte in Universitäten und Hochschulen sinnvoll und
Welche Professionalisierung des Hochschulmanagements? Berinfor Hochschulevent 2016 «Modernes Hochschulmanagement Adaptation betriebswirtschaftlicher Konzepte in Universitäten und Hochschulen sinnvoll und
Einstiegskurs. Für Einsteigerinnen und Einsteiger in den agogischen Bereich. In Partnerschaft mit
 Für Einsteigerinnen und Einsteiger in den agogischen Bereich In Partnerschaft mit Einstiegskurs Wenn Sie eine Tätigkeit im Bereich der agogischen Begleitung aufgenommen haben, finden Sie im Einstiegskurs
Für Einsteigerinnen und Einsteiger in den agogischen Bereich In Partnerschaft mit Einstiegskurs Wenn Sie eine Tätigkeit im Bereich der agogischen Begleitung aufgenommen haben, finden Sie im Einstiegskurs
Bundespressekonferenz
 Bundespressekonferenz Mittwoch, den 29.Oktober 2014 Erklärung von Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.v. Deutscher Caritasverband e.v. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hauptvorstand Deutschland braucht
Bundespressekonferenz Mittwoch, den 29.Oktober 2014 Erklärung von Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.v. Deutscher Caritasverband e.v. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hauptvorstand Deutschland braucht
Nachhaltige Personalentwicklung
 Maren Lay Nachhaltige Personalentwicklung an Universitäten Konzeptionelle Grundlagen und empirische Untersuchungen vor dem Hintergrund befristeter Beschäftigungsverhältnisse von Wissenschaftlerinnen und
Maren Lay Nachhaltige Personalentwicklung an Universitäten Konzeptionelle Grundlagen und empirische Untersuchungen vor dem Hintergrund befristeter Beschäftigungsverhältnisse von Wissenschaftlerinnen und
Stellenbeschreibungen aus dem Blickwinkel der AVR neu
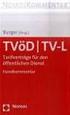 Stellenbeschreibungen aus dem Blickwinkel der AVR neu Dr. Kathrin Raitza / Michael Unger 8. Fachtagung 08.-10. Juni 2009 in Bonn 0. Inhaltsübersicht 1. Wozu brauchen wir überhaupt Stellenbeschreibungen?
Stellenbeschreibungen aus dem Blickwinkel der AVR neu Dr. Kathrin Raitza / Michael Unger 8. Fachtagung 08.-10. Juni 2009 in Bonn 0. Inhaltsübersicht 1. Wozu brauchen wir überhaupt Stellenbeschreibungen?
Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität
 Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität PD Dr. Rainer Strobl Universität Hildesheim Institut für Sozialwissenschaften & proval Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Analyse, Beratung und
Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität PD Dr. Rainer Strobl Universität Hildesheim Institut für Sozialwissenschaften & proval Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Analyse, Beratung und
Adam Smith und die Gerechtigkeit
 Geisteswissenschaft Patrick Weber Studienarbeit ADAM SMITH und die GERECHTIGKEIT Historisches Seminar der Universität Zürich Seminar: Gouvernementalität und neue Theorien der Macht Wintersemester 2006/2007
Geisteswissenschaft Patrick Weber Studienarbeit ADAM SMITH und die GERECHTIGKEIT Historisches Seminar der Universität Zürich Seminar: Gouvernementalität und neue Theorien der Macht Wintersemester 2006/2007
Lehrtext. Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Zentrale Einrichtung Fernstudienzentrum
 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Zentrale Einrichtung Fernstudienzentrum Psychologische Gesundheitsförderung für Krankenpflegepersonal Lehrtext Hilfreiche Gespräche Ilka Albers 1997 Zentrale Einrichtung
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Zentrale Einrichtung Fernstudienzentrum Psychologische Gesundheitsförderung für Krankenpflegepersonal Lehrtext Hilfreiche Gespräche Ilka Albers 1997 Zentrale Einrichtung
2. Funktion von Leitbildern Folgende Funktionen von Leitbildern können unterschieden werden:
 Leitbilder 1. Definition Leitbild Ein Leitbild stellt die Erklärung der allgemeinen Grundsätze einer Schule dar, die sich nach innen an die Mitarbeiter und SchülerInnen wenden und nach außen an Eltern
Leitbilder 1. Definition Leitbild Ein Leitbild stellt die Erklärung der allgemeinen Grundsätze einer Schule dar, die sich nach innen an die Mitarbeiter und SchülerInnen wenden und nach außen an Eltern
Lebensphasenorientierte Führung
 S1 Prof. Dr. Jutta Rump Ernst-Boehe-Str. 4 67059 Ludwigshafen 0621 / 5203-238 jutta.rump@ibe-ludwigshafen.de Lebensphasenorientierte Führung Dresden, den 12. März 2013 S2 Gliederung 1. Warum Lebensphasenorientierung?
S1 Prof. Dr. Jutta Rump Ernst-Boehe-Str. 4 67059 Ludwigshafen 0621 / 5203-238 jutta.rump@ibe-ludwigshafen.de Lebensphasenorientierte Führung Dresden, den 12. März 2013 S2 Gliederung 1. Warum Lebensphasenorientierung?
Unternehmensorganisation
 Unternehmensorganisation Lehrbuch der Organisation und strategischen Unternehmensfuhrung Von Universitätsprofessor Dr. Walter Schertier 7., unwesentlich veränderte Auflage R. Oldenbourg Verlag München
Unternehmensorganisation Lehrbuch der Organisation und strategischen Unternehmensfuhrung Von Universitätsprofessor Dr. Walter Schertier 7., unwesentlich veränderte Auflage R. Oldenbourg Verlag München
Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach:
![Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach: Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach:](/thumbs/50/26220103.jpg) Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Zielsetzung Jedes Unternehmen setzt sich Ziele Egal ob ein Unternehmen neu gegründet oder eine bestehende Organisation verändert werden soll, immer wieder
Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Zielsetzung Jedes Unternehmen setzt sich Ziele Egal ob ein Unternehmen neu gegründet oder eine bestehende Organisation verändert werden soll, immer wieder
1.1 Elemente des Unternehmungsmodells Elemente des Unternehmungsmodells S. 25. Klare Zielsetzungen
 1.1 Elemente des Unternehmungsmodells 1 1.1 Elemente des Unternehmungsmodells S. 25 Was ist die Basis für wirtschaftlichen Erfolg? Klare Zielsetzungen 1.1 Elemente des Unternehmungsmodells 2 1.1 Elemente
1.1 Elemente des Unternehmungsmodells 1 1.1 Elemente des Unternehmungsmodells S. 25 Was ist die Basis für wirtschaftlichen Erfolg? Klare Zielsetzungen 1.1 Elemente des Unternehmungsmodells 2 1.1 Elemente
1.1 Was soll mit der Lerndokumentation erreicht werden?
 Leitfaden zur Lerndokumentation 1 Die Lerndokumentation 1.1 Was soll mit der Lerndokumentation erreicht werden? a. Zum Ersten dokumentieren die Lernenden während der beruflichen Grundbildung ihre Arbeit
Leitfaden zur Lerndokumentation 1 Die Lerndokumentation 1.1 Was soll mit der Lerndokumentation erreicht werden? a. Zum Ersten dokumentieren die Lernenden während der beruflichen Grundbildung ihre Arbeit
Entscheidungsorientierte Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
 Entscheidungsorientierte Einführung in die Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Johann Nagengast Technische Hochschule Deggendorf Kapitel 1 Der Alltag eines Unternehmers Ein Angebot der vhb - virtuelle hochschule
Entscheidungsorientierte Einführung in die Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Johann Nagengast Technische Hochschule Deggendorf Kapitel 1 Der Alltag eines Unternehmers Ein Angebot der vhb - virtuelle hochschule
Andreas Meiwes Diözesan-Caritasdirektor. Statement zum K+D Kongress am 10.3.2012. - Es gilt das gesprochene Wort -
 Andreas Meiwes Diözesan-Caritasdirektor Statement zum K+D Kongress am 10.3.2012 - Es gilt das gesprochene Wort - Sehr geehrter Herr Bischof, sehr geehrte Sr. Basina, sehr geehrter Herr Generalvikar, sehr
Andreas Meiwes Diözesan-Caritasdirektor Statement zum K+D Kongress am 10.3.2012 - Es gilt das gesprochene Wort - Sehr geehrter Herr Bischof, sehr geehrte Sr. Basina, sehr geehrter Herr Generalvikar, sehr
I.O. BUSINESS. Checkliste Teamentwicklung
 I.O. BUSINESS Checkliste Teamentwicklung Gemeinsam Handeln I.O. BUSINESS Checkliste Teamentwicklung Der Begriff Team wird unterschiedlich gebraucht. Wir verstehen unter Team eine Gruppe von Mitarbeiterinnen
I.O. BUSINESS Checkliste Teamentwicklung Gemeinsam Handeln I.O. BUSINESS Checkliste Teamentwicklung Der Begriff Team wird unterschiedlich gebraucht. Wir verstehen unter Team eine Gruppe von Mitarbeiterinnen
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik
 Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
Menschenführung. DLRG KatS-Unterführer. PO 830 / PO 831 Menschenführung
 Menschenführung Menschenführung umfasst in der Psychologie alle Maßnahmen von Vorgesetzten, die auf die Kooperation, Koordination, und Kommunikation aller Angehörigen einer Organisation einwirken. In der
Menschenführung Menschenführung umfasst in der Psychologie alle Maßnahmen von Vorgesetzten, die auf die Kooperation, Koordination, und Kommunikation aller Angehörigen einer Organisation einwirken. In der
Wertewandel in Deutschland
 Geisteswissenschaft Miriam Fonfe Wertewandel in Deutschland Ein kurzer Überblick Studienarbeit EINLEITUNG UND DARSTELLUNG DER ARBEIT 3 WERTE UND WERTEWANDEL 4 Werte und Konsum 4 Phasen des Wertewandels
Geisteswissenschaft Miriam Fonfe Wertewandel in Deutschland Ein kurzer Überblick Studienarbeit EINLEITUNG UND DARSTELLUNG DER ARBEIT 3 WERTE UND WERTEWANDEL 4 Werte und Konsum 4 Phasen des Wertewandels
Controlling in Nonprofit- Organisationen
 Christian Horak Controlling in Nonprofit- Organisationen Erfolgsfaktoren und Instrumente 2. Auflage DeutscherUniversitätsVerlag GABLER VIEWEG WESTDEUTSCHER VERLAG INHALTSVERZEICHNIS 0 Einleitung 1 0.0
Christian Horak Controlling in Nonprofit- Organisationen Erfolgsfaktoren und Instrumente 2. Auflage DeutscherUniversitätsVerlag GABLER VIEWEG WESTDEUTSCHER VERLAG INHALTSVERZEICHNIS 0 Einleitung 1 0.0
Qualitätssicherung in der betrieblichen Ausbildung DEQA-VET Fachtagung
 22. September 2009, Bonn Vorstand Qualitätssicherung in der betrieblichen Ausbildung DEQA-VET Fachtagung Der betriebliche Teil der dualen Berufsausbildung findet unterschiedliche Bedingungen vor und ist
22. September 2009, Bonn Vorstand Qualitätssicherung in der betrieblichen Ausbildung DEQA-VET Fachtagung Der betriebliche Teil der dualen Berufsausbildung findet unterschiedliche Bedingungen vor und ist
Business Workshop. Reorganisation. Die Entwicklung der idealen Organisation
 Business Workshop Organisation GRONBACH Die Entwicklung der idealen Organisation Jedes Unternehmen steht irgendwann vor der Aufgabe, die Organisation an den aktuellen oder künftigen Gegebenheit anzupassen.
Business Workshop Organisation GRONBACH Die Entwicklung der idealen Organisation Jedes Unternehmen steht irgendwann vor der Aufgabe, die Organisation an den aktuellen oder künftigen Gegebenheit anzupassen.
Leitbild. des Jobcenters Dortmund
 Leitbild des Jobcenters Dortmund 2 Inhalt Präambel Unsere Kunden Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unser Jobcenter Unsere Führungskräfte Unser Leitbild Unser Jobcenter Präambel 03 Die gemeinsame
Leitbild des Jobcenters Dortmund 2 Inhalt Präambel Unsere Kunden Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unser Jobcenter Unsere Führungskräfte Unser Leitbild Unser Jobcenter Präambel 03 Die gemeinsame
Shared Services: Grundlegende Konzeption und konkrete Umsetzung im Bereich Human Resources
 Wirtschaft Christine Rössler Shared Services: Grundlegende Konzeption und konkrete Umsetzung im Bereich Human Resources Diplomarbeit Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Diplom-Betriebswirtin
Wirtschaft Christine Rössler Shared Services: Grundlegende Konzeption und konkrete Umsetzung im Bereich Human Resources Diplomarbeit Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Diplom-Betriebswirtin
Führungsverhaltensanalyse
 Führungsverhaltensanalyse 1 Fragebogen zur Einschätzung des Führungsverhaltens (FVA) Selbsteinschätzung Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen möglichst spontan und offen, indem Sie die zutreffende
Führungsverhaltensanalyse 1 Fragebogen zur Einschätzung des Führungsverhaltens (FVA) Selbsteinschätzung Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen möglichst spontan und offen, indem Sie die zutreffende
Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft 10. Vorlesung 22. Dezember Policy-Analyse 1: Einführung
 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft Policy-Analyse 1: Einführung 1 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft Vgl. Böhret, Carl u.a.: Innenpolitik und politische Theorie. Ein Studienbuch.
Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft Policy-Analyse 1: Einführung 1 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft Vgl. Böhret, Carl u.a.: Innenpolitik und politische Theorie. Ein Studienbuch.
11. Sozial-kognitive Persönlichkeitstheorien. Rotter und Bandura. Teil 11.b: Bandura
 10. Theorien der Persönlichkeit GHF im WiSe 2008 / 2009 an der HS MD- SDL(FH) im Studiengang Rehabilitationspsychologie, B.Sc., 1. Semester Persönlichkeitstheorien Rotter und Bandura Teil 11.b: Bandura
10. Theorien der Persönlichkeit GHF im WiSe 2008 / 2009 an der HS MD- SDL(FH) im Studiengang Rehabilitationspsychologie, B.Sc., 1. Semester Persönlichkeitstheorien Rotter und Bandura Teil 11.b: Bandura
Dietmar Vahs. Organisation. Ein Lehr- und Managementbuch. 9., überarbeitete und erweiterte Auflage. 2015 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart
 Dietmar Vahs Organisation Ein Lehr- und Managementbuch 9., überarbeitete und erweiterte Auflage 2015 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Vorwort zur 9. Auflage Vorwort zur 1. Auflage Abkürzungsverzeichnis
Dietmar Vahs Organisation Ein Lehr- und Managementbuch 9., überarbeitete und erweiterte Auflage 2015 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Vorwort zur 9. Auflage Vorwort zur 1. Auflage Abkürzungsverzeichnis
M 7.4 Mathematik im Alltag: Daten, Diagramme und Prozentrechnung
 M 7.4 Mathematik im Alltag: Daten, Diagramme und Prozentrechnung Dieses Kapitel dient vor allem der Wiederholung und Vertiefung bekannter Lerninhalte. Die Schüler haben sich im Rahmen des Lehrplanabschnitts
M 7.4 Mathematik im Alltag: Daten, Diagramme und Prozentrechnung Dieses Kapitel dient vor allem der Wiederholung und Vertiefung bekannter Lerninhalte. Die Schüler haben sich im Rahmen des Lehrplanabschnitts
Alfred Kieser/Peter Walgenbach. Organisation. 5., überarbeitete Auflage Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart
 Alfred Kieser/Peter Walgenbach Organisation 5., überarbeitete Auflage 2007 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart XI Vorworte AbbildungsVerzeichnis V XI XVII Tabellen Verzeichnis XXI 1. Einführung 1 1.1. Was
Alfred Kieser/Peter Walgenbach Organisation 5., überarbeitete Auflage 2007 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart XI Vorworte AbbildungsVerzeichnis V XI XVII Tabellen Verzeichnis XXI 1. Einführung 1 1.1. Was
Direktionsrecht. Zusammenfassung. Begriff. Gesetze, Vorschriften und Rechtsprechung. Arbeitsrecht. 1 Umfang HI LI
 TK Lexikon Arbeitsrecht Direktionsrecht Direktionsrecht HI520823 Zusammenfassung LI1097783 Begriff Das Direktionsrecht ist das Weisungsrecht des Arbeitgebers, die im Arbeitsvertrag nur rahmenmäßig umschriebene
TK Lexikon Arbeitsrecht Direktionsrecht Direktionsrecht HI520823 Zusammenfassung LI1097783 Begriff Das Direktionsrecht ist das Weisungsrecht des Arbeitgebers, die im Arbeitsvertrag nur rahmenmäßig umschriebene
LehrplanPLUS Gymnasium Geschichte Klasse 6. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. 1. Kompetenzorientierung
 Gymnasium Geschichte Klasse 6 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der neue Lehrplan für das Fach Geschichte ist kompetenzorientiert ausgerichtet. Damit ist die Zielsetzung verbunden, die Lernenden
Gymnasium Geschichte Klasse 6 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der neue Lehrplan für das Fach Geschichte ist kompetenzorientiert ausgerichtet. Damit ist die Zielsetzung verbunden, die Lernenden
Bachelorprüfung/Diplomvorprüfung Einführung in die Unternehmensführung (BWL 1)
 Bachelorprüfung/Diplomvorprüfung Einführung in die Unternehmensführung (BWL 1) Sommersemester 2011, 8. September 2011 Name, Vorname:... Ich bestätige hiermit, dass ich der Veröffentlichung Matr. Nr.:...
Bachelorprüfung/Diplomvorprüfung Einführung in die Unternehmensführung (BWL 1) Sommersemester 2011, 8. September 2011 Name, Vorname:... Ich bestätige hiermit, dass ich der Veröffentlichung Matr. Nr.:...
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW
 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2007 21. August 2007 Am 8. und 10. Mai 2007 wurden in
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2007 21. August 2007 Am 8. und 10. Mai 2007 wurden in
Begriffsdefinitionen
 Begriffsdefinitionen Sozialisation: Unter Sozialisation versteht man die Entstehung und Bildung der Persönlichkeit aufgrund ihrer Interaktion mit einer spezifischen materiellen, kulturellen und sozialen
Begriffsdefinitionen Sozialisation: Unter Sozialisation versteht man die Entstehung und Bildung der Persönlichkeit aufgrund ihrer Interaktion mit einer spezifischen materiellen, kulturellen und sozialen
Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung.
 Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung. Exposé aus Medienpädagogik Themenfeld Wechselverhältnis Medientheorie Medienpädagogik Artikel
Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung. Exposé aus Medienpädagogik Themenfeld Wechselverhältnis Medientheorie Medienpädagogik Artikel
Kinga Szűcs Friedrich-Schiller-Universität Jena Fakultät für Mathematik und Informatik Abteilung Didaktik
 Die Stufentheorie von Piaget Kinga Szűcs Friedrich-Schiller-Universität Jena Fakultät für Mathematik und Informatik Abteilung Didaktik 14.04.2016 Hintergrund Die umfassendste und bedeutendste Theorie des
Die Stufentheorie von Piaget Kinga Szűcs Friedrich-Schiller-Universität Jena Fakultät für Mathematik und Informatik Abteilung Didaktik 14.04.2016 Hintergrund Die umfassendste und bedeutendste Theorie des
Bedeutung der Kompetenzfeststellung für die Zulassung zur Externenprüfung
 Bedeutung der Kompetenzfeststellung für die Zulassung zur Externenprüfung Ergebnisse des Begleitprojektes zu Fragen der Zulassung zur Externenprüfung Impulsvortrag auf der Jahrestagung Perspektive Berufsabschluss
Bedeutung der Kompetenzfeststellung für die Zulassung zur Externenprüfung Ergebnisse des Begleitprojektes zu Fragen der Zulassung zur Externenprüfung Impulsvortrag auf der Jahrestagung Perspektive Berufsabschluss
Unser Pflegeleitbild. Ev. Diakoniewerk Friederikenstift Hannover
 Unser Pflegeleitbild Ev. Diakoniewerk Friederikenstift Hannover Vorwort Wir, die Pflegenden des Ev. Diakoniewerkes Friederikenstift, verstehen uns als Teil einer christlichen Dienstgemeinschaft, die uns
Unser Pflegeleitbild Ev. Diakoniewerk Friederikenstift Hannover Vorwort Wir, die Pflegenden des Ev. Diakoniewerkes Friederikenstift, verstehen uns als Teil einer christlichen Dienstgemeinschaft, die uns
Im Kolloqium wählen Sie eine dieser Säule aus und stellen in Ihrer Präsentation dar, wie sich diese Gegebenheiten auf die anderen Säulen auswirken.
 Das Kolloqium dauert 40 Minuten und besteht aus 15 Minuten Präsentation und 25 Minuten Gespräch. Sie haben einen Bericht geschrieben. Der Teil I Insitutionsanalyse des Berichtes besteht aus 4 Säulen: Konzepte
Das Kolloqium dauert 40 Minuten und besteht aus 15 Minuten Präsentation und 25 Minuten Gespräch. Sie haben einen Bericht geschrieben. Der Teil I Insitutionsanalyse des Berichtes besteht aus 4 Säulen: Konzepte
Arbeitsaufwand (workload) Moduldauer (laut Studienverlaufsplan) (laut Studienverlaufsplan)
 2. BA. Studiengang Erziehungswissenschaft - Beifach Modul 1: Einführung in die Erziehungswissenschaft 300 h 1 Semester 1./2. Semester 10 LP 1. Lehrveranstaltungen/Lehrformen Kontaktzeit Selbststudium VL:
2. BA. Studiengang Erziehungswissenschaft - Beifach Modul 1: Einführung in die Erziehungswissenschaft 300 h 1 Semester 1./2. Semester 10 LP 1. Lehrveranstaltungen/Lehrformen Kontaktzeit Selbststudium VL:
Bjarne Reuter Außenseiterkonstruktion - en som hodder, buster-trilogi
 Sprachen Tim Christophersen Bjarne Reuter Außenseiterkonstruktion - en som hodder, buster-trilogi Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG... 3 2 WAS IST EIN AUßENSEITER?... 3 3 REUTERS AUßENSEITERKONSTRUKTION...
Sprachen Tim Christophersen Bjarne Reuter Außenseiterkonstruktion - en som hodder, buster-trilogi Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG... 3 2 WAS IST EIN AUßENSEITER?... 3 3 REUTERS AUßENSEITERKONSTRUKTION...
Integration - ein hehres Ziel
 Geisteswissenschaft Anonym Integration - ein hehres Ziel Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Grundlagen zur Thematisierung und Behandlung von Menschen mit Behinderung... 3 2.1 Definition
Geisteswissenschaft Anonym Integration - ein hehres Ziel Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Grundlagen zur Thematisierung und Behandlung von Menschen mit Behinderung... 3 2.1 Definition
DISKUSSIONSBEITRÄGE DER FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE MERCATOR SCHOOL OF MANAGEMENT UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN. Nr. 350
 DISKUSSIONSBEITRÄGE DER FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE MERCATOR SCHOOL OF MANAGEMENT UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN Nr. 350 Ein konzeptioneller Business-Intelligence-Ansatz zur Gestaltung von Geschäftsprozessen
DISKUSSIONSBEITRÄGE DER FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE MERCATOR SCHOOL OF MANAGEMENT UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN Nr. 350 Ein konzeptioneller Business-Intelligence-Ansatz zur Gestaltung von Geschäftsprozessen
Erst Change Management macht ITIL Projekte erfolgreich
 www.apmg-international.com APMG-International Webinar Erst Change Management macht ITIL Projekte erfolgreich Wednesday 6 June 2012 / 14:00 CET Presented by Markus Bause, SERVIEW www.apmg-international.com
www.apmg-international.com APMG-International Webinar Erst Change Management macht ITIL Projekte erfolgreich Wednesday 6 June 2012 / 14:00 CET Presented by Markus Bause, SERVIEW www.apmg-international.com
Wissenschaftspropädeutik Gymnasium > Universität? Prof. Dr. A. Loprieno, 4. HSGYM-Herbsttagung, 12. November 2015
 Wissenschaftspropädeutik Gymnasium > Universität? Prof. Dr. A. Loprieno, 4. HSGYM-Herbsttagung, 12. November 2015 Gymnasium > Universität in historischer Perspektive Das frühneuzeitliche Modell (1500-1848):
Wissenschaftspropädeutik Gymnasium > Universität? Prof. Dr. A. Loprieno, 4. HSGYM-Herbsttagung, 12. November 2015 Gymnasium > Universität in historischer Perspektive Das frühneuzeitliche Modell (1500-1848):
Nachstehende Satzung wurde geprüft und in der 352. Sitzung des Senats am 20. Januar 2016 verabschiedet. Nur diese Satzung ist daher verbindlich!
 Nachstehende Satzung wurde geprüft und in der 352. Sitzung des Senats am 20. Januar 2016 verabschiedet. Nur diese Satzung ist daher verbindlich! Prof. Dr. Rainald Kasprik Prorektor für Studium und Lehre
Nachstehende Satzung wurde geprüft und in der 352. Sitzung des Senats am 20. Januar 2016 verabschiedet. Nur diese Satzung ist daher verbindlich! Prof. Dr. Rainald Kasprik Prorektor für Studium und Lehre
I.O. BUSINESS. Einführung von alternierender Telearbeit
 I.O. BUSINESS Eine Checkliste aus der Serie "Arbeitszeit" Einführung von alternierender Telearbeit Gemeinsam Handeln I.O. BUSINESS Checkliste Arbeitszeit Checkliste: Einführung von alternierender Telearbeit
I.O. BUSINESS Eine Checkliste aus der Serie "Arbeitszeit" Einführung von alternierender Telearbeit Gemeinsam Handeln I.O. BUSINESS Checkliste Arbeitszeit Checkliste: Einführung von alternierender Telearbeit
Einführung zur Kurseinheit Interview
 Interview 3 Einführung zur Kurseinheit Interview Bitte lesen Sie diese Einführung sorgfältig durch! Der Kurs 03420 umfasst zwei Kurseinheiten: die vorliegende Kurseinheit zur Interview-Methode und eine
Interview 3 Einführung zur Kurseinheit Interview Bitte lesen Sie diese Einführung sorgfältig durch! Der Kurs 03420 umfasst zwei Kurseinheiten: die vorliegende Kurseinheit zur Interview-Methode und eine
Prof. Dr. Thomas Breisig unter Mitarbeit von Christina Meyer-Truelsen. Organisation und Veränderungsmanagement
 Prof. Dr. Thomas Breisig unter Mitarbeit von Christina Meyer-Truelsen Organisation und Veränderungsmanagement Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2016 Impressum Autor: Prof. Dr. Thomas Breisig unter
Prof. Dr. Thomas Breisig unter Mitarbeit von Christina Meyer-Truelsen Organisation und Veränderungsmanagement Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2016 Impressum Autor: Prof. Dr. Thomas Breisig unter
Führungsstile & Umgang mit Konflikten (Teil I)
 Führungsstile & Umgang mit Konflikten (Teil I) Gastvortrag an der ETH Zürich Vorlesung Management Maya Bentele 17. Mai 2016 Führung im Überblick - Persönlichkeit - Grundposition - Reflexionsfähigkeit -
Führungsstile & Umgang mit Konflikten (Teil I) Gastvortrag an der ETH Zürich Vorlesung Management Maya Bentele 17. Mai 2016 Führung im Überblick - Persönlichkeit - Grundposition - Reflexionsfähigkeit -
Für bessere Arbeitsbedingungen, mehr Personal und höhere Löhne
 Für bessere Arbeitsbedingungen, mehr Personal und höhere Löhne - Gegen teure Symbolpolitik! Die Zeit ist reif Aufwertung der Pflege bessere Rahmenbedingungen drastische Anhebung der Krankenhausinvestitionen
Für bessere Arbeitsbedingungen, mehr Personal und höhere Löhne - Gegen teure Symbolpolitik! Die Zeit ist reif Aufwertung der Pflege bessere Rahmenbedingungen drastische Anhebung der Krankenhausinvestitionen
Institut für ökosoziales Management e.v.
 Institut für ökosoziales Management e.v. - Gesundheit Umwelt Soziales - Moderation eines Lokalen Agenda - Prozesses Erfahrungen und Möglichkeiten (Vortragsmanuskript anlässlich des Kolloquiums der Rostocker
Institut für ökosoziales Management e.v. - Gesundheit Umwelt Soziales - Moderation eines Lokalen Agenda - Prozesses Erfahrungen und Möglichkeiten (Vortragsmanuskript anlässlich des Kolloquiums der Rostocker
Forschendes Lernen im Kunstunterricht Anregungen zur Veränderung von Schule
 Forschendes Lernen im Kunstunterricht Anregungen zur Veränderung von Schule Impulsreferat zur Berliner Auftaktveranstaltung des Schulprogramms Kultur.Forscher der DKJS in Kooperation mit der PwC- Stiftung
Forschendes Lernen im Kunstunterricht Anregungen zur Veränderung von Schule Impulsreferat zur Berliner Auftaktveranstaltung des Schulprogramms Kultur.Forscher der DKJS in Kooperation mit der PwC- Stiftung
Demokratisierung und Marktwirtschaft in der VR China
 Wirtschaft Markus Schilling Demokratisierung und Marktwirtschaft in der VR China Studienarbeit Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Institut für Wirtschaftswissenschaften Kolloquium: Die
Wirtschaft Markus Schilling Demokratisierung und Marktwirtschaft in der VR China Studienarbeit Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Institut für Wirtschaftswissenschaften Kolloquium: Die
Matrix. Personalentwicklung. Sie sind ein Unternehmen und möchten gerne Personalentwicklung kostenminimiert einführen, oder erweitern?
 Personalentwicklung Sie sind ein Unternehmen und möchten gerne Personalentwicklung kostenminimiert einführen, oder erweitern? Voraussetzungen der Personalentwicklung Personalentwicklung darf nicht isoliert
Personalentwicklung Sie sind ein Unternehmen und möchten gerne Personalentwicklung kostenminimiert einführen, oder erweitern? Voraussetzungen der Personalentwicklung Personalentwicklung darf nicht isoliert
Städtisches Gymnasium Olpe. Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre
 Städtisches Gymnasium Olpe Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase 1-1. Halbjahr Halbjahresthema: Gotteslehre / Theologie Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie kann ich mit
Städtisches Gymnasium Olpe Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase 1-1. Halbjahr Halbjahresthema: Gotteslehre / Theologie Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie kann ich mit
Beuth Hochschule BEUTH HOCHSCHULE FÜR TECHNIK BERLIN University of Applied Sciences
 Beuth Hochschule BEUTH HOCHSCHULE FÜR TECHNIK BERLIN University of Applied Sciences WISSENSCHAFTLICHE WEITERBILDUNG Fernstudium Industrial Engineering Produktions- und Betriebstechnik Kurseinheit 95 Einführung
Beuth Hochschule BEUTH HOCHSCHULE FÜR TECHNIK BERLIN University of Applied Sciences WISSENSCHAFTLICHE WEITERBILDUNG Fernstudium Industrial Engineering Produktions- und Betriebstechnik Kurseinheit 95 Einführung
