Facetten der Codierungstheorie
|
|
|
- Erwin Glöckner
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 . p. 1/15 Facetten der Codierungstheorie Axel Kohnert, Alfred Wassermann Aachen SPP 1489 Februar Universität Bayreuth
2 . p. 2/15 Facetten Kombinatorische Optimierung Geometrie Kryptographie
3 . p. 3/15 Suche nach Codes mit Minimialdistanz d Suche nach [n, k, d] q -Code =
4 . p. 3/15 Suche nach Codes mit Minimialdistanz d Suche nach [n, k, d] q -Code = Suche nach Generatormatrix G
5 . p. 3/15 Suche nach Codes mit Minimialdistanz d Suche nach [n, k, d] q -Code = Suche nach Generatormatrix G G hat Minimumdistanz d
6 . p. 3/15 Suche nach Codes mit Minimialdistanz d Suche nach [n, k, d] q -Code = Suche nach Generatormatrix G G hat Minimumdistanz d Hamming-Gewicht jeder der q k 1 möglichen Nichtnull-Linearkombination (=vγ) der Zeilen d ist
7 . p. 3/15 Suche nach Codes mit Minimialdistanz d Suche nach [n, k, d] q -Code = Suche nach Generatormatrix G G hat Minimumdistanz d Hamming-Gewicht jeder der q k 1 möglichen Nichtnull-Linearkombination (=vγ) der Zeilen d ist Anzahl der Nullen jeweils (n d) ist.
8 . p. 4/15 Suche nach Generatormatrix mit Minimialdistanz d Insgesamt q k 1 mögliche Spalten γ einer Generatormatrix G.
9 . p. 4/15 Suche nach Generatormatrix mit Minimialdistanz d Insgesamt q k 1 mögliche Spalten γ einer Generatormatrix G. Der Beitrag der Spalte γ zum Codewort vg (des Informationswort v) ist gerade v, γ.
10 . p. 4/15 Suche nach Generatormatrix mit Minimialdistanz d Insgesamt q k 1 mögliche Spalten γ einer Generatormatrix G. Der Beitrag der Spalte γ zum Codewort vg (des Informationswort v) ist gerade v, γ. Konstruiere den gesuchten Code als Lösung eines Diophantischen Gleichungssystem.
11 . p. 5/15 Diophantischen Gleichungssystem kontrolliere, dass v, γ nicht zu oft Null wird.
12 . p. 5/15 Diophantischen Gleichungssystem kontrolliere, dass v, γ nicht zu oft Null wird. Definiere die Matrix M = M(q, k) als die ( ) ( ) q k 1 q k 1 Matrix (Zeilen = Informationswort v, Spalten =γ) durch M v,γ := { 1 falls v, γ = 0 0 sonst
13 . p. 6/15 Kombinatorische Optimierung Es ex ein [n, k, d] q -Code es existiert eine Lösung x N qk 1 von n d n d Mx T. n d n d mit der Nebenbedingung x i = n
14 . p. 7/15 Inzidenzgeometrie Wegen der Bilinearität von v, γ genügt es die q k 1 q 1 möglichen Zeilen und Spalten zu betrachten, deren erste Eintrag = 0 auf 1 normiert ist.
15 . p. 7/15 Inzidenzgeometrie Wegen der Bilinearität von v, γ genügt es die q k 1 q 1 möglichen Zeilen und Spalten zu betrachten, deren erste Eintrag = 0 auf 1 normiert ist. Neue Interpretation für M(q, k):
16 . p. 7/15 Inzidenzgeometrie Wegen der Bilinearität von v, γ genügt es die q k 1 q 1 möglichen Zeilen und Spalten zu betrachten, deren erste Eintrag = 0 auf 1 normiert ist. Neue Interpretation für M(q, k): Spalten werden durch die Punkte γ der projektiven Geometrie PG(k 1, q) gelabelt.
17 . p. 7/15 Inzidenzgeometrie Wegen der Bilinearität von v, γ genügt es die q k 1 q 1 möglichen Zeilen und Spalten zu betrachten, deren erste Eintrag = 0 auf 1 normiert ist. Neue Interpretation für M(q, k): Spalten werden durch die Punkte γ der projektiven Geometrie PG(k 1, q) gelabelt. Zeilen ebenso durch die Punkte v.
18 . p. 7/15 Inzidenzgeometrie Wegen der Bilinearität von v, γ genügt es die q k 1 q 1 möglichen Zeilen und Spalten zu betrachten, deren erste Eintrag = 0 auf 1 normiert ist. Neue Interpretation für M(q, k): Spalten werden durch die Punkte γ der projektiven Geometrie PG(k 1, q) gelabelt. Zeilen ebenso durch die Punkte v. Eintrag M v,γ ist 1 Punkt γ v.
19 . p. 8/15 Inzidenzgeometrie M ist die Inzidenzmatrix zwischen Punkten und Hyperebenen in PG(k 1, q).
20 . p. 8/15 Inzidenzgeometrie M ist die Inzidenzmatrix zwischen Punkten und Hyperebenen in PG(k 1, q). 0/1-Lösungen sind Punktmengen in PG(k 1, q).
21 . p. 8/15 Inzidenzgeometrie M ist die Inzidenzmatrix zwischen Punkten und Hyperebenen in PG(k 1, q). 0/1-Lösungen sind Punktmengen in PG(k 1, q). Es ex ein projektiver [n, k, d] q -Code es gibt n Punkte in PG(k 1, q) mit der Eigenschaft: jede Hyperebene enthält maximal n d dieser Punkte.
22 . p. 8/15 Inzidenzgeometrie M ist die Inzidenzmatrix zwischen Punkten und Hyperebenen in PG(k 1, q). 0/1-Lösungen sind Punktmengen in PG(k 1, q). Es ex ein projektiver [n, k, d] q -Code es gibt n Punkte in PG(k 1, q) mit der Eigenschaft: jede Hyperebene enthält maximal n d dieser Punkte. Arc-Problem in PG(k 1, q)
23 . p. 9/15 Inzidenzgeometrie Normalform der Generatormatrix liefert dann Normalform der Punktmenge.
24 . p. 9/15 Inzidenzgeometrie Normalform der Generatormatrix liefert dann Normalform der Punktmenge. Die Berücksichtigung von Körperautomorphismen liefert, dass die komplete Automorphismengruppe PΓL(k 1, q) von PG(k 1, q) betrachtet wird.
25 . p. 9/15 Inzidenzgeometrie Normalform der Generatormatrix liefert dann Normalform der Punktmenge. Die Berücksichtigung von Körperautomorphismen liefert, dass die komplete Automorphismengruppe PΓL(k 1, q) von PG(k 1, q) betrachtet wird. Hilft bei Klassifizierungsfragen.
26 . p. 9/15 Inzidenzgeometrie Normalform der Generatormatrix liefert dann Normalform der Punktmenge. Die Berücksichtigung von Körperautomorphismen liefert, dass die komplete Automorphismengruppe PΓL(k 1, q) von PG(k 1, q) betrachtet wird. Hilft bei Klassifizierungsfragen. nützliches Zusammenspiel: Geometrie Codierungstheorie
27 . p. 10/15 Hjelmslev Geometrie statt endlicher Körper: Ring Z 4 := Z/4Z.
28 . p. 10/15 Hjelmslev Geometrie statt endlicher Körper: Ring Z 4 := Z/4Z. Die projektive Geometrie der freien Untermoduln von Z k 4 wird mit PHG(k 1, Z 4) bezeichnet.
29 . p. 10/15 Hjelmslev Geometrie statt endlicher Körper: Ring Z 4 := Z/4Z. Die projektive Geometrie der freien Untermoduln von Z k 4 wird mit PHG(k 1, Z 4) bezeichnet. Beispiel einer endlichen projektiven Hjelmslev Geometrie.
30 . p. 10/15 Hjelmslev Geometrie statt endlicher Körper: Ring Z 4 := Z/4Z. Die projektive Geometrie der freien Untermoduln von Z k 4 wird mit PHG(k 1, Z 4) bezeichnet. Beispiel einer endlichen projektiven Hjelmslev Geometrie. Allgemeiner funktioniert dies für Kettenringe, d.h. Ringe deren Idealverband eine Kette bildet.
31 . p. 11/15 Hjelmslev Geometrie und Codierungstheorie Der Nordstrom-Robinson Code ist das bekannteste Beispiel eines binären nicht-linearen Codes, der besser (höhere Minimaldistanz bei gleicher Länge und Größe) ist, als es mit linearen Codes erreicht werden kann.
32 . p. 12/15 Hjelmslev Geometrie und Codierungstheorie Man erhält ihn als Bild des Z 4 Codes mit der Generatormatrix unter der Gray Abbildung (0 00, 1 01, 2 11, 3 10).
33 . p. 12/15 Hjelmslev Geometrie und Codierungstheorie Man erhält ihn als Bild des Z 4 Codes mit der Generatormatrix unter der Gray Abbildung (0 00, 1 01, 2 11, 3 10). Im Allgemeinen auch nicht freie Zeilen und Spalten.
34 . p. 13/15 Hjelmslev Geometrie und Codierungstheorie Das Zusammenspiel von Geometrie und Codierungstheorie ist nicht mehr so direkt.
35 . p. 13/15 Hjelmslev Geometrie und Codierungstheorie Das Zusammenspiel von Geometrie und Codierungstheorie ist nicht mehr so direkt. Geometrie: einige bekannte geometrische Konstruktionen aus PG(k 1, q) funktionieren auch in PHG(k 1, R) wenn R ein beliebiger Kettenring ist.
36 . p. 13/15 Hjelmslev Geometrie und Codierungstheorie Das Zusammenspiel von Geometrie und Codierungstheorie ist nicht mehr so direkt. Geometrie: einige bekannte geometrische Konstruktionen aus PG(k 1, q) funktionieren auch in PHG(k 1, R) wenn R ein beliebiger Kettenring ist. Codierungstheorie: neben dem Hamming- Gewicht weitere Gewichte ( z.b. Lee-Gewicht) wichtig. Was ist die richtige Definition der Äquivalenz?
37 . p. 14/15 Inzidenzgeometrie und Kryptographie Sicherheit von S-Boxen
38 . p. 14/15 Inzidenzgeometrie und Kryptographie Sicherheit von S-Boxen Eine boolesche Funktion f : F2 m Fn 2 (almost perfect nonlinear) falls für alle a F2 m\{0} und alle b Fn 2 gilt: heißt APN {x F m 2 : f(x+a) f(x) = b} 2.
39 . p. 14/15 Inzidenzgeometrie und Kryptographie Sicherheit von S-Boxen Eine boolesche Funktion f : F2 m Fn 2 (almost perfect nonlinear) falls für alle a F2 m\{0} und alle b Fn 2 gilt: heißt APN {x F m 2 : f(x+a) f(x) = b} 2. Dies ist eine Eigenschaft, die Angriffe (differential cryptanalysis) erschwert.
40 . p. 15/15 Inzidenzgeometrie und Kryptographie Man erhält eine Generatormatrix Γ( f) eines linearen [2 m, m+n] 2 -Codes indem man pro Spalte Urbild x T und Bild f(x) T notiert.
41 . p. 15/15 Inzidenzgeometrie und Kryptographie Man erhält eine Generatormatrix Γ( f) eines linearen [2 m, m+n] 2 -Codes indem man pro Spalte Urbild x T und Bild f(x) T notiert. APN kann als Eigenschaft des Codes zu Γ( f) definiert werden.
42 . p. 15/15 Inzidenzgeometrie und Kryptographie Man erhält eine Generatormatrix Γ( f) eines linearen [2 m, m+n] 2 -Codes indem man pro Spalte Urbild x T und Bild f(x) T notiert. APN kann als Eigenschaft des Codes zu Γ( f) definiert werden. Verbindung zur endlichen Geometrie.
43 . p. 15/15 Inzidenzgeometrie und Kryptographie Man erhält eine Generatormatrix Γ( f) eines linearen [2 m, m+n] 2 -Codes indem man pro Spalte Urbild x T und Bild f(x) T notiert. APN kann als Eigenschaft des Codes zu Γ( f) definiert werden. Verbindung zur endlichen Geometrie. Normalform (bzgl CCZ-Äquivalenz) und Klassifikation von APN Funktionen.
Einführung in die Kodierungstheorie
 Einführung in die Kodierungstheorie Einführung Vorgehen Beispiele Definitionen (Code, Codewort, Alphabet, Länge) Hamming-Distanz Definitionen (Äquivalenz, Coderate, ) Singleton-Schranke Lineare Codes Hamming-Gewicht
Einführung in die Kodierungstheorie Einführung Vorgehen Beispiele Definitionen (Code, Codewort, Alphabet, Länge) Hamming-Distanz Definitionen (Äquivalenz, Coderate, ) Singleton-Schranke Lineare Codes Hamming-Gewicht
Lineare Codes. Dipl.-Inform. Wolfgang Globke. Institut für Algebra und Geometrie Arbeitsgruppe Differentialgeometrie Universität Karlsruhe 1 / 19
 Lineare Codes Dipl.-Inform. Wolfgang Globke Institut für Algebra und Geometrie Arbeitsgruppe Differentialgeometrie Universität Karlsruhe 1 / 19 Codes Ein Code ist eine eindeutige Zuordnung von Zeichen
Lineare Codes Dipl.-Inform. Wolfgang Globke Institut für Algebra und Geometrie Arbeitsgruppe Differentialgeometrie Universität Karlsruhe 1 / 19 Codes Ein Code ist eine eindeutige Zuordnung von Zeichen
Definition Sei V ein Vektorraum, und seien v 1,..., v n V. Dann heißt eine Linearkombination. n λ i = 1. mit. v = v i λ i.
 Kapitel Geometrie Sei V ein Vektorraum, z.b. V = R 3. Wenn wir uns für geometrische Eigenschaften von R 3 interessieren, so stört manchmal die Ausnahmerolle des Nullvektors, die es ja in V gibt. Beispielsweise
Kapitel Geometrie Sei V ein Vektorraum, z.b. V = R 3. Wenn wir uns für geometrische Eigenschaften von R 3 interessieren, so stört manchmal die Ausnahmerolle des Nullvektors, die es ja in V gibt. Beispielsweise
Unimodularität. Kapitel 1. Peter Becker (H-BRS) Operations Research II Wintersemester 2015/16 11 / 206
 Kapitel 1 Unimodularität Peter Becker (H-BRS) Operations Research II Wintersemester 2015/16 11 / 206 Inhalt 1 Unimodularität Total unimodulare Matrizen Inzidenzmatrix Optimierungsprobleme auf Graphen Peter
Kapitel 1 Unimodularität Peter Becker (H-BRS) Operations Research II Wintersemester 2015/16 11 / 206 Inhalt 1 Unimodularität Total unimodulare Matrizen Inzidenzmatrix Optimierungsprobleme auf Graphen Peter
Geometrische Konstruktionen linearer Codes über Galois-Ringen der Charakteristik 4 von hoher homogener Minimaldistanz
 Universität Bayreuth Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik Dissertation Geometrische Konstruktionen linearer Codes über Galois-Ringen der Charakteristik 4 von hoher homogener Minimaldistanz Michael
Universität Bayreuth Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik Dissertation Geometrische Konstruktionen linearer Codes über Galois-Ringen der Charakteristik 4 von hoher homogener Minimaldistanz Michael
37 Gauß-Algorithmus und lineare Gleichungssysteme
 37 Gauß-Algorithmus und lineare Gleichungssysteme 37 Motivation Lineare Gleichungssysteme treten in einer Vielzahl von Anwendungen auf und müssen gelöst werden In Abschnitt 355 haben wir gesehen, dass
37 Gauß-Algorithmus und lineare Gleichungssysteme 37 Motivation Lineare Gleichungssysteme treten in einer Vielzahl von Anwendungen auf und müssen gelöst werden In Abschnitt 355 haben wir gesehen, dass
7 Vektorräume und Körperweiterungen
 $Id: vektor.tex,v 1.3 2009/05/25 15:03:47 hk Exp $ 7 Vektorräume und Körperweiterungen Wir sind gerade bei der Besprechung derjenigen Grundeigenschaften des Tensorprodukts, die mit vergleichsweise wenig
$Id: vektor.tex,v 1.3 2009/05/25 15:03:47 hk Exp $ 7 Vektorräume und Körperweiterungen Wir sind gerade bei der Besprechung derjenigen Grundeigenschaften des Tensorprodukts, die mit vergleichsweise wenig
In diesem Abschnitt betrachten wir nur quadratische Matrizen mit Komponenten aus einem Körper K, also A K n n für ein n N. Wenn (mit einem n > 1)
 34 Determinanten In diesem Abschnitt betrachten wir nur quadratische Matrizen mit Komponenten aus einem Körper K, also A K n n für ein n N Wenn (mit einem n > 1) a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A =, (1)
34 Determinanten In diesem Abschnitt betrachten wir nur quadratische Matrizen mit Komponenten aus einem Körper K, also A K n n für ein n N Wenn (mit einem n > 1) a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A =, (1)
Stichwortliste zur Vorlesung. Lineare Algebra II. Gabriela Weitze-Schmithüsen. Saarbrücken, Sommersemester 2016
 Stichwortliste zur Vorlesung Lineare Algebra II Gabriela Weitze-Schmithüsen Saarbrücken, Sommersemester 2016 Kapitel I Jordansche Normalform Ziel: Wir möchten Matrizen bis aus Ähnlichkeit klassifizieren.
Stichwortliste zur Vorlesung Lineare Algebra II Gabriela Weitze-Schmithüsen Saarbrücken, Sommersemester 2016 Kapitel I Jordansche Normalform Ziel: Wir möchten Matrizen bis aus Ähnlichkeit klassifizieren.
3 Der Hamming-Code. Hamming-Codes
 3 Der Hamming-Code Hamming-Codes Ein binärer Code C heißt ein Hamming-Code Ha s, wenn seine Kontrollmatrix H als Spalten alle Elemente in Z 2 s je einmal hat. Die Parameter eines n-k-hamming-codes sind:
3 Der Hamming-Code Hamming-Codes Ein binärer Code C heißt ein Hamming-Code Ha s, wenn seine Kontrollmatrix H als Spalten alle Elemente in Z 2 s je einmal hat. Die Parameter eines n-k-hamming-codes sind:
Lineare Hülle. span(a) := λ i v i : so dass k N, λ i R und v i A.
 Lineare Hülle Def A sei eine nichtleere Teilmenge des Vektorraums (V,+, ) Die lineare Hülle von A (Bezeichung: span(a)) ist die Menge aller Linearkombinationen der Elemente aus A { k } span(a) := λ i v
Lineare Hülle Def A sei eine nichtleere Teilmenge des Vektorraums (V,+, ) Die lineare Hülle von A (Bezeichung: span(a)) ist die Menge aller Linearkombinationen der Elemente aus A { k } span(a) := λ i v
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler im WS 2013/14 Lösungen zu den Übungsaufgaben (Vortragsübung) Blatt 7
 Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler im WS 203/4 Lösungen zu den Übungsaufgaben (Vortragsübung) Blatt 7 Aufgabe 27 Sei eine lineare Abbildung f : R 4 R 3 gegeben durch f(x, x 2, x 3 ) = (2 x 3 x 2
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler im WS 203/4 Lösungen zu den Übungsaufgaben (Vortragsübung) Blatt 7 Aufgabe 27 Sei eine lineare Abbildung f : R 4 R 3 gegeben durch f(x, x 2, x 3 ) = (2 x 3 x 2
1.5 Duales Gitter und Diskriminantengruppe
 Gitter und Codes c Rudolf Scharlau 24. April 2009 27 1.5 Duales Gitter und Diskriminantengruppe Dieser Abschnitt ist im wesentlichen algebraischer Natur: Es spielt keine Rolle, dass unsere Gitter in einem
Gitter und Codes c Rudolf Scharlau 24. April 2009 27 1.5 Duales Gitter und Diskriminantengruppe Dieser Abschnitt ist im wesentlichen algebraischer Natur: Es spielt keine Rolle, dass unsere Gitter in einem
Euklidische und unitäre Vektorräume
 Kapitel 7 Euklidische und unitäre Vektorräume In diesem Abschnitt ist der Körper K stets R oder C. 7.1 Definitionen, Orthonormalbasen Definition 7.1.1 Sei K = R oder C, und sei V ein K-Vektorraum. Ein
Kapitel 7 Euklidische und unitäre Vektorräume In diesem Abschnitt ist der Körper K stets R oder C. 7.1 Definitionen, Orthonormalbasen Definition 7.1.1 Sei K = R oder C, und sei V ein K-Vektorraum. Ein
Technische Universität München Zentrum Mathematik. Übungsblatt 7
 Technische Universität München Zentrum Mathematik Mathematik (Elektrotechnik) Prof. Dr. Anusch Taraz Dr. Michael Ritter Übungsblatt 7 Hausaufgaben Aufgabe 7. Für n N ist die Matrix-Exponentialfunktion
Technische Universität München Zentrum Mathematik Mathematik (Elektrotechnik) Prof. Dr. Anusch Taraz Dr. Michael Ritter Übungsblatt 7 Hausaufgaben Aufgabe 7. Für n N ist die Matrix-Exponentialfunktion
Lineare Gleichungssysteme
 Lineare Gleichungssysteme Sei K ein Körper, a ij K für 1 i m, 1 j n. Weiters seien b 1,..., b m K. Dann heißt a 11 x 1 + a 12 x 2 +... + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 +... + a 2n x n = b 2... a m1
Lineare Gleichungssysteme Sei K ein Körper, a ij K für 1 i m, 1 j n. Weiters seien b 1,..., b m K. Dann heißt a 11 x 1 + a 12 x 2 +... + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 +... + a 2n x n = b 2... a m1
Eigenwerte und Diagonalisierung
 Eigenwerte und Diagonalisierung Wir wissen von früher: Seien V und W K-Vektorräume mit dim V = n, dim W = m und sei F : V W linear. Werden Basen A bzw. B in V bzw. W gewählt, dann hat F eine darstellende
Eigenwerte und Diagonalisierung Wir wissen von früher: Seien V und W K-Vektorräume mit dim V = n, dim W = m und sei F : V W linear. Werden Basen A bzw. B in V bzw. W gewählt, dann hat F eine darstellende
Übungen zum Ferienkurs Lineare Algebra WS 14/15
 Übungen zum Ferienkurs Lineare Algebra WS 14/15 Linearkombinationen, Basen, Lineare Abbildungen 2.1 Lineare Unabhängigkeit Sind die folgenden Vektoren linear unabhängig? (a) 1, 2, 3 im Q Vektorraum R (b)
Übungen zum Ferienkurs Lineare Algebra WS 14/15 Linearkombinationen, Basen, Lineare Abbildungen 2.1 Lineare Unabhängigkeit Sind die folgenden Vektoren linear unabhängig? (a) 1, 2, 3 im Q Vektorraum R (b)
Urbild Angriff auf Inkrementelle Hashfunktionen
 Urbild Angriff auf Inkrementelle Hashfunktionen AdHash Konstruktion: (Bellare, Micciancio 1997) Hashe Nachricht x = (x 1,..., x k ) als H(x) = k i=1 h(i, x i) mod M. Inkrementell: Block x i kann leicht
Urbild Angriff auf Inkrementelle Hashfunktionen AdHash Konstruktion: (Bellare, Micciancio 1997) Hashe Nachricht x = (x 1,..., x k ) als H(x) = k i=1 h(i, x i) mod M. Inkrementell: Block x i kann leicht
2 Die Dimension eines Vektorraums
 2 Die Dimension eines Vektorraums Sei V ein K Vektorraum und v 1,..., v r V. Definition: v V heißt Linearkombination der Vektoren v 1,..., v r falls es Elemente λ 1,..., λ r K gibt, so dass v = λ 1 v 1
2 Die Dimension eines Vektorraums Sei V ein K Vektorraum und v 1,..., v r V. Definition: v V heißt Linearkombination der Vektoren v 1,..., v r falls es Elemente λ 1,..., λ r K gibt, so dass v = λ 1 v 1
Theoretische Grundlagen der Informatik WS 09/10
 Theoretische Grundlagen der Informatik WS 09/10 - Tutorium 6 - Michael Kirsten und Kai Wallisch Sitzung 13 02.02.2010 Inhaltsverzeichnis 1 Formeln zur Berechnung Aufgabe 1 2 Hamming-Distanz Aufgabe 2 3
Theoretische Grundlagen der Informatik WS 09/10 - Tutorium 6 - Michael Kirsten und Kai Wallisch Sitzung 13 02.02.2010 Inhaltsverzeichnis 1 Formeln zur Berechnung Aufgabe 1 2 Hamming-Distanz Aufgabe 2 3
Affine Geometrie (Einfachere, konstruktive Version)
 Affine Geometrie (Einfachere, konstruktive Version) Def. Affiner Raum der Dimension n über Körper K ist nach Definition K n. Bemerkung. Man könnte Theorie von affinen Raumen auch axiomatisch aufbauen mit
Affine Geometrie (Einfachere, konstruktive Version) Def. Affiner Raum der Dimension n über Körper K ist nach Definition K n. Bemerkung. Man könnte Theorie von affinen Raumen auch axiomatisch aufbauen mit
Codes und Codegitter. Katharina Distler. 27. April 2015
 Codes und Codegitter Katharina Distler 7. April 015 Inhaltsverzeichnis 1 Codes 4 Codegitter 14 Einleitung Die folgende Seminararbeit behandelt das Konzept von Codes und Codegittern. Da sie bei der Informationsübertragung
Codes und Codegitter Katharina Distler 7. April 015 Inhaltsverzeichnis 1 Codes 4 Codegitter 14 Einleitung Die folgende Seminararbeit behandelt das Konzept von Codes und Codegittern. Da sie bei der Informationsübertragung
Wiederholungsblatt Elementargeometrie LÖSUNGSSKIZZE
 Wiederholungsblatt Elementargeometrie im SS 01 bei Prof. Dr. S. Goette LÖSUNGSSKIZZE Die Lösungen unten enthalten teilweise keine vollständigen Rechnungen. Es sind aber alle wichtigen Zwischenergebnisse
Wiederholungsblatt Elementargeometrie im SS 01 bei Prof. Dr. S. Goette LÖSUNGSSKIZZE Die Lösungen unten enthalten teilweise keine vollständigen Rechnungen. Es sind aber alle wichtigen Zwischenergebnisse
Einführung. Vorlesungen zur Komplexitätstheorie: Reduktion und Vollständigkeit (3) Vorlesungen zur Komplexitätstheorie. K-Vollständigkeit (1/5)
 Einführung 3 Vorlesungen zur Komplexitätstheorie: Reduktion und Vollständigkeit (3) Univ.-Prof. Dr. Christoph Meinel Hasso-Plattner-Institut Universität Potsdam, Deutschland Hatten den Reduktionsbegriff
Einführung 3 Vorlesungen zur Komplexitätstheorie: Reduktion und Vollständigkeit (3) Univ.-Prof. Dr. Christoph Meinel Hasso-Plattner-Institut Universität Potsdam, Deutschland Hatten den Reduktionsbegriff
Codierungstheorie. Anton Betten Harald Fripertinger Adalbert Kerber Alfred Wassermann Karl-Heinz Zimmermann. Konstruktion und Anwendung linearer Codes
 Anton Betten Harald Fripertinger Adalbert Kerber Alfred Wassermann Karl-Heinz Zimmermann Codierungstheorie Konstruktion und Anwendung linearer Codes Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris
Anton Betten Harald Fripertinger Adalbert Kerber Alfred Wassermann Karl-Heinz Zimmermann Codierungstheorie Konstruktion und Anwendung linearer Codes Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris
1 0 1, V 3 = M, und λ A = λa
 Aufgabe 57. Magische Quadrate Eine reelle 3 3-Matrix A = a 11 a 12 a 13 a 21 a 22 a 23 heißt magisches Quadrat, falls alle Zeilensummen, alle Spaltensummen und die beiden Diagonalsummen a 11 + a 22 + a
Aufgabe 57. Magische Quadrate Eine reelle 3 3-Matrix A = a 11 a 12 a 13 a 21 a 22 a 23 heißt magisches Quadrat, falls alle Zeilensummen, alle Spaltensummen und die beiden Diagonalsummen a 11 + a 22 + a
9.2 Invertierbare Matrizen
 34 9.2 Invertierbare Matrizen Die Division ist als Umkehroperation der Multiplikation definiert. Das heisst, für reelle Zahlen a 0 und b gilt b = a genau dann, wenn a b =. Übertragen wir dies von den reellen
34 9.2 Invertierbare Matrizen Die Division ist als Umkehroperation der Multiplikation definiert. Das heisst, für reelle Zahlen a 0 und b gilt b = a genau dann, wenn a b =. Übertragen wir dies von den reellen
4.0.2 Beispiel (Einfacher Wiederholungscode). Im einfachsten Fall wird die Nachricht einfach wiederholt. D.h. man verwendet die Generatorabbildung
 Wir beschäftigen uns mit dem Problem, Nachrichten über einen störungsanfälligen Kanal (z.b. Internet, Satelliten, Schall, Speichermedium) zu übertragen. Wichtigste Aufgabe in diesem Zusammenhang ist es,
Wir beschäftigen uns mit dem Problem, Nachrichten über einen störungsanfälligen Kanal (z.b. Internet, Satelliten, Schall, Speichermedium) zu übertragen. Wichtigste Aufgabe in diesem Zusammenhang ist es,
Der Golay-Code und das Leech-Gitter
 Der Golay-Code und das Leech-Gitter Vortrag zum Seminar Gitter und Codes Nils Malte Pawelzik.5.5 Inhaltsverzeichnis Designs 3. Elementare Eigenschaften eines Designs und die Eindeutigkeit eines - (, 5,
Der Golay-Code und das Leech-Gitter Vortrag zum Seminar Gitter und Codes Nils Malte Pawelzik.5.5 Inhaltsverzeichnis Designs 3. Elementare Eigenschaften eines Designs und die Eindeutigkeit eines - (, 5,
Elemente von S n = Aut([1, n]) heißen Permutationen. Spezielle Permutationen sind Transpositionen und Zyklen. (Vergl. Skript S
![Elemente von S n = Aut([1, n]) heißen Permutationen. Spezielle Permutationen sind Transpositionen und Zyklen. (Vergl. Skript S Elemente von S n = Aut([1, n]) heißen Permutationen. Spezielle Permutationen sind Transpositionen und Zyklen. (Vergl. Skript S](/thumbs/48/24062974.jpg) Begriffe Faser: Es sei f : M N eine Abbildung von Mengen. Es sei n N. Die Menge f 1 ({n}) M nennt man die Faser in n. (Skript Seite 119). Parallel: Zwei Vektoren v und w heißen parallel, wenn für einen
Begriffe Faser: Es sei f : M N eine Abbildung von Mengen. Es sei n N. Die Menge f 1 ({n}) M nennt man die Faser in n. (Skript Seite 119). Parallel: Zwei Vektoren v und w heißen parallel, wenn für einen
Übungen zur Linearen Algebra 1
 Übungen zur Linearen Algebra 1 Wintersemester 014/015 Universität Heidelberg - IWR Prof. Dr. Guido Kanschat Dr. Dörte Beigel Philipp Siehr Blatt 7 Abgabetermin: Freitag, 05.1.014, 11 Uhr Aufgabe 7.1 (Vektorräume
Übungen zur Linearen Algebra 1 Wintersemester 014/015 Universität Heidelberg - IWR Prof. Dr. Guido Kanschat Dr. Dörte Beigel Philipp Siehr Blatt 7 Abgabetermin: Freitag, 05.1.014, 11 Uhr Aufgabe 7.1 (Vektorräume
Mathematik II für Studierende der Informatik. Wirtschaftsinformatik (Analysis und lineare Algebra) im Sommersemester 2016
 und Wirtschaftsinformatik (Analysis und lineare Algebra) im Sommersemester 2016 25. April 2016 Die Dimensionsformel Definition 3.9 Sei f : V W eine lineare Abbildung zwischen zwei K-Vektorräumen. Der Kern
und Wirtschaftsinformatik (Analysis und lineare Algebra) im Sommersemester 2016 25. April 2016 Die Dimensionsformel Definition 3.9 Sei f : V W eine lineare Abbildung zwischen zwei K-Vektorräumen. Der Kern
Codierungstheorie, Vorlesungsskript
 Codierungstheorie, Vorlesungsskript Irene I. Bouw Sommersemester 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Lineare Codes 2 1.1 Einführung.............................. 2 1.2 Eigenschaften linearer Codes....................
Codierungstheorie, Vorlesungsskript Irene I. Bouw Sommersemester 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Lineare Codes 2 1.1 Einführung.............................. 2 1.2 Eigenschaften linearer Codes....................
Lineare Algebra II 6. Übungsblatt
 Lineare Algebra II 6 Übungsblatt Fachbereich Mathematik SS 2011 Prof Dr Kollross 18/19 Mai 2011 Susanne Kürsten Tristan Alex Gruppenübung Aufgabe G1 (Minimalpolynom) Bestimmen Sie das Minimalpolynom der
Lineare Algebra II 6 Übungsblatt Fachbereich Mathematik SS 2011 Prof Dr Kollross 18/19 Mai 2011 Susanne Kürsten Tristan Alex Gruppenübung Aufgabe G1 (Minimalpolynom) Bestimmen Sie das Minimalpolynom der
Übungen zu Einführung in die Lineare Algebra und Geometrie
 Übungen zu Einführung in die Lineare Algebra und Geometrie Andreas Cap Sommersemester 2010 Kapitel 1: Einleitung (1) Für a, b Z diskutiere analog zur Vorlesung das Lösungsverhalten der Gleichung ax = b
Übungen zu Einführung in die Lineare Algebra und Geometrie Andreas Cap Sommersemester 2010 Kapitel 1: Einleitung (1) Für a, b Z diskutiere analog zur Vorlesung das Lösungsverhalten der Gleichung ax = b
1 Singulärwertzerlegung und Pseudoinverse
 Singulärwertzerlegung und Pseudoinverse Singulärwertzerlegung A sei eine Matrix mit n Spalten und m Zeilen. Zunächst sei n m. Bilde B = A A. Dies ist eine n n-matrix. Berechne die Eigenwerte von B. Diese
Singulärwertzerlegung und Pseudoinverse Singulärwertzerlegung A sei eine Matrix mit n Spalten und m Zeilen. Zunächst sei n m. Bilde B = A A. Dies ist eine n n-matrix. Berechne die Eigenwerte von B. Diese
Mathematik II für Studierende der Informatik. Wirtschaftsinformatik (Analysis und lineare Algebra) im Sommersemester 2015
 und Wirtschaftsinformatik (Analysis und lineare Algebra) im Sommersemester 2015 4. April 2016 Zu der Vorlesung wird ein Skript erstellt, welches auf meiner Homepage veröffentlicht wird: http://www.math.uni-hamburg.de/home/geschke/lehre.html
und Wirtschaftsinformatik (Analysis und lineare Algebra) im Sommersemester 2015 4. April 2016 Zu der Vorlesung wird ein Skript erstellt, welches auf meiner Homepage veröffentlicht wird: http://www.math.uni-hamburg.de/home/geschke/lehre.html
3 Elementare Umformung von linearen Gleichungssystemen und Matrizen
 3 Elementare Umformung von linearen Gleichungssystemen und Matrizen Beispiel 1: Betrachte das Gleichungssystem x 1 + x 2 + x 3 = 2 2x 1 + 4x 2 + 3x 3 = 1 3x 1 x 2 + 4x 3 = 7 Wir formen das GLS so lange
3 Elementare Umformung von linearen Gleichungssystemen und Matrizen Beispiel 1: Betrachte das Gleichungssystem x 1 + x 2 + x 3 = 2 2x 1 + 4x 2 + 3x 3 = 1 3x 1 x 2 + 4x 3 = 7 Wir formen das GLS so lange
x y f : R 2 R 3, Es gilt: Bild f = y : wobei x,y R Kern f = 0 (wird auf der nächsten Folie besprochen)
 Def Wiederholung Sei f : V U eine lineare Abbildung Das Bild von f ist die folgende Teilmenge von U: Bild f = {u U so dass es gibt ein Element v V mit f (v) = u} (Andere Bezeichnung: f (V) wird in Analysis-Vorlesung
Def Wiederholung Sei f : V U eine lineare Abbildung Das Bild von f ist die folgende Teilmenge von U: Bild f = {u U so dass es gibt ein Element v V mit f (v) = u} (Andere Bezeichnung: f (V) wird in Analysis-Vorlesung
Algorithmen zur Berechnung der Smith-Normalform und deren Implementation auf Parallelrechnern
 Algorithmen zur Berechnung der Smith-Normalform und deren Implementation auf Parallelrechnern Gerold Jäger Institut für Experimentelle Mathematik Ellernstraße 29 45326 Essen 20. Juli 2001 1 Einführung
Algorithmen zur Berechnung der Smith-Normalform und deren Implementation auf Parallelrechnern Gerold Jäger Institut für Experimentelle Mathematik Ellernstraße 29 45326 Essen 20. Juli 2001 1 Einführung
Die Abbildung (x 1 ;x 2 ) 7! (x 1 ;x 2 ; 1) ist eine Einbettung von R 2 in P 2 (als Mengen). Punkte mit z 6= 0 sind endliche" Punkte mit inhomogenen K
 Kapitel IV Projektive Geometrie In diesem Kapitel wird eine kurze Einführung in die projektive Geometrie gegeben. Es sollen unendlich ferne Punkte mit Hilfe von homogene Koordinaten eingeführt werden und
Kapitel IV Projektive Geometrie In diesem Kapitel wird eine kurze Einführung in die projektive Geometrie gegeben. Es sollen unendlich ferne Punkte mit Hilfe von homogene Koordinaten eingeführt werden und
(Allgemeine) Vektorräume (Teschl/Teschl 9)
 (Allgemeine) Vektorräume (Teschl/Teschl 9) Sei K ein beliebiger Körper. Ein Vektorraum über K ist eine (nichtleere) Menge V, auf der zwei Operationen deniert sind, die bestimmten Rechenregeln genügen:
(Allgemeine) Vektorräume (Teschl/Teschl 9) Sei K ein beliebiger Körper. Ein Vektorraum über K ist eine (nichtleere) Menge V, auf der zwei Operationen deniert sind, die bestimmten Rechenregeln genügen:
Lösung (die Geraden laufen parallel) oder unendlich viele Lösungen.
 1 Albert Ludwigs Universität Freiburg Abteilung Empirische Forschung und Ökonometrie Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler Dr. Sevtap Kestel Winter 2008 Kapitel 16 Determinanten und inverse Matrizen
1 Albert Ludwigs Universität Freiburg Abteilung Empirische Forschung und Ökonometrie Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler Dr. Sevtap Kestel Winter 2008 Kapitel 16 Determinanten und inverse Matrizen
2 Die Darstellung linearer Abbildungen durch Matrizen
 2 Die Darstellung linearer Abbildungen durch Matrizen V und V seien Vektorräume über einem Körper K. Hom K (V, V ) bezeichnet die Menge der K linearen Abbildungen von V nach V. Wir machen Hom K (V, V )
2 Die Darstellung linearer Abbildungen durch Matrizen V und V seien Vektorräume über einem Körper K. Hom K (V, V ) bezeichnet die Menge der K linearen Abbildungen von V nach V. Wir machen Hom K (V, V )
:= 1. Der affine Unterraum Γ heißt Punkt, Gerade, Ebene oder Hyperebene, wenn dim K dim K
 apitel II Lineare Algebra und analytische Geometrie 4 Punkte, Geraden, Ebenen, affine Unterräume in einem Vektorraum. Wie bisher ist V ein endlichdimensionaler Vektorraum über dem örper, oft ist V = n
apitel II Lineare Algebra und analytische Geometrie 4 Punkte, Geraden, Ebenen, affine Unterräume in einem Vektorraum. Wie bisher ist V ein endlichdimensionaler Vektorraum über dem örper, oft ist V = n
Lineare Algebra I Klausur. Klausur - Musterlösung
 Prof. Dr. B. Hanke Dr. J. Bowden Lineare Algebra I Klausur Klausur - Musterlösung 20. Februar 203 Aufgabe - Lösung Aussage wahr falsch (Z, +, 0) ist eine abelsche Gruppe. Der Ring Z/24Z ist nullteilerfrei.
Prof. Dr. B. Hanke Dr. J. Bowden Lineare Algebra I Klausur Klausur - Musterlösung 20. Februar 203 Aufgabe - Lösung Aussage wahr falsch (Z, +, 0) ist eine abelsche Gruppe. Der Ring Z/24Z ist nullteilerfrei.
Lineare Algebra für D-ITET, D-MATL, RW. Beispiellösung für Serie 10. Aufgabe ETH Zürich D-MATH. Herbstsemester Dr. V. Gradinaru D.
 Dr. V. Gradinaru D. Devaud Herbstsemester 5 Lineare Algebra für D-ITET, D-MATL, RW ETH Zürich D-MATH Beispiellösung für Serie Aufgabe..a Bezüglich des euklidischen Skalarprodukts in R ist die Orthogonalprojektion
Dr. V. Gradinaru D. Devaud Herbstsemester 5 Lineare Algebra für D-ITET, D-MATL, RW ETH Zürich D-MATH Beispiellösung für Serie Aufgabe..a Bezüglich des euklidischen Skalarprodukts in R ist die Orthogonalprojektion
Lineare Abbildungen. Es seien V und W Vektorräume über einem Körper K. Eine Abbildung f : V W heißt linear oder Homomorphismus, falls. d.h.
 Lineare Abbildungen Es seien V und W Vektorräume über einem Körper K. Eine Abbildung f : V W heißt linear oder Homomorphismus, falls (1) u, v V : f( u + v) = f( u) + f( v). (2) v V α K : f(α v) = αf( v).
Lineare Abbildungen Es seien V und W Vektorräume über einem Körper K. Eine Abbildung f : V W heißt linear oder Homomorphismus, falls (1) u, v V : f( u + v) = f( u) + f( v). (2) v V α K : f(α v) = αf( v).
entspricht der Länge des Vektorpfeils. Im R 2 : x =
 Norm (oder Betrag) eines Vektors im R n entspricht der Länge des Vektorpfeils. ( ) Im R : x = x = x + x nach Pythagoras. Allgemein im R n : x x = x + x +... + x n. Beispiele ( ) =, ( 4 ) = 5, =, 4 = 0.
Norm (oder Betrag) eines Vektors im R n entspricht der Länge des Vektorpfeils. ( ) Im R : x = x = x + x nach Pythagoras. Allgemein im R n : x x = x + x +... + x n. Beispiele ( ) =, ( 4 ) = 5, =, 4 = 0.
Lineare Algebra und Numerische Mathematik für D-BAUG
 P. Grohs T. Welti F. Weber Herbstsemester 5 Lineare Algebra und Numerische Mathematik für D-BAUG ETH Zürich D-MATH Beispiellösung für Serie Aufgabe. Skalarprodukt und Orthogonalität.a) Bezüglich des euklidischen
P. Grohs T. Welti F. Weber Herbstsemester 5 Lineare Algebra und Numerische Mathematik für D-BAUG ETH Zürich D-MATH Beispiellösung für Serie Aufgabe. Skalarprodukt und Orthogonalität.a) Bezüglich des euklidischen
Die Mathematik in der CD
 Lehrstuhl D für Mathematik RWTH Aachen Lehrstuhl D für Mathematik RWTH Aachen St.-Michael-Gymnasium Monschau 14. 09. 2006 Codes: Definition und Aufgaben Ein Code ist eine künstliche Sprache zum Speichern
Lehrstuhl D für Mathematik RWTH Aachen Lehrstuhl D für Mathematik RWTH Aachen St.-Michael-Gymnasium Monschau 14. 09. 2006 Codes: Definition und Aufgaben Ein Code ist eine künstliche Sprache zum Speichern
Brückenkurs Mathematik
 Brückenkurs Mathematik 6.10. - 17.10. Vorlesung 3 Geometrie Doris Bohnet Universität Hamburg - Department Mathematik Mi 8.10.2008 1 Geometrie des Dreiecks 2 Vektoren Länge eines Vektors Skalarprodukt Kreuzprodukt
Brückenkurs Mathematik 6.10. - 17.10. Vorlesung 3 Geometrie Doris Bohnet Universität Hamburg - Department Mathematik Mi 8.10.2008 1 Geometrie des Dreiecks 2 Vektoren Länge eines Vektors Skalarprodukt Kreuzprodukt
Rückblick auf die letzte Vorlesung. Bemerkung
 Bemerkung 1) Die Bedingung grad f (x 0 ) = 0 T definiert gewöhnlich ein nichtlineares Gleichungssystem zur Berechnung von x = x 0, wobei n Gleichungen für n Unbekannte gegeben sind. 2) Die Punkte x 0 D
Bemerkung 1) Die Bedingung grad f (x 0 ) = 0 T definiert gewöhnlich ein nichtlineares Gleichungssystem zur Berechnung von x = x 0, wobei n Gleichungen für n Unbekannte gegeben sind. 2) Die Punkte x 0 D
Beispiellösungen zur Klausur Lineare Algebra bei Prof. Habegger
 Beispiellösungen zur Klausur Lineare Algebra bei Prof. Habegger Stefan Lell 2. Juli 2 Aufgabe. Sei t Q und A t = t 4t + 2 2t + 2 t t 2t 2t Mat 3Q a Bestimmen Sie die Eigenwerte von A t in Abhängigkeit
Beispiellösungen zur Klausur Lineare Algebra bei Prof. Habegger Stefan Lell 2. Juli 2 Aufgabe. Sei t Q und A t = t 4t + 2 2t + 2 t t 2t 2t Mat 3Q a Bestimmen Sie die Eigenwerte von A t in Abhängigkeit
Kombinatorische Geometrien
 KAPITEL 5 Kombinatorische Geometrien Beispiele von Geometrien wurden schon als Inzidenzstrukturen (z.b. projektive Ebenen) gegeben. Wir nehmen hier einen anderen Standpunkt ein und verstehen unter einer
KAPITEL 5 Kombinatorische Geometrien Beispiele von Geometrien wurden schon als Inzidenzstrukturen (z.b. projektive Ebenen) gegeben. Wir nehmen hier einen anderen Standpunkt ein und verstehen unter einer
1 Lineare Optimierung, Simplex-Verfahren
 1 Lineare Optimierung, Simplex-Verfahren 1.1 Einführung Beispiel: In einer Fabrik werden n Produkte A 1, A 2,..., A n hergestellt. Dazu werden m Rohstoffe B 1, B 2,..., B m (inklusive Arbeitskräfte und
1 Lineare Optimierung, Simplex-Verfahren 1.1 Einführung Beispiel: In einer Fabrik werden n Produkte A 1, A 2,..., A n hergestellt. Dazu werden m Rohstoffe B 1, B 2,..., B m (inklusive Arbeitskräfte und
BONUS MALUS SYSTEME UND MARKOV KETTEN
 Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Mathematik, Institut für Mathematische Stochastik BONUS MALUS SYSTEME UND MARKOV KETTEN Klaus D. Schmidt Ringvorlesung TU Dresden Fakultät MN,
Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Mathematik, Institut für Mathematische Stochastik BONUS MALUS SYSTEME UND MARKOV KETTEN Klaus D. Schmidt Ringvorlesung TU Dresden Fakultät MN,
Lineare Abbildungen Definitionen von linearer Abbildung, linearer Transformation, affiner Abbildung. Parallentreue und Teilverhältnistreue
 Lineare Abbildungen Vorlesung Lineare Algebra mit integrierten Übungen WS 12 13 Studiengang LBS Unterrichtsfach Mathematik Lineare Algebra, Teil 2 Abbildungen Lineare Abbildungen Lineare Eigenwerte, Eigenvektoren
Lineare Abbildungen Vorlesung Lineare Algebra mit integrierten Übungen WS 12 13 Studiengang LBS Unterrichtsfach Mathematik Lineare Algebra, Teil 2 Abbildungen Lineare Abbildungen Lineare Eigenwerte, Eigenvektoren
Affine und projektive Räume
 Affine und projektive Räume W. Kühnel Literatur hierzu: G.Fischer, Analytische Geometrie, 7. Aufl., Vieweg 2001 Zur Motivation: Wenn man in einem Vektorraum die Elemente nicht als Vektoren, sondern als
Affine und projektive Räume W. Kühnel Literatur hierzu: G.Fischer, Analytische Geometrie, 7. Aufl., Vieweg 2001 Zur Motivation: Wenn man in einem Vektorraum die Elemente nicht als Vektoren, sondern als
Proseminar: Primzahlen 1. Vortrag Der erweiterte euklidische Algorithmus
 Proseminar: Primzahlen 1. Vortrag Der erweiterte euklidische Algorithmus Max Zoller 14. April 8 1 Der klassische euklidische Algorithmus Beispiel: ggt 15, 56? 15 = 1 56 + 49 56 = 1 49 + 7 49 = 7 7 + =
Proseminar: Primzahlen 1. Vortrag Der erweiterte euklidische Algorithmus Max Zoller 14. April 8 1 Der klassische euklidische Algorithmus Beispiel: ggt 15, 56? 15 = 1 56 + 49 56 = 1 49 + 7 49 = 7 7 + =
Grundlagen exakter Methoden zur Verschlüsselung von Codewörtern mittels linearer Codes*
 Grundlagen exakter Methoden zur Verschlüsselung von Codewörtern mittels linearer Codes* Andrea Kraft andreakraft@gmx.at Elisabeth Pilgerstorfer elisabeth_pilg@hotmail.com Johannes Kepler Universität Linz
Grundlagen exakter Methoden zur Verschlüsselung von Codewörtern mittels linearer Codes* Andrea Kraft andreakraft@gmx.at Elisabeth Pilgerstorfer elisabeth_pilg@hotmail.com Johannes Kepler Universität Linz
Definition 7.1. Der Coxeter Graph zu W ist der ungerichtete gewichtete Graph Γ W = (V, E), mit Eckenmenge V und Kantenmenge E, gegeben durch V = und
 7. Coxeter Graphen Um die endlichen Spiegelungsgruppen zu klassifizieren, wollen wir ihnen nun Graphen zuordnen, die die Gruppen bis auf Isomorphie eindeutig bestimmen. Im Folgenden sei wie vorher Π Φ
7. Coxeter Graphen Um die endlichen Spiegelungsgruppen zu klassifizieren, wollen wir ihnen nun Graphen zuordnen, die die Gruppen bis auf Isomorphie eindeutig bestimmen. Im Folgenden sei wie vorher Π Φ
Übungen zur Vorlesung Diskrete Strukturen
 Abt. Reine Mathematik SS 06 Blatt 1 Di., 02.05.2006 um 14:15 Uhr vor Beginn der Vorlesung 1. Beweisen Sie: Ist n N mit n > 4 keine Primzahl, so gilt (n 1)! 0 mod n. 2. Berechnen Sie den größten gemeinsamen
Abt. Reine Mathematik SS 06 Blatt 1 Di., 02.05.2006 um 14:15 Uhr vor Beginn der Vorlesung 1. Beweisen Sie: Ist n N mit n > 4 keine Primzahl, so gilt (n 1)! 0 mod n. 2. Berechnen Sie den größten gemeinsamen
Vorbereitungskurs Mathematik zum Sommersemester 2011 Tag 7
 Vorbereitungskurs Mathematik zum Sommersemester 2011 Tag 7 Timo Stöcker Erstsemestereinführung Informatik TU Dortmund 22. März 2011 Heute Themen Lineare Gleichungssysteme Matrizen Timo Stöcker https://fsinfo.cs.tu-dortmund.de/studis/ese/vorkurse/mathe
Vorbereitungskurs Mathematik zum Sommersemester 2011 Tag 7 Timo Stöcker Erstsemestereinführung Informatik TU Dortmund 22. März 2011 Heute Themen Lineare Gleichungssysteme Matrizen Timo Stöcker https://fsinfo.cs.tu-dortmund.de/studis/ese/vorkurse/mathe
6 Fehlerkorrigierende Codes
 R. Reischuk, ITCS 35 6 Fehlerkorrigierende Codes Wir betrachten im folgenden nur Blockcodes, da sich bei diesen das Decodieren und auch die Analyse der Fehlertoleranz-Eigenschaften einfacher gestaltet.
R. Reischuk, ITCS 35 6 Fehlerkorrigierende Codes Wir betrachten im folgenden nur Blockcodes, da sich bei diesen das Decodieren und auch die Analyse der Fehlertoleranz-Eigenschaften einfacher gestaltet.
Kurze Geschichte der linearen Algebra
 Kurze Geschichte der linearen Algebra Dipl.-Inform. Wolfgang Globke Institut für Algebra und Geometrie Arbeitsgruppe Differentialgeometrie Universität Karlsruhe 1 / 20 Entwicklung Die Historische Entwicklung
Kurze Geschichte der linearen Algebra Dipl.-Inform. Wolfgang Globke Institut für Algebra und Geometrie Arbeitsgruppe Differentialgeometrie Universität Karlsruhe 1 / 20 Entwicklung Die Historische Entwicklung
4. Vektorräume und Gleichungssysteme
 technische universität dortmund Dortmund, im Dezember 2011 Fakultät für Mathematik Prof Dr H M Möller Lineare Algebra für Lehramt Gymnasien und Berufskolleg Zusammenfassung der Abschnitte 41 und 42 4 Vektorräume
technische universität dortmund Dortmund, im Dezember 2011 Fakultät für Mathematik Prof Dr H M Möller Lineare Algebra für Lehramt Gymnasien und Berufskolleg Zusammenfassung der Abschnitte 41 und 42 4 Vektorräume
11 Untermannigfaltigkeiten des R n und lokale Extrema mit Nebenbedingungen
 11 Untermannigfaltigkeiten des R n und lokale Extrema mit Nebenbedingungen Ziel: Wir wollen lokale Extrema von Funktionen f : M R untersuchen, wobei M R n eine k-dimensionale Untermannigfaltigkeit des
11 Untermannigfaltigkeiten des R n und lokale Extrema mit Nebenbedingungen Ziel: Wir wollen lokale Extrema von Funktionen f : M R untersuchen, wobei M R n eine k-dimensionale Untermannigfaltigkeit des
5. Woche Perfekte und Optimale Codes, Schranken. 5. Woche: Perfekte und Optimale Codes, Schranken 88/ 142
 5 Woche Perfekte und Optimale Codes, Schranken 5 Woche: Perfekte und Optimale Codes, Schranken 88/ 142 Packradius eines Codes (Wiederholung) Definition Packradius eines Codes Sei C ein (n, M, d)-code Der
5 Woche Perfekte und Optimale Codes, Schranken 5 Woche: Perfekte und Optimale Codes, Schranken 88/ 142 Packradius eines Codes (Wiederholung) Definition Packradius eines Codes Sei C ein (n, M, d)-code Der
8 Tangenten an Quadriken
 8 Tangenten an Quadriken A Geraden auf Quadriken: Sei A 0 eine symmetrische n n Matri und Q : t A + b t + c = 0 eine nicht leere Quadrik im R n, b R n, c R. g = p + R v R n ist die Gerade durch p mit Richtung
8 Tangenten an Quadriken A Geraden auf Quadriken: Sei A 0 eine symmetrische n n Matri und Q : t A + b t + c = 0 eine nicht leere Quadrik im R n, b R n, c R. g = p + R v R n ist die Gerade durch p mit Richtung
Beispiele 1. Gegeben sei das lineare Gleichungssystem mit erweiterter Matrix (A
 133 e 1. Gegeben sei das lineare Gleichungssystem mit erweiterter Matrix 1 3 2 1 1 2 3 0. 1 3 2 1 2. Gegeben sei das lineare Gleichungssystem mit erweiterter Matrix 1 3 2 1 1 2 3 0. 1 3 2 1 Schritte des
133 e 1. Gegeben sei das lineare Gleichungssystem mit erweiterter Matrix 1 3 2 1 1 2 3 0. 1 3 2 1 2. Gegeben sei das lineare Gleichungssystem mit erweiterter Matrix 1 3 2 1 1 2 3 0. 1 3 2 1 Schritte des
f h c 7 a 1 b 1 g 2 2 d
 ) Man bestimme mit Hilfe des Dijkstra-Algorithmus einen kürzesten Weg von a nach h: c 7 a b f 5 h 3 4 5 i e 6 g 2 2 d Beim Dijkstra-Algorithmus wird in jedem Schritt von den noch unmarkierten Knoten jener
) Man bestimme mit Hilfe des Dijkstra-Algorithmus einen kürzesten Weg von a nach h: c 7 a b f 5 h 3 4 5 i e 6 g 2 2 d Beim Dijkstra-Algorithmus wird in jedem Schritt von den noch unmarkierten Knoten jener
Tropische Kurven zählen. Enumerative Geometrie. Alg. Geometrie. Beispiel Strategie. Geometrie. Kurven Multiplizität Correspondence Theorem Ergebnisse
 Alg. Ebene e Hannah Markwig Technische Universität Kaiserslautern 6. Juli 2006 Alg. Inhalt 1 () 2 3 Der Algorithmus zum Zählen ebener 4 Der Algorithmus Alg. Algebraische Geometrische Objekte sind Nullstellengebilde
Alg. Ebene e Hannah Markwig Technische Universität Kaiserslautern 6. Juli 2006 Alg. Inhalt 1 () 2 3 Der Algorithmus zum Zählen ebener 4 Der Algorithmus Alg. Algebraische Geometrische Objekte sind Nullstellengebilde
Geometrische Objekte im 3-dimensionalen affinen Raum oder,... wie nützlich ist ein zugehöriger Vektorraum der Verschiebungen
 Geometrische Objekte im -dimensionalen affinen Raum Bekanntlich versteht man unter geometrischen Objekten Punktmengen, auf die man die üblichen Mengenoperationen wie z.b.: Schnittmenge bilden: - aussagenlogisch:
Geometrische Objekte im -dimensionalen affinen Raum Bekanntlich versteht man unter geometrischen Objekten Punktmengen, auf die man die üblichen Mengenoperationen wie z.b.: Schnittmenge bilden: - aussagenlogisch:
Geometrie von Flächen und Algebraischen Kurven Der Satz von Pascal
 Geometrie von Flächen und Algebraischen Kurven Der Satz von Pascal Laura Hinsch November 005 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 Algebraische Kurven 1 3 Singularitäten 3 4 Der Satz von Pascal 5 i 1 Einleitung
Geometrie von Flächen und Algebraischen Kurven Der Satz von Pascal Laura Hinsch November 005 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 Algebraische Kurven 1 3 Singularitäten 3 4 Der Satz von Pascal 5 i 1 Einleitung
Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS 1
 INHALTSVERZEICHNIS 1 Inhaltsverzeichnis 1 Die Parabel 2 1.1 Definition................................ 2 1.2 Bemerkung............................... 3 1.3 Tangenten................................ 3 1.4
INHALTSVERZEICHNIS 1 Inhaltsverzeichnis 1 Die Parabel 2 1.1 Definition................................ 2 1.2 Bemerkung............................... 3 1.3 Tangenten................................ 3 1.4
4 Lineare Algebra (Teil 2): Quadratische Matrizen
 4 Lineare Algebra (Teil : Quadratische Matrizen Def.: Eine (n n-matrix, die also ebensoviele Zeilen wie Spalten hat, heißt quadratisch. Hat sie außerdem den Rang n, sind also ihre n Spalten linear unabhängig,
4 Lineare Algebra (Teil : Quadratische Matrizen Def.: Eine (n n-matrix, die also ebensoviele Zeilen wie Spalten hat, heißt quadratisch. Hat sie außerdem den Rang n, sind also ihre n Spalten linear unabhängig,
1. Woche Einführung in die Codierungstheorie, Definition Codes, Präfixcode, kompakte Codes
 1 Woche Einführung in die Codierungstheorie, Definition Codes, Präfixcode, kompakte Codes 1 Woche: Einführung in die Codierungstheorie, Definition Codes, Präfixcode, kompakte Codes 5/ 44 Unser Modell Shannon
1 Woche Einführung in die Codierungstheorie, Definition Codes, Präfixcode, kompakte Codes 1 Woche: Einführung in die Codierungstheorie, Definition Codes, Präfixcode, kompakte Codes 5/ 44 Unser Modell Shannon
 - - CodE 11 CodE 0 0 0 0 0 0 0 0 2.o C 1 10.0 C 2 off 3 3.0 4 2.0 5 off 6 1 8 20.0 9 60 C 7 4.0 10 80 C 1 38 C 12 8 k 13 on 14 30.0 15 10 16 - - CodE 11 CodE 0 0 0 0 0 0 0 0 2.o C 1 10.0 C 2
- - CodE 11 CodE 0 0 0 0 0 0 0 0 2.o C 1 10.0 C 2 off 3 3.0 4 2.0 5 off 6 1 8 20.0 9 60 C 7 4.0 10 80 C 1 38 C 12 8 k 13 on 14 30.0 15 10 16 - - CodE 11 CodE 0 0 0 0 0 0 0 0 2.o C 1 10.0 C 2
Proseminar Lineare Algebra II, SS 11. Blatt
 Blatt 1 1. Berechnen Sie die Determinante der Matrix 0 0 4 1 2 5 1 7 1 2 0 3 1 3 0 α. 2. Stellen Sie folgende Matrix als Produkt von Elementarmatrizen dar: 1 3 1 4 2 5 1 3 0 4 3 1. 3 1 5 2 3. Seien n 2
Blatt 1 1. Berechnen Sie die Determinante der Matrix 0 0 4 1 2 5 1 7 1 2 0 3 1 3 0 α. 2. Stellen Sie folgende Matrix als Produkt von Elementarmatrizen dar: 1 3 1 4 2 5 1 3 0 4 3 1. 3 1 5 2 3. Seien n 2
2. Spezielle anwendungsrelevante Funktionen
 2. Spezielle anwendungsrelevante Funktionen (1) Affin-lineare Funktionen Eine Funktion f : R R heißt konstant, wenn ein c R mit f (x) = c für alle x R existiert linear, wenn es ein a R mit f (x) = ax für
2. Spezielle anwendungsrelevante Funktionen (1) Affin-lineare Funktionen Eine Funktion f : R R heißt konstant, wenn ein c R mit f (x) = c für alle x R existiert linear, wenn es ein a R mit f (x) = ax für
Lineare Gleichungssysteme
 Christian Serpé Universität Münster 14. September 2011 Christian Serpé (Universität Münster) 14. September 2011 1 / 56 Gliederung 1 Motivation Beispiele Allgemeines Vorgehen 2 Der Vektorraum R n 3 Lineare
Christian Serpé Universität Münster 14. September 2011 Christian Serpé (Universität Münster) 14. September 2011 1 / 56 Gliederung 1 Motivation Beispiele Allgemeines Vorgehen 2 Der Vektorraum R n 3 Lineare
Zusammenfassung zu Codierungstheorie
 Zusammenfassung zu Codierungstheorie Proseminar Mathematische Modelle in den Naturwissenschaften WS 09/10 Thomas Holzer 0755600 Sandra Sampl 0755049 Kathrin Oberradter 0755123 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einführung
Zusammenfassung zu Codierungstheorie Proseminar Mathematische Modelle in den Naturwissenschaften WS 09/10 Thomas Holzer 0755600 Sandra Sampl 0755049 Kathrin Oberradter 0755123 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einführung
5 Eigenwerte und die Jordansche Normalform
 Mathematik für Physiker II, SS Mittwoch 8.6 $Id: jordan.tex,v.6 /6/7 8:5:3 hk Exp hk $ 5 Eigenwerte und die Jordansche Normalform 5.4 Die Jordansche Normalform Wir hatten bereits erwähnt, dass eine n n
Mathematik für Physiker II, SS Mittwoch 8.6 $Id: jordan.tex,v.6 /6/7 8:5:3 hk Exp hk $ 5 Eigenwerte und die Jordansche Normalform 5.4 Die Jordansche Normalform Wir hatten bereits erwähnt, dass eine n n
Fehlererkennung und Fehlerkorrektur in Codes
 Fehlererkennung und Fehlerkorrektur in Codes Blockcodes und Hamming Abstand Untersuchungen zu Codierungen von Informationen, die über einen Nachrichtenkanal übertragen werden sollen, konzentrieren sich
Fehlererkennung und Fehlerkorrektur in Codes Blockcodes und Hamming Abstand Untersuchungen zu Codierungen von Informationen, die über einen Nachrichtenkanal übertragen werden sollen, konzentrieren sich
Symmetrische Polynome,Diskriminante und Resultante, Fermatscher Satz für Polynome
 Proseminar Lineare Algebra SS10 Symmetrische Polynome,Diskriminante und Resultante, Fermatscher Satz für Polynome Natalja Shesterina Heinrich-Heine-Universität ASymmetrische Polynome Definition 1 Sei n
Proseminar Lineare Algebra SS10 Symmetrische Polynome,Diskriminante und Resultante, Fermatscher Satz für Polynome Natalja Shesterina Heinrich-Heine-Universität ASymmetrische Polynome Definition 1 Sei n
Algebraische Kurven - Vorlesung 5. Homogene Komponenten
 Algebraische Kurven - Vorlesung 5 Homogene Komponenten Definition 1. Sei S ein kommutativer Ring und R = S[X 1,...,X n ] der Polynomring über R in n Variablen. Dann heißt zu einem Monom G = X ν = X ν 1
Algebraische Kurven - Vorlesung 5 Homogene Komponenten Definition 1. Sei S ein kommutativer Ring und R = S[X 1,...,X n ] der Polynomring über R in n Variablen. Dann heißt zu einem Monom G = X ν = X ν 1
Vektorräume und Rang einer Matrix
 Universität Basel Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum Vektorräume und Rang einer Matrix Dr. Thomas Zehrt Inhalt:. Lineare Unabhängigkeit 2. Vektorräume und Basen 3. Basen von R n 4. Der Rang und Rangbestimmung
Universität Basel Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum Vektorräume und Rang einer Matrix Dr. Thomas Zehrt Inhalt:. Lineare Unabhängigkeit 2. Vektorräume und Basen 3. Basen von R n 4. Der Rang und Rangbestimmung
Ersetzbarkeitstheorem
 Ersetzbarkeitstheorem Die Abgeschlossenheit läßt sich auch folgendermaßen formulieren: Ersetzbarkeitstheorem Seien F und G Formeln mit F G. SeienH und H Formeln, so daß H aus H hervorgeht, indem ein Vorkommen
Ersetzbarkeitstheorem Die Abgeschlossenheit läßt sich auch folgendermaßen formulieren: Ersetzbarkeitstheorem Seien F und G Formeln mit F G. SeienH und H Formeln, so daß H aus H hervorgeht, indem ein Vorkommen
Lineare Algebra, Teil 2 Abbildungen
 Lineare Abbildungen Vorlesung Lineare Algebra mit integrierten Übungen WS 12 13 Studiengang LBS Unterrichtsfach hmth Mathematiktik Lineare Algebra, Teil 2 Abbildungen Lineare Abbildungen Lineare Gleichungssysteme
Lineare Abbildungen Vorlesung Lineare Algebra mit integrierten Übungen WS 12 13 Studiengang LBS Unterrichtsfach hmth Mathematiktik Lineare Algebra, Teil 2 Abbildungen Lineare Abbildungen Lineare Gleichungssysteme
Lineare Algebra. I. Vektorräume. U. Stammbach. Professor an der ETH-Zürich
 Lineare Algebra U Stammbach Professor an der ETH-Zürich I Vektorräume Kapitel I Vektorräume 1 I1 Lineare Gleichungssysteme 1 I2 Beispiele von Vektorräumen 7 I3 Definition eines Vektorraumes 8 I4 Linearkombinationen,
Lineare Algebra U Stammbach Professor an der ETH-Zürich I Vektorräume Kapitel I Vektorräume 1 I1 Lineare Gleichungssysteme 1 I2 Beispiele von Vektorräumen 7 I3 Definition eines Vektorraumes 8 I4 Linearkombinationen,
1 Geometrie - Lösungen von linearen Gleichungen
 Übungsmaterial Geometrie - Lösungen von linearen Gleichungen Lineare Gleichungen sind von der Form y = f(x) = 3x + oder y = g(x) = x + 3. Zwei oder mehr Gleichungen bilden ein Gleichungssystem. Ein Gleichungssystem
Übungsmaterial Geometrie - Lösungen von linearen Gleichungen Lineare Gleichungen sind von der Form y = f(x) = 3x + oder y = g(x) = x + 3. Zwei oder mehr Gleichungen bilden ein Gleichungssystem. Ein Gleichungssystem
DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Die Golay Codes. Verfasser. Daniel Eiwen. angestrebter akademischer Grad
 DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Die Golay Codes Verfasser Daniel Eiwen angestrebter akademischer Grad Magister der Naturwissenschaften (Mag.rer.nat) Wien, im Mai 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt:
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Die Golay Codes Verfasser Daniel Eiwen angestrebter akademischer Grad Magister der Naturwissenschaften (Mag.rer.nat) Wien, im Mai 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt:
1 Zahlentheorie. 1.1 Kongruenzen
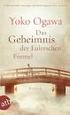 3 Zahlentheorie. Kongruenzen Der letzte Abschnitt zeigte, daß es sinnvoll ist, mit großen Zahlen möglichst einfach rechnen zu können. Oft kommt es nicht darauf, an eine Zahl im Detail zu kennen, sondern
3 Zahlentheorie. Kongruenzen Der letzte Abschnitt zeigte, daß es sinnvoll ist, mit großen Zahlen möglichst einfach rechnen zu können. Oft kommt es nicht darauf, an eine Zahl im Detail zu kennen, sondern
Vorlesung Kombinatorische Optimierung (Wintersemester 2016/17)
 Vorlesung Kombinatorische Optimierung (Wintersemester 06/7) Kapitel : Flüsse und Zirkulationen Volker Kaibel Otto-von-Guericke Universität Magdeburg (Version vom 4. Oktober 06) Definition. Ein Netzwerk
Vorlesung Kombinatorische Optimierung (Wintersemester 06/7) Kapitel : Flüsse und Zirkulationen Volker Kaibel Otto-von-Guericke Universität Magdeburg (Version vom 4. Oktober 06) Definition. Ein Netzwerk
LINEARE ALGEBRA Ferienkurs. Hanna Schäfer Philipp Gadow
 LINEARE ALGERA Ferienkurs Hanna Schäfer Philipp Gadow INHALT Lineare Gleichungssysteme und Determinanten. Lineare Gleichungssysteme.2 Determinanten 3 iii 2 LINEARE GLEIHUNGSSYSTEME UND DETERMINANTEN KAPITEL
LINEARE ALGERA Ferienkurs Hanna Schäfer Philipp Gadow INHALT Lineare Gleichungssysteme und Determinanten. Lineare Gleichungssysteme.2 Determinanten 3 iii 2 LINEARE GLEIHUNGSSYSTEME UND DETERMINANTEN KAPITEL
Kapitel 2: Mathematische Grundlagen
 [ Computeranimation ] Kapitel 2: Mathematische Grundlagen Prof. Dr. Stefan M. Grünvogel stefan.gruenvogel@fh-koeln.de Institut für Medien- und Phototechnik Fachhochschule Köln 2. Mathematische Grundlagen
[ Computeranimation ] Kapitel 2: Mathematische Grundlagen Prof. Dr. Stefan M. Grünvogel stefan.gruenvogel@fh-koeln.de Institut für Medien- und Phototechnik Fachhochschule Köln 2. Mathematische Grundlagen
6. Übung zur Linearen Optimierung SS08
 6 Übung zur Linearen Optimierung SS08 1 Sei G = (V, E) ein schlichter ungerichteter Graph mit n Ecken und m Kanten Für eine Ecke v V heißt die Zahl der Kanten (u, v) E Grad der Ecke (a) Ist die Anzahl
6 Übung zur Linearen Optimierung SS08 1 Sei G = (V, E) ein schlichter ungerichteter Graph mit n Ecken und m Kanten Für eine Ecke v V heißt die Zahl der Kanten (u, v) E Grad der Ecke (a) Ist die Anzahl
Kap 5: Rang, Koordinatentransformationen
 Kap 5: Rang, Koordinatentransformationen Sei F : V W eine lineare Abbildung. Dann ist der Rang von F erklärt durch: rang F =dim ImF. Stets gilt rang F dimv, und ist dimv
Kap 5: Rang, Koordinatentransformationen Sei F : V W eine lineare Abbildung. Dann ist der Rang von F erklärt durch: rang F =dim ImF. Stets gilt rang F dimv, und ist dimv
