Kapitel 5. Diskussion der Befunde. 5.1 Die Modelle
|
|
|
- Bella Färber
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Kapitel 5 Diskussion der Befunde In den folgenden beiden Abschnitten wird zunächst eine kurze Zusammenfassung der zentralen Befunde zu den Codierungsmodellen und der Sehbedingung erfolgen. Diese werden sodann in den Forschungskontext eingebettet, um schließlich im letzten Abschnitt in einen Ausblick zu münden. 5.1 Die Modelle Zum Abschluss sei ein zusammenfassender Überblick über alle erwähnten Modellvarianten in Abbildung 5.1 gegeben. Das Diagramm verdeutlicht durch Pfeile, in welcher Reihenfolge die Modelle durch entsprechende Verallgemeinerungen auseinander hervorgehen und damit auch, welche Modelle statistisch direkt gegeneinander getestet werden können. Die Allgemeinheit der Modelle nimmt nach unten ab. Bei paarweisen statistischen Prüfungen stellte damit das jeweils untere Modell die Nullhypothese. 161
2 Die Modelle AM PSfrag replacements MOP MP OP MO UP MW OM WM RM Abbildung 5.1: Hierarchischer Überblick über die Modelle. Beginnend von allgemeineren oben hin zu jeweils restringierteren Modellen darunter. Im einzelnen seien sie hier benannt mit: AM Allgemeines Modell (varianzanalytisches Modell) (Gl. 4.7), MOP Multivariates Oktantenmodell mit partial discounting (Gl. 4.11), MP Multivariates partial discounting ohne Oktantenasymmetrien (Gl. 4.11), OP Univariates Oktantenmodell mit partial discounting (Gl. 2.11), MO Multivariates Oktantenmodell mit full discounting (Gl. 4.3), UP Univariates reines partial discounting (Gl. 2.9), MW Multivariates Walravenmodell (Gl. 3.3), OM Univariates Oktantenmodell (Gl. 2.10), WM Univariates Walravenmodell (Gl. 2.8), RM Ratiomodell (Gl. 2.6). Die Pfeile verdeutlichen, welche Modelle statistisch gegeneinander getestet werden konnten, die gestrichelte Linie verdeutlicht das Identifizierbarkeitsproblem aus Abschnitt Einen Vergleich der mittleren CIELuv-Vorhersagefehler der Modelle getrennt für Tri- und Dichromaten ermöglicht Abbildung 5.2. Die multivariaten und univariaten Modellvarianten sind getrennt dargestellt und innerhalb dieser beiden Säulengruppen erfolgte die Sortierung von links nach rechts gemäß ihrer Parametersättigungen.
3 PSfrag replacements Kapitel 5 0 Diskussion der Befunde (a) (b) MOP MO MW OP OM WM RM Abbildung 5.2: Vergleich der mittleren CIELuv-Vorhersagefehler ausgewählter Modelle. Die Werte sind jeweils am Vorhersagefehler des AM normiert. Säulengruppe (a) umfasst die multivariaten und (b) die univariaten Modellvarianten. Die dunklen Säulen stehen für die Dichromaten, die hellen für die Trichromaten. In diese vollständige Übersicht gehen auch Auswertungen ein, die in der bisherigen Befunddarstellung nicht vorgestellt wurden. Die Gegenüberstellung der Vorhersagegüten kann in gewisser Weise als Ersatz für eine Abschätzung der Effektstärken der verschiedenen Modelltests angesehen werden. Die Befunde stehen in guter Übereinstimmung mit denen aus den durchgeführten Schwellenexperimenten. Die Aussagekraft der statistischen Signifikanzen muss daher zum Teil als begrenzt angesehen werden. Die Einschränkung der Gültigkeit auf die verwendeten Reize muss allerdings an dieser Stelle wiederholt werden. Linearität: Eine gewisse Abschätzbarkeit der Abweichungen von der oktantenweisen Linearitätsvoraussetzung wird durch einen Vergleich der Fehlersäule des MO mit der gestrichelten Linie - also dem mittleren Fehler des AM - in Abbildung 5.2 ermöglicht. Es scheint sich danach um eine durchaus zulässige Restriktion zu handeln. Auch die Auswertungen zu Experimenten 1 und 3 zeigten trotz gewisser statistischer Abweichungen, dass die oktantenweise Linearitätsannahme durchaus als gerechtfertigt gelten kann. Lediglich im Bereich kleiner Kontraste
4 Die Modelle ergaben sich bedeutsame Abweichungen. Nun ist aber im Ansatz des Oktantenmodells dem Gedanken der qualitativen Trennung der Phänomene und damit einhergehender Verarbeitungsmechanismen durch unterschiedliche lineare Beziehungen in den Oktanten Rechnung getragen. Das bedeutet, diese in den meisten Situationen tragfähige Heuristik braucht für die Situation kleiner Kontraste nicht allzu ernst genommen zu werden. Hier scheinen weitere Mechanismen Wirkungen zu entfalten, wie etwa die Kontrastverstärkung durch crispening (vgl. hierzu Takasaki, 1966), die zu den beobachteten Abweichungen führen können. Zuletzt konnten bei Dichromaten keine Hinweise auf eine Verletzung der Lineariätsannahme gefunden werden. Was ein Argumentieren für die Nullhypothese allerdings ein wenig schwächt, ist die geringere Anzahl an Messwiederholungen. Es sind zudem keine allzu kleinen Kontraste zum Einsatz gekommen. Dies führte auch dazu, dass keine Messungen zu verzeichnen waren, in denen für irgendeinen Farbkanal ein Inkrement durch ein Dekrement oder umgekehrt abgeglichen worden wäre. Experimente 1 und 3 hingegen lieferten Durchgänge solcher Art. Das lässt den Schluss zu, dass hier zum Teil in näheren Umgebungen zu Nullkontrasten erhoben wurde, die auch durch das oben erwähnte crispening nicht merklich werden konnten. Dadurch wahrscheinlichere fälschliche Zuordungen einzelner Reize zu einem Oktanten bewirken natürlich zusätzliche Fehler bei statistischen Prüfungen zu Ungunsten der Linearitätsannahme. Augenunterschiede: Es zeigen sich kaum nennenswerte Unterschiede in mittleren Vorhersagefehlern zwischen den multivariaten und den univariaten Ansätzen erstere waren durch die Befürchtung motiviert, Augenunterschiede könnten zu einer Beeinträchtigung der Datenerhebung führen. Augenunterschiede, die in der Situation isolierter Lichter teils drastisch durchbrachen, scheinen bei Kontextfarben nur geringe Wirkungen zu zeigen. Das liegt sicherlich zum Teil an der robusteren Einschätzbarkeit der Infeldfarben aufgrund von Ankereffekten (vgl. Gilchrist et al., 1999 für achromatisches Reizmaterial). Dieses Phänomen wird vor allem auch durch die um Größenordnungen kleineren Streuungen der Einstellungen bei Kontextreizen deutlich.
5 Kapitel 5 Diskussion der Befunde 165 Auch lieferten die Schätzungen von Korrekturtransformationen nur schlecht interpretierbare Lösungen. Dies lässt entweder Zweifel an der Vorstellung aufkommen, dass die Stimuluskoordinaten linear zu Versuchspersonenkoordinaten korrigiert werden könnten, oder, dass die Auswirkungen von Augenunterschieden in der Sehbedingung tatsächlich als substantiell zu bezeichnen wären. Beispielsweise ergaben sich bei Urgelbeinstellungen interokulare Unterschiede bezüglich der dominanten Wellenlänge bei Reizen mit 2, nicht aber bei solchen mit 7 visuellem Winkel (Shevell & He, 1995). Eine auf die Infelder beschränkte Anwendung linearer Korrekturtransformationen würde allerdings ebenfalls zu Problemen mit den Nullkontrasten führen. Eine alternative Möglichkeit wäre, die Korrekturstärke entsprechend der Exzentrizität als fließend veränderlich zu modellieren etwa als Idealisierung in Form einer Gaußglocke. Dabei ergibt sich allerdings die Notwendigkeit einer plausiblen Annahme darüber, wie die Infeldund Umfeldgradienten zu jeweils isolierten Codes zu integrieren wären, so dass der Nullpunkt des full discounting erhalten bliebe. Beim Versuch der Ermittlung linearer Korrekturglieder mit über alle Sehgebiete gleichverteilten Korrekturstärken konnten die mittleren Vorhersagefehler der univariaten Anpassungen nicht unterschritten werden siehe Anhang 5.3. Das spricht entweder dafür, dass diese Modellierung nicht adäquat war, oder aber dass die Effekte von Augenunterschieden als vernachlässigbar erachtet werden können. Schließlich weisen auch die Ergebnisse aus den Schwellenexperimenten in Richtung der letzteren Deutung. Der multivariate Zugang wäre damit nicht länger notwendig, und die Schätzungen der Quotienten von ρ-koeffizienten aus der univariaten Herangehensweise könnten als hinreichende Approximationen erachtet werden. Kontrastcodierung: Weiter werden nur geringe Zugewinne bei der Vorhersage gegenüber dem Oktantenmodell in der Version des full discounting erzielt, wenn man den Ansatz des partial discounting verfolgt 1. Dies war schon aus eingangs 1 Die zugehörigen mittleren Vorhersagefehler in der Grafik sind geringfügig unterschätzt, da hier mögliche Verschiebungen nicht auf die Umfeldrichtung beschränkt waren.
6 Das Paradigma dargelegten Argumenten zu erwarten. Vergleicht man hingegen das Oktantenmodell mit dem full discounting im Sinne von Walraven, so ergeben sich deutlichere Zugewinne. Konnten die Knicks bei den Trichromaten in Experimenten 1, 3 und 4 in der geometrischen Anschauung zum Teil kaum überzeugen, so lieferten die zugehörigen statistischen Prüfungen und auch die Ergebnisse aus den Schwellenexperimenten durchgehend deutliche Befunde in Richtung der Asymmetrien. Dichromaten zeigten zudem sehr viel größere Effekte als die Trichromaten. Dies steht im Einklang mit den statistischen Befunden und den unterschiedlichen Knickstärken für die beiden Probandengruppen. Die Königsche Sichtweise, dass es sich bei der Dichromasie lediglich um eine reduzierte Form der Trichromasie handele, muss damit in Zweifel gezogen werden (vgl. hierzu auch Mitchell & Rushton, 1971). Der Versuch einer Begründung für diesen Befund geht allerdings über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinaus. Betrachtet man zuletzt das Ratiomodell, so zeigt sich ein weiteres substantielles Anwachsen der Vorhersagefehler. Dies mag zunächst als klarer Hinweis erscheinen, diesen Ansatz zu verwerfen. Berücksichtigt man allerdings die Tatsache, dass hier über die Kenntnis der Reizeigenschaften hinaus keine Modellparameter nötig sind, so mag es dennoch erstaunen, dass diese äußerst einfache Vorstellung schon eine so gute Annäherungen an tatsächliches Einstellungsverhalten vor allem bei inkrementellen Reizen liefert. Die Ergebnisdarstellung aus Experiment 4 steht zudem in gutem Einklang mit dem Ratiomodell und zu jüngeren Befunden, die mit einer ähnlichen Methode bei geblitzten Infeldern vor perzeptuell homogenen Umfeldern gewonnen wurden 2 (Beer & MacLeod, 2001). 5.2 Das Paradigma Wie schon festgehalten können die Augenunterschiede in der vorliegenden Sehbedingung als Einfluss von nur geringer Auswirkung angesehen werden. Das 2 Eines der Umfelder ging in Form einer zweidimensionalen Gaußrampe in ein alles umgebendes Umfeld über und verschmolz daher nach kurzer Zeit mit diesem.
7 Kapitel 5 Diskussion der Befunde 167 bedeutet insbesondere, dass im HSD-Verfahren direkt auf die Schätzungen der ρ-quotienten Bezug genommen werden kann. Dieser tröstliche Befund betrifft allerdings lediglich die Fehler innerhalb einer Messbedingung. Sollen hingegen Befunde aus Messungen an einer Hintergrundkombination auf andere Reizbedingungen verallgemeinert werden können, so ist die Gültigkeit der Unabhängigkeit von zentraler Bedeutung. Entsprechende Tests dieser Voraussetzung konnten an Daten aus den Experimenten 1 und 2 durchgeführt werden. Auch hier zeigten sich wieder Unterschiede zwischen den beiden Probandengruppen für die Dichromaten schien es keinen Grund zu geben, die Unabhängigkeitsannahme anzuzweifeln. Die deutlichen statistischen Verletzungen vor allem bei einer Versuchsperson aus der Gruppe der Trichromaten (vgl. auch Richter, 1998) könnte die Auffassung stützen, dass in der HSD-Situation eben nicht nur primäre Kontrastcodierung isoliert wird. Sollten übergeordnete Kontrastmechanismen (siehe zum Beispiel Shevell, 1978; Land, Hubel, Livingstone, Hollis & Burns, 1983) bei der Codierung wenn schon nicht allein verantwortlich so doch maßgeblich beteiligt sein, so müsste bei zentraler Modifikation der Codes auch die Fusion der Hintergründe hinsichtlich ihrer Kontrastwirkung auf die Infelder einbezogen werden. Damit könnte also bei der verwendeten Sehbedingung nicht zwischen Mechanismen unterschieden werden, die auf Rezeptorebene oder in nachgeschalteten Arealen lokalisiert sind. Die Befunde zur Unabhängigkeit konnten allerdings durch eines der Schwellenexperimente in der vorliegenden Arbeit relativiert werden. Hier zeigte sich, dass Vorhersagen mit und ohne Unabhängigkeitsvoraussetzung perzeptuell nicht unterscheidbar waren. Damit kann der Anteil retinaler Mechanismen am Zustandekommen der Abgleiche als weitaus bedeutsamer aufgefasst werden dies wird auch plausibel aufgrund schon recht alter Befunde, die eine frühe und isolierte Verschaltung der unterschiedlichen Rezeptorklassen nachwiesen (Svaetichin & MacNichol, 1958; Wiesel & Hubel, 1966). Es ist die Generalisierbarkeit von Befunden aus vorliegenden HSD-Daten möglicherweise auch aus einem anderen Grund eingeschränkt. So liefert die Art der Reizdarbietung mittels Computermonitoren nämlich nur einen relativ kleinen
8 Ausblick Ausschnitt aus dem Farbraum einen Teil des unteren Endes der Farbtüte. Damit sind natürlich auch die Wahlmöglichkeiten für die Reizkonfigurationen stark eingeschränkt. So sind bei größerer Verschiedenheit der beteiligten Hintergründe stärker ausgeprägte Knicks zu erwarten, als diejenigen aus den vorliegenden Experimenten. Als Ergänzung zu Befunden, die mit ähnlichen Verfahren (Wuerger, 1996; Beer & MacLeod, 2001; Ekroll, Faul, Niederée & Richter, 2002) oder auch anderen Darbietungsapparaten und Methoden (Walraven, 1976; Shevell, 1982; Mausfeld & Niederée, 1993) gewonnen wurden, stellen die haploskopisch fusionierten Hintergründe allerdings sicherlich eine nützliche und fruchtbare experimentelle Herangehensweise dar, wenn bei der Interpretation anfallender Daten die nötige Vorsicht waltet. 5.3 Ausblick In den einführenden Kapiteln klang bereits streiflichtartig die Problematik der Dimensionalität vollständiger Codes für Kontextfarben an. Mit einem Stetigkeitsargument, welches auf phänomenologischen Überlegungen beruhte, konnte Niederée (1999) nachweisen, dass solche Codes sich nur in mehr als drei Dimensionen fassen lassen. Die Graßmanngesetze für Reize im Dunkelkontext sind davon allerdings unberührt. Ebenso können danach stets verschiedene Infelder vor demselben Hintergrund durch dreidimensionale Matchingprozeduren abgeglichen werden. Problematisch werden erst Abgleiche vor verschiedenen Hintergründen, denn hier müssen und werden in aller Regel nach dem Dimensionalitätssatz keine vollständigen Abgleiche existieren. Werden Versuchspersonen hier allerdings zu Abgleichen gezwungen, so ergeben sich dabei nur solche Abgleiche, bei denen von bestimmten Unterschiedlichkeiten abstrahiert werden muss weiter oben war in diesem Zusammenhang von modes of appearance die Rede. Die genannten Unterschiedlichkeiten können sich auf sehr subtile Aspekte der Reizqualität beziehen. Erwähnt sei das Phänomen der Verhüllung der Infeldfarbe
9 Kapitel 5 Diskussion der Befunde 169 durch gewisse Eigenschaften des Kontextes. So findet man vor allem für kleine Kontraste Effekte, die zusammenfassend als eine Aufspaltung der Infeldefarbe in einen objekthaften und einen beleuchtungshaften Anteil beschrieben werden können. Dabei ergibt sich oft auch der Eindruck, es läge eine transparente Schicht über dem Infeld, welche die Chromatizität des Umfeldes annimmt. Dieser duale Aspekt (vgl. auch Mausfeld, 1998; Faul & Ekroll, 2002) der Wahrnehmung von Kontextfarben spiegelt sich auf der Seite der Codes in einer höheren Dimensionalität wider. Statt eines discounting the background muss danach eher von einem keeping the background gesprochen werden das visuelle System verwirft damit keine Information in der durch dreidimensionale Codierungsmodelle nahegelegten Weise. Diese Codierungsmodelle zusammen mit entsprechend gezwungenen Abgleichsbedingungen können damit nur Approximationen der viel reichhaltigeren Phänomenologie liefern. Es schließt sich die Frage an, ob die genannte Zerlegung tatsächlich schon auf der untersten Ebene retinaler Verschaltungen implementiert ist. Damit wären dann auch Farbabgleiche mit der hier verwendeten Sehbedingung von der Dimensionalitätsproblematik betroffen. Innerhalb eines fest gewählten Umfeldes ließen sich alle Farbcodes als dreidimensionale Mannigfaltigkeit des höherdimensionalen Raumes auffassen. In der Abgleichssituation vor unterschiedlichen Hintergründen ergäben sich unter Umständen keine zusammenfallenden Bereiche der beiden Gebilde, so dass vollständige Abgleiche nicht erzielt werden könnten. Den oben beschriebenen subtilen und nicht auflösbaren Unterschiedlichkeiten begegnet man hier allerdings nicht. Abgleiche gelangen stets und zur Zufriedenheit aller Probanden. Daraus lässt sich mit gewisser Berechtigung schließen, dass die genannten Phänomene eher auf nachgeordneten Verarbeitungsstufen erzeugt werden. Die Verhüllung geschähe also bezüglich des fusionierten Perzepts, der beleuchtungshafte Aspekt der Infeldfarben käme erst auf der Ebene der phänomenalen Wahrnehmung hinzu. Eine solche Entkopplung der retinalen Kontrastmechanismen von der Beleuchtungszuschreibung im Perzept führte dazu, dass sich zugehörige Codes immer innerhalb derselben Mannigfaltigkeit
10 Ausblick befänden. Es könnten damit grundsätzlich vollständige Abgleiche erzielt werden. Diese Vermutung kann wiederum durch phänomenale Beobachtung untermauert werden wählt man im Haploskop, um deutliche Effekte zu erhalten, beliebige geringe Kontraste aus einem Oktanten vor unterschiedlichen Hintergründen aus, so lassen sich für beide Infelder zweifellos gleichartige Verhüllungen wahrnehmen, und zwar in der Farbe des fusionierten Hintergrundes. Ein weiterer Hinweis liegt in der Verletzung der starken Unabhängigkeit. Verändert man das contralaterale Umfeld, so geht dies mit Änderungen des ipsilateralen Infeldeindrucks einher, da sich auch das fusionierte Umfeld ändert. Der Befund, dass statistische Abweichungen von der schwachen Version der Unabhängigkeit sich unterhalb der Entdeckbarkeit zu befinden scheinen, spricht hingegen dafür, dass mit der Heringschen Sehbedingung tatsächlich retinale Mechanismen abgegriffen werden. Interessanterweise zeigen sich dennoch Oktantenasymmetrien. Diese wären danach als zum retinalen Mechanismus der Kontrastcodierung gehörig zu verstehen. Es fließen also auch schon auf der Low-Level-Ebene Beleuchtungsaspekte in die Verarbeitung mit ein, die in die Richtung der genannten Segmentierungsleistungen weisen. Das mag man so verstehen, dass sich strukturelle Merkmale, die das visuelle System zur Bearbeitung dieser fundamentalen Aufgabe befähigen, natürlich auch schon auf sehr frühen Stufen der Verarbeitung zeigen müssen. Die retinalen Mechanismen lassen sich auch als Vorverarbeitung auffassen, die die Reizeigenschaften in möglichst ökonomischer Weise mit möglichst hohem Sinngehalt abbildet. Nachgeordneten Mechanismen würde damit eine effiziente Weiterverabeitung gestattet, die schließlich die endgültigen Interpretationen mit allen ihren Erscheinungsweisen hervorbringt. So wäre jede Ebene auf ein gemeinsames Ziel hin nach den Möglichkeiten der Komplexität ihnen zugeordneter Verschaltungen organisiert. Die Besonderheit haploskopischer Darbietungen liegt also in der Möglichkeit, die retinalen Aspekte der Gesamtleistung weitgehend isoliert zu untersuchen. Dies lässt sich wie beschrieben durch phänomenologische Beobachtungen stützen. Bei den klassischen asymmetrischen Abgleichen mit sichtbaren Umfeldern wirken
11 Kapitel 5 Diskussion der Befunde 171 sich die höheren Segmentierungsmechanismen hingegen nicht gleichartig aus. Dies macht eine systematische Untersuchung der retinalen Mechanismen schließlich unmöglich. Infeld-Umfeld-Reize für sich haben natürlich nach wie vor einen unverzichtbaren Wert bei der Beantwortung von Fragen, die die höheren Leistungen betreffen. Diesbezügliche Gesetzmäßigkeiten lassen sich allerdings besser im Rahmen von Äquilibriumseinstellungen oder rein phänomenologischen Betrachtungen behandeln. Quantifizierende Untersuchungen zur Kontrastcodierung müssen hingegen mit experimentellen Strategien untersucht werden, die die genannten Eigenschaften mit der Methode haploskopischer Darbietungen teilen. Idealerweise sollten dabei die angeklungenen Probleme, die sich durch Augenunterschiede oder störende Interaktionen zwischen den Augen ergeben können, vermieden oder klein gehalten werden. Neben den schon erwähnten Ansätzen mit verschmierten Umfeldkanten (Wuerger, 1996; Beer & MacLeod, 2001) kommen auch Verfahren in Betracht, die sich eher strukturellen Eigenschaften von Kontrasträumen widmen (Ekroll, Faul, Niederée & Richter, 2002).
Modelle der Kontrastcodierung Untersuchung mit der Heringschen Sehbedingung
 Modelle der Kontrastcodierung Untersuchung mit der Heringschen Sehbedingung Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie (Dr. phil.) vorgelegt der Philosophischen Fakultät der Martin-Luther-Universität
Modelle der Kontrastcodierung Untersuchung mit der Heringschen Sehbedingung Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie (Dr. phil.) vorgelegt der Philosophischen Fakultät der Martin-Luther-Universität
Ziele der vorliegenden Untersuchung
 Kapitel 3 Ziele der vorliegenden Untersuchung Nachdem im vorangegangenen Kapitel zum einen verschiedene codierungsmodelle behandelt und zum anderen die hier verwendete Erhebungsmethode kurz vorgestellt
Kapitel 3 Ziele der vorliegenden Untersuchung Nachdem im vorangegangenen Kapitel zum einen verschiedene codierungsmodelle behandelt und zum anderen die hier verwendete Erhebungsmethode kurz vorgestellt
Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:
 18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
Items Einstellungen sportliches Engagement der Freundinnen und Freunde Frauen keinen Wenige / niemand meiner Freundinnen und Freunde sind der Meinung,
 9 Ergebnisse: Soziales Umfeld Freundinnen und Freunde 117 9 Freundinnen und Freunde Im folgenden Kapitel wird herausgearbeitet, wie die Schülerinnen und Studentinnen die Einstellungen und das Sportverhalten
9 Ergebnisse: Soziales Umfeld Freundinnen und Freunde 117 9 Freundinnen und Freunde Im folgenden Kapitel wird herausgearbeitet, wie die Schülerinnen und Studentinnen die Einstellungen und das Sportverhalten
Verfeinerungen des Bayesianischen Nash Gleichgewichts
 Spieltheorie Sommersemester 007 Verfeinerungen des Bayesianischen Nash Gleichgewichts Das Bayesianische Nash Gleichgewicht für Spiele mit unvollständiger Information ist das Analogon zum Nash Gleichgewicht
Spieltheorie Sommersemester 007 Verfeinerungen des Bayesianischen Nash Gleichgewichts Das Bayesianische Nash Gleichgewicht für Spiele mit unvollständiger Information ist das Analogon zum Nash Gleichgewicht
Die Wahrnehmung von Durchsichtigkeit. Referentin: Carina Kogel Seminar: Visuelle Wahrnehmung Dozent: Dr. Alexander C. Schütz
 Die Wahrnehmung von Durchsichtigkeit Referentin: Carina Kogel Seminar: Visuelle Wahrnehmung Dozent: Dr. Alexander C. Schütz Die Wahrnehmung von Durchsichtigkeit Ein Mosaik aus undurchsichtigen Farbflächen
Die Wahrnehmung von Durchsichtigkeit Referentin: Carina Kogel Seminar: Visuelle Wahrnehmung Dozent: Dr. Alexander C. Schütz Die Wahrnehmung von Durchsichtigkeit Ein Mosaik aus undurchsichtigen Farbflächen
Kapitel 9: Verfahren für Nominaldaten
 Kapitel 9: Verfahren für Nominaldaten Eindimensionaler Chi²-Test 1 Zweidimensionaler und Vierfelder Chi²-Test 5 Literatur 6 Eindimensionaler Chi²-Test Berechnen der Effektgröße w² Die empirische Effektgröße
Kapitel 9: Verfahren für Nominaldaten Eindimensionaler Chi²-Test 1 Zweidimensionaler und Vierfelder Chi²-Test 5 Literatur 6 Eindimensionaler Chi²-Test Berechnen der Effektgröße w² Die empirische Effektgröße
Glossar. Cause of Effects Behandelt die Ursache von Auswirkungen. Debriefing Vorgang der Nachbesprechung der experimentellen Untersuchung.
 Abhängige Variable Die zu untersuchende Variable, die von den unabhängigen Variablen in ihrer Ausprägung verändert und beeinflusst wird (siehe auch unabhängige Variable). Between-Subjects-Design Wenn die
Abhängige Variable Die zu untersuchende Variable, die von den unabhängigen Variablen in ihrer Ausprägung verändert und beeinflusst wird (siehe auch unabhängige Variable). Between-Subjects-Design Wenn die
Cox-Regression. Ausgangspunkt Ansätze zur Modellierung von Einflussgrößen Das Cox-Modell Eigenschaften des Cox-Modells
 Cox-Regression Ausgangspunkt Ansätze zur Modellierung von Einflussgrößen Das Cox-Modell Eigenschaften des Cox-Modells In vielen Fällen interessiert, wie die Survivalfunktion durch Einflussgrößen beeinflusst
Cox-Regression Ausgangspunkt Ansätze zur Modellierung von Einflussgrößen Das Cox-Modell Eigenschaften des Cox-Modells In vielen Fällen interessiert, wie die Survivalfunktion durch Einflussgrößen beeinflusst
Mehrfache Lineare Regression 1/9
 Mehrfache Lineare Regression 1/9 Ziel: In diesem Fallbeispiel soll die Durchführung einer mehrfachen linearen Regressionsanalyse auf der Basis vorhandener Prozessdaten (Felddaten) beschrieben werden. Nach
Mehrfache Lineare Regression 1/9 Ziel: In diesem Fallbeispiel soll die Durchführung einer mehrfachen linearen Regressionsanalyse auf der Basis vorhandener Prozessdaten (Felddaten) beschrieben werden. Nach
Statistik II. Regressionsrechnung+ Regressionsanalyse. Statistik II
 Statistik II Regressionsrechnung+ Regressionsanalyse Statistik II - 16.06.2006 1 Regressionsrechnung Nichtlineare Ansätze In einigen Situation könnte man einen nichtlinearen Zusammenhang vermuten. Bekannte
Statistik II Regressionsrechnung+ Regressionsanalyse Statistik II - 16.06.2006 1 Regressionsrechnung Nichtlineare Ansätze In einigen Situation könnte man einen nichtlinearen Zusammenhang vermuten. Bekannte
Vorlesung: Multivariate Statistik für Psychologen
 Vorlesung: Multivariate Statistik für Psychologen 7. Vorlesung: 05.05.2003 Agenda 2. Multiple Regression i. Grundlagen ii. iii. iv. Statistisches Modell Verallgemeinerung des Stichprobenmodells auf Populationsebene
Vorlesung: Multivariate Statistik für Psychologen 7. Vorlesung: 05.05.2003 Agenda 2. Multiple Regression i. Grundlagen ii. iii. iv. Statistisches Modell Verallgemeinerung des Stichprobenmodells auf Populationsebene
Kipp/Opitz UdS 2007/08. Experimentalmethodik
 Experimentalmethodik Alltagspsychologie & Wissenschaftliche Psychologie nicht systematisch trennend zw. Richtigem und Falschem nicht methodisch kontrolliert geeignete Werkzeuge nicht kritische Überprüfung
Experimentalmethodik Alltagspsychologie & Wissenschaftliche Psychologie nicht systematisch trennend zw. Richtigem und Falschem nicht methodisch kontrolliert geeignete Werkzeuge nicht kritische Überprüfung
5 Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz empirische Prüfung
 Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz U.R. Roeder - 66-5 Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz empirische Prüfung 5.1 Die Hypothesen Im Rahmen dieser Arbeit können nur wenige der im theoretischen
Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz U.R. Roeder - 66-5 Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz empirische Prüfung 5.1 Die Hypothesen Im Rahmen dieser Arbeit können nur wenige der im theoretischen
Hierarchische lineare Modelle: Mehrebenenmodelle
 Hierarchische lineare Modelle: Mehrebenenmodelle Eine erste Einführung in grundsätzliche Überlegungen und Vorgehensweisen Dr. Matthias Rudolf: M3 Multivariate Statistik Vorlesung Einführung HLM Folie Nr.
Hierarchische lineare Modelle: Mehrebenenmodelle Eine erste Einführung in grundsätzliche Überlegungen und Vorgehensweisen Dr. Matthias Rudolf: M3 Multivariate Statistik Vorlesung Einführung HLM Folie Nr.
Kapitel 11. Dimension und Isomorphie
 Kapitel 11. Dimension und Isomorphie Bestimmung der Dimension Satz. Sei (v 1, v 2,..., v n ) ein minimales Erzeugendensystem von V, d.h. dieses System ist ein Erzeugendensystem von V, aber keines der nach
Kapitel 11. Dimension und Isomorphie Bestimmung der Dimension Satz. Sei (v 1, v 2,..., v n ) ein minimales Erzeugendensystem von V, d.h. dieses System ist ein Erzeugendensystem von V, aber keines der nach
Forschungsbericht. Effekt bildlicher Warnhinweise auf die Einstellung Jugendlicher zum Zigarettenrauchen
 Forschungsbericht Effekt bildlicher Warnhinweise auf die Einstellung Jugendlicher zum Zigarettenrauchen PD Dr. Matthis Morgenstern Ramona Valenta, M.Sc. Prof. Dr. Reiner Hanewinkel Institut für Therapie-
Forschungsbericht Effekt bildlicher Warnhinweise auf die Einstellung Jugendlicher zum Zigarettenrauchen PD Dr. Matthis Morgenstern Ramona Valenta, M.Sc. Prof. Dr. Reiner Hanewinkel Institut für Therapie-
Einfaktorielle Varianzanalyse
 Kapitel 16 Einfaktorielle Varianzanalyse Im Zweistichprobenproblem vergleichen wir zwei Verfahren miteinander. Nun wollen wir mehr als zwei Verfahren betrachten, wobei wir unverbunden vorgehen. Beispiel
Kapitel 16 Einfaktorielle Varianzanalyse Im Zweistichprobenproblem vergleichen wir zwei Verfahren miteinander. Nun wollen wir mehr als zwei Verfahren betrachten, wobei wir unverbunden vorgehen. Beispiel
Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern
 Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern Worum geht es in diesem Modul? Schätzer als Zufallsvariablen Vorbereitung einer Simulation Verteilung von P-Dach Empirische Lage- und Streuungsparameter zur
Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern Worum geht es in diesem Modul? Schätzer als Zufallsvariablen Vorbereitung einer Simulation Verteilung von P-Dach Empirische Lage- und Streuungsparameter zur
10 Der statistische Test
 10 Der statistische Test 10.1 Was soll ein statistischer Test? 10.2 Nullhypothese und Alternativen 10.3 Fehler 1. und 2. Art 10.4 Parametrische und nichtparametrische Tests 10.1 Was soll ein statistischer
10 Der statistische Test 10.1 Was soll ein statistischer Test? 10.2 Nullhypothese und Alternativen 10.3 Fehler 1. und 2. Art 10.4 Parametrische und nichtparametrische Tests 10.1 Was soll ein statistischer
Auf Biegen und Schieben
 0 Auf Biegen und Schieben Seite Auf Biegen und Schieben Modifikationen von Graphen durch Faktoren und Summanden Düsseldorf, den 7.06.0 Der bisher veröffentlichte Entwurf des Kernlehrplans für die Sekundarstufe
0 Auf Biegen und Schieben Seite Auf Biegen und Schieben Modifikationen von Graphen durch Faktoren und Summanden Düsseldorf, den 7.06.0 Der bisher veröffentlichte Entwurf des Kernlehrplans für die Sekundarstufe
Aufgaben zu Kapitel 5:
 Aufgaben zu Kapitel 5: Aufgabe 1: Ein Wissenschaftler untersucht, in wie weit die Reaktionszeit auf bestimmte Stimuli durch finanzielle Belohnung zu steigern ist. Er möchte vier Bedingungen vergleichen:
Aufgaben zu Kapitel 5: Aufgabe 1: Ein Wissenschaftler untersucht, in wie weit die Reaktionszeit auf bestimmte Stimuli durch finanzielle Belohnung zu steigern ist. Er möchte vier Bedingungen vergleichen:
Auswertung P2-10 Auflösungsvermögen
 Auswertung P2-10 Auflösungsvermögen Michael Prim & Tobias Volkenandt 22 Mai 2006 Aufgabe 11 Bestimmung des Auflösungsvermögens des Auges In diesem Versuch sollten wir experimentell das Auflösungsvermögen
Auswertung P2-10 Auflösungsvermögen Michael Prim & Tobias Volkenandt 22 Mai 2006 Aufgabe 11 Bestimmung des Auflösungsvermögens des Auges In diesem Versuch sollten wir experimentell das Auflösungsvermögen
Statische Spiele mit vollständiger Information
 Statische Spiele mit vollständiger Information Wir beginnen nun mit dem Aufbau unseres spieltheoretischen Methodenbaukastens, indem wir uns zunächst die einfachsten Spiele ansehen. In diesen Spielen handeln
Statische Spiele mit vollständiger Information Wir beginnen nun mit dem Aufbau unseres spieltheoretischen Methodenbaukastens, indem wir uns zunächst die einfachsten Spiele ansehen. In diesen Spielen handeln
Parametrische vs. Non-Parametrische Testverfahren
 Parametrische vs. Non-Parametrische Testverfahren Parametrische Verfahren haben die Besonderheit, dass sie auf Annahmen zur Verteilung der Messwerte in der Population beruhen: die Messwerte sollten einer
Parametrische vs. Non-Parametrische Testverfahren Parametrische Verfahren haben die Besonderheit, dass sie auf Annahmen zur Verteilung der Messwerte in der Population beruhen: die Messwerte sollten einer
6 Forschungsfragen und Untersuchungsdesign
 6.1 Liste der Forschungsfragen 143 Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Verfolgung von Vernetzungen bei ihrer Übertragung durch Lehr- und Lernprozesse aus dem Unterrichtsstoff Mathematik auf die kognitive
6.1 Liste der Forschungsfragen 143 Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Verfolgung von Vernetzungen bei ihrer Übertragung durch Lehr- und Lernprozesse aus dem Unterrichtsstoff Mathematik auf die kognitive
Verleihung des BKK Innovationspreises Gesundheit 2016 Armut und Gesundheit am 13. September 2017 in Frankfurt a. M.
 Verleihung des BKK Innovationspreises Gesundheit 2016 Armut und Gesundheit am 13. September 2017 in Frankfurt a. M. 1. Preisträger: Tanja Krause Thema: Gesundheit Behinderung Teilhabe. Soziale Ungleichheit
Verleihung des BKK Innovationspreises Gesundheit 2016 Armut und Gesundheit am 13. September 2017 in Frankfurt a. M. 1. Preisträger: Tanja Krause Thema: Gesundheit Behinderung Teilhabe. Soziale Ungleichheit
3.1 Sukzessive Minima und reduzierte Basen: Resultate
 Gitter und Codes c Rudolf Scharlau 4. Juni 2009 202 3.1 Sukzessive Minima und reduzierte Basen: Resultate In diesem Abschnitt behandeln wir die Existenz von kurzen Basen, das sind Basen eines Gitters,
Gitter und Codes c Rudolf Scharlau 4. Juni 2009 202 3.1 Sukzessive Minima und reduzierte Basen: Resultate In diesem Abschnitt behandeln wir die Existenz von kurzen Basen, das sind Basen eines Gitters,
Teil: lineare Regression
 Teil: lineare Regression 1 Einführung 2 Prüfung der Regressionsfunktion 3 Die Modellannahmen zur Durchführung einer linearen Regression 4 Dummyvariablen 1 Einführung o Eine statistische Methode um Zusammenhänge
Teil: lineare Regression 1 Einführung 2 Prüfung der Regressionsfunktion 3 Die Modellannahmen zur Durchführung einer linearen Regression 4 Dummyvariablen 1 Einführung o Eine statistische Methode um Zusammenhänge
Tab. 4.1: Altersverteilung der Gesamtstichprobe BASG SASG BAS SAS UDS SCH AVP Mittelwert Median Standardabweichung 44,36 43,00 11,84
 Im weiteren wird gemäß den allgemeinen statistischen Regeln zufolge bei Vorliegen von p=,5 und
Im weiteren wird gemäß den allgemeinen statistischen Regeln zufolge bei Vorliegen von p=,5 und
Vortrag zur Helligkeitswahrnehmung
 Vortrag zur Helligkeitswahrnehmung Kapitel 5 Seeing Brightness des Buches Eye and Brain the psychology of seeing von Richard L. Gregory Vortragender: Stefan Magalowski 1/33 Inhalt o Dunkeladaption o Anpassung
Vortrag zur Helligkeitswahrnehmung Kapitel 5 Seeing Brightness des Buches Eye and Brain the psychology of seeing von Richard L. Gregory Vortragender: Stefan Magalowski 1/33 Inhalt o Dunkeladaption o Anpassung
Neuronale Kodierung sensorischer Reize. Computational Neuroscience Jutta Kretzberg
 Neuronale Kodierung sensorischer Reize Computational Neuroscience 30.10.2006 Jutta Kretzberg (Vorläufiges) Vorlesungsprogramm 23.10.06!! Motivation 30.10.06!! Neuronale Kodierung sensorischer Reize 06.11.06!!
Neuronale Kodierung sensorischer Reize Computational Neuroscience 30.10.2006 Jutta Kretzberg (Vorläufiges) Vorlesungsprogramm 23.10.06!! Motivation 30.10.06!! Neuronale Kodierung sensorischer Reize 06.11.06!!
6 Vergleich und Bewertung der Optimierungs und Meßergebnisse
 6.1 Vergleich der Optimierungs und Meßergebnisse 89 6 Vergleich und Bewertung der Optimierungs und Meßergebnisse Die Systeme aus Abschnitt 4.4.2 sollen abschließend bewertet werden. Wie in Kapitel 5 wird
6.1 Vergleich der Optimierungs und Meßergebnisse 89 6 Vergleich und Bewertung der Optimierungs und Meßergebnisse Die Systeme aus Abschnitt 4.4.2 sollen abschließend bewertet werden. Wie in Kapitel 5 wird
Methodenlehre. Vorlesung 12. Prof. Dr. Björn Rasch, Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg
 Methodenlehre Vorlesung 12 Prof. Dr., Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg 1 Methodenlehre II Woche Datum Thema 1 FQ Einführung, Verteilung der Termine 1 18.2.15 Psychologie als Wissenschaft
Methodenlehre Vorlesung 12 Prof. Dr., Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg 1 Methodenlehre II Woche Datum Thema 1 FQ Einführung, Verteilung der Termine 1 18.2.15 Psychologie als Wissenschaft
Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat?
 Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Kapitel 3. Minkowski-Raum. 3.1 Raumzeitlicher Abstand
 Kapitel 3 Minkowski-Raum Die Galilei-Transformation lässt zeitliche Abstände und Längen unverändert. Als Länge wird dabei der räumliche Abstand zwischen zwei gleichzeitigen Ereignissen verstanden. Solche
Kapitel 3 Minkowski-Raum Die Galilei-Transformation lässt zeitliche Abstände und Längen unverändert. Als Länge wird dabei der räumliche Abstand zwischen zwei gleichzeitigen Ereignissen verstanden. Solche
Das visuelle System. Das Sehen von Kanten: Das Sehen von Kanten ist eine trivial klingende, aber äußerst wichtige Funktion des visuellen Systems!
 Das Sehen von Kanten: Das Sehen von Kanten ist eine trivial klingende, aber äußerst wichtige Funktion des visuellen Systems! Kanten definieren die Ausdehnung und die Position von Objekten! Eine visuelle
Das Sehen von Kanten: Das Sehen von Kanten ist eine trivial klingende, aber äußerst wichtige Funktion des visuellen Systems! Kanten definieren die Ausdehnung und die Position von Objekten! Eine visuelle
Statistische Tests. Kapitel Grundbegriffe. Wir betrachten wieder ein parametrisches Modell {P θ : θ Θ} und eine zugehörige Zufallsstichprobe
 Kapitel 4 Statistische Tests 4.1 Grundbegriffe Wir betrachten wieder ein parametrisches Modell {P θ : θ Θ} und eine zugehörige Zufallsstichprobe X 1,..., X n. Wir wollen nun die Beobachtung der X 1,...,
Kapitel 4 Statistische Tests 4.1 Grundbegriffe Wir betrachten wieder ein parametrisches Modell {P θ : θ Θ} und eine zugehörige Zufallsstichprobe X 1,..., X n. Wir wollen nun die Beobachtung der X 1,...,
Beispiellösungen zu Blatt 96
 µathematischer κorrespondenz- zirkel Mathematisches Institut Georg-August-Universität Göttingen Aufgabe 1 Beispiellösungen zu Blatt 96 Gegeben sei ein Oktaeder. Auf dessen Kanten suchen wir Wege von einer
µathematischer κorrespondenz- zirkel Mathematisches Institut Georg-August-Universität Göttingen Aufgabe 1 Beispiellösungen zu Blatt 96 Gegeben sei ein Oktaeder. Auf dessen Kanten suchen wir Wege von einer
Mehrdimensionale Zufallsvariablen
 Mehrdimensionale Zufallsvariablen Im Folgenden Beschränkung auf den diskreten Fall und zweidimensionale Zufallsvariablen. Vorstellung: Auswerten eines mehrdimensionalen Merkmals ( ) X Ỹ also z.b. ω Ω,
Mehrdimensionale Zufallsvariablen Im Folgenden Beschränkung auf den diskreten Fall und zweidimensionale Zufallsvariablen. Vorstellung: Auswerten eines mehrdimensionalen Merkmals ( ) X Ỹ also z.b. ω Ω,
Ernst Mach: Über die Wirkung der räumlichen Verteilung des Lichtreizes auf die Netzhaut
 Seminar: Visuelle Wahrnehmung Datum: 8. November 2001 Referentin: Iris Skorka Dozent: Prof. Dr. Gegenfurtner Ernst Mach: Über die Wirkung der räumlichen Verteilung des Lichtreizes auf die Netzhaut 1. Überblick:
Seminar: Visuelle Wahrnehmung Datum: 8. November 2001 Referentin: Iris Skorka Dozent: Prof. Dr. Gegenfurtner Ernst Mach: Über die Wirkung der räumlichen Verteilung des Lichtreizes auf die Netzhaut 1. Überblick:
Fragestellung Fragestellungen
 Fragestellung 107 7 Fragestellungen Im Fokus dieser Studie steht die Frage, welche Auswirkungen individualisierte Rückmeldungen über den aktuellen Cholesterin- und Blutdruckwert auf die Bewertung der eigenen
Fragestellung 107 7 Fragestellungen Im Fokus dieser Studie steht die Frage, welche Auswirkungen individualisierte Rückmeldungen über den aktuellen Cholesterin- und Blutdruckwert auf die Bewertung der eigenen
Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse
 Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Durchführung einer einfaktoriellen Varianzanalyse ohne Messwiederholung Dieser Abschnitt zeigt die Durchführung der in Kapitel 5 vorgestellten einfaktoriellen Varianzanalyse
Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Durchführung einer einfaktoriellen Varianzanalyse ohne Messwiederholung Dieser Abschnitt zeigt die Durchführung der in Kapitel 5 vorgestellten einfaktoriellen Varianzanalyse
Kapitel 4. Experimente. 4.1 Experimenteller Aufbau
 Kapitel 4 Experimente Die Struktur aus Kapitel 3 soll sich in der Reihenfolge der experimentellen Arbeiten weitestgehend widerspiegeln Es folgt zunächst die detaillierte Beschreibung des Versuchsaufbaus
Kapitel 4 Experimente Die Struktur aus Kapitel 3 soll sich in der Reihenfolge der experimentellen Arbeiten weitestgehend widerspiegeln Es folgt zunächst die detaillierte Beschreibung des Versuchsaufbaus
Hauptachsentransformation: Eigenwerte und Eigenvektoren
 Hauptachsentransformation: Eigenwerte und Eigenvektoren die bisherigen Betrachtungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Standardbasis des R n Nun soll aufgezeigt werden, wie man sich von dieser Einschränkung
Hauptachsentransformation: Eigenwerte und Eigenvektoren die bisherigen Betrachtungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Standardbasis des R n Nun soll aufgezeigt werden, wie man sich von dieser Einschränkung
k np g(n, p) = Pr p [T K] = Pr p [T k] Φ. np(1 p) DWT 4.1 Einführung 359/467 Ernst W. Mayr
![k np g(n, p) = Pr p [T K] = Pr p [T k] Φ. np(1 p) DWT 4.1 Einführung 359/467 Ernst W. Mayr k np g(n, p) = Pr p [T K] = Pr p [T k] Φ. np(1 p) DWT 4.1 Einführung 359/467 Ernst W. Mayr](/thumbs/52/28946049.jpg) Die so genannte Gütefunktion g gibt allgemein die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Test die Nullhypothese verwirft. Für unser hier entworfenes Testverfahren gilt ( ) k np g(n, p) = Pr p [T K] = Pr p
Die so genannte Gütefunktion g gibt allgemein die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Test die Nullhypothese verwirft. Für unser hier entworfenes Testverfahren gilt ( ) k np g(n, p) = Pr p [T K] = Pr p
Teil Methodische Überlegungen Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17
 Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
5.1.1 Beeinträchtigungen unter emotional neutralen Testbedingungen
 59 5. Diskussion In der vorliegenden Arbeit wurden die Exekutivfunktionen und das Arbeitsgedächtnis sowie deren Beeinträchtigungen im Rahmen bestehender depressiver Symptomatik untersucht. Die Untersuchungen
59 5. Diskussion In der vorliegenden Arbeit wurden die Exekutivfunktionen und das Arbeitsgedächtnis sowie deren Beeinträchtigungen im Rahmen bestehender depressiver Symptomatik untersucht. Die Untersuchungen
Überblick der heutigen Sitzung
 Rückblick Überblick der heutigen Sitzung Exkursion: Blitzlicht-Methode Moral Session: Hausaufgabe Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden Arbeiten in den Projektgruppen Wissenschaftliches Arbeiten
Rückblick Überblick der heutigen Sitzung Exkursion: Blitzlicht-Methode Moral Session: Hausaufgabe Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden Arbeiten in den Projektgruppen Wissenschaftliches Arbeiten
2.2.4 Logische Äquivalenz
 2.2.4 Logische Äquivalenz (I) Penélope raucht nicht und sie trinkt nicht. (II) Es ist nicht der Fall, dass Penélope raucht oder trinkt. Offenbar behaupten beide Aussagen denselben Sachverhalt, sie unterscheiden
2.2.4 Logische Äquivalenz (I) Penélope raucht nicht und sie trinkt nicht. (II) Es ist nicht der Fall, dass Penélope raucht oder trinkt. Offenbar behaupten beide Aussagen denselben Sachverhalt, sie unterscheiden
Methodenlehre. Vorlesung 11. Prof. Dr. Björn Rasch, Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg
 Methodenlehre Vorlesung 11 Prof. Dr., Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg 1 03.12.13 Methodenlehre I Woche Datum Thema 1 FQ Einführung, Verteilung der Termine 1 25.9.13 Psychologie
Methodenlehre Vorlesung 11 Prof. Dr., Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg 1 03.12.13 Methodenlehre I Woche Datum Thema 1 FQ Einführung, Verteilung der Termine 1 25.9.13 Psychologie
Aufgaben zu Kapitel 7:
 Aufgaben zu Kapitel 7: Aufgabe 1: In einer Klinik sollen zwei verschiedene Therapiemethoden miteinander verglichen werden. Zur Messung des Therapieerfolges werden die vorhandenen Symptome einmal vor Beginn
Aufgaben zu Kapitel 7: Aufgabe 1: In einer Klinik sollen zwei verschiedene Therapiemethoden miteinander verglichen werden. Zur Messung des Therapieerfolges werden die vorhandenen Symptome einmal vor Beginn
Statistik Testverfahren. Heinz Holling Günther Gediga. Bachelorstudium Psychologie. hogrefe.de
 rbu leh ch s plu psych Heinz Holling Günther Gediga hogrefe.de Bachelorstudium Psychologie Statistik Testverfahren 18 Kapitel 2 i.i.d.-annahme dem unabhängig. Es gilt also die i.i.d.-annahme (i.i.d = independent
rbu leh ch s plu psych Heinz Holling Günther Gediga hogrefe.de Bachelorstudium Psychologie Statistik Testverfahren 18 Kapitel 2 i.i.d.-annahme dem unabhängig. Es gilt also die i.i.d.-annahme (i.i.d = independent
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Grafisches Gestalten, Druck und Bleistifttechnik
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Grafisches Gestalten, Druck und Bleistifttechnik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de BESONDERHEITEN DES GRAFISCHEN
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Grafisches Gestalten, Druck und Bleistifttechnik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de BESONDERHEITEN DES GRAFISCHEN
Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse
 Rasch, Friese, Hofmann & Naumann (010). Quantitative Methoden. Band (3. Auflage). Heidelberg: Springer. Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung
Rasch, Friese, Hofmann & Naumann (010). Quantitative Methoden. Band (3. Auflage). Heidelberg: Springer. Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung
Familiäre Prädiktoren bilingualer Sprachkenntnisse
 Familiäre Prädiktoren bilingualer Sprachkenntnisse Masterthesis in der AE Entwicklungspsychologie: Jana Baumann Betreuung: Frau Prof. Dr. Leyendecker Überblick 1. 2. 1. Deskriptive Beobachtungen 2. Hypothese
Familiäre Prädiktoren bilingualer Sprachkenntnisse Masterthesis in der AE Entwicklungspsychologie: Jana Baumann Betreuung: Frau Prof. Dr. Leyendecker Überblick 1. 2. 1. Deskriptive Beobachtungen 2. Hypothese
Aufgaben zu Kapitel 3
 Aufgaben zu Kapitel 3 Aufgabe 1 a) Berechnen Sie einen t-test für unabhängige Stichproben für den Vergleich der beiden Verarbeitungsgruppen strukturell und emotional für die abhängige Variable neutrale
Aufgaben zu Kapitel 3 Aufgabe 1 a) Berechnen Sie einen t-test für unabhängige Stichproben für den Vergleich der beiden Verarbeitungsgruppen strukturell und emotional für die abhängige Variable neutrale
Statistische Tests (Signifikanztests)
 Statistische Tests (Signifikanztests) [testing statistical hypothesis] Prüfen und Bewerten von Hypothesen (Annahmen, Vermutungen) über die Verteilungen von Merkmalen in einer Grundgesamtheit (Population)
Statistische Tests (Signifikanztests) [testing statistical hypothesis] Prüfen und Bewerten von Hypothesen (Annahmen, Vermutungen) über die Verteilungen von Merkmalen in einer Grundgesamtheit (Population)
Aufgaben zu Kapitel 7:
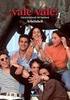 Aufgaben zu Kapitel 7: Aufgabe 1: In einer Klinik sollen zwei verschiedene Therapiemethoden miteinander verglichen werden. Zur Messung des Therapieerfolges werden die vorhandenen Symptome einmal vor Beginn
Aufgaben zu Kapitel 7: Aufgabe 1: In einer Klinik sollen zwei verschiedene Therapiemethoden miteinander verglichen werden. Zur Messung des Therapieerfolges werden die vorhandenen Symptome einmal vor Beginn
Statistik II. Lineare Regressionsrechnung. Wiederholung Skript 2.8 und Ergänzungen (Schira: Kapitel 4) Statistik II
 Statistik II Lineare Regressionsrechnung Wiederholung Skript 2.8 und Ergänzungen (Schira: Kapitel 4) Statistik II - 09.06.2006 1 Mit der Kovarianz und dem Korrelationskoeffizienten können wir den statistischen
Statistik II Lineare Regressionsrechnung Wiederholung Skript 2.8 und Ergänzungen (Schira: Kapitel 4) Statistik II - 09.06.2006 1 Mit der Kovarianz und dem Korrelationskoeffizienten können wir den statistischen
Kapitel 4: Das Überdeckungsproblem
 Kapitel : Das Überdeckungsproblem Kapitel Das Überdeckungsproblem Kapitel : Das Überdeckungsproblem Seite / 25 Kapitel : Das Überdeckungsproblem Inhaltsverzeichnis. Überdeckungsmatrizen.2 Minimalüberdeckungen.
Kapitel : Das Überdeckungsproblem Kapitel Das Überdeckungsproblem Kapitel : Das Überdeckungsproblem Seite / 25 Kapitel : Das Überdeckungsproblem Inhaltsverzeichnis. Überdeckungsmatrizen.2 Minimalüberdeckungen.
Stromstärken und Spannungen in einer elektrischen Schaltung
 Stromstärken und Spannungen in einer elektrischen Schaltung Stand: 20.06.2016 Jahrgangsstufen 8 Fach/Fächer Benötigtes Material Physik evtl. Experimentiermaterial entsprechend der Schaltskizze (für Teilaufgabe
Stromstärken und Spannungen in einer elektrischen Schaltung Stand: 20.06.2016 Jahrgangsstufen 8 Fach/Fächer Benötigtes Material Physik evtl. Experimentiermaterial entsprechend der Schaltskizze (für Teilaufgabe
Formwahrnehmung aus Schattierung. Von Vilayanur S. Ramachandran bearbeitet von Anna- Marisa Piontek
 Formwahrnehmung aus Schattierung Von Vilayanur S. Ramachandran bearbeitet von Anna- Marisa Piontek Wie sehen wir dreidimensional? Seherfahrung basiert auf zweidimensionalen Bildern, die auf Retina abgebildet
Formwahrnehmung aus Schattierung Von Vilayanur S. Ramachandran bearbeitet von Anna- Marisa Piontek Wie sehen wir dreidimensional? Seherfahrung basiert auf zweidimensionalen Bildern, die auf Retina abgebildet
Feedback-Bogen (Feebo)
 Feedback-Bogen (Feebo) Ein Instrument zur Prävention von Ausbildungsabbrüchen Warum ein Feedback-Bogen? Im Betriebsalltag stellen Ausbildungsabbrüche eine nicht zu unterschätzende Größe dar. Der Anteil
Feedback-Bogen (Feebo) Ein Instrument zur Prävention von Ausbildungsabbrüchen Warum ein Feedback-Bogen? Im Betriebsalltag stellen Ausbildungsabbrüche eine nicht zu unterschätzende Größe dar. Der Anteil
Statistische Methoden 2
 Lothar Sachs Statistische Methoden 2 Planung und Auswertung Mit 48 Tabellen und 21 Übersichten Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo Hong Kong Inhaltsverzeichnis Vorwort VII Die
Lothar Sachs Statistische Methoden 2 Planung und Auswertung Mit 48 Tabellen und 21 Übersichten Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo Hong Kong Inhaltsverzeichnis Vorwort VII Die
5. Lektion: Einfache Signifikanztests
 Seite 1 von 7 5. Lektion: Einfache Signifikanztests Ziel dieser Lektion: Du ordnest Deinen Fragestellungen und Hypothesen die passenden einfachen Signifikanztests zu. Inhalt: 5.1 Zwei kategoriale Variablen
Seite 1 von 7 5. Lektion: Einfache Signifikanztests Ziel dieser Lektion: Du ordnest Deinen Fragestellungen und Hypothesen die passenden einfachen Signifikanztests zu. Inhalt: 5.1 Zwei kategoriale Variablen
Geometrisch-optische Täuschungen
 Prof. Dr. Gegenfurtner Geometrisch-optische Täuschungen Text von Barbara Gillam bearbeitet von Kathy Loh GLIEDERUNG. Vorstellung unterschiedlicher geometrisch-optischer Täuschunge. Mögliche Ursachen geometrisch
Prof. Dr. Gegenfurtner Geometrisch-optische Täuschungen Text von Barbara Gillam bearbeitet von Kathy Loh GLIEDERUNG. Vorstellung unterschiedlicher geometrisch-optischer Täuschunge. Mögliche Ursachen geometrisch
Kapitel 13. Lineare Gleichungssysteme und Basen
 Kapitel 13. Lineare Gleichungssysteme und Basen Matrixform des Rangsatzes Satz. Sei A eine m n-matrix mit den Spalten v 1, v 2,..., v n. A habe den Rang r. Dann ist die Lösungsmenge L := x 1 x 2. x n x
Kapitel 13. Lineare Gleichungssysteme und Basen Matrixform des Rangsatzes Satz. Sei A eine m n-matrix mit den Spalten v 1, v 2,..., v n. A habe den Rang r. Dann ist die Lösungsmenge L := x 1 x 2. x n x
42 Orthogonalität Motivation Definition: Orthogonalität Beispiel
 4 Orthogonalität 4. Motivation Im euklidischen Raum ist das euklidische Produkt zweier Vektoren u, v IR n gleich, wenn die Vektoren orthogonal zueinander sind. Für beliebige Vektoren lässt sich sogar der
4 Orthogonalität 4. Motivation Im euklidischen Raum ist das euklidische Produkt zweier Vektoren u, v IR n gleich, wenn die Vektoren orthogonal zueinander sind. Für beliebige Vektoren lässt sich sogar der
Überblick über multivariate Verfahren in der Statistik/Datenanalyse
 Überblick über multivariate Verfahren in der Statistik/Datenanalyse Die Klassifikation multivariater Verfahren ist nach verschiedenen Gesichtspunkten möglich: Klassifikation nach der Zahl der Art (Skalenniveau)
Überblick über multivariate Verfahren in der Statistik/Datenanalyse Die Klassifikation multivariater Verfahren ist nach verschiedenen Gesichtspunkten möglich: Klassifikation nach der Zahl der Art (Skalenniveau)
13 Mehrdimensionale Zufallsvariablen Zufallsvektoren
 3 Mehrdimensionale Zufallsvariablen Zufallsvektoren Bisher haben wir uns ausschließlich mit Zufallsexperimenten beschäftigt, bei denen die Beobachtung eines einzigen Merkmals im Vordergrund stand. In diesem
3 Mehrdimensionale Zufallsvariablen Zufallsvektoren Bisher haben wir uns ausschließlich mit Zufallsexperimenten beschäftigt, bei denen die Beobachtung eines einzigen Merkmals im Vordergrund stand. In diesem
Beziehungen zwischen Verteilungen
 Kapitel 5 Beziehungen zwischen Verteilungen In diesem Kapitel wollen wir Beziehungen zwischen Verteilungen betrachten, die wir z.t. schon bei den einzelnen Verteilungen betrachtet haben. So wissen Sie
Kapitel 5 Beziehungen zwischen Verteilungen In diesem Kapitel wollen wir Beziehungen zwischen Verteilungen betrachten, die wir z.t. schon bei den einzelnen Verteilungen betrachtet haben. So wissen Sie
Management ( /management/) Apr 25, 2014
 http://www.3minutencoach.com/eine-tragfaehige-strategien-entwickeln- Management (http://www.3minutencoach.com/category /management/) Apr 25, 2014 Ist unsere (angedachte) Strategie tragfähig und robust?
http://www.3minutencoach.com/eine-tragfaehige-strategien-entwickeln- Management (http://www.3minutencoach.com/category /management/) Apr 25, 2014 Ist unsere (angedachte) Strategie tragfähig und robust?
Unabhängigkeit KAPITEL 4
 KAPITEL 4 Unabhängigkeit 4.1. Unabhängigkeit von Ereignissen Wir stellen uns vor, dass zwei Personen jeweils eine Münze werfen. In vielen Fällen kann man annehmen, dass die eine Münze die andere nicht
KAPITEL 4 Unabhängigkeit 4.1. Unabhängigkeit von Ereignissen Wir stellen uns vor, dass zwei Personen jeweils eine Münze werfen. In vielen Fällen kann man annehmen, dass die eine Münze die andere nicht
Lösungsmenge L I = {x R 3x + 5 = 9} = L II = {x R 3x = 4} = L III = { }
 Zur Einleitung: Lineare Gleichungssysteme Wir untersuchen zunächst mit Methoden, die Sie vermutlich aus der Schule kennen, explizit einige kleine lineare Gleichungssysteme. Das Gleichungssystem I wird
Zur Einleitung: Lineare Gleichungssysteme Wir untersuchen zunächst mit Methoden, die Sie vermutlich aus der Schule kennen, explizit einige kleine lineare Gleichungssysteme. Das Gleichungssystem I wird
Lösungsmenge L I = {x R 3x + 5 = 9} = L II = {x R 3x = 4} = L III = { }
 Zur Einleitung: Lineare Gleichungssysteme Wir untersuchen zunächst mit Methoden, die Sie vermutlich aus der Schule kennen, explizit einige kleine lineare Gleichungssysteme. Das Gleichungssystem I wird
Zur Einleitung: Lineare Gleichungssysteme Wir untersuchen zunächst mit Methoden, die Sie vermutlich aus der Schule kennen, explizit einige kleine lineare Gleichungssysteme. Das Gleichungssystem I wird
1. Es sind einfach zu viele! Varianzanalytische Verfahren.
 1. Es sind einfach zu viele! Varianzanalytische Verfahren. 1.3. Vorbereitung des Datensatzes Auch wenn im Kapitel zur Einfaktoriellen ANOVA nur ein kleiner Unterschied im Gehalt zwischen den Herkunftsländern
1. Es sind einfach zu viele! Varianzanalytische Verfahren. 1.3. Vorbereitung des Datensatzes Auch wenn im Kapitel zur Einfaktoriellen ANOVA nur ein kleiner Unterschied im Gehalt zwischen den Herkunftsländern
Konkretes Durchführen einer Inferenzstatistik
 Konkretes Durchführen einer Inferenzstatistik Die Frage ist, welche inferenzstatistischen Schlüsse bei einer kontinuierlichen Variablen - Beispiel: Reaktionszeit gemessen in ms - von der Stichprobe auf
Konkretes Durchführen einer Inferenzstatistik Die Frage ist, welche inferenzstatistischen Schlüsse bei einer kontinuierlichen Variablen - Beispiel: Reaktionszeit gemessen in ms - von der Stichprobe auf
2 für 1: Subventionieren Fahrgäste der 2. Klasse bei der Deutschen Bahn die 1. Klasse?
 2 für 1: Subventionieren Fahrgäste der 2. Klasse bei der Deutschen Bahn die 1. Klasse? Felix Zesch November 5, 2016 Abstract Eine kürzlich veröffentlichte These lautet, dass bei der Deutschen Bahn die
2 für 1: Subventionieren Fahrgäste der 2. Klasse bei der Deutschen Bahn die 1. Klasse? Felix Zesch November 5, 2016 Abstract Eine kürzlich veröffentlichte These lautet, dass bei der Deutschen Bahn die
Color scaling of discs and natural objects at different luminance levels
 Color scaling of discs and natural objects at different luminance levels Hansen & Gegenfurtner (2006) 1 Gliederung I. Grundlagen: a) Einzelneuronen- vs. Ensemblecodierung b) Dreifarben-Theorie c) Gegenfarben-Theorie
Color scaling of discs and natural objects at different luminance levels Hansen & Gegenfurtner (2006) 1 Gliederung I. Grundlagen: a) Einzelneuronen- vs. Ensemblecodierung b) Dreifarben-Theorie c) Gegenfarben-Theorie
Der Alpha-Beta-Algorithmus
 Der Alpha-Beta-Algorithmus Maria Hartmann 19. Mai 2017 1 Einführung Wir wollen für bestimmte Spiele algorithmisch die optimale Spielstrategie finden, also die Strategie, die für den betrachteten Spieler
Der Alpha-Beta-Algorithmus Maria Hartmann 19. Mai 2017 1 Einführung Wir wollen für bestimmte Spiele algorithmisch die optimale Spielstrategie finden, also die Strategie, die für den betrachteten Spieler
Anfertigen von wissenschaftlichen Arbeiten. Peter Altenbernd - Hochschule Darmstadt
 Anfertigen von wissenschaftlichen Arbeiten 1 Übersicht 1. Die Einleitung 2. Die Einführung 3. Der Inhalt 4. Experimente 5. Stand der Technik (Related Work) 6. Zusammenfassung Kurzfassung (Abstract) Anhang
Anfertigen von wissenschaftlichen Arbeiten 1 Übersicht 1. Die Einleitung 2. Die Einführung 3. Der Inhalt 4. Experimente 5. Stand der Technik (Related Work) 6. Zusammenfassung Kurzfassung (Abstract) Anhang
Erfolgreiches Altern: Zum funktionalen Zusammenspiel von personalen Ressourcen und adaptiven Strategien des Lebensmanagements
 Erfolgreiches Altern: Zum funktionalen Zusammenspiel von personalen Ressourcen und adaptiven Strategien des Lebensmanagements Daniela Jopp Dissertationsschrift zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie
Erfolgreiches Altern: Zum funktionalen Zusammenspiel von personalen Ressourcen und adaptiven Strategien des Lebensmanagements Daniela Jopp Dissertationsschrift zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie
1. Hierarchische Basen. 1. Hierarchische Basen Perlen der Informatik I, Hans-Joachim Bungartz page 1 of 33
 Perlen der Informatik I, Hans-Joachim Bungartz page 1 of 33 1.1. Quadratur nach Archimedes Näherungsweise Berechnung von F 1 := 1 0 4 x (1 x) dx = 2 3 1 t=1 t=2 ¼ 0 ½ 1 ¼ 0 ½ 1 0 ½ 1 Perlen der Informatik
Perlen der Informatik I, Hans-Joachim Bungartz page 1 of 33 1.1. Quadratur nach Archimedes Näherungsweise Berechnung von F 1 := 1 0 4 x (1 x) dx = 2 3 1 t=1 t=2 ¼ 0 ½ 1 ¼ 0 ½ 1 0 ½ 1 Perlen der Informatik
Ausgewählte Lösungen zu den Übungsblättern 4-5
 Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik Institut für Mathematik und Rechneranwendung Vorlesung: Lineare Algebra (ME), Prof. Dr. J. Gwinner Ausgewählte en zu den Übungsblättern -5 Aufgabe, Lineare Unabhängigkeit
Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik Institut für Mathematik und Rechneranwendung Vorlesung: Lineare Algebra (ME), Prof. Dr. J. Gwinner Ausgewählte en zu den Übungsblättern -5 Aufgabe, Lineare Unabhängigkeit
Verschiedene Bindungsmuster
 Verschiedene Bindungsmuster 19 Abbildung 2 zeigt den Bewegungsspielraum der sicher, unsicher-vermeidend und unsicher-ambivalent gebundenen Kinder in der Fremden Situation in Anlehnung an Ainsworth und
Verschiedene Bindungsmuster 19 Abbildung 2 zeigt den Bewegungsspielraum der sicher, unsicher-vermeidend und unsicher-ambivalent gebundenen Kinder in der Fremden Situation in Anlehnung an Ainsworth und
5.2 Diagonalisierbarkeit und Trigonalisierung
 HINWEIS: Sie finden hier eine vorläufige Kurzfassung des Inhalts; es sind weder Beweise ausgeführt noch ausführliche Beispiele angegeben. Bitte informieren Sie sich in der Vorlesung. c M. Roczen und H.
HINWEIS: Sie finden hier eine vorläufige Kurzfassung des Inhalts; es sind weder Beweise ausgeführt noch ausführliche Beispiele angegeben. Bitte informieren Sie sich in der Vorlesung. c M. Roczen und H.
Vorlesung 9: Kumulierte (gepoolte) Querschnittsdaten
 Vorlesung 9: Kumulierte (gepoolte) Querschnittsdaten 1. Kumulierte Querschnittsdaten: Was ist das? 2. Anwendungsmöglichkeiten im Überblick 3. Fallstudie 1: Determinanten von Erwerbseinkommen 1978-85 4.
Vorlesung 9: Kumulierte (gepoolte) Querschnittsdaten 1. Kumulierte Querschnittsdaten: Was ist das? 2. Anwendungsmöglichkeiten im Überblick 3. Fallstudie 1: Determinanten von Erwerbseinkommen 1978-85 4.
Wiederholte Spiele. Grundlegende Konzepte. Zwei wichtige Gründe, wiederholte Spiele zu betrachten: 1. Wiederholte Interaktionen in der Realität.
 Spieltheorie Sommersemester 2007 1 Wiederholte Spiele Grundlegende Konzepte Zwei wichtige Gründe, wiederholte Spiele zu betrachten: 1. Wiederholte Interaktionen in der Realität. 2. Wichtige Phänomene sind
Spieltheorie Sommersemester 2007 1 Wiederholte Spiele Grundlegende Konzepte Zwei wichtige Gründe, wiederholte Spiele zu betrachten: 1. Wiederholte Interaktionen in der Realität. 2. Wichtige Phänomene sind
Binomialverteilung Vertrauensbereich für den Anteil
 Übungen mit dem Applet Binomialverteilung Vertrauensbereich für den Anteil Binomialverteilung Vertrauensbereich für den Anteil 1. Statistischer Hintergrund und Darstellung.... Wie entsteht der Vertrauensbereich?...
Übungen mit dem Applet Binomialverteilung Vertrauensbereich für den Anteil Binomialverteilung Vertrauensbereich für den Anteil 1. Statistischer Hintergrund und Darstellung.... Wie entsteht der Vertrauensbereich?...
L3 Euklidische Geometrie: Längen, Winkel, senkrechte Vektoren...
 L3 Euklidische Geometrie: Längen, Winkel, senkrechte Vektoren... (benötigt neue Struktur über Vektorraumaxiome hinaus) Sei Länge von nach Pythagoras: Länge quadratisch in Komponenten! - Für : Skalarprodukt
L3 Euklidische Geometrie: Längen, Winkel, senkrechte Vektoren... (benötigt neue Struktur über Vektorraumaxiome hinaus) Sei Länge von nach Pythagoras: Länge quadratisch in Komponenten! - Für : Skalarprodukt
Self-complexity and affective extremity. Präsentation von Katharina Koch Seminar: Themenfelder der Sozialpsychologie WS 11/12
 Self-complexity and affective extremity Präsentation von Katharina Koch Seminar: Themenfelder der Sozialpsychologie WS 11/12 Inhalt 1. Einführung 2. Struktur des Selbst Modell von P. Linville 3. Aufbau
Self-complexity and affective extremity Präsentation von Katharina Koch Seminar: Themenfelder der Sozialpsychologie WS 11/12 Inhalt 1. Einführung 2. Struktur des Selbst Modell von P. Linville 3. Aufbau
Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin
 Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin Vertrauensvolle Verständigung herstellen: Ein Modell interdisziplinärer Projektarbeit Dissertation zur Erlangung des akademischen
Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin Vertrauensvolle Verständigung herstellen: Ein Modell interdisziplinärer Projektarbeit Dissertation zur Erlangung des akademischen
Biometrieübung 10 Lineare Regression. 2. Abhängigkeit der Körpergröße von der Schuhgröße bei Männern
 Biometrieübung 10 (lineare Regression) - Aufgabe Biometrieübung 10 Lineare Regression Aufgabe 1. Düngungsversuch In einem Düngeversuch mit k=9 Düngungsstufen x i erhielt man Erträge y i. Im (X, Y)- Koordinatensystem
Biometrieübung 10 (lineare Regression) - Aufgabe Biometrieübung 10 Lineare Regression Aufgabe 1. Düngungsversuch In einem Düngeversuch mit k=9 Düngungsstufen x i erhielt man Erträge y i. Im (X, Y)- Koordinatensystem
Vektorwertige Integrale vektorwertiger Funktionen
 Vektorwertige Integrale vektorwertiger Funktionen 8.1 Prinzip der Integralerweiterung In den vorangehenden Kapiteln haben wir uns auf klassische Inhalte und Maße, d. h. mit nicht-negativen Werten, beschränkt.
Vektorwertige Integrale vektorwertiger Funktionen 8.1 Prinzip der Integralerweiterung In den vorangehenden Kapiteln haben wir uns auf klassische Inhalte und Maße, d. h. mit nicht-negativen Werten, beschränkt.
Transformation Allgemeines Die Lage eines Punktes kann durch einen Ortsvektor (ausgehend vom Ursprung des Koordinatensystems
 Transformation - 1 1. Allgemeines 2. Zwei durch eine Translation verknüpfte gleichartige Basissysteme 3. Zwei durch eine Translation verknüpfte verschiedenartige Basissysteme (noch gleiche Orientierung)
Transformation - 1 1. Allgemeines 2. Zwei durch eine Translation verknüpfte gleichartige Basissysteme 3. Zwei durch eine Translation verknüpfte verschiedenartige Basissysteme (noch gleiche Orientierung)
Versuche an verschiedenen Beispielen zu erklären, worauf die jeweilige optische Täuschung beruht.
 Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 6 Von den Leistungen der Sinnesorgane (P8013800) 6.5 Optische Täuschungen Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.10.2013 16:02:48 intertess (Version 13.06
Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 6 Von den Leistungen der Sinnesorgane (P8013800) 6.5 Optische Täuschungen Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.10.2013 16:02:48 intertess (Version 13.06
