Tiermaterial für die Untersuchung der Hornbildungsrate und des Hornverlustes am Huf von Przewalskipferden (alphabetisch geordnet) Zuchtbuch- Nummer
|
|
|
- Anna Gerhardt
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 36 III. MATERIAL UND METHODEN 1. Untersuchungsmaterial Für die Untersuchung der Hornbildungsrate und des Abnutzungsgrades des Kronhornes standen insgesamt 15 Przewalskipferde zur Verfügung, die im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) für Przewalskipferde im Semireservat Schorfheide nördlich von Berlin gehalten werden. Ein Teil der Przewalskipferde wurde außerdem von Dr. K.-M. SCHEIBE und Mitarbeitern des Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin für Untersuchungen zur Ermittlung des Körpergewichtes und der Bewegungsaktivität genutzt. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich von Januar 1996 bis September Aufgrund eines abnehmenden Toleranzverhaltens konnten die meisten Pferde nicht über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg in die Untersuchung einbezogen werden. Drei Przewalskistuten wurden außerdem 1997 im Rahmen von Auswilderungsprogrammen aus dem Semireservat entfernt. Im gleichen Jahr wurden als Ausgleich fünf weitere Stuten in die Herde integriert. Einen Überblick über die untersuchten Przewalskipferde mit Angaben zum Alter, zum Geschlecht sowie zum individuellen Untersuchungszeitraum gibt Tabelle 4. Tabelle 4: 1) 2) Name Tiermaterial für die Untersuchung der Hornbildungsrate und des Hornverlustes am Huf von Przewalskipferden (alphabetisch geordnet) Zuchtbuch- Nummer Geschlecht Geburtsdatum individueller Untersuchungszeitraum ALINA 1789 weiblich Januar August 1996, Februar Juli 1998 ASHNAI 1), 2) 4587 weiblich Juli Juli 1997 ATAMAN 1618 männlich September September 1998 BARBARINA 2) 4636 weiblich Februar Februar 1997 MADA 1), 2) 4651 weiblich September Oktober 1997, Juni September 1998 MEDI 5159 weiblich Mai September 1998 MEDINA 2722 weiblich Mai September 1998 MIDA 4557 weiblich August Juni 1998 NOMIN 1), 2) 4588 weiblich August Juli 1997, November Mai 1998 SIRENA 2) 4634 weiblich Januar Februar 1997 SPIRRE 1), 2) 4680 weiblich August September 1998 SPRILLE 4523 weiblich Juni Januar 1998 VICKY 2951 weiblich September September 1998 VIOLA 2904 weiblich September September 1998 VIRGINIA 2952 weiblich September September 1998 im Frühjahr 1997 gedeckt, Fohlen bei Fuß ab April bzw. Mai 1998; Härtemessung des äußeren Kronhornes im Feldversuch Im Semireservat Schorfheide-Liebenthal wurde zunächst eine reine Stutenherde auf einem 44 Hektar großen Areal gehalten, das 82 % Grünland sowie 18 % Wald umfasst. Im Juli 1996 wurden vier Przewalskistuten in ein 24 Hektar großes Gehege des Wildparks Groß Schönebeck verbracht. Zu dieser Stutenherde wurde im April 1997 ein Hengst hinzugesellt,
2 37 der alle vier Stuten deckte. In beiden Gehegen waren ähnliche Haltungsbedingungen für die Przewalskipferde gegeben. Die jeweilige Weidefläche diente den Pferden ganzjährig als Nahrungsgrundlage, auch in den Wintermonaten erfolgte keine zusätzliche Fütterung. Als Untersuchungsmaterial für die strukturellen Untersuchungen am Kronhorn standen Hufe von 10 Przewalskipferden zur Verfügung, die in Semireservaten oder Zoologischen Gärten vorwiegend in Deutschland gehalten wurden und aufgrund medizinischer Indikationen getötet werden mussten. Laut Vorbericht waren sämtliche Tiere klinisch hufgesund. Die Angaben zum Alter und Geschlecht sowie zur Haltung und Fütterung der Przewalskipferde und das Datum der Euthanasie der einzelnen Tiere sind in Tabelle 5 zusammengefasst. Tabelle 5: Tiermaterial für die strukturelle Untersuchung des Hufhornes von Przewalskipferden (alphabetisch geordnet) Nr. Name Zuchtbuch-Nr. Geschlecht Geburtsdatum Tag der Tötung I ANAR #, 1) 2120 weiblich II ANNIKA #, 2) 1652 weiblich III GEORG * 2152 männlich IV MEDINA # 563 weiblich V MERIAN #, 1) 2825 männlich VI MURINA # 2919 weiblich VII NATHAN * 1153 männlich VIII PRIMUS * 2376 männlich IX ROMANA # 815 weiblich X ROSINANTE # 788 weiblich * Haltung in einem Semireservat, ganzjährig Weide; # Haltung im Gehege eines Zoologischen Gartens bei ganzjährig gleichmäßiger Fütterung 1) zusätzlich Gras im Sommer, 2) zusätzlich Gras im Sommer und Silage im Winter Daneben wurden sechs Hornchips in die Untersuchung einbezogen, die aus dem Tragrand der in Tabelle 4 genannten Przewalskipferde herausgebrochen waren (siehe auch Textabb. 3). Für eine vergleichende Untersuchung wurde außerdem Probenmaterial aus den Hufen von vier Warmblutpferden entnommen, die aus dem Schlachtgut der Pferdeschlächterei W. GENTHIN stammten. Weitere 28 Hufe von Warmblutpferden wurden zeitgleich von Frau B. KÖNIG im Rahmen eines weiteren Dissertationsvorhabens untersucht. Die distalen Gliedmaßenabschnitte sämtlicher Pferde wurden nach der Tötung im Fesselgelenk abgesetzt, zum Transport zunächst tiefgefroren und bis zur Weiterverarbeitung bei -22 C tiefgefroren gelagert. Vor der Probengewinnung erfolgte stets eine makroskopische Untersuchung der Hufe. Es wurde ausschließlich Untersuchungsmaterial von solchen Hufen verwendet, die bei der makroskopischen Untersuchung keine Anzeichen einer pathologischen Veränderung aufwiesen.
3 Probeentnahmestellen Aus dem linken Vorderhuf der in Tabelle 5 genannten 10 Przewalskipferde wurden am Rückenteil der Hufplatte insgesamt an vier definierten Lokalisationen Proben aus dem Kronsegment entnommen. Die Probeentnahmestellen sind in Textabb. 1 dargestellt. Eine Probeentnahme erfolgte jeweils direkt am Kronrand, um die Struktur der lebenden Kronepidermis sowie die Oberfläche der Kronlederhaut untersuchen zu können. Zur Untersuchung der vollständig verhornten Kronepidermis hinsichtlich struktureller und qualitativer Veränderungen während des Distalschubes wurde das Probenmaterial außerdem an drei weiteren Lokalisationen entnommen. Für die proximale Kronhornprobe befand sich die Probeentnahmestelle 1,5 cm, für die mittlere 4 cm und für die distale Kronhornprobe 6,5 cm unterhalb des Kronrandes. Die Probenentnahmestellen am Fohlenhuf waren der geringeren Vorderwandlänge angepasst (1,5 cm / 3,5 cm / 5,5 cm unterhalb des Kronrandes). Bei dieser Probeentnahme konnten Hornproben gewonnen werden, die in unterschiedlichen Jahreszeiten gebildet wurden. Der Zeitpunkt der Hornbildung kann mit Hilfe der Ergebnisse aus der Untersuchung der monatlichen Hornbildungsrate und der genauen Kenntnis des Todestages geschätzt werden. Um die Untersuchungsergebnisse der verschiedenen Untersuchungsmethoden miteinander in Verbindung setzen zu können, wurde das Probenmaterial für alle Untersuchungen gleichzeitig entnommen. Textabb. 1: Medianschnitt des Hufes eines Przewalskipferdes. Die direkt am Kronrand entnommene Probe zur Untersuchung der lebenden Kronepidermis und der Kronlederhaut ist mit der Ziffer 0 gekennzeichnet. Die Probeentnahmestellen im Kronhorn (Kh) sind mit den Ziffern 1 bis 3 bezeichnet (1 = proximale Kronhornprobe, 2 = mittlere Kronhornprobe, 3 = distale Kronhornprobe). Sh = Saumhorn; Soh = Sohlenhorn; Strh = Strahlhorn
4 39 2. Ermittlung der Hornbildungsrate und des Hornverlustes des Kronhornes Zur Bestimmung der monatlichen Hornbildungsrate und des Hornverlustes des äußeren Kronhornes wurden alle Hufe der in Tabelle 4 genannten 15 Przewalskipferde am Rückenteil der Hufplatte mit Markierungen versehen. Die Markierungen wurden anfänglich mit einer Metallsäge angebracht, was später von den Pferden nicht mehr toleriert wurde. Aus diesem Grund erfolgte die weitere Markierung mit Hilfe eines Lötkolbens (siehe Textabb. 2). Infolge des Distalschubes des Kronhornes mussten die Markierungen im Abstand von 4-6 Monaten erneuert werden. Von den markierten Hufen wurden monatlich Videoaufnahmen bzw. Diapositive angefertigt, an denen der Abstand zwischen Kronrand und Markierung sowie zwischen Markierung und Tragrand gemessen wurde. Die Messung erfolgte unter definierten Bedingungen, das heißt stets am gleichen Punkt der Markierung und parallel zur Längsachse der Hornröhrchen. Anhand eines Maßstabes, der ebenfalls am Rückenteil der Hufplatte angebracht wurde (siehe Textabb. 2), konnten die im Bild gemessenen Abstände auf die realen Verhältnisse umgerechnet werden. Aufgrund des Distalschubes des Kronhornes vergrößerte sich der Abstand zwischen Kronrand und Markierung zunehmend, während der Abstand zwischen Markierung und Tragrand geringer wurde. Aus der jeweiligen Differenz wurde die monatliche Hornbildungsrate bzw. der Hornverlust des äußeren Kronhornes berechnet. Der Hornverlust ergab sich dabei nicht nur aus dem Abrieb am Tragrand, sondern war teilweise auch durch Tragrandausbrüche (siehe Textabb. 3) bedingt. Textabb. 2: Thermomarkierung (Pfeil) und Maßstab am Rückenteil der Hufplatte eines Przewalskipferdes Textabb. 3: Hornausbruch am Tragrand eines Przewalskipferdes Einleger: ausgebrochener Hornchip
5 40 3. Speichertelemetrische Messung der Bewegungsaktivität (BERGER et al., 1999; SCHEIBE et al., 1998a) Um den Jahresgang der täglichen Bewegungsaktivität der im Semireservat Schorfheide- Liebenthal gehaltenen Przewalskipferde zu bestimmen, wurden vier Tiere von Mitarbeitern des Instituts für Zoo- und Wildtierforschung / Berlin ein Jahr lang mit Hilfe eines Speichertelemetrie-Systems (ETHOSYS, IMF Electronic, Frankfurt / Oder) untersucht. Dieses System ermöglicht eine kontinuierliche automatische Aufzeichnung der Bewegungsaktivität, die von Sensoren in Halsbändern (ETHOREC) gemessen wird. Von den Sensoren werden in bestimmten Zeitintervallen Signale ausgesendet, die von einer Zentralstation (ETHOLINK) erfasst werden. Zu dem System gehört außerdem Software für die Datenübertragung und Verarbeitung am Computer (ETHODAT). 4. Ermittlung des Körpergewichtes (SCHEIBE et al., 1998b) Im Semireservat Schorfheide-Liebenthal wurde aufgrund des Fehlens einer natürlichen Wasserquelle eine frostgeschützte stationäre Tränke eingerichtet, die einen Messplatz zur individuellen Messung der Körpermasse enthält. Die Tränke befindet sich in einem Gang, den jeweils nur ein Tier betreten kann und dessen Boden eine Wägplattform darstellt. Sobald ein Tier diesen Gang betritt, wird die Gewichtsmessung über eine Lichtschranke ausgelöst. Zur individuellen Erkennung wurden alle Przewalskipferde mit Halsbändern versehen, an denen externe Transponder (TROVAN) befestigt sind. Beim Auslösen der Lichtschranke erfasste ein Computer das Datum, die Tageszeit, die Lufttemperatur, die Tiernummer und das Körpergewicht des Tieres (Messplatz realisiert von IMF Electronic, Frankfurt / 0der). Die Datenauswertung erfolgte in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Instituts für Zoo- und Wildtierforschung / Berlin, wobei für den gesamten Untersuchungszeitraum (Januar 1996 bis September 1998) das monatliche Durchschnittsgewicht der Przewalskipferde sowie die monatliche Durchschnittstemperatur berechnet wurden. 5. Physikalische Materialprüfung Für die Untersuchung der Materialeigenschaften des Kronhornes wurde der linke Vorderhuf von den in Tabelle 5 genannten 10 Przewalskipferden unmittelbar nach dem Auftauen mit einer Tischbandsäge durch einen Medianschnitt halbiert und an der medialen Hälfte eine 2 cm dicke Sagittalscheibe herausgesägt. Mit Hilfe einer Metallbügelsäge wurden anschließend an den unter III.1.1. beschriebenen Probeentnahmestellen reine Hornblöckchen mit einer Kantenlänge von 20 x 10 x 15 mm entnommen. Diese Proben wurden zur Ermittlung von Unterschieden in den drei Kronhornzonen durch Transversalschnitte in ca. 20 x 10 x 5 mm große Blöckchen zerlegt. Zur Bestimmung der Feuchtigkeitsparameter wurden die jeweiligen proximalen, mittleren und distalen Hornproben zusammen untersucht, die Hornhärte der verschiedenen Kronhornzonen wurde an den mittleren Hornproben gemessen. Um die Materialeigenschaften des in verschiedenen Jahreszeiten gebildeten Hornes zu untersuchen, wurde aus dem äußeren
6 41 Kronhorn zusätzlich ein 20 mm breiter sagittaler Streifen entnommen und in seiner gesamten proximodistalen Ausdehnung in 20 x 10 x 5 mm große Blöckchen zersägt. Daneben wurde am Tragrand bzw. in der Mitte und an der Bruchkante von sechs Hornchips, die aus den Hufen der in Tabelle 4 genannten Przewalskipferde ausgebrochen waren, 20 x 10 x 5 mm große Kronhornproben entnommen. Anhand dieser Proben sollte geklärt werden, ob unterschiedliche Materialeigenschaften für den Ausbruch der Hornchips mitverantwortlich sind. Diese Proben wurden sowohl für die Bestimmung der Feuchtigkeitsparameter als auch für die Härtemessung genutzt. 5.1 Bestimmung der Feuchtigkeitsparameter Direkt nach der Probeentnahme wurden die Hornblöckchen auf einer Feinanalysewaage gewogen und anschließend zur Bestimmung der Wasserabgabe bei Raumtemperatur bis zur Gewichtskonstanz (4 Wochen) getrocknet. Zur Untersuchung des Wasseraufnahmevermögens wurden die Proben anschließend bis zur Gewichtskonstanz (in Abhängigkeit von der untersuchten Kronhornzone 7-14 Tage) bei 4 C in Wasser gelagert. Um die Geschwindigkeit der Wasseraufnahme zu ermitteln, wurden einige Proben in bestimmten Zeitintervallen (siehe Tab. VII im Anhang) gewogen. Anschließend wurden die Proben erneut bei Raumtemperatur getrocknet und zur Bestimmung der Geschwindigkeit der Wasserabgabe wiederum nach bestimmten Zeitintervallen (siehe Tab. VIII im Anhang) gewogen. Abschließend wurden die Proben im Trockenschrank bei 105 C bis zur Gewichtskonstanz (3 Tage) getrocknet. Die Feuchtigkeitsparameter wurden nach folgenden Formeln berechnet: physiologischer Wassergehalt der Hornprobe [%] (= maximale Wasserabgabe) Wasserabgabe nach Trocknung bei Raumtemperatur [%] (bezogen auf die maximale Wasserabgabe bei 105 C) = A - HTr A = A - RTr A - HTr x 100 x 100 minimaler Wassergehalt [%] (nach Trocknung bei Raumtemperatur) = RTr - HTr A x 100 relative Wasseraufnahme nach einem definierten Zeitintervall [%] (bezogen auf die maximale Wasseraufnahme) = Wx - RTr MaxF - RTr x 100 maximaler Wassergehalt [%] (= maximale Wasserabgabe der maximal feuchten Probe) = MaxF - HTr MaxF x 100 relative Wasserabgabe nach einem definierten Zeitintervall [%] (bezogen auf den maximalen Wassergehalt) = MaxF - Tx MaxF - HTr x 100 A HTr RTr MaxF Wx Tx = Ausgangsgewicht der Hornprobe direkt nach der Probeentnahme = Gewicht der Probe nach Hitzetrocknung bei 105 C = Gewicht der Probe nach Trocknung bei Raumtemperatur = Gewicht der maximal feuchten Probe = Gewicht der für einen definierten Zeitintervall gewässerten Probe = Gewicht der im Anschluss an die Wässerung für einen definierten Zeitintervall bei Raumtemperatur getrockneten Probe
7 Messung der Hornhärte Die Bestimmung der Hornhärte erfolgte mit Hilfe eines SHORE C-Härteprüfgerätes (Fa. Fritschi, Nürnberg), das den Widerstand eines Materials gegen das Eindringen eines kegelförmigen Eindringkörpers misst (siehe Textabb. 4). Das Gerät ist geeicht und entspricht der amerikanischen Norm ASTMD Die Anpresskraft, die über eine Feder im Prüfgerät konstant gehalten wird, beträgt 50 Newton. Die Härte des Materials wird in SHORE-Einheiten von 0 bis 100 angegeben, wobei 100 SHORE-Einheiten einer maximalen Härte entsprechen. Um subjektive Einflüsse auf das Messergebnis auszuschließen, wurde das Härteprüfgerät für die Untersuchung in einen Prüfständer (Fa. Fritschi, Nürnberg) eingespannt. Die Prüfung im Feldversuch an den in Tabelle 4 genannten Przewalskipferden erfolgte ohne diesen Prüfständer, um den Fehler zu minimieren jedoch immer durch den gleichen Untersucher. Textabb. 4: a) In den Prüfständer eingespanntes SHORE C-Härteprüfgerät während der Härtemessung; b) Detailansicht des Gerätes vor der Härtemessung (Pfeil: Eindringkörper des Härteprüfgerätes, Pfeilkopf: Hornprobe) Die Härteprüfung wurde zunächst parallel zur Längsachse der Hornröhrchen durchgeführt, da die natürliche Druckbelastung auf das Horn beim Fußen des Hufes nachempfunden werden sollte. Dabei wurden in der Mitte der Messfläche jeweils drei aufeinanderfolgende Messungen vorgenommen und aus den Ergebnissen der Mittelwert errechnet. Um zu prüfen, ob eine andere Orientierung des Messgerätes eine Auswirkung auf das Ergebnis der Hornhärte hat, wurden die Messungen in einem Vorversuch zusätzlich senkrecht zur Röhrchenachse durchgeführt. Dies ist insofern von Bedeutung, da im Feldversuch die Hornhärte der
8 43 natürlichen Oberfläche des äußeren Kronhornes ausschließlich senkrecht zur Längsachse der Hornröhrchen gemessen werden kann. Zusätzlich zur Härtemessung bei physiologischem Wassergehalt (direkt nach der Probeentnahme) wurde die Härte der maximal feuchten und der maximal getrockneten Hornproben gemessen. 6. Methoden für die lichtmikroskopischen Untersuchungen Nach der Entnahme der Proben für die Materialprüfung wurde an der lateralen Hälfte des linken Vorderhufes von den in Tabelle 5 genannten 10 Przewalskipferden sowie von vier Warmblutpferden eine 1 cm dicke Sagittalscheibe herausgesägt. Mit Hilfe einer Metallbügelsäge wurden anschließend aus dem Kronhorn an den unter III.1.1 beschriebenen Probeentnahmestellen reine Hornblöckchen mit einer Kantenlänge von 10 x 10 x 15 mm entnommen. Für die histometrische Untersuchung wurde zusätzlich das Kronhorn von zwei Hufen in seiner gesamten proximodistalen Ausdehnung in 10 x 10 x 15 mm große Blöckchen zersägt. Etwa gleichgroße Blöckchen wurden außerdem an der Bruchkante und am Tragrand von zwei Hornchips entnommen, die am Tragrand der in Tabelle 4 genannten Przewalskipferde herausgebrochenen waren. Ohne eine weitere Vorbehandlung der Hornproben durch Fixierungsmittel oder Einbettungsmedien wurden am Hart- und Großschnittmikrotom POLYCUT-S (Fa. Reichert-Jung, Heidelberg) längs und quer zur Hornröhrchenachse verlaufende Sagittal- bzw. Horizontalschnitte mit einer Dicke von 7 µm angefertigt, anschließend flottierend gefärbt und auf Objektträger aufgezogen. Weitere "Nativschnitte" mit einer Dicke von 20 µm wurden für die histometrische Untersuchung hergestellt, wobei die Schnittebene senkrecht zum Verlauf der Hornröhrchen lag. Nach der Beendigung der lichtmikroskopischen Untersuchung wurden die unfixierten Hornblöckchen durch einen Sagittalschnitt halbiert und zur Herstellung von Präparaten für die transmissionselektronenmikroskopische Untersuchung bzw. für die gelelektrophoretische Untersuchung genutzt. Zur Untersuchung der lebenden Epidermis und der Lederhaut im Kronsegment wurden am Kronrand mit Hilfe eines Skalpells Blöckchen mit einer Größe von 10 x 15 x 20 mm entnommen, die sowohl Epidermis als auch Dermis umfassten. Das Horn wurde an jedem Blöckchen bis auf eine 3 mm breite Schicht abgetragen. Von den Blöckchen wurde an der seitlichen Kante eine 2 mm dicke Sagittalscheibe abgetrennt, anschließend wurde das Blöckchen in 2 mm dicke Horizontalscheiben zerlegt. Diese Proben wurden in 4 %iger wässriger Paraformaldehyd-Lösung für 8 Stunden bei 4 C immersionsfixiert, anschließend in Aqua dest. gespült und in einer aufsteigenden Alkoholreihe entwässert. Zur Einbettung in Hydroxyethylmethacrylat (Technovit 7100 ; Fa. Kulzer, Wehrheim) wurden die Einbettungsvorschriften der Fa. Kulzer in modifizierter Form angewandt. Nach einer 10-stündigen Präinfiltration mit 50 %igem alkoholischen Technovit 7100 wurden die Proben für 15 Stunden in reinem Technovit 7100 inkubiert. Im Anschluss an eine 8-stündige Inkubation in Technovit 7100, das einen Zusatz von 1 % Dibenzoylperoxid enthielt, erfolgte die Einbettung der Proben in den Kunststoff. Nach dem Aufblocken der Kunststoffblöckchen mit
9 44 Technovit 3040 (Fa. Kulzer, Wehrheim) wurden von den fixierten Proben ebenfalls am Hartund Großschnittmikrotom POLYCUT-S (Fa. Reichert-Jung, Heidelberg) 3 µm dicke Sagittalbzw. Horizontalschnitte angefertigt. Die Schnitte wurden im Wasserbad gestreckt, anschließend auf Objektträger aufgezogen, zwei Stunden auf einer Heizplatte bei 60 C getrocknet und abschließend gefärbt. Für die DDD-Reaktion (siehe Kap. III.6.2.2) wurden Silane-beschichtete Objektträger benutzt, die eine bessere Haftung der Schnitte bewirken. 6.1 Histologische Übersichtsfärbungen An den fixierten Kunststoffschnitten wurde als Übersichtsfärbung eine Hämalaun/Eosin (HE)- Färbung (GERRITS, 1992, S. 4; ROMEIS, 1989, S. 235ff) angewandt. Bei dieser Färbung werden saure, basophile Strukturen (z.b. Nukleinsäuren im Zellkern, ribosomale Nukleinsäuren oder Keratohyalingranula im Stratum granulosum) durch Hämalaun nach MAYER blau angefärbt. Die Gegenfärbung mit 0,1 %iger wässriger Eosin-Lösung erfasst basische, azidophile Strukturen, die rötlich gefärbt werden. Eine weitere Übersichtsfärbung in Form der Methylenblau-Azur-II-Färbung nach RICHARDSON (ROMEIS, 1989, S. 248) wurde sowohl an den fixierten Kunststoffschnitten als auch an den "Nativschnitten" durchgeführt. Diese Schnellfärbung dient der Erhöhung der Schnittkontraste der Semidünnschnitte, anhand derer geeignete Stellen für die transmissionselektronenmikroskopischen Untersuchungen ausgewählt wurden. Basophile und osmiophile Strukturen färben sich blau, während metachromatische Substanzen rotviolett dargestellt werden. 6.2 Histochemische Nachweisverfahren Darstellung von Keratinen Die spezifische Anfärbung der Keratine erfolgte mittels der Rhodamin-B-Färbung nach LIISBERG (1968). Für die Färbung der "Nativschnitte" wurde die von LIISBERG (1968) angegebene Färbezeit eingehalten, für die Kunststoffschnitte wurde die Färbezeit verdoppelt. Das Rhodamin-B färbt die Keratine in den verhornten Epidermiszellen leuchtend rot. Durch eine Gegenfärbung mit Toluidinblau werden basophile Strukturen wie die Zellkerne in den lebenden Epidermiszellen blau bis blauschwarz angefärbt Darstellung von Sulfhydrylgruppen und Disulfidbrücken Für den semiquantitativen Nachweis von Sulfhydrylgruppen (SH-Gruppen) und Disulfidbrückenbindungen (SS-Gruppen) wurde sowohl an den Kunststoffschnitten als auch an den "Nativschnitten" die Dihydroxy-Dinaphthyl-Disulfid-(DDD)-Reaktion nach BARNETT und SELIGMANN (1952 u. 1954) in modifizierter Form angewandt. Das DDD-Reagenz bindet bei dieser Reaktion an freie SH-Gruppen und wird anschließend durch den Farbstoff Fast-Blue-B dargestellt. Ein niedriger Gehalt an SH-Gruppen führt durch eine einseitige Kopplung des Fast- Blue-B-Salzes zu einer roten Färbung, ein hoher Gehalt an SH-Gruppen durch bilaterale Kopplung zu einer Blaufärbung.
10 45 Für den Nachweis der SH-Gruppen wurden die Schnitte für eine Stunde in 0,1 %iger DDD- Lösung in alkoholischem 0,1 molaren Trispuffer (ph 8,5) bei 50 C inkubiert, anschließend gründlich in alkoholischem Trispuffer und Aqua dest. gespült und zwei Minuten in 0,1 %iger Fast-Blue-B-Lösung in 0,1 molarem Phosphatpuffer nach SØRENSEN (ph 7,4) (ROMEIS, 1989, S. 657) gefärbt. Zur Entfernung überschüssiger Färbelösung wurden die Schnitte nach der Färbung gründlich in Leitungswasser gespült. Zum Nachweis der SS-Gruppen wurden zunächst die freien SH-Gruppen blockiert, indem die Schnitte für 24 Stunden in 1,25 %iger phosphatgepufferter N-Ethylmaleinimid-Lösung bei 37 C inkubiert wurden. Nach gründlichem Spülen in 1 %iger Essigsäure und Aqua dest. erfolgte eine Reduktion der SS-Gruppen zu SH-Gruppen durch eine zweistündige Inkubation in 0,4 molarer Natrium-Thioglykolat-Lösung (ph 8,0) bei 56 C. Im Anschluss an ein erneutes Spülen mit 1 %iger Essigsäure und Aqua dest. wurden die SH-Gruppen, die durch die Reduktion aus den SS-Gruppen entstanden sind, mit Hilfe der DDD-Reaktion und der anschließenden Färbung mit Fast-Blue-B nachgewiesen. Zur Kontrolle der SH-Gruppen-Blockierung wurde an einigen Schnitten direkt im Anschluss an die Inkubation mit N-Ethylmaleinimid eine DDD-Reaktion durchgeführt. Bei vollständiger Blockierung der SH-Gruppen kann das DDD-Reagenz nicht an die Proteine gebunden werden. Infolgedessen bleibt die Farbreaktion aus. Die Auswertung erfolgte in Anlehnung an das von KORTE (1987) aufgestellte Schema, das in Tabelle 6 dargestellt ist. Tabelle 6: Reaktionsintensität bzw. Gehalt an SH- und SS-Gruppen bei der DDD-Reaktion (in Anlehnung an KORTE, 1987) Reaktionsintensität Färbung Gehalt an SH- und SS-Gruppen 0 = keine Reaktion 1 = schwach positiv 2 = schwach bis mittelgradig positiv 3 = mittelgradig positiv 4 = mittelgradig bis stark positiv 5 = stark positiv 6 = stark bis sehr stark positiv 7 = sehr stark positiv farblos rosa rosarot dunkelrot rotviolett violett blauviolett blau keine SH- / SS-Gruppen hoher Gehalt an SH- / SS-Gruppen Nachweis von Glykogen sowie Zuckeranteilen in Lipiden und Proteinen Für die histochemische Darstellung von Glykogen im Zytoplasma der Epidermiszellen sowie von Glykolipiden und Glykoproteinen, die insbesondere im Interzellularkitt auftreten, wurde die Perjodsäure-Schiff-Reaktion (PAS-Reaktion) nach MCMANUS (GERRITS, 1992, S. 5; ROMEIS, 1989, S. 393ff u. 441ff) sowohl an den "Nativschnitten" als auch an den Kunststoffschnitten angewandt. Die Perjodsäure oxidiert Hydroxyl-Gruppen des Zuckers zu Aldehyd- Gruppen, die anschließend durch das Schiff-Reagenz angefärbt werden. PAS-positive Substanzen färben sich rosarot bis violett, schwach positive hellrosa und PAS-negative
11 46 Substanzen bleiben farblos. Die Zellkerne der lebenden Epidermiszellen werden durch eine Gegenfärbung mit Hämalaun nach MAYER (ROMEIS, 1989, S. 215) dargestellt. Um Glykogen von Glykoproteinen bzw. Glykolipiden zu differenzieren, wurde ein Teil der Schnitte vor der PAS-Reaktion für eine Stunde in 2 %iger wässriger Diastase-Lösung bei 37 C inkubiert. Das Enzym Diastase bewirkt eine Herauslösung des diastaselabilen Glykogens aus der Epidermiszelle, wohingegen die diastasestabilen Glykoproteine und -lipide auch nach der Diastase-Inkubation PAS-positiv reagieren Darstellung von Lipiden Der Nachweis von Lipiden in den Zellen und vor allem im Bereich der Zellgrenzen wurde mit dem Farbstoff Sudanschwarz-B (ROMEIS, 1989, S. 381) ausschließlich an den "Nativschnitten" durchgeführt. An den Kunststoffschnitten lassen sich die Lipide nicht mehr darstellen, da sie infolge der Entwässerung in einer aufsteigenden Alkoholreihe herausgelöst wurden. Bei der Sudanschwarz-B-Färbung bedingt ein hoher Lipidgehalt eine schwarzgraue Färbung, während ein niedriger Lipidgehalt zu einer hellgrauen Färbung führt. 6.3 Histometrische Untersuchung Die histometrische Untersuchung wurde durchgeführt, um die Architektur des Hornzellverbandes im Kronhorn zu studieren. Die Ergebnisse sollen eine Vorstellung über den Unterschied der strukturellen Parameter in den drei Kronhornzonen beim Przewalskipferd sowie über strukturelle Unterschiede zwischen Haus- und Wildpferd vermitteln. Die Untersuchung erfolgte an den distalen Kronhornproben der in Tabelle 5 genannten 10 Przewalskipferde und an den entsprechenden Kronhornproben von drei Warmblutpferden. Daneben sollte untersucht werden, ob tendenzielle Unterschiede der Röhrchenparameter im jahreszeitlichen Rhythmus auftreten. Dazu wurde das äußere Kronhorn von zwei Hufen in seiner gesamten proximodistalen Ausdehnung im Abstand von 1 cm untersucht, wobei jeweils exakt die gleichen Röhrchen vermessen wurden. Zur Klärung der Frage, ob strukturelle Unterschiede für den Ausbruch der Hornchips am Tragrand mitverantwortlich sind, wurden zusätzlich die strukturellen Parameter des äußeren Kronhornes von Proben, die am Tragrand bzw. an der Bruchkante von zwei Hornchips entnommen wurden, gegenübergestellt. Die Untersuchung erfolgte an 20 µm dicken Nativschnitten, an denen eine PAS-Reaktion durchgeführt wurde. Die PAS-Färbung bewirkt eine deutliche Darstellung der Zellgrenzen gegenüber dem ungefärbten Zytoplasma, wodurch Röhrchenmark und Röhrchenrinde sowie Hornröhrchen und Zwischenröhrchenhorn gut voneinander zu differenzieren sind. Die morphometrische Untersuchung erfolgte an einem Mikroskop vom Typ AXIOSKOP (Fa. Zeiss, Oberkochen) mittels eines speziellen Computerprogramms (KONTRON- KS400 ). Zunächst wurden die zu untersuchenden Kronhornbereiche über eine mit dem Mikroskop verbundene digitale Videokamera (SONY 3CCD ) in das Computerprogramm überführt. Das Untersuchungsareal umfasste jeweils fünf Bilder mit einer Fläche von
12 47 ca. 1 mm². Da die bereits aufgenommenen Bilder am Bildschirm des Computers angezeigt wurden, konnte eine Überschneidung von Bereichen des Schnittes ausgeschlossen werden. Anschließend wurden die Bilder nacheinander ausgewertet. Auf einem Digitalisiertablett (SummaSketch III ) wurde mit einer Stiftmaus zunächst die Gesamtfläche eines Bildes erfasst. Im Anschluss daran wurden alle Querschnitte solcher Hornröhrchen mit der Stiftmaus umfahren, deren gesamte Querschnittsfläche im Bildausschnitt sichtbar war. Im gleichen Schritt wurde auch der Querschnitt des jeweiligen Röhrchenmarkes umrandet. Eine farbige Markierung der bereits umfahrenen Hornröhrchen bzw. der Markanteile schloss eine doppelte Vermessung aus. Die Software ermöglicht durch diesen Arbeitsschritt die Messung der Fläche einzelner Hornröhrchen bzw. des Röhrchenmarkes sowie die Angabe des größten und kleinsten Röhrchen- bzw. Markdurchmessers. In einem zweiten Schritt wurde die Fläche der am Bildrand befindlichen und daher unvollständig abgebildeten Hornröhrchen ermittelt. Die erhobenen Daten wurden in das Programm EXCEL 97 (Microsoft) überführt, in welchem weitere Berechnungen der strukturellen Parameter erfolgten. Aus der Addition der Gesamtflächen der fünf einzelnen Bilder ergibt sich die Fläche des untersuchten Kronhornbereiches (jeweils ca. 5 mm²). Die Addition aller Querschnittsflächen der Hornröhrchen (einschließlich der angeschnittenen Röhrchen) liefert die Gesamtfläche der Hornröhrchen. Die Differenz dieser beiden Flächen stellt die Fläche des Zwischenröhrchenhornes in absoluten Zahlen dar. Aus diesen Angaben lässt sich der prozentuale Flächenanteil der Hornröhrchen bzw. des Zwischenröhrchenhornes errechnen und das Verhältnis von Hornröhrchen zu Zwischenröhrchenhorn ableiten. In die Berechnung des Mittelwertes der Hornröhrchen- bzw. Markfläche sowie der maximalen und minimalen Röhrchendurchmesser gingen ausschließlich solche Hornröhrchen ein, deren Querschnittsfläche vollständig im Bildausschnitt sichtbar war. Der Quotient aus dem Flächenanteil der Hornröhrchen und dem Mittelwert der Röhrchengröße ergibt die Anzahl der Hornröhrchen pro Flächeneinheit. Die Fläche der Röhrchenrinde lässt sich aus der Differenz von Röhrchenfläche und Markfläche berechnen. Daraus kann das Verhältnis von Röhrchenrinde zu Röhrchenmark abgeleitet werden. Bei einem runden Querschnitt von Hornröhrchen bzw. Röhrchenmark sind maximaler und minimaler Durchmesser identisch und der Quotient aus beiden ist 1. Der Quotient ist umso größer, je stärker oval der Querschnitt ist. Daher kann das Verhältnis von maximalem zu minimalem Röhrchen- bzw. Markdurchmesser als Maß für die Form des Hornröhrchens bzw. des Röhrchenmarkes angesehen werden. Das Verhältnis von maximaler zu minimaler Querschnittsfläche der verschiedenen Hornröhrchen kann als Maß für die Variabilität der Röhrchengröße angesehen werden.
13 48 7. Methoden für die rasterelektronenmikroskopischen Untersuchungen 7.1 Trennung von Dermis und Epidermis Zur Darstellung der dermoepidermalen Grenzfläche im Kronsegment wurden aus dem Rückenteil der Hufe von den in Tabelle 5 genannten 10 Przewalskipferden am Kronrand Blöckchen mit einer Kantenlänge von 10 x 20 x 25 mm entnommen, die sowohl Epidermis als auch Dermis umfassten. Um den Übergang von der Kronlederhaut in die Saum- bzw. Wandlederhaut zu erfassen, enthielten die Probenblöckchen auch Teile der an das Kronsegment angrenzenden Segmente. Die Trennung von Epidermis und Lederhaut mittels Essigsäure wurde nach der von BAIER (1950) an Huf und Klaue angewandten Methode in modifizierter Form durchgeführt. Bei dieser Methode erfolgt die Trennung nach MÜLLING (1993) in bzw. dicht oberhalb der Basalmembran. Die Probenblöckchen wurden Stunden in 1 %iger Essigsäure bei 37 C inkubiert und anschließend kurz in Leitungswasser gespült. Zur Trennung von Dermis und Epidermis wurde unter einer Präparierlupe (Fa. Zeiss, Oberkochen) mit zwei Pinzetten ein vorsichtiger Zug ausgeübt. Reichte ein leichter Zug zur Trennung nicht aus, wurde die Inkubation in der Essigsäure fortgesetzt. Direkt nach der Trennung wurden die Lederhaut- und Epidermisproben für 8-12 Stunden in Phosphatpuffer nach SØRENSEN (ph 7,4) (ROMEIS, 1989, S. 657) gespült. Um ein Verkleben der Lederhautzotten zu vermeiden, wurden die Lederhautproben vorher auf Korkscheiben aufgespießt und schwimmend behandelt. Dadurch waren die Lederhautpapillen frei flottierend und der Schwerkraft folgend nach unten gerichtet. Nach der Spülung erfolgte eine 72-stündige Immersionsfixation in 3 %iger phosphatgepufferter Glutaraldehyd-Lösung. Im Anschluss wurden die Proben erneut für 8-12 Stunden in Phosphatpuffer gespült und zur Nachfixierung und Kontrastierung für 18 Stunden in einer 1 %igen phosphatgepufferten Osmiumtetroxid-Lösung inkubiert. 7.2 Gerichteter Gefrierbruch Um die Architektur des Hornzellverbandes im Kronhorn darzustellen, wurden von den in Tabelle 5 genannten 10 Przewalskipferden an den unter III.1.1 beschriebenen Probeentnahmestellen im Rückenteil der Hufplatte reine Hornproben mit einer Größe von 10 x 10 x 15 mm entnommen und in flüssigem Stickstoff schockgefroren. Anschließend wurden die Probenblöckchen mit einer Zange sowohl parallel zur Längsachse der Hornröhrchen als auch quer zum Röhrchenverlauf gebrochen und für 18 Stunden in einer 1 %igen phosphatgepufferten Osmiumtetroxid-Lösung inkubiert. 7.3 Herstellung der Präparate für die rasterelektronenmikroskopische Untersuchung Die fixierten Präparate wurden gründlich in Phosphatpuffer gespült und in einer aufsteigenden Alkoholreihe entwässert. Zur Substitution des Alkohols wurden die Proben anschließend für 18 Stunden in Hexamethyldisilazan verbracht, das nachfolgend durch 72-stündiges Abdampfen aus den Proben entfernt wurde. Die getrockneten Präparate wurden mittels Leit-C nach
14 49 GÖCKE (Fa. Plano, Marburg) auf kleine Aluminiumteller geklebt und in einem Kathodenzerstäubungsgerät (Fa. Polaron, Watford / England) mit Gold in einer Schichtdicke von 50 nm besputtert. Die Untersuchung und fotografische Befunddokumentation erfolgten am Rasterelektronenmikroskop NANOLAP 2000 (Fa. Bausch u. Lomb, Kanada). 8. Methoden für die transmissionselektronenmikroskopischen Untersuchungen Als Probenmaterial für die transmissionselektronenmikroskopische Untersuchung dienten die unfixierten Hornblöckchen, die zuvor für die Herstellung von "Nativschnitten" für die lichtmikroskopischen Untersuchungen genutzt wurden. Die Blöckchen wurden durch einen Sagittalschnitt halbiert und eine Hälfte wurde jeweils für die gelelektrophoretische Untersuchung weiterverarbeitet. Aus der anderen Hälfte wurden 10 x 5 x 5 mm große Blöckchen herausgesägt, die repräsentative Stellen des äußeren, mittleren und inneren Kronhornes umfassten. Die Schnittfläche wurde anschließend auf eine Größe von 2 x 2 mm getrimmt. Von diesen Probenblöcken wurden ohne weitere Vorbehandlung "Nativschnitte" angefertigt, deren Schnittebene senkrecht zum Verlauf der Hornröhrchen lag. Dazu wurden an einem Ultramikrotom ULTRACUT-E (Fa. Reichert-Jung, Heidelberg) zunächst mit einem Glasmesser 1 µm dicke Semidünnschnitte von den Blöckchen abgenommen, im Wasserbad gestreckt und auf Objektträger aufgezogen. Anschließend wurden die Schnitte mit 1 %iger Methylenblau-Azur-II-Lösung (Romeis, 1989, S. 248) für die lichtmikroskopische Vororientierung gefärbt. Diese histologische Übersichtsfärbung ermöglicht die Auswahl geeigneter Areale für die Anfertigung von Ultradünnschnitten. Von den ausgewählten Bereichen wurden am Ultramikrotom mit einem Diamantmesser 90 nm dicke Ultradünnschnitte hergestellt. Nach dem Auffangen der Schnitte auf befilmten Kupfernetzen wurde abschließend in einem Ultrastainer (Fa. Leica, Bensheim) eine Schnittkontrastierung mit Uranylacetat und Bleizitrat nach der Methode von VENABLE und COGGESHALL (1965) durchgeführt. Die Auswertung der Ultradünnschnitte und die fotografische Befunddokumentation erfolgten an einem Transmissionselektronenmikroskop des Typs EM 10 CR (Fa. Zeiss, Oberkochen). Da die in der Literatur beschriebenen elektronenmikroskopischen Befunde bisher ausschließlich an fixiertem und in Kunststoff eingebettetem Material erhoben wurden, sollte in einem Vorversuch geklärt werden, ob die "Nativschnitte" mit den herkömmlich hergestellten Kunststoffschnitten vergleichbar sind. Dazu wurden einige Hornblöckchen nach der Abnahme der Nativschnitte für 20 Stunden in 2,5 %iger phosphatgepufferter Glutaraldehyd-Lösung (ph 7,4) immersionsfixiert. Anschließend wurden die Schnitte gründlich in Phosphatpuffer nach SØRENSEN (ph 7,4) (ROMEIS, 1989, S. 657) gespült und 18 Stunden zur Nachfixation und Kontrastierung in einer 1 %igen Osmiumtetroxid-Lösung inkubiert. Nach der Entwässerung in einer aufsteigenden Alkoholreihe wurden die Hornblöckchen schließlich in Epoxy-Harz (Epon ; Fa. Serva, Heidelberg) eingebettet. Von den in Epon eingebetteten Probenblöckchen wurden am Ultramikrotom ebenfalls 1 µm dicke Semidünnschnitte und
15 50 90 nm dicke Ultradünnschnitte angefertigt. Das weitere Vorgehen entsprach der für die "Nativschnitte" beschriebenen Methode. 8.1 Immunhistochemische Untersuchung zur Darstellung von Keratinen Die Anordnung und Verteilung der Zytokeratine, die mit Hilfe der Gelelektrophorese und dem Western Blotting im Kronhorn nachgewiesen wurden, sollte durch eine ultrastrukturelle immunhistochemische Untersuchung dargestellt werden. Bei dieser Untersuchung wurden einige der Anti-Zytokeratine genutzt, die auch beim Western Blotting zur Anwendung kamen (siehe Tab. 7, Kap. III.11). Die immunhistochemische Untersuchung wurde an "nativen" Ultradünnschnitten durchgeführt, die auf befilmte Nickelnetzchen aufgezogen wurden. Die anschließende Inkubation der Schnitte erfolgte jeweils auf einem Tropfen der entsprechenden Lösung. Zur Unterdrückung einer unspezifischen Hintergrundfärbung wurden die Schnitte zunächst 10 Minuten in einer 0,02 molaren Tris-gepufferten Glycin-Lösung, die 0,1 % bovines Serumalbumin enthielt, inkubiert. Darauf folgte eine 15-minütige Inkubation in einer 5 %igen Tris-gepufferten Lösung des Normalserums der Tierart (Ziege), deren Immunsystem den sekundären Antikörper erzeugt. Um eine unspezifische Bindung des sekundären Antikörpers zu vermeiden, wurde dem Trispuffer 0,1 % bovines Serumalbumin zugesetzt. Im Anschluss erfolgte eine einstündige Inkubation mit dem jeweiligen Primär-Antikörper (Anti-Zytokeratin). Dieser war in einem Verhältnis von 1:100 mit Trispuffer, der 0,1 % bovines Serumalbumin und 1 % Ziegen-Normalserum enthielt, verdünnt. Zur Entfernung der ungebundenen Anteile der Inkubationslösung wurden die Schnitte anschließend gründlich in Trispuffer, der einen 0,1 %igen Zusatz von bovinem Serumalbumin enthielt, gespült. Der an das Antigen gebundene primäre Antikörper wurde schließlich durch eine einstündige Inkubation mit einem Sekundär- Antikörper (Fa. BioTrend, Köln), der gegen den primären Antikörper gerichtet ist, nachgewiesen. Der Sekundär-Antikörper ist mit 6 nm großen Goldkörnchen markiert, die sich im Elektronenmikroskop darstellen lassen. Für diesen Reaktionsschritt wurde der Sekundär- Antikörper in einer Verdünnung von 1:30 in Trispuffer gelöst, dem 0,1 % bovines Serumalbumin und 1 % Ziegen-Normalserum zugesetzt war. Um den ungebundenen Anteil des sekundären Antikörpers zu entfernen, wurden die Schnitte gründlich in Trispuffer, der einen 0,1 %igen Zusatz von bovinem Serumalbumin enthielt, und phosphatgepufferter Salzlösung (ECKERT u. KARTENBECK, 1997, S. 230) gespült. Eine Nachfixation zur Stabilisierung des Antigen-Antikörper-Komplexes erfolgte durch eine 2minütige Inkubation in einer 2 %igen phosphatgepufferten Glutaraldehyd-Lösung. Nach dem Waschen der Schnitte in Aqua bidest. erfolgte eine Schnittkontrastierung mit Uranylacetat und Bleizitrat. Zum Ausschluss unspezifischer Reaktionen wurden in jedem Versuch Negativkontrollen durchgeführt, wobei der primäre Antikörper durch eine Trispuffer-Lösung, die 0,1 % bovines Serumalbumin und 1 % Ziegen-Normalserum enthielt, ersetzt wurde.
16 51 9. SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese 9.1 Extraktion der Proteine aus dem Hufhorn Die Proteinextraktion erfolgte nach der von GROSENBAUGH und HOOD (1992) beschriebenen Methode, die von HOCHSTETTER (1998) und FROHNES (1999) modifiziert wurde. Dazu wurden die Hornproben verwendet, die bei der Probeentnahme für die Transmissionselektronenmikroskopie abgeteilt worden sind. Neben den Proben von den in Tabelle 5 genannten Przewalskipferden wurden außerdem vergleichbare Hornproben von vier Warmblutpferden untersucht. Von den Hornproben wurden mit Hilfe einer Raspel feine Hornspäne hergestellt. Zur Extraktion der schwer löslichen intrazellulären Strukturproteine wurden 50 mg dieser Späne in 1,25 ml Tris-gepufferter 8 molarer Harnstoff-Lösung (ph 9,0) inkubiert, die zusätzlich zur Spaltung von Disulfidbrücken 0,39 % Dithiotreitol enthielt. Die 18-stündige Inkubation erfolgte unter ständigem Schütteln bei Raumtemperatur. Nach 30-minütigem Zentrifugieren in der High-Speed-Tischzentrifuge BIOFUGE 22R (Fa. Heraeus, Osterode) bei einer Drehzahl von min -1 und einer Temperatur von 4 C wurde vom Überstand zweimal 0,5 ml entnommen und zur Fällung der gelösten Proteine mit jeweils 1 ml Aceton versetzt. Nach GROSENBAUGH und HOOD (1992) werden durch das Aceton lediglich die Keratinproteine und die Keratinfilament-assoziierten Proteine vom HS-Typ gefällt, während die Keratinfilamentassoziierten Proteine vom HT-Typ in Lösung bleiben. Im Anschluss an eine erneute 30minütige Zentrifugation (4 C, Drehzahl: min -1 ) wurde je eines der Präzipitate zur Bestimmung der extrahierten Proteinmenge herangezogen (siehe Kap. III.9.2). Das korrespondierende Präzipitat wurde in einer Tris-gepufferten 1 %igen Natriumdodecylsulfat-(SDS)-Lösung (ph 8,0) gelöst, die außerdem 0,14 % Dithiotreitol und 0,01 % Bromphenolblau enthielt, und für drei Minuten auf 95 C erhitzt. Bromphenolblau ist ein Farbstoff mit hoher elektrophoretischer Mobilität, der den Verlauf der Trennung anzeigt. Durch das Dithiotreitol werden intra- und intermolekulare Disulfidbindungen gespalten. Die Reoxidation der entstandenen Sulfhydrylgruppen wurde durch eine Alkylierung infolge der Zugabe von 1,5 % Jodacetamid verhindert. Das anionische Detergenz SDS bewirkt zum einen die Überführung der Proteine in ihre Primärstruktur, da stabilisierende intra- und intermolekulare nichtkovalente Bindungen gelöst werden, und überdeckt zum anderen individuelle Ladungsunterschiede der Proteine. Infolgedessen entstehen Mizellen, deren negative Ladung proportional zur Masse des Proteins ist. Daher werden die Proteine in der anschließenden Elektrophorese ausschließlich aufgrund ihrer unterschiedlichen Molekulargewichte getrennt (WESTERMEIER, 1990). Daneben wurde eine von ECKERT und KARTENBECK (1997, S. 21ff) vorgeschlagene Methode zur Extraktion von Zytokeratinen aus mehrschichtigen verhornten Epithelien angewandt. Mit dieser Methode konnten aus dem Kronhorn jedoch keine Proteine extrahiert werden.
17 Bestimmung der Proteinkonzentration Die Konzentration der bei der Extraktion aus den Hornproben gelösten Proteine wurde nach der Biuret-Methode (ROBINSON u. HOGDEN, 1940) bestimmt. Dazu wurde das unter III.9.1 beschriebene Präzipitat in 1 ml Natronlauge (0,1 molar) gelöst und mit 4 ml Biuret-Reagenz (Fa. Fluka, Buchs) versetzt. Nach einer 30-minütigen Einwirkzeit wurde der Proteingehalt an einem Spektralphotometer PMQ II (Fa. Zeiss, Oberkochen) photometrisch bei 550 nm bestimmt. Als Eichprotein diente bovines Serumalbumin (Fa. Sigma, Deisenhofen). Die Bestimmung der Proteinkonzentration diente als Grundlage für die Verdünnung der Proben, die für die gelelektrophoretische Proteintrennung genutzt wurden. 9.3 Herstellung der diskontinuierlichen Polyacrylamidgele Die für die Elektrophorese verwendeten Polyacrylamidgele wurden in einem vertikalen Gießständer (Fa. Pharmacia Biotech, Freiburg) nach der von WESTERMEIER (1990, S. 172ff) beschriebenen Methode auf eine Trägerfolie aufpolymerisiert. Die Herstellung der Gele basiert auf einer chemischen Co-Polymerisation von Acrylamidmonomeren mit einem Vernetzer (Methylenbisacrylamid). Dabei entsteht durch eine radikalische Kettenreaktion ein komplexes, flexibles dreidimensionales Netzwerk. Es wurde eine diskontinuierliche Elektrophorese durchgeführt, bei der die Gelmatrix aus zwei Bereichen besteht. Das großporige Sammelgel bedingt bei der Elektrophorese durch eine Stapelbildung der Proteine ("stacking"-effekt) eine Konzentrierung der in das Gel diffundierenden Proteine. Das engporige Trenngel setzt den Proteinen einen hohen Reibungswiderstand entgegen und bewirkt eine Auftrennung der Proteine in der Reihenfolge ihrer Molekülgröße und eine Zonenschärfung der Proteinbanden. Die Porengröße ist umgekehrt proportional zur Totalacrylamidkonzentration T und zusätzlich abhängig vom Vernetzungsgrad C, der durch das Verhältnis von Acrylamid zu Methylenbisacrylamid bestimmt wird (ECKERT u. KARTENBECK, 1997; WESTERMEIER, 1990). Für die Herstellung der Trenngele wurde eine Tris-gepufferte Acrylamid-Methylenbisacrylamid-Lösung (T = 7 %, 10 % oder 12,5 %; ph 8,8) verwendet, die außerdem 10 % Glycerol und 1 % SDS enthielt. Die Acrylamid-Methylenbisacrylamid-Lösung wurde aus einem Konzentrat (T = 40%, C = 5%; Fa. Pharmacia Biotech, Freiburg) durch Verdünnung mit Aqua dest. hergestellt. Für das Sammelgel wurde einer Tris-gepufferten Acrylamid- Methylenbisacrylamid-Lösung (ph 6,8) 4 % Glycerol und 1 % SDS zugesetzt. Die Polymerisationsreaktion wurde jeweils durch freie Radikale gestartet, die bei der Wechselwirkung der zugesetzten Katalysatoren Ammoniumpersulfat (APS) und Tetramethylethylendiamin (TEMED) entstehen (ECKERT u. KARTENBECK, 1997, S. 69).
18 Auftrennung und Darstellung der Proteine Die Trennung der Proteine erfolgte in einer horizontalen Trennkammer (Multiphor II Electrophoresis System; Fa. Pharmacia Biotech, Freiburg), die eine Kühlplatte und seitlich angeordnete Puffertanks besitzt. Als Kühlkontaktflüssigkeit wurde Mineralöl (Fa. Pharmacia Biotech, Freiburg) eingesetzt. Nach dem Füllen der Puffertanks mit Anoden- bzw. Kathodenpuffer (WESTERMEIER, 1990, S. 172) wurde mit Hilfe von Papier-Elektrodenbrücken eine Verbindung zwischen den Puffer-Lösungen und dem Gel hergestellt. Anschließend wurden die Proben gemeinsam mit einem Marker (Low Molecular Weight [LMW] Calibration Kit for Electrophoresis; Fa. Pharmacia Biotech, Freiburg), der sechs verschiedene Referenzproteine mit bekannten Molekulargewichten von 14,4 bis 94 kda enthält, auf das Gel aufgetragen. Um methodisch bedingte Einflüsse auf das Proteinbandenmuster ausschließen zu können, wurden die Hornproben eines Hufes im selben Arbeitsgang aufbereitet und anschließend nebeneinander auf das Gel pipettiert. Auch die Proben von den Warmblutpferden wurden gemeinsam mit denen der Przewalskipferde hergestellt und zusammen mit diesen auf ein Gel aufgetragen. Die Elektrophorese wurde in zwei Phasen bei einer Temperatur von 15 C durchgeführt. Nach einer 30-minütigen Eindringphase bei Niedrigspannung (100 Volt, 50 Milliampere, 30 Watt), die einen sanften Proteineintritt in das Trennmedium ermöglicht, wurden die Proteine in der zweiten Phase bei Hochspannung (600 Volt, 50 Milliampere, 30 Watt) über 2,5-3,5 Stunden aufgetrennt. Die hohe Spannung bewirkt eine schnelle Trennung bei minimaler Diffusion der Proteine. Im Anschluss wurden die Gele in 40 %igem Ethanol, dem 10 % Eisessig zugesetzt war, fixiert. Die abschließende Darstellung der Proteinbanden erfolgte durch eine Coomassie- Färbung bzw. durch eine Versilberung nach HEUKESHOVEN und DERNICK (1985). Für die Coomassie-Färbung, die für Proben mit einem Proteingehalt von 0,2-5,0 mg / ml geeignet ist, wurde der Farbstoff PhastGel Blue R (Fa. Pharmacia Biotech, Freiburg) verwendet. Die deutlich empfindlichere Silberfärbung wurde mit dem Silver Staining Kit, Protein (Fa. Pharmacia Biotech, Freiburg) durchgeführt. Bei dieser Färbung werden die Proteinbanden durch eine photochemische Reaktion dargestellt, wobei die Silber-Ionen mit den Proteinen Silber-Protein-Komplexe bilden. Die Versilberung ist für Proben mit einem Proteingehalt von 0,01-1,0 mg / ml geeignet. Anhand der bekannten Molekulargewichte der Proteinbanden des Markers wurde für jedes Gel eine Eichkurve erstellt, die eine Berechnung der Molekulargewichte der einzelnen Proteinbanden des Untersuchungsmaterials ermöglichte. 10. Western Blotting Die durch die SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese aufgetrennten Proteine können durch das Western Blotting vollständig auf eine synthetische Membran übertragen werden. Die auf der Membranoberfläche gebundenen Proteine sind dadurch für einen anschließenden immunologischen Nachweis mit spezifischen Antikörpern leicht zugänglich.
19 54 Bei der Verwendung der zuvor hergestellten diskontinuierlichen Polyacrylamidgele wurden leider nur unbefriedigende Ergebnisse erzielt. Aus diesem Grund wurde für das Blotting auf kommerziell erhältliche Gradientengele (ExcelGel SDS, gradient 8-18; Fa. Pharmacia Biotech, Freiburg) zurückgegriffen Proteintransfer Zum Transfer der gelelektrophoretisch aufgetrennten Proteine auf eine Nitrocellulosemembran wurde das Semidry-Blotting-Verfahren angewandt. Dazu wurde das Polyacrylamidgel zusammen mit der Blotmembran zwischen zwei in Transferpuffer getränkte Filterpapierstapel gelegt, die direkten Kontakt zu zwei horizontalen Graphitplatten-Elektroden hatten. Der Transfer erfolgte in einem diskontinuierlichen Puffersystem nach KYHSE-ANDERSEN (WESTERMEIER, 1990, S. 59 u. 190ff) bei einer konstanten Stromstärke von 0,8 Milliampere / cm² innerhalb einer Stunde bei Raumtemperatur. 11. Differenzierung der Zytokeratine Vor dem spezifischen immunologischen Proteinnachweis wurden die Proteine auf der Blotmembran durch eine reversible Anfärbung mit Ponceau S (ECKERT u. KARTENBECK, 1997, S. 155ff) dargestellt. Das Bandenmuster wurde zur späteren Orientierung fotografiert. Anschließend wurde die Blotmembran zur Entfärbung gründlich in Tris-gepufferter Kochsalzlösung (TBS, ph 7,4) (ECKERT u. KARTENBECK, 1997, S. 230) gespült. Zur Blockierung von unspezifischen Bindungsstellen auf der Blotmembran wurde zunächst eine 45-minütige Inkubation in 3 %iger Magermilch bei 37 C durchgeführt. Dazu wurde Magermilchpulver (Fa. Sigma, Deisenhofen) in TBS gelöst, dem 0,1 % der oberflächenaktiven Substanz Tween 20 zugesetzt war (TBST). Direkt im Anschluss erfolgte eine 18-stündige Inkubation mit dem jeweiligen Primär-Antikörper (Anti-Zytokeratin, siehe Tab. 7), der je nach Typ und Ausgangskonzentration in einem Verhältnis von 1:100 bis 1:1000 mit TBST verdünnt war, bei 4 C. Zur Entfernung der ungebundenen Anteile des Primär-Antikörpers wurde die Blotmembran anschließend gründlich in TBST gewaschen. Der an das Antigen gebundene Primär-Antikörper wurde schließlich durch einen enzymgekoppelten Sekundär-Antikörper (DAKO, StreptAB-Komplex/HRP-Duett, Fa. DAKO Diagnostika, Hamburg), der gegen den Primär-Antikörper gerichtet ist, nachgewiesen. Dazu wurde die Blotmembran zunächst eine Stunde mit dem biotinylierten Sekundär-Antikörper, der in einem Verhältnis von 1:200 mit TBS verdünnt war, bei Raumtemperatur inkubiert. Um den ungebundenen Anteil des Sekundär-Antikörpers zu entfernen, wurde die Blotmembran anschließend gründlich in TBS gewaschen. Im Anschluss daran wurde eine einstündige Inkubation mit einem Streptavidinbiotinylierten Peroxidase-Komplex, der ebenfalls in einem Verhältnis von 1:200 mit TBS verdünnt war, bei Raumtemperatur durchgeführt. Das Avidin, das eine hohe Affinität zu Biotin besitzt, fungiert bei dieser Reaktion als Brückenmolekül zwischen dem biotinylierten Sekundär-Antikörper und dem biotinylierten Enzym. Danach wurde die Blotmembran erneut
Tabelle 1: Futterrationen der verschiedenen Versuchstiergruppen. Halbsynthetische Biotinmangeldiät + 2% Avidin
 44 C. MATERIAL UND METHODEN 1. DAS UNTERSUCHUNGSMATERIAL Untersucht wurden vier verschiedene Hautstellen von insgesamt 12 Hühnerküken aus drei Versuchstiergruppen mit jeweils vier Tieren. Die Masthühner
44 C. MATERIAL UND METHODEN 1. DAS UNTERSUCHUNGSMATERIAL Untersucht wurden vier verschiedene Hautstellen von insgesamt 12 Hühnerküken aus drei Versuchstiergruppen mit jeweils vier Tieren. Die Masthühner
Western Blot. Zuerst wird ein Proteingemisch mit Hilfe einer Gel-Elektrophorese aufgetrennt.
 Western Blot Der Western Blot ist eine analytische Methode zum Nachweis bestimmter Proteine in einer Probe. Der Nachweis erfolgt mit spezifischen Antikörpern, die das gesuchte Protein erkennen und daran
Western Blot Der Western Blot ist eine analytische Methode zum Nachweis bestimmter Proteine in einer Probe. Der Nachweis erfolgt mit spezifischen Antikörpern, die das gesuchte Protein erkennen und daran
3. Material und Methoden
 3. Material und Methoden Untersucht wurden 12 operativ gewonnene Eileiter von Frauen im Lebensalter von 24 bis 70 Jahren (Tabelle 4). Um die Tuben analysieren zu können, wurde das Einverständnis der Patientinnen
3. Material und Methoden Untersucht wurden 12 operativ gewonnene Eileiter von Frauen im Lebensalter von 24 bis 70 Jahren (Tabelle 4). Um die Tuben analysieren zu können, wurde das Einverständnis der Patientinnen
Bioanalytik-Vorlesung Western-Blot. Vorlesung Bioanalytik/ Westfälische Hochschule WS 1015/16
 Bioanalytik-Vorlesung Western-Blot Vorlesung Bioanalytik/ Westfälische Hochschule WS 1015/16 Western-Blot Western-Blot: Übertragung von elektrophoretisch aufgetrennten Proteinen auf eine Membran und Nachweis
Bioanalytik-Vorlesung Western-Blot Vorlesung Bioanalytik/ Westfälische Hochschule WS 1015/16 Western-Blot Western-Blot: Übertragung von elektrophoretisch aufgetrennten Proteinen auf eine Membran und Nachweis
Abbildungen 197. Abbildung 16
 Abbildungen 197 Abbildung 16 Die dermoepidermale Grenzfläche und Architektur des Zellverbundes vom epidermalen Teil des Klauenbeinträgers im mittleren und distalen Bereich des Wandsegmentes (Horizontschnitte)
Abbildungen 197 Abbildung 16 Die dermoepidermale Grenzfläche und Architektur des Zellverbundes vom epidermalen Teil des Klauenbeinträgers im mittleren und distalen Bereich des Wandsegmentes (Horizontschnitte)
1. Probenentnamestellen Abb. 1
 144 VIII. ABBILDUNGEN 1. Probenentnamestellen Abb. 1 2. Das innere Kronhorn Die Lederhaut Abb. 2 Das Stratum basale Abb. 3 Das Stratum spinosum Abb. 4 Die Architektur der inneren Kronhornröhrchen Abb.
144 VIII. ABBILDUNGEN 1. Probenentnamestellen Abb. 1 2. Das innere Kronhorn Die Lederhaut Abb. 2 Das Stratum basale Abb. 3 Das Stratum spinosum Abb. 4 Die Architektur der inneren Kronhornröhrchen Abb.
SERVA Streptavidin Agarose Resin Agarosematrix zur Affinitätsreinigung von biotinylierten Biomolekülen
 GEBRAUCHSANLEITUNG SERVA Streptavidin Agarose Resin Agarosematrix zur Affinitätsreinigung von biotinylierten Biomolekülen (Kat.-Nr. 42177) SERVA Electrophoresis GmbH - Carl-Benz-Str. 7-69115 Heidelberg
GEBRAUCHSANLEITUNG SERVA Streptavidin Agarose Resin Agarosematrix zur Affinitätsreinigung von biotinylierten Biomolekülen (Kat.-Nr. 42177) SERVA Electrophoresis GmbH - Carl-Benz-Str. 7-69115 Heidelberg
2 Materialien und Methodik
 2 Materialien und Methodik 2.1 Geräte Adhäsivobjektträger; MERCK, Darmstadt Brutschrank INCO 2; MEMMERT, Schwabach Cydok Bildanalysesystem; FIRMA C. H. HILGES, Königswinter Deckglas; TECHNISCHES GLAS ILMENAU
2 Materialien und Methodik 2.1 Geräte Adhäsivobjektträger; MERCK, Darmstadt Brutschrank INCO 2; MEMMERT, Schwabach Cydok Bildanalysesystem; FIRMA C. H. HILGES, Königswinter Deckglas; TECHNISCHES GLAS ILMENAU
Abb. 13: IEF-Gelelektrophorese (nativ) der wasserlöslichen Proteine der Schweinelinse
 43 4. Ergebnisse 4.1 Gele 4.1.1 IEF-Gelelektrophorese In den Versuchen wurden von den Schweinelinsen zunächst IEF-Gelelektrophoresen erstellt, in denen die Proteine der einzelnen Schnitte nach ihrem ph-wert
43 4. Ergebnisse 4.1 Gele 4.1.1 IEF-Gelelektrophorese In den Versuchen wurden von den Schweinelinsen zunächst IEF-Gelelektrophoresen erstellt, in denen die Proteine der einzelnen Schnitte nach ihrem ph-wert
Praktikum Biochemie Einführung in die Molekularbiologie. Bettina Siebers
 Praktikum Biochemie Einführung in die Molekularbiologie Bettina Siebers Rekombinante Expression einer Esterase aus Pseudomonas aeruginosa in E. coli Polyacrylamide Gelelektrophorese (PAGE) Denaturierende
Praktikum Biochemie Einführung in die Molekularbiologie Bettina Siebers Rekombinante Expression einer Esterase aus Pseudomonas aeruginosa in E. coli Polyacrylamide Gelelektrophorese (PAGE) Denaturierende
3. Ergebnisse Charakterisierung des Untersuchungsmaterials
 - 14-3. Ergebnisse 3.1. Charakterisierung des Untersuchungsmaterials Untersucht wurden 76 Basaliome von Patienten, die in der Hautklinik der Martin- Luther-Universität Halle-Wittenberg operativ entfernt
- 14-3. Ergebnisse 3.1. Charakterisierung des Untersuchungsmaterials Untersucht wurden 76 Basaliome von Patienten, die in der Hautklinik der Martin- Luther-Universität Halle-Wittenberg operativ entfernt
Versuch 3. Elektrophorese
 Versuch 3 Elektrophorese Protokollant: E-mail: Studiengang: Gruppen-Nr: Semester: Betreuer: Max Mustermann max@mustermann.de X X X Prof. Dr. Schäfer Wird benotet?: 1. Einleitung Ziel des ersten Versuches
Versuch 3 Elektrophorese Protokollant: E-mail: Studiengang: Gruppen-Nr: Semester: Betreuer: Max Mustermann max@mustermann.de X X X Prof. Dr. Schäfer Wird benotet?: 1. Einleitung Ziel des ersten Versuches
Nach dem Auftauen erfolgte die Kultivierung der Zellen zunächst in mit Gelatine-Lösung (Bacto Gelatine, 1,5% in PBS) beschichteten 6-Lochplatten.
 4 Methoden 4.1 Zellkultur 4.1.1 Kultivierung der Endothelzellen Nach dem Auftauen erfolgte die Kultivierung der Zellen zunächst in mit Gelatine-Lösung (Bacto Gelatine, 1,5% in PBS) beschichteten 6-Lochplatten.
4 Methoden 4.1 Zellkultur 4.1.1 Kultivierung der Endothelzellen Nach dem Auftauen erfolgte die Kultivierung der Zellen zunächst in mit Gelatine-Lösung (Bacto Gelatine, 1,5% in PBS) beschichteten 6-Lochplatten.
4. Ergebnisse. Tab. 10:
 4. Ergebnisse 4.1 in vitro-ergebnisse Es war aus sicherheitstechnischen und arbeitsrechtlichen Gründen nicht möglich, die für den Tierversuch hergestellten, radioaktiv markierten PMMA-Nanopartikel auf
4. Ergebnisse 4.1 in vitro-ergebnisse Es war aus sicherheitstechnischen und arbeitsrechtlichen Gründen nicht möglich, die für den Tierversuch hergestellten, radioaktiv markierten PMMA-Nanopartikel auf
Elektronenmikroskopie. Institut für Veterinär-Anatomie Freie Universität Berlin Prof Dr. Johanna Plendl und Sophie Hansen
 Elektronenmikroskopie Institut für Veterinär-Anatomie Freie Universität Berlin Prof Dr. Johanna Plendl und Sophie Hansen Transmissionselektronenmikroskopie Leuchtschirm Strahlenquelle Kondensor Objektiv
Elektronenmikroskopie Institut für Veterinär-Anatomie Freie Universität Berlin Prof Dr. Johanna Plendl und Sophie Hansen Transmissionselektronenmikroskopie Leuchtschirm Strahlenquelle Kondensor Objektiv
RESOLUTION OENO 24/2004 NACHWEIS VON EIWEISSSTOFFEN PFLANZLICHER HERKUNFT IN WEIN UND MOST
 NACHWEIS VON EIWEISSSTOFFEN PFLANZLICHER HERKUNFT IN WEIN UND MOST DIE GENERALVERSAMMLUNG, unter Bezugnahme auf Artikel 2, Paragraf 2 IV des Gründungsübereinkommens vom 3. April 2001 der Internationalen
NACHWEIS VON EIWEISSSTOFFEN PFLANZLICHER HERKUNFT IN WEIN UND MOST DIE GENERALVERSAMMLUNG, unter Bezugnahme auf Artikel 2, Paragraf 2 IV des Gründungsübereinkommens vom 3. April 2001 der Internationalen
SERVA ProteinStain Fluo-Y Sensitive Fluoreszenz-Proteinfärbung für Polyacrylamidgele
 GEBRAUCHSANLEITUNG SERVA ProteinStain Fluo-Y Sensitive Fluoreszenz-Proteinfärbung für Polyacrylamidgele (Kat.-Nr. 35092) SERVA Electrophoresis GmbH - Carl-Benz-Str. 7 - D-69115 Heidelberg Phone +49-6221-138400,
GEBRAUCHSANLEITUNG SERVA ProteinStain Fluo-Y Sensitive Fluoreszenz-Proteinfärbung für Polyacrylamidgele (Kat.-Nr. 35092) SERVA Electrophoresis GmbH - Carl-Benz-Str. 7 - D-69115 Heidelberg Phone +49-6221-138400,
Immunhistochemische Färbung F Immunfluoreszenz. Vortrag Immunologie am von Christopher Tollrian
 Immunhistochemische Färbung F und Immunfluoreszenz Vortrag Immunologie am 22.05.2009 von Christopher Tollrian Inhalt Grundlagen Immunhistochemische Färbung Immunfluoreszenz Proben-Vorbereitung Methoden
Immunhistochemische Färbung F und Immunfluoreszenz Vortrag Immunologie am 22.05.2009 von Christopher Tollrian Inhalt Grundlagen Immunhistochemische Färbung Immunfluoreszenz Proben-Vorbereitung Methoden
PAGE POLYACRYLAMIDGELELEKTROPHORESE
 PAGE POLYACRYLAMIDGELELEKTROPHORESE In der modernen Bioanalytik stellt die Gelelektrophorese immer noch eine Technik dar, die durch keine andere ersetzt werden kann. Vertikale Gele werden dabei i.d.r.
PAGE POLYACRYLAMIDGELELEKTROPHORESE In der modernen Bioanalytik stellt die Gelelektrophorese immer noch eine Technik dar, die durch keine andere ersetzt werden kann. Vertikale Gele werden dabei i.d.r.
Phalloidin-Färbung an kultivierten adhärenten Säugerzellen. Formaldehyd-Fixierung
 Phalloidin-Färbung an kultivierten adhärenten Säugerzellen Formaldehyd-Fixierung 2 Materialien Pinzetten Für das Handling der Zellen ist es empfehlenswert Pinzetten mit sehr feiner Spitze zu nutzen. Hier
Phalloidin-Färbung an kultivierten adhärenten Säugerzellen Formaldehyd-Fixierung 2 Materialien Pinzetten Für das Handling der Zellen ist es empfehlenswert Pinzetten mit sehr feiner Spitze zu nutzen. Hier
Praktikumsanleitung: Proteine III Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamid Gel Elektrophorese
 Praktikumsanleitung: Proteine III Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamid Gel Elektrophorese Lerninhalt: Proteinanalytische Methoden: Elektrophorese, Färbung und Molekulargewichtsbestimmung, Primär, Sekundär,
Praktikumsanleitung: Proteine III Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamid Gel Elektrophorese Lerninhalt: Proteinanalytische Methoden: Elektrophorese, Färbung und Molekulargewichtsbestimmung, Primär, Sekundär,
8.1. Zusammensetzung und Herstellung der verwendeten Medien für die In-vitro-Maturation, -Fertilisation und - Kultivierung
 8. Anhang 8.1. Zusammensetzung und Herstellung der verwendeten Medien für die In-vitro-Maturation, -Fertilisation und - Kultivierung 1.) Spüllösung (modifizierte PBS-Lösung) modifizierte PBS-Lösung 500
8. Anhang 8.1. Zusammensetzung und Herstellung der verwendeten Medien für die In-vitro-Maturation, -Fertilisation und - Kultivierung 1.) Spüllösung (modifizierte PBS-Lösung) modifizierte PBS-Lösung 500
GEBRAUCHSANLEITUNG. Lowry Assay Kit. Kit für die Proteinkonzentrationsbestimmung. (Kat.-Nr )
 GEBRAUCHSANLEITUNG Lowry Assay Kit Kit für die Proteinkonzentrationsbestimmung (Kat.-Nr. 39236) SERVA Electrophoresis GmbH Carl-Benz-Str. 7 D-69115 Heidelberg Phone +49-6221-138400, Fax +49-6221-1384010
GEBRAUCHSANLEITUNG Lowry Assay Kit Kit für die Proteinkonzentrationsbestimmung (Kat.-Nr. 39236) SERVA Electrophoresis GmbH Carl-Benz-Str. 7 D-69115 Heidelberg Phone +49-6221-138400, Fax +49-6221-1384010
5,6- Carboxy- Rhodamin (Rox) TIB MolBiol, Berlin Desoxynukleosidtriphosphat (dntp)
 8 Anhang 8.1 Chemikalien und Reagenzien Bromphenolblau Bromma, Schweden 5,6- Carboxy- Rhodamin (Rox) TIB MolBiol, Berlin Desoxynukleosidtriphosphat (dntp) Invitrogen TM, Karlsruhe Ethanol (RNase-frei)
8 Anhang 8.1 Chemikalien und Reagenzien Bromphenolblau Bromma, Schweden 5,6- Carboxy- Rhodamin (Rox) TIB MolBiol, Berlin Desoxynukleosidtriphosphat (dntp) Invitrogen TM, Karlsruhe Ethanol (RNase-frei)
SDS- PAGE und Western Blot
 SDS- PAGE und Western Blot LiSSA Methodenseminar 16.09.2015 Doreen Braun InsCtut für Biochemie und Molekularbiologie doreen.braun@uni- bonn.de Grundstruktur von Aminosäuren H H H 2 N C R + H 3 N C R COOH
SDS- PAGE und Western Blot LiSSA Methodenseminar 16.09.2015 Doreen Braun InsCtut für Biochemie und Molekularbiologie doreen.braun@uni- bonn.de Grundstruktur von Aminosäuren H H H 2 N C R + H 3 N C R COOH
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Fachbereich Biologie, Institut für Zoologie Leitung: Prof. Dr. Wolfrum Datum: 15. April 2005
 Johannes Gutenberg-Universität Mainz Fachbereich Biologie, Institut für Zoologie Leitung: Prof. Dr. Wolfrum Datum: 15. April 2005 F1 Molekulare Zoologie Teil II: Expressionsanalyse Proteinexpressionsanalyse
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Fachbereich Biologie, Institut für Zoologie Leitung: Prof. Dr. Wolfrum Datum: 15. April 2005 F1 Molekulare Zoologie Teil II: Expressionsanalyse Proteinexpressionsanalyse
4. Material und Methoden 4.1. Gewinnung des Untersuchungsmaterials
 4. Material und Methoden 4.1. Gewinnung des Untersuchungsmaterials Kleinste Proben von intraoperativ gewonnenem Beckenbindegewebe wurden von 29 Frauen im Alter von 34 bis 78 Jahren untersucht. Davon waren
4. Material und Methoden 4.1. Gewinnung des Untersuchungsmaterials Kleinste Proben von intraoperativ gewonnenem Beckenbindegewebe wurden von 29 Frauen im Alter von 34 bis 78 Jahren untersucht. Davon waren
Abbildungsverzeichnis. Tabellenverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis. 1 Einleitung 1
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis I Abbildungsverzeichnis VI Tabellenverzeichnis VIII Abkürzungsverzeichnis IX 1 Einleitung 1 1.1 Wasser, ein limitierender Faktor für die Landwirtschaft 1 1.2 Anpassungen
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis I Abbildungsverzeichnis VI Tabellenverzeichnis VIII Abkürzungsverzeichnis IX 1 Einleitung 1 1.1 Wasser, ein limitierender Faktor für die Landwirtschaft 1 1.2 Anpassungen
Praktikumsanleitung: Proteine III Sodium-Dodecyl-Sulfate Polyacrylamid-Gel- Elektrophorese
 Praktikumsanleitung: Proteine III Sodium-Dodecyl-Sulfate Polyacrylamid-Gel- Elektrophorese Lerninhalt: Proteinanalytische Methoden: Elektrophorese, Färbung und Molekulargewichtsbestimmung, Primär-, Sekundär-,
Praktikumsanleitung: Proteine III Sodium-Dodecyl-Sulfate Polyacrylamid-Gel- Elektrophorese Lerninhalt: Proteinanalytische Methoden: Elektrophorese, Färbung und Molekulargewichtsbestimmung, Primär-, Sekundär-,
TEV Protease, rekombinant (Kat.-Nr )
 GEBRAUCHSANLEITUNG TEV Protease, rekombinant (Kat.-Nr. 36403) SERVA Electrophoresis GmbH - Carl-Benz-Str. 7-69115 Heidelberg Phone +49-6221-138400, Fax +49-6221-1384010 e-mail: info@serva.de -http://www.serva.de
GEBRAUCHSANLEITUNG TEV Protease, rekombinant (Kat.-Nr. 36403) SERVA Electrophoresis GmbH - Carl-Benz-Str. 7-69115 Heidelberg Phone +49-6221-138400, Fax +49-6221-1384010 e-mail: info@serva.de -http://www.serva.de
Praktikumsanleitung: Proteine III Sodium-Dodecyl-Sulfate Polyacrylamid-Gel- Elektrophorese
 Praktikumsanleitung: Proteine III Sodium-Dodecyl-Sulfate Polyacrylamid-Gel- Elektrophorese Lerninhalt: Proteinanalytische Methoden: Elektrophorese, Färbung und Molekulargewichtsbestimmung, Primär-, Sekundär-,
Praktikumsanleitung: Proteine III Sodium-Dodecyl-Sulfate Polyacrylamid-Gel- Elektrophorese Lerninhalt: Proteinanalytische Methoden: Elektrophorese, Färbung und Molekulargewichtsbestimmung, Primär-, Sekundär-,
Modul 4 SS 2015. Western Blot. Tag 1: Proteinbestimmung, SDS-PAGE-Gel-Herstellung S. 3. Tag 2: Gelelektrophorese, Western Blot, Blockierung S.
 Modul 4 SS 2015 Western Blot Tag 1: Proteinbestimmung, SDS-PAGE-Gel-Herstellung S. 3 Tag 2: Gelelektrophorese, Western Blot, Blockierung S. 6 Tag 3: Detektion der Proteine auf der Membran S. 10 1 Über
Modul 4 SS 2015 Western Blot Tag 1: Proteinbestimmung, SDS-PAGE-Gel-Herstellung S. 3 Tag 2: Gelelektrophorese, Western Blot, Blockierung S. 6 Tag 3: Detektion der Proteine auf der Membran S. 10 1 Über
5 Monate w Ketamin/Xylazin i.v. 2 Institut für Veterinär- Anatomie. Leghorn- Hybrid. w Ketamin/Xylazin i.v. 3 Institut für Veterinär- Anatomie
 37 3. MATERIAL UND METHODEN 3.1 MATERIAL Es wurden die Meningen von insgesamt 34 Hühnern und Hähnen untersucht. Die Tiere stammten aus der institutseigenen Hühnerzucht des Institutes für Veterinäranatomie
37 3. MATERIAL UND METHODEN 3.1 MATERIAL Es wurden die Meningen von insgesamt 34 Hühnern und Hähnen untersucht. Die Tiere stammten aus der institutseigenen Hühnerzucht des Institutes für Veterinäranatomie
3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung
 Eigene Untersuchungen 25 3.2 Ergebnisse 3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung Untersucht wurde, ob die Magnetfeldbehandlung mit 1, 8, 12, 29 und 5 Hz einen Einfluss
Eigene Untersuchungen 25 3.2 Ergebnisse 3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung Untersucht wurde, ob die Magnetfeldbehandlung mit 1, 8, 12, 29 und 5 Hz einen Einfluss
Inhaltsverzeichnis. Geleitwort. Vorwort XVII. Vorwort zur ersten Auflage XIX. Abkürzungen XXI. Teil I Grundlagen 1
 Inhaltsverzeichnis Geleitwort XV Vorwort XVII Vorwort zur ersten Auflage XIX Abkürzungen XXI Teil I Grundlagen 1 1 Elektrophorese 7 1.1 Allgemeines 7 1.1.1 Elektrophoresen in freier Lösung 7 1.1.2 Elektrophoresen
Inhaltsverzeichnis Geleitwort XV Vorwort XVII Vorwort zur ersten Auflage XIX Abkürzungen XXI Teil I Grundlagen 1 1 Elektrophorese 7 1.1 Allgemeines 7 1.1.1 Elektrophoresen in freier Lösung 7 1.1.2 Elektrophoresen
SERVA Lightning Sci2. SERVA Lightning Sci3. SERVA Lightning Sci5. SERVA Lightning SciDye Set
 GEBRAUCHSANLEITUNG SERVA Lightning Sci2 (Kat.-Nr. 43404) SERVA Lightning Sci3 (Kat.-Nr. 43405) SERVA Lightning Sci5 (Kat.-Nr. 43406) SERVA Lightning SciDye Set (Kat.-Nr. 43407) Fluoreszenzfarbstoffe für
GEBRAUCHSANLEITUNG SERVA Lightning Sci2 (Kat.-Nr. 43404) SERVA Lightning Sci3 (Kat.-Nr. 43405) SERVA Lightning Sci5 (Kat.-Nr. 43406) SERVA Lightning SciDye Set (Kat.-Nr. 43407) Fluoreszenzfarbstoffe für
Inhalt 1. Einleitung Material und Methode... 17
 Inhalt 1. Einleitung... 1 1. 1. Zum Thema... 1 1. 2. Aufbau der Epidermis und Überblick über die verschiedenen Bestrahlungsarten... 2 1. 2. 1. Epidermisaufbau und Epidermiskinetik... 2 1. 2. 2. Verschiedene
Inhalt 1. Einleitung... 1 1. 1. Zum Thema... 1 1. 2. Aufbau der Epidermis und Überblick über die verschiedenen Bestrahlungsarten... 2 1. 2. 1. Epidermisaufbau und Epidermiskinetik... 2 1. 2. 2. Verschiedene
Praktikum Biochemie Einführung in die Molekularbiologie. Bettina Siebers
 Praktikum Biochemie Einführung in die Molekularbiologie Bettina Siebers (4) Rekombinante Expression einer Esterase aus Pseudomonas aeruginosa in E. coli Proteinreinigung Techniken & Methoden der Proteinreinigung
Praktikum Biochemie Einführung in die Molekularbiologie Bettina Siebers (4) Rekombinante Expression einer Esterase aus Pseudomonas aeruginosa in E. coli Proteinreinigung Techniken & Methoden der Proteinreinigung
3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome
 3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome Untersucht wurden insgesamt 26 Melanome, die zwischen 1991 und 1997 in der Universitätsklinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie
3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome Untersucht wurden insgesamt 26 Melanome, die zwischen 1991 und 1997 in der Universitätsklinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie
Segmentspezifitäten am Pferdehuf - Teil II: Zusammenhang. Horneigenschaften in den verschiedenen Hufsegmenten. Einleitung
 B. Patan und K.-D. Budras Pferdeheilkunde 19 (2003) 1 (Januar/Februar) 177-184 Segmentspezifitäten am Pferdehuf - Teil II: Zusammenhang zwischen Hornstruktur und mechanischphysikalischen Horneigenschaften
B. Patan und K.-D. Budras Pferdeheilkunde 19 (2003) 1 (Januar/Februar) 177-184 Segmentspezifitäten am Pferdehuf - Teil II: Zusammenhang zwischen Hornstruktur und mechanischphysikalischen Horneigenschaften
Alcianblau-PAS Die Kombination für optimale Färbeergebnisse
 Alcianblau-PAS Die Kombination für optimale Färbeergebnisse Histologie Ihre Ziele im Fokus. Alcianblau-PAS die Kombinationsfärbung für die Histologie Beste Färbequalität und hervorragende Reproduzierbarkeit
Alcianblau-PAS Die Kombination für optimale Färbeergebnisse Histologie Ihre Ziele im Fokus. Alcianblau-PAS die Kombinationsfärbung für die Histologie Beste Färbequalität und hervorragende Reproduzierbarkeit
clixx Histologie Highlights aus dem Innenleben der Tiere von Sabine Bungart, Frank Paris 1. Auflage
 clixx Histologie Highlights aus dem Innenleben der Tiere von Sabine Bungart, Frank Paris 1. Auflage clixx Histologie Bungart / Paris schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG
clixx Histologie Highlights aus dem Innenleben der Tiere von Sabine Bungart, Frank Paris 1. Auflage clixx Histologie Bungart / Paris schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG
Mikroskopische Aufgaben
 Mikroskopische Aufgaben 1. Die Benutzung des Lichtmikroskops Schauen Sie sich die Bauteile des Praktikumsmikroskops an und üben Sie ihre Benutzung! - Okular, Tubus - Großtrieb, Feintrieb - Objektivrevolver,
Mikroskopische Aufgaben 1. Die Benutzung des Lichtmikroskops Schauen Sie sich die Bauteile des Praktikumsmikroskops an und üben Sie ihre Benutzung! - Okular, Tubus - Großtrieb, Feintrieb - Objektivrevolver,
Elektrophorese. Herbstsemester ETH Zurich Dr. Thomas Schmid Dr. Martin Badertscher,
 Elektrophorese 1 Elektrophorese Allgemein: Wanderung geladener Teilchen im elektrischen Feld Analytische Chemie: Trennung von Ionen im elektrischen Feld (Elektrophoretische Trenntechniken zählen im Allgemeinen
Elektrophorese 1 Elektrophorese Allgemein: Wanderung geladener Teilchen im elektrischen Feld Analytische Chemie: Trennung von Ionen im elektrischen Feld (Elektrophoretische Trenntechniken zählen im Allgemeinen
Protokoll zur Übung Gelelektrophorese
 Protokoll zur Übung Gelelektrophorese im Rahmen des Praktikums Labor an der TU Wien Durchgeführt bei Univ.Ass. Mag.rer.nat. Dr.rer.nat. Martina Marchetti-Deschmann Verfasser des Protokolls: Gwendolin Korinek
Protokoll zur Übung Gelelektrophorese im Rahmen des Praktikums Labor an der TU Wien Durchgeführt bei Univ.Ass. Mag.rer.nat. Dr.rer.nat. Martina Marchetti-Deschmann Verfasser des Protokolls: Gwendolin Korinek
2. Material und Methoden
 - 6-2. Material und Methoden 2.1. Untersuchungsmaterial Aus dem Gesamtkrankengut (203 Fälle) aller im Jahr 1994 in der Klinik und Poliklinik für Hautkrankheiten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
- 6-2. Material und Methoden 2.1. Untersuchungsmaterial Aus dem Gesamtkrankengut (203 Fälle) aller im Jahr 1994 in der Klinik und Poliklinik für Hautkrankheiten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Grundlagen: Galvanische Zellen:
 E1 : Ionenprodukt des Wassers Grundlagen: Galvanische Zellen: Die Galvanische Zelle ist eine elektrochemische Zelle. In ihr laufen spontan elektrochemische Reaktionen unter Erzeugung von elektrischer Energie
E1 : Ionenprodukt des Wassers Grundlagen: Galvanische Zellen: Die Galvanische Zelle ist eine elektrochemische Zelle. In ihr laufen spontan elektrochemische Reaktionen unter Erzeugung von elektrischer Energie
6.2 Tabellen Kapitel 2
 -55- SiO 2 Na 2 O CaO P 2 O 5 Tab. 2.1.1: Zusaensetzung der einzelnen Glaskompositionen in Gewichtsprozent 45s5 45 24.5 24.5 52s 52 21 21 55s 55 19.5 19.5 Iersionsfixation in Formaldehyd nach Lillie, ph
-55- SiO 2 Na 2 O CaO P 2 O 5 Tab. 2.1.1: Zusaensetzung der einzelnen Glaskompositionen in Gewichtsprozent 45s5 45 24.5 24.5 52s 52 21 21 55s 55 19.5 19.5 Iersionsfixation in Formaldehyd nach Lillie, ph
aktualisiert, 10.03.2011, Wera Roth, DE1 WESTERN BLOT
 1 aktualisiert, 10.03.2011, Wera Roth, DE1 WESTERN BLOT 1. Hinweise zu Membranen a. Nitrocellulose b. PVDF (alternativ) 2. Aufbau des Transfers a. Naßblot b. Semi-dry (alternativ) 3. Färben und Dokumentation
1 aktualisiert, 10.03.2011, Wera Roth, DE1 WESTERN BLOT 1. Hinweise zu Membranen a. Nitrocellulose b. PVDF (alternativ) 2. Aufbau des Transfers a. Naßblot b. Semi-dry (alternativ) 3. Färben und Dokumentation
DAC-Probe 10. Hochleistungsdünnschichtchromatographie (HPTLC) Einleitung. Allgemeine Angaben
 DAC-Probe 0 Probe_0 DAC-Probe 0 Hochleistungsdünnschichtchromatographie (HPTLC) Sofern in der Monographie nichts anderes angegeben ist, wird die Auftrennung mit den folgenden Angaben durchgeführt: es werden
DAC-Probe 0 Probe_0 DAC-Probe 0 Hochleistungsdünnschichtchromatographie (HPTLC) Sofern in der Monographie nichts anderes angegeben ist, wird die Auftrennung mit den folgenden Angaben durchgeführt: es werden
PROTEINBESTIMMUNG. Vergleich Bradford und BCA
 PROTEINBESTIMMUNG Vergleich Bradford und BCA ÜBERSICHT Einleitung Theorie Durchführung Resultate und Diskussion Fragen EINLEITUNG Aufgabenstellung: Vergleich der Methoden zur quantitativen Proteinbestimmung
PROTEINBESTIMMUNG Vergleich Bradford und BCA ÜBERSICHT Einleitung Theorie Durchführung Resultate und Diskussion Fragen EINLEITUNG Aufgabenstellung: Vergleich der Methoden zur quantitativen Proteinbestimmung
p53-menge bei 4197 nach Bestrahlung mit 4Gy Röntgenstrahlung 3,51 PAb421 PAb1801 PAb240 Do-1 Antikörper
 1.1 STRAHLENINDUZIERTE P53-MENGE 1.1.1 FRAGESTELLUNG Die Kenntnis, daß ionisierende Strahlen DNA Schäden verursachen und daß das Protein p53 an den zellulären Mechanismen beteiligt ist, die der Manifestation
1.1 STRAHLENINDUZIERTE P53-MENGE 1.1.1 FRAGESTELLUNG Die Kenntnis, daß ionisierende Strahlen DNA Schäden verursachen und daß das Protein p53 an den zellulären Mechanismen beteiligt ist, die der Manifestation
3 Ergebnisse 3.1 Klinische Befunde Alter und Geschlecht in Abhängigkeit von der Überlebenszeit
 13 3 Ergebnisse 3.1 Klinische Befunde 3.1.1 Alter und Geschlecht in Abhängigkeit von der Überlebenszeit Es wurden die klinischen Daten von 33 Patienten ausgewertet. Es handelte sich um 22 Frauen (66,7
13 3 Ergebnisse 3.1 Klinische Befunde 3.1.1 Alter und Geschlecht in Abhängigkeit von der Überlebenszeit Es wurden die klinischen Daten von 33 Patienten ausgewertet. Es handelte sich um 22 Frauen (66,7
Protein-Molekulargewichtsmarker und anti-marker-antikörper für die chemilumineszente Detektion auf Westernblots
 Roti -Mark WESTERN Set (Art. Nr. 0947.1) und MINI-Set (Art. Nr. 0947.2) Roti -Mark WESTERN Marker (Art. Nr. 0948.1) Roti -Mark WESTERN HRP-Konjugat (Art. Nr. 0949.1) Protein-Molekulargewichtsmarker und
Roti -Mark WESTERN Set (Art. Nr. 0947.1) und MINI-Set (Art. Nr. 0947.2) Roti -Mark WESTERN Marker (Art. Nr. 0948.1) Roti -Mark WESTERN HRP-Konjugat (Art. Nr. 0949.1) Protein-Molekulargewichtsmarker und
Methodensammlung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Gentechnik (LAG) Differenzierung von E.coli-Stämmen mit Hilfe der Pulsfeldgelelektrophorese
 Methodensammlung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Gentechnik (LAG) Differenzierung von E.coli-Stämmen mit Hilfe der Pulsfeldgelelektrophorese Erstellt vom Unterausschuss Methodenentwicklung der LAG,
Methodensammlung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Gentechnik (LAG) Differenzierung von E.coli-Stämmen mit Hilfe der Pulsfeldgelelektrophorese Erstellt vom Unterausschuss Methodenentwicklung der LAG,
3,58 g 0,136 g. ad 100 ml
 9 Anhang 9.1 Rezepturen der Puffer und Lösungen 9.1.1 Vorbereitung der Proben zur Extraktion Coon s-puffer (0,1 M, ph 7,2-7,6) Na 2 HPO 4 x 12 H 2 O KH 2 PO 4 Aqua dest. 3,58 g 0,136 g 8,77 g 9.1.2 Aufbereitung
9 Anhang 9.1 Rezepturen der Puffer und Lösungen 9.1.1 Vorbereitung der Proben zur Extraktion Coon s-puffer (0,1 M, ph 7,2-7,6) Na 2 HPO 4 x 12 H 2 O KH 2 PO 4 Aqua dest. 3,58 g 0,136 g 8,77 g 9.1.2 Aufbereitung
Tabelle 11: AgNOR- und Zellparameter aller benignen Tumoren
 60 Tumor- Nr. Gesamtfläche Zahl/ Zelle [z/ - Quotient [z/µm²] höchste Zahl [z/nukl.] Kernfläche Nukleolenzahl [NZ/ Nuk.ges. [µm²/ 1 0,080 0,373 4,6 57,73 12,0 48,33 1,0 3,64 2 0,120 0,275 2,3 19,02 3,0
60 Tumor- Nr. Gesamtfläche Zahl/ Zelle [z/ - Quotient [z/µm²] höchste Zahl [z/nukl.] Kernfläche Nukleolenzahl [NZ/ Nuk.ges. [µm²/ 1 0,080 0,373 4,6 57,73 12,0 48,33 1,0 3,64 2 0,120 0,275 2,3 19,02 3,0
Modul 5 Praktikum Western Blotting, Krauß / Lamparter, für Biologie 4. Semester Sommersemester 2017
 Modul 5 Praktikum Western Blotting, Krauß / Lamparter, für Biologie 4. Semester Sommersemester 2017 Einteilung in 2 Untergruppen, beide arbeiten parallel. 1. Tag: Gele gießen (1 h), Vorbesprechung (1 h),
Modul 5 Praktikum Western Blotting, Krauß / Lamparter, für Biologie 4. Semester Sommersemester 2017 Einteilung in 2 Untergruppen, beide arbeiten parallel. 1. Tag: Gele gießen (1 h), Vorbesprechung (1 h),
Enzymologie 10. Kurs
 Arbeitsgruppe D Clara Dees Susanne Duncker Anja Hartmann Kristin Hofmann Kurs : Enzymologie Einleitung Enzyme ermöglichen durch ihre katalytische Wirkung viele Reaktionen im Stoffwechsel von Lebewesen.
Arbeitsgruppe D Clara Dees Susanne Duncker Anja Hartmann Kristin Hofmann Kurs : Enzymologie Einleitung Enzyme ermöglichen durch ihre katalytische Wirkung viele Reaktionen im Stoffwechsel von Lebewesen.
Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease.
 A 36 Michaelis-Menten-Kinetik: Hydrolyse von Harnstoff Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease. Grundlagen: a) Michaelis-Menten-Kinetik Im Bereich der Biochemie spielen
A 36 Michaelis-Menten-Kinetik: Hydrolyse von Harnstoff Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease. Grundlagen: a) Michaelis-Menten-Kinetik Im Bereich der Biochemie spielen
Untersuchungsergebnisse 59 IV. UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE
 Untersuchungsergebnisse 59 IV. UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE Da die Architektur der Hornröhrchen sowohl durch die Lederhaut als auch durch die lebende Epidermis bestimmt wird, erfolgte sowohl eine licht- als
Untersuchungsergebnisse 59 IV. UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE Da die Architektur der Hornröhrchen sowohl durch die Lederhaut als auch durch die lebende Epidermis bestimmt wird, erfolgte sowohl eine licht- als
Ergebnisse 4.1 Der Vaginalabstrich der Maus
 45 4 Ergebnisse 4.1 Der Vaginalabstrich der Maus Alle 24 Stunden ist bei jeder Maus ein vaginaler Abstrich angefertigt worden, der auf einem Objektträger ausgestrichen und mittels Giemsa-Färbung gefärbt
45 4 Ergebnisse 4.1 Der Vaginalabstrich der Maus Alle 24 Stunden ist bei jeder Maus ein vaginaler Abstrich angefertigt worden, der auf einem Objektträger ausgestrichen und mittels Giemsa-Färbung gefärbt
Analytische Chemie. B. Sc. Chemieingenieurwesen. 8. Juli 2015, Uhr. Prof. Dr. T. Jüstel, Stephanie Möller M. Sc.
 Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 8. Juli 2015, 12.30 15.30 Uhr Prof. Dr. T. Jüstel, Stephanie Möller M. Sc. Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges
Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 8. Juli 2015, 12.30 15.30 Uhr Prof. Dr. T. Jüstel, Stephanie Möller M. Sc. Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges
SERVALight Vega Western Blot Chemilumineszenz HRP Substrat Kit
 GEBRAUCHSANLEITUNG SERVALight Vega Western Blot Chemilumineszenz HRP Substrat Kit (Kat.-Nr. 42588) SERVA Electrophoresis GmbH - Carl-Benz-Str. 7-69115 Heidelberg Phone +49-6221-138400, Fax +49-6221-1384010
GEBRAUCHSANLEITUNG SERVALight Vega Western Blot Chemilumineszenz HRP Substrat Kit (Kat.-Nr. 42588) SERVA Electrophoresis GmbH - Carl-Benz-Str. 7-69115 Heidelberg Phone +49-6221-138400, Fax +49-6221-1384010
F-I Molekulare Zoologie: Teil II: Expressionsanalysen. Proteinexpressionsanalyse mittels SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese und Western Blot Analyse
 F-I Molekulare Zoologie: Teil II: Expressionsanalysen Proteinexpressionsanalyse mittels SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese und Western Blot Analyse Inhalt: Seite I. Allgemeines 1 II. Durchführung der Elektrophorese
F-I Molekulare Zoologie: Teil II: Expressionsanalysen Proteinexpressionsanalyse mittels SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese und Western Blot Analyse Inhalt: Seite I. Allgemeines 1 II. Durchführung der Elektrophorese
Probe und Probenmenge Wassermenge Auftragspuffermenge 5 µl Kaninchenmuskelextrakt 50 µl 100 µl
 Arbeitsgruppe D 6 Clara Dees Susanne Duncker Anja Hartmann Kristin Hofmann Kurs 3: Proteinanalysen Im heutigen Kurs extrahierten wir zum einen Proteine aus verschiedenen Geweben eines Kaninchens und führten
Arbeitsgruppe D 6 Clara Dees Susanne Duncker Anja Hartmann Kristin Hofmann Kurs 3: Proteinanalysen Im heutigen Kurs extrahierten wir zum einen Proteine aus verschiedenen Geweben eines Kaninchens und führten
Rosa Geheimschrift. Durchführung
 Name: Datum: Materialien verschiedene Papiersorten (auch Filterpapier), Pinsel, Wattestäbchen, Fön, Lösung F (Phenolphthalein-Lösung: 0,1 g/100 ml Ethanol), Lösung G (Natriumcarbonat-Lösung: 1 g/100 ml)
Name: Datum: Materialien verschiedene Papiersorten (auch Filterpapier), Pinsel, Wattestäbchen, Fön, Lösung F (Phenolphthalein-Lösung: 0,1 g/100 ml Ethanol), Lösung G (Natriumcarbonat-Lösung: 1 g/100 ml)
Zellbiologie. Lichtmikroskopie Elektronenmikroskopie Biologische Membranen Membranverbindungen
 Zellbiologie Lichtmikroskopie Elektronenmikroskopie Biologische Membranen Membranverbindungen Elektronenmikroskopie 1924 erkannte der Belgier L. de Broglie den Wellencharakter von Elektronenstrahlen M.
Zellbiologie Lichtmikroskopie Elektronenmikroskopie Biologische Membranen Membranverbindungen Elektronenmikroskopie 1924 erkannte der Belgier L. de Broglie den Wellencharakter von Elektronenstrahlen M.
Kursus in Histopathologie. Allgemeines
 Kursus in Histopathologie I. Bestandteile des Kursus: Präparate zur - Allgemeinen Pathologie (n = 31) - Speziellen (Organ)Pathologie (n = 23) II. Ziel des Kursus: Wiederholung von: - Allgemeiner Pathologie
Kursus in Histopathologie I. Bestandteile des Kursus: Präparate zur - Allgemeinen Pathologie (n = 31) - Speziellen (Organ)Pathologie (n = 23) II. Ziel des Kursus: Wiederholung von: - Allgemeiner Pathologie
Abbildung 1: Schematische Darstellung der Domänenorganisation von Survivin
 Abbildung 1: Schematische Darstellung der Domänenorganisation von Survivin Survivin weist eine N-terminale BIR-Domäne (grün) und eine C-terminale α-helix (blau) auf. Das intrinsische nuclear export signal
Abbildung 1: Schematische Darstellung der Domänenorganisation von Survivin Survivin weist eine N-terminale BIR-Domäne (grün) und eine C-terminale α-helix (blau) auf. Das intrinsische nuclear export signal
Übungsaufgabe 1. Photometrische Bestimmung von Chrom als Chromat Chemikalien: H 2 O 2, Natronlauge, Chrom-(III)-salz
 Übungsaufgabe 1 Photometrische Bestimmung von Chrom als Chromat Chemikalien: H 2 O 2, Natronlauge, Chrom-(III)-salz Versuchsbeschreibung: 20 ml der erhaltenen Probelösung werden in ein 150 ml Becherglas
Übungsaufgabe 1 Photometrische Bestimmung von Chrom als Chromat Chemikalien: H 2 O 2, Natronlauge, Chrom-(III)-salz Versuchsbeschreibung: 20 ml der erhaltenen Probelösung werden in ein 150 ml Becherglas
RESOLUTION OIV/OENO 427/2010 KRITERIEN FÜR METHODEN ZUR QUANTIFIZIERUNG VON POTENTIELL ALLERGENEN RÜCKSTÄNDEN EIWEISSHALTIGER SCHÖNUNGSMITTEL IM WEIN
 RESOLUTION OIV/OENO 427/2010 KRITERIEN FÜR METHODEN ZUR QUANTIFIZIERUNG VON POTENTIELL ALLERGENEN RÜCKSTÄNDEN EIWEISSHALTIGER SCHÖNUNGSMITTEL IM WEIN Die GENERALVERSAMMLUNG, unter Berücksichtigung des
RESOLUTION OIV/OENO 427/2010 KRITERIEN FÜR METHODEN ZUR QUANTIFIZIERUNG VON POTENTIELL ALLERGENEN RÜCKSTÄNDEN EIWEISSHALTIGER SCHÖNUNGSMITTEL IM WEIN Die GENERALVERSAMMLUNG, unter Berücksichtigung des
NUTZUNGS- UND GEBÜHRENORDNUNG TECHNOLOGIEANGEBOT ELEKTRONENMIKROSKOPIE - NUTZUNGSORDNUNG ELEKTRONENMIKROSKOPIE -
 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Medizinische Fakultät Institut für Muskuloskelettale Medizin (IMM) (Direktor: Univ.-Prof. Dr. med Thomas Pap) Albert Schweitzer Campus 1 Gebäude D3 NUTZUNGS- UND
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Medizinische Fakultät Institut für Muskuloskelettale Medizin (IMM) (Direktor: Univ.-Prof. Dr. med Thomas Pap) Albert Schweitzer Campus 1 Gebäude D3 NUTZUNGS- UND
SERVA HPE Silver Staining Kit
 GEBRAUCHSANLEITUNG SERVA HPE Silver Staining Kit Sensitive Proteinfärbung für SDS Polyacrylamidgele (Kat.-Nr. 43395) SERVA Electrophoresis GmbH Carl-Benz-Str. 7 D-69115 Heidelberg Phone +49-6221-138400,
GEBRAUCHSANLEITUNG SERVA HPE Silver Staining Kit Sensitive Proteinfärbung für SDS Polyacrylamidgele (Kat.-Nr. 43395) SERVA Electrophoresis GmbH Carl-Benz-Str. 7 D-69115 Heidelberg Phone +49-6221-138400,
Übung Vor-Ort Parameter / Elektroden (1)
 Übung Vor-Ort Parameter / Elektroden (1) 14.04.2009 Filtration / Probenstabilisierung Gegeben ist eine Oberflächenwasser-Probe versetzt mit einer definierten Menge Multi- Element-Standard. Für Gruppe 1,
Übung Vor-Ort Parameter / Elektroden (1) 14.04.2009 Filtration / Probenstabilisierung Gegeben ist eine Oberflächenwasser-Probe versetzt mit einer definierten Menge Multi- Element-Standard. Für Gruppe 1,
Immunofluoreszenz-Markierung an kultivierten adhärenten Säugerzellen. Methanol-Fixierung
 Immunofluoreszenz-Markierung an kultivierten adhärenten Säugerzellen Methanol-Fixierung 2 Materialien Pinzetten Für das Handling der Zellen ist es empfehlenswert Pinzetten mit sehr feiner Spitze zu nutzen.
Immunofluoreszenz-Markierung an kultivierten adhärenten Säugerzellen Methanol-Fixierung 2 Materialien Pinzetten Für das Handling der Zellen ist es empfehlenswert Pinzetten mit sehr feiner Spitze zu nutzen.
Versuchsprotokoll: Aminosäure- und Proteinbestimmung
 Versuchsprotokoll: Aminosäure- und Proteinbestimmung a) Proteinbestimmung mit Biuret-Reagenz 1.1. Einleitung Das Ziel des Versuchs ist es nach Aufstellen einer Eichgerade mit gegeben Konzentrationen, die
Versuchsprotokoll: Aminosäure- und Proteinbestimmung a) Proteinbestimmung mit Biuret-Reagenz 1.1. Einleitung Das Ziel des Versuchs ist es nach Aufstellen einer Eichgerade mit gegeben Konzentrationen, die
Teil 1 Knochenverarbeitung Seiten 3 13
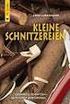 Inhaltsverzeichnis Teil 1 Knochenverarbeitung Seiten 3 13 1. Fixierung 4/5 2. Entfettung 6 3. Entkalkung 6 4. Nachbehandlung 7 5. Möglichkeiten 8/9 6. Entwässerung und Einbettung 10 7. Ausgiessen, Schnitte
Inhaltsverzeichnis Teil 1 Knochenverarbeitung Seiten 3 13 1. Fixierung 4/5 2. Entfettung 6 3. Entkalkung 6 4. Nachbehandlung 7 5. Möglichkeiten 8/9 6. Entwässerung und Einbettung 10 7. Ausgiessen, Schnitte
SERVAGel N Native Gel Precast Vertical Gels for native Electrophoresis
 GEBRAUCHSANLEITUNG SERVAGel N Native Gel Precast Vertical Gels for native Electrophoresis (Kat.-Nr. 43250, 43251, 43252, 43253) SERVA Electrophoresis GmbH - Carl-Benz-Str. 7-69115 Heidelberg Phone +49-6221-138400,
GEBRAUCHSANLEITUNG SERVAGel N Native Gel Precast Vertical Gels for native Electrophoresis (Kat.-Nr. 43250, 43251, 43252, 43253) SERVA Electrophoresis GmbH - Carl-Benz-Str. 7-69115 Heidelberg Phone +49-6221-138400,
Nachweis von p53-antikörpern in Patientenseren - Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist einfacher -
 Arbeitsblatt 9: Praktikumsanleitung: Nachweis von p53-antikörpern in Patientenseren - Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist einfacher - I. Theoretische Einführung: Das Testverfahren Immunologische
Arbeitsblatt 9: Praktikumsanleitung: Nachweis von p53-antikörpern in Patientenseren - Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist einfacher - I. Theoretische Einführung: Das Testverfahren Immunologische
Springer Essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur
 essentials Springer Essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur Darstellung bringen. Damit sind sie besonders
essentials Springer Essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur Darstellung bringen. Damit sind sie besonders
Versuch 1.6/1: Benutzung des Wasserabscheiders zur Synthese von 2 (m Nitrophenyl) 1,3 dioxalan
 Endersch, Jonas 16.06.2008 Praktikum Allgemeine Chemie 2, Saal G1, Gruppe 3, Platz 53 Versuchsprotokoll Versuch 1.6/1: Benutzung des Wasserabscheiders zur Synthese von 2 (m Nitrophenyl) 1,3 dioxalan Reaktionsgleichung:
Endersch, Jonas 16.06.2008 Praktikum Allgemeine Chemie 2, Saal G1, Gruppe 3, Platz 53 Versuchsprotokoll Versuch 1.6/1: Benutzung des Wasserabscheiders zur Synthese von 2 (m Nitrophenyl) 1,3 dioxalan Reaktionsgleichung:
Inhalt SEMINAR 1: mit zu bringen ist: 1. DC von Aminosäuren. 2. Pipettierübung (Präzisionskontrolle) 3. Gelfiltration
 SEMINAR 1: mit zu bringen ist: Arbeitsmantel Skriptum Rechner, Bleistift, Lineal... Protokollheft Und darin eingeklebt das Anwesenheitsblatt 1 Inhalt 1. DC von Aminosäuren 2. Pipettierübung (Präzisionskontrolle)
SEMINAR 1: mit zu bringen ist: Arbeitsmantel Skriptum Rechner, Bleistift, Lineal... Protokollheft Und darin eingeklebt das Anwesenheitsblatt 1 Inhalt 1. DC von Aminosäuren 2. Pipettierübung (Präzisionskontrolle)
Lösung: a) b = 3, 08 m c) nein
 Phy GK13 Physik, BGL Aufgabe 1, Gitter 1 Senkrecht auf ein optisches Strichgitter mit 100 äquidistanten Spalten je 1 cm Gitterbreite fällt grünes monochromatisches Licht der Wellenlänge λ = 544 nm. Unter
Phy GK13 Physik, BGL Aufgabe 1, Gitter 1 Senkrecht auf ein optisches Strichgitter mit 100 äquidistanten Spalten je 1 cm Gitterbreite fällt grünes monochromatisches Licht der Wellenlänge λ = 544 nm. Unter
ARBEITSTECHNIKEN IN DER PROTEINCHEMIE. Immunologie
 ARBEITSTECHNIKEN IN DER PROTEINCHEMIE Immunologie Wichtige Grundbegriffe der Immunologie: Antigen: Körperfremdes Agens, welches beim Eindringen in den Organismus eine Immunantwort hervorruft (z.b. Fremdproteine,
ARBEITSTECHNIKEN IN DER PROTEINCHEMIE Immunologie Wichtige Grundbegriffe der Immunologie: Antigen: Körperfremdes Agens, welches beim Eindringen in den Organismus eine Immunantwort hervorruft (z.b. Fremdproteine,
SDS-PAGE und Western Blotting
 1 Enzymaktivierung und Pathogenabwehr Praktikumsabschnitt zum Modul Molekularbiologie und Biochemie der Pflanzen WS 09/19 SDS-PAGE und Western Blotting Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese in der Gegenwart
1 Enzymaktivierung und Pathogenabwehr Praktikumsabschnitt zum Modul Molekularbiologie und Biochemie der Pflanzen WS 09/19 SDS-PAGE und Western Blotting Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese in der Gegenwart
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg
 TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL SEKUNDARSTUFE I Modul: Versuch: Korrosionsschutz durch metallische
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL SEKUNDARSTUFE I Modul: Versuch: Korrosionsschutz durch metallische
Klausur für die Teilnehmer des Physikalischen Praktikums für Mediziner und Zahnmediziner im Wintersemester 2004/2005
 Name: Gruppennummer: Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 insgesamt erreichte Punkte erreichte Punkte Aufgabe 8 9 10 11 12 13 14 erreichte Punkte Klausur für die Teilnehmer des Physikalischen Praktikums für Mediziner
Name: Gruppennummer: Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 insgesamt erreichte Punkte erreichte Punkte Aufgabe 8 9 10 11 12 13 14 erreichte Punkte Klausur für die Teilnehmer des Physikalischen Praktikums für Mediziner
Proteinanalyse mittels SDS-PAGE (SDS Polyacrylamid Gel-Elektrophorese)
 Praktikum IV, SS 07 Biologieversuch 2-23.05.2007 Proteinanalyse mittels SDS-PAGE (SDS Polyacrylamid Gel-Elektrophorese) Zahner Michele (zahnerm@student.ethz.ch) Büchi Luca (lbuechi@student.ethz.ch) Reibisch
Praktikum IV, SS 07 Biologieversuch 2-23.05.2007 Proteinanalyse mittels SDS-PAGE (SDS Polyacrylamid Gel-Elektrophorese) Zahner Michele (zahnerm@student.ethz.ch) Büchi Luca (lbuechi@student.ethz.ch) Reibisch
C Säure-Base-Reaktionen
 -V.C1- C Säure-Base-Reaktionen 1 Autoprotolyse des Wassers und ph-wert 1.1 Stoffmengenkonzentration Die Stoffmengenkonzentration eines gelösten Stoffes ist der Quotient aus der Stoffmenge und dem Volumen
-V.C1- C Säure-Base-Reaktionen 1 Autoprotolyse des Wassers und ph-wert 1.1 Stoffmengenkonzentration Die Stoffmengenkonzentration eines gelösten Stoffes ist der Quotient aus der Stoffmenge und dem Volumen
GEBRAUCHSANLEITUNG. SERVAGel Native PAGE Starter Kit Precast Vertical Gels for Electrophoresis
 GEBRAUCHSANLEITUNG SERVAGel Native PAGE Starter Kit Precast Vertical Gels for Electrophoresis (Kat.-Nr. 43201.01) ERVA Electrophoresis GmbH Carl-Benz-Str. 7 D-69115 Heidelberg Phone +49-6221-138400, Fax
GEBRAUCHSANLEITUNG SERVAGel Native PAGE Starter Kit Precast Vertical Gels for Electrophoresis (Kat.-Nr. 43201.01) ERVA Electrophoresis GmbH Carl-Benz-Str. 7 D-69115 Heidelberg Phone +49-6221-138400, Fax
Analytische Chemie. B. Sc. Chemieingenieurwesen. 15. März 2017, Uhr. Prof. Dr. Thomas Jüstel, Dr. Stephanie Möller.
 Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 15. März 2017, 12.30 15.30 Uhr Prof. Dr. Thomas Jüstel, Dr. Stephanie Möller Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges
Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 15. März 2017, 12.30 15.30 Uhr Prof. Dr. Thomas Jüstel, Dr. Stephanie Möller Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges
PRÄPARATION EINER MAUS
 PRÄPARATION EINER MAUS Anna Typplt Hewlett-Packard 22.11.2013 Präparation einer Maus In diesem Portfolio möchte ich das Sezieren einer Maus und die jeweiligen Schritte wiedergeben. Dieses Projekt fand
PRÄPARATION EINER MAUS Anna Typplt Hewlett-Packard 22.11.2013 Präparation einer Maus In diesem Portfolio möchte ich das Sezieren einer Maus und die jeweiligen Schritte wiedergeben. Dieses Projekt fand
6. Induktion der Galactosidase von Escherichia coli
 Johannes Gutenberg-Universität Mainz Institut für Mikrobiologie und Weinforschung FI-Übung: Identifizierung, Wachstum und Regulation (WS 2004/05) Sebastian Lux Datum: 19.1.2005 6. Induktion der Galactosidase
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Institut für Mikrobiologie und Weinforschung FI-Übung: Identifizierung, Wachstum und Regulation (WS 2004/05) Sebastian Lux Datum: 19.1.2005 6. Induktion der Galactosidase
Biochemische UE Alkaline Phosphatase.
 Biochemische UE Alkaline Phosphatase peter.hammerl@sbg.ac.at Alkaline Phosphatase: Katalysiert die Hydrolyse von Phosphorsäure-Estern: O - O - Ser-102 R O P==O O - H 2 O R OH + HO P==O O - ph-optimum im
Biochemische UE Alkaline Phosphatase peter.hammerl@sbg.ac.at Alkaline Phosphatase: Katalysiert die Hydrolyse von Phosphorsäure-Estern: O - O - Ser-102 R O P==O O - H 2 O R OH + HO P==O O - ph-optimum im
(Die Zusammensetzungen der Puffer etc. finden sich stets am Ende eines Abschnittes.)
 3. Methoden (Die Zusammensetzungen der Puffer etc. finden sich stets am Ende eines Abschnittes.) 3.1 Immunfluoreszenzmikroskopie 3.1.1 Gewebeeinbettung Adulte WISTAR-Ratten (ca. 300 g) wurden mit Diethylether
3. Methoden (Die Zusammensetzungen der Puffer etc. finden sich stets am Ende eines Abschnittes.) 3.1 Immunfluoreszenzmikroskopie 3.1.1 Gewebeeinbettung Adulte WISTAR-Ratten (ca. 300 g) wurden mit Diethylether
Klausur zum Vorkurs des Chemischen Grundpraktikums WS 2015/16 vom
 Klausur zum Vorkurs des Chemischen Grundpraktikums WS 2015/16 vom 18.09.2015 A1 A2 A3 A4 A5 Note 15 5 9 11 10 NAME:... VORNAME:... Pseudonym für Ergebnisveröffentlichung:... Schreiben Sie bitte gut leserlich:
Klausur zum Vorkurs des Chemischen Grundpraktikums WS 2015/16 vom 18.09.2015 A1 A2 A3 A4 A5 Note 15 5 9 11 10 NAME:... VORNAME:... Pseudonym für Ergebnisveröffentlichung:... Schreiben Sie bitte gut leserlich:
Physikalisches Grundpraktikum
 Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald / Institut für Physik Physikalisches Grundpraktikum Praktikum für Mediziner M1 Viskose Strömung durch Kapillaren Name: Versuchsgruppe: Datum: Mitarbeiter der Versuchsgruppe:
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald / Institut für Physik Physikalisches Grundpraktikum Praktikum für Mediziner M1 Viskose Strömung durch Kapillaren Name: Versuchsgruppe: Datum: Mitarbeiter der Versuchsgruppe:
10 Theorie Solubilisierung biologischer Membranen und Aktivitätstests von Atmungskettenkomplexen
 10 Theorie Solubilisierung biologischer Membranen und Aktivitätstests von Atmungskettenkomplexen 10.1 Solubilisierung biologischer Membranen In Lipiddoppelschichten verankerte Proteine und Proteinkomplexe
10 Theorie Solubilisierung biologischer Membranen und Aktivitätstests von Atmungskettenkomplexen 10.1 Solubilisierung biologischer Membranen In Lipiddoppelschichten verankerte Proteine und Proteinkomplexe
