Grundlagen der Internationalen. Wirtschaftsbeziehungen
|
|
|
- Jasper Hafner
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Prof. Dr. Hans-Jörg Schmerer Grundlagen der Internationalen Wirtschaftsbeziehungen Modul Kurs Leseprobe
2 Der Inhalt dieses Dokumentes darf ohne vorherige schriftliche Erlaubnis durch die FernUniversität in Hagen nicht (ganz oder teilweise) reproduziert, benutzt oder veröffentlicht werden. Das Copyright gilt für alle Formen der Speicherung und Reproduktion, in denen die vorliegenden Informationen eingeflossen sind, einschließlich und zwar ohne Begrenzung Magnetspeicher, Computerausdrucke und visuelle Anzeigen. Alle in diesem Dokument genannten Gebrauchsnamen, Handelsnamen und Warenbezeichnungen sind zumeist eingetragene Warenzeichen und urheberrechtlich geschützt. Warenzeichen, Patente oder Copyrights gelten gleich ohne ausdrückliche Nennung. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
3 Kapitel 4 Migration und Handel Die Inhalte dieses Moduls beschränkten sich bislang ausschließlich auf die Analyse des internationalen Güterthandels. Jedoch sind es nicht nur finale Ausbringungsgüter, die die Grenzen in Form von Importen und Exporten überqueren, auch die Einsatzfaktoren selbst können migrieren. Arbeitskräfte, die mit dem Ziel der dauerhaften Niederlassung ins Ausland wandern, erweitern die Arbeitsausstattung im Zielland. In der Volkswirtschaftslehre wird häufig unterstellt, dass die Migrationsentscheidung intrinsisch motiviert ist. Vereinfachend wird in den Modellen davon ausgegangen, dass höhere Löhne im Ausland Arbeitskräfte zur Wanderung bewegen. Tatsächlich migrieren Menschen aus einer Vielzahl an Gründen, die nicht immer intrinsisch motiviert sind. In den folgenden, sehr einfachen Modellen werden diese Faktoren allerdings nicht weiter thematisiert. Neben der Migration sind ausländische Direktinvestitionen, also internationale Kapitalflüsse, eine weitere Form der Faktorbewegung. Der einem Land zur Verfügung stehende Kapitalstock kann im Ausland investiert werden und somit in der ausländischen Güterproduktion Verwendung finden. Als dritte Form des internationalen Faktortransfers hat das Phänomen Outsourcing in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Ganze Produktionsprozesse können heute in unterschiedliche Länder verlagert werden, um dann am Ende der Produktionskette zu einem finalen 93
4 94 KAPITEL 4. MIGRATION UND HANDEL Gut zusammengesetzt zu werden. Nicht immer sind es günstigere Produktionskosten im Ausland, die ein Unternehmen dazu bewegen Teile der Produktion auszulagern. Häufig gehen Unternehmen dazu über, Produkte vor Ort zu produzieren statt diese kostenintensiv ins Ausland zu verschiffen. Fokus dieses Kapitels ist allerdings die internationale Migration. Outsourcing und ausländische Direktinvestitionen werden in einem separaten Modul thematisiert. Zu Beginn dieser Einheit werden wir einige Fakten zum Thema Migration durchleuchten. Wir werden die Zusammensetzung der US-Arbeiterschaft nach Qualifikation und Migrationshintergrund untersuchen und feststellen, dass vor allem Arbeitskräfte mit besonders hoher oder besonders niedriger Qualifikation (gemessen durch den Bildungsstand) migrieren. Anhand einiger empirischer Befunde werden wir dann die beobachtbaren Auswirkungen der Migration auf Löhne und Beschäftigung anhand eines in der Vergangenheit beobachteten Migrationsschock analysieren, dem sogenannten Miami Boatlift". Langfristig scheint sich die Ökonomie durch Umstrukturierung an den Anstieg der verfügbaren Arbeitskräfte angepasst zu haben und dies geschah ohne einen signifikanten Einfluss auf den Arbeitsmarkt. Negative Arbeitsmarkteffekte traten nur kurzfristig auf und wurden langfristig durch Anpassungsprozesse in der Industriestruktur absorbiert. Basierend auf diesen Befunden werden wir analysieren, wie sich Migration in den bisher behandelten Modellen auswirkt. Im Einklang mit den empirischen Befunden finden wir, dass Migration nicht zwangsläufig nur negative Effekte auf eine Ökonomie haben muss. Bei moderater Veränderung des Arbeitsangebotes können positive Ausstattungschocks durch Reallokation der Faktoren und Umschichtung des Produktionsprogramms langfristig aufgefangen werden, ohne dass die Entlohnung der einheimischen Einsatzfaktoren von der Migration beeinträchtigt wird.
5 4.1. EMPIRISCHE EVIDENZ ZUR MIGRATION Empirische Evidenz zur Migration Abbildung 4.1 zeigt den Migrationsanteil der in 7 Bildungsgruppen unterteilten US Bevölkerung. Wir sehen, dass die Gruppe der Arbeitskräfte mit Ausbildungsniveau von 0 und 11 Jahren Schulzeit (repräsentiert durch die beiden linken Balken in der Abbildung) gerade einmal 10 Prozent der in den USA geborenen Arbeitskräfte, ausmacht. In den mittleren Bildungsgruppen (high school Abschluss, Jahre Ausbildung oder College Abschluss), in die 80 Prozent der in den USA geborenen Bevölkerung fallen, ist der Anteil der Migranten mit ca. 10 Prozent verhältnismäßig gering. Interessant ist die dritte Gruppe der Arbeiterschaft mit besonders hochqualifizierten Abschlüssen wie Master oder Ph.D. Tendenziell würde man erwarten, dass der Anteil der Migranten in diesem Segment ebenfalls relativ gering ausfällt. Analog zur ersten Gruppe der gering qualifizierten Arbeitnehmer findet man auch in dieser Gruppe einen relativ hohen Anteil an Arbeitskräften mit Migrationshintergrund. Gerade einmal 10 Prozent der in dieser Gruppe angesiedelten Arbeitskräfte wurden in den USA geboren. Halten wir also fest, dass die Verteilung der Migranten nach Bildungsniveau U-förmig ist. Die aus dem Buch Feenstra und Taylor (2014) entnommene Grafik basiert auf dem 2010 American Comunity Survey des U.S. Census Bureau. 4.1: Migrationsanteil der Bevölkerung nach Qualifikation Quelle: Feenstra und Taylor (2014)
6 96 KAPITEL 4. MIGRATION UND HANDEL Wie hat sich die Migration der letzten Jahrzehnte auf die Einkommen der Bevölkerung ausgewirkt? Tabelle 4.1 fasst eine prominente Studie von Ottaviano und Peri (2005) Rethinking the Gains from Immigration: Theory and Evidence from the U.S. zusammen. 1 Die Autoren untersuchen mögliche Einkommenseffekte der Migration in den USA über den Zeitraum 1990 bis Laut dieser Studie betrug der Anteil der Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund im Jahre 1980 gerade einmal 6.2 Prozent. Dieser Anteil stieg bis zum Jahr 2005 auf 12.9 Prozent an und hat sich damit mehr als verdoppelt. 2 Wie wirkte sich dieser massive Anstieg der Migration auf die Löhne der Arbeitnehmer ohne Migrationshintergrund aus? Die Studie von Ottaviano und Peri (2005) unterscheidet zwei unterschiedliche Modellvarianten und stellt die Ergebnisse gegenüber. Tabelle 4.1: Lohnänderung in den verschiedenen Bildungsgruppen Quelle: Feenstra und Taylor (2014) basierend auf Ottaviano und Peri (2005, 2008) In Anlehnung an das Ricardo Modell wird zunächst eine Variante des Modells mit sektorspezifischem Kapital getestet (Variante Capital and land fixed ). Zwar tauchte Kapital in der zu Beginn dieses Kurses besprochenen Modellvariante überhaupt nicht auf, das Modell lässt sich allerdings sehr leicht dahingehend anpassen. Eine häufige Variante dieses Modells lässt Kapital im Produktionsprozess zu, nimmt aber an, dass dieses Kapital sektorspezifisch ist. Diese Annahme ist keineswegs willkürlich gewählt, sondern stammt aus einer kurzfristigen Variante des Modells des letzten 1 Die Grafik wurde dem Textbuch Feenstra und Taylor (2014) entnommen. 2 Vergleiche Feenstra und Taylor (2014), Seite 142.
7 4.1. EMPIRISCHE EVIDENZ ZUR MIGRATION 97 Kapitels. Für die kurze Frist wird angenommen, dass Kapital sektorspezifisch ist und nicht zwischen den beiden Sektoren wandern kann. Die Kapitalrendite muss also nicht zwangsläufig in beiden Sektoren identisch sein. Die Implikationen des Modells ähneln den Implikationen des Ricardo Modells und wir werden diese Modellvariante am Ende des Kapitels ausführlich besprechen. Die zweite Spezifikation, die von den Autoren ebenfalls getestet wird, ähnelt der des Heckscher Ohlin Modells. Es wird die Annahme getroffen, dass die Entlohnung des Kapitals trotz Migration konstant bleibt. Statt einer Anpassung der Kapitalrendite, wandern die Faktoren Arbeit und Kapital solange zwischen den Sektoren bis ein neues Gleichgewicht bei gleicher Entlohnung aller Faktoren erreicht ist. Auch diese Spezifikation der empirischen Analyse ist nicht willkürlich gewählt sondern entspricht den Ergebnissen des Modells mit Migration. Wir werden die erste Modellvariante als kurzfristiges und die zweite Modellvariante als langfristiges Modell bezeichnen. Kurzfristig ist der Faktor Kapital in einem Sektor fix und langfristig können beide Faktoren zwischen den Sektoren wandern. Beide Annahmen liefern polarisierende Schätzergebnisse. Besonders in den hohen und in den niedrigen Qualifikationsgruppen hat die Migration einen stark negativen Effekt. Unter der Annahme des sektor-spezifischen Kapitals führte der Anstieg der Migration zwischen den Jahren zu einer durchschnittlichen Reduktion der Löhne von 9 Prozent (Gruppe der Arbeitnehmer mit weniger als 12 Jahren Schulbildung). In den mittleren Gruppen, also den Gruppen mit besonders hohem Anteil an in den USA geborenen Arbeitnehmern, finden Ottaviano und Peri (2005) entweder geringe oder teilweise sogar leicht positive Effekte durch den Migrationsschock. In der Gruppe mit 16 Jahren Schulbildung wächst der negative Lohneffekt wieder auf 5 Prozent an. Schaut man sich die Effekte über alle Bildungsgruppen hinweg gemittelt an, dann ist der durchschnittliche Effekt unter der Annahme des sektorspezifischen Kapitals negativ. Im zweiten Teil der Tabelle werden die Effekte unter der Annahme konstanter Ka-
8 98 KAPITEL 4. MIGRATION UND HANDEL pitalrenditen geschätzt. Unter dieser Annahme ist der Effekt zwar durchschnittlich positiv, die Stärke des Effekts fällt mit gerade einmal 0.3 Prozent allerdings eher gering aus. Wir werden sehen, dass dieses Ergebnis durch eine einfache Erweiterung der bestehenden Modelle erklärt werden kann. Das sogenannte Rybczynski Theorem besagt, dass ein Migrationsschock die Faktorpreise langfristig nicht beeinflusst. Statt einer Anpassung der Faktorpreise kommt es zu einer strukturellen Anpassung der sektoralen Produktionsstruktur. Dieses Theorem wird durch die Annahme konstanter Kapitalrenditen in der Schätzung berücksichtigt. 4.2: Natürliches Experiment des Miami Boat Lift Quelle: Lewis (2004), Grafik entnommen aus Feenstra und Taylor (2014) Neben Ottaviano und Peri haben weitere Autoren versucht den Einfluss von Migration auf Löhne einer Ökonomie zu untersuchen. Ein prominentes Beispiel basiert auf
9 4.1. EMPIRISCHE EVIDENZ ZUR MIGRATION 99 einem natürlichen Experiment, dem Miami Boat Lift. Im Jahr 1980 erreichte eine Vielzahl an Booten mit Flüchtlingen aus Kuba die Küste vor Miami. Dieser plötzliche Migrationsschock war unerwartet und ist daher ein ideales Experiment, um die Auswirkungen von Migration auf den Arbeitsmarkt des Ziellandes zu untersuchen. In Abbildung 4.2 wird der Output in zwei verschiedenen Industrien über die Zeit hinweg verglichen. Gemäß einer einfachen Erweiterung des Heckscher Ohlin Modells würden wir erwarten, dass sich statt den Löhnen die sektoralen Ausbringungsmengen anpassen. Wir werden diese Erweiterung gleich im Anschluss an den empirischen Ausblick diskutieren und sehen, dass sich die Ausbringungsmengen in den Sektoren an das zusätzliche Angebot an Arbeitskräften anpassen. In der empirischen Anwendung wird Miami als Treatmentruppe der Migration mit der Kontrollgruppe andere Staaten vergleichen. Als Treatment sind die unmittelbar durch den Schock betroffenen Regionen bezeichnet, die mit nicht betroffenen Städten in der Kontrollgruppe verglichen werden. Wir gehen davon aus, dass der Schock unerwartet war und somit auch keinerlei Vorkehrungen in Miami oder den Städten der Kontrollgruppe getroffen wurden. Eine unterschiedliche Entwicklung in den beiden Gruppen wäre also mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Migrationsschock zurückzuführen. In der arbeitsintensiven Kleidungsindustrie beobachtet man eine rückgängige Wertschöpfung (in der Abbildung bezeichnet als value-added") pro Einwohner in allen Gruppen, wobei die Wertschöpfung ein Maß für die sektorale Ausbringungsmenge ist. Bei der Berechnung wird der Einsatz an Vorprodukten herausgerechnet, sodass also nur die im Sektor stattgefundene Wertschöpfung berücksichtigt wird. Der Rückgang lässt sich zwar in allen Gruppen beobachten, der Effekt ist in Miami allerdings weniger stark als in den Städten der Kontrollgruppe. Noch interessanter sind die Effekte in den bildungsorientierten Industrien. Hier finden wir kurz nach dem positiven Migrationsschock einen starken Rückgang der Wertschöpfung pro Einwohner in Miami bei fast gleichbleibender Wertschöpfung pro Einwohner in den Vergleichsgruppen. Wie können wir dieses Ergebnis interpretieren? Zunächst gehen wir davon aus, dass die Flüchtlinge aus Kuba weniger qualifiziert wa-
10 100 KAPITEL 4. MIGRATION UND HANDEL ren als die vorhandenen Arbeitskräfte mit denen sie nach ihrer Ankunft in den USA konkurrierten. Vergleichen wir nun die Entwicklung in Miami (Treatmentgruppe) mit der Entwicklung in den Kontrollgruppen fällt auf, dass die Kleidungsindustrie (Apparel) in Miami weniger stark geschrumpft ist als der Output der selben Industrie in den Kontrollgruppen. Die Steigung der Trendlinie in Miami ist kleiner als die Steigung der Trendlinie in der Kontrollgruppe. Hat das zusätzliche Angebot an niedrig qualifizierter Arbeit den rückläufigen Trend in dieser Industrie abgemildert? In den empirischen Ergebnissen sieht es zumindest danach aus. Die Theorie wird zeigen, dass dieses Ergebnis konform mit dem Heckscher Ohlin Modell ist. In den Industrien, die intensiv mit hoch-qualifizierten Arbeitnehmern produzieren, finden wir ein gegenteiliges Muster. Der Output pro Arbeitskraft, gemessen an der Wertschöpfung, sinkt in Miami schneller als in den Industrien der Kontrollgruppe. Regional betrachtet scheint es so zu sein als würde die Migration die Industrien begünstigen, die den migrierenden Faktor intensiv nutzt. Der Sektor, der die weniger qualifizierten Arbeitskräfte intensiv nutzt, schrumpft weniger stark im Vergleich zu den Sektoren der Kontrollgruppe. Diese Ergebnisse können in unserer Heckscher Ohlin Welt sehr einfach erklärt werden. Statt der Löhne, passen sich die Produktionsmuster über die verschiedenen Sektoren hinweg an. Der Sektor, der den migrierenden Faktor intensiv nutzt expandiert, der andere Sektor schrumpft. Löhne bleiben auf Grund der sektoralen Anpassung des Produktionsprogramms konstant. Diese Anpassungsprozesse sind langfristiger Natur, sodass dieses Ergebnis eine mögliche Erklärung für die in Tabelle 4.1 dargestellten Ergebnisse liefert. Langfristig können die Löhne durch die sektorale Anpassung des Produktionsprogramms konstant bleiben. In der kurzen Frist gehen wir aber davon aus, dass einige Faktoren nicht unmittelbar zwischen den Sektoren wandern können. In diesem Fall kann der Migrationsschock sehr wohl einen Einfluss auf die Faktorpreise haben.
11 4.2. MIGRATION IM MODELL: LANGFRISTIGE BETRACHTUNG Migration im Modell: Langfristige Betrachtung Das Modell dieses Kapitels ist eine Erweiterung des Standard Modells. Um eine Aussage über Migration treffen zu können, müssen wir zunächst sogenannte Ausstattungspunkte in das Lerner Diagramm des letzten Kapitels aufnehmen. Die Faktorausstattung war bislang nur für die Bestimmung der Form der Produktionsmöglichkeitengrenzen und der damit einhergehenden Opportunitätskosten der Produktion unter Autarkie von Bedeutung. In diesem Kapitel wollen wir allerdings die Auswirkungen der Migration auf den Arbeitsmarkt untersuchen und dazu ist die Bestimmung des exakten Produktionsprogramms in beiden Sektoren wichtig. Wir haben gesagt, dass Migration die Faktorausstattung eines Landes beeinflusst. Im Zielland wächst die Ausstattung an Arbeitskräften durch einen positiven Migrationsschock an. Wie passen sich die beiden Sektoren im Modell an diesen Schock an? Führt ein Überangebot an Arbeitskräften plötzlich zu einem Lohnverlust aller Arbeitskräfte? Für die Beantwortung dieser Frage müssen wir unser Modell - wie in Abbildung 4.3 gezeigt - um Ausstattungspunkte erweitern. Gehen wir zunächst von der bekannten Freihandelssituation aus, in der Güter- und Faktorpreise im In- und Ausland ausgeglichen sind. Die Tatsache, dass wir Freihandel annehmen, erkennt man an den identischen Isokostenkurven in Abbildung 4.3. Die Steigungen der Isokostenkurven werden durch die Faktorpreise bestimmt. Da die Steigung der in- und ausländischen Isokostenkurven und ihre Schnittpunkte mit den Achsen identisch sind, müssen die Faktorpreise über die Landesgrenzen hinweg ebenfalls identisch sein. Dieses Ergebnis bezeichnen wir als Faktorpreisausgleich durch internationalen Handel. Die Gründe für diesen Faktorpreisausgleich wurden bereits ausführlich im letzten Kapitel besprochen.
12 102 KAPITEL 4. MIGRATION UND HANDEL =1/ Abbildung 4.3: Produktion im Heckscher Ohlin Modell =1/ =1/ =1/
13 4.2. MIGRATION IM MODELL: LANGFRISTIGE BETRACHTUNG 103 Die beiden Aussattungspunkte im In- und Ausland werden durch Kreuze im Diagramm gekennzeichnet. Die Koordinaten der Kreuze im Inland und im Ausland bestimmen sich durch die respektive Ausstattung L, K (Inland) und L, K (Ausland). Die Koordinaten können an den X- und Y-Achsen abgetragen werden, um so die Lage der beiden Aussattungspunkte einzeichnen zu können. In beiden Ökonomien wird so produziert, dass die Ausstattung gänzlich in der Produktion der Güter M und F aufgeht. Es werden also auch in dieser Modellvariante keinerlei Ressourcen verschwendet. Außerdem muss die Faktorintensität der Produktion in beiden Sektoren der optimalen Faktorintensität entsprechen. Diese optimale Faktorintensität wurde ja schon zuvor in einem Optimierungsproblem gelöst und kann nun über Faktorintensitätsstrahlen verallgemeinert werden. Da wir implizit auf dem Modell des vorherigen Kapitels aufbauen, kann auch das zuvor gelöste Kostenminimierungsproblem verwendet werden. Gemäß der Lösung dieses Problems können wir mit Sicherheit sagen, dass der Faktoreinsatz in beiden Sektoren auf einem Punkt des Fahrstrahls zwischen Ursprung und den beiden Punkten liegt, in denen die beiden Isoquanten tangential zur Isokostenkurve verlaufen. In der Abbildung sind das die durchgängig gezeichneten Strahlen. In der digitalen Version der Abbildung, die Sie in den Zusatzmaterialien finden, sind beiden Strahlen durchgängig, gelb gezeichnet. Gesucht wird eine Kombination von K und L, für die sowohl die optimale Faktorintensität als auch die Vollbeschäftigungsbedingungen entsprechend erfüllt sind. Diese Lösung kann durch eine Verschiebung der (durchgängigen) Faktorintensitätsstrahlen gefunden werden. Wie in Abbildung 4.3 gezeigt, werden die durchgängig gezeichneten Strahlen (in der digitalen Version gelb gezeichnet) solange parallel nach außen verschoben, bis die verschobenen Strahlen beider Sektoren die Ausstattungspunkte schneiden. Dies entspricht den gestrichelten Faktorintensitätsstrahlen, die ein Parallelogramm zwischen dem Ursprung und dem Ausstattungspunkt aufspannen (in der digitalen Version als gelb, gestrichelte Linien gezeichnet). Die Schnittpunk-
14 104 KAPITEL 4. MIGRATION UND HANDEL te der ursprünglichen Faktorintensitätsstrahlen mit den verschobenen Faktorintensitätsstrahlen (gelb, gestrichelt in der digitalen Version) bestimmen den tatsächlichen Faktoreinsatz im jeweiligen Sektor. Spielen wir dies einmal für den Einsatz an Arbeit im Zielland durch. Die Hilfslinien, die parallel zu den Achsen verlaufen und die Aussattungspunkte scheiden, tragen die Koordinaten der Ausstattungspunkte an den Achsen ab. Die Strecke vom Ursprung bis zum Punkt L entspricht der Strecke der gesamten Ausstattung an Arbeit im Zielland. Diese Strecke kann als Vollbeschäftigungsbedingung interpretiert werden. Die Schnittpunkte der durchgängigen Strahlen mit den verschobenen Strahlen entsprechen den tatsächlichen Faktoreinsatzpunkten in den beiden Sektoren. Wir verwenden erneut Hilfslinien, die parallel zu den Achsen verlaufen und diese Punkte auf der jeweiligen Achse abtragen. Die Strecke zwischen dem Ursprung und dem Punkt L m entspricht dem Einsatz an Arbeit in Sektor M. Die Strecke zwischen Ursprung und dem Punkt L f entspricht dem Einsatz an Arbeit im Sektor F. Ist die Vollbeschäftigungsbedingung in diesen Punkten erfüllt? Einfaches aufaddieren der Strecke zwischen Ursprung und L m sowie der Strecke zwischen Ursprung und L f sollte der Strecke zwischen Ursprung und L entsprechen. Dies ist auch tatsächlich der Fall. Entspricht die Kombination von K und L aber auch dem optimalen Faktoreinsatz in beiden Sektoren? Auch dies ist offensichtlich der Fall. Beide Punkte liegen auf den durchgängig gezeichneten Faktorintensitätsstrahlen und entsprechen somit den aus dem Minimierungsproblem bestimmten Faktorintensitäten. Durch Abtragen der entsprechenden Punkte auf der Y-Achse können die zugehörigen Kapitaleinsätze in den beiden Sektoren ausfindig gemacht werden. Sowohl die Vollbeschäftigungsbedingung als auch die optimale Faktorintensität für die Kapitaleinsatzpunkte sind in beiden Sektoren erfüllt. Migration. Nehmen Sie nun an, die Ausstattung im Ausland verändere sich durch einen positiven Migrationsschock. Was passiert in unserem Modell? Wir schauen uns nun das Zielland an und vernachlässigen das Ursprungsland.
15 4.2. MIGRATION IM MODELL: LANGFRISTIGE BETRACHTUNG 105 Abbildung 4.4: Veränderung der Einsatzmengen von Kapital und Arbeit im Heckscher Ohlin Modell unter Migration K Ausland M = 1/P m w K K f K f S w F = 1/P f w K m K m L m L m L f L L f L L L Der Ausstattungspunkt wandert vom Punkt L, K nach rechts zum Punkt L, K. Abbildung 4.4 veranschaulicht dies, vernachlässigt aber das Ursprungsland. Durch Migration hat sich nur die Arbeitsausstattung verändert, sodass die X-Achsen Koordinate des Ausstattungspunkts unverändert bleibt. Die ursprünglichen Faktorintensitätsstrahlen (gelbe Linien in der digitalen Version) schneiden sich nunmehr nicht länger im neuen Ausstattungspunkt, da sich dieser nach rechts verschoben hat. Wir müssen die Faktorintensitätsstrahlen also erneut parallel verschieben bis diese sich wieder im verschobenen Ausstattungspunkt schneiden. Dies entspricht den rot, gestrichelten Geraden im Schaubild der digitalen Version dieser Abbildung. Wie man erwarten würde, steigt der Einsatz des Faktors Arbeit im Sektor F. Der Punkt L f, der den Einsatz an Arbeit im Sektor F bestimmt, wandert nach rechts auf die Position L f. Dies entspricht einem erhöhten Einsatz an Arbeit im Sektor F. Da nun insgesamt mehr
16 106 KAPITEL 4. MIGRATION UND HANDEL Arbeit für die Produktion zur Verfügung steht, würde man vielleicht auch erwarten, dass beide Sektoren sich ausdehnen und mehr Arbeit in der Produktion beider Güter zum Einsatz kommt. Dies ist allerdings nicht der Fall. Der ohnehin schon recht geringe Einsatz im Sektor M wird noch weiter verringert und schrumpft auf das Niveau L m. Dies spricht dafür, dass der Sektor M kleiner wird und der Sektor F durch die Migration expandiert. Um die sektoralen Anpassungsprozesse besser verstehen zu können, muss zusätzlich die Kapitalbewegung zwischen den zwei Sektoren analysiert werden. Tragen Sie dazu auf der Y-Achse die neuen Koordinaten der Faktoreinsatzpunkte (Schnittpunkte der durchgängig-gelben und der rot-gestrichelten Strahlen in der digitalen Version) ab, um zu sehen, dass auch dieser in Sektor M abnimmt. Der Kapitaleinsatz sinkt von K m auf K m. Da von beiden Faktoren nun insgesamt mehr in Sektor F, aber weniger in Sektor M eingesetzt wird, muss Sektor M bei unveränderter Technologie kleiner werden, wohingegen sich der Sektor F ausdehnt. Alle durch die Migration hinzugekommenen Arbeitskräfte wandern folglich in den Sektor F. Zusätzlich muss Kapital und Arbeit aus Sektor M in den Sektor F übertragen werden. Ändert sich die optimale Faktorentlohnung? Nein, da sich die optimale Faktorintensität in beiden Sektoren nicht ändert, bleiben die Faktorpreise ebenfalls konstant. Zwar ändern sich die absoluten Einsatzmengen an Kapital und Arbeit, die Intensität darf sich aber trotzdem nicht ändern. Diese wurden zuvor schon optimiert und weder die Preise noch die Technologie hat sich durch die Migration verändert. Die Faktorpreise bleiben also ebenfalls konstant. Dieses bemerkenswerte Ergebnis wird in der Literatur als Rybzynski-Effekt bezeichnet.
17 4.2. MIGRATION IM MODELL: LANGFRISTIGE BETRACHTUNG 107 Rybzynski Theorem: Ändert sich die Faktorausstattung beispielsweise durch Migration, dann passt sich die Produktion in beiden Sektoren wie folgt an: 1. Der Sektor, der den durch Migration ansteigenden Faktor Arbeit intensiv nutzt, wächst. Der andere Sektor schrumpft. 2. Die Faktorentlohnung ist durch die Veränderung der Ausstattung nicht betroffen. In unserem Beispiel wächst die Ausstattung des Faktors Arbeit, welcher gemäß der getroffenen Annahme intensiv im Sektor F genutzt wird. Aus unserer grafischen Analyse des Lerner Diagramms sehen wir, dass der Sektor F tatsächlich wächst und der Sektor M schrumpft. Da die Steigung der Isokostenkurven trotz Migration unverändert bleibt, kann sich die Faktorentlohnung nicht ändern. Dieses Ergebnis hält allerdings nur unter einer Voraussetzung: Sowohl der alte als auch der neue Ausstattungspunkt müssen innerhalb der Fläche, die durch die beiden Faktorintensitätsstrahlen (durchgehend-gelb gezeichnete Strahlen) aufgespannt wird, liegen. Wir nennen diese Fläche den Diversifizierungskegel. Solange der Ausstattungspunkt in diesem Kegel liegt, sind beide Sektoren aktiv und eine Änderung der Ausstattung führt nur zu einer Anpassung der Produktionsniveaus und nicht der optimalen Faktorintensität oder der Faktorpreise. Dieses letzte Ergebnis bedeutet, dass Migration keinen Einfluss auf die Löhne der Arbeitskräfte oder die Kapitalrendite hat. Dies ist ein bemerkenswertes Ergebnis. Zunehmende Migration führt zwar zu Veränderungen der Produktion, die Arbeitnehmer und Kapitaleigner müssen jedoch keine Einbußen befürchten.
Einschub: Kurze Einführung in die Außenhandelstheorie : (Widerholung für Studenten die Theorie des internationalen Handels bereits gehört haben)
 Einschub: Kurze Einführung in die Außenhandelstheorie : (Widerholung für Studenten die Theorie des internationalen Handels bereits gehört haben) 1. Aufgabe Im Inland werden mit Hilfe des Faktors Arbeit
Einschub: Kurze Einführung in die Außenhandelstheorie : (Widerholung für Studenten die Theorie des internationalen Handels bereits gehört haben) 1. Aufgabe Im Inland werden mit Hilfe des Faktors Arbeit
Das Heckscher-Ohlin-Modell. Wintersemester 2013/2014
 Das Heckscher-Ohlin-Modell Wintersemester 2013/2014 Ressourcen und Außenhandel unterschiedliche Ausstattungen mit Produktionsfaktoren einzige Ursache für Unterschiede in Autarkiepreisen zwischen zwei Ländern
Das Heckscher-Ohlin-Modell Wintersemester 2013/2014 Ressourcen und Außenhandel unterschiedliche Ausstattungen mit Produktionsfaktoren einzige Ursache für Unterschiede in Autarkiepreisen zwischen zwei Ländern
Umweltökonomie KE 2: Internalisierung externer Effekte
 Umweltökonomie KE 2: Internalisierung externer Effekte Interdisziplinäres Fernstudium Umweltwissenschaften infernum Internalisierung externer Effekte Interdisziplinäres Fernstudium Umweltwissenschaften
Umweltökonomie KE 2: Internalisierung externer Effekte Interdisziplinäres Fernstudium Umweltwissenschaften infernum Internalisierung externer Effekte Interdisziplinäres Fernstudium Umweltwissenschaften
Theorie des Außenhandels
 Theorie des Außenhandels Das Konzept des komparativen Vorteils Faktorausstattung und Handelsmuster Intra-industrieller Handel Freihandel und die Gewinne aus Außenhandel K. Morasch 2008 Außenhandel und
Theorie des Außenhandels Das Konzept des komparativen Vorteils Faktorausstattung und Handelsmuster Intra-industrieller Handel Freihandel und die Gewinne aus Außenhandel K. Morasch 2008 Außenhandel und
Kapitalverkehr (Direktinvestitionen) in der neoklassischen Außenhandelstheorie
 Kapitalverkehr (Direktinvestitionen) in der neoklassischen Außenhandelstheorie Dr. Andre Jungmittag Lehrstuhl für Makroökonomische Theorie und Politik Universität Wuppertal Kapitalverkehr im engeren Sinne
Kapitalverkehr (Direktinvestitionen) in der neoklassischen Außenhandelstheorie Dr. Andre Jungmittag Lehrstuhl für Makroökonomische Theorie und Politik Universität Wuppertal Kapitalverkehr im engeren Sinne
Kapitelübersicht. Weltagrarmärkte (74064) Kapitel 2 Theorie des internationalen Handels Why Do We trade? 2.6: Internationale Faktorbewegungen
 Kapitelübersicht Weltagrarmärkte (74064) Kapitel 2 Theorie des internationalen Handels Why Do We trade? 2.6: Internationale Faktorbewegungen Einführung und Kreditvergabe und multinationale Unternehmen
Kapitelübersicht Weltagrarmärkte (74064) Kapitel 2 Theorie des internationalen Handels Why Do We trade? 2.6: Internationale Faktorbewegungen Einführung und Kreditvergabe und multinationale Unternehmen
Klausur: Grundlagen der Internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Modul: Termin: , 14:00 16:00 Uhr
 Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Internationale Ökonomie Univ.-Prof. Dr. Hans-Jörg Schmerer Name: Vorname: Matrikel-Nr.: Klausur: Grundlagen der Internationalen
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Internationale Ökonomie Univ.-Prof. Dr. Hans-Jörg Schmerer Name: Vorname: Matrikel-Nr.: Klausur: Grundlagen der Internationalen
Internationale Ökonomie I. Vorlesung 4: Das Heckscher-Ohlin-Modell: Ressourcen, komparative Vorteile und Einkommen. Dr.
 Internationale Ökonomie I Vorlesung 4: Das Heckscher-Ohlin-Modell: Ressourcen, komparative Vorteile und Einkommen Dr. Dominik Maltritz Vorlesungsgliederung 1. Einführung 2. Der Welthandel: Ein Überblick
Internationale Ökonomie I Vorlesung 4: Das Heckscher-Ohlin-Modell: Ressourcen, komparative Vorteile und Einkommen Dr. Dominik Maltritz Vorlesungsgliederung 1. Einführung 2. Der Welthandel: Ein Überblick
Regionalökonomik (BA) Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung
 Regionalökonomik (BA) Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Prof. Dr. Falko Jüßen 30. Oktober 2014 1 / 33 Einleitung Rückblick Ricardo-Modell Das Ricardo-Modell hat die potentiellen Handelsgewinne
Regionalökonomik (BA) Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Prof. Dr. Falko Jüßen 30. Oktober 2014 1 / 33 Einleitung Rückblick Ricardo-Modell Das Ricardo-Modell hat die potentiellen Handelsgewinne
Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft
 Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft Einführung in die Makroökonomie SS 2012 16. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012)Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft 16. Juni 2012 1
Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft Einführung in die Makroökonomie SS 2012 16. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012)Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft 16. Juni 2012 1
Kapitel 1 Einführung Kapitel 4: Ressourcen, komparativer Vorteil und Einkommensverteilung
 Kapitel 1 Einführung Kapitel 4: Ressourcen, komparativer Vorteil und Einkommensverteilung Folie 4-1 Kapitelübersicht Einführung Modell einer Volkswirtschaft Wirkungen des internationalen Handels auf Volkswirtschaften
Kapitel 1 Einführung Kapitel 4: Ressourcen, komparativer Vorteil und Einkommensverteilung Folie 4-1 Kapitelübersicht Einführung Modell einer Volkswirtschaft Wirkungen des internationalen Handels auf Volkswirtschaften
Identifikation der Arbeitsmarkteffekte
 Identifikation der Arbeitsmarkteffekte der Zuwanderung Identifikation der Arbeitsmarkteffekte der Zuwanderung Prof. Dr. Thomas K. Bauer (RWI und Ruhr-Universität Bochum) DAGStat Symposium "Migranten in
Identifikation der Arbeitsmarkteffekte der Zuwanderung Identifikation der Arbeitsmarkteffekte der Zuwanderung Prof. Dr. Thomas K. Bauer (RWI und Ruhr-Universität Bochum) DAGStat Symposium "Migranten in
Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft
 Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Einführung Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Wachstum und Wohlfahrt Zölle und Exportsubventionen 1 Einführung Die bisher besprochenen
Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Einführung Standardmodell einer Handel treibenden Volkswirtschaft Wachstum und Wohlfahrt Zölle und Exportsubventionen 1 Einführung Die bisher besprochenen
Interdisziplinäre Einführung in die Umweltwissenschaften
 Interdisziplinäre Einführung in die Umweltwissenschaften Interdisziplinäres Fernstudium Umweltwissenschaften - infernum Interdisziplinäre Einführung in die Umweltwissenschaften Interdisziplinäres Fernstudium
Interdisziplinäre Einführung in die Umweltwissenschaften Interdisziplinäres Fernstudium Umweltwissenschaften - infernum Interdisziplinäre Einführung in die Umweltwissenschaften Interdisziplinäres Fernstudium
Die Produktion eines bestimmten Outputs zu minimalen Kosten
 Einführung in die Mikroökonomie Produktion und die Kosten der Produktion Universität Erfurt Wintersemester 07/08 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Die Produktion Winter 1 / 20 Übersicht Die Kostenfunktion
Einführung in die Mikroökonomie Produktion und die Kosten der Produktion Universität Erfurt Wintersemester 07/08 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Die Produktion Winter 1 / 20 Übersicht Die Kostenfunktion
Einführung in die Mikroökonomie Produktion und die Kosten der Produktion. Die Produktion: Wiederholung und Übung
 Einführung in die Mikroökonomie Produktion und die Kosten der Produktion Universität Erfurt Wintersemester 07/08 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Die Produktion Winter 1 / 23 Die Produktion: Wiederholung
Einführung in die Mikroökonomie Produktion und die Kosten der Produktion Universität Erfurt Wintersemester 07/08 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Die Produktion Winter 1 / 23 Die Produktion: Wiederholung
Zuwanderung. Presseseminar der Bundesagentur für Arbeit. Neue Trends und Auswirkungen auf Arbeitsmarkt und Sozialstaat
 Zuwanderung Neue Trends und Auswirkungen auf Arbeitsmarkt und Sozialstaat Presseseminar der Bundesagentur für Arbeit Lauf, 25.-26. Juni 2013 Prof. Dr. Herbert Brücker Internationale Vergleiche und Europäische
Zuwanderung Neue Trends und Auswirkungen auf Arbeitsmarkt und Sozialstaat Presseseminar der Bundesagentur für Arbeit Lauf, 25.-26. Juni 2013 Prof. Dr. Herbert Brücker Internationale Vergleiche und Europäische
Internationale Mikroökonomik Kurs, 3h, Do 14.00-17.00, HS15.06. VO6: International mobile Produktionsfaktoren
 Internationale Mikroökonomik Kurs, 3h, Do 14.00-17.00, HS15.06 VO6: International mobile Produktionsfaktoren Übersicht Einführung International mobile Arbeitskräfte Kurzfristige Immigrationseffekte Langfristige
Internationale Mikroökonomik Kurs, 3h, Do 14.00-17.00, HS15.06 VO6: International mobile Produktionsfaktoren Übersicht Einführung International mobile Arbeitskräfte Kurzfristige Immigrationseffekte Langfristige
IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA
 IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA LVA-Leiter: Michael Noldi Einheit 7: Die Kosten der Produktion (Kap. 7.1.-7.4.) Kosten der Produktion IK WS 2014/15 1 Produktionstheorie Kapitel 6: Produktionstechnologie
IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA LVA-Leiter: Michael Noldi Einheit 7: Die Kosten der Produktion (Kap. 7.1.-7.4.) Kosten der Produktion IK WS 2014/15 1 Produktionstheorie Kapitel 6: Produktionstechnologie
Beschäftigte, Löhne und Arbeitslosigkeit in einer modernen Ökonomie
 Beschäftigte, Löhne und Arbeitslosigkeit in einer modernen Ökonomie MB Fünf wichtige Trends auf dem Arbeitsmarkt Wichtige Trends auf Arbeitsmärkten Trends bei Reallöhnen Im 20. Jahrhundert haben alle Industrieländer
Beschäftigte, Löhne und Arbeitslosigkeit in einer modernen Ökonomie MB Fünf wichtige Trends auf dem Arbeitsmarkt Wichtige Trends auf Arbeitsmärkten Trends bei Reallöhnen Im 20. Jahrhundert haben alle Industrieländer
Heckscher-Ohlin-Modell, nur Inland
 Kapitel 1 Einführung Kapitel 4: Ressourcen und Außenhandel: Das Heckscher- Ohlin-Modell (2) Foliensatz basierend auf Internationale Wirtschaft, 6. Auflage von Paul R. Krugman und Maurice Obstfeld Folie
Kapitel 1 Einführung Kapitel 4: Ressourcen und Außenhandel: Das Heckscher- Ohlin-Modell (2) Foliensatz basierend auf Internationale Wirtschaft, 6. Auflage von Paul R. Krugman und Maurice Obstfeld Folie
Beschreibung von Diagrammen, Tabellen und Grafiken zur Prüfungsvorbereitung auf das Zertifikat Deutsch
 Beschreibung von Diagrammen, Tabellen und Grafiken zur Prüfungsvorbereitung auf das Zertifikat Deutsch Einleitung: Was ist der Titel oder Inhalt der Grafik? Das Diagramm zeigt... Die Grafik stellt... dar.
Beschreibung von Diagrammen, Tabellen und Grafiken zur Prüfungsvorbereitung auf das Zertifikat Deutsch Einleitung: Was ist der Titel oder Inhalt der Grafik? Das Diagramm zeigt... Die Grafik stellt... dar.
Christel Salewski & Manja Vollmann Gesundheitspsychologische Modelle zu Stress, Stressbewältigung und Prävention/Gesundheitsförderung
 Christel Salewski & Manja Vollmann Gesundheitspsychologische Modelle zu Stress, Stressbewältigung und Prävention/Gesundheitsförderung kultur- und sozialwissenschaften Der Inhalt dieses Dokumentes darf
Christel Salewski & Manja Vollmann Gesundheitspsychologische Modelle zu Stress, Stressbewältigung und Prävention/Gesundheitsförderung kultur- und sozialwissenschaften Der Inhalt dieses Dokumentes darf
Geld- und Fiskalpolitik (2) und Währungsintegration. Aufgabe 1
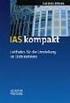 UNIVERSITÄT SIEGEN Theorie und Praxis für Karrieren von morgen Univ.-Professor Dr. Carsten Hefeker Dipl.-Volksw. Katja Popkova Fachbereich 5 Einführung in die Probleme der europäischen Wirtschaft Wintersemester
UNIVERSITÄT SIEGEN Theorie und Praxis für Karrieren von morgen Univ.-Professor Dr. Carsten Hefeker Dipl.-Volksw. Katja Popkova Fachbereich 5 Einführung in die Probleme der europäischen Wirtschaft Wintersemester
Kapitel 2 Der Gütermarkt. Lekt. Dr. Irina-Marilena Ban. Pearson Studium 2014 Olivier Olivier Blanchard/Gerhard Illing: Illing: Makroökonomie
 Kapitel 2 Der Gütermarkt Lekt. Dr. Irina-Marilena Ban 1 Pearson Studium 2014 2014 Literaturhinweise Blanchard, Olivier, Illing, Gerhard, Makroökonomie, 5. Aufl., Pearson 2009, Kap. 3. 2 Vorlesungsübersicht
Kapitel 2 Der Gütermarkt Lekt. Dr. Irina-Marilena Ban 1 Pearson Studium 2014 2014 Literaturhinweise Blanchard, Olivier, Illing, Gerhard, Makroökonomie, 5. Aufl., Pearson 2009, Kap. 3. 2 Vorlesungsübersicht
Kapitelübersicht. Weltagrarmärkte (74064)
 Kapitelübersicht Weltagrarmärkte (74064) Kapitel 2 Theorie des internationalen Handels Why Do We trade? 2.3: Ressourcen und Außenhandel: Das Heckscher- Einführung mit zwei Faktoren auf Volkswirtschaften
Kapitelübersicht Weltagrarmärkte (74064) Kapitel 2 Theorie des internationalen Handels Why Do We trade? 2.3: Ressourcen und Außenhandel: Das Heckscher- Einführung mit zwei Faktoren auf Volkswirtschaften
AS/AD Modell (Blanchard Ch. 7)
 AS/ Modell (Blanchard Ch. 7) 115 Aggregiertes Angebot Aggregierte Nachfrage Gleichgewicht in der kurzen und mittleren Frist Geldpolitik im AS/- Modell Fiskalpolitik im AS/- Modell Angebotsschocks Schlussfolgerungen
AS/ Modell (Blanchard Ch. 7) 115 Aggregiertes Angebot Aggregierte Nachfrage Gleichgewicht in der kurzen und mittleren Frist Geldpolitik im AS/- Modell Fiskalpolitik im AS/- Modell Angebotsschocks Schlussfolgerungen
Tutorium Blatt 8 Offene Volkswirtschaft
 Tutorium Blatt 8 Offene Volkswirtschaft 1. Aufgabe Das einzige Gut in dieser Welt sei ein Hotdog. Ein Hotdog in den USA entspreche von seinen Produkteigenschaften exakt einem Hotdog im Euroraum. Gegeben
Tutorium Blatt 8 Offene Volkswirtschaft 1. Aufgabe Das einzige Gut in dieser Welt sei ein Hotdog. Ein Hotdog in den USA entspreche von seinen Produkteigenschaften exakt einem Hotdog im Euroraum. Gegeben
Einführung in die Mikroökonomie
 Einführung in die Mikroökonomie Übungsaufgaben (2) 1. Erklären Sie den Unterschied zwischen einer Verschiebung der Angebotskurve und einer Bewegung entlang der Angebotskurve. Eine Bewegung entlang der
Einführung in die Mikroökonomie Übungsaufgaben (2) 1. Erklären Sie den Unterschied zwischen einer Verschiebung der Angebotskurve und einer Bewegung entlang der Angebotskurve. Eine Bewegung entlang der
Übungsaufgaben zu Kapitel 6: Der Arbeitsmarkt
 Kapitel 6 Übungsaufgaben zu Kapitel 6: Der Arbeitsmarkt Florian Verheyen, Master Econ. Makroökonomik I Sommersemester 2011 Folie 1 Übungsaufgabe 6 1 6 1 Nehmen Sie an, die Höhe des Lohnes hänge positiv
Kapitel 6 Übungsaufgaben zu Kapitel 6: Der Arbeitsmarkt Florian Verheyen, Master Econ. Makroökonomik I Sommersemester 2011 Folie 1 Übungsaufgabe 6 1 6 1 Nehmen Sie an, die Höhe des Lohnes hänge positiv
Übungsaufgaben zu Kapitel 3: Der Gütermarkt
 Kapitel 3 Übungsaufgaben zu Kapitel 3: Der Gütermarkt Florian Verheyen, Master Econ. Makroökonomik I Sommersemester 20 Folie Übungsaufgabe 3 3 In einer Volkswirtschaft werden zwei Güter gehandelt: Computer
Kapitel 3 Übungsaufgaben zu Kapitel 3: Der Gütermarkt Florian Verheyen, Master Econ. Makroökonomik I Sommersemester 20 Folie Übungsaufgabe 3 3 In einer Volkswirtschaft werden zwei Güter gehandelt: Computer
Konvergenz und Bedingte Konvergenz. = h 0 ( ) ( ) i 2 0 Zudem sinkt die Wachstumsrate der pro-kopf-produktion mit dem Niveau.
 TU Dortmund, WS 12/13, Konjunktur, Wachstum und Beschäftigung 14 Konvergenz und Bedingte Konvergenz Fundamentale Gleichung in Pro-Kopf-Größen = und = = ( ) = ( ) = = [ ( ) ] Die Wachstumsrate sinkt mit
TU Dortmund, WS 12/13, Konjunktur, Wachstum und Beschäftigung 14 Konvergenz und Bedingte Konvergenz Fundamentale Gleichung in Pro-Kopf-Größen = und = = ( ) = ( ) = = [ ( ) ] Die Wachstumsrate sinkt mit
Migration: Potential und Effekte für den deutschen Arbeitsmarkt
 Herbert Brücker / Harald Trabold / Parvati Trübswetter / Christian Weise (Hrsg.) Migration: Potential und Effekte für den deutschen Arbeitsmarkt Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden Inhaltsverzeichnis
Herbert Brücker / Harald Trabold / Parvati Trübswetter / Christian Weise (Hrsg.) Migration: Potential und Effekte für den deutschen Arbeitsmarkt Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden Inhaltsverzeichnis
Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Michael Alpert Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Übung 2 Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Michael Alpert Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Übung 2 Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion
Haushalts- und Konsumökonomie
 Haushalts- und Konsumökonomie Thema 5: Fertilität Ziele der heutigen Vorlesung Wie hat sich die Fertilität in den letzten Jahrzehnt entwickelt? Welche Faktoren beeinflussen die Fertilität? Wie sieht ein
Haushalts- und Konsumökonomie Thema 5: Fertilität Ziele der heutigen Vorlesung Wie hat sich die Fertilität in den letzten Jahrzehnt entwickelt? Welche Faktoren beeinflussen die Fertilität? Wie sieht ein
Die Arbeitsteilung ist die Mutter unseres Wohlstandes
 Die Arbeitsteilung ist die Mutter unseres Wohlstandes 3.1 Hauptthema des Kapitels......................... 20 3.2 Aufgaben........................................ 21 3.2.1 Übungen.....................................
Die Arbeitsteilung ist die Mutter unseres Wohlstandes 3.1 Hauptthema des Kapitels......................... 20 3.2 Aufgaben........................................ 21 3.2.1 Übungen.....................................
Klausur Makroökonomie (WS 2006/2007)
 Prof. Dr. Bernd Kempa Klausur Makroökonomie (WS 2006/2007) 02.04.2007 1) In der vorliegenden Tabelle sehen Sie die gerundete Zusammensetzung des deutschen Inlandsproduktes für das Jahr 2005. Deutschland:
Prof. Dr. Bernd Kempa Klausur Makroökonomie (WS 2006/2007) 02.04.2007 1) In der vorliegenden Tabelle sehen Sie die gerundete Zusammensetzung des deutschen Inlandsproduktes für das Jahr 2005. Deutschland:
Ricardo: Zusammenfassung
 Kapitel 1 Einführung Schluß Kapitel 2 Arbeitsproduktivität und komparativer Vorteil: das Ricardo-Modell Internationale Wirtschaft, 6. Auflage von Paul R. Krugman und Maurice Obstfeld Folie 20041117-1 Ricardo:
Kapitel 1 Einführung Schluß Kapitel 2 Arbeitsproduktivität und komparativer Vorteil: das Ricardo-Modell Internationale Wirtschaft, 6. Auflage von Paul R. Krugman und Maurice Obstfeld Folie 20041117-1 Ricardo:
Kapitel 4 der neuen Auflage: Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung
 Kapitel 1 Einführung Kapitel 4 der neuen Auflage: Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Folie 4-1 4: Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Das Modell spezifischer Faktoren Außenhandel im
Kapitel 1 Einführung Kapitel 4 der neuen Auflage: Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Folie 4-1 4: Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Das Modell spezifischer Faktoren Außenhandel im
ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser. Kapitel 4 Das AS-AD- Modell
 ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 4 Das AS-AD- Modell Version: 23.05.2011 4.1 Der Arbeitsmarkt zentrale Annahmen des IS-LM-Modells werden aufgehoben in der mittleren Frist passen sich Preise an
ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 4 Das AS-AD- Modell Version: 23.05.2011 4.1 Der Arbeitsmarkt zentrale Annahmen des IS-LM-Modells werden aufgehoben in der mittleren Frist passen sich Preise an
Tutorium Makroökonomie I. Blatt 6. Arbeitsmarkt, Okunsches Gesetz, AS AD Modell
 Tutorium Makroökonomie I Blatt 6 Arbeitsmarkt, Okunsches Gesetz, AS AD Modell Aufgabe 1 (Multiple Choice: wahr/falsch) Betrachten Sie den Arbeitsmarkt einer Volkswirtschaft, auf dem die privaten Haushalte
Tutorium Makroökonomie I Blatt 6 Arbeitsmarkt, Okunsches Gesetz, AS AD Modell Aufgabe 1 (Multiple Choice: wahr/falsch) Betrachten Sie den Arbeitsmarkt einer Volkswirtschaft, auf dem die privaten Haushalte
Die Produktionskosten
 Produktionskosten Mankiw Grzüge Volkswirtschaftslehre Kapitel 13 Autor: Stefan Furer phw / Stefan Furer 1 In In sem sem Kapitel Kapitel wirst wirst Du: Du: einzelnen Posten Posten unternehmerischen Produktionskosten
Produktionskosten Mankiw Grzüge Volkswirtschaftslehre Kapitel 13 Autor: Stefan Furer phw / Stefan Furer 1 In In sem sem Kapitel Kapitel wirst wirst Du: Du: einzelnen Posten Posten unternehmerischen Produktionskosten
Nachholklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester Bitte auf dem Lösungsblatt angeben!
 Freiburg, 12.01.2015 Nachholklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2014 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Das Solow-Modell bildet von den
Freiburg, 12.01.2015 Nachholklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2014 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Das Solow-Modell bildet von den
Kosten der Produktion
 IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte Kosten der Produktion (Kapitel 7) Nicole Schneeweis (JKU Linz) IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte 1 / 28 Produktionstheorie Kapitel 6: Produktionstechnologie
IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte Kosten der Produktion (Kapitel 7) Nicole Schneeweis (JKU Linz) IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte 1 / 28 Produktionstheorie Kapitel 6: Produktionstechnologie
Die Einbeziehung des technischen Fortschritts in die neoklassische Wachstumstheorie
 (c) Holger Sandker, 26133 Oldenburg 1 Die Einbeziehung des technischen Fortschritts in die neoklassische Wachstumstheorie Die Einbeziehung des technischen Fortschritts in die neoklassische Wachstumstheorie
(c) Holger Sandker, 26133 Oldenburg 1 Die Einbeziehung des technischen Fortschritts in die neoklassische Wachstumstheorie Die Einbeziehung des technischen Fortschritts in die neoklassische Wachstumstheorie
Unter fixen Wechselkursen sinkt das Einkommen vorrübergehen und das Preisniveau reduziert sich
 Aufgabe 26 Aus dem Mundell-Flemming-Modell ist bekannt, dass 1. bei Flexiblen Wechselkursen: - Ein Anstieg des Weltmarktzinses führt zu einem Überangebot an inländischer Währung (da i< i w ) - Um dieses
Aufgabe 26 Aus dem Mundell-Flemming-Modell ist bekannt, dass 1. bei Flexiblen Wechselkursen: - Ein Anstieg des Weltmarktzinses führt zu einem Überangebot an inländischer Währung (da i< i w ) - Um dieses
Demographische Situation in Schalkenmehren. Überblick. Historische Bevölkerungsentwicklung
 Demographische Situation in Schalkenmehren Überblick langfristig gewachsene Ortsgemeinde Die OG Schalkenmehren hat seit 1962 deutlich an Bevölkerung gewonnen. Dass sich das langfristig zu beobachtende
Demographische Situation in Schalkenmehren Überblick langfristig gewachsene Ortsgemeinde Die OG Schalkenmehren hat seit 1962 deutlich an Bevölkerung gewonnen. Dass sich das langfristig zu beobachtende
Kurzfristige ökonomische Fluktuationen
 Kurzfristige ökonomische Fluktuationen MB Rezessionen und Expansionen Konjunkturschwankungen Rezession: Beschreibt eine Periode deutlich schwächeren Wirtschaftswachstums als normal (formale Definition:
Kurzfristige ökonomische Fluktuationen MB Rezessionen und Expansionen Konjunkturschwankungen Rezession: Beschreibt eine Periode deutlich schwächeren Wirtschaftswachstums als normal (formale Definition:
Das (einfache) Solow-Modell
 Kapitel 3 Das (einfache) Solow-Modell Zunächst wird ein Grundmodell ohne Bevölkerungswachstum und ohne technischen Fortschritt entwickelt. Ausgangspunkt ist die Produktionstechnologie welche in jeder Periode
Kapitel 3 Das (einfache) Solow-Modell Zunächst wird ein Grundmodell ohne Bevölkerungswachstum und ohne technischen Fortschritt entwickelt. Ausgangspunkt ist die Produktionstechnologie welche in jeder Periode
Technology Governance
 Technology Governance Interdisziplinäres Fernstudium Umweltwissenschaften - infernum Technology Governance Interdisziplinäres Fernstudium Umweltwissenschaften - infernum Technology Governance von Prof.
Technology Governance Interdisziplinäres Fernstudium Umweltwissenschaften - infernum Technology Governance Interdisziplinäres Fernstudium Umweltwissenschaften - infernum Technology Governance von Prof.
LÖSUNG ZUR VORLESUNG MAKROÖKONOMIK I (SoSe 14) Aufgabenblatt 4
 Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Jun.-Prof. Dr. Philipp Engler, Michael Paetz LÖSUNG ZUR VORLESUNG MAKROÖKONOMIK I (SoSe 14) Aufgabenblatt 4 Aufgabe 1: IS-Kurve Leiten Sie graphisch mit Hilfe
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Jun.-Prof. Dr. Philipp Engler, Michael Paetz LÖSUNG ZUR VORLESUNG MAKROÖKONOMIK I (SoSe 14) Aufgabenblatt 4 Aufgabe 1: IS-Kurve Leiten Sie graphisch mit Hilfe
Klausur zum Modul bzw. zur Veranstaltung Handel: Außenhandel und internationaler Wettbewerb
 Institut für Ökonomie und Recht der globalen Wirtschaft Univ.-Prof. Dr. Karl Morasch Volkswirtschaftslehre, insbesondere Mikroökonomie und Wettbewerbspolitik Universität der Bundeswehr München 85577 Neubiberg
Institut für Ökonomie und Recht der globalen Wirtschaft Univ.-Prof. Dr. Karl Morasch Volkswirtschaftslehre, insbesondere Mikroökonomie und Wettbewerbspolitik Universität der Bundeswehr München 85577 Neubiberg
Geld und Währung. Übungsfragen
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wintersemester
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wintersemester
Wachstumstheorie und Wachtumspolitik
 Wachstumstheorie und Wachtumspolitik Die bisherige Analyse makroökonomischer Fragestellungen konzentrierte sich auf die kurze Frist, also den Zeitraum 3-5 Jahre. Ausgangspunkt war ein Gleichgewichtszustand
Wachstumstheorie und Wachtumspolitik Die bisherige Analyse makroökonomischer Fragestellungen konzentrierte sich auf die kurze Frist, also den Zeitraum 3-5 Jahre. Ausgangspunkt war ein Gleichgewichtszustand
3.3 Kapitalstock und Investitionen
 3.3 Kapitalstock und Investitionen Langfristige Anpassung: Substitution und Kapazitäten Die Annahmen des Modells: Die Nachfrage bestimmt sich aus einer logarithmisch linearen Nachfragekurve D = p η Z bzw.
3.3 Kapitalstock und Investitionen Langfristige Anpassung: Substitution und Kapazitäten Die Annahmen des Modells: Die Nachfrage bestimmt sich aus einer logarithmisch linearen Nachfragekurve D = p η Z bzw.
Mikroökonomik für Wirtschaftsingenieure. Dr. Christian Hott
 Mikroökonomik für Wirtschaftsingenieure Agenda 1. Einführung 2. Analyse der Nachfrage 3. Analyse des s 3.1 Marktgleichgewicht 3.2 Technologie und Gewinnmaximierung 3.3 Kostenkurven 3.4 Monopolmarkt 4.
Mikroökonomik für Wirtschaftsingenieure Agenda 1. Einführung 2. Analyse der Nachfrage 3. Analyse des s 3.1 Marktgleichgewicht 3.2 Technologie und Gewinnmaximierung 3.3 Kostenkurven 3.4 Monopolmarkt 4.
Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie
 age 1 1 Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie Kapitel 7: Das AS-AD-Modell Günter W. Beck 1 age 2 2 Überblick Einleitung Das aggregierte Angebot Die aggregierte Nachfrage Gleichgewicht in der kurzen
age 1 1 Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie Kapitel 7: Das AS-AD-Modell Günter W. Beck 1 age 2 2 Überblick Einleitung Das aggregierte Angebot Die aggregierte Nachfrage Gleichgewicht in der kurzen
Kapitel 6 Der Arbeitsmarkt
 Kapitel 6 Der Arbeitsmarkt Folie 1 6.2 Ein Überblick über den Arbeitsmarkt Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bzw. das Arbeitskräftepotenzial, umfasst alle Personen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren,
Kapitel 6 Der Arbeitsmarkt Folie 1 6.2 Ein Überblick über den Arbeitsmarkt Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bzw. das Arbeitskräftepotenzial, umfasst alle Personen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren,
Volkswirtschaft Modul 2
 Volkswirtschaft Modul 2 Teil II Angebot und Nachfrage I: Wie Märkte funktionieren 2012 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH www.sp-dozenten.de Institut für Wirtschaftswissenschaft.
Volkswirtschaft Modul 2 Teil II Angebot und Nachfrage I: Wie Märkte funktionieren 2012 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH www.sp-dozenten.de Institut für Wirtschaftswissenschaft.
Konjunktur und Wachstum
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Christian Peukert Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2010/11
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Christian Peukert Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2010/11
Die Wirkung der EU-Russland-Sanktionen auf das EU-BIP
 Die Wirkung der EU-Russland-Sanktionen auf das EU-BIP Plausibilitätsprüfung bisheriger Studien durch eine einfache Schätzung Fassung: 17. Februar 2017 Dr. Ricardo Giucci, Woldemar Walter Ergebnisse unserer
Die Wirkung der EU-Russland-Sanktionen auf das EU-BIP Plausibilitätsprüfung bisheriger Studien durch eine einfache Schätzung Fassung: 17. Februar 2017 Dr. Ricardo Giucci, Woldemar Walter Ergebnisse unserer
Kapitelübersicht. Weltagrarmärkte (74064) Einführung. Das Modell spezifischer Faktoren
 Kapitelübersicht Weltagrarmärkte (74064) Kapitel Theorie des internationalen Handels Why Do We trade?.3: Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Einführung Einkommensverteilung und Außenhandelsgewinne
Kapitelübersicht Weltagrarmärkte (74064) Kapitel Theorie des internationalen Handels Why Do We trade?.3: Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Einführung Einkommensverteilung und Außenhandelsgewinne
Übung Makroökonomie zur Vorlesung Makroökonomische Theorie (Montag Uhr und Mittwoch 8-10 Uhr HS Loh 3/4)
 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre II Übung Makroökonomie zur Vorlesung Makroökonomische Theorie (Montag 10-12 Uhr und Mittwoch 8-10 Uhr HS Loh 3/4) Übungstermine Montag 12-14 Uhr und 14 16 Uhr HS 4 (M.
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre II Übung Makroökonomie zur Vorlesung Makroökonomische Theorie (Montag 10-12 Uhr und Mittwoch 8-10 Uhr HS Loh 3/4) Übungstermine Montag 12-14 Uhr und 14 16 Uhr HS 4 (M.
Eine durch Steuererhöhung finanzierte expansive Fiskalpolitik führt im Rahmen eines IS/LM-Modells einer geschlossenen Volkswirtschaft
 Makro-Quiz I Eine durch Steuererhöhung finanzierte expansive Fiskalpolitik führt im Rahmen eines IS/LM-Modells einer geschlossenen Volkswirtschaft [ ] zu einem höheren Zinsniveau sowie einem höheren Output.
Makro-Quiz I Eine durch Steuererhöhung finanzierte expansive Fiskalpolitik führt im Rahmen eines IS/LM-Modells einer geschlossenen Volkswirtschaft [ ] zu einem höheren Zinsniveau sowie einem höheren Output.
Die kurzfristigen Kosten eines Unternehmens (Euro)
 Einführung in die Mikroökonomie Produktion und die Kosten der Produktion Universität Erfurt Wintersemester 08/09 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Die Produktion Winter 1 / 24 Übersicht Kosten in der
Einführung in die Mikroökonomie Produktion und die Kosten der Produktion Universität Erfurt Wintersemester 08/09 Prof. Dittrich (Universität Erfurt) Die Produktion Winter 1 / 24 Übersicht Kosten in der
Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion
 Dipl.-WiWi Michael Alpert Wintersemester 2006/2007 Institut für Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 03 Tel. 0731 50 24264 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Dipl.-WiWi Michael Alpert Wintersemester 2006/2007 Institut für Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 03 Tel. 0731 50 24264 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte
 LVA-Leiter: Martin Halla Einheit 7: Die Kosten der Produktion (Kapitel 7.1-7.4.) Einheit 7-1 - Die Kosten der Produktion Kapitel 6: Produktionstechnologie (Inputs Output) Kapitel 7: Preis der Produktionsfaktoren
LVA-Leiter: Martin Halla Einheit 7: Die Kosten der Produktion (Kapitel 7.1-7.4.) Einheit 7-1 - Die Kosten der Produktion Kapitel 6: Produktionstechnologie (Inputs Output) Kapitel 7: Preis der Produktionsfaktoren
Sitzung 4. Besprechung der Beispielklausur Fragen 10, 11, 12 & 13. Dr. Gerrit Bauer Zentralübung Sozialstrukturanalyse
 Sitzung 4 Besprechung der Beispielklausur Fragen 10, 11, 12 & 13 Dr. Gerrit Bauer Zentralübung Sozialstrukturanalyse Altersstruktur: Frage 10 Die Altersstruktur der deutschen Bevölkerung 2009 entspricht
Sitzung 4 Besprechung der Beispielklausur Fragen 10, 11, 12 & 13 Dr. Gerrit Bauer Zentralübung Sozialstrukturanalyse Altersstruktur: Frage 10 Die Altersstruktur der deutschen Bevölkerung 2009 entspricht
Die Situation von Muslimen am Arbeitsmarkt Empirische Grundlagen auf Basis der Daten der Studie Muslimisches Leben in Deutschland (MLD)
 DIK-Fachtagung und Arbeitsmarkt -Vielfalt fördern, Potenziale besser nutzen Berlin, 18.04.2012 Die Situation von n am Arbeitsmarkt Empirische Grundlagen auf Basis der Daten der Studie Muslimisches Leben
DIK-Fachtagung und Arbeitsmarkt -Vielfalt fördern, Potenziale besser nutzen Berlin, 18.04.2012 Die Situation von n am Arbeitsmarkt Empirische Grundlagen auf Basis der Daten der Studie Muslimisches Leben
Restriktive Fiskalpolitik im AS-
 Fiskalpolitik im AS-AD-Modell Restriktive Fiskalpolitik im AS- AD-Modell Eine Senkung des Budgetdefizits führt zunächst zu einem Fall der Produktion und einem Rückgang der Preise. Im Zeitverlauf kehrt
Fiskalpolitik im AS-AD-Modell Restriktive Fiskalpolitik im AS- AD-Modell Eine Senkung des Budgetdefizits führt zunächst zu einem Fall der Produktion und einem Rückgang der Preise. Im Zeitverlauf kehrt
Kapitel 8: Wettbewerbsangebot
 Kapitel 8: Wettbewerbsangebot Hauptidee: Eine Firma, die auch im Outputmarkt ein Preisnehmer ist, wählt einen Produktionsplan, der optimal ist gegeben Inputpreise und Outputpreis 8.1 Das Angebot der Firma
Kapitel 8: Wettbewerbsangebot Hauptidee: Eine Firma, die auch im Outputmarkt ein Preisnehmer ist, wählt einen Produktionsplan, der optimal ist gegeben Inputpreise und Outputpreis 8.1 Das Angebot der Firma
Übung 6: Mobilität. match, und mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% ein schlechter
 Übung 6: Mobilität Aufgabe 1 Die Fähigkeiten einer Person lassen sich durch die Effizienzeinheiten s zusammenfassen, über die sie verfügt. Angenommen, die Verteilung der Effizienzeinheiten in der Bevölkerung
Übung 6: Mobilität Aufgabe 1 Die Fähigkeiten einer Person lassen sich durch die Effizienzeinheiten s zusammenfassen, über die sie verfügt. Angenommen, die Verteilung der Effizienzeinheiten in der Bevölkerung
Ressourcenausstattung und komparative Vorteile: Das Heckscher- Ohlin-Modell
 Ressourcenausstattung und komparative Vorteile: Das Heckscher- Ohlin-Modell Einführung Modell einer Volkswirtschaft mit zwei Faktoren Wirkungen des internationalen Handels auf Volkswirtschaften mit zwei
Ressourcenausstattung und komparative Vorteile: Das Heckscher- Ohlin-Modell Einführung Modell einer Volkswirtschaft mit zwei Faktoren Wirkungen des internationalen Handels auf Volkswirtschaften mit zwei
Neoklassische Produktions- und Kostenfunktion Mathematische Beschreibung zu einer Modellabbildung mit Excel
 Neoklassische Produktions- und Kostenfunktion Mathematische Beschreibung zu einer Modellabbildung mit Excel Dieses Skript ist die allgemeine Basis eines Modells zur Simulation der ökonomischen Folgen technischer
Neoklassische Produktions- und Kostenfunktion Mathematische Beschreibung zu einer Modellabbildung mit Excel Dieses Skript ist die allgemeine Basis eines Modells zur Simulation der ökonomischen Folgen technischer
JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom
 Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 205/6 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.06.206 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (0 Fragen, 5 Punkte)
Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 205/6 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.06.206 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (0 Fragen, 5 Punkte)
Das makroökonomische Grundmodell
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-Kfm. hilipp Buss Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2013/2014
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-Kfm. hilipp Buss Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2013/2014
Das AS-AD Modell. Einführung in die Makroökonomie SS Mai 2012
 Das AS-AD Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 18. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Das AS-AD Modell 18. Mai 2012 1 / 38 Was bisher geschah Mit Hilfe des IS-LM Modells war es
Das AS-AD Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 18. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Das AS-AD Modell 18. Mai 2012 1 / 38 Was bisher geschah Mit Hilfe des IS-LM Modells war es
Aufgabensammlung für das Modul Wirtschaftswissenschaften
 Aufgabensammlung für das Modul Wirtschaftswissenschaften Aufgabengruppe Wirtschaftliche Zusammenhänge analysieren Bei der Aufgabengruppe "Wirtschaftliche Zusammenhänge analysieren" (WZA) müssen Diagramme,
Aufgabensammlung für das Modul Wirtschaftswissenschaften Aufgabengruppe Wirtschaftliche Zusammenhänge analysieren Bei der Aufgabengruppe "Wirtschaftliche Zusammenhänge analysieren" (WZA) müssen Diagramme,
Aufgabenblatt 1: Güter- und Geldmarkt
 Aufgabenblatt : Güter- und Geldmarkt Lösungsskizze Bitten beachten Sie, dass diese Lösungsskizze lediglich als Hilfestellung zur eigenständigen Lösung der Aufgaben gedacht ist. Sie erhebt weder Anspruch
Aufgabenblatt : Güter- und Geldmarkt Lösungsskizze Bitten beachten Sie, dass diese Lösungsskizze lediglich als Hilfestellung zur eigenständigen Lösung der Aufgaben gedacht ist. Sie erhebt weder Anspruch
6.8 Die Wirkungen von Angebotsschocks
 Beispiel 3a): positiver Angebotsschock - unerwarteter technischer Fortschritt - Sinken der Einstandspreise importierter Rohstoffe - Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen Angebotsschocks verändern
Beispiel 3a): positiver Angebotsschock - unerwarteter technischer Fortschritt - Sinken der Einstandspreise importierter Rohstoffe - Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen Angebotsschocks verändern
Übung zur Vorlesung Volkswirtschaftliche Aspekte des technischen Fortschritts
 Übung zur Vorlesung Volkswirtschaftliche Aspekte des technischen Fortschritts Herbsttrimester 2014 Dr. Anja Behrendt Aufgabe 2 a) Erläutern Sie das Konzept des Hicks neutralen sowie des Hicksarbeitssparenden
Übung zur Vorlesung Volkswirtschaftliche Aspekte des technischen Fortschritts Herbsttrimester 2014 Dr. Anja Behrendt Aufgabe 2 a) Erläutern Sie das Konzept des Hicks neutralen sowie des Hicksarbeitssparenden
Übung 3: Unternehmenstheorie
 Übung 3: Unternehmenstheorie Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Intermediate Microeconomics HS 11 Unternehmenstheorie 1 / 42 Produktion Zur Erinnerung: Grenzprodukt
Übung 3: Unternehmenstheorie Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Intermediate Microeconomics HS 11 Unternehmenstheorie 1 / 42 Produktion Zur Erinnerung: Grenzprodukt
IS: y(schock,i), wobei y positiv vom Schock und negativ von i abhängt LM: M/P=L(y,i) wobei L positiv von y und negativ von i abhängt
 Aufgabenblatt 3, Aufgabe 3 IS-LM/AD- Negativer Schock der Güternachfrage IS: (Schock,i), wobei positiv vom Schock und negativ von i abhängt LM: M/=L(,i) wobei L positiv von und negativ von i abhängt a)
Aufgabenblatt 3, Aufgabe 3 IS-LM/AD- Negativer Schock der Güternachfrage IS: (Schock,i), wobei positiv vom Schock und negativ von i abhängt LM: M/=L(,i) wobei L positiv von und negativ von i abhängt a)
VO Grundlagen der Mikroökonomie
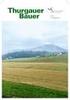 Institut für Wirtschaftsmathematik Ökonomie VO 105.620 Grundlagen der Mikroökonomie Die Kosten der Produktion (Kapitel 7) ZIEL: Die Messung von Kosten Die Kosten in der kurzen Frist Die Kosten in der langen
Institut für Wirtschaftsmathematik Ökonomie VO 105.620 Grundlagen der Mikroökonomie Die Kosten der Produktion (Kapitel 7) ZIEL: Die Messung von Kosten Die Kosten in der kurzen Frist Die Kosten in der langen
Demographische Situation in Immerath. Überblick. Historische Bevölkerungsentwicklung
 Demographische Situation in Immerath Überblick im Vergleich stabile und junge Ortsgemeinde Immerath ist eine Ortsgemeinde mit vergleichsweise stabilen demographischen Bedingungen. Die langfristige Betrachtung
Demographische Situation in Immerath Überblick im Vergleich stabile und junge Ortsgemeinde Immerath ist eine Ortsgemeinde mit vergleichsweise stabilen demographischen Bedingungen. Die langfristige Betrachtung
Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell
 Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 21. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell 21. Juni
Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 21. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell 21. Juni
Außenhandelstheorie und internationaler Wettbewerb
 1. Einführung 2. Außenhandel 3. Handelspolitik 4. Institutionen Außenhandelstheorie und internationaler Wettbewerb Das Konzept des komparativen Vorteils Faktorausstattung und Handelsmuster Intra industrieller
1. Einführung 2. Außenhandel 3. Handelspolitik 4. Institutionen Außenhandelstheorie und internationaler Wettbewerb Das Konzept des komparativen Vorteils Faktorausstattung und Handelsmuster Intra industrieller
Arbeitsmarkt. Einführung in die Makroökonomie. 10. Mai 2012 SS 2012. Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Arbeitsmarkt 10.
 Arbeitsmarkt Einführung in die Makroökonomie SS 2012 10. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Arbeitsmarkt 10. Mai 2012 1 / 31 Was bisher geschah Im IS-LM haben wir eine Volkswirtschaft in
Arbeitsmarkt Einführung in die Makroökonomie SS 2012 10. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Arbeitsmarkt 10. Mai 2012 1 / 31 Was bisher geschah Im IS-LM haben wir eine Volkswirtschaft in
Bachelor Business Administration and Economics / Bachelor Governance and Public Policy / Lehramt
 Bachelor Business Administration and Economics / Bachelor Governance and Public Policy / Lehramt Prüfungsfach/Modul: Makroökonomik Klausur: Makroökonomik (80 Minuten) (211751) Prüfer: Prof. Dr. Johann
Bachelor Business Administration and Economics / Bachelor Governance and Public Policy / Lehramt Prüfungsfach/Modul: Makroökonomik Klausur: Makroökonomik (80 Minuten) (211751) Prüfer: Prof. Dr. Johann
Von. Avinash Dixit. Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Warwick und. Victor Norman
 Außenhandelstheorie Von Avinash Dixit Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Warwick und Victor Norman Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Norwegischen Wirtschaftsuniversität
Außenhandelstheorie Von Avinash Dixit Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Warwick und Victor Norman Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Norwegischen Wirtschaftsuniversität
Makro II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser. Kapitel 8 Erwartungsbildung, Wirtschaftsaktivität und Politik
 Makro II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 8 Erwartungsbildung, Wirtschaftsaktivität und Politik Version: 12.12.2011 Erwartungen und Nachfrage: eine Zusammenfassung Erwartungskanäle und Nachfrage Erwartungen
Makro II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 8 Erwartungsbildung, Wirtschaftsaktivität und Politik Version: 12.12.2011 Erwartungen und Nachfrage: eine Zusammenfassung Erwartungskanäle und Nachfrage Erwartungen
IK Ökonomische Entscheidungen & Märkte
 LVA-Leiter: Martin Halla Einheit 6: Die Produktion (Kapitel 6) Einheit 6-1 - Theorie der Firma - I In den letzten beiden Kapiteln: Genaue Betrachtung der Konsumenten (Nachfrageseite). Nun: Genaue Betrachtung
LVA-Leiter: Martin Halla Einheit 6: Die Produktion (Kapitel 6) Einheit 6-1 - Theorie der Firma - I In den letzten beiden Kapiteln: Genaue Betrachtung der Konsumenten (Nachfrageseite). Nun: Genaue Betrachtung
Historische Bevölkerungsentwicklung insgesamt und nach Geschlecht Bevölkerungsanstieg bis 1997, seit 1998 rückläufige Bevölkerungsentwicklung
 Demographische Situation in der Stadt Daun Überblick langfristig positive Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Daun gesamt Entwicklung der Hauptwohnsitze je nach Stadtteil/Kernstadt unterschiedlich, von
Demographische Situation in der Stadt Daun Überblick langfristig positive Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Daun gesamt Entwicklung der Hauptwohnsitze je nach Stadtteil/Kernstadt unterschiedlich, von
Auswanderung als Herausforderung für die Europäischen Wohlfahrtsstaaten
 Auswanderung als Herausforderung für die Europäischen Wohlfahrtsstaaten Prof. Panu Poutvaara, Ph.D CEMIR Konferenz Berlin, am 10. November 2015 ifo Center for Excellence in Migration and Integration Research
Auswanderung als Herausforderung für die Europäischen Wohlfahrtsstaaten Prof. Panu Poutvaara, Ph.D CEMIR Konferenz Berlin, am 10. November 2015 ifo Center for Excellence in Migration and Integration Research
Kosten. Vorlesung Mikroökonomik Marktangebot. Preis. Menge / Zeit. Bieten die Unternehmen bei höheren Preisen mehr an?
 Kosten Vorlesung Mikroökonomik 22.11.24 Marktangebot Preis Bieten die Unternehmen bei höheren Preisen mehr an? Angebot 1 Oder können die Unternehmen den Preis bei grösserer Produktion senken? Angebot 2
Kosten Vorlesung Mikroökonomik 22.11.24 Marktangebot Preis Bieten die Unternehmen bei höheren Preisen mehr an? Angebot 1 Oder können die Unternehmen den Preis bei grösserer Produktion senken? Angebot 2
Außenwirtschaftspolitik Modul 1 Theorie des internationalen Handels (I) 1. April 2008
 Prof. Dr. Thomas Straubhaar Universität Hamburg Sommersemester 2008 Vorlesung 21-60.376 Außenwirtschaftspolitik Modul 1 Theorie des internationalen Handels (I) 1. April 2008 1 Arbeitsteilung POSITIVE EFFEKTE
Prof. Dr. Thomas Straubhaar Universität Hamburg Sommersemester 2008 Vorlesung 21-60.376 Außenwirtschaftspolitik Modul 1 Theorie des internationalen Handels (I) 1. April 2008 1 Arbeitsteilung POSITIVE EFFEKTE
Internationale Mikroökonomik Kurs, 3h, Do , HS VO4: Faktorproportion, Leontief- Paradoxon und Weiterentwicklungen
 Internationale Mikroökonomik Kurs, 3h, Do 14.00-17.00, HS15.06 VO4: Faktorproportion, Leontief- Paradoxon und Weiterentwicklungen Einführung und Literaturhinweise Faktorproportionentheorem logisch konsistent
Internationale Mikroökonomik Kurs, 3h, Do 14.00-17.00, HS15.06 VO4: Faktorproportion, Leontief- Paradoxon und Weiterentwicklungen Einführung und Literaturhinweise Faktorproportionentheorem logisch konsistent
