Optimierung der Bewegungsabläufe beim Startsprung im Sportschwimmen
|
|
|
- Gotthilf Reuter
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 1 Optimierung der Bewegungsabläufe beim Startsprung im Sportschwimmen (AZ /11-13) Heike Hermsdorf, Norman Hofmann & Albrecht Keil (Projektleiter) Institut für Mechatronik e. V. an der TU Chemnitz 1 Problem Die Bewertung sportlicher Bewegungsabläufe unter Einbeziehung von Messungen beruht darauf, dass ein Modell existiert, das den Einfluss gemessener Größen auf das sportliche Ergebnis abbildet. Um ein solches Modell für die individuelle Gestaltung des Trainings nutzen zu können, muss es nach Möglichkeit auch die individuellen Fähigkeiten einer Athletin bzw. eines Athleten berücksichtigen. Während aktuell angewandte Bewertungsverfahren oft auf die Einnahme oder das Durchlaufen bestimmter Posen ausgerichtet sind, muss sich eine an der individuellen Physis der Athletin bzw. des Athleten orientierte Bewertung bevorzugt auf die wirkenden Kräfte bzw. Momente beziehen. Eine solche Bewertung liegt nahe, weil die Fähigkeit, Antriebsmomente aufzubringen, vergleichsweise gut trainierbar ist. Die von der Athletin und vom Athleten aufgebrachten Momente lassen sich nicht direkt messen. Sie können aber mit Hilfe eines Simulationsmodells aus der gemessenen Bewegung und den ebenfalls gemessenen äußeren Kräften bestimmt werden. Es war das Ziel des hier beschriebenen Projektes, für den Startsprung im Sportschwimmen die Methoden für eine an der individuellen Physis der Athletin bzw. des Athleten orientierte Bewertung der Übung zu entwickeln und zu testen. Dabei sind zwei Teilprobleme zu lösen: Die Genauigkeit der eingesetzten Methoden muss soweit verbessert werden, dass die individuellen Unterschiede zwischen den Ausführungen sicher von den Messfehlern unterschieden werden können. Das Verfahren muss außerdem zu einer minimalen technologischen Reife entwickelt werden. Nur dann ist es möglich, die für eine Validierung des Bewertungsmodells notwendige Menge an individuellen Daten zu erheben und damit gleichzeitig Auswirkungen auf Trainingsprozesse zu erreichen. Die entwickelten Methoden lassen sich zumindest teilweise auch auf andere Sportarten anwenden. Der Startsprung wurde ausgewählt, weil für diese Übung bereits Vorarbeiten existierten (Küchler, 1994) und außerdem beim Verbundpartner IAT in Leipzig ein entsprechender Messplatz verfügbar ist. 2 Methoden 2.1 Modellierung und Simulation Die Auswahl eines geeigneten Modells sowie der zugehörigen Simulationsverfahren richtet sich in erster Linie nach den für die Bewertung des Bewegungsablaufes benötigten Beobachtungsgrößen. Da bei der Bewertung der Absprungbewegung die von der Sportlerin bzw. vom Sportler aufgebrachten Momente berücksichtigt werden sollen, ist die Abbildung von Sportlerin/Sportler und Startblock durch ein Mehrkörpersystem (MKS) geeignet. Mit alaska steht ein am Institut für Mechatronik entwickeltes Simulationswerkzeug zur Analyse, Synthese und Optimierung von Mehrkörpersystemen zur Verfügung. Die Modellbibliothek alaska/dynamicus (Institut für Mechatronik e. V., 2014) stellt ein biomechanisches MKS-Menschmodell sowie ein Verfahren zur Bewegungsrekonstruktion zur Verfügung, wobei das Menschmodell um beliebige MKS-Modellkomponenten, wie z. B. eingeprägte Kräfte, erweitert werden kann (Abb. 1).
2 2 Optimierung der Bewegungsabläufe... Abb. 1: Aufbau des biomechanischen Menschmodells Dynamicus Für die Modellierung des Startsprungs sind die Bewegungsmöglichkeiten in den Gelenken des Modells, die individuellen anthropometrischen Daten der Testperson und die gemessene Bewegung in Form von Markerkoordinaten zu spezifizieren. Der Startblock wird als starrer Körper modelliert, der fest mit dem Fundament verbunden ist. Um Gelenkmomente berechnen zu können, werden die gemessenen Bodenreaktionskräfte zwischen Testperson und Startblock eingeprägt. Dabei werden Kräfte in den Armen durch Zug an der Griffstange, Kräfte auf den vorderen Fuß und Kräfte auf den hinteren Fuß, der auf der Fersenstütze abgestützt ist, berücksichtigt. Die eingeprägten Kräfte werden im Modell durch Kraftvektor und Kraftangriffspunkt definiert. Diese Daten werden aus Messungen auf dem Messstartblock des IAT gewonnen. Für fehlende Daten werden geeignete Standardwerte angenommen (Abb. 2). Abb. 2: Menschmodell mit eingeprägten Bodenreaktionskräften
3 Optimierung der Bewegungsabläufe... 3 Die Simulation ist ein zweistufiges Verfahren. In der ersten Stufe wird die Bewegungsrekonstruktion ausgeführt. Auf Grundlage von Daten der Bewegungserfassung wird die Bewegung der Testperson auf das Menschmodell übertragen, d. h. das Menschmodell bewegt sich wie die Testperson. Anschließend wird die Inverse Dynamik berechnet. Dazu wird die rekonstruierte Bewegung, d. h. die globale Bewegung des Modellkörpers Pelvis sowie die Relativbewegung aller Gelenke, als Zwangsbedingung vorgegeben. Das Menschmodell durchläuft alle Lagen der rekonstruierten Bewegung. Geschwindigkeiten und Beschleunigungen werden durch Interpolation berechnet, so dass auch dynamische Beobachtungsgrößen berechnet werden können. Die Inverse Dynamik wird dabei in zwei Konfigurationen berechnet. Zunächst werden keine Bodenreaktionskräfte in das Modell eingeprägt. Die Zwangskräfte zur Steuerung der Bewegung des Modellkörpers Pelvis stellen in diesem Fall die Summe der Bodenreaktionskräfte (Summe über beide Füße und Hände) dar. Durch Vergleich der so berechneten mit den gemessenen Bodenreaktionskräften wird die Güte des Modells validiert. In der zweiten Konfiguration werden die gemessenen Bodenreaktionskräfte in den Modellkörpern (Hände und Füße) eingeprägt und die Gelenkmomente berechnet. Die Gelenkmomente stellen die Reduktionsmomente aller Muskelkräfte, die das Gelenk überspannen, bezüglich des Gelenkpunktes dar. Die Gelenkmomente sind daher eine geeignete Größe zur Beurteilung der insgesamt aufgebrachten Muskelkräfte (Abb. 3). Abb. 3: Simulationsverfahren und dessen Eingangsdaten
4 4 Optimierung der Bewegungsabläufe Ermittlung von Eingangsdaten für das Modell Zur Berechnung der individuell aufgebrachten Momente werden neben den Zeitverläufen von Bewegungsdaten und Bodenreaktionskräften die individuellen anthropometrischen Daten der Sportlerin bzw. des Sportlers benötigt. Diese werden beim klassischen Vorgehen durch eine Vermessung der Testperson mit speziellen anthropometrischen Messwerkzeugen erhoben. Im Ergebnis liegen Abstände und Umfänge ( Leitmaße ), die durch äußere anthropometrische Punkte definiert sind, vor. Für biomechanische Analysen sind jedoch die Lage der Gelenke sowie die Masseverteilung entscheidend. Diese Daten werden aktuell durch Regressionsformeln aus den Leitmaßen berechnet. Damit wird der Individualität der Sportlerin bzw. des Sportlers jedoch nur bedingt Rechnung getragen. Deshalb wurden alternative Verfahren zur Bestimmung anthropometrischer Daten entwickelt und eingesetzt (Härtel, 2011). Eine Analyse der Möglichkeiten des Bodyscanners VITUS Smart LC der Firma Human Solutions zeigte verschiedene Anwendungsszenarien auf. Die vom Bodyscanner generierte Beschreibung der Hüllgeometrie der Testperson kann geometrisch analysiert werden, um die geforderten anthropometrischen Leitmaße automatisiert zu berechnen. Mit einer zusätzlichen Softwarekomponente kann ein Skelett in die Hüllgeometrie eingepasst werden. Damit stehen Daten zur Lage der Gelenke zur Verfügung. Wird die Hüllgeometrie mit Hilfe geometrischer Schnittfunktionen in Teilkörper separiert, können bei Annahme einer durchschnittlichen Dichte Aussagen über Massen und Massenträgheitsmomente abgeleitet werden. Eine weitere interessante Möglichkeit besteht in der Anwendung eines Motion Capture Systems. Wenngleich die Lage der Gelenke der Testperson nicht direkt durch ein Motion Capture System erfasst werden kann, steht mit der Methode der virtuellen Drehzentren ein Verfahren zur Verfügung, das die Lage der Gelenke aus den Daten von Sensoren, die an der Testperson befestigt wurden, berechnet. Zur Untersuchung dieser Methodik wurde das Motion Capture System ART eingesetzt. An der Testperson wurden sogenannte Targets eine Kombination aus optischen Markern befestigt und eine Kalibrierbewegung der Person aufgezeichnet. Es wurde eine Softwarekomponente entwickelt, die aus den Sensordaten der Kalibrierbewegung die Lage der Gelenke berechnet. Bei der Arbeit mit dem ART-System konnte die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Bewegungserfassung nachgewiesen werden. Deshalb wurde der Einsatz des Systems zur Gewinnung von Bewegungsdaten für Absprungbewegungen in Betracht gezogen. Da davon auszugehen war, dass die Einsatzbedingungen für das Motion Capture System in der Schwimmhalle wesentlich schwieriger als in der Sporthalle sind, wurden zunächst Imitationssprünge erfasst. Nach Optimierung des Aufnahmeszenarios (Anzahl und Position der Kameras) konnten die Imitationssprünge erfolgreich erfasst werden und eine Übertragung der Technologie auf die Schwimmhalle erschien möglich. Jedoch konnten hier keine verwertbaren Bewegungsdaten gewonnen werden. Die Erkennungsrate des Systems war so gering, dass keine zusammenhängenden Zeitverläufe von Sensordaten erstellt werden konnten. Als mögliche Ursachen sind die relativ niedrige Aufnahmefrequenz des Systems von maximal 60 Hz sowie unkontrollierte Reflexionspunkte durch die Wasseroberfläche zu sehen. Deshalb musste auf das bewährte Verfahren der Videobildanalyse zurückgegriffen werden. Dieses Verfahren ist sehr zeitaufwändig und liefert Daten nur mit eingeschränkter Genauigkeit, ist jedoch eine robuste Möglichkeit der Bewegungserfassung, wenn der Einsatz automatisierter Motion Capture Systeme nicht möglich ist. Die Absprungbewegungen in der Schwimmhalle wurden mit vier Videokameras aufgezeichnet. Für die Videobildanalyse wurde die am IAT entwickelten Software Mess3D (Hildebrand & Drenk, 2000)
5 Optimierung der Bewegungsabläufe... 5 eingesetzt. Durch manuelles Selektieren von 20 Körperpunkten in allen Videobildern konnten die 3D-Koordinaten der Körperpunkte bestimmt werden (Abb. 4). Abb. 4: Erfasste Körperpunkte in der Videobildanalyse Die Zeitverläufe der Bodenreaktionskräfte wurden durch einen Messstartblock erfasst, der am IAT entwickelt wurde (Kindler, 2011). Der Messstartblock erfasst die horizontalen und vertikalen Komponenten der Kräfte, die durch die Füße auf den Startblock übertragen werden separat für den rechten und linken Fuß. Weiterhin werden summarisch die Zugkräfte zwischen beiden Händen und der Griffstange in vertikaler Richtung gemessen. Die gemessenen Kräfte liegen mit einer Abtastfrequenz von 200 Hz vor (Abb. 5). Abb. 5: Messstartblock
6 6 Optimierung der Bewegungsabläufe... 3 Ergebnisse Im Ergebnis der Arbeiten entstand ein biomechanisches Modell zur Simulation von Absprungbewegungen. Das Modell ist parametrisiert und kann einfach an die jeweilige Sportlerin/den jeweiligen Sportler und die zu simulierende Absprungbewegung angepasst werden. Damit ist gewährleistet, dass alle Absprungbewegungen mit den gleichen Modellannahmen simuliert und weitere Absprungbewegungen einfach einbezogen werden können. Mit den beschriebenen Methoden zur Ermittlung von Eingangsdaten für das Simulationsmodell wurden die Absprungbewegungen für fünf Nachwuchssportlerinnen und -sportler erfasst (Tab. 1). Tab. 1: Probandenübersicht Zur Absicherung des Modells und der Simulationsverfahren wurde die Summe der Bodenreaktionskräfte für alle fünf Absprungbewegungen berechnet. Die folgende Abbildung zeigt an einem Beispiel den Vergleich mit den gemessenen Bodenreaktionskräften in vertikaler und horizontaler Richtung (Abb. 6). Abb. 6: Vergleich der berechneten (grün) und der gemessenen Bodenreaktionskräfte (rot) für Sportler 5. Die gute Übereinstimmung der Ergebnisse zeigt, dass die gemessene Bewegung, die gemessenen Kräfte und die individuellen Modellparameter, die in der Simulation durch die Bewegungsgleichungen verbunden sind, ein konsistentes System bilden. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass das Modell sowohl hinsichtlich der kinematischen als auch der dynamischen Eigenschaften valide
7 Optimierung der Bewegungsabläufe... 7 ist. Mit Hilfe dieses Modells können nun weitere Beobachtungsgrößen wie z. B. die Flexionswinkel für Arme und Beine, Lage und Geschwindigkeit des Körperschwerpunkts, Abflugwinkel, Impuls und Drehimpuls sowie Gelenkmomente der Flexion für Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüftgelenk berechnet werden (Abb. 7). Abb. 7: Flexionsmomente im Kniegelenk und Hüftgelenk für Sportler 5 jeweils für das vordere und hintere Bein. Im TrainerAnalyseTool, das ebenfalls am IfM entwickelt wurde, können mehrere Absprungbewegungen verglichen werden. In die Gegenüberstellung werden sowohl Animationssequenzen als auch Kurvenverläufe einbezogen. Das TrainerAnalyseTool in Verbindung mit dem dynamo- und videometrischen Messplatz stellt somit dem Trainingswissenschaftler bzw. Trainer alle notwendigen Informationen zur Bewertung der Absprungbewegung in geschlossener Form zur Verfügung. Neben der klassischen biomechanischen Analyse (Betrachtung des Körperschwerpunktes, kinematische Analyse) ist es nun möglich, das komplexe zeitliche Zusammenspiel der Einzelantriebe zu beurteilen. So kann z. B. die Auswirkung von Armzugkräften oder einer rückverlagerten Starthaltung auf das Kräftespiel innerhalb der Gliederkette bewertet werden. Die Aufklärung des Zusammenhangs zwischen äußeren gemessenen Reaktionskräften und den inneren Antriebsmomenten in den Gelenken der Beinkette, die nun berechnet werden können, birgt dabei großes Potenzial für die trainingswissenschaftliche Analyse (Abb. 8). Abb. 8: Vergleich von Absprungbewegungen im TrainerAnalyseTool
8 8 Optimierung der Bewegungsabläufe... 4 Diskussion Es konnte gezeigt werden, dass mit Hilfe eines individualisierten MKS-Simulationsmodells aus gemessenen Bodenreaktionskräften und Bewegungen, die am Trainingsmessplatz erfasst werden können, valide Beobachtungsgrößen für eine individuelle dynamische Bewertung von Startsprüngen im Sportschwimmen ermittelt werden können. Dazu gehören insbesondere die Antriebsmomente in den Gelenken, die summarisch die vom Athleten aufgebrachten Muskelkräfte abbilden. Das Simulationsmodell basiert auf individuellen anthropometrischen Daten der Sportlerinnen und Sportler. Für deren Ermittlung wurden mit dem Bodyscanner und dem Verfahren der Kalibrierbewegung zwei interessante neue Ansätze realisiert. Beide Verfahren weisen Vor- und Nachteile auf. Die Kalibrierbewegung erweist sich für die Bestimmung der Gelenkpositionen als überlegen, da sie keine Regressionsformeln benötigt. Jedoch kann diese Methode keine Aussagen zur Massenverteilung liefern. Diese Daten können hingegen zuverlässig mit Hilfe eines Bodyscanners ermittelt werden. Da die Daten für eine begrenzte Anzahl von Athletinnen und Athleten jeweils nur einmal ermittelt werden müssen, sollten zukünftig beide Verfahren kombiniert werden. Die entwickelte Technologie muss in der Folge durch eine größere Anzahl von Experimenten abgesichert werden. Diese werden auch benötigt, um aus den berechneten Zeitreihen ein praktisch handhabbares Bewertungsmodell zu entwickeln. Die Durchführung einer größeren Zahl von Experimenten ebenso wie die unmittelbare Nutzung der Technologie im Trainingsprozess wird gegenwärtig noch durch die Nutzung der Videobildanalyse als Methode der Bewegungserfassung erschwert, weil damit eine zeitnahe Gewinnung von Bewegungsdaten nicht möglich ist. Die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der Motion Capture Technologie lassen jedoch erwarten, dass dieses Problem möglicherweise schon mit einer nächsten Generation von Infrarotkameras behoben werden kann. Die entwickelten Methoden sind nicht auf die Anwendung im Startsprung beschränkt. Sie können auf andere Sportarten übertragen werden, sofern eine vollständige Messung von Kräften und Bewegung technisch möglich ist.
9 Optimierung der Bewegungsabläufe Literatur Graumnitz, J., Küchler, J. & Drenk, V. (2007). Greifstart oder Schrittstart Fakten und Tendenzen aus Analysen bei internationalen Meisterschaften im Sportschwimmen. In W. Leopold (Hrsg./ Red.), Schwimmen Lernen und Optimieren, 28 (S ). Beucha: DSTV. Härtel, T., Schleichardt, A. & Graumnitz, J.(2011): Längenänderungen von Antriebsmuskeln der Beinkette beim Startsprung im Sportschwimmen. In T. Sieber & R. Blickhan (Hrsg.), Biomechanik vom Muskelmodell bis zur angewandten Bewegungswissenschaft, Schriften der DVS, Band 219 (S ). Edition Czwalina, Feldhaus Verlag, Hamburg. Härtel, T. & Schleichardt, A. (2011): Individuelle Optimierung von Bewegungsabläufen beim Startsprung im Sportschwimmen, Jahrestagung der dvs-kommission Schwimmen, November, Leipzig. Hildebrand, F. & Drenk, V. (2000). Software mess3d für die Auswertung dreidimensionaler Videoaufnahmen. [Computersoftware]. Leipzig: IAT. Institut für Mechatronik e. V., Chemnitz, (2014). Dynamicus 8.0 Referenz- und Benutzerhandbuch. Kibele, A., Fischer, S. & Biel, K. (2011). Biomechanische Grundlagen des Startsprungs im Schwimmen Sportwissenschaft, 41, Kibele, A., Fischer, S. & Biel, K. (2012/2013). Optimizing individual stance position in swim start on the OSB11. In Bundesinstitut für Sportwissenschaft (Hrsg.) BISp-Jahrbuch Forschungsförderung 2012/13 (S ). Köln: Sportverlag Strauß. Kindler, M. (2011). Der dynamometrische Startblock im MIS Schwimmen, 13. Frühjahrsschule Informations- und Kommunikationstechnologien in der angewandten Trainingswissenschaft, 13./ 14. April. Küchler, J. (1994). Mechanische Analyse des Startabschnitts im Schwimmen. In W. Freitag (Hrsg.), Schwimmen - Lernen und Optimieren, 8 (S ). Rüsselsheim: DSTV. Schleichardt, A. & Härtel, T.(2011). Längenänderungen von Antriebsmuskeln der Beinkette beim Startsprung im Sportschwimmen, Tagung der DVS Sektion Biomechanik 2011, April, Jena.
Erfassung, Simulation und Weiterverarbeitung menschlicher Bewegungen mit Dynamicus
 Erfassung, Simulation und Weiterverarbeitung menschlicher Bewegungen mit Dynamicus Heike Hermsdorf, Norman Hofmann Institut für Mechatronik e.v. Reichenhainer Straße 88 09126 Chemnitz www.ifm-chemnitz.de
Erfassung, Simulation und Weiterverarbeitung menschlicher Bewegungen mit Dynamicus Heike Hermsdorf, Norman Hofmann Institut für Mechatronik e.v. Reichenhainer Straße 88 09126 Chemnitz www.ifm-chemnitz.de
Nordische Kombination. Simulative Untersuchungen des Bewegungsablaufes im Skisprung und dessen materialtechnische Beeinflussung
 205 Nordische Kombination Simulative Untersuchungen des Bewegungsablaufes im Skisprung und dessen materialtechnische Beeinflussung Albrecht Keil, Heike Hermsdorf, Norman Hofmann, Karin Knoll & Sören Müller
205 Nordische Kombination Simulative Untersuchungen des Bewegungsablaufes im Skisprung und dessen materialtechnische Beeinflussung Albrecht Keil, Heike Hermsdorf, Norman Hofmann, Karin Knoll & Sören Müller
Simulative Untersuchungen zum Startsprung im Sportschwimmen
 161 Simulative Untersuchungen zum Startsprung im Sportschwimmen Albrecht Keil 1, Thomas Härtel 1, Axel Schleichardt 2, Jürgen Küchler 2 & Jens Graumnitz 2 1 Institut für Mechatronik e.v. Chemnitz 2 Institut
161 Simulative Untersuchungen zum Startsprung im Sportschwimmen Albrecht Keil 1, Thomas Härtel 1, Axel Schleichardt 2, Jürgen Küchler 2 & Jens Graumnitz 2 1 Institut für Mechatronik e.v. Chemnitz 2 Institut
Biomechanik im Sporttheorieunterricht
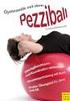 Betrifft 22 DR. MARTIN HILLEBRECHT Biomechanik im Sporttheorieunterricht - Grafische Schwerpunktbestimmung - 1. EINLEITUNG Im ersten Teil diese Artikels (vgl. Betrifft Sport 4/ 98) wurden zwei Verfahren
Betrifft 22 DR. MARTIN HILLEBRECHT Biomechanik im Sporttheorieunterricht - Grafische Schwerpunktbestimmung - 1. EINLEITUNG Im ersten Teil diese Artikels (vgl. Betrifft Sport 4/ 98) wurden zwei Verfahren
Die Last der Gelenke. Neues gkf-projekt
 Neues gkf-projekt Die Last der Gelenke Französische Bulldogge mit Markern. Die Marker stören den Hund nicht. Wie stark werden Gelenke in der Bewegung belastet? Diese Frage kann bislang nur intuitiv beantwortet
Neues gkf-projekt Die Last der Gelenke Französische Bulldogge mit Markern. Die Marker stören den Hund nicht. Wie stark werden Gelenke in der Bewegung belastet? Diese Frage kann bislang nur intuitiv beantwortet
Bessere Therapieplanung durch komplexe kinetische Analysen nach Schlaganfall? Mario Siebler MediClin Fachklinik Rhein/Ruhr
 Bessere Therapieplanung durch komplexe kinetische Analysen nach Schlaganfall? Mario Siebler MediClin Fachklinik Rhein/Ruhr Dominik Raab Universität Duisburg-Essen 2. NRW-Forum Rehabilitationsensomotorischer
Bessere Therapieplanung durch komplexe kinetische Analysen nach Schlaganfall? Mario Siebler MediClin Fachklinik Rhein/Ruhr Dominik Raab Universität Duisburg-Essen 2. NRW-Forum Rehabilitationsensomotorischer
Biomechanik im Sporttheorieunterricht
 Betrifft 1 Biomechanische Prinzipien 33 DR. MARTIN HILLEBRECHT Das biomechanische Prinzip des optimalen Beschleunigungsweges 1 BIOMECHANISCHE PRINZIPIEN HOCHMUTH nennt bei der Aufzählung der Aufgaben der
Betrifft 1 Biomechanische Prinzipien 33 DR. MARTIN HILLEBRECHT Das biomechanische Prinzip des optimalen Beschleunigungsweges 1 BIOMECHANISCHE PRINZIPIEN HOCHMUTH nennt bei der Aufzählung der Aufgaben der
Vermittlung und Optimierung des Schwimmstarts
 Vermittlung und Optimierung des Schwimmstarts Kristina Biel, Yvonne Mittag, Sebastian Fischer, Armin Kibele AG Training & Bewegung, Universität Kassel 1 Literaturüberblick Die Startzeit beträgt 10% bei
Vermittlung und Optimierung des Schwimmstarts Kristina Biel, Yvonne Mittag, Sebastian Fischer, Armin Kibele AG Training & Bewegung, Universität Kassel 1 Literaturüberblick Die Startzeit beträgt 10% bei
Gelenksmomente und Muskelkräfte. Gelenksmomente und Muskelkräfte. Isometrischer Maximalkrafttest - Kniestrecker. Datenerfassung
 Gelenksmomente und Muskelkräfte Gelenksmomente und Muskelkräfte Datenerfassung, Grundlagen, Anwendung Ziele Grundlagen der Berechnung von Gelenksmomenten (Knie, Hüfte, ) und Kräften in den einzelnen Muskeln
Gelenksmomente und Muskelkräfte Gelenksmomente und Muskelkräfte Datenerfassung, Grundlagen, Anwendung Ziele Grundlagen der Berechnung von Gelenksmomenten (Knie, Hüfte, ) und Kräften in den einzelnen Muskeln
Institut für Mechatronik e.v. an der Technischen Universität Chemnitz
 Institut für Mechatronik e.v. an der Technischen Universität Chemnitz Mechatronik und funktioneller Entwurf P. Maißer Institut für Mechatronik e.v. an der Technischen Universität Chemnitz Reichenhainer
Institut für Mechatronik e.v. an der Technischen Universität Chemnitz Mechatronik und funktioneller Entwurf P. Maißer Institut für Mechatronik e.v. an der Technischen Universität Chemnitz Reichenhainer
Arbeitsblatt : Messung von Beschleunigungen beim Vertikalsprung
 1 Studienwerkstatt Bewegungsanalyse Universität Kassel Arbeitsblatt : Messung von Beschleunigungen beim Vertikalsprung Einleitung : Die Beschleunigung ist neben der Geschwindigkeit eine wichtige Beschreibungsgröße
1 Studienwerkstatt Bewegungsanalyse Universität Kassel Arbeitsblatt : Messung von Beschleunigungen beim Vertikalsprung Einleitung : Die Beschleunigung ist neben der Geschwindigkeit eine wichtige Beschreibungsgröße
Biomechanik im Sporttheorieunterricht
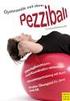 Betrifft 31 DR. MARTIN HILLEBRECHT Biomechanik im Sporttheorieunterricht - Innere und äußere Kräfte - 1 EINLEITUNG Im ersten Teil der Reihe Biomechanik im Sportunterricht wurde die physikalische Größe
Betrifft 31 DR. MARTIN HILLEBRECHT Biomechanik im Sporttheorieunterricht - Innere und äußere Kräfte - 1 EINLEITUNG Im ersten Teil der Reihe Biomechanik im Sportunterricht wurde die physikalische Größe
CAD-FEM-MKS, CAD FEM MKS. von der dreidimensionalen Konstruktionszeichnung zum guten mechanischen Simulationsmodell
 CAD-FEM-MKS, 24.11.16 CAD FEM MKS von der dreidimensionalen Konstruktionszeichnung zum guten mechanischen Simulationsmodell der erste Schritt zum digitalen Zwilling im Rahmen von Industrie 4.0 Bocholt,
CAD-FEM-MKS, 24.11.16 CAD FEM MKS von der dreidimensionalen Konstruktionszeichnung zum guten mechanischen Simulationsmodell der erste Schritt zum digitalen Zwilling im Rahmen von Industrie 4.0 Bocholt,
LEITFADEN - GRUNDLAGEN DER BEWEGUNGSANALYSE
 LEITFADEN - GRUNDLAGEN DER BEWEGUNGSANALYSE Autoren: Roland Aller, Ulrike Hausen 2015 WWW.KNSU.DE Seite 1 Übersicht Leitfaden zum Powerpoint-Vortrag Bewegungsanalyse o Was ist die Bewegungsanalyse? o Anwendungsgebiete
LEITFADEN - GRUNDLAGEN DER BEWEGUNGSANALYSE Autoren: Roland Aller, Ulrike Hausen 2015 WWW.KNSU.DE Seite 1 Übersicht Leitfaden zum Powerpoint-Vortrag Bewegungsanalyse o Was ist die Bewegungsanalyse? o Anwendungsgebiete
3. Systeme von starren Körpern
 Systeme von starren Körpern lassen sich folgendermaßen berechnen: Die einzelnen starren Körper werden freigeschnitten. Für jeden einzelnen Körper werden die Bewegungsgleichungen aufgestellt. Die kinematischen
Systeme von starren Körpern lassen sich folgendermaßen berechnen: Die einzelnen starren Körper werden freigeschnitten. Für jeden einzelnen Körper werden die Bewegungsgleichungen aufgestellt. Die kinematischen
Bachelorprüfung MM I 2. März Vorname: Name: Matrikelnummer:
 Institut für Mechatronische Systeme Prof. Dr.-Ing. S. Rinderknecht Erreichbare Punktzahl: 40 Bearbeitungszeit: 60 Min Prüfung Maschinenelemente & Mechatronik I 2. März 2010 Rechenteil Name: Matr. Nr.:......
Institut für Mechatronische Systeme Prof. Dr.-Ing. S. Rinderknecht Erreichbare Punktzahl: 40 Bearbeitungszeit: 60 Min Prüfung Maschinenelemente & Mechatronik I 2. März 2010 Rechenteil Name: Matr. Nr.:......
Stiftungsprofessur für Systemzuverlässigkeit in Elektromobilität und Energiemanagement
 Stiftungsprofessur für Systemzuverlässigkeit in Elektromobilität und Energiemanagement Stiftungs-Professur Systemzuverlässigkeit in Elektromobilität und Energiemanagement Start: 1. April 2012 Eingebettet
Stiftungsprofessur für Systemzuverlässigkeit in Elektromobilität und Energiemanagement Stiftungs-Professur Systemzuverlässigkeit in Elektromobilität und Energiemanagement Start: 1. April 2012 Eingebettet
3. Analyse der Kamerabewegung Video - Inhaltsanalyse
 3. Analyse der Kamerabewegung Video - Inhaltsanalyse Stephan Kopf Bewegungen in Videos Objektbewegungen (object motion) Kameraoperationen bzw. Kamerabewegungen (camera motion) Semantische Informationen
3. Analyse der Kamerabewegung Video - Inhaltsanalyse Stephan Kopf Bewegungen in Videos Objektbewegungen (object motion) Kameraoperationen bzw. Kamerabewegungen (camera motion) Semantische Informationen
Technische Mechanik I
 1 Die Technische Mechanik ist ein Teilgebiet der Physik und wird definiert als Lehre von den Bewegungen und den Kräften. Sie lässt sich unterteilen in die Behandlung von Kräften an ruhenden Körpern (Statik,
1 Die Technische Mechanik ist ein Teilgebiet der Physik und wird definiert als Lehre von den Bewegungen und den Kräften. Sie lässt sich unterteilen in die Behandlung von Kräften an ruhenden Körpern (Statik,
Optimierung des Individualstarts auf dem neuen Startblock OSB11 (AZ /10)
 131 Optimierung des Individualstarts auf dem neuen Startblock OSB11 (AZ 071619/10) Sebastian Fischer, Armin Kibele (Projektleiter) & Kristina Biel Universität Kassel Problemstellung Mit einer Regeländerung
131 Optimierung des Individualstarts auf dem neuen Startblock OSB11 (AZ 071619/10) Sebastian Fischer, Armin Kibele (Projektleiter) & Kristina Biel Universität Kassel Problemstellung Mit einer Regeländerung
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Elastische Mehrkörpersysteme Modellierung Kinematik elastischer Mehrkör
 Studienarbeit STUD 185 Transiente Spannungssimulationen mit modalen Spannungsmatrizen von Michael Peić Betreuer: Prof. Dr. Ing. W. Schiehlen Dipl. Ing. H. Claus Universität Stuttgart Institut B für Mechanik
Studienarbeit STUD 185 Transiente Spannungssimulationen mit modalen Spannungsmatrizen von Michael Peić Betreuer: Prof. Dr. Ing. W. Schiehlen Dipl. Ing. H. Claus Universität Stuttgart Institut B für Mechanik
Rotation. Versuch: Inhaltsverzeichnis. Fachrichtung Physik. Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010. Physikalisches Grundpraktikum
 Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Versuch: RO Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010 Rotation Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung 2 2 Allgemeine Grundlagen 2 2.1
Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Versuch: RO Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010 Rotation Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung 2 2 Allgemeine Grundlagen 2 2.1
Leistungsrelevante Kenngrößen der Startleistung im Schwimmen für Greif- und Schrittstart. Armin Kibele & Sebastian Fischer Universität Kassel
 Leistungsrelevante Kenngrößen der Startleistung im Schwimmen für Greif- und Schrittstart * gefördert durch das Bundesinstitut für Sportwissenschaft (IIA1-070603/08 ) und die Universität Kassel...bei Einzelstarts
Leistungsrelevante Kenngrößen der Startleistung im Schwimmen für Greif- und Schrittstart * gefördert durch das Bundesinstitut für Sportwissenschaft (IIA1-070603/08 ) und die Universität Kassel...bei Einzelstarts
Institut für Mechatronik e.v. - Systemdynamik nach Maß
 Wo Institut für Mechatronik e.v. Reichenhainer Straße 88 09126 Chemnitz www.ifm-chemnitz.de Institut für Mechatronik e.v. - Systemdynamik nach Maß www.ifm-chemnitz.de Institut für Mechatronik e.v. Grundlagenforschung
Wo Institut für Mechatronik e.v. Reichenhainer Straße 88 09126 Chemnitz www.ifm-chemnitz.de Institut für Mechatronik e.v. - Systemdynamik nach Maß www.ifm-chemnitz.de Institut für Mechatronik e.v. Grundlagenforschung
Biomechanik. Läuferspezifisch
 Biomechanik Läuferspezifisch Grundlagen der Biomechanik (Sportmechanik) Was ist Biomechanik / Sportmechanik? o Unter Biomechanik versteht man die Mechanik des menschlichen Körpers beim Sporttreiben. o
Biomechanik Läuferspezifisch Grundlagen der Biomechanik (Sportmechanik) Was ist Biomechanik / Sportmechanik? o Unter Biomechanik versteht man die Mechanik des menschlichen Körpers beim Sporttreiben. o
DIPLOMARBEIT Z U M TH E M A. Entwicklung eines Knochenersatzwerkstoffes für den Einsatz in einem biofidelen Dummy
 Entwicklung eines Knochenersatzwerkstoffes für den Einsatz in einem biofidelen Dummy Eigenschaften ein hohes Maß an Übereinstimmung mit dem menschlichen Vorbild auf. Dafür soll im Rahmen einer Diplomarbeit
Entwicklung eines Knochenersatzwerkstoffes für den Einsatz in einem biofidelen Dummy Eigenschaften ein hohes Maß an Übereinstimmung mit dem menschlichen Vorbild auf. Dafür soll im Rahmen einer Diplomarbeit
Institut für Mechatronik, Chemnitz
 Modellbasierte Entwicklung von Windenergieanlagen - MBE-Wind Albrecht Keil Institut für Mechatronik e.v. Reichenhainer Straße 88 09126 Chemnitz www.ifm-chemnitz.de 1 3. Wissenschaftstage des BMU zur Offshore-Windenergienutzung,
Modellbasierte Entwicklung von Windenergieanlagen - MBE-Wind Albrecht Keil Institut für Mechatronik e.v. Reichenhainer Straße 88 09126 Chemnitz www.ifm-chemnitz.de 1 3. Wissenschaftstage des BMU zur Offshore-Windenergienutzung,
Menschlicher Bewegung auf den Zahn gefühlt
 Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/menschlicher-bewegung-aufden-zahn-gefuehlt/ Menschlicher Bewegung auf den Zahn gefühlt Schon das ganz normale Stehen
Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/menschlicher-bewegung-aufden-zahn-gefuehlt/ Menschlicher Bewegung auf den Zahn gefühlt Schon das ganz normale Stehen
SCAN&GO DIE NEUE VERMESSUNGSTECHNOLOGIE. www.scan-go.eu www.shop.laserscanning-europe.com V.02.2014
 SCAN&GO DIE NEUE VERMESSUNGSTECHNOLOGIE V.02.2014 www.scan-go.eu www.shop.laserscanning-europe.com SCAN&GO SYSTEM (PATENTRECHTLICH GESCHÜTZT) DIE NEUE VERMESSUNGSTECHNOLOGIE Scan&Go ist eine neue Methode
SCAN&GO DIE NEUE VERMESSUNGSTECHNOLOGIE V.02.2014 www.scan-go.eu www.shop.laserscanning-europe.com SCAN&GO SYSTEM (PATENTRECHTLICH GESCHÜTZT) DIE NEUE VERMESSUNGSTECHNOLOGIE Scan&Go ist eine neue Methode
Entwicklung einer netzbasierten Methodik zur Modellierung von Prozessen der Verdunstungskühlung
 Institut für Energietechnik - Professur für Technische Thermodynamik Entwicklung einer netzbasierten Methodik zur Modellierung von Prozessen der Verdunstungskühlung Tobias Schulze 13.11.2012, DBFZ Leipzig
Institut für Energietechnik - Professur für Technische Thermodynamik Entwicklung einer netzbasierten Methodik zur Modellierung von Prozessen der Verdunstungskühlung Tobias Schulze 13.11.2012, DBFZ Leipzig
Kinetik des starren Körpers
 Technische Mechanik II Kinetik des starren Körpers Prof. Dr.-Ing. Ulrike Zwiers, M.Sc. Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau Hochschule Bochum WS 2009/2010 Übersicht 1. Kinematik des Massenpunktes 2.
Technische Mechanik II Kinetik des starren Körpers Prof. Dr.-Ing. Ulrike Zwiers, M.Sc. Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau Hochschule Bochum WS 2009/2010 Übersicht 1. Kinematik des Massenpunktes 2.
3.1.2 Ergonomiesimulation im Nutzfahrzeug. Daimler AG, Human Solutions GmbH, Institut für Mechatronik e.v.
 3.1.2 Ergonomiesimulation im Nutzfahrzeug Daimler AG, Human Solutions GmbH, Institut für Mechatronik e.v. Leben im Fahrzeug Leben im Fahrzeug = Bewegung Erreichbarkeit Ablagen Bewegungsfreiheit Gehen /
3.1.2 Ergonomiesimulation im Nutzfahrzeug Daimler AG, Human Solutions GmbH, Institut für Mechatronik e.v. Leben im Fahrzeug Leben im Fahrzeug = Bewegung Erreichbarkeit Ablagen Bewegungsfreiheit Gehen /
Anleitung Ranger 3D-Kalibrierung
 EINLEITUNG Der Coordinator ist ein Programm, das die Kalibrierungsprozedur des Rangers vereinfacht und beschleunigt. Kalibrierte 3D-Daten sind entscheidend, wenn korrekte Positionen, Größen, Weite und
EINLEITUNG Der Coordinator ist ein Programm, das die Kalibrierungsprozedur des Rangers vereinfacht und beschleunigt. Kalibrierte 3D-Daten sind entscheidend, wenn korrekte Positionen, Größen, Weite und
Übungen zu Theoretische Physik I - Mechanik im Sommersemester 2013 Blatt 7 vom Abgabe:
 Übungen zu Theoretische Physik I - Mechanik im Sommersemester 03 Blatt 7 vom 0.06.3 Abgabe: 7.06.3 Aufgabe 9 3 Punkte Keplers 3. Gesetz Das 3. Keplersche Gesetz für die Planetenbewegung besagt, dass das
Übungen zu Theoretische Physik I - Mechanik im Sommersemester 03 Blatt 7 vom 0.06.3 Abgabe: 7.06.3 Aufgabe 9 3 Punkte Keplers 3. Gesetz Das 3. Keplersche Gesetz für die Planetenbewegung besagt, dass das
Parabelfunktion in Mathematik und Physik im Fall des waagrechten
 Parabelfunktion in Mathematik und Physik im Fall des waagrechten Wurfs Unterrichtsvorschlag, benötigtes Material und Arbeitsblätter Von der Physik aus betrachtet.. Einführendes Experiment Die Kinematik
Parabelfunktion in Mathematik und Physik im Fall des waagrechten Wurfs Unterrichtsvorschlag, benötigtes Material und Arbeitsblätter Von der Physik aus betrachtet.. Einführendes Experiment Die Kinematik
Biomechanik des Schwimmens
 Klaus Reischle Biomechanik des Schwimmens sport fahnemann verlag Bockenem Inhalt Vorwort 11 Einführung und Überblick 12 TEIL I: Technikbeschreibung und biomechanische Grundlagen 13 1 Einstieg: Beobachten,
Klaus Reischle Biomechanik des Schwimmens sport fahnemann verlag Bockenem Inhalt Vorwort 11 Einführung und Überblick 12 TEIL I: Technikbeschreibung und biomechanische Grundlagen 13 1 Einstieg: Beobachten,
Interaktives 3D Sportfernsehen
 Warum das Volumen eines 54-dimensionalen Hyperellipsoids und die Bewegungen des menschlichen Körpers eine bijektive Abbildung bilden können Cornelius Malerczyk, ZGDV, Darmstadt (1) Interaktives 3D Fernsehen
Warum das Volumen eines 54-dimensionalen Hyperellipsoids und die Bewegungen des menschlichen Körpers eine bijektive Abbildung bilden können Cornelius Malerczyk, ZGDV, Darmstadt (1) Interaktives 3D Fernsehen
Theoretische Mechanik
 Prof. Dr. R. Ketzmerick/Dr. R. Schumann Technische Universität Dresden Institut für Theoretische Physik Sommersemester 2008 Theoretische Mechanik 9. Übung 9.1 d alembertsches Prinzip: Flaschenzug Wir betrachten
Prof. Dr. R. Ketzmerick/Dr. R. Schumann Technische Universität Dresden Institut für Theoretische Physik Sommersemester 2008 Theoretische Mechanik 9. Übung 9.1 d alembertsches Prinzip: Flaschenzug Wir betrachten
M1 Maxwellsches Rad. 1. Grundlagen
 M1 Maxwellsches Rad Stoffgebiet: Translations- und Rotationsbewegung, Massenträgheitsmoment, physikalisches Pendel. Versuchsziel: Es ist das Massenträgheitsmoment eines Maxwellschen Rades auf zwei Arten
M1 Maxwellsches Rad Stoffgebiet: Translations- und Rotationsbewegung, Massenträgheitsmoment, physikalisches Pendel. Versuchsziel: Es ist das Massenträgheitsmoment eines Maxwellschen Rades auf zwei Arten
Hindernisumfahrung eines autonomen Roboters in einer unbekannten statischen Umgebung. Ronny Menzel
 Hindernisumfahrung eines autonomen Roboters in einer unbekannten statischen Umgebung. Ronny Menzel Inhalt Aufgabenstellung Begriffserklärung Hindernisumfahrungsstrategien Anforderungen an die Hindernisumfahrung
Hindernisumfahrung eines autonomen Roboters in einer unbekannten statischen Umgebung. Ronny Menzel Inhalt Aufgabenstellung Begriffserklärung Hindernisumfahrungsstrategien Anforderungen an die Hindernisumfahrung
Mechanische Schuhprüfung
 Mechanische Schuhprüfung Bestimmung der Dämpfungs- und Biegewiderstandseigenschaften testxpo, 23. Fachmesse für Prüftechnik Ulm, 15. Oktober 2014 Dr.-Ing. Gert Schlegel gert.schlegel@mb.tu-chemnitz.de
Mechanische Schuhprüfung Bestimmung der Dämpfungs- und Biegewiderstandseigenschaften testxpo, 23. Fachmesse für Prüftechnik Ulm, 15. Oktober 2014 Dr.-Ing. Gert Schlegel gert.schlegel@mb.tu-chemnitz.de
Gruppenarbeit Federn, Kräfte und Vektoren
 1 Gruppenarbeit Federn, Kräfte und Vektoren Abzugeben bis Woche 10. Oktober Der geschätzte Zeitaufwand wird bei jeder Teilaufgabe mit Sternen angegeben. Je mehr Sterne eine Aufgabe besitzt, desto grösser
1 Gruppenarbeit Federn, Kräfte und Vektoren Abzugeben bis Woche 10. Oktober Der geschätzte Zeitaufwand wird bei jeder Teilaufgabe mit Sternen angegeben. Je mehr Sterne eine Aufgabe besitzt, desto grösser
FEM-Modellbildung und -Berechnung von Kehlnähten
 FEM-Modellbildung und -Berechnung von Kehlnähten 1. Problemstellung und Lösungskonzept Die wesentliche Schwierigkeit bei der Berechnung einer Kehlnaht ist die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Geometrie
FEM-Modellbildung und -Berechnung von Kehlnähten 1. Problemstellung und Lösungskonzept Die wesentliche Schwierigkeit bei der Berechnung einer Kehlnaht ist die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Geometrie
Dynamografischer Messplatz zur Tiefstart-Leistungsdiagnose
 235 Dynamografischer Messplatz zur Tiefstart-Leistungsdiagnose Veit Wank, Hendrik Heger & Michael Schwarz Universität Tübingen, Institut für Sportwissenschaft Problemstellung Mit dem Tiefstart verfolgt
235 Dynamografischer Messplatz zur Tiefstart-Leistungsdiagnose Veit Wank, Hendrik Heger & Michael Schwarz Universität Tübingen, Institut für Sportwissenschaft Problemstellung Mit dem Tiefstart verfolgt
Grundlagen der Biomechanik
 Grundlagen der Biomechanik Was ist Biomechanik 1 Unter Biomechanik versteht man die Mechanik des menschlichen Körpers beim Sporttreiben. 2 Was ist Biomechanik 2 Bewegungen entstehen durch das Einwirken
Grundlagen der Biomechanik Was ist Biomechanik 1 Unter Biomechanik versteht man die Mechanik des menschlichen Körpers beim Sporttreiben. 2 Was ist Biomechanik 2 Bewegungen entstehen durch das Einwirken
Mehmet Maraz. MechanikNachhilfe
 Mehmet Maraz MechanikNachhilfe 1. Auflage 015 Inhaltsverzeichnis 1 Statik 1 1.1 Lagerungen und Lagerreaktionen................. 1. Kräftegleichgewichte......................... 5 1..1 Drehmoment.........................
Mehmet Maraz MechanikNachhilfe 1. Auflage 015 Inhaltsverzeichnis 1 Statik 1 1.1 Lagerungen und Lagerreaktionen................. 1. Kräftegleichgewichte......................... 5 1..1 Drehmoment.........................
LEE2: 2. Messung der Molrefraktion der Flüssigkeiten für die Bestimmung der Qualität des Rohmaterials
 ŠPŠCH Brno Erarbeitung berufspädagogischer Konzepte für die beruflichen Handlungsfelder Arbeiten im Chemielabor und Operator Angewandte Chemie und Lebensmittelanalyse LEE2: 2. Messung der Molrefraktion
ŠPŠCH Brno Erarbeitung berufspädagogischer Konzepte für die beruflichen Handlungsfelder Arbeiten im Chemielabor und Operator Angewandte Chemie und Lebensmittelanalyse LEE2: 2. Messung der Molrefraktion
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik im Dienstleistungsbereich
 WI 2013, Leipzig, Deutschland Automatische Rekonstruktion eines 3D Körpermodells aus Kinect Sensordaten, Jochen Süßmuth, Freimut Bodendorf Agenda Motivation Methode Ausblick 2 Problemstellung Onlineshopping
WI 2013, Leipzig, Deutschland Automatische Rekonstruktion eines 3D Körpermodells aus Kinect Sensordaten, Jochen Süßmuth, Freimut Bodendorf Agenda Motivation Methode Ausblick 2 Problemstellung Onlineshopping
VII. Inhaltsverzeichnis
 VII Inhaltsverzeichnis 1 Biomechanik - Definitionen, Aufgaben und Fragestellungen 1 1.1 Definition der Biomechanik 1 1.2 Grundaufbau des menschlichen Bewegungsapparats 1 1.2.1 Passiver Bewegungsapparat
VII Inhaltsverzeichnis 1 Biomechanik - Definitionen, Aufgaben und Fragestellungen 1 1.1 Definition der Biomechanik 1 1.2 Grundaufbau des menschlichen Bewegungsapparats 1 1.2.1 Passiver Bewegungsapparat
Thema: Die biomechanische Betrachtungsweise
 Thema: Die biomechanische Betrachtungsweise Definition: Die Biomechanik des Sports ist...... die Wissenschaft von der mechanischen Beschreibung und Erklärung der Erscheinungen und Ursachen von Bewegungen
Thema: Die biomechanische Betrachtungsweise Definition: Die Biomechanik des Sports ist...... die Wissenschaft von der mechanischen Beschreibung und Erklärung der Erscheinungen und Ursachen von Bewegungen
Das autinitymmd. Fallstudie Hochlauf App
 Das autinitymmd Mobile Maintenance Device Fallstudie Hochlauf App CMS CAQ ERP MES MMD Trsf. Fallstudie Hochlauf App Komponenten / Aufbau Laptop mit autinitymmd Apps Alternativ autinitymmd IFM VSE 002 mit
Das autinitymmd Mobile Maintenance Device Fallstudie Hochlauf App CMS CAQ ERP MES MMD Trsf. Fallstudie Hochlauf App Komponenten / Aufbau Laptop mit autinitymmd Apps Alternativ autinitymmd IFM VSE 002 mit
Messplatztraining zum Absprung im Kunstspringen
 185 1 Problem Falk Naundorf, Jürgen Krug (Projektleiter) & Katja Wenzel Universität Leipzig Sportwissenschaftliche Fakultät Der fehlende Nachweis der Wirksamkeit eines Messplatztrainings (MPT) stellt einen
185 1 Problem Falk Naundorf, Jürgen Krug (Projektleiter) & Katja Wenzel Universität Leipzig Sportwissenschaftliche Fakultät Der fehlende Nachweis der Wirksamkeit eines Messplatztrainings (MPT) stellt einen
Einführung in die Bewegungswissenschaft SS 2007
 Einführung in die SS 2007 Definition 2. des der Die ist die Wissenschaft von der mechanischen Beschreibung und Erklärung der Erscheinungen und Ursachen von Bewegungen im Sport unter Zugrundelegung der
Einführung in die SS 2007 Definition 2. des der Die ist die Wissenschaft von der mechanischen Beschreibung und Erklärung der Erscheinungen und Ursachen von Bewegungen im Sport unter Zugrundelegung der
Präzise Leistungs- und Performance-Bewertung von PV- Kraftwerken im laufenden Betrieb
 Präzise Leistungs- und Performance-Bewertung von PV- Kraftwerken im laufenden Betrieb Andreas Steinhüser, Björn Müller, Christian Reise Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme Heidenhofstraße 2,
Präzise Leistungs- und Performance-Bewertung von PV- Kraftwerken im laufenden Betrieb Andreas Steinhüser, Björn Müller, Christian Reise Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme Heidenhofstraße 2,
SolidLine-Launch-Day , Rodgau. Thema: virtuelle Produktentwicklung am Beispiel der KIESER AG, Zürich. daskernteam GbR, Modautal Start
 SolidLine-Launch-Day 08.10.2009, Rodgau Vortrag: Fit für Fitness Thema: virtuelle Produktentwicklung am Beispiel der KIESER AG, Zürich Autor: daskernteam GbR, Modautal Start Fit für Fitness virtuelle Produktentwicklung
SolidLine-Launch-Day 08.10.2009, Rodgau Vortrag: Fit für Fitness Thema: virtuelle Produktentwicklung am Beispiel der KIESER AG, Zürich Autor: daskernteam GbR, Modautal Start Fit für Fitness virtuelle Produktentwicklung
Mehrkörpersysteme. Eine Einführung in die Kinematik und Dynamik von Systemen starrer Körper. Bearbeitet von Christoph Woernle
 Mehrkörpersysteme Eine Einführung in die Kinematik und Dynamik von Systemen starrer Körper Bearbeitet von Christoph Woernle 1. Auflage 2011. Taschenbuch. XX, 396 S. Paperback ISBN 978 3 642 15981 7 Format
Mehrkörpersysteme Eine Einführung in die Kinematik und Dynamik von Systemen starrer Körper Bearbeitet von Christoph Woernle 1. Auflage 2011. Taschenbuch. XX, 396 S. Paperback ISBN 978 3 642 15981 7 Format
M0 BIO - Reaktionszeit
 M0 BIO - Reaktionszeit 1 Ziel des Versuches In diesem Versuch haben Sie die Möglichkeit, sich mit Messunsicherheiten vertraut zu machen. Die Analyse von Messunsicherheiten erfolgt hierbei an zwei Beispielen.
M0 BIO - Reaktionszeit 1 Ziel des Versuches In diesem Versuch haben Sie die Möglichkeit, sich mit Messunsicherheiten vertraut zu machen. Die Analyse von Messunsicherheiten erfolgt hierbei an zwei Beispielen.
1. Einfache ebene Tragwerke
 Die Ermittlung der Lagerreaktionen einfacher Tragwerke erfolgt in drei Schritten: Freischneiden Aufstellen der Gleichgewichtsbedingungen Auflösen der Gleichungen Prof. Dr. Wandinger 3. Tragwerksanalyse
Die Ermittlung der Lagerreaktionen einfacher Tragwerke erfolgt in drei Schritten: Freischneiden Aufstellen der Gleichgewichtsbedingungen Auflösen der Gleichungen Prof. Dr. Wandinger 3. Tragwerksanalyse
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR KARDIOLOGIE HERZ- UND KREISLAUFFORSCHUNG e.v. German Cardiac Society
 Vergleich zwischen Flächen- und Perimeter-basierter Bestimmung der effektiven Anulusgröße mit der direkten intraoperativen Messung Dr. Won-Keun Kim, Bad Nauheim Einleitung: Die präzise Messung des Aortenanulus
Vergleich zwischen Flächen- und Perimeter-basierter Bestimmung der effektiven Anulusgröße mit der direkten intraoperativen Messung Dr. Won-Keun Kim, Bad Nauheim Einleitung: Die präzise Messung des Aortenanulus
Anthropometrische Grundlagen für die Optimierung der Sitzposition im Radsport
 133 Anthropometrische Grundlagen für die Optimierung der Sitzposition im Radsport Björn Stapelfeldt (Projektleiter) & Malte Wangerin Universität Freiburg, Institut für Sport und Sportwissenschaft Problem
133 Anthropometrische Grundlagen für die Optimierung der Sitzposition im Radsport Björn Stapelfeldt (Projektleiter) & Malte Wangerin Universität Freiburg, Institut für Sport und Sportwissenschaft Problem
Bachelorprüfung MM I 8. März Vorname: Name: Matrikelnummer:
 Institut für Mechatronische Systeme Prof. Dr.-Ing. S. Rinderknecht Erreichbare Punktzahl: 40 Bearbeitungszeit: 80 Min Prüfung Maschinenelemente & Mechatronik I 8. März 2011 Rechenteil Name:... Matr. Nr.:...
Institut für Mechatronische Systeme Prof. Dr.-Ing. S. Rinderknecht Erreichbare Punktzahl: 40 Bearbeitungszeit: 80 Min Prüfung Maschinenelemente & Mechatronik I 8. März 2011 Rechenteil Name:... Matr. Nr.:...
Portfolio Management. Die Klusa Module. Aufgaben des Portfoliomanagements
 Die Klusa Module Die Projektmanagement-Software KLUSA ist in Module für das Projektmanagement, das Ressourcenmanagement, das Project Management Office (PMO), Zeiterfassung und weitere Bereiche gegliedert.
Die Klusa Module Die Projektmanagement-Software KLUSA ist in Module für das Projektmanagement, das Ressourcenmanagement, das Project Management Office (PMO), Zeiterfassung und weitere Bereiche gegliedert.
Modellierungsansatz für die realitätsnahe Abbildung der technischen Verfügbarkeit
 Modellierungsansatz für die realitätsnahe Abbildung der technischen Verfügbarkeit intralogistischer Systeme Dipl.-Logist. Eike-Niklas Jung Seite 1 / 20 Gliederung Motivation & Zielsetzung Grundlagen Merkmale
Modellierungsansatz für die realitätsnahe Abbildung der technischen Verfügbarkeit intralogistischer Systeme Dipl.-Logist. Eike-Niklas Jung Seite 1 / 20 Gliederung Motivation & Zielsetzung Grundlagen Merkmale
LASER-KONTUR- MESSUNG
 Sitronic LASER-KONTUR- MESSUNG LKM-700 LKM-900 LKM-1100 LKM-1400 2 LASER-KONTUR-MESSUNG RUNDHOLZ-MESSANLAGE Das Laser-Konturen-Messung LKM stellt ein komplettes Messsystem dar. Es dient zum berührungslosen
Sitronic LASER-KONTUR- MESSUNG LKM-700 LKM-900 LKM-1100 LKM-1400 2 LASER-KONTUR-MESSUNG RUNDHOLZ-MESSANLAGE Das Laser-Konturen-Messung LKM stellt ein komplettes Messsystem dar. Es dient zum berührungslosen
1. Grundlagen der ebenen Kinematik
 Lage: Die Lage eines starren Körpers in der Ebene ist durch die Angabe von zwei Punkten A und P eindeutig festgelegt. Die Lage eines beliebigen Punktes P wird durch Polarkoordinaten bezüglich des Bezugspunktes
Lage: Die Lage eines starren Körpers in der Ebene ist durch die Angabe von zwei Punkten A und P eindeutig festgelegt. Die Lage eines beliebigen Punktes P wird durch Polarkoordinaten bezüglich des Bezugspunktes
Überprüfung der Genauigkeit eines Fahrradtachos
 Überprüfung der Genauigkeit eines Fahrradtachos Stand: 26.08.2015 Jahrgangsstufen 7 Fach/Fächer Natur und Technik/ Schwerpunkt Physik Kompetenzerwartungen Die Schülerinnen und Schüler bestimmen experimentell
Überprüfung der Genauigkeit eines Fahrradtachos Stand: 26.08.2015 Jahrgangsstufen 7 Fach/Fächer Natur und Technik/ Schwerpunkt Physik Kompetenzerwartungen Die Schülerinnen und Schüler bestimmen experimentell
TEP. Impulsübertrag eines Balls aus dem freien Fall
 Impulsübertrag eines Balls TEP Lernziele und verwandte Themen Freier Fall, Impulsberechnung als Kraft pro Zeit, Impulsübertrag von bewegten Gegenständen, exponentielle Funktionen, wissenschaftliches experimentieren.
Impulsübertrag eines Balls TEP Lernziele und verwandte Themen Freier Fall, Impulsberechnung als Kraft pro Zeit, Impulsübertrag von bewegten Gegenständen, exponentielle Funktionen, wissenschaftliches experimentieren.
Entwicklung eines Messplatzes Synchronspringen vom 3-Meter-Brett
 229 1 Problem Falk Naundorf, Jürgen Krug (Projektleiter) & Katja Wenzel Universität Leipzig Sportwissenschaftliche Fakultät Das Synchronspringen vom 3-Meter-Brett und 10-Meter-Turm gehört seit den Olympischen
229 1 Problem Falk Naundorf, Jürgen Krug (Projektleiter) & Katja Wenzel Universität Leipzig Sportwissenschaftliche Fakultät Das Synchronspringen vom 3-Meter-Brett und 10-Meter-Turm gehört seit den Olympischen
Naturwissenschaftliches Praktikum. Rotation. Versuch 1.1
 Naturwissenschaftliches Praktikum Rotation Versuch 1.1 Inhaltsverzeichnis 1 Versuchsziel 3 2 Grundlagen 3 2.1 Messprinzip............................. 3 2.2 Energiesatz............................. 3 2.3
Naturwissenschaftliches Praktikum Rotation Versuch 1.1 Inhaltsverzeichnis 1 Versuchsziel 3 2 Grundlagen 3 2.1 Messprinzip............................. 3 2.2 Energiesatz............................. 3 2.3
Modellbildung und Simulation (ModBilSim)
 Name: Mat.Nr: Schriftliche Prüfung aus Modellbildung und Simulation (ModBilSim) Biomedizinische Informatik Schwerpunkt Bioinformatik Diplomingenieur-Studium UMIT, EWZ, Hall in Tirol Wichtige Hinweise:
Name: Mat.Nr: Schriftliche Prüfung aus Modellbildung und Simulation (ModBilSim) Biomedizinische Informatik Schwerpunkt Bioinformatik Diplomingenieur-Studium UMIT, EWZ, Hall in Tirol Wichtige Hinweise:
Mehrkörper-Simulation Theorie und Praxis
 Mehrkörper-Simulation Theorie und Praxis Josef Althaus NTB Buchs 4. Swiss VPE Symposium, 24. April 2013, Hochschule für Technik Rapperswil 1 Inhalt Was ist ein Mehrkörpersystem (MKS)? Grundlagen des Modellaufbaus
Mehrkörper-Simulation Theorie und Praxis Josef Althaus NTB Buchs 4. Swiss VPE Symposium, 24. April 2013, Hochschule für Technik Rapperswil 1 Inhalt Was ist ein Mehrkörpersystem (MKS)? Grundlagen des Modellaufbaus
4.6 Computergestütztes Aufstellen der Bewegungsgleichungen
 Computergestütztes Aufstellen der Bewegungsgleichungen 91 4.6 Computergestütztes Aufstellen der Bewegungsgleichungen Die Schwierigkeit bei der Herleitung der dynamischen Gleichungen komplexer Mehrkörpersysteme
Computergestütztes Aufstellen der Bewegungsgleichungen 91 4.6 Computergestütztes Aufstellen der Bewegungsgleichungen Die Schwierigkeit bei der Herleitung der dynamischen Gleichungen komplexer Mehrkörpersysteme
Betrachtungsweisen von Bewegungen
 n von Bewegungen 1. Bewegungen von außen u. innen 2. Morphologischer Ansatz 3. Biomechanische 4. Funktionsanalytischer Ansatz Ad 1. Außen- Innenaspekt Außenaspekt Wie lässt sich Bewegung beschreiben? Welche
n von Bewegungen 1. Bewegungen von außen u. innen 2. Morphologischer Ansatz 3. Biomechanische 4. Funktionsanalytischer Ansatz Ad 1. Außen- Innenaspekt Außenaspekt Wie lässt sich Bewegung beschreiben? Welche
Simulationsgestützte tzte Auslegung von Lineardirektantrieben mit MAXWELL, SIMPLORER und ANSYS. Matthias Ulmer, Universität Stuttgart
 Simulationsgestützte tzte Auslegung von Lineardirektantrieben mit MAXWELL, SIMPLORER und ANSYS Matthias Ulmer, Universität Stuttgart Gliederung 1. Motivation und Zielsetzung 2. Elektrodynamische Lineardirektantriebe
Simulationsgestützte tzte Auslegung von Lineardirektantrieben mit MAXWELL, SIMPLORER und ANSYS Matthias Ulmer, Universität Stuttgart Gliederung 1. Motivation und Zielsetzung 2. Elektrodynamische Lineardirektantriebe
Schwimmen. 1. Allgemeiner Teil
 1. Allgemeiner Teil 1.1 Bedeutung des s wird zu den gesündesten Freizeitbetätigungen gezählt und gilt auch als Sportart mit geringem Verletzungsrisiko. Durch den Auftrieb im Wasser wird der Körper unterstützt
1. Allgemeiner Teil 1.1 Bedeutung des s wird zu den gesündesten Freizeitbetätigungen gezählt und gilt auch als Sportart mit geringem Verletzungsrisiko. Durch den Auftrieb im Wasser wird der Körper unterstützt
Grundlagen der Biomechanik
 Grundlagen der Biomechanik Was ist Biomechanik 1 Unter Biomechanik versteht man die Mechanik des menschlichen Körpers beim Sporttreiben. 3 Was ist Biomechanik 2 Bewegungen entstehen durch das Einwirken
Grundlagen der Biomechanik Was ist Biomechanik 1 Unter Biomechanik versteht man die Mechanik des menschlichen Körpers beim Sporttreiben. 3 Was ist Biomechanik 2 Bewegungen entstehen durch das Einwirken
Umstellung, Umlernen und Umstrukturierung von hochgeübten sportlichen Bewegungen
 225 Umstellung, Umlernen und Umstrukturierung von hochgeübten sportlichen Bewegungen R. Daugs 1 (Projektleiter), St. Panzer 2, A. Ehrig 3, A. Toews 1, K. Fieguth 1 1 Sportwissenschaftliches Institut der
225 Umstellung, Umlernen und Umstrukturierung von hochgeübten sportlichen Bewegungen R. Daugs 1 (Projektleiter), St. Panzer 2, A. Ehrig 3, A. Toews 1, K. Fieguth 1 1 Sportwissenschaftliches Institut der
Computergestützte Videoanalyse sportlicher Bewegungen
 Institut für Sportwissenschaft Computergestützte Videoanalyse sportlicher Bewegungen Veranstaltungsreihe Praxis trifft Sportwissenschaft Universität Landau, 25. November 2009 Ingo Keller Bewegungswissenschaft
Institut für Sportwissenschaft Computergestützte Videoanalyse sportlicher Bewegungen Veranstaltungsreihe Praxis trifft Sportwissenschaft Universität Landau, 25. November 2009 Ingo Keller Bewegungswissenschaft
Technische Mechanik Dynamik
 Hans Albert Richard Manuela Sander Technische Mechanik Dynamik Grundlagen - effektiv und anwendungsnah Mit 135 Abbildungen Viewegs Fachbiicher der Technik vieweg VII VII 1 Fragestellungen der Dynamik 1
Hans Albert Richard Manuela Sander Technische Mechanik Dynamik Grundlagen - effektiv und anwendungsnah Mit 135 Abbildungen Viewegs Fachbiicher der Technik vieweg VII VII 1 Fragestellungen der Dynamik 1
Validierung von KLiC Trainingsaktivitäten "Online-Fragebogen für Sch... StudentInnen, LehrerInnen, HochschulmitarbeiterInnen sowie SportlerInnen"
 1 von 8 09.06.2011 10:46 Validierung von KLiC Trainingsaktivitäten "Online- Fragebogen für SchülerInnen, StudentInnen, LehrerInnen, HochschulmitarbeiterInnen sowie SportlerInnen" Dieser Fragebogen ist
1 von 8 09.06.2011 10:46 Validierung von KLiC Trainingsaktivitäten "Online- Fragebogen für SchülerInnen, StudentInnen, LehrerInnen, HochschulmitarbeiterInnen sowie SportlerInnen" Dieser Fragebogen ist
Beispiel 1:Der Runge-Lenz Vektor [2 Punkte]
![Beispiel 1:Der Runge-Lenz Vektor [2 Punkte] Beispiel 1:Der Runge-Lenz Vektor [2 Punkte]](/thumbs/59/43248755.jpg) Übungen Theoretische Physik I (Mechanik) Blatt 9 (Austeilung am: 1.9.11, Abgabe am 8.9.11) Hinweis: Kommentare zu den Aufgaben sollen die Lösungen illustrieren und ein besseres Verständnis ermöglichen.
Übungen Theoretische Physik I (Mechanik) Blatt 9 (Austeilung am: 1.9.11, Abgabe am 8.9.11) Hinweis: Kommentare zu den Aufgaben sollen die Lösungen illustrieren und ein besseres Verständnis ermöglichen.
Aesculap Orthopaedics Patienteninformation
 Aesculap Orthopaedics Patienteninformation Hüftoperation mit dem OrthoPilot Das Navigationssystem OrthoPilot ermöglicht eine optimierte Implantation des künstlichen Hüftgelenks Patienteninformation Hüftoperation
Aesculap Orthopaedics Patienteninformation Hüftoperation mit dem OrthoPilot Das Navigationssystem OrthoPilot ermöglicht eine optimierte Implantation des künstlichen Hüftgelenks Patienteninformation Hüftoperation
Inverse Kinematik am Robotersimulationsprogramm
 Inverse Kinematik am Robotersimulationsprogramm EASY-ROB Problemstellung Kinematiken in EASY-ROB Vorwärtstransformation Inverse Transformation Numerisches Lösungsverfahren zur inversen Transformation Kombination
Inverse Kinematik am Robotersimulationsprogramm EASY-ROB Problemstellung Kinematiken in EASY-ROB Vorwärtstransformation Inverse Transformation Numerisches Lösungsverfahren zur inversen Transformation Kombination
1 Einleitung Historie und Anwendungsgebiete Elemente der Mehrkörperdynamik... 2 Literatur... 2
 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 1 1.1 Historie und Anwendungsgebiete...... 1 1.2 Elemente der Mehrkörperdynamik..... 2 Literatur...... 2 2 Dynamik des starren Körpers... 3 2.1 Lagebeschreibung......
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 1 1.1 Historie und Anwendungsgebiete...... 1 1.2 Elemente der Mehrkörperdynamik..... 2 Literatur...... 2 2 Dynamik des starren Körpers... 3 2.1 Lagebeschreibung......
Intelligente Energieversorgung in Gebäuden
 Intelligente Energieversorgung in Gebäuden durch individuelle Energiemanagementsysteme Thomas Hofmann 27.092016 1 Copyright ESI Copyright Group, 2016. ESI Group, All rights 2016. reserved. All rights reserved.
Intelligente Energieversorgung in Gebäuden durch individuelle Energiemanagementsysteme Thomas Hofmann 27.092016 1 Copyright ESI Copyright Group, 2016. ESI Group, All rights 2016. reserved. All rights reserved.
4.9 Der starre Körper
 4.9 Der starre Körper Unter einem starren Körper versteht man ein physikalische Modell von einem Körper der nicht verformbar ist. Es erfolgt eine Idealisierung durch die Annahme, das zwei beliebig Punkte
4.9 Der starre Körper Unter einem starren Körper versteht man ein physikalische Modell von einem Körper der nicht verformbar ist. Es erfolgt eine Idealisierung durch die Annahme, das zwei beliebig Punkte
Seilzug- und Freihanteltraining
 w w w. a c a d e m y o f s p o r t s. d e w w w. c a m p u s. a c a d e m y o f s p o r t s. d e Seilzug- und Freihanteltraining L E H R S K R I P T online-campus Auf dem Online Campus der Academy of Sports
w w w. a c a d e m y o f s p o r t s. d e w w w. c a m p u s. a c a d e m y o f s p o r t s. d e Seilzug- und Freihanteltraining L E H R S K R I P T online-campus Auf dem Online Campus der Academy of Sports
Vorteile der raumakustischen Simulation bei der Gestaltung von Aufnahme-, Regie-, und Bearbeitungsräumen
 Vorteile der raumakustischen Simulation bei der Gestaltung von Aufnahme-, Regie-, und Bearbeitungsräumen (Advantages of room acoustical simulation for the design of recording and control rooms) Sebastian
Vorteile der raumakustischen Simulation bei der Gestaltung von Aufnahme-, Regie-, und Bearbeitungsräumen (Advantages of room acoustical simulation for the design of recording and control rooms) Sebastian
Mehrkomponenten-Messplattform
 Kraft Mehrkomponenten-Messplattform Typ 9260AA... für Gang- und Gleichgewichtsanalyse in der Biomechanik, F z 0... 5 kn Kostengünstige Mehrkomponenten-Messplattform mit Aluminium Deckplatte in Sandwichbauweise
Kraft Mehrkomponenten-Messplattform Typ 9260AA... für Gang- und Gleichgewichtsanalyse in der Biomechanik, F z 0... 5 kn Kostengünstige Mehrkomponenten-Messplattform mit Aluminium Deckplatte in Sandwichbauweise
8.1 Gleichförmige Kreisbewegung 8.2 Drehung ausgedehnter Körper 8.3 Beziehung: Translation - Drehung 8.4 Vektornatur des Drehwinkels
 8. Drehbewegungen 8.1 Gleichförmige Kreisbewegung 8.2 Drehung ausgedehnter Körper 8.3 Beziehung: Translation - Drehung 8.4 Vektornatur des Drehwinkels 85 8.5 Kinetische Energie der Rotation ti 8.6 Berechnung
8. Drehbewegungen 8.1 Gleichförmige Kreisbewegung 8.2 Drehung ausgedehnter Körper 8.3 Beziehung: Translation - Drehung 8.4 Vektornatur des Drehwinkels 85 8.5 Kinetische Energie der Rotation ti 8.6 Berechnung
Reinhild Kemper, Josefine Kliebes-Fischer (Red.) Reinhild Kemper, Dieter Teipel. Reinhild Kemper, Dieter Teipel
 Reinhild Kemper, Josefine Kliebes-Fischer (Red.) Inklusion in Bewegung: Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam im Sport. (Herausgeber: Fachausschuss Wissenschaft, Special Olympics Deutschland e.v.
Reinhild Kemper, Josefine Kliebes-Fischer (Red.) Inklusion in Bewegung: Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam im Sport. (Herausgeber: Fachausschuss Wissenschaft, Special Olympics Deutschland e.v.
Simulation als epistemologische Grundlage für intelligente Roboter
 1 Simulation als epistemologische Grundlage für intelligente Roboter Andreas Tolk The MITRE Corporation Umut Durak Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.v. (DLR) Public Release No. 17-0085 2017 The
1 Simulation als epistemologische Grundlage für intelligente Roboter Andreas Tolk The MITRE Corporation Umut Durak Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.v. (DLR) Public Release No. 17-0085 2017 The
1 Einleitung Historie Elemente der Mehrkörperdynamik Anwendungsgebiete... 3 Literatur... 4
 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 1 1.1 Historie... 1 1.2 Elemente der Mehrkörperdynamik... 2 1.3 Anwendungsgebiete... 3 Literatur... 4 2 Dynamik des starren Körpers... 5 2.1 Lagebeschreibung... 6 2.1.1
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 1 1.1 Historie... 1 1.2 Elemente der Mehrkörperdynamik... 2 1.3 Anwendungsgebiete... 3 Literatur... 4 2 Dynamik des starren Körpers... 5 2.1 Lagebeschreibung... 6 2.1.1
PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FÜR ANFÄNGER LGyGe
 1.9.08 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FÜR ANFÄNGER LGyGe Versuch: O 2 - Linsensysteme Literatur Eichler, Krohnfeld, Sahm: Das neue physikalische Grundpraktikum, Kap. Linsen, aus dem Netz der Universität http://dx.doi.org/10.1007/3-540-29968-8_33
1.9.08 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FÜR ANFÄNGER LGyGe Versuch: O 2 - Linsensysteme Literatur Eichler, Krohnfeld, Sahm: Das neue physikalische Grundpraktikum, Kap. Linsen, aus dem Netz der Universität http://dx.doi.org/10.1007/3-540-29968-8_33
Rotation von torischen IOLs bei Kapselsackschrumpfung
 125 Rotation von torischen IOLs bei Kapselsackschrumpfung Simulation E. Roth Einleitung Wie an anderer Stelle bereits näher beschrieben, entwickelten wir eine Simulationsvorrichtung, die es erlaubt, das
125 Rotation von torischen IOLs bei Kapselsackschrumpfung Simulation E. Roth Einleitung Wie an anderer Stelle bereits näher beschrieben, entwickelten wir eine Simulationsvorrichtung, die es erlaubt, das
Abschlussbericht zu Kennziffer 2472: Experimentelle Bestimmung von Grenzaktivitätskoeffizienten in ternären und höheren Elektrolytsystemen
 Abschlussbericht zu Kennziffer 2472: Experimentelle Bestimmung von Grenzaktivitätskoeffizienten in ternären und höheren Elektrolytsystemen Während es bei Nichtelektrolytsystemen möglich ist, mit Hilfe
Abschlussbericht zu Kennziffer 2472: Experimentelle Bestimmung von Grenzaktivitätskoeffizienten in ternären und höheren Elektrolytsystemen Während es bei Nichtelektrolytsystemen möglich ist, mit Hilfe
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR. Antriebssysteme und Exoskelette
 FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR Produktionstechnik und Automatisierung IPA Antriebssysteme und Exoskelette MOTIVATION ANGEBOT Mobilität ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen und gerät durch den voranschreitenden
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR Produktionstechnik und Automatisierung IPA Antriebssysteme und Exoskelette MOTIVATION ANGEBOT Mobilität ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen und gerät durch den voranschreitenden
1. Bewegungsgleichung
 1. Bewegungsgleichung 1.1 Das Newtonsche Grundgesetz 1.2 Dynamisches Gleichgewicht 1.3 Geführte Bewegung 1.4 Massenpunktsysteme 1.5 Schwerpunktsatz Prof. Dr. Wandinger 2. Kinetik des Massenpunkts Dynamik
1. Bewegungsgleichung 1.1 Das Newtonsche Grundgesetz 1.2 Dynamisches Gleichgewicht 1.3 Geführte Bewegung 1.4 Massenpunktsysteme 1.5 Schwerpunktsatz Prof. Dr. Wandinger 2. Kinetik des Massenpunkts Dynamik
