Diplomarbeit. Titel der Arbeit. ImpostorInnen kommen zu Wort. Das Impostor Phänomen im Arbeitsumfeld Hochschule. Verfasser. Moritz Karl Hagedorn, BA
|
|
|
- Franka Franke
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Diplomarbeit Titel der Arbeit ImpostorInnen kommen zu Wort. Das Impostor Phänomen im Arbeitsumfeld Hochschule Verfasser Moritz Karl Hagedorn, BA Angestrebter akademischer Grad Magister der Naturwissenschaften (Mag. rer. nat.) Wien, im April 2015 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 298 Studienrichtung lt. Studienblatt: Betreut von: Psychologie Univ.-Prof. Dipl.-Psych. Dr. Barbara Schober
2
3 Danksagung Meiner Diplomarbeitsbetreuerin Prof. in Barbara Schober danke ich für den großen Freiraum, den sie mir in der Bearbeitung meines Themas zugestanden hat und das äußerst wertvolle Feedback zu den richtigen Zeitpunkten. Herzlicher Dank gebührt auch dem Team des Arbeitsbereichs für Bildungspsychologie und Evaluation, bei dem ich jederzeit auf offene Ohren für meine Fragen gestoßen bin. Insbesondere Marlene Kollmayer, Monika Finsterwald und Gregor Jöstl haben mit ihrer fachlichen Kompetenz, ihrem hohen zeitlichen Einsatz und ihrer Begeisterung für meine Forschung entscheidend zum Gelingen dieser Abschlussarbeit beigetragen. Große Anteile hält auch mein Diplomarbeitspartner Andreas Zall, der mit seiner bedingungslosen Bereitschaft zum Teilen seines Wissens und seinem kritischen Geist die Qualität beträchtlich gesteigert hat. Bei lebhaften Diskussionen und fruchtbaren Reflexionen ist er mir ein guter Freund geworden. Der vielleicht größte Dank gebührt meinen Eltern Susanne Spatz und Bernd-Olaf Hagedorn, die mich über meinen ganzen Ausbildungsweg hinweg bedingungslos unterstützt und in meinen Entscheidungen bestärkt haben. Gerade in der heißen Schreibphase dieser Arbeit standen sie mir mit wertvollem Feedback zur Seite und hielten mir den Rücken frei. Außerdem danke ich meiner Schwester Carolin Hagedorn für stetige Ermutigung und guten Zuspruch in dieser herausfordernden Zeit. Stellvertretend für die vielen von euch, die mir über das gesamte Studium hinweg und insbesondere in der Diplomarbeitsphase treue FreundInnen waren, danke ich Verena Giesinger und Lukas Steinbach. Danke für die Stunden der Aufmunterung in schwierigen Phasen und das Teilen meiner Freude über erzielte Erfolge.
4
5 Inhaltsverzeichnis Abstract... 1 Kurzzusammenfassung... 2 Einleitung Das Impostor Phänomen Definition Das Impostor Profil Das Impostor Phänomen als psychologische Barriere für Erfolg und Leistung Affektive Komponenten des IP Anspruch die oder der Beste zu sein Superfrau- bzw. Superman Komplex Angst vor Misserfolg Attribution und Einschätzung der Fähigkeiten Angst vor Erfolg Schlussfolgerung Das Impostor Phänomen im Kontext Wissenschaft Prävalenz und Ausmaß der Ausprägung Geschlechtsunterschiede Akademisches Alter Der WissenschaftlerInnenbegriff Wissenschaft als Beruf: Das IP im Arbeitsumfeld Hochschule Aufgabengebiete von WissenschaftlerInnen in Hochschulanstellung Strukturelle Rahmenbedingungen des Arbeitsplatzes Hochschule Arbeitsbedingungen an der Hochschule Konkurrenz im Arbeitsumfeld Arbeitskontext unter Leistungsevaluation Enttäuschung des Arbeitsumfeldes Konflikte zwischen Arbeits- und Privatleben Unbekannte Herausforderung und IP Austausch über Schwierigkeiten Soziale Unterstützung Feedback Unterschiede zur Mehrheit der KollegInnen... 28
6 4 Zielsetzung und Forschungsfragen Allgemeine Zielsetzung Forschungsfragen Forschungsfrage 1: Ausprägung des IP bei Doktoratsstudierenden Forschungsfrage 2: Aspekte des Arbeitsumfeldes Hochschule in Zusammenhang mit dem IP Forschungsfrage 3: Austausch über Schwierigkeiten Forschungsfrage 4: Soziale Unterstützung aus dem Arbeitsumfeld Forschungsfrage 5: Feedback Forschungsfrage 6: Unterschiede zur Mehrheit der KollegInnen Forschungsfrage 7: Charakteristika des IP zu Doktoratsbeginn Forschungsfrage 8: Zukünftige berufliche Perspektive Methode Untersuchungsdesign Durchführung Erhebung der quantitativen Daten mittels Online-Fragebogen Erhebung der qualitativen Daten mittels problemzentriertem Interview Stichprobenbeschreibung Gesamtstichprobe Teilstichprobe DoktorandInnen in Hochschulanstellung Teilstichprobe InterviewpartnerInnen Konstruktion des Onlinefragebogens Erhebung des Impostor Phänomens Skalen zur Erfassung von Aspekten des Arbeitsumfeldes Hochschule Konstruktion des Interviewleitfadens und Durchführung der Interviews Quantitative Auswertungsverfahren Analyse der Skalen Definition der Gruppen von ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring Ablauf der Analyse Kategoriensysteme Ergebnisse Forschungsfrage 1: Ausprägung des IP bei Doktoratsstudierenden Das IP bei DoktorandInnen im Arbeitsumfeld Hochschule... 65
7 6.2.1 Forschungsfrage 2: Aspekte des Arbeitsumfeldes Hochschule in Zusammenhang mit dem IP Forschungsfrage 3: Austausch über Schwierigkeiten im Arbeitsalltag Forschungsfrage 4: Soziale Unterstützung aus dem Arbeitsumfeld Forschungsfrage 5: Feedback Forschungsfrage 6: Unterschiede zur Mehrheit der KollegInnen Forschungsfrage 7: Charakteristika des IP zu Doktoratsbeginn Forschungsfrage 8: Zukünftige berufliche Perspektive Diskussion Interpretation der Ergebnisse Praktische Implikationen Intervention auf Mikroebene: DoktorandInnencoaching Prävention und Intervention auf Mesoebene: Mentoring Programme für DoktorandInnen Limitationen Forschungsausblick Literatur Tabellenverzeichnis Abbildungsverzeichnis Anhang
8
9 Abstract The impostor phenomenon (IP) concerns high achievers, who feel being intellectual frauds contrary to any objective evidence. Confronted with an achievement related task, people affected by the IP suffer the fear their perceived fraudulence could be revealed by others. Besides a negative effect on wellbeing, the consequences are linked to lower performance and success. Recent research has shown that scientists employed at university report stronger impostor feelings than external researchers. Taking these results as a reason, the present study investigates relationships of variables regarding the work environment with the IP. This approach represents the first examination of the IP related to environmental factors. Within the framework of an explorative mixed method design the extent of the IP was conducted in doctoral students (N = 561) by completing an online questionnaire at first. Furthermore those employed at the university (n = 247) where surveyed within that questionnaire and some (n = 19) additionally in problem-centered interviews, both regarding aspects of the work environment that where theoretically assumed to be linked to the IP. The results replicate findings whereupon university employed researchers and female scientists suffer more from the IP than males and those writing their thesis without tenure. Regarding work environment, doctoral students with faculty membership affected by the IP reported less emotional support and a stronger necessity to disappoint colleges because of limited temporal resources than doctoral students without the IP. In the interviews those who were affected by the IP additionally described to lack mentoring and communication about difficulties in job as well as feedback. Furthermore, they perceive distinctions between themselves and colleges more frequently. Facing these findings, the consideration of environmental variables in future research on the IP is advised. Keywords: impostor phenomenon, work environment, academic environment, gender differences, mixed method 1
10 Kurzzusammenfassung Unter dem Impostor Phänomen leiden SpitzenleisterInnen, die sich entgegen jeglicher Evidenz als intellektuelle HochstaplerInnen fühlen. Angesichts einer leistungsbezogenen Aufgabe schürt die Selbstwahrnehmung eines vermeintlichen Betruges Ängste vor dessen Enthüllung durch andere. Neben dem Wohlbefinden schmälern die Folgen des IP Leistungen und Erfolge von Betroffenen. Neuere Befunde zeigen, dass an der Hochschule beschäftigte WissenschaftlerInnen in höherem Ausmaß vom IP betroffen sind als externe ForscherInnen. Dies zum Anlass nehmend, untersucht die vorliegende Studie Zusammenhänge des Arbeitsumfeldes mit dem IP und stellt dessen erste systematische Erhebung in Bezug auf Umgebungsvariablen ins Zentrum des Interesses. Im Rahmen eines explorativen Mixed Method Designs wurde das Ausmaß des IP zunächst mittels Onlinefragebogen bei DoktorandInnen (N = 561) erhoben. Weiters wurden hochschulbeschäftigte Promovierende (n = 247) in diesem Schritt der Erhebung und zusätzlich in problemzentrierten Interviews (n = 19) zu Aspekten des Arbeitsumfeldes befragt, die als in Verbindung mit dem IP stehend vermutet wurden. Die Ergebnisse replizieren Forschungsbefunde, wonach hochschulangestellte DoktorandInnen und insbesondere Frauen in dieser Population in hohem Ausmaß unter dem IP leiden. Bezüglich des Arbeitsumfeldes berichteten vom IP betroffene Hochschulangestellte von geringerer emotionaler Unterstützung und häufiger von dem Umstand, aufgrund knapper zeitlicher Ressourcen, das Arbeitsumfeld enttäuschen zu müssen. Hypothesenkonform beschrieben unter dem IP Leidende im Interview, seltener über MentorInnen zu verfügen, Austausch über berufsbezogene Schwierigkeiten in geringerem Ausmaß zu erleben, seltener Feedback zu erhalten sowie vermehrt Unterschiede zwischen sich und den KollegInnen wahrzunehmen. Angesichts dieser Forschungsbefunde wird zur Berücksichtigung von Variablen des Umfeldes in der zukünftigen Forschung zum IP geraten. Schlüsselbegriffe: Impostor Phänomen, Arbeitsumfeld, akademisches Umfeld, Geschlechtsunterschiede, Mixed Method 2
11 Einleitung Vor jedem ersten Wort bleibt die Zeit für einen Moment stehen. Mein Herz rast. Und pumpt mit Hochdruck die dollsten Versagensängste, Selbstzweifel und Fluchtgedanken ins Hirn. Warum bloß haben die beim SPIEGEL mich eingestellt? Wer sagt denn, dass ich schreiben kann? Mülltonne, verschlucke mein Werk, bevor sich alle darüber lustig machen! (Kistner, 2014) Die Journalistin des renommierten deutschen Wochenmagazins DER SPIEGEL beschreibt mit diesem Zitat das Erleben des Moments, in dem sie mit dem Verfassen eines Artikels beginnt. Wie viele andere SpitzenleisterInnen leidet sie unter dem sogenannten Impostor Phänomen (IP), welches im deutschsprachigen Raum medial besonders im in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erhielt (z.b. Austria Presse Agentur, 2012; Deutsche Presse- Agentur, 2014; Volk, 2014). Vom IP betroffene Personen (in weiterer Folge Impostorin bzw. Impostor genannt) erleben sich entgegen jeglicher objektiver Evidenz als intellektuelle HochstaplerInnen bezüglich ihrer Erfolge und beruflichen Position. Wie auch von Kistner (2014) im obigen Zitat eindrücklich geschildert, verspüren sie Angst vor der Enthüllung des vermeintlichen Betruges, sobald sie mit einer an Leistung gebundenen Aufgabe konfrontiert werden. In Reaktion auf diese Angst handeln Betroffene mit Übervorbereitung oder selbsthinderlichem Verhalten, welches zum Wohnbefinden zusätzlich auch die Leistungsfähigkeit einschränkt. Erfolge schreiben sie Glück oder der investierten Anstrengung zu, während sie Misserfolge auf ihre mangelnden Fähigkeiten zurückführen (Clance, 1985; Clance & Imes, 1978). In den Fokus der Bildungspsychologie rückt das IP, da es Leistungen und Erfolge von Betroffenen eingeschränkt. Empirische Studien belegen, dass Neurotizismus bei ImpostorInnen stärker ausgeprägt ist (Bernard, Dollinger, & Ramaniah, 2002) und sich weiters negativ auf Studienleistungen auswirkt (Surtees, Wainwright, & Pharoah, 2002). Jöstl, Bergsmann, Lüftenegger, Schober und Spiel (2012) fanden, dass unter dem IP Leidende eine niedrigere Selbstwirksamkeit aufweisen, was nach Zimmerman (2000) die akademische Produktivität unmittelbar beeinträchtigt. Zudem ist das bei ImpostorInnen verbreitete Erleben von leistungsbezogener Angst (Thompson, Foreman, & Martin, 2000) und depressionsähnlicher Symptomatik (McGregor, Gee, & Posey, 2008) mit verminderter akademischer Leistung assoziiert (Andrews & Wilding, 2004). 3
12 Eine aktuelle Studie belegt die starke Verbreitung des IP insbesondere unter jenen WissenschaftlerInnen, die im Arbeitsumfeld Hochschule beschäftigt sind (Jöstl et al., 2012). Dieser Befund zeigt einen blinden Fleck in der bisherigen IP Forschung: Den Einfluss von Umgebungsfaktoren auf die Entstehung und Aufrechterhaltung des IP. Die vorliegende Arbeit beschreibt erstmalig eine systematische Untersuchung des IP unter WissenschaftlerInnen, die den Fokus auf mögliche Zusammenhänge mit dem Arbeitsumfeld Hochschule richtet. Neben der Untersuchung des Ausmaßes der Ausprägung unter DoktorandInnen wird erhoben, in welcher Form das IP mit Konkurrenz im Arbeitsumfeld (z.b. Craddock, Birnbaum, Rodriguez, Cobb, & Zeeh, 2011), der Wahrnehmung von Leistungsevaluation (z.b. Jöstl et al., 2012), Enttäuschungen des Arbeitsumfeldes sowie Konflikten zwischen Arbeits- und Privatleben, Austausch über Schwierigkeiten (Klinkhammer & Saul-Soprun, 2009), sozialer Unterstützung (z.b. Parkman & Beard, 2008), Feedback (z.b. Brems, Baldwin, Davis, & Namyniuk, 1994) und wahrgenommenen Unterschieden zur Mehrheit der KollegInnen (Harvey & Katz, 1985) in Zusammenhang steht. Ziel der Studie ist es, das IP bei WissenschaftlerInnen im Arbeitsumfeld Hochschule besser zu verstehen. Die lückenhafte empirische Forschung zu den oben aufgeführten Aspekten des Gegenstandes spricht für einen eher explorativen Untersuchungsansatz. Im Rahmen eines Mixed Method Designs wird das IP deshalb erstmals in einer Kombination qualitativer und quantitativer Erhebungsinstrumente beforscht. Die so gewonnene Datenbasis ermöglicht es, das IP bezüglich Faktoren des Hochschulumfeldes in seiner Breite abzubilden. Das methodische Herzstück bilden problemzentrierte Interviews mit ImpostorInnen und Nicht- ImpostorInnen, deren Schilderungen des Erlebens ihres Arbeitsumfeldes dieser Studie den Titel verleihen. 4
13 1 Das Impostor Phänomen In diesem Kapitel werden der Untersuchungsgegenstand (Kapitel 1.1) sowie dessen Kerncharakteristika (Kapitel 1.2) definiert. Auf Basis dieser Darstellungen wird in Abschnitt 1.3 der bisherige Forschungsstand zum Impostor Phänomen mit einem spezifischen Fokus auf dessen Auswirkungen für individuellen Erfolg und Leistung abgebildet. 1.1 Definition Das in der Wissenschaft unter Impostor Phänomen bekannte psychologische Konstrukt beschreibt einen Erlebniszustand, bei dem sich Betroffene, die objektiv sehr gute Leistungen erbringen und verdientermaßen einen hohen Status genießen, in der Selbstwahrnehmung vorwerfen, ihre Leistungen und Erfolge durch Betrug erschlichen zu haben (Clance & Imes, 1978). Unter dem IP leidende Personen neigen dazu, Erfolge external, sprich auf Glück bzw. Zufall zu attribuieren (Clance & Imes, 1978; Kumar & Jagacinski, 2006) und ihre Fähigkeiten abzuwerten (Bernard et al., 2002). In ihrer subjektiven Wahrnehmung täuschen ImpostorInnen ihr Umfeld bezüglich ihrer intellektuellen Fähigkeiten, was zu diffusen Ängsten vor der Enthüllung des vermeintlichen Betruges bei Betroffenen führt. Die Frage nach dem How good am I really? (Clance, 1985, S. 25) ist bei ImpostorInnen stetig präsent. Die mit dem IP assoziierten Folgen reichen vom Erleben allgemein negativer Emotionen (z.b. Cozzarelli & Major, 1990) über einen niedrigen Selbstwert (z.b. Sonnak & Towell, 2001) bis hin zu Zusammenhängen mit dem klinischen Störungsbild der Depression (z.b. Bernard et al., 2002). Zudem münden sie in dysfunktionale Arbeits- und Verhaltensmuster (z.b. Ferrari & Thompson, 2006; Want & Kleitman, 2006). Das IP wurde zuerst von Clance und Imes (1978) in einem psychologisch-therapeutischen Setting bei über 150 hochleistenden Frauen beobachtet, die im wissenschaftlichen Kontext tätig waren. Alle Betroffenen hatten gemein, dass sie in ihren verschiedenen Fachdisziplinen formal hoch qualifiziert und in ihrer Tätigkeit äußert erfolgreich waren. Was in der ersten Publikation zum IP noch auf allgemein hoch gesteckte Leistungsstandards zurückgeführt wurde, beschreibt Pauline Clance (1985) in weiteren Publikationen als ein umfassendes Konstrukt mit sechs Merkmalen, welches als Impostor Profil bekannt wurde. 5
14 Auf Basis dessen entwickelte die Autorin mit der Clance Impostor Scale (CIPS) zudem ein Instrument, welches das IP quantitativ empirisch untersuchbar macht. In den folgenden Kapiteln werden die Charakteristika des IP im Impostor Profil und deren empirische Grundlage mit Blick auf dessen Potential als psychologische Barriere für Erfolg und Leistung beschrieben. 1.2 Das Impostor Profil Clance (1985) beschreibt die Wirkmechanismen des IP mittels sechs Charakteristika. Unter dem IP leiden laut ihren Ausführungen jene Personen, auf die zwei bis drei der Charakteristika zutreffen. Diese Kategorisierung entbehrt jedoch sowohl einer empirischen, als auch einer theoretischen Grundlage. Der Impostor Kreislauf bildet die Charakteristika des IP in seiner Dynamik ab. Trifft eine vom IP betroffene Person auf eine mit Erfolg und Leistung verbundene Aufgabe, reagiert sie mit aus dem Zweifel resultierenden Ängsten, dass ihre Fähigkeiten dieser Herausforderung nicht gewachsen seien. ImpostorInnen begegnen dieser Angst entweder mittels übermäßig vorbereitenden oder verdrängenden Verhaltensmustern. Im Falle der Übervorbereitung wird ein sich einstellender Erfolg auf hohe Anstrengung und im Falle des Vermeidens auf Glück attribuiert. In beiden Reaktionsmustern findet keine Attribution auf die Fähigkeiten der Betroffenen statt, in Folge dessen positives Feedback aus dem Umfeld abgewertet wird. In erneuter Konfrontation mit einer an Leistung gebundenen Aufgabe reagieren ImpostorInnen erneut mit Ängstlichkeit, welche durch die eben beschriebenen Erfahrungen verstärkt auftritt. Als zweites Charakteristikum des IP gilt ein selbst auferlegter Anspruch die oder der Beste zu sein. ImpostorInnen erfuhren in ihrer Bildungskarriere häufig die Position der oder des Höchstleistenden. Betreten unter dem IP leidende Personen nun beispielsweise einen Kontext, in dem sie (noch) nicht zu den SpitzenleisterInnen zählen (z.b. im Übergang von Schule in Universität), werten sie ihre Leistungen übermäßig ab. Im Konnex des eben Beschriebenen steht das von Clance (1985) als Superfrau bzw. Supermann Komplex bezeichnete Charakteristikum. Es meint die Tendenz von ImpostorInnen, jene außerordentlich hohen Ansprüche auf alle Lebensbereiche zu verallgemeinern. Deren meist unmögliches Erfüllen wird von ImpostorInnen im Zuge stetiger Selbstevaluation als generalisierte Insuffizienz der eigenen Fähigkeiten erfahren. 6
15 Angst vor Misserfolg wird von Clance und O Toole (1987) als der am weitesten verbreitete Aspekt des IP beschrieben. Um die Wirkung dieser Emotion zu reduzieren, übervorbereiten sich ImpostorInnen angesichts einer an Leistung geknüpften Aufgabe. Clance (1985) beschreibt dieses Charakteristikum wie folgt: Most intelligent people know that almost everyone no matter how successful or smart occasionally has failed some endeavour. [ ] Impostors are aware of such things, too. But Impostors are unable to apply this knowledge to themselves. Even though they know intellectually that failure is a necessary part of living, they can t tolerate the thought of it, and they avoid it at all costs. (S. 63) Eine weitere Strategie zur Reduktion der Angst vor Misserfolg bei ImpostorInnen besteht darin, sich im Arbeitsprozess selbst so zu behindern, dass ein Scheitern vor sich selbst und vor Anderen in den Bereich des Erwartbaren fällt. Die Abwertung von Lob und die fehlende Zuschreibung von Erfolg auf die eigenen Fähigkeiten bilden das bereits im Rahmen des Impostor Kreislaufs erläuterte, fünfte Charakteristikum. Als letztes Charakteristikum wird Angst und Schuld angesichts des Erfolges beschrieben. Schuld entsteht durch einen auf dem herausragenden Erfolg basierenden Unterschied im Vergleich zum Arbeitsumfeld und damit einher gehender Angst vor Zurückweisung. Zusätzlich leiden ImpostorInnen unter der Angst, dass die antizipiert steigenden Erwartungen aufgrund der Erfolge ebenfalls wachsen und der daraus resultierenden Sorge, ob sie dieses Anspruchsniveau zukünftig werden erfüllen können (Clance, 1985). 1.3 Das Impostor Phänomen als psychologische Barriere für Erfolg und Leistung Relevanz aus bildungspsychologischer Perspektive gewinnt das IP in erster Linie in der Betrachtung seiner Auswirkung auf die langfristige berufliche (Bildungs-)Karriere in der Wissenschaft (Spiel, Reimann, Wagner, & Schober, 2008). Dem Forschungsinteresse von Jöstl et al. (2012) folgend, wird das IP in dieser Arbeit weniger als klinisches Syndrom, denn hinsichtlich seines Potentials als psychologische Barriere für intellektuelle Leistung und Erfolg betrachtet. Die folgenden Kapitel bilden diesbezüglich den aktuellen Forschungsstand ab. Die Darstellung erfolgt entlang der ursprünglichen Definition der Charakteristika des Impostor Profils nach Clance (1985), wobei mit einem Überblick der Erkenntnisse zu den affektiven Komponenten des IP begonnen wird. 7
16 1.3.1 Affektive Komponenten des IP Clance (1985) betont zwar, dass es sich beim Impostor Phänomen um kein dezidiert klinisches Störungsbild handelt, es jedoch in seiner unbewussten Wirkung das Wohlbefinden von Betroffenen beeinträchtigt und mit hohem Leidensdruck verbunden ist. Zusammenhänge mit negativen Affekten konnten in vielfachen Forschungsbemühungen belegt werden. So wurden Korrelationen des IP mit Depressionen (Bernard et al., 2002; Chrisman, Pieper, Clance, Holland, & Glickauf-Hughes, 1995; McGregor et al., 2008; Scott R Ross, Stewart, Mugge, & Fultz, 2001), verringerter psychischer Gesundheit (Sonnak & Towell, 2001) und eingeschränktem Wohlbefinden (September, McCarrey, Baranowsky, Parent, & Schindler, 2001) sowie allgemeiner Ängstlichkeit (Thompson et al., 2000) gefunden. ImpostorInnen leiden zudem unter einem niedrigen Selbstwert (Caselman, Self, & Self, 2006; Cozzarelli & Major, 1990; Kamarzarrin, Khaledian, Shooshtari, Yousefi, & Ahrami, 2013; Sonnak & Towell, 2001; Thompson, Davis, & Davidson, 1998; Want & Kleitman, 2006). In einer geringen Ausprägung, lässt der Selbstwert lässt auf einer verhaltensbezogenen Ebene das Ergreifen von Handlungsinitiativen und auf einer affektiven Ebene positive affektive Gefühlszustände unwahrscheinlicher werden (Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 2003). Zudem gilt ein niedriger Selbstwert unter gewissen Umständen als Risikofaktor für Depression (Battle, 1978; Harter, 1993; Orth, Robins, & Roberts, 2008; Sowislo & Orth, 2013). Weiters wurden positive Korrelationen zwischen dem IP und der Dimension Neurotizismus der Big Five Persönlichkeitsmerkmale gefunden, die auf eine emotionale Labilität von IP Betroffenen hinweist (Bernard et al., 2002; Chae, Piedmont, Estadt, & Wicks, 1995). Henning, Ey und Shaw (1998) fanden zusätzlich einen starken Zusammenhang zwischen dem IP und dem Ausmaß von Stresserleben in einer Stichprobe von 477 Studierenden verschiedener medizinischer Fachrichtungen. Dass sich die oben beschriebenen Affekte negativ auf akademische Leistungen auswirken wurde mehrfach belegt: Andrews und Wilding (2004) konnten zum Beispiel zeigen, dass Studierende, die unter Angst und Aspekten von Depression litten, schlechtere Studienleistungen erbrachten. Surtees et al. (2002) fanden im Rahmen einer Langzeitstudie an Studierenden der University of Oxford, dass sich hohe Ausprägungen von Neurotizismus, insbesondere bei Frauen, negativ auf den Studienerfolg auswirken. 8
17 1.3.2 Anspruch die oder der Beste zu sein Bereits frühe Befunde in einer Stichprobe von Universitätsangestellten gaben Hinweise darauf, dass ImpostorInnen im Vergleich zu Nicht-ImpostorInnen ein höheres Maß an Leistungsmotivation zeigen (Topping, 1983). Topping (1983) schließt hieraus, dass ImpostorInnen in besonderem Maße den Drang verspüren, ihre Kompetenz zu zeigen, um so die Angst vor der Entlarvung eines vermeintlichen intellektuellen Betruges zu reduzieren. Dies würde den höheren Leistungsanspruch von unter dem IP Leidenden erklären(king & Cooley, 1995). Erfüllen ImpostorInnen diesen zumeist kaum erreichbaren Anspruch nicht, resultiert das Verfehlen in ein Erleben persönlicher Unfähigkeit (Leary, Patton, Orlando, & Wagoner Funk, 2000), welches mit der erhöhten Anfälligkeit für Schuld und Scham bezüglich der eigenen Leistungen einhergeht (Cowman & Ferrari, 2002). Als psychologisches Konstrukt das in Bezug auf den Anspruch der oder die Beste zu sein steht, wurde Perfektionismus untersucht. Als Persönlichkeitsmerkmal weist dieses große Ähnlichkeit mit dem von Clance (1985) beschriebenen Charakteristikum auf: Perfektionistische Personen zeichnen sich durch in hohem Maße ausgeprägte persönliche Standards für die eigene Arbeit, hohe Erwartungen an die eigene Leistung, stark ausgeprägte Selbstkritik, Selbstzweifel an der Qualität der eigenen Handlungen und eine besondere Präferenz für Struktur sowie Ordnung aus (Frost, Marten, Lahart, & Rosenblate, 1990). In mehreren Studien konnten moderate bis starke Korrelationen zwischen dem IP und Perfektionismus gezeigt werden (Dudău, 2014; Henning et al., 1998; Thompson et al., 1998, 2000). Weiters steht Perfektionismus in Verbindung zu Arbeitssucht und Burnout (Stoeber & Damian, in Druck), die wiederum mit dem IP in Verbindung gebracht werden (Robinson, 2014; Ross & Krukowski, 2003) Superfrau- bzw. Superman Komplex Der Aspekt der stetigen Selbstevaluation der eigenen Leistung und einer übergeneralisierten Insuffizienzwahrnehmung der eigenen Fähigkeit in Folge eines Fehlers wurde von Thompson et al. (2000) untersucht. Nach der Bearbeitung einer Aufgabe überschätzten ImpostorInnen ihre eigene Fehlerrate gemessen an den eigenen Ansprüchen signifikant stärker als Nicht- ImpostorInnen und unterschätzten ihre absoluten Leistungen. Zudem zeigten sich ImpostorInnen stärker von der höheren Fehlerzahl betroffen als nicht vom IP Betroffene. Weiterführend finden sich positive Korrelationen zwischen der Ausprägung des IP bei Frauen 9
18 und dem Glauben, Intelligenz wäre, im Sinne der Entity Theorie (Dweck, 1986), eine fixe, angeborene und unveränderliche Größe. Wird ein solch starres und generalisiertes Konzept von Intelligenz in einem Teilbereich beschädigt, so könnten von dem IP Betroffene den Glauben an ihre Fähigkeiten im Absoluten verlieren, schlussfolgern Kumar und Jagacinski (2006). Diese Annahme wird von den Ergebnissen zweier Studien gestützt, welche positive Korrelationen zwischen der generellen Geringschätzung der eigenen Fähigkeiten und dem IP fanden (Cozzarelli & Major, 1990; September et al., 2001). Mit dem Zusammenhang zwischen Zweifeln an den eigenen Fähigkeiten und der tatsächlichen intellektuellen Leistung befasst sich Kapitel Angst vor Misserfolg Nicht jedes Ziel wird erreicht, auch wenn ein Maximum an Mühe und Ressourcen investiert wird. Angst vor Misserfolg (AvM) beschreibt die Furcht vor dem Scheitern angesichts einer bedeutungsvollen Aufgabe. Um den drohenden Selbstwertverlust angesichts des antizipierten Misserfolges zu vermeiden, setzen Betroffene Ziele unterhalb ihres eigentlichen Potentials (Conroy, Willow, & Metzler, 2002). Eine weitere Möglichkeit zum Schutz des Selbstwerts ist das Setzen von Zielen in kaum erfüllbarer Höhe. Das Verfehlen von diesen wird für Betroffene und ihr soziales Umfeld absehbar und damit wenig überraschend. Der eintretende Misserfolg lässt sich auf die Höhe der Zielsetzung attribuieren und schützt so den eigenen Selbstwert (Birney, Burdick, & Teevan, 1969). Beide Folgen der AvM beeinträchtigen die Umsetzung des Leistungspotentials und sind somit als psychologische Barriere für Erfolg anzusehen. Direkte Korrelationen zwischen AvM und dem IP sind mehrfach empirisch bestätigt (Fried- Buchalter, 1997; Jöstl et al., 2012; Kumar & Jagacinski, 2006). Auch die im vorangestellten Absatz beschriebenen Folgen wurden in Zusammenhang mit dem IP untersucht. So konnten schon Cozzarelli und Major (1990) zeigen, dass ImpostorInnen sich signifikant niedrige Ziele setzen. Kumar und Jagacinski (2006) fanden in ihrer Studie zum AvM zunächst positive Korrelationen zwischen IP und Prüfungsangst. Bezüglich der Zielsetzung unterschieden sich männliche und weibliche ImpostorInnen in ihren Mustern. Impostoren wählten eher Ziele unter ihrem Potential um ein Scheitern zu vermeiden, während Impostorinnen verstärkt solche Ziele anvisierten, die ein vorhersagbares Scheitern implizieren (Kumar & Jagacinski, 2006). 10
19 Im Zuge der Bemühungen die Folgen des IP besser zu verstehen, bekam das Konstrukt des Self-Handicapping besondere Aufmerksamkeit. Die zuerst von Feick und Rhodewalt (1997) beschriebene, kognitive Strategie meint allgemein das Platzieren von Hürden zur Behinderung des eigenen Erfolges angesichts eines antizipierten Scheiterns. Der nun noch wahrscheinlich gewordene Misserfolg kann in seinem Ursprung auf eben diese Hürden attribuiert werden und verhindert so eine mögliche Ursachenzuschreibung des potentiellen Scheiterns auf die eigene Person. Self-Handicapping dient bei AvM somit dem Schutz des eigenen Selbstwerts. Basierend auf ersten empirischen Hinweisen für einen direkten Zusammenhang zwischen dem IP und Self-Handicapping (Cowman & Ferrari, 2002; Leary et al., 2000), untersuchten Ferrari und Thompson (2006) in einem experimentellen Design an einer Stichprobe von 165 Studierenden das Ausmaß von Self-Handicapping in Zusammenhang mit dem IP. ImpostorInnen zeigten im Vergleich zu Nicht-ImpostorInnen angesichts einer leistungsbezogenen Aufgabe signifikant stärkeres, selbsthinderliches Verhalten und beanspruchten häufiger, unter leistungshemmenden Faktoren wie Stress, Krankheit, Erschöpfung oder Prüfungsangst zu leiden. Die Autorinnen assoziieren in der Diskussion emotionale Erschöpfung und negative Auswirkungen auf die Leistungsmotivation als Folge von Self-Handicapping. Clance (1985) beschreibt mit der im Impostor Kreislauf definierten Prokrastination eine Strategie zur Reduktion der Ängste mittels Arbeitsaufschub. Tatsächlich ist ein Zusammenhang zwischen dieser Form des Self-Handicapping und dem IP mehrfach belegt (Flett, Stainton, Hewitt, Sherry, & Lay, 2012; Want & Kleitman, 2006) Attribution und Einschätzung der Fähigkeiten Zu dem im Impostor Kreislauf zentralen Attributionsstil von ImpostorInnen, nach dem Erfolg auf externale Faktoren (Glück, Zufall, Anstrengung) und Misserfolge internal attribuiert werden (Clance, 1985; Clance & Imes, 1978; Harvey & Katz, 1985), liegen vergleichsweise viele empirische Befunde vor. Der bereits von Topping und Kimmel (1985) gefundene Zusammenhang zwischen diesem maladaptiven Attributionsverhalten und dem IP wurde durch aktuellere Forschungsbefunde bestätigt (Sightler & Wilson, 2001; Sonnak & Towell, 2001). In einem experimentellen Design stellte Thompson et al. (1998) fest, dass ImpostorInnen positives Feedback abwerteten und selbstempfundene Misserfolge verstärkt auf die eigenen Fähigkeiten attribuierten. Im Rahmen einer Studie zu IP, Bindung und 11
20 Ansprüchen an das Umfeld kamen Gibson-Beverly und Schwartz (2008) zu dem Ergebnis, dass ImpostorInnen in Folge des Zweifels an den eigenen Fähigkeiten, Lob und Zuspruch aus dem Umfeld abwerten. Thompson et al. (1998) konnten weiters zeigen, dass die hohe Ausprägung des IP über den maladaptiven Attributionsstil von ImpostorInnen mit einem niedrigen Selbstwert in Verbindung steht. Selbstwert meint das Ausmaß an Wertschätzung, welches eine Person sich selbst zuschreibt (Harter, 1993). Der Konnex zwischen Selbstwert, Attribution und IP lässt sich nach Heckhausen (1967) wie folgt erklären. Ein positiver Selbstwert wird bedingt durch einen Attributionsstil, der Erfolg überwiegend internal stabilen Faktoren und Misserfolg eher external variablen Ursachen zuschreibt. ImpostorInnen jedoch zeigen ein gegenteiliges Attributionsmuster, was den negativen Zusammenhang zwischen IP und Selbstwert erklärt (siehe Kapitel 1.3.1). Ein niedriger Selbstwert wie auch das IP, steht in direktem Zusammenhang mit negativen Affekten wie Depression (z.b. Sowislo & Orth, 2013), jedoch ist kein unmittelbarer Einfluss auf die akademischen Leistungen feststellbar (Baumeister et al., 2003; Marsh & O Mara, 2008). Der Attributionsstil beeinflusst jedoch das akademische Fähigkeitsselbstkonzept. Nach Marsh (1990) umfasst dieses jegliches Wissen und jegliche Vorstellungen, die eine Person bezüglich ihrer intellektuellen Fähigkeiten besitzt. Craven, Marsh und Debus (1991) konnten zeigen, dass internal fokussierende Feedbacks bei Erfolg das Fähigkeitsselbstkonzept stärken. Der direkte Zusammenhang zwischen dem akademischen Selbstkonzept und den tatsächlichen Leistungen wurde vielfach bewiesen (z.b. Marsh, 1990; Marsh & O Mara, 2008). Ein weiterer, leistungsbezogener Anteil des Selbst ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Auch sie steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der intellektuellen Leistung (Marsh & O Mara, 2008). Das Konstrukt der Selbstwirksamkeit ist definiert als das Vertrauen, mittels der eigenen Fähigkeiten zufriedenstellende Resultate erbringen zu können (Bandura, 2001). Im akademischen Kontext steht die Selbstwirksamkeit in einem starken Zusammenhang mit der generellen akademischen Produktivität (Blackburn, Bieber, Lawrence, & Trautvetter, 1991). Die von Antoine, Hutchison und Follman (2006) geäußerte Hypothese einer Korrelation zwischen hoher Ausprägung des IP und niedriger Selbstwirksamkeit wurde von Jöstl et al. (2012) überprüft. Die AutorInnen fanden, dass hohe Ausprägungen des IP mit niedrigen Werten in der akademischen Selbstwirksamkeit einhergehen. Aus dem vielfach gefundenen Einfluss der akademischen Selbstwirksamkeit auf wissenschaftliche 12
21 Produktivität (Zimmerman, 2000) lassen sich die negativen Auswirkungen des IP auf Leistung und Erfolg ableiten (Jöstl et al., 2012) Angst vor Erfolg Angst vor Erfolg (AvE) wurde von Clance (1985) als eines der Kerncharakteristika des IP unter der Bezeichnung Angst und Schuld angesichts des Erfolgs beschrieben (siehe Kapitel 1.2). Nach Horner (1972) sind Personen von AvE betroffen, die entgegen der Erwartungen eines auf sie projizierten, dominierenden sozialen Stereotyps erfolgreich sind. Das Widerlegen eines gesellschaftlich vorherrschenden Stereotyps wird mit negativen Konsequenzen seitens des Umfeldes antizipiert und deshalb vermieden. Vielfach beobachtet wurde die AvE bei Frauen, die in Erwartung auf einen bevorstehenden Erfolg Angst verspürten, aufgrund dessen als weniger weiblich wahrgenommen zu werden und soziale Zurückweisung zu erfahren (André & Metzler, 2011; Feather & Simon, 1973). Das AvE als Charakteristikum des IP hat zur Folge, dass niedrigere Ziele gesetzt werden (Fried- Buchalter, 1997) und gilt somit in seinen Folgen ähnlich der AvM als psychologische Barriere für Erfolg und Leistung. Die bisherigen Ergebnisse bezüglich eines unmittelbaren Zusammenhangs zwischen dem IP und AvE sind widersprüchlich: Während sich in einer Stichprobe von ManagerInnen keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen AvE und dem IP zeigte (Fried-Buchalter, 1997), fanden Jöstl et al. (2012) eine signifikant positive Korrelation in einer Stichprobe von Doktoratsstudierenden. 1.4 Schlussfolgerung Die Darstellung der empirischen Befunde zu den Wirkmechanismen des IP verdeutlicht dessen negative Folgen für Leistung und Erfolg. So wurde in Kapitel der Konnex zwischen den mit dem IP zusammenhängenden, affektiven Zuständen und niedrigeren akademischen Leistungen sowie geringerem Studienerfolg hergestellt. Die Verbindung zwischen Arbeitssucht und Burnout mit dem IP wurde in Kapitel mittels des Konstruktes des Perfektionismus erklärt. Wie besonders hohe, auf alle Lebensbereiche generalisierte Leistungsansprüche zu Selbstzweifeln an den eigenen Fähigkeiten führen, wurde in Kapitel beschrieben. Dass ImpostorInnen verstärkt unter Angst vor Misserfolg leiden, welcher sich negativ auf die Zielsetzung (im Potential nicht ausschöpfendem Sinne) 13
22 auswirkt, zeigt Kapitel Unmittelbare Zusammenhänge zwischen Self-Handicapping und der Ausprägung des IP liefern ebenfalls Hinweise in diese Richtung. Kapitel beschreibt die Auswirkungen des IP inherenten, maladaptiven Attributionsstils auf den Selbstwert, das akademische Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeitserwartung. Der Wirkmechanismus von Angst vor Erfolg als psychologische Barriere für Erfolg wird in Kapitel aufgezeigt, zu dem zumindest im akademischen Kontext empirische Hinweise für einen Zusammenhang mit dem IP vorliegen. 14
23 2 Das Impostor Phänomen im Kontext Wissenschaft Die folgenden Kapitel widmen sich dem Impostor Phänomen in der Wissenschaft. Dabei werden zunächst in Punkto Verbreitung und Ausmaß der Ausprägung des IP Vergleiche zwischen Stichproben aus dem akademischen Kontext mit solchen anderer Populationen angestellt (Kapitel 2.1). Diese werden in Kapitel und um Erkenntnisse zu Geschlechts- und Altersunterschieden in der Ausprägung des IP im Wissenschaftskontext erweitert. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse des vorangestellten Kapitels erklärend, die Besonderheit des WissenschaftlerInnenbegriffs in Bezug zum IP gesetzt (Kapitel 2.2). 2.1 Prävalenz und Ausmaß der Ausprägung Das IP wurde in den verschiedensten Stichproben untersucht. Es zeigte sich, dass bereits SchülerInnen, wenngleich in geringerem Ausmaß als Erwachsene, zu den Betroffenen gehören (Chayer & Bouffard, 2010). Mit voranschreitendem Schulalter steigen die Prävalenzraten der Ausprägung des IP (Caselman et al., 2006). Vergleicht man nun das Ausmaß des IP unter Studierenden (z.b. Bernard et al., 2002; Ferrari & Thompson, 2006) mit jenem unter DissertantInnen (Jöstl et al., 2012), so lassen sich kaum Unterschiede finden. Die These von Cozzarelli und Major (1990), wonach die Verbreitung in der Population mit dem Anstieg des Bildungsgrades und der Qualifikation zunähme, lässt sich somit nicht bestätigen. Betrachtet man die Prävalenz und das Ausmaß des IP in Stichproben, die nicht aus einem akademischen Kontext stammen, so werden markante Unterschiede ersichtlich. Jöstl et al. (2012) fanden bei österreichischen Promovierenden im Vergleich zu österreichischen Angestellten (Kaiser, 2005) nicht nur deutlich höhere Ausprägungen, sondern auch eine wesentlich stärkere Verbreitung in den von Clance (1985) definierten Kategorien des IP. Während in der Stichprobe der Angestellten knapp die Hälfte der Befragten kein IP (47.5%), kaum weniger Personen ein geringes IP (46.7 %), nur 5.4 Prozent ein mittelgradiges IP und keine bzw. keiner der Befragten ein hochgradiges IP aufwiesen (Kaiser, 2005), sind DoktorandInnen wesentlich häufiger und in höherem Ausmaß betroffen (kein IP = 17.1%; geringes IP = 49%, mittelgradiges IP = 29.2%; hochgradiges IP = 4.8%; Jöstl et al., 2012). Dieser Befund wird durch eine Studie von Mattie, Gietzen, Davis und Prata (2008) gestützt, die das IP bei mehr als einem Drittel von befragten AssistenzärztInnen in Ausbildung zum Facharzt fanden. Neben der stärkeren Ausprägung und dem häufigeren Vorkommen des IP 15
24 in der Wissenschaft zeigten Jöstl et al. (2012) zudem, dass an der Hochschule beschäftigte DoktorandInnen, gegenüber externen DissertantInnen, signifikant stärker vom IP betroffen sind Geschlechtsunterschiede Clance und Imes (1978) beschrieben das IP in Folge von Beobachtungen besonders erfolgreicher Frauen im Therapiesetting, von denen die Mehrzahl im Hochschulkontext tätig war. In aktuellerer Forschung zeigen sich diesbezüglich heterogene Ergebnisse: Während einige Studien bei Studierenden keine Geschlechtsunterschiede in den Ausprägungen des IP feststellen konnten (z.b. Bernard et al., 2002; Ferrari & Thompson, 2006), fanden andere deutlich höhere Ausprägungen bei Frauen (z.b. Kumar & Jagacinski, 2006). Untersuchungen an Stichproben von Hochschulpersonal ergaben ebenfalls widersprüchliche Ergebnisse: Entgegen ihren eigenen Erwartungen fanden Topping und Kimmel (1985) signifikant höhere Ausprägungen bei Universitätsassistenten und Professoren als bei deren weiblichen KollegInnen. Vergleichsweise aktuelle Forschungsergebnisse an einer Stichprobe österreichischer DoktorandInnen (Jöstl et al., 2012) unterstützen indes die These von Clance und O Toole (1987), wonach Frauen mit Tätigkeiten im Hochschulkontext in besonderem Ausmaß unter dem IP leiden. Der Anteil weiblicher Doktoratsstudierender, in den nach Clance (1985) definierten IP Gruppen, lag bei mittelgradigen (69,6%), vor allem aber bei hochgradigen Ausprägungen des IP (93,3%) um ein vielfaches höher als der Anteil männlicher Doktoratsstudierender (Jöstl et al., 2012). Prata und Gietzen (2007) fanden das IP bei knapp jeder zweiten Assistenzärztin (46%), während nur knapp jeder vierte (22%) von deren männlichen Kollegen betroffen war. Die antizipierten Ursachen für eine stärkere Verbreitung und Ausprägung des IP bei Frauen im akademischen Kontext sind vielfältig. Clance, Dingman, Reviere und Stober (1995) sehen in der ungleichen Sozialisierung von Frauen und Männern über die Lebensspanne den Ursprung der Geschlechtsunterschiede. Frauen würden die Ansicht, dass Erfolg ihnen nicht gebühre, deshalb stärker verinnerlichen, weil sie sich mit der gesellschaftlichen Grundüberzeugungen decke. Mit diesem Reaktionsmuster liefen sie keine Gefahr dem Erfolg als vorherrschend männlich assoziierten Geschlechterstereotyp entgegenzuwirken und ihre Weiblichkeit in der Außenwahrnehmung zu verlieren (Eagly & Karau, 2002). Zusätzlich 16
25 könnten geschlechterstereotype Rollenerwartungen an Frauen das IP bei WissenschaftlerInnen verstärken (siehe Kapitel 3.3.4). Miller und Kastberg (1995) diskutieren den Einfluss fehlender weiblicher Rollenvorbilder in akademischen Spitzenpositionen. Wären erfolgreiche Frauen beispielsweise in Professuren keine Ausnahmen mehr, so würden Selbstzweifel bezüglich der eigenen Fähigkeiten über die Frage Warum gerade ich, wenn es keine andere dorthin geschafft hat? weniger stark genährt (siehe Kapitel 3.3.9). Kumar und Jagacinski (2006) vermuten, dass die Folgen des IP durch berufliche Netzwerke und der Anwesenheit von MentorInnen abgeschwächt werden können, die bis dato vor allem von Männern dominiert sind (siehe Kapitel 3.3.7) Akademisches Alter Es gibt bisher keine schlüssige theoretische Basis für die Prävalenz oder das Ausmaß der Ausprägung des IP über die Lebensspanne. Zwar besteht eine empirische Basis, die für eine geringere Ausprägung des IP bei SchülerInnen gegenüber Studierenden spricht, jedoch weisen Promovierende im Ausmaß ähnlich hohe Ausprägungen auf (siehe Kapitel 2.1). Auch in homogeneren Stichproben sind die empirischen Befunde widersprüchlich: Während unter StudentInnen signifikant negative Korrelationen zwischen Lebensalter und IP gefunden wurden (Chae et al., 1995; Harvey, 1981; Thompson et al., 1998), zeigte sich in einer Stichprobe von AssistenzärztInnen kein signifikanter Zusammenhang (Mattie et al., 2008). Vielmehr scheint die Verweildauer innerhalb eines Kontextes von Relevanz. Harvey und Katz (1985) vermuteten, dass die Ausprägung des IP zum Eintritt in eine neue akademische Phase in Anbetracht neuer Aufgaben zunächst zunimmt. Mit der Zeit finden sich Personen jedoch besser in ihre Rolle ein und Routinen nehmen zu, was das IP weniger wahrscheinlich werden lässt (siehe Kapitel 3.3.5). Diese Annahme würde die eben erwahnten Ergebnisse (Chae et al., 1995; Harvey, 1981; Thompson et al., 1998) mittels der Variable des akademischen Alters erklären. Demnach ist die Zeitspanne zwischen dem Eintritt in eine neue Ausbildungsphase und dem Erhebungszeitpunkt des IP (z.b. Anzahl der bereits studierten Semester) eher von Relevanz, als das Lebensalter per se. Mattie et al. (2008) fanden einen, wenn auch nur geringen Zusammenhang, zwischen der Ausprägung des IP und dem akademischen Alter von AssistenzärztInnen. Die Befunde von Topping und Kimmel (1985) in einer Stichprobe von
26 WissenschaftlerInnen weisen in die gleiche Richtung. Die Autorinnen fanden das Ausmaß des IP mit Anstieg des universitären Ranges geringer werdend. 2.2 Der WissenschaftlerInnenbegriff Dem Beruf der bzw. des Forschenden umgibt ein besonderer Mythos: In der gesellschaftlichen Wahrnehmung wie auch in der Selbstbeurteilung vieler in der Wissenschaft Beschäftigter, müssen WissenschaftlerInnen für die Ausübung dieses Berufes auserkoren sein. ForscherIn sein könne man nicht lernen, vielmehr müsse ein herausragendes Genie einer inneren Veranlagung entspringen (siehe Kapitel 1.3.3). WissenschaftlerInnen müssten ihr Leben ausschließlich ihrer Arbeit widmen und benötigten kein Freizeit- bzw. Privatleben. Aufopferung wird als Voraussetzung für diese Tätigkeit erwartet. Nur wer sich diesem Kodex verschreibe, könne im wissenschaftlichen Betrieb erfolgreich sein (Macha, 1992). Aufgeladen wird dieser Idealtypus zudem mit einer besonderen Verantwortung, welche WissenschaftlerInnen nach David (2000) dazu verpflichtet, [ ] in ihrer Arbeit allein von Tatsachen auszugehen und nur diese gelten lassen, in der Aufklärung der Wahrheit sich nur durch Zuverlässigkeit, Exaktheit und Unbestechlichkeit leiten lassen, in ihrer schöpferischen Arbeit, Fortschritt und Humanität gleicher Weise als Zielsetzung sehen [ ] (S. 9) Wird dieser Idealtypus von WissenschaftlerInnen, anstatt ihn als durchaus sinnvolle Leitlinie für das eigene Arbeiten zu nehmen, als Anspruch bezüglich der eigenen Arbeit verinnerlicht, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, diesem im täglichen Tun nicht entsprechen zu können. Es entstehen Zweifel an den eigenen Fähigkeiten und der Eignung für die berufliche Position (Klinkhammer & Saul-Soprun, 2009). Die Wirksamkeit eines Idealbildes von WissenschaftlerInnen unter ImpostorInnen spiegelt sich im hohen Leistungsanspruch von ImpostorInnen wider (siehe Kapitel 1.3.2). Bereits In der frühen Forschungen zum IP wurde beobachtet, dass sich ImpostorInnen einem idealisierten und mystifizierten Intelligenzbegriffs verschreiben (Clance & Imes, 1978; Clance & O Toole, 1987). 18
27 3 Wissenschaft als Beruf: Das IP im Arbeitsumfeld Hochschule Im ersten Kapitel dieser Arbeit konnte gezeigt werden, wie sich das IP als psychologische Barriere für Erfolg und Leistung auswirkt. Kapitel zwei führt auf, dass das IP im akademischen Kontext in höherem Ausmaß und stärkerer Verbreitung zu finden ist als in anderen beruflichen Kontexten. Zudem gibt es Evidenz dafür, dass das Arbeitsumfeld, namentlich eine Anstellung an der Hochschule, die Ausprägung des IP fördert. Im folgenden Kapitel werden aus Theorie und Empirie stammende Hinweise beschrieben, die von einem systematischen Zusammenhang zwischen dem Arbeitsumfeld Hochschule und der der Entstehung sowie Aufrechterhaltung des IP ausgehen. Sofern vorhanden, werden diese Behauptungen mit empirischer Evidenz unterfüttert. Abschnitt 3.1 befasst sich mit den an die Tätigkeiten von WissenschaftlerInnen gebundenen Faktoren, die in Zusammenhang mit dem IP vermutet werden. In Abschnitt 3.2 werden strukturelle Rahmenbedingungen der Hochschule beschrieben und ein Konnex zum IP hergestellt. Abschnitt 3.3 schließlich nennt konkrete Thesen bezüglich der Auswirkungen individueller Arbeitsbedingungen von WissenschaftlerInnen an der Hochschule, für die ein Bezug zum IP vermutet wird. 3.1 Aufgabengebiete von WissenschaftlerInnen in Hochschulanstellung WissenschaftlerIn mit Anstellung an einer Hochschule zu sein, bedeutet sich mit einer Fülle von Aufgaben konfrontiert zu sehen. Im österreichischen Wissenschaftsbetrieb identifiziert Schober (2013) die Bereiche Forschen, Drittmittel einwerben, Lehren und Verwalten, die jeweils eine Vielzahl an Tätigkeiten mit sich bringen (siehe Abbildung 1). Abbildung 1. Aufgaben von WissenschaftlerInnen im Überblick (Schober, 2013, S. 46) 19
28 UniversitätsassistentInnen berichten, dass ihre Forschungstätigkeit im Spannungsfeld zwischen den Pflichten der Lehre und administrativer Tätigkeiten mit enger Terminbindung zeitlich untergehe (Gschwandtner, Buchinger, & Gödl, 2002). Jauhiainen, Jauhiainen und Laiho (2009) befragten 150 wissenschaftliche MitarbeiterInnen zu Belastungen im Arbeitsalltag, deren Ursache diese in den strukturellen Gegebenheiten des Wissenschaftsbetriebes sehen. Die Befragten WissenschaftlerInnen berichteten, dass der Konflikt zwischen Lehre und Forschung, hochgradige Hierarchie in der Organisationsstruktur Hochschule und fehlende soziale Eingebundenheit im wissenschaftlichen Arbeiten zu den kontextuellen Belastungsfaktoren zählen. Wilkesmann und Schmid (2011) beleuchten diese Entwicklung am Beispiel der Gewichtung von Lehre und Forschung. Die Autoren stellen fest, dass Lehrtätigkeit gegenüber Forschung in der Bewerbung um eine Anstellung an der Hochschule eine deutlich untergeordnete Rolle spielt. Da das Publizieren wissenschaftlicher Arbeiten den wesentlichen Ausschlag für eine Karriere in der Wissenschaft darstellt und somit über weitere Beschäftigungsverhältnisse entscheidet (Jungbauer-Gans & Gross, 2013), geraten insbesondere JungwissenschaftlerInnen in Konflikte bei der Priorisierung ihrer Tätigkeiten. Aufgrund des zeitlich engen Korsetts sehen sich WissenschaftlerInnen immer wieder gezwungen, in der Erfüllung von Aufgaben KollegInnen, Studierende, Vorgesetzte und auch die eigenen Ansprüche zu enttäuschen. Attribuieren WissenschaftlerInnen diese Notwendigkeit auf mangelnde eigene Fähigkeit und berufliche Inkompetenz (siehe Kapitel 3.3.5) erhöht dies die Wahrscheinlichkeit vom IP betroffen zu sein. Dieser Aspekt wird in Kapitel näher diskutiert. 3.2 Strukturelle Rahmenbedingungen des Arbeitsplatzes Hochschule JungwissenschaftlerInnen befinden sich in finanzieller Hinsicht und in Bezug auf die Arbeitsplatzsicherheit in prekären Arbeitsverhältnissen. Arbeitsverträge an österreichischen Hochschulen sind fast ausschließlich zeitlich befristet. Zumeist ist der einzige Weg zu einer Festanstellung an einer Universität oder Fachhochschule im wissenschaftlichen Arbeitsfeld überhaupt nur über eine der seltenen Professuren möglich (Klinkhammer, 2013). Da es keine unbefristeten Anstellungen im akademischen Mittelbau gibt, werden eigentlich als arbeitsrechtliche Schutzmaßnahme gedachte, dienstrechtliche Rahmenbedingungen wie die Kettenvertragsregelungen zur Bedrohung für den Arbeitsplatz. So gilt für befristete Stellen 20
29 an der Universität Wien eine zeitliche Beschränkung, die in Vollzeit- maximal sechs, in Teilzeitbeschäftigung maximal acht Jahre beträgt (Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal an der Universität Wien, 2009). Nach dem Ablauf dieser Frist sind WissenschaftlerInnen de facto gezwungen die Universität zu verlassen und sich eine neue Arbeits- bzw. Forschungsstelle zu suchen. Schober (2013) kommt in diesem Zusammenhang zu dem Schluss, dass Wissenschaft als Beruf ohne Fokus auf Karriere im aktuellen System nicht möglich (S. 47) ist. WissenschaftlerInnen sind häufig an mehreren Projekten beteiligt um ihren Unterhalt zu finanzieren zeitweise auch ohne Anbindung an eine Hochschule (Klinkhammer & Saul- Soprun, 2009). Zudem sieht sich der akademische Mittelbau (exkl. außerordentliche UniversitätsprofessorInnen / AssistenzprofessorInnen) im Verhältnis zur Arbeitszeit deutlich unterbezahlt. Hinzu kommen unbezahlte Überstunden, die im Hochschulalltag zur Regel werden und das Einkommen in Relation zur Arbeitszeit weiter schmälern. Gleichwohl belastender stellt sich die Situation für Teilzeitangestellte dar (Gschwandtner et al., 2002). Eine umfassende Befragung von Doktoratsstudierenden in Deutschland kam zu dem Schluss, dass viele DoktorandInnen gezwungen sind, sich durch mehrere Beschäftigungsverhältnisse zu finanzieren. Jede/r neunte Promovierende lebt unter der Armutsgrenze (Hauss et al., 2012). Je nach Fachdisziplin gibt es deutliche Unterschiede in der finanziellen Lage von Promovierenden. Die Finanzierung des Studiums mittels Stipendien ist beispielsweise für Studierende der Biologie um ein vielfaches greifbarer als für solche des Faches Geschichte (Fräßdorf, Kaulisch, & Hornbostel, 2012). Dass sich finanzielle Nöte direkt negativ auf die akademische Leistung auswirken, konnten Andrews und Wilding (2004) eindrucksvoll belegen. Trifft diese Realität der strukturellen Rahmenbedingungen auf den bereits in Kapitel 2.2 beschrieben Mechanismus der Wirkung eines idealisierten WissenschafterInnenbegriffs, so verstärkt sich nach der These von Klinkhammer und Saul-Soprun (2009) die Wahrnehmung, den Status als WissenschaftlerIn nur durch Betrug erlangt zu haben. Das Arbeiten unter prekären Bedingungen könnte zudem eine gewisse Geringschätzung der eigenen Arbeit ausdrücken, die auf mangelnde Fähigkeiten attribuierbar wäre. 21
30 3.3 Arbeitsbedingungen an der Hochschule In den folgenden Kapiteln werden mögliche Faktoren des Arbeitsumfeldes Hochschule beschrieben, die als in Zusammenhang mit dem IP stehend vermutet werden Konkurrenz im Arbeitsumfeld Die Seltenheit von Festanstellungen mit geregeltem Einkommen (siehe Kapitel 3.2) wie auch von verfügbaren Spitzenpositionen im Allgemeinen begünstigt Konkurrenz und Leistungsdruck im Wissenschaftsbetrieb (Klinkhammer, 2013; Winter, 2012). Im Rahmen einer Fallstudie untersuchten Craddock et al. (2011) retrospektiv die Wahrnehmung von Charakteristika des IP mittels Einzel- und Fokusgruppeninterviews bei Doktoratsstudierenden. Obwohl die Befragten zum Erhebungszeitpunkt nicht nachweislich unter dem IP litten bzw. in der Vergangenheit gelitten hatten, identifizierten sich diese mit den Erlebniszuständen des IP und benannten Faktoren des Arbeitskontexts als Ursache. Die Promovierenden nahmen beispielsweise einen hohen Konkurrenzdruck innerhalb der Fakultät und insbesondere unter Promovierenden wahr. Gerade zu Beginn des Doktoratsprogramms führe der Zustand dauerhaften Vergleichens des getätigten Aufwandes sowie bisheriger Qualifikationen mit denen der Mitstudierenden zu einem Gefühl der Minderwertigkeit der eigenen Leistungen. Dies habe Zweifel an der eigenen Intelligenz und ihrer Tauglichkeit für ein Doktoratsprogramm hervorgerufen. Aus der Sicht der Interviewten war der Konkurrenzdruck Ursache für fehlende Kooperationen und Allianzen innerhalb der DoktorandInnengruppe. In ihrer Arbeit mit Universitätspersonal berichtet auch Zorn (2005) von aggressivem Konkurrenzdruck, der Teilschuld an der Ausprägung des IP im Hochschulkontext habe. Mattie et al. (2008) sehen die der Organisation der FachärztInnenausbildung inhärente, strukturelle Konkurrenz zwischen AssistenzärztInnen als Ursache für die verbreitete Ausprägung des IP in dieser Stichprobe. Das von Ross und Krukowski (2003) gefundene, unter ImpostorInnen stärker verbreitete Misstrauen gegenüber anderen könnte ebenfalls ein Indiz für die Wirkung von Konkurrenz in Bezug auf das IP sein Arbeitskontext unter Leistungsevaluation Die Hochschule als Arbeitsplatz stellt einen beruflichen Kontext dar, in dem eigene Leistungen auf mehreren Ebenen und in gewisser Regelmäßigkeit evaluiert werden 22
31 (McCormick & Barnes, 2008). Jöstl et al. (2012) sehen die Häufigkeit der Leistungsbewertung aus unterschiedlichen Quellen als Ursache für Selbstzweifel bezüglich der eigenen Fähigkeit, da dieser Praxis ein stetiges Hinterfragen der Leistung mitschwinge. Clance (1985) beschreibt die regelmäßige Überprüfung und Bewertung der Leistungen von Studierenden als ursächlich für die hohen Ausprägungen des IP in dieser Population. Klinkhammer und Saul- Soprun (2009) sprechen in diesem Zusammenhang sogar von Entwertung, da der Fokus der Leistungsevaluation oftmals auf der Person anstelle der Arbeit läge. Dass ImpostorInnen verstärkt Angst verspüren, wenn ihre Leistungen öffentlich verkündet werden (Leary et al., 2000), könnte ein empirischer Hinweis für den Zusammenhang öffentlicher Leistungsevaluation und dem IP sein. Zudem zeigen sich positive Korrelationen zwischen dem IP mit Angst vor Situationen, in denen Leistung überprüft wird (Kumar & Jagacinski, 2006) Enttäuschung des Arbeitsumfeldes Wie bereits in Kapitel 3.1 beschrieben, bedeutet es WissenschaftlerIn in Anstellung an der Hochschule zu sein, dass eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufgabenkomplexen zu bearbeiten sind. In deren Erfüllung sind WissenschaftlerInnen mit verschiedentlichen Berufsrollen konfrontiert. Klinkhammer und Saul-Sopron (2009) nennen konkret die Rollen als Vorgesetzte/r, Prüfer/in, als Mentor/in, Gutachter/in, Kolleg/in, Tagungsleiter/in, Autor/in [...] (S. 174). Differierende, von innen und von außen gestellte Ansprüche an diese Rollen führen Betroffene im Setzen von Prioritäten in Berufsrollenkonflikte. Richten verschiedene Personen an unterschiedliche Rollen gegeneinanderstehende Erwartungen und bestehen auf deren Einhaltung, so gerät die betroffene Person unter Entscheidungsdruck (Schulz, 2013). Während beispielsweise Studierende von Lehrpersonen Zeit und Aufmerksamkeit für ihre Seminararbeiten erwarten, honoriert die Forschungsgemeinschaft hauptsächlich zeitliche Investitionen in Publikationen mit einem Karrierefortschritt (siehe Kapitel 3.1). Die Konsequenzen der Entscheidung für bzw. gegen die Erfüllung einer Rollenerwartung erzeugt Rollenstress (Nir & Zilberstein Levy, 2006). Buchinger (2000) beschreibt das Arbeiten unter zeitlicher Not im Hochschulkontext als das Herstellen eines Enttäuschungsgleichgewichts : Eine Wahl besteht nur darin, welche Rollenerwartung man nicht erfüllt und es bleiben einzig Entscheidungen zwischen unerwünschten Alternativen. Werden Berufsrollenkonflikte in ihren Ursachen auf einen 23
32 subjektiven Mangel der eigenen Fähigkeiten in der Erfüllung der Rolle attribuiert, so entsteht das Gefühl, den Ansprüchen der beruflichen Positionen und den eigenen Standards nicht zu entsprechen (Klinkhammer & Saul-Soprun, 2009). Empirische Hinweise auf Zusammenhänge zwischen dem IP und der Enttäuschung des Arbeitsumfeldes im Hochschulkontext liegen nicht vor, jedoch ähneln die beschriebenen Folgen von Berufsrollenkonflikten jenen des IP. So stehen Berufsrollenkonflikte mit negativen Auswirkungen auf das generelle Wohlbefinden und einem hohen generellen Stressniveau (Hendel & Horn, 2008; Schulz, 2013) sowie Burnout und Depression (Schaufeli, Bakker, van der Heijden, & Prins, 2009) in direktem Zusammenhang Konflikte zwischen Arbeits- und Privatleben Die Vereinbarkeit eines erfüllenden Privatlebens mit einer wissenschaftlichen Anstellung an der Hochschule wird von JungwissenschaftlerInnen einhellig in Frage gestellt. In einer Befragung von Gschwandtner et al. (2002) geben alle UniversitätsassistentInnen an, dass neben dem Beruf zu wenig Zeit für Freunde und Familie bleibe. Weiters lassen Vorträge, Kongresse und Tagungen weltweite Mobilität und Flexibilität zu einer Voraussetzung für eine Karriere in der Wissenschaft werden. Diese längeren Abwesenheiten belasten das soziale Netz von WissenschaftlerInnen zusätzlich (Klinkhammer, 2013). Trotz des hohen getätigten Aufwandes besteht im Vergleich zu anderen Berufsgruppen, besteht bei WissenschaftlerInnen das Gefühl, chronisch zu wenig Zeit in die eigene Arbeit zu investieren. Eine Wissenschaftlerin beschreibt dies wie folgt: Ich habe schon ein permanent schlechtes Gewissen, also, dass ich zuwenig [sic!] machen würde, obwohl ich eigentlich, glaube ich, die ganze Zeit arbeite. Aber ich glaube immer, man könnte noch mehr machen. (Gschwandtner & KollegInnen, 2002, S. 132) Das ständige Ausbalancieren zwischen Arbeitszeit und Privatleben lässt es für WissenschaftlerInnen in der eigenen Wahrnehmung wahrscheinlicher werden, in beiden Lebensbereichen den eigenen und den Ansprüchen des Umfeldes nicht gerecht zu werden. Das Empfinden dieses Zustandes könnte auf eigenes Versagen, sprich mangelnde Fähigkeit attribuiert werden und somit die Ausprägung des IP fördern (Klinkhammer & Saul-Soprun, 2009). 24
33 Studdard (2002) sieht in verinnerlichten multiplen Rollenerwartungen gegenüber Frauen eine Ursache für eine höhere Prävalenz von Impostorinnen im akademischen Kontext. Es bestehe die gesellschaftliche Erwartung eine gute Mutter und Ehefrau zu sein und gleichzeitig der Anspruch beruflich herausragende Leistungen zu vollbringen. Dass diese Ansprüche in Konflikt geraten und hierbei die Wahrnehmung von Insuffizienz der eigenen Fähigkeiten entsteht, sei nicht verwunderlich (siehe Kapitel 2.1.1). Empirische Befunde zu diesem als Work-Family Conflict (WFC) bezeichneten Konstrukt (Greenhaus & Beutell, 1985) in direktem Zusammenhang mit dem IP liegen bislang nicht vor. Evidenz für Bezüge lassen sich nur über mit dem IP assoziierte, affektive Erlebniszustände finden (siehe Kapitel 1.3.1). Unter WissenschaftlerInnen zeigten sich Korrelationen zwischen niedriger Arbeitszufriedenheit sowie Stresserleben und dem WFC (Love, Tatman, & Chapman, 2010). In einer Stichprobe von 2700 Angestellten fand Frone (2000) signifikante Korrelationen zwischen dem WFC und Angst- sowie affektiven Störungen. Kontraintuitiv stellte der Autor im Ausmaß des WFC keine Geschlechtsunterschiede fest. Reinert (1991) fand in einer Stichprobe von 256 Managerinnen den Zusammenhang zwischen dem IP und Schwierigkeiten in der Familie. Sie schloss hieraus, dass der Arbeitskontext und das Familienleben zumindest im Konnex zum IP stehen Unbekannte Herausforderung und IP In dem von Clance und Imes (1978) postulierten Impostor Kreislauf beschreiben die Autorinnen die Zunahme des IP in Konfrontation mit der Anforderung einer neuen, an Leistung gebundenen Aufgabe (siehe Kapitel 1.2). In diesem Charakteristikum stellt das IP kein stabiles Persönlichkeitsmerkmal dar, sondern besitzt ein situatives Moment. In ihrer Forschung zum IP im Hochschulkontext berichten Penland und McCammon (1984) stärkere Ausprägungen des IP bei herausragenden Studierenden, die gerade ihr Studium aufgenommen haben, gegenüber solchen, die bereits mehrere Jahre in Exzellenzprogrammen studierten. Harvey und Katz (1985) erklären diesen Umstand damit, dass Unsicherheit bezüglich der Suffizient der eigenen Fähigkeiten in Bezug auf unbekannte, leistungsbezogene Aufgaben die Ausprägung des IP wahrscheinlicher werden lasse. In diesem Zusammenhang stellen die Autorinnen die These des Top Dog Factor auf: Die Häufigkeit der Wahrnehmung des IP nimmt durch Gewöhnung und zunehmender Routine in Bezug auf leistungsbezogene Anforderungen ab. Verlassen Personen diese Komfortzone 25
34 und stehen neunen Herausforderungen gegenüber, attribuieren ImpostorInnen den Umstand, noch nicht zur Gruppe der SpitzenleisterInnen zu gehören, auf unzureichende Fähigkeiten, obwohl es sich um einen gewöhnlichen Prozess der Einarbeitung handelt. Harvey und Katz (1985) sehen im Top Dog Factor die Erklärung dafür, dass das IP bei im Studium fortgeschrittenen, herausragenden Studierenden in geringerer Häufigkeit vorliege, als solche die ihr Studium gerade erfolgreich beendeten und neuen Herausforderungen gegenüberstehen Austausch über Schwierigkeiten Die beschriebenen strukturellen Bedingungen der Organisation des Wissenschaftsbetriebs an Hochschulen haben Auswirkungen auf den Austausch über Schwierigkeiten im Kollegium. Im wettbewerbsorientierten Wissenschaftsbetrieb (Klinkhammer, 2013; Winter, 2012) hat sich eine Kultur des für sich Behaltens von Problemen und Sorgen entwickelt, die WissenschaftlerInnen mit ihren Ängsten alleine lässt. Konkurrenz unter KollegInnen (siehe Kapitel 3.3.1) und der Anspruch, der dem WissenschaftlerInnenberuf anhaftet (siehe Kapitel 2.2), befeuern diese kontraproduktive Kommunikationskultur. Inhaltliche Isolation aufgrund von stark ausdifferenzierten Forschungsbereichen mit hochgradigen Spezialisierungen werden ebenfalls als Ursache für fehlenden Austausch unter ForscherInnen genannt (Zorn 2005). Dies hat zur Folge, dass WissenschaftlerInnen, die keine Möglichkeit zum Austausch über Schwierigkeiten im Arbeitsumfeld wahrnehmen, mit arbeitsbezogenen Schwierigkeiten für sich bleiben. Die Wahrscheinlichkeit von Selbstzweifeln an den eigenen akademischen Fähigkeiten steigt ebenfalls, wenn WissenschaftlerInnen nicht von ähnlichen Hürden ihrer KollegInnen erfahren (Klinkhammer & Saul-Soprun, 2009). Studdard (2002) unterbreitet den Vorschlag, zur Reduktion der akademischen Einsamkeit Austauschmöglichkeiten in sozialen Gruppen in geschütztem Rahmen zu schaffen Soziale Unterstützung Soziale Unterstützung im Sinne fachlichen und emotionalen Beistandes von KollegInnen und Vorgesetzten aus dem Arbeitsumfeld wird als generelle Ressource gegenüber der Ausprägung des IP vermutet (Clance, 1985; Klinkhammer & Saul-Soprun, 2009; Parkman & Beard, 2008). So ist naheliegend, dass soziale Unterstützung die mutmaßlichen Effekte der 26
35 Konkurrenz am Arbeitsplatz sowie der wahrgenommenen Enttäuschung des Arbeitsumfeldes abschwächt und die Wahrscheinlichkeit für Austausch über Schwierigkeiten sowie konstruktives Feedback erhöht. Emotionale Unterstützung wird nach Ducharme und Martin (2000) als Ausmaß der Wahrnehmung von Akzeptanz und Beistand im Arbeitsumfeld definiert. Als fachliche Unterstützung beschreiben die Autoren konkret inhaltliche, arbeitsbezogene Hilfestellungen. Aufgrund fehlender empirischer Befunde für einen direkten Konnex zwischen sozialer Unterstützung und dem IP, lassen sich Zusammenhänge nur über gemeinsame, affektive Folgen vermuten (siehe Kapitel 1.3.1). So fanden beispielsweise Gillespie, Walsh, Winefield, Dua und Stough (2001), dass die Beeinträchtigung der Leistung und des Wohlbefindens von WissenschaftlerInnen aufgrund arbeitsbezogenen Stresserlebens durch soziale Unterstützung von MitarbeiterInnen und Vorgesetzten reduziert werden kann. Weiters verringert soziale Unterstützung das Stresserleben von Personen in Arbeitsumgebungen mit hoher Stressbelastung (Schmieder & Smith, 1996). Zudem finden sich positive Korrelationen zwischen Arbeitszufriedenheit und emotionaler sowie fachlicher Unterstützung aus dem Arbeitsumfeld (Ducharme & Martin, 2000). In der Literatur zur Entstehung und Aufrechterhaltung des IP im Hochschulkontext wird die Rolle von MentorInnen in Zusammenhang mit dem IP diskutiert (z.b. Clance & O Toole, 1987). Whitman und Shanine (2012) sehen in positiven Beziehungen zu MentorInnen für DoktorandInnen die Wahrscheinlichkeit der Internalisierung von positivem Feedback durch eine in der Wissenschaft erfolgreiche Person in Vorbildfunktion erhöht. So könnten gerade junge WissenschaftlerInnen, neben der praktischen Unterstützung in Forschung und Lehre (Jungbauer-Gans & Gross, 2013), vom Spiegeln der eigenen Fähigkeiten und Qualifikationen durch MentorInnen profitieren (Hooper, Wright, & Burnham, 2012; McCormick & Barnes, 2008). Besonders jenen Personengruppen, die sich aufgrund von Merkmalen wie Geschlecht, Alter oder sozialer Herkunft als benachteiligte Minderheit unter KollegInnen fühlen, könnten MentorInnen nützen (siehe Kapitel 3.3.9). So sehen Wissenschaftlerinnen aus dem ArbeiterInnenmilieu einen Großteil ihres Erfolges mit Blick auf ihre Bildungskarriere in der Unterstützung und Bestärkung durch herausragende Förderinnen und Förderer begründet (Miller & Kastberg, 1995). Clance und O'Toole (1987) führen ihre Beobachtung der höheren Ausprägungen des IP bei Frauen an Hochschulen unter anderem auf fehlende MentorInnen und weibliche Vorbilder zurück. 27
36 Parkman und Beard (2008) stellen einen Zusammenhang zwischen Kündigungsquoten und dem IP her. So würde die Angst vor Entlarvung des vermeintlichen intellektuellen Betrugs zur Selbstselektion von MitarbeiterInnen führen. MentorInnen- und Buddy-Programme hätten das Potential solcher Selbstselektion in Organisationen vorzubeugen. Der Benefit für die betreffende Organisation läge in personeller Planungssicherheit und langfristiger Bindung von Fachkräften Feedback Ein wesentliches Merkmal von unter dem IP leidenden Personen stellt deren Unfähigkeit dar, positives Feedback aus dem Umfeld zu internalisieren (siehe Kapitel 1.3.5). Mehrfach wird von AutorInnen auf den Effekt der Bewusstmachung von positivem Feedback für Betroffene verwiesen. Bereits in der ersten Publikation zum IP schlagen Clance und Imes (1978) ImpostorInnen vor, positives Feedback schriftlich zu protokollieren. Brems et al. (1994) merken an, dass Feedback für MitarbeiterInnen zu einer Stärkung in der positiven Selbstwahrnehmung und des Selbstwerts führen könnte, um so die Ausprägung des IP weniger wahrscheinlich werden zu lassen. Fehlendes arbeitsbezogenes Feedback hingegen lasse Betroffene im Ungewissen über Wertschätzung und die Güte ihrer Arbeit. Nur mittels Feedback würden Erfolge überhaupt erst erkenn- und in einem nächsten Schritt internalisierbar (Clance, 1985). Die Realität zeigt, dass es vielen jungen WissenschaftlerInnen jedoch generell an Rückmeldung auf ihre Arbeit mangelt (Schmidt, 2008). In ihrer Darstellung der Auswirkungen des IP auf personalplanerische Entscheidungen in Unternehmen werden Parkman und Beard (2008) in ihren Empfehlungen konkret: Sie raten Führungskräften zu persönlichem und unmittelbar auf die Arbeit bezogenem, positivem Feedback, das Fähigkeiten und Fertigkeiten von MitarbeiterInnen direkt anspricht. Laut den Autorinnen könne so der Gefahr der Ausprägung des IP bei zur Abwertung der eigenen Fähigkeiten tendierenden Beschäftigten am effektivsten entgegengewirkt werden Unterschiede zur Mehrheit der KollegInnen Bereits in den Anfängen der Forschung IP schwang der Gedanke mit, dass soziale Kategorien (Oakes, Turner, & Haslam, 1991) wie Geschlecht, Ethnizität und Alter (Clance & Imes, 1978; Harvey & Katz, 1985), aber auch soziale Herkunft (Miller & Kastberg, 1995) in Zusammenhang mit dem IP stünden. 28
37 Harvey und Katz (1985) diskutieren die These, dass ImpostorInnen aufgrund der eigenen Wahrnehmung von Unterschieden bezüglich einer sozialen Kategorie, eine Exponiertheit gegenüber ihrem Umfeld empfinden. Mit Bezug auf Geschlecht als unterschiedsbildenden Faktor beschreiben die AutorInnen, dass sowohl erfolgreiche Männer in als weiblich angesehenen Berufen wie auch erfolgreiche Frauen in männlich dominierten Branchen Ängste davor ausbilden, dass sie die Zurückweisung des Widerlegens eines Stereotypes ausbilden. Das IP diene als unbewusster Schutzmechanismus: Wenn ich annehme, dass Erfolge nur erschlichen und nicht wirklich verdient seien, reduziere ich Ängste vor der Entkräftung von Geschlechterstereotype (siehe Kapitel 1.3.6). Anhand eines Fallbeispiels beschreiben Harvey und Katz (1985) eine weitere These über die Wirkung der Selbstwahrnehmung als exponierte Minderheit in Zusammenhang mit dem IP: die Funktion als AlibigeberIn. Selbstzweifel von Minderheiten an der Rechtmäßigkeit des eigenen Erfolges entstehen, gerade weil sie in einer sozialen Kategorie die Ausnahme bilden. Betroffene haben die Vermutung, aufgrund Ausnahmestatus, Positionen und Ämter zu erhalten, obwohl sie deren Anforderungen nicht genügen. In dieser Funktion würden sie beispielsweise dem Image von Diversität der Einrichtung dienen. Empirische Befunde zu Geschlechtsunterschieden im akademischen Kontext wurden bereits in Kapitel beschrieben. In Zusammenhang mit Ethnizität fanden Stahl, Turner, Wheeler und Elbert (1980) eine stärkere Ausprägung des IP bei Studierenden mit afroamerikanischen Wurzeln. Im Rahmen einer qualitativen Studie beschrieben afroamerikanische DoktorandInnen, dass sie sich vom IP betroffen fühlten als sie erfuhren, dass nur ein sehr geringerer Prozentsatz der Träger des Doktortitels afroamerikanischer Herkunft sei (Craddock et al., 2011). Bezüglich der sozialen Herkunft in Zusammenhang mit dem IP beschreiben Miller und Kastberg (1995) die im Rahmen einer qualitativen Studie erhobenen Zweifel von erfolgreichen Akademikerinnen aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status daran, ihre Position aus eigener Kraft erreicht zu haben. Die befragten Wissenschaftlerinnen begründeten deren Ursprung mit der Unterrepräsentation von VertreterInnen ihrer sozialen Klasse im Hochschulkontext. Harvey und Katz (1985) sprechen in Bezug auf Frauen mit sozialer Herkunft aus der Arbeiterklasse im Hochschulkontext von einer doppelten Vulnerabilität für die Ausprägung des IP. 29
38 4 Zielsetzung und Forschungsfragen Im Folgenden wird zunächst die allgemeine Zielsetzung der Studie beschrieben, um im Anschluss konkrete Forschungsfragen abzuleiten. 4.1 Allgemeine Zielsetzung Seit der ersten Beschreibung des Impostor Phänomens (Clance & Imes, 1978) widmeten sich eine Vielzahl von Untersuchungen der Prävalenz des IP in verschiedenen Stichproben (z.b. SchülerInnen, Studierende, ÄrztInnen) und den affektiven Erlebniszuständen von unter dem IP leidenden Personen. Das beeinträchtigte Wohlempfinden von ImpostorInnen ist durch Zusammenhänge in einem Spektrum von Ängstlichkeit bis zu hin Depression nun hinreichend belegt (siehe Kapitel 1.3.1). Weiteres Forschungsinteresse richtete sich bislang auf die von Clance (1985) im Impostor Profil definierten Charakteristiken des IP (Kapitel 1.2). Empirische Befunde für Zusammenhänge mit Konstrukten wie dem Perfektionismus (Kapitel 1.3.2), übermäßiger Ansprüche an die eigenen Leistungen, den Folgen von Angst vor Misserfolg (Kapitel 1.3.4) sowie Erfolg (Kapitel 1.3.6) und Attributionsstilen (Kapitel 1.3.5) sind vielfach bewiesen. Einen umfassenden Überblick über die Konzeptualisierungen des IP sowie Strömungen der Forschung liefern Zall (2014) sowie Sakulku und Alexander (2011). Weitestgehend außerhalb des Fokus der Forschung lag bislang die Untersuchung von Kontexten der Entstehung und Aufrechterhaltung des IP. Die Wirkung des Umfeldes auf die Ausprägung und Aufrechterhaltung des IP wurde als möglicher Einflussfaktor bislang in keiner Studie empirisch überprüft. Befunde einzelner Studien jüngeren Datums (z.b. Jöstl et al., 2012) geben den Anlass dazu, theoretische Annahmen bezüglich des IP und Umgebungsfaktoren am Beispiel des Arbeitsumfeldes Hochschule zu überprüfen. Die negativen Auswirkungen des IP auf akademische Leistungen und Erfolg (siehe Kapitel 1.4) bilden die Grundmotivation dieser Untersuchung. Bisherige Forschungen haben gezeigt, dass DoktorandInnen, besonders jene mit Hochschulanstellung, eine besonders betroffene Berufsgruppe darstellen (siehe Kapitel 2.1). Erklärtes Ziel ist es, das IP in dieser Stichprobe mit einem spezifischen Blick auf das Arbeitsumfeld besser zu verstehen, um Vorschläge für Maßnahmen einer erfolgreichen Prävention und ggf. Intervention für diesen Kontext zu liefern. 30
39 4.2 Forschungsfragen Das konkrete Forschungsinteresse wird in diesem Kapitel in Form von Forschungsfragen formuliert. Dabei adressiert Forschungsfrage 1 alle DoktorandInnen, während Forschungsfrage 2 sich nur auf die Teilstichprobe der Promovierenden mit Hochschulanstellung bezieht Forschungsfrage 1: Ausprägung des IP bei Doktoratsstudierenden Die Ergebnisse der Studie von Jöstl et al. (2012) zeigen, dass jene DoktorandInnen, die an der Hochschule angestellt sind, verstärkt unter dem IP leiden. Zudem fanden die AutorInnen Frauen in besonderem Maße vom IP belastet (siehe Kapitel 2.1 & Kapitel 2.1.1). Ob sich diese Befunde nun replizieren lassen und eventuelle Interaktionseffekte zwischen Geschlecht und Hochschulanstellung feststellbar sind, fasst die Forschungsfrage 1a zusammen. Es gibt widersprüchliche Befunde bezüglich der Variation des IP über das Lebensalter sowie über das akademische Alter (siehe Kapitel 2.1.2). Ob die Annahmen von Thompson et al. (1998), wonach das IP mit zunehmendem Lebensalter abnimmt oder die Vermutung von Harvey und Katz (1985), wonach sich das IP mit zunehmendem akademischen Alter verringert, empirisch zutreffen, wird entlang der Forschungsfrage 1b überprüft. 1a) Unterscheiden sich Frauen und Männer mit und ohne Hochschulanstellung in der Ausprägung des Impostor Phänomens? 1b) Gibt es Zusammenhänge zwischen dem Lebensalter bzw. dem akademischen Alter von DoktorandInnen mit dem Impostor Phänomen? Forschungsfrage 2: Aspekte des Arbeitsumfeldes Hochschule in Zusammenhang mit dem IP Wie in Kapitel dargestellt, gibt es empirische Hinweise darauf, dass erhöhte Konkurrenz im Arbeitsumfeld Vergleiche bezüglich des unternommenen Arbeitsaufwandes unter KollegInnen begünstigt und in weiterer Folge Zweifel an eigenen Fähigkeiten verstärkt. Häufige Leistungsevaluation wird, aufgrund eines der Praxis des Bewertens inhärenten Hinterfragens von Fähigkeiten, ebenfalls in Konnex mit dem IP vermutet (siehe Kapitel 3.3.2). Geraten DoktorandInnen unter hohe Arbeitsbelastung, so wird angenommen, dass das 31
40 Enttäuschen von Ansprüchen des Arbeitsumfeldes die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dieser Umstand auf eine Insuffizienz der eigenen Fähigkeiten attribuiert wird (siehe Kapitel 3.3.3). Liegen Konflikte zwischen Arbeits- und Privatleben vor, schürt dies Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, da der Anspruch beide Lebensfelder erfolgreich zu gestalten nicht erfüllt werden kann (siehe Kapitel 3.3.4). Soziale Unterstützung von KollegInnen und Vorgesetzten wird als Ressource gegenüber dem IP eingeschätzt, welche Konkurrenz verhindert, Austausch über Schwierigkeiten fördert und praktische fachliche Hilfestellungen im Forschungsprozess zur Folge hat (siehe Kapitel 3.3.7). Ob die eben beschriebenen Aspekte des Arbeitsumfeldes Hochschule mit dem IP in Verbindung stehen, fasst folgende Forschungsfrage zusammen: 2) Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Wahrnehmung von Konkurrenz im Arbeitsumfeld (1), der Leistungsevaluation (2), der Enttäuschung des Arbeitsumfeldes (3), des Konfliktes zwischen Arbeits-und Privatleben (4), der sozialen Unterstützung von KollegInnen (5) sowie von Vorgesetzten (6) und dem Impostor Phänomen? Forschungsfrage 3: Austausch über Schwierigkeiten Wie in Kapitel ausgeführt, wird die fehlende Möglichkeit des Austausches über Schwierigkeiten mit Personen aus dem Arbeitsumfeld in Zusammenhang mit dem IP vermutet. Die Wahrscheinlichkeit von Selbstzweifeln bezüglich der eigenen Fähigkeiten erhöht sich, da beispielsweise Krisen im Forschungsprozess ohne die Sichtweise Anderer schlechter relativiert werden können. Das Forschungsinteresse an der Wahrnehmung der Kultur eines Austausches von ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen sowie Bewertungen der Praxis, spiegelt sich in Forschungsfrage 3a wieder. Bislang nicht untersucht wurde der Umgang von ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen in Konfrontation mit Schwierigkeiten im Arbeitsprozess anhand von praktischen Beispielen aus dem Arbeitsalltag. Zwar gibt es Hinweise auf den Zusammenhang des IP mit perfektionistischem (siehe Kapitel 1.3.2) oder prokrastinierendem Verhalten und Erleben (siehe Kapitel 1.3.4), es wurde jedoch bislang kein Bezug zu einem spezifischen Arbeitskontext hergestellt. Forschungsfrage 3b adressiert diese Forschungslücke. 32
41 3a) Wie beschreiben ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen den Austausch über Schwierigkeiten im Kollegium allgemein? 3b) Welche Muster beschreiben ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen im Umgang mit Schwierigkeiten im Arbeitsprozess und wie reagiert das Arbeitsumfeld? Forschungsfrage 4: Soziale Unterstützung aus dem Arbeitsumfeld Soziale Unterstützung wird als mögliche Ressource gegenüber dem IP gesehen (siehe Kapitel 3.3.7). Während Forschungsfrage zwei (Kapitel 4.2.2) das Ausmaß von fachlicher und emotionaler Unterstützung durch KollegInnen und Vorgesetzte adressiert, steht im Rahmen der folgenden Forschungsfrage die Art und Weise der sozialen Unterstützung im Fokus. 4a) Welche Formen der Unterstützung durch KollegInnen beschreiben ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen? MentorInnen im Arbeitsumfeld werden als Ressource gegenüber dem IP vermutet (siehe Kapitel 3.3.7). Das Interesse daran, ob ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen die Anwesenheit von MentorInnen wahrnehmen und welche Funktion diese für sie im Arbeitskontext Hochschule übernehmen, drückt sich in den Forschungsfragen 4b und 4c aus. 4b) Nennen ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen die Anwesenheit eines/r Mentors/in in ihrem Arbeitsumfeld? 4c) Welche Funktionen erfüllen MentorInnen für ImpostorInnen und Nicht- ImpostorInnen? Forschungsfrage 5: Feedback Feedback erleichtert es eine realistische Einschätzung über die Güte der eigenen Arbeit zu treffen. Wird Personen diese Möglichkeit der Selbsteinschätzung durch Rückmeldung genommen, so verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass Betroffene Erfolge wahrnehmen und internalisieren können (siehe Kapitel 3.3.8). In welcher Form ImpostorInnen und Nicht- ImpostorInnen im Arbeitskontext Hochschule Feedback wahrnehmen (Forschungsfrage 5a), wie sie dessen Güte und Fokus bewerten (Forschungsfrage 5b) sowie welche emotionalen 33
42 Reaktionen sie auf Feedback zeigen (Forschungsfrage 5c) ist in diesem Zusammenhang von Interesse. 5a) Wie beschreiben ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen Feedbackabläufe bezüglich der eigenen Arbeit? 5b) Wie bewerten ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen die Güte und den Fokus des Feedbacks, das sie erhalten? 5c) Welche emotionale Reaktion beschreiben ImpostorInnen und Nicht- ImpostorInnen, nachdem sie Feedback erhalten haben? Forschungsfrage 6: Unterschiede zur Mehrheit der KollegInnen Die Wirkung von sozialen Unterscheidungsmerkmalen und eine damit einhergehende Selbstwahrnehmung als exponierte Minderheit wird in Kapitel mit dem IP in Verbindung gebracht. Das Interesse an der Wahrnehmung von sozialen Merkmalen als Unterschied zu ihrem Arbeitsumfeld sowie antizipierte Konsequenzen und der Umgang mit diesen, spiegelt sich in den Forschungsfragen 6a bis 6c wider. 6a) Beschreiben ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen Merkmalsunterschiede der eigenen Person im Vergleich zum Kollegium? 6b) Wie beschreiben ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen die Konsequenzen von Merkmalsunterschieden? 6c) Wie beschreiben ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen ihre Reaktion auf Konsequenzen von Merkmalsunterschieden? Forschungsfrage 7: Charakteristika des IP zu Doktoratsbeginn Harvey und Katz (1985) beschreiben in ihrer als Top Dog Factor bezeichneten These, dass das IP in Konfrontation mit unbekannten Herausforderungen an Intensität zunehme (siehe Kapitel 3.3.9). Die erste Zeit als Doktorandin bzw. Doktorand in Anstellung an der 34
43 Hochschule mit umfassenden neuen Tätigkeiten und Rollen (siehe Kapitel 3.1) kann als eine solche bezeichnet werden. Ob jetzige ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen in einer Selbsteinschätzung Aspekte des IP zur Zeit des Doktoratsbeginns auf sich beziehen und wie sie den Umgang mit diesen beschreiben, steht im Mittelpunkt der Forschungsfragen 7a bis 7c. 7a) Wie schätzen sich ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen bezüglich des IP zu Beginn des Doktorats ein? 7b) Welche Ursachen weisen ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen diesem Gefühl in der Retrospektive zu? Forschungsfrage 8: Zukünftige berufliche Perspektive Die Wirkung des WissenschaftlerInnenbegriffs in Konfrontation mit den reellen Arbeitsbedingungen des Arbeitsumfeldes Hochschule in Bezug auf das IP wurde in Kapitel 3.2 beschrieben. Wie ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen in Hochschulanstellung ihre berufliche Sicherheit beschreiben und über welchen Zeitraum sie diese als gesichert wahrnehmen, soll im Rahmen der Fragestellungen 8a und 8b erforscht werden. Dass das IP sich in seinen negativen Auswirkungen auf Erfolg und Leistung nicht nur im Kurzfristigen (siehe Kapitel 1.4), sondern auch langfristig auf die Bildungskarriere von Betroffenen auswirkt, wird wiederholt von AutorInnen im Forschungsgebiet des IP geäußert (Jöstl et al., 2012; Klinkhammer & Saul-Soprun, 2009; Parkman & Beard, 2008). Mittels Forschungsfrage 8c wird untersucht, ob ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen nach Abschluss des Doktorats eine Karriere an der Hochschule anstreben. 8a) Welche emotionale Bewertung treffen ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen bezüglich der eigenen beruflichen Zukunft, und wie begründen sie diese? 8b) Für welchen Zeitrahmen beschreiben ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen ihre Hochschulanstellung als gesichert? 35
44 8c) Welche berufliche Perspektive sehen ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen an der Hochschule für sich? 36
45 5 Methode Die Operationalisierung der Forschungsinteressen bisheriger Studien zum IP ist, mit Blick auf die Güte der Forschungsdesigns, als sehr durchwachsen zu bewerten. Während der Ursprung der Forschung zum IP auf Einzelfallstudien beruht (Clance & Imes, 1978), basieren die Mehrzahl der Befunde auf einfachen Korrelationen von Ergebnissen aus Fragebogenstudien (z.b. Sonnak & Towell, 2001; Want & Kleitman, 2006). Die Betrachtung des IP in seinen komplexeren Zusammenhängen mittels der Berechnung statistischer Modelle bilden die absolute Ausnahme (z.b. Jöstl et al., 2012) und experimentelle Designs sind eine Seltenheit (z.b. Leary et al., 2000; Thompson et al., 1998). Längschnittstudien fehlen zur Gänze. Da das IP mit einem expliziten Fokus auf das Arbeitsumfeld bislang nicht systematisch untersucht wurde, verfolgt dieser Ansatz das Ziel diesbezüglich eine möglichst breite Datenbasis zu schaffen. In den folgenden Kapiteln werden das Untersuchungsdesign und die praktische Durchführung erläutert sowie die Stichprobe(n) beschrieben. Der Darstellung der Erhebungsinstrumente folgt die Beschreibung der Analysemethode. 5.1 Untersuchungsdesign Das Design dieser Untersuchung steht für den Versuch, dem bisherig dünnen empirischen Forschungsstand zum IP bei WissenschaftlerInnen in Interaktion mit ihrem Arbeitsumfeld mittels verschiedener methodischer Ansätze zu begegnen. Um die Vorzüge der qualitativen und quantitativen Paradigmen und deren Synergien im Sinne der Triangulierung (Hussy, Schreier, & Echterhoff, 2010) zu nutzen, wurden Instrumenten aus beiden Methodenpools gewählt. Zu den in Kapitel 4.2 beschriebenen Aspekten des Untersuchungsgegenstandes (Forschungsfragen 1-2) wird mittels quantitativer Erhebungsinstrumente hypothesenprüfend vorgegangen. Die Erhebung qualitativer Daten im Rahmen problemzentrierter Interviews erfüllt eine eher explorative, Hypothesen generierende Funktion (Bortz & Döring, 2006). Der gewählte zweistufige Erhebungsplan erfolgte nach (Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 2007) einem Mixed Method Paradigma: In einem ersten Schritt wurden quantitative Daten zur Ausprägung des IP Phänomens selbst und weiteren, mit dem Arbeitsumfeld Hochschule in Verbindung stehenden Konstrukten, bei DoktorandInnen mittels Online-Fragebogen erhoben. Auf Basis dieser Daten wurden anschließend Gruppen von DoktorandInnen mit 37
46 hohen und niedrigen Ausprägungen des IP gebildet und zu einem Interview eingeladen (Abbildung 2). Erhebung quantitativer Daten mittels Online- Fragebogen Auswahl & Kontakt der InterviewpartnerInnen Durchführung der Interviews Auswertung quantitativer Daten Auswertung qualitativer Daten Qualitative Ergebnisse Quantitative Ergebnisse Abbildung 2. Chronologischer Untersuchungsablauf. In der Kategorisierung von Mixed Method Designs nach Creswell und Clark (2007) entspricht dieser Ansatz einem explanativen Triangulierungsdesign: Die vorangestellte Erhebung des IP und weiterer Aspekte der Interaktion von ImpostorInnen im Arbeitsumfeld Hochschule mittels quantitativer Instrumente bildete zunächst die Datenbasis für Entscheidungen im Rahmen der qualitativen Erhebung (Auswahl der InterviewpartnerInnen). Zum anderen wurden die quantitativen Daten zum Prüfen von Hypothesen ausgewertet. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt jedoch, nach der Verortung von Mixed Method Designs nach Morse (1990), in der Analyse der qualitativen Daten, die in problemzentrieren Interviews gewonnen wurden. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte der Durchführung ausführlich beschrieben. 5.2 Durchführung Die Erhebung der quantitativen und der qualitativen Daten erfolgte in zwei Etappen, die in diesem Kapitel ausführlich beschrieben werden Erhebung der quantitativen Daten mittels Online-Fragebogen Um eine möglichst große Anzahl an StudienteilnehmerInnen zu gewinnen, wurden die für Doktoratsstudierende zuständigen Stellen der Universität Wien, der Technischen Universität Wien, der Wirtschaftsuniversität Wien und der Universität für Bodenkultur sowie deren HochschülerInnenvertretungen um das Versenden einer Einladung, einer Informationsbroschüre (siehe Anhang 1) und des Links zum Online-Fragebogen (siehe Anhang 2) gebeten. Da bei der Nennung des Impostor Phänomens als Untersuchungsgegenstand mit erheblichen Verfälschungen der Ergebnisse zu rechnen war, wurde die Studie unter dem Titel 38
47 Wissenschaft als Beruf und mit dem Forschungsinteresse Wohlbefinden und Arbeitsbedingungen im Hochschulkontext geführt. Das DoktorandInnenzentrum der Universität Wien (DZUW) versandte, nach vorangegangener Prüfung der Einhaltung von Datenschutzrichtlinien durch den Betriebsrat der Universität Wien, im Februar 2014 die Unterlagen via verteiler an 9367 DoktorandInnen. Laut Aussage des DZUW werden von den Kontaktierten ca Personen als aktiv am Doktoratsstudium partizipierend eingeschätzt; genaue Daten liegen jedoch nicht vor. Eine Erinnerung mit nochmaliger Bitte um Teilnahme und Nennung der Deadline für die Bearbeitung des Onlinefragebogens erfolgte eine Woche nach der Aussendung. Neben dem DZWU nahm die Fachschaft Doktorat der Technischen Universität Wien die Einladung inklusive des Links zur Studie in die März-Ausgabe (2014) ihres Newsletters auf, welcher an alle Doktoratsstudierenden versandt wurde. Da kein direkter Kontakt zu den DoktorandInnen bestand, war eine Erinnerung zur Teilnahme in diesem Fall nicht möglich. Der Online-Fragebogen war nach der Aussendung der Einladungen insgesamt 16 Tage ( ) zur Bearbeitung freigeschaltet Erhebung der qualitativen Daten mittels problemzentriertem Interview Den TeilnehmerInnen wurde gegen Ende der Bearbeitung des Onlinefragebogens die Möglichkeit geboten, bei Interesse an der Thematik ihren kontakt zu hinterlassen, um zu einem späteren Zeitpunkt an einem die Inhalte vertiefenden Interview teilzunehmen. Die Auswahl der InterviewpartnerInnen erfolgte entsprechend der Fragestellungen auf Basis einer vorläufigen Auswertung der Daten nach den Variablen Geschlecht, Beschäftigungsstatus und Ausprägungsgrad des IP (siehe Kapitel 5.6.2). Die Interviews wurden unter Einsatz eines Interviewleitfadens (siehe Anhang 4) von zwei Interviewern geführt und fanden im Zeitraum von März bis April 2014 statt. Dabei stand es den Interviewten frei, einen für sie angenehmen, ruhigen Ort zur Durchführung zu benennen oder eine angebotene Räumlichkeit des Arbeitsbereiches für Bildungspsychologie & Evaluation der Fakultät für Psychologie zu wählen. Nach vorheriger Bitte um Erlaubnis der Interviewten mit Verweis auf Schweigepflicht und Anonymisierung des Materials wurde das Interview mit einem digitalen Audioaufnahme-gerätes aufgezeichnet. Insgesamt umfassen die Tonaufnahmen 1166 Minuten (19.43 Stunden); die Dauer der Interviews variierte zwischen 35 und 107 Minuten (M = 61). 39
48 5.3 Stichprobenbeschreibung Bei der Mehrzahl der Untersuchungen ist zu kritisieren, dass zur Unterscheidung von tatsächlichen intellektuellen HochstaplerInnen und ImpostorInnen selten ein Faktor der tatsächlichen Hochleistung erhoben wurde. In Österreich tragen ca Personen einen Doktortitel, was 0.6 Prozent der Bevölkerung entspricht (0.36% Frauen, 0.78% Männer; Statistik Austria, 2011). Damit zählen angehende DoktorInnen per se zu den qualifiziertesten Fachkräften in der österreichischen Gesellschaft und den erfolgreichsten im formalen Bildungssystem. In diesem Kapitel werden die Gesamtstichprobe der Promotionsstudierenden, die Teilstichprobe von DoktorandInnen mit Hochschulanstellung sowie die Teilstichprobe der InterviewpartnerInnen beschrieben Gesamtstichprobe Über den Erhebungszeitraum hinweg wurde der Fragebogen 947 Mal geöffnet und von 561 Personen vollständig ausgefüllt (59.2%). Davon waren 343 Frauen (61.1%) und 212 Männer (37.8%); 6 Personen machten keine Angabe zu ihrem Geschlecht (1.1%). Die durchschnittliche Bearbeitungszeit betrug 15.8 Minuten. Die Geschlechterverteilung der ordentlichen Doktoratsstudierenden in Österreich (Daten des Sommersemesters 2013) weist mit 53.1 Prozent Männern und 46.9 Prozent Frauen einen leicht abweichenden Wert zur vorliegenden Stichprobe auf. In Bezug auf die Geschlechterverteilung von Doktoratsstudierenden an der Universität Wien, von der aufgrund des direkten Kontakts über das DZWU angenommen werden kann, dass der überwiegende Großteil der Stichprobe sich von dort rekrutierte, ist die Stichprobe repräsentativ (Statistik Austria, 2014). Die Universität Wien ist in Zahlen der Doktoratstudierenden die größte und an ordentlichen Studiengängen die umfassendste Hochschule Österreichs (Universität Wien, 2014), weshalb bezüglich des Geschlechts und des Alters eine gewisse Gültigkeit Ergebnisse für Doktoratsstudierende in Österreich angenommen werden kann. Die Altersspanne reichte von Jahren und das Durchschnitts-alter betrug Jahre (SD = 9.09). Über eine Anstellung an einer Hochschule verfügten 247 Personen (44%) im Gegensatz zu jenen 314 (56%) ohne Beschäftigungsverhältnis. Das akademische Alter im Doktoratsstudium erstreckte sich über eine Zeitspanne von Monaten (M = 41.34, SD = 33.24) wobei TeilnehmerInnen mit nicht eindeutigen Angaben ausgeschlossen werden mussten (n = 499). 40
49 5.3.2 Teilstichprobe DoktorandInnen in Hochschulanstellung Zur quantitativen Erhebung von Aspekten des Arbeitsumfeld Hochschule wurden jenen TeilnehmerInnen, die im Rahmen ihres Doktorates eine Anstellung an der Hochschule innehaben, die in Kapitel angeführten Skalen vorgegeben (n = 247). Die Geschlechterverteilung innerhalb dieser Teilstichprobe weicht nur geringfügig von jener der Gesamtstichprobe ab (Frauen 61.1%, Männer 37.7%, ohne Angabe 1.2%). Das durchschnittliche Lebensalter von Jahren (SD = 4.78) verteilte sich in einer Altersspanne von Jahren und war damit, ebenso wie das akademische Alter in Monaten (M = 35.39, SD = 27.93), in seinem Ausmaß niedriger als in der Gesamtstichprobe Teilstichprobe InterviewpartnerInnen Für die freiwillige Teilnahme am Interview erklärten sich 117 DoktorandInnen bereit, was gut einem Fünftel (20.8%) der Gesamtstichprobe entspricht. Die Voraussetzung der Anstellung an einer Hochschule erfüllten 46 StudienteilnehmerInnen, von welchen 19 DoktorandInnen (11 Frauen, 8 Männer) entsprechend der gewünschten Extremausprägungen des IP ausgewählt und für das Interview gewonnen wurden. Der Altersdurchschnitt entspricht jenem der DoktorandInnen mit Hochschulanstellung (M = 29.11, SD = 1.66), wobei die Spanne des Lebensalters (26-32 Jahre) geringer ausfiel. Die Kriterien zur Auswahl und Zuordnung der Promovierenden in ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen wird in Kapitel beschrieben. Um möglichst vergleichbare Lebenswelten der InterviewpartnerInnen vorzufinden und somit den Einfluss von Störvariablen konstant zu halten, wurden die TeilnehmerInnen, neben der Ausprägung des IP auch hinsichtlich des Geschlechts und Alters ausgewählt. Da die Standardabweichung im Lebensalters gering und die Geschlechterverteilung relativ ausgewogen ist, wird die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der Interviews für die Teilstichprobe der interviewten DoktorandInnen als hoch eingeschätzt. 5.4 Konstruktion des Onlinefragebogens Die Erhebung der quantitativen Daten wurde mittels eines auf der Plattform Unipark programmierten Online-Fragebogens unternommen. Neben der Erhebung des Lebens- sowie des akademischen Alters und Geschlechts der TeilnehmerInnen wurde erfragt, ob ein Beschäftigungsverhältnis an der Hochschule im Rahmen des Doktorats bestand. In weiterer Folge werden die für die Beantwortung der Forschungsfragen 1 und 2 gewählten 41
50 Instrumente beschrieben. Die Reliabilitäten der Skalen, berechnet auf Basis dieser Stichprobe, sind in Kapitel abgebildet Erhebung des Impostor Phänomens Die Ausprägung des Impostor Phänomens wurde mit der aus 20 Items bestehenden und von Clance (1985) entwickelten Clance Impostor Scale (CIPS) in der deutschen Übersetzung von (Klinkhammer & Saul-Soprun, 2009) erhoben. Dieser Fragebogen stellt aufgrund seiner vielfach bestätigten, hohen internen Konsistenz zwischen Cronbach's α =.84 (Prince, 1989) und.94 (French, Ullrich-French, & Follman, 2008; Holmes, Kertay, Adamson, Holland, & Clance, 1993) sowie einer guten Validität (Chrisman et al., 1995) das meistgenutzte Erhebungsinstrument in der Impostor Forschung da. Wie bei Jöstl et al. (2012) beschrieben, wurden 10 Items aufgrund der spezifischen Stichprobe in ihren Formulierungen angepasst und in der ursprünglichen Langform von 20 Items vorgegeben. TeilnehmerInnen wurden gebeten, die Aussagen auf einer 5-stufigen Likertskala (trifft nicht zu trifft zu) zu bewerten. Ein Beispielitem lautet: Manchmal habe ich Angst, dass die anderen merken, wie wenig ich eigentlich weiß und kann Skalen zur Erfassung von Aspekten des Arbeitsumfeldes Hochschule Im Folgenden werden die verwendeten Skalen zur Erhebung jener Merkmale des Arbeitsumfeldes Hochschule dargestellt, für die entsprechend der theoretischen Herleitung eine mögliche Verbindung mit dem IP vermutet wird. Da keine Instrumente für die Erhebung dieser Aspekte vorhanden waren, wurden bereits bestehende Instrumente aus anderen Kontexten adaptiert bzw. übersetzt. Für zwei Skalen mussten theoriegeleitet Items neu konstruiert und nach Feedback von ExpertInnen mehrfach überarbeitet werden. In Kapitel werden diese Skalen faktorenanalytisch und auf ihre Reliabilität hin überprüft. Jedes der Items wurde mit einer 4-stufigen Likertskala (trifft nicht zu - trifft zu) zur Bewertung vorgegeben. Die Items der Skalen sind in ihren Ausformulierungen inklusive statistischer Kennwerte in Anhang 3 einsehbar Konkurrenz In Erhebung der wahrgenommenen Konkurrenz im Arbeitsumfeld wurde die Skala Konkurrenz nach König (2007) aus dem Grund- auf den Hochschulkontext adaptiert 42
51 (Beispielitem: In meinem Arbeitsumfeld gönnt man sich gegenseitig keine Erfolge ). Dabei wurde ein Item als zu schulspezifisch verworfen und durch ein, nach Craddock et al. (2011) als typisch für Konkurrenz im Hochschulkontext berichteten Aspekt, neu erstelltes ersetzt (Item 4: Im Arbeitsbereich wird verglichen und bewertet, wie viel Zeit am Arbeitsplatz verbracht wird ) Leistungsevaluation Die Skala Leistungsevaluation wurde auf Basis der beschriebenen Annahmen (siehe Kapitel 3.3.2) konstruiert und nach Rückmeldung von VertreterInnen der Stichprobe angepasst. Ein Beispielitem lautet Meine Leistungen werden regelmäßigen Evaluationen unterzogen Enttäuschung des Arbeitsumfeldes Die Skala Enttäuschung des Arbeitsumfeldes wurde auf Basis der in Kapitel beschriebenen Theorie ebenfalls neu konstruiert und nach Bewertungen von ExpertInnen sowie VertreterInnen der Zielgruppe überarbeitet. Eine beispielhafte Aussage der Skala lautet In der Erfüllung meiner Aufgaben habe ich oft nur die Wahl zwischen zwei unliebsamen Entscheidungen Konflikte zwischen Arbeits- und Privatleben Die Items der Skala Konflikte zwischen Arbeits- und Privatleben wurden aus der Work-Family Conflict Scale (Netemeyer, Boles, & McMurrian, 1996) entnommen. Die deutsche Übersetzung wurde dahingehend adaptiert, das sie sich nun, statt rein auf das Familienleben, auf das Privatleben im Allgemeinen bezieht. Im englischen Original weist die Skala eine hohe Reliabilität auf (Cronbach's α =.88). Eine der zu bewertenden Aussagen lautet: Der Zeitaufwand, den mir meine Arbeit abverlangt, macht es mir schwer, meine privaten Verpflichtungen zu erfüllen Sozialen Unterstützung am Arbeitsplatz Die emotionale und fachliche Unterstützung am Arbeitsplatz wurde mittels der ins Deutsche übersetzten Skalen Affective social support und Instrumental social support nach Ducharme und Martin (2000) erfasst. Die Skala weist in der US amerikanischen Stichprobe eine hohe 43
52 Reliabilität auf (Cronbach's α =.80). In der vorliegenden Studie wurde sich dafür entschieden, die Items in Bezug auf KollegInnen und Vorgesetzte getrennt bewerten zu lassen, da aufgrund der stark ausgeprägten Hierarchie an Hochschulen (siehe Kapitel 3.2) Unterschiede in der sozialen Unterstützung angenommen werden. Somit erfassen die vier Skalen, namentlich Emotionale Unterstützung (KollegInnen), Fachliche Unterstützung (KollegInnen), Emotionale Unterstützung (Vorgesetzte) und Fachliche Unterstützung (Vorgesetzte), die soziale Unterstützung am Arbeitsplatz. Die Zulässigkeit einer Trennung zwischen KollegInnen und Vorgesetzten wird in weiterer Folge statistisch überprüft (siehe Kapitel 5.6.1). Ein Beispielitem für emotionale Unterstützung lautet Meine Kolleginnen und Kollegen interessieren sich für mich und eines für fachliche Unterstützung Meine Kolleginnen und Kollegen geben mir wertvolle Tipps bei Problemen, die meine Arbeit betreffen. In Abbildung 3 wird beispielgebend die Form der Darstellung dieser Skala im Onlinefragebogen gezeigt. Abbildung 3. Operationalisierung der Erhebung der sozialen Unterstützung am Arbeitsplatz. 5.5 Konstruktion des Interviewleitfadens und Durchführung der Interviews Zur Erhebung der in Kapitel 3.3 beschriebenen Aspekte des Verhaltens und Erlebens von ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen in deren jeweiligem Arbeitsumfeld wurde das qualitativ sowie quantitativ inhaltsanalytisch auswertbare, teilstrukturierte und offene Instrument des problemzentrierten Interviews (PZI) gewählt (Witzel, 2000). Die von Witzel (2000) formulierten Grundpositionen des PZI bilden ab, weshalb für das Forschungsvorhaben diese Methode gewählt wurde: Die Untersuchung des IP in Verbindung mit dem Arbeitskontext Hochschule aus Sicht von DoktorandInnen stellt eine gesellschaftlich relevante Thematik dar. Der bisher dünne Bestand an Forschungsergebnissen erfordert Offenheit und Flexibilität in Annäherung an den Untersuchungsgegenstand, weshalb ein ausschließlich quantitativer Zugang nicht zur gewünschten Datenbasis führen würde, obwohl sich dessen Ergebnisse eher generalisieren ließen. Problemzentrierte Interviews hingegen werden auf Basis von theoretischen Vorannahmen strukturiert und ermöglichen es zudem, 44
53 in der Interviewsituation problemorientierte Nachfragen zu stellen (Problemzentrierung). Die Grundposition der Gegenstandsorientierung drückt sich in der Kombination des PZI mit der vorangegangenen quantitativen Erhebung aus. Dabei ermöglicht das Interview eine flexible Reaktion auf unterschiedliche Reflexionsniveaus sowie Eloquenz von Befragten. Der Untersuchungsgegenstand des IPs wie auch des Arbeitsumfeldes ist als persönlich und sensibel zu werten, weshalb der Nutzen des PZI in der Möglichkeit liegt, eine Vertrauensbasis zu den Befragten aufzubauen, die eine Erhebung von ökologisch valideren Daten wahrscheinlicher werden lässt (Prozessorientierung). Auf Basis der in Kapitel 4.2 formulierten Forschungsfragen wurden die jeweiligen Themenkomplexe in Form eines Interviewleitfadens operationalisiert, um die Verallgemeinerbarkeit und Vergleichbarkeit (Mey & Mruck, 2010) der Ergebnisse zu gewährleisten (siehe Anhang 4). Die Konstruktion des Leitfadens wurde in Form mehrfacher Feedbackschleifen von ExpertInnen wie auch VertreterInnen der Zielgruppe begleitet. Parallel zu diesem Prozess wurden jeweils Probeinterviews geführt und der Leitfaden im Hinblick auf das Forschungsinteresse in Formulierungen sowie Aufbau adjustiert. Entlang der bei Lamnek (2005) beschriebenen Phasen des PZI wurde für jeden der sechs Problembereiche (Schwierigkeiten im Arbeitsalltag, Soziale Unterstützung, Feedbackprozesse, Unterschiede zur Mehrheit der KollegInnen, Charakteristika des IP zu Doktoratsbeginn, Zukünftige berufliche Perspektiven) eine Einleitung mit dem Ziel verfasst, den jeweiligen Themenkomplex für die soziale Welt von DoktorandInnen anschlussfähig zu machen. Um im Sinne der allgemeinen Sondierung nach Lamnek (2005) zum Erzählen anzuregen sowie das offene Format stärker inhaltsgenerierend zu nutzen, wurden die Interviewten dazu aufgefordert, Beispielsituationen aus ihrem Arbeitsalltag zu beschreiben oder ihre Einschätzung zu vorformulierten Vignetten abzugeben. Entsprechend der Phase der spezifischen Sondierung wurden Aussagen von Seiten des Interviewers mit eigenen Worten wiedergegeben (Zurückspiegelungen) und Verständnisfragen gestellt. Inhaltlich ergab sich die Möglichkeit für den Interviewer sowohl mittels Adhoc-Fragen (direkte Fragen) auf Äußerungen zu reagieren, als auch bei Bedarf aus einem bereits bestehenden Pool an theoriegeleiteten Nachfragen zu wählen. Eine subjektive Einschätzung der Gesprächsatmosphäre und Nennung besonderer Vorkommnisse während des Interviews sowie relevanter Kommentare vor dem Ein- bzw. nach dem Abschalten des Aufnahmegeräts wurden anschließend in Form eines Postskripts 45
54 (Mey & Mruck, 2010) vom jeweiligen Interviewer protokolliert. Das Interview wurde auf einem digitalen Aufnahmegerät mitgeschnitten und mittels der Software f4 in Protokolltechnik transkribiert. Dialektwörter wurden in Schriftdeutsch übertragen und nonverbale Aspekte wie Pausen oder Gelächter mittels Zeichen vermerkt (Lamnek, 2005). 5.6 Quantitative Auswertungsverfahren Die deskriptive und inferenzstatistische Analyse der quantitativen Daten des Online- Fragebogens wurde mittels des Statistikprogramms IBM SPSS Statistics (Version 20) unternommen. Grafiken und Tabellen wurden mittels Microsoft Excel (Version 365) erstellt. In einer Voranalyse wurden die Reliabilitäten aller Skalen überprüft sowie explorative Faktorenanalysen bei jenen unternommen. Zur Beantwortung der Fragestellungen 1 und 2 wurden zweifaktorielle Varianzanalysen sowie schrittweise multiple Regressionen berechnet (Field, 2013). Als α-signifikanzniveau gilt bei allen Auswertungen eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 Prozent. Zu signifikanten Ergebnissen werden nach Cohen (1992) Effektgrößen in r und ηp2 (partielles Eta-Quadrat) angegeben. Entsprechend seiner Einstufung wurden r =.10 bzw. ηp 2 =.01 als klein, r =.30 bzw. ηp 2 =.06 als mittelgroße und r =.50 bzw. ηp 2 =.14 als große Effekte bewertet Analyse der Skalen Zu den in Kapitel 4.2 formulierten Forschungsfragen 1 und 2 wird in weiterer Folge die deskriptive Statistik der Skalen dargestellt. Mittels explorativer Faktorenanalyse wurden die eigens für diese Untersuchung konstruierten, adaptierten bzw. übersetzten Skalen in den Ladungen der Items einer jeden Skala auf je einen latenten Faktor hin überprüft. Das Ergebnis der explorativen Faktorenanalyse (Hauptkomponentenanalyse) zeigt für die Skalen Konkurrenz, Leistungsevaluation, Enttäuschung des Arbeitsumfeldes sowie Konflikt zwischen Arbeits- und Privatleben nach Kaiserkriterium und Screetest (= graphisches Verfahren zur Prüfung der Faktorenzahl) je einen unabhängigen Faktor. Die Items der Skalen Emotionale Unterstützung (Vorgesetzte), Fachliche Unterstützung (Vorgesetzte), Emotionale Unterstützung (KollegInnen) und Fachliche Unterstützung (KollegInnen) wurden gemeinsam faktorenanalytisch untersucht, um deren Unabhängigkeit zu überprüfen. Emotionale Unterstützung (Vorgesetzte) und Fachliche Unterstützung (Vorgesetzte) laden hoch auf einem gemeinsamen Faktor und wurden deshalb zu einer Skala, namentlich Emotionale & 46
55 Fachliche Unterstützung (Vorgesetzte), zusammengefasst. Die standardisierten Faktorladungen der Items der betreffenden Skalen erreichen mit Werten zwischen.605 und.908 eine zufriedenstellende Höhe (siehe Tabelle 1). Tabelle 1 Faktorladungen der Skalen zu Aspekten des Arbeitsumfeldes Hochschule Faktorladungen Konkurrenz Leistungsevaluation Enttäuschung des Arbeitsumfeldes Konflikt zwischen Arbeits- und Privatleben Emotionale Unterstützung (KollegInnen) Fachliche Unterstützung (KollegInnen) Emotionale & Fachliche Unterstützung (Vorgesetzte) Anmerkung: 1 = Exklusion eines Items nach Reliabilitätsanalyse; 2 = Faktormatrix rotiert in Varimax Methode Weiters wurden Reliabilitäten (Cronbach's α) bei allen Instrumenten berechnet und Items exkludiert, welche die interne Konsistenz senken. Aus Tabelle 2 lässt sich entnehmen, dass sowohl die Skala zur Erhebung des Impostor Phänomens als auch die Skalen zur Erhebung des Arbeitsumfeldes mit.833 < α <.935 gute bis sehr gute Reliabilitäten aufweisen. Tabelle 2 Statistische Kennwerte der im Onlinefragebogen verwendeten Skalen Anzahl Items M SD Range Cronbach's α Clance Impostor Phenomenon Scale (dt. Übersetzung) Konkurrenz ² ³ Leistungsevaluation ² Enttäuschung des Arbeitsumfeldes ² ³ Konflikt zwischen Arbeits- und Privatleben ² Emotionale Unterstützung (KollegInnen) ² ³ Fachliche Unterstützung (KollegInnen) ² ³ Emotionale & Fachliche Unterstützung (Vorgesetzte) ² ³ Anmerkung. M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; Cronbach's α = Innere Konsistenz (Reliabilität der Skalen). Anmerkung. 1 N = 561; ² n = 247; ³ Skalen nach Exklusion von Items als Folge von Reliabilitätsanalysen Definition der Gruppen von ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen Da sich nicht genügend Männer mit den für das Interview ursprünglich angestrebten Ausprägungen des IP zur Teilnahme am Interview bereit erklärten, wurde der Wertebereich 47
56 für die Einteilung in ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen erweitert. Als ImpostorInnen gelten Personen mit Ausprägungen des IP im Wertebereich zwischen und als Nicht- ImpostorInnen im Spektrum zwischen Punkten. Nach Holmes et al. (1993) ist neben dem gängigen Cut-Off-Score von 62 Punkten auch ein Wert von 58 ein zulässiger Wert, um verlässlich zwischen ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen zu unterscheiden. Fünf Frauen und drei Männer (n = 8) mit niedrigen Ausprägungen auf der CIPS (Frauen 30-41, Männer 34-43) bildeten die Gruppe der Nicht-ImpostorInnen. In der Gruppe der Impostoren befanden sich sieben Impostorinnen und vier Impostoren (n = 11) mit hohen Ausprägungen auf der CIPS (Frauen 79-96, Männer 59-68). 5.7 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring Zur Analyse des transkribierten Interviewmaterials stehen eine Vielzahl an qualitativen Analysemethoden zur Auswahl, die sich in ihrem Ausmaß der Strukturierung und inhaltlichen Schwerpunktsetzungen unterscheiden (Lamnek, 2005). Für die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010b) (in weiterer Folge kurz QIA) wurde sich entschieden, da sie ein Scharnier zwischen qualitativem und quantitativem Paradigma (S. 610) darstellt. Die Stärke des Ansatzes ist die Integration von qualitativen und quantitativen Analysetechniken, deren Einsatz sich nach inhaltlicher Sinnhaftigkeit mit Blick auf die Forschungsfragen entscheidet. Da neben einem rein qualitativen Zugang auch eine Quantifizierung der Ergebnisse angestrebt wird, schlägt Mayring (2010b) selbst die Bezeichnung als qualitativ orientierte kategoriengeleitete Textanalyse (S. 604) vor. Aufgrund der Verbreitung des Ansatzes als qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring wird jedoch weiterhin diese Bezeichnung verwendet. Die einzelnen Schritte der Auswertung erfolgen in sukzessiver Auseinandersetzung mit dem Material entlang von standardisierten Arbeitsschritten. Bezogen auf das hier vorliegende Forschungsvorhaben schafft der Ansatz der QIA den nötigen Freiraum für qualitatives Vorgehen und bietet gleichzeitig mittels standardisierter Methoden Orientierung in den Abläufen der Analyse. Nach einem Vergleich verschiedener Formen qualitativer Inhaltsanalysen befindet Steigleder (2008), die QIA nach sei mit ihren differenzierten Auswertungstechniken [ ] hervorragend dazu geeignet, [ ] qualitativ erhobenes Material auszuwerten (S. 197). So ermöglicht die QIA, dass sich die Güte der Analyse und damit die Gültigkeit der Ergebnisse entlang von Kriterien bewerten lassen. 48
57 5.7.1 Ablauf der Analyse In Anlehnung an das Phasenmodell zum Verständnis qualitativer und quantitativer Analyse (Abbildung bei Mayring, 2010, S. 21) wurde zunächst die Erstellung der Kategoriensysteme unternommen. In einem nächsten Schritt wurden inhaltstragende Aussagen der Interviews zu den entsprechenden Kategorien zugeordnet (kodiert). Die Ergebnisse sind in Kombination von frequenzanalytischen Häufigkeiten und in Textform über die Gruppen von ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen dargestellt. Zu den Stärken der QIA zählt nach Mayring (2010) die Zerlegung der Analyse in einzelne Interpretationsschritte, was sie für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar (S. 59) sowie auf andere Forschungsgegenstände übertragbar macht. Das auf diese Untersuchung angepasste, inhaltsanalytische Ablaufmodell ist in Abbildung 4 dargestellt und wird im Folgenden genauer beschrieben. Abbildung 4. Inhaltsanalytisches Ablaufmodell dieser Untersuchung. Schritt 1 - Festlegung des Ausgangsmaterials In einem ersten Schritt wird definiert, welches Material in die Analyse Einzug halten soll. In diesem Fall wurden der QIA jene Passagen des Transkripts unterzogen, welche als Reaktion der Interviewten auf theoriegeleitete Fragestellungen entstanden sind. Diese Passagen 49
58 enthalten somit alle relevanten Inhalte zur Beantwortung der Forschungsfragen. Auf Analysen der im Anschluss an die Interviews angefertigten Postskripte wurde verzichtet, da die Beschreibungen der Interviewsituation keine Besonderheiten aufwiesen und abseits dessen keine relevanten Informationen für die Ergebnisse der Studie enthielten. Schritt 2 - Bestimmung der Analysetechnik Nach Mayring (2010) stehen je nach inhaltlichem Interesse, die Grundformen der zusammenfassenden, explizierenden und strukturierenden Inhaltsanalyse zur Verfügung. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde das Textmaterial in der Erstellung des Kategoriensystems sowohl einer inhaltlichen Strukturierung in der Anwendung der deduktiven Oberkategorien auf das Textmaterial, als auch einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse zur Erstellung der induktiven Subkategorien unterzogen (siehe Schritt 4). Die anschließende Kodierung des Materials erfolgte in der Logik der strukturierenden Inhaltsanalyse, welche das Textmaterial entlang der theoretischen Forschungsfragen in eine Kurzversion transformiert. Schritt 3 - Definition der Analyseeinheit Die Definition der Analyseeinheiten in seiner Unterteilung nach Kodier-, Kontext- und Auswertungseinheit (Mayring, 2010b) wird in dieser Studie wie folgt entsprochen: Als Kodiereinheit (= kleinster kodierbarer Textbaustein) gelten alle inhaltstragenden Aussagen der befragten DoktorandInnen bezüglich der Forschungsfragen. Die Kontexteinheit, definiert als größtmöglicher Textbestandteil des Materials, kann ganze Absätze umfassen, solange es sich um eine zusammenhängende Aussage handelt. Die Reihenfolge der Auswertung, beschrieben durch die Auswertungseinheit, ist durch den chronologischen Ablauf des Interviews festgelegt. Schritt 4 - Erstellung des Kategoriensystems und des Kodierleitfadens Die Erstellung der Kategoriensystems und des Kodierleitfadens folgte zwei Analysetechniken, namentlich der strukturierenden Inhaltsanalyse und der zusammenfassenden Inhaltsanalyse, die sich nach Mayring (2010) in diesem Schritt der QIA ausdrücklich ergänzen. Die durch die Forschungsfragen vorgegebenen Oberkategorien des Kategoriensystems entstanden deduktiv und strukturieren das Material inhaltlich entlang der Themenkomplexe. Die bei 50
59 Mayring (2010) umfassend beschriebene, induktive Erstellung der Subkategorien in den Schritten der Paraphrasierung, Generalisierung sowie der ersten und zweiten Reduktion, entsprechen dem Ablauf einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse. In Vorbereitung auf die Kodierung (Schritte 5-7), welche wiederum in seiner Analysetechnik einer strukturierenden Inhaltsanalyse folgt, wurde ein Kodierleitfaden erstellt (siehe Anhang 5). Dieser enthält die Bezeichnung der Kategorien, Ein- und Ausschlusskriterien der Zuordnung von Analyseeinheiten sowie deren Form der Strukturierung (formal, inhaltlich, typisierend, skalierend). Weiters sind Kodierregeln und Ankerbeispiele in je einer Kategorie beschrieben. Der Kodierleitfadens erfüllt den Zweck, die Kodierung im Sinne der Transparenz und Nachvollziehbarkeit (u.a. auch für den Co-Rater) zu ermöglichen. Schritte Kodierung, Revision der Kategorien, endgültiger Materialdurchlauf Die Zuordnung der Textbausteine zu den Kategorien wurde entsprechend den Ausführungen des Kodierleitfadens mittels der Software MAXQDA (Version 11) unternommen. Dabei wurde jeder Subkategorie eine Kategorie ohne inhaltliche Beschreibung (Sonstiges) hinzugefügt. In dieser konnte für die Forschungsfrage relevantes Material kodiert werden, das in keiner der bereits bestehenden Kategorien abgebildet worden wäre. Da nach dem Kodieren von ca. 42 Prozent des Interviewmaterials (Empfehlung bei 10%-50%, Mayring, 2010) jede Analyseeinheit einer inhaltstragenden Kategorien zugeordnet werden konnte, sprich die Kategorie Sonstiges ohne Kodierung blieb, war in dieser Phase keine Revision des Kategoriensystems notwendig. Dementsprechend konnte der endgültige Materialdurchlauf ohne Adaptation fortgesetzt werden. Schritt 8 - Rücküberprüfung des Kategoriensystems Die Rücküberprüfung der Güte des Kategoriensystems im Rahmen der QIA stellt eine elementare Voraussetzung für die Gültigkeit der Ergebnisse dar. Laut Hussy et al. (2010) muss Validität, Objektivität und Reliabilität bezüglich des Kategoriensystems gegeben sein. Eine hohe Validität im Sinne, dass für die Forschungsfragen relevante Textteile im Kategoriensystem ausreichend abgebildet werden, drückt sich durch nur geringe Unterschiede in der Summe der Kodierungen auf den Unterkategorien aus. Dies gilt besonders bei induktiv entstandenen Kategorien als Maß für den Grad an Differenzierung der Subkategorien (Hussy et al., 2010). Bei der Anzahl der Nennungen ist zu berücksichtigen, 51
60 dass es sich hierbei nicht um absolute Häufigkeiten, sondern um max. eine Kodierung pro Person pro Kategorie handelt (Stichprobengröße gleich max. Anzahl an Nennungen). Bei der Betrachtung wird ersichtlich, dass die Besetzungshäufigkeiten (= Häufigkeit der kodierten Nennungen auf einer Kategorie) deutlich variieren (Subkategorie Schwierigkeiten im Arbeitsalltag / Aktive Bewältigungsstrategie / Perspektiven austauschen, n = 16 versus Unterschiede zur Mehrheit der KollegInnen / Unterschied wahgenommen / Bewertung als Nachteil / Reaktion auf Benachteiligung / Entgegenwirken, n = 1). Weshalb dieses Maß kaum eine zutreffende Aussage über die Validität in dieser Untersuchung darstellt, lässt sich wie folgendermaßen begründen: Zum einen folgen die Subkategorien verschiedenen Formen der Strukturierung. Bei solchen, die einer inhaltlichen Strukturierung unterliegen (z.b. Schwierigkeiten im Arbeitsalltag / Aktive Bewältigungsstrategie / Setzen von Handlungen), sind Nennungen auf allen Subkategorien möglich, während bei solchen, die skalierend strukturiert wurden, sich Nennungen auf Subkategorien ausschließen (z.b. Zukünftige berufliche Perspektive / Zeitraum bis zum Auslaufen der Anstellung / Ohne Anstellung). Zum anderen liegt bei einer Nennung bzw. Nichtnennung auf einer Subkategorie ein qualitatives Moment: Relativ gesehen viele Aussagen zu einem Thema könnte auf eine hohe Relevanz für alle befragten Doktoratsstudierenden hindeuten. Im Sinne der Erhebung von explorativen Aspekten für diese Untersuchung sind solche Ergebnisse im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse interessant (Lamnek, 2005). Eine aussagekräftigere Einschätzung der Validität in dieser Studie lässt sich über die Häufigkeiten der Kodierung einer Restkategorie treffen (Hussy et al., 2010). Dieses Maß der Validität weist, wie in den Schritten 5-7 beschrieben, auf eine hohe Validität in dieser Untersuchung hin. Trotzdem wurden im Zuge der Auswertung einige Subkategorien aufgrund geringer Anzahl an Nennungen zusammengefasst und in ihren Definitionen ergänzt. Exklusionen von Subkategorien, Neukonstruktionen oder gänzliche Umstrukturierungen mussten nicht vorgenommen werden, weshalb eine wiederholte Kodierung nicht notwendig war. Die Überprüfung von Objektivität und Reliabilität des Kategoriensystems wird mittels der Berechnung der Kodierübereinstimmungen zwischen Rater und Co-Rater bestimmt (Hussy et al., 2010). Die Zuordnung der Textteile zu den Kategorien wurde hierzu bei 30 Prozent des Materials von einem Co-Rater wiederholt. Als Basis für die Entscheidungen bzgl. der Kodierung wurde einzig der Kodierleitfaden gereicht. Die Intercoderreliabilitäten je 52
61 Themenkomplex wurden mittels Kappa-Koeffizienten (Cohen, 1968) berechnet und in Tabelle 3 abgebildet. Die Reliabilitäten zwischen κ =.77 und κ =.90 sind nach Bortz und Döring (2006) als gut bis sehr gut zu bewerten. Eine Überarbeitung des Kategoriensystems oder des Kodierleitfadens war aus Gründen der Objektivität und Reliabilität demnach nicht notwendig. Eine Beschreibung der Kategoriensysteme folgt in Kapitel Tabelle 3 Übersicht der Intercoderreliabilitäten der Kategoriensysteme Intercoderreliabilität (κ) Schwierigkeiten im Arbeitsalltag 0.86 Soziale Unterstützung 0.85 Feedbackprozesse 0.80 Unterschiede zur Mehrheit der KollegInnen 0.77 Herausforderung Doktoratsbeginn und IP 0.90 Zukünftige berufliche Perspektiven 0.89 Anmerkung. Angabe der Intercoderreliabilität nach (Cohen, 1968). Schritte 9-10 Ergebnisaufbereitung und Interpretation der Ergebnisse Dem Prozessdiagramm nach Mayring (2010a) folgend, wird das Datenmaterial in einer Kombination von quantitativ-frequenzanalytischen Analyse unternommen, die durch inhaltliche Darstellungen in Form von Textbeispielen ergänzt werden. In Vorbereitung auf die Frequenzanalyse wurden Nennungen der Befragten in Häufigkeiten entsprechend den Gruppen von ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen nach summiert. Pro Person und Subkategorie durfte nicht mehr als eine Nennung gezählt werden, da eine höhere Wahrscheinlichkeit vorlag, dass Wiederholungen von Aussagen eher dem Sprachduktus einer Person, als einer erhöht inhaltlichen Relevanz geschuldet waren. Dies verhindert eine fälschliche Gewichtung der Ergebnisse. Die kombinierte Form der Analyse verfolgt das Ziel, das Datenmaterial umfassend abzubilden Kategoriensysteme Die Kategoriensysteme folgen in ihrer Struktur dem chronologischen Aufbau des teilstrukturierten Interviews entlang der Forschungsfragen. Deduktiv strukturierte Oberkategorien markieren die erfragten Themenkomplexe, während Subkategorien induktiv aus dem Interviewmaterial entstanden sind. Die Kategoriensysteme folgen einer 53
62 hierarchischen Logik, wonach die niedrigste Subkategorie (max. drei Subkategorien) aufbauend auf den vorangegangenen Ebenen der Kategorien den höchsten Informationsgehalt besitzt. In der Betrachtung der im Folgenden überblicksartig beschriebenen Kategoriensysteme ist zu betonen, dass diese auf den Wahrnehmungen und Deutungen der befragten Doktorats-studierenden beruhen. Aus Gründen des Leseflusses wird in den Beschreibungen nicht jeweils gesondert auf diesen Umstand hingewiesen. Die Reihung der Beschreibungen folgt der chronologischen Struktur des Interviewablaufes Austausch über Schwierigkeiten im Arbeitsalltag Das Kategoriensystem Schwierigkeiten im Arbeitsalltag fußt auf der These von Klinkhammer und Saul-Soprun (2009), wonach ein fehlender Austausch über arbeitsbezogene Schwierigkeiten im Kollegium die Ausprägung des IP fördert. Zudem wird der Umgang von ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen sowie deren Interaktion mit dem Arbeitsumfeld in Konfrontation mit arbeitsbezogenen Schwierigkeiten im Interview erfragt (siehe Kapitel 3.3.6). Ziel war es hierbei, ein umfassendes Bild über den Austausch bei Schwierigkeiten im Arbeitsumfeld generell und in der Wahrnehmung von DoktorandInnen bezüglich der eigenen Anliegen zu gewinnen (siehe Tabelle 4). Die Oberkategorie Umgang mit Schwierigkeiten speist sich aus den von DoktorandInnen beschriebenen Bewältigungstrategien in Konfrontation mit beruflichen Schwierigkeiten. Unter passiven Bewältigungstrategien fallen solche, die an den Ursachen bzw. in der Bearbeitung der Folgen von Schwierigkeiten nicht unmittelbar eine von außen beobachtbare Reaktion folgen lassen. Unter die Subkategorie Selbstberuhigung fallen Aussagen, die Schwierigkeiten relativieren oder negieren. Die Subkategorie Zustände ertragen umfasst Äußerungen, die eine abwartende Haltung ausdrücken. Als aktive Bewältigungsstrategien wurden solche Aussagen kodiert, die konkrete Handlungen umfassen. Dabei wird in den Subkategorien zweiter Ordnung zwischen Setzen von Handlungen, bestehend aus Berichten über konkrete Unternehmungen, und Perspektiven einholen unterschieden, welche Aussagen über Austausch mit Personen umfassen. Die Oberkategorie Hilfe aus dem Arbeitsumfeld umfasst Äußerungen darüber, ob (Hilfsangebot / Kein Hilfsangebot) und auf wessen Initiative hin (Hilfe eingefordert / Hilfe nicht eingefordert) ein Unterstützungsangebot durch das Arbeitsumfeldes in Reaktion auf die geschilderte Schwierigkeiten der bzw. des Doktoratsstudierenden stattfand. Dabei wurden in 54
63 der Subkategorie Hilfe nicht eingefordert die Ursachenzuschreibung für die fehlende Eigeninitiative in der Suche nach Hilfe (Keine Besserung erwartet / Nicht möglich / Ohne Begründung) genauer spezifiziert und entsprechend kodiert. Beschreibungen bezüglich des Austausches bei Schwierigkeiten im Kollegium generell wurden unter der entsprechenden Oberkategorie subsummiert. Die Subkategorie Vorliegen beschreibt die Wahrnehmung des generellen Auftretens des Austausches in drei qualitativen Abstufungen (Findet statt / Findet eingeschränkt statt / Findet nicht statt). Zudem werden, insofern vorhanden, eine Bewertung der subjektiv empfundenen Folgen (Positiv / Negativ), und die zugesprochene Relevanz (Austausch ist relevant / Austausch ist irrelevant) kodiert. Tabelle 4 Übersicht des Kategoriensystems "Schwierigkeiten im Arbeitsalltag" Oberkategorie Subkategorie 1 Subkategorie 2 Umgang mit Schwierigkeiten Passive Bewältigungsstrategie Selbstberuhigung Zustände ertragen Aktive Bewältigungsstrategien Setzen von Handlungen Perspektiven einholen Hilfe aus dem Arbeitsumfeld Hilfsangebot Kein Hilfsangebot Hilfe eigeninitiativ eingefordert Hilfe nicht eigeninitiativ eingefordert Ursachenzuschreibung: Keine Besserung erwartet Ursachenzuschreibung: Nicht möglich Ursachenzuschreibung: Beschreibung ohne Begründung Austausch über Schwierigkeiten im Kollegium Vorliegen Findet statt Findet unter Einschränkungen statt Findet nicht statt Bewertung Positive Folgen Negative Folgen Relevanz Austausch ist relevant Austausch ist nicht relevant Soziale Unterstützung aus dem Arbeitsumfeld Fehlende soziale Unterstützung aus dem Arbeitsumfeld wird, wie in Kapitel beschrieben, wiederholt als möglicher Faktor für die Ausprägung des IP in Erwägung gezogen. Mehrfach wird in diesem Zusammenhang auf eine mögliche schützende Funktion 55
64 von positiven Beziehungen zu MentorInnen verwiesen (Clance & O'Toole, 1987; Craddock et al., 2011; Klinkhammer & Saul-Soprun, 2009). Das Kategoriensystem soziale Unterstützung aus dem Arbeitsumfeld bildet Beschreibungen von DoktorandInnen bezüglich des Ausmaßes und der Form von Unterstützung durch das Arbeitsumfeld sowie die Anwesenheit und Funktion von MentorInnen im Speziellen ab. Ist nach den Aussagen der Doktoratsstudierenden Soziale Unterstützung vorhanden, so wird auf Ebene der zweiten Subkategorie dessen inhaltliche Qualität beschrieben. Auf Nicht näher spezifizierte Unterstützung wurde kodiert, wenn keine inhaltliche Ausführung folgte. In die Subkategorie Fachliche Unterstützung fallen Beispiele und Schilderungen von konkreten Arbeitsprozessen, die explizite Nennungen von Unterstützung im fachlichen Sinne betreffen. Unter der Subkategorie Emotionale Unterstützung werden Aussagen subsummiert, die zur emotionalen Stabilität der/des Doktoratsstudierenden am Arbeitsplatz beitragen und keinen direkten Bezug zur Arbeit aufweisen (z.b. guter Zuspruch durch KollegInnen). In der ersten Subkategorie Unzureichende soziale Unterstützung werden Aussagen über fehlende Unterstützung kodiert, die sich auf der Ebene von Subkategorie zwei mit geändertem Vorzeichen weitestgehend analog zum gerade beschriebenen System darstellen. Einzig die Kategorie fachliche Unterstützung spezifiziert eine Ursache für mangelnde Unterstützung in Arbeitsprozessen, nämlich das Fehlen fachlicher AnsprechpartnerInnen aufgrund geringer inhaltlicher Überschneidungen mit anderen ForscherInnen im Arbeitsumfeld. Auf der Oberkategorie MentorIn wird zunächst die Anwesenheit von solchen erfasst (MentorIn anwesend / Kein/e MentorIn anwesend) um in weiterer Folge Aussagen über deren wahrgenommene Funktion für den Arbeitsprozess auf der Ebene der zweiten Subkategorie qualitativ zu bestimmen. Wie Tabelle 5 zu entnehmen ist, handelt es sich hierbei um Aspekte der Unterstützung, die Hilfe bei konkreten wissenschaftlichen Tätigkeiten bedeuten (Unterstützung konkreter Arbeitsprozesse), Unterstützung in der Funktion als Quelle für Informationen über Abläufe im Wissenschaftsbetrieb (Orientierungsfunktion) sowie MentorInnen in der Rolle als Ansprechpartnerin für fachliche Fragen (AustauschpartnerIn für Fachliches). Tabelle 5 Übersicht des Kategoriensystems "Soziale Unterstützung" Oberkategorie Subkategorie 1 Subkategorie 2 Subkategorie 3 Ausmaß der Unterstützung Soziale Unterstützung vorhanden Nicht näher spezifizierte Unterstützung Fachliche Unterstützung 56
65 MentorIn Unzureichende soziale Unterstützung MentorIn anwesend Kein/e anwesend MentorIn Emotionale Unterstützung Nicht näher spezifizierte Unterstützung Emotionale Unterstützung Fachliche Unterstützung Nicht näher spezifizierte Unterstützung Unterstützung konkreter Arbeitsprozesse Orientierungsfunktion AustauschpartnerIn für Fachliches Beschreibung ohne Begründung Fehlende fachliche Ansprechpartner Feedback Bereits in der ersten Publikation zum IP bemerken Clance und Imes (1978), dass mangelndes Feedback eine gewichtige Rolle in der Ausprägung des IP spielt. Wie in Kapitel ausgeführt, lässt diese These FoscherInnen bezüglich des beruflichen Kontextes vermuten, dass Feedback im Arbeitsumfeld als ein vor dem IP schützender Faktor wirken könnte (z.b. Brems et al., 1994; Parkman & Beard, 2008). Das Kategoriensystem Feedback bildet auf den Oberkategorien Aussagen zur Quelle des Feedbacks (KollegInnen / ProfessorInnen, BetreuerInnen / Fachpersonen außerhalb des Arbeitsumfeldes) bzw. kein Feedback, dem Emotionalen Erleben nach Erhalt von Feedback und der im Allgemeinen wahrgenommen Güte des Feedbacks ab. Bei Aussagen zu SenderInnen des Feedbacks wird auf der zweiten Subkategorie zwischen Informellem Feedback, also solchem, dass in einem inoffiziellen Rahmen (z.b. bei einem individuellen persönlichen Termin mit der Betreuung der Dokorarbeit) und formellem Feedback, sprich solchem, dass in einem offiziellen Kontext (z.b. im DoktorandInnenseminar) erteilt wurde, unterschieden. Auf Ebene der dritten Subkategorie wird zusätzlich die Ergreifung der Feedbackinitiative des Befragten (eigeninitiativ / Initiative nicht näher spezifiziert) abgebildet. Die Güte des Feedbacks wird in den Subkategorien konstruktiv (Feedback das dem Fortgang der Arbeit als sinnvoll förderlich empfunden wird) sowie Einschränkungen des Konstruktiven (z.b. konstruktives Feedback mit starker Verzögerung) und wertschätzend abgebildet. 57
66 Unter der Oberkategorie Fokus des Feedbacks wird zwischen solchem, das sich auf die Person der/des Doktoratsstudierenden richtet (Bezug auf Person), solchem, das auf die Arbeit abzielt (Bezug auf Arbeit) und jenen Aussagen, die eine Trennung aufgrund der hohen persönlichen Identifikation mit der eigenen Arbeit nicht zulässt (Nicht trennbar), unterschieden. Neben allgemeinen Qualitäten von Emotionalem Erleben nach dem Erhalt von Feedback (Positiv / Ambivalent / Negativ) werden in der ersten Subkategorie zusätzlich Aussagen über eine zeitliche Perspektive zusammengefasst, die Schwierigkeiten im Umgang mit Feedback zu Doktoratsbeginn beschreiben und zum Zeitpunkt des Interviews nicht mehr präsent waren. Tabelle 6 Übersicht des Kategoriensystems "Feedback" Oberkategorie Subkategorie 1 Subkategorie 2 Subkategorie 3 Quelle des Informelles Eigeninitiativ Feedbacks Feedback Güte des Feedbacks Fokus des Feedbacks Emotionales Erleben KollegInnen Kein Feedback von KollegInnen ProfessorInnen, BetreuerInnen Kein Feedback von ProfessorInnen / BetreuerInnen Fachpersonen außerhalb des Arbeitsumfeldes Konstruktiv Eingeschränkt Konstruktiv Wertschätzend Bezug auf Arbeit Bezug auf Person Nicht trennbar Positiv Ambivalent Negativ Schwierigkeiten im Umgang mit Feedback zu Doktoratsbeginn Formelles Feedback Informelles Feedback Formelles Feedback Informelles Feedback Formelles Feedback Initiative nicht näher spezifiziert Eigeninitiativ Initiative nicht näher spezifiziert Eigeninitiativ Initiative nicht näher spezifiziert 58
67 Unterschiede zur Mehrheit der KollegInnen Harvey und Katz (1985) äußern die These, dass eine Selbstwahrnehmung der Andersartigkeit im Vergleich zum Kollegium als möglicher Faktor in der Entstehung des IP beitragen könnte (siehe Kapitel 3.3.9). Das in Tabelle 7 dargestellte Kategoriensystem abstrahiert Äußerungen von DoktorandInnen zur Selbstwahrnehmung von Unterschieden zur Mehrheit der KollegInnen (Unterschied wahrgenommen / Kein Unterschied wahrgenommen). Die Subkategorie Fokus des Unterschieds beschreibt die Art von Unterschieden näher. Es wird spezifiziert, ob sich der wahrgenommene Unterschied auf die/den Befragte/n mit seinen personenbezogenen Merkmalen (z.b. Geschlecht; Personenbezogenes Unterscheidungsmerkmal) bezieht oder auf die Arbeitstätigkeit bzw. die berufliche Qualifikation (Professionsbezogener Unterschied). Ebenfalls auf Ebene der zweiten Subkategorie werden Aussagen in Wertung als Vorteil und Nachteil kodiert. Als Auswirkungen des als Vorteil wahrgenommenen Unterschiedes gelten Erleichterungen im Arbeitsprozess, Unterschiede die zur Bevorteilung in der Karriereentwicklung führen sowie solche, die Anforderungen des Arbeitsumfeldes reduzieren (insofern dies als Vorteil empfunden wird) und Strukturelle Vorteile (z.b. Frauenförderung). In den Wertungen als Nachteil wird qualitativ zwischen dem Ursprung des Nachteils in Form von struktureller Benachteiligung (z.b. aufgrund von Auflagen für Förderungen), Benachteiligung durch Fremdwahrnehmung, in der das Umfeld die betreffende Person aufgrund des Unterscheidungsmerkmals diskriminiert, oder Benachteiligungen, die aus der sich selbst abwertenden Sichtweise der Person entsteht (Benachteiligung in Selbstwahrnehmung) sowie Benachteiligung in konkret praktischen Arbeitsprozessen, unterschieden. Auf der zweiten Kategorie werden Äußerungen in Reaktion auf Benachteiligung abgebildet. Es werden Verhaltensmuster, die dem Nachteil Entgegenwirken und solche, die deren Ursache Relativieren sowie eine abwartende Haltung in Konfrontation mit dem Nachteil ausdrücken (Zustand ertragen), beschrieben. Tabelle 7 Übersicht des Kategoriensystems "Unterschiede zur Mehrheit der KollegInnen" Oberkategorie Subkategorie 1 Subkategorie 2 Subkategorie 3 Unterschied wahrgenommen Personenbezogenes Unterscheidungsmerkmal Professionsbezogenes Unterscheidungsmerkmal Bewertung als Vorteil Auswirkungen Arbeitsprozess 59
68 Kein Unterschied wahrgenommen Bewertung als Nachteil Kein Vor-/Nachteil Ursprung des Nachteils Reaktion auf Benachteiligung Karriereentwicklung Anforderungen des Arbeitsumfeldes Strukturelle Vorteile Strukturelle Benachteiligung Benachteiligungen durch Fremdwahrnehmung Benachteiligung in Selbstwahrnehmung Benachteiligung in konkret praktischen Arbeitsprozessen Entgegenwirken Relativieren Zustand ertragen Charakteristika des IP zu Doktoratsbeginn Clance und Imes (1978) postulierten in ihren Ausführungen zum Impostor Kreislauf bereits ein situatives Moment in der Ausprägung des IP: Die Zunahme von Impostor Gefühlen in Konfrontation mit der Anforderung einer neuen, an Leistung gebundenen Aufgabe. Auch Harvey und Katz (1985) äußern die These, wonach Unsicherheit bezüglich einer unbekannten, leistungsbezogenen Aufgaben die Erlebniszustände des IP bei DoktorandInnen verstärken könnte (siehe Kapitel 3.3.5). Das Kategoriensystem Charakteristika des IP zu Doktoratsbeginn strukturiert in den Oberkategorien die Reaktionen von DoktorandInnen auf vorgelesene Items der CIPS Ich fürchte oft, dass ich bei einer neuen Aufgabe versagen könnte, obwohl mir eigentlich gelingt, was ich versuche. respektive Manchmal habe ich Angst, dass die anderen merken, dass ich eigentlich zu wenig kann.. Diese beiden Aussagen weisen in einer explorativ faktorenanalytischen Untersuchung der CIPS an dieser Stichprobe die höchsten Ladungen auf (Item 1 =.715; Item 2 =.678). Unter der Oberkategorie Identifikation mit Zitat werden Äußerungen auf der ersten Subkategorien Vorhanden bzw. Nicht vorhanden subsummiert. In der Subkategorie Zeitliche Verortung der Identifikation steht, neben der deduktiv auf Subkategorie drei entstandenen Zustimmung zu den Zitaten innerhalb den ersten drei Monate des Doktorats (Doktoratsbeginn), die Subkategorie Anhaltend präsent, welche Äußerungen von 60
69 DoktorandInnen über weiterhin vorliegende Identifikation mit den Aspekten des IP strukturiert. Aussagen, die eine Zuschreibung der Ursache für die Identifikation (Attribution der Ursache) auf äußere Umstände bzw. Situationen beziehen, werden in der Subkategorie External abgebildet. Jene, welche auf in der eigenen Person liegende Merkmale (z.b. mangelnde Fähigkeiten) attribuieren, werden in der Subkategorie Internal abstrahiert. Tabelle 8 Übersicht des Kategoriensystems "Charakteristika des IP zu Doktoratsbeginn" Oberkategorie Subkategorie 1 Subkategorie 2 Subkategorie 3 Identifikation mit Zitat Vorhanden Nicht vorhanden Zeitliche Verortung der Identifikation Doktoratsbeginn Anhaltend präsent Attribution der Ursache External Internal Zukünftige berufliche Perspektive Österreichische Doktoratsstudierende stehen unter vielfachen Belastungen, insbesondere was die Arbeitsplatz- und die finanzielle Sicherheit sowie die Arbeitsauslastung anbelangt (Klinkhammer, 2013; Schober, 2013). Bei Faktoren, die eine Unsicherheit bezüglich der beruflichen Zukunft schüren, wäre nach der Annahme über den Mechanismus der Konfrontation mit neuen Herausforderungen (Harvey & Katz, 1985), ein Zusammenhang mit der Ausprägung des IP denkbar (siehe Kapitel 3.3.5). Zudem könnte, so zumindest von Jöstl et al. (2012) vermutet, die Ausprägung des IP im Arbeitsumfeld Hochschule zu einer Selbstselektion von fähigen Doktoratsstudierenden führen. Das Kategoriensystem Zukünftige berufliche Perspektive abstrahiert Aussagen der Befragten die eine Sorge bzgl. der beruflichen Zukunft (Vorhanden / Nicht Vorhanden) betreffen sowie den Zeitraum bis zum Auslaufen der Anstellung (> 24 Monate / Monate / Monate / 7-12 Monate / 1-6 Monate / Ohne Anstellung) ab dem Interviewtermin im März bzw. April 2014 und ob langfristig eine Hochschulkarriere angestrebt wird (Angestrebt / Unentschlossen / Nicht angestrebt). Auf Ebene der dritten Subkategorie werden Ursachen bei vorhandener Sorge bezüglich der beruflichen Zukunft abgebildet. Unklarheit über berufliche Ziele meint eine Sorge, die aus fehlenden beruflichen Absichten nach dem Doktorat resultiert. Antizipierte berufliche Rahmenbedingungen mit Befristeten Arbeitsverträgen sowie Geringen Aufstiegs-chancen, Einschränkungen aufgrund der Qualifikation am freien Arbeitsmarkt und niedriger Gehälter (Einschränkungen der 61
70 finanziellen Sicherheit) nach dem Abschluss des Doktorats beschreiben inhaltlich die Subkategorien der Ursachenzuschreibung. Bei nicht vorhandener Sorge bezüglich der beruflichen Zukunft wurden als Ursache für die Bewertung solche Aussagen in Subkategorien gebündelt, die sich in einer noch Langen Vertragslaufzeiten im Doktorat sowie positiv bewerteten Chancen am freien Arbeitsmarkt und einer zuversichtliche Grundhaltung (Optimistische Grundhaltung) ausdrücken. Tabelle 9 Übersicht des Kategoriensystems "Zukünftige berufliche Perspektive" Oberkategorie Subkategorie 1 Subkategorie 2 Subkategorie 3 Sorge bzgl. der beruflichen Zukunft Vorhanden Ursachenzuschreibung Unklarheit über beruflichen Ziele Befristete Arbeitsverträge Geringe Aufstiegsmöglichkeiten Einschränkungen aufgrund der Qualifikation am freien Arbeitsmarkt Einschränkungen der finanziellen Sicherheit Ohne Begründung Nicht vorhanden Ursachenzuschreibung Lange Vertragslaufzeit Positive Chancen am freien Arbeitsmarkt Optimistische Grundhaltung Ohne Begründung Zeitraum bis zum Auslaufen der Anstellung > 24 Monate Monate Monate 7-12 Monate 1-6 Monate Ohne Anstellung Hochschulkarriere Angestrebt Unentschlossen Nicht angestrebt 62
71 6 Ergebnisse Die folgenden Kapitel beschreiben die Ergebnisse der Auswertungen der quantitativen Daten, die mittels Online-Fragebogen erhoben und der qualitativen Daten, die im Zuge der problemzentrierten Interviews gesammelt wurden. Die Befunde werden entlang der theoretisch abgeleiteten Forschungsfragen (siehe Kapitel 4.2) berichtet, wobei sich Kapitel 6.1 auf die Ergebnisse der Gesamtstichprobe der DoktorandInnen und die Abschnitte des Kapitels 6.2 auf jene Stichproben in Hochschulanstellung beziehen. 6.1 Forschungsfrage 1: Ausprägung des IP bei Doktoratsstudierenden Unterscheiden sich Frauen und Männer mit und ohne Hochschulanstellung in der Ausprägung des Impostor Phänomens? Zur Feststellung, ob sich Frauen und Männer ohne und mit Universitätsanstellung in der Ausprägung des Impostor Phänomens unterscheiden, wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse berechnet. Zuvor wurden jene TeilnehmerInnen aus der Gesamtstichprobe ausgeschlossen, die keine Angaben über ihr Geschlecht machten (N = 555). Als unabhängige Variablen wurden Geschlecht (weiblich/ männlich) sowie Beschäftigungsstatus (an der Hochschule angestellt / nicht an der Hochschule angestellt) verwendet. Die abhängige Variable stellte das Impostor Phänomen dar. Tabelle 10 bildet die deskriptiven Statistiken der abhängigen Variablen ab. Im Ergebnis zeigten sich signifikante Haupteffekte für den Faktor Geschlecht (F(1; 551) = , p <.001, η p ² =.027) und Beschäftigungsstatus (F(1; 551) = , p <.001, η p ² =.027), jedoch keine signifikante Wechselwirkung von Geschlecht*Beschäftigungsstatus (F(1; 551) =.007, p =.935) auf die abhängige Variable. Wie in Tabelle 10 ersichtlich, ist das IP bei Doktorandinnen stärker ausgeprägt als bei deren männlichen Kollegen. Auch zeigt sich, dass DoktorandInnen mit einer Anstellung an der Hochschule in höherem Maße vom IP betroffen sind als solche, die ihre Dissertation hochschulextern verfassen. Die gefundenen Effekte sind klein. 63
72 Tabelle 10 Mittelwerte und Standardabweichungen nach Beschäftigungsstatus und Geschlecht Mittelwert (Standardabweichung) Beschäftigungsstatus Anstellung Keine Anstellung Gesamt Weiblich (16.87) (16.46) (16.83) Geschlecht Männlich (13.65) (15.45) (14.92) Gesamt (15,91) (16.29) 56,23 (16.33) Die vorliegende Stichprobe wurde nach den von Clance (1985) definierten Wertebereichen der Ausprägung des IP kategorisiert (IP < 41 = Kein IP; IP < 61 = Niedriges IP; IP < 81 = Mittelgradiges IP; IP < 100 = Hochgradiges IP). Demnach weisen 18.6 Prozent keine, 42.7 Prozent eine niedrige, 31.4 Prozent eine mittelgradige und 7.3 Prozent eine hochgradige Ausprägung des IP auf. Abbildung 5 zeigt, dass Frauen in den mittel- und hochgradigen Kategorien der Ausprägung des IP überrepräsentiert sind (die Geschlechterverteilung in der Stichprobe wurde berücksichtigt). 45% 40% 35% 30% 18,5% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 18,1% 8,2% 24,2% 10,4% 13,3% 5,9% 1,4% Kein IP Niedriges IP Mittelgradiges IP Hochgradiges IP Männer Frauen Abbildung 5. Verteilung der Gesamtstichprobe auf die Kategorien des Impostor Phänomens. 64
73 Gibt es Zusammenhänge zwischen dem Lebensalter bzw. dem akademischen Alter von DoktorandInnen mit dem Impostor Phänomen? Mögliche Zusammenhänge zwischen dem Lebensalter und dem akademischen Alter von DoktorandInnen mit dem IP wurden mittels multipler Regression überprüft. Dabei dienten Akademisches Alter sowie das Lebensalter als unabhängige und das Impostor Phänomen als abhängige Variable. Die Berechnungen ergaben einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Lebensalter und der Ausprägung des Impostor Phänomens (β = -.176, p <.001), jedoch keinen signifikanten Zusammenhang zwischen den Variablen Akademisches Alter und Impostor Phänomen. Das Lebensalter erklärt 3.1 Prozent der Varianz des IP (R² =.031, F(1; 498) =15.978, <.001). 6.2 Das IP bei DoktorandInnen im Arbeitsumfeld Hochschule In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Auswertungen der Daten von DoktorandInnen mit Hochschulanstellung entlang der Forschungsfragen 2 bis 8 berichtet. Zunächst werden in Abschnitt die statistischen Analysen an der Teilstichprobe aller Promovierenden mit Hochschulanstellung (n = 247) bezüglich der Aspekte des Arbeitsumfeldes Hochschule und dem IP abgebildet (Forschungsfrage 2). Die Ergebnisse der QIA im Sinne von Mayring (2010b) sind in den Kapiteln bis dargestellt und beschrieben (Forschungsfragen 3-8). Im Anschluss an den jeweiligen Bericht je Themenkomplex sind die dazugehörigen Tabellen des jeweiligen Kategoriensystems und deren Besetzungshäufigkeit (nominal und relativ) in den Gruppen der ImpostorInnen bzw. Nicht-ImpostorInnen zu abgebildet. Mit Blick auf den geringen Umfang der Stichprobe (n = 19) und damit einhergehende Einschränkungen der Aussagekraft der frequenzanalytischen Ergebnisse, wurde folgende Entscheidung bezüglich der Form der Darstellung gewählt: Für Subkategorien ab der zweiten Ebene, die keine skalierende Struktur aufweisen und deren Besetzungshäufigkeit < 6 ist, wird aufgrund mangelnder Aussagekraft auf eine Beschreibung der Ergebnisse in Prozentwerten verzichtet. Da das Kategoriensystem jene Aspekte abbildet, die inhaltlich für die Forschungsfragen von Relevanz sind, werden diese Subkategorien durch Textbeispiele illustriert dargestellt. Aufgrund des gefundenen Geschlechterunterschiedes als Ergebnis der quantitativen Auswertungen (siehe Kapitel 6.1.1) wurden zusätzliche Analysen für Impostorinnen (n = 7) 65
74 und Impostoren (n = 4) getrennt unternommen. Unterschiede zwischen Impostorinnen und Impostoren werden dann beschrieben, wenn die Differenz der relativen Besetzungshäufigkeiten hoch (Differenz der Nennungen min. 30%) ist und von mehr als drei Personen eine Nennung vorliegt. Die Einschränkung der Generalisier- und Interpretierbarkeit der qualitativen Ergebnisse aufgrund der geringen Stichprobengröße wird in Kapitel 7.3 diskutiert Forschungsfrage 2: Aspekte des Arbeitsumfeldes Hochschule in Zusammenhang mit dem IP Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Wahrnehmung von Konkurrenz im Arbeitsumfeld (1), der Leistungsevaluation (2), der Enttäuschung des Arbeitsumfeldes (3), des Konfliktes zwischen Arbeits-und Privatleben (4), der sozialen Unterstützung von KollegInnen (5) sowie von Vorgesetzten (6) und dem Impostor Phänomen? Um mögliche Zusammenhänge zwischen Variablen des Arbeitsumfeldes Hochschule (siehe Kapitel 4.2.2) und dem Impostor Phänomen zu ermitteln, wurde eine schrittweise multiple Regressionsanalyse durchgeführt. Im Ergebnis zeigt sich, dass die Variablen Enttäuschung des Arbeitsumfeldes und Emotionale Soziale Unterstützung (KollegInnen) insgesamt 9.3 Prozent der Varianz der Skala des IP erklären (R² =.093, F(2; 246) = , p =.001) sowie signifikant mit diesem zusammenhängen. Wie Tabelle 11 zu entnehmen, weist die Variable Enttäuschung des Arbeitsumfeldes einen mittleren (β =.255, p <.001) und die Variable Emotionale Unterstützung (KollegInnen) einen gering negativen Zusammenhang (β = -.124, p =.048) mit der abhängigen Variable auf. Kein signifikanter Zusammenhang mit dem Impostor Phänomen konnte mit Konkurrenz, Leistungsevaluation, Konflikt zwischen Arbeits- und Privatleben, Fachlicher Unterstützung (KollegInnen) sowie Emotionaler & Fachlicher Unterstützung (Vorgesetzte) gefunden werden. 66
75 Tabelle 11 Statistische Kennwerte der multiplen Regressionsanalyse Schritt 1 Regressionskoeffizient Standardfehler β Konstante Enttäuschung des Arbeitsumfeldes Schritt 2 Konstante Enttäuschung des Arbeitsumfeldes * Emotionale Unterstützung (KollegInnen) * Anmerkung. R² =.078 für Schritt 1, ΔR² =.093 für Schritt 2 (p =.048). *p <.05, **p <.001, β = standardisierter Regressionskoeffizient Forschungsfrage 3: Austausch über Schwierigkeiten im Arbeitsalltag Wie beschreiben ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen den Austausch über Schwierigkeiten im Kollegium allgemein? Bezüglich des Austausches über Schwierigkeiten und Krisen unter KollegInnen im Generellen äußerten 88 Prozent der Nicht-ImpostorInnen und 45 Prozent der ImpostorInnen, dass dieser stattfindet (siehe Tabelle 12). Dem gegenüber stehen keine Beschreibungen der Nicht-ImpostorInnen, die auf Einschränkungen dieses Aspektes der Kommunikation von Schwierigkeiten und Krisen hinweist, während 18 Prozent der Gruppe der ImpostorInnen über eben diese berichteten. Beispielgebend für diese Gruppe beschrieb eine vom IP betroffene Doktorandin folgendes: Also wenn ich jetzt einmal breiter Kollegen miteinbeziehe vom Institut, dann sind es halt immer über die die man eh immer schimpft. Da erzählt man sich dann ma, jetzt hat er das schon wieder gesagt und so [ ] Dass kein Austausch stattfindet berichteten 13 Prozent der Nicht-ImpostorInnen und etwas mehr als ein Drittel der TeilnehmerInnen aus der Gruppe der ImpostorInnen (36%). Bezüglich der Bewertung der Folgen dieses Austausches (sofern vorhanden), nennen unter Berück-sichtigung der Stichprobengröße, mehr als doppelt so viele Nicht-ImpostorInnen (63%) denn ImpostorInnen (27%) positive Folgen. Dem gegenüber stehen bei Nicht- ImpostorInnen keine explizit negativ genannten Auswirkungen. 67
76 Eine der drei ImpostorInnen (27%) beschreibt diese Wertung wie folgt: Ich habe zum Beispiel [ ] eine Kollegin, mit der ich zum Beispiel öfter rede, auch privat, und (.) also sie erzählt mir, dass sie schon (.) gewisse Sachen, oder Schwierigkeiten mit Kollegen oder Kolleginnen bespricht. Und sie hat das immer so geschildert, dass das dann doch irgendwie zurück kommt [ ] Eine Relevanz des Austausches über Schwierigkeiten im Kollegium nannten explizit die Hälfte der Nicht-ImpostorInnen (50%) und 18 Prozent der ImpostorInnen, während jeweils ein/e VertreterIn je Gruppe diesen als explizit irrelevant beschrieb (NIP = 13%, IP = 9%). Welche Muster beschreiben ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen im Umgang mit Schwierigkeiten im Arbeitsprozess und wie reagiert das Arbeitsumfeld? In Reaktion auf Schwierigkeiten im Arbeitsalltag (siehe Tabelle 12) beschrieben 38 Prozent der Nicht-ImpostorInnen und 27 Prozent der ImpostorInnen den Einsatz passiver Bewältigungsstrategien. In der Subkategorie Selbstberuhigung drückt eine Nicht-ImpostorIn ihre Reaktion in Konfrontation mit einer schwierigen beruflichen Situation wie folgt aus: [ ] ich versuche mich einfach nicht zu sehr beunruhigen zu lassen und denke mir halt "ich habe nicht alles unter Kontrolle" [ ] Eine Impostorin äußerte ihre passive Bewältigungsstrategie (Zustände ertragen) so: Am Montag bin ich einfach echt dagesessen und war nur so eine viertel Stunden gelähmt, weil ich einfach mir gedacht habe [ ] es ist so viel was ich irgendwie gerade tun muss [ ] Alle Nicht-ImpostorInnen wie auch ImpostorInnen berichteten von der Anwendung zumindest einer aktiven Bewältigungsstrategie. Dreiviertel der Nicht-ImpostorInnen und kaum mehr ImpostorInnen (82%) beschrieben das Einholen von Perspektiven. Ein nicht vom IP betroffener Doktorand drückte das Setzen von Handlungen wie folgt aus: Ich habe gesagt "wo sind da Ansprechpartner?" und habe dann einfach auf eigene Faust die getroffen, ohne dass ich das irgendwem gesagt habe, weil in der Zeit war mein Chef auch auf Urlaub [ ] 68
77 Knapp zwei Drittel der Nicht-ImpostorInnen (63%) und ein Drittel der ImpostorInnen (36%) beschrieben, dass ihnen Hilfsangebote gemacht wurden, während 13 Prozent der Nicht- ImpostorInnen und 36 Prozent der ImpostorInnen explizit keine Hilfsofferte nannten. In diesem Aspekt zeigt sich ein deutlicher Geschlechterunterschied: Alle männlichen und keine weiblichen vom IP Betroffene/n beschrieben explizit keine Hilfe angeboten zu bekommen. Berichte über Eigeninitiative im Einfordern von Hilfe äußerten Nicht-ImpostorInnen (13%) und ImpostorInnen (18%) in ähnlich geringem Umfang (je eine Nennung). Dem gegenüber stehen Angaben über explizit nicht eingeholte Hilfe von einem Viertel der Nicht- ImpostorInnen (25%) und 55 Prozent der ImpostorInnen. Hier zeigt sich, dass 75 Prozent der männlichen und 39 Prozent der weiblichen ImpostorInnen explizit vom nicht Einfordern von Hilfe sprachen. Weshalb keine Besserung erwartet wurde, begründete eine Impostorin beispielgebend mit der Wahrnehmung arbeitsinterner Konkurrenz: [ ] also wenn man einen Kollegen, (.) also ich finde, dass es sehr schwierig ist irgendwie mit KollegInnen zu reden, die in der gleichen Position oder in einer ähnlichen Situation sind, weil es eben immer Konkurrenz gibt [ ] 69
78 Tabelle 12 Kategoriensystem "Schwierigkeiten im Arbeitsalltag" mit absoluten und relativen Besetzungshäufigkeiten BH BH Oberkategorie Subkategorie 1 IP 1 % NIP 2 % Subkategorie 2 BH IP 1 % BH NIP 2 % Austausch über Schwierigkeiten im Kollegium Vorliegen Findet statt 5 45% 7 88% Findet unter Einschränkungen statt 2 18% 0 0% Findet nicht statt 4 36% 1 13% Bewertung 6 55% 5 63% Positive Folgen 3 27% 5 63% Negative Folgen 3 27% 0 0% Relevanz 3 27% 5 63% Austausch ist relevant 2 18% 4 50% Austausch ist nicht relevant 1 9% 1 13% Umgang mit Schwierigkeiten Passive Bewältigungsstrategie 3 27% 3 38% Selbstberuhigung 2 18% 3 38% Zustände ertragen 2 18% 3 38% Aktive Bewältigungsstrategien % 8 100% Setzen von Handlungen 7 64% 7 88% Perspektiven einholen 9 82% 6 75% Hilfe aus dem Arbeitsumfeld Hilfsangebot 4 36% 5 63% Kein Hilfsangebot 4 36% 1 13% Hilfe eigeninitiativ eingefordert 2 18% 1 13% Hilfe nicht eigeninitiativ Ursachenzuschreibung: Keine Besserung 6 55% 2 25% eingefordert erwartet 4 36% 0 0% Ursachenzuschreibung: Nicht möglich 2 18% 1 13% Ursachenzuschreibung: Beschreibung ohne Begründung 3 27% 1 13% Anmerkung. 1 = Besetzungshäufigkeit von ImpostorInnen, n = 11; 2 = Besetzungshäufigkeit von Nicht-ImpostorInnen, n = 8. 70
79 6.2.3 Forschungsfrage 4: Soziale Unterstützung aus dem Arbeitsumfeld Welche Formen der Unterstützung durch KollegInnen beschreiben ImpostorInnen und Nicht- ImpostorInnen? Bezüglich des Ausmaßes der sozialen Unterstützung gaben 64 Prozent der ImpostorInnen und Dreiviertel der Nicht-ImpostorInnen an, dass ausreichend Unterstützung von KollegInnen vorhanden sei (siehe Tabelle 13). Während die Unterschiede der Beschreibung von fachlicher Unterstützung (IP = 64%, NIP = 63%) gering blieben, äußerten 55 Prozent der ImpostorInnen gegenüber Dreivierteln der Nicht-ImpostorInnen, dass genügend emotionale Unterstützung aus dem Arbeitsumfeld käme. Eine Nicht-Impostorin schilderte emotionale Unterstützung wie folgt: Ja, also die war hauptsächlich emotional und (.) dass ich mich einmal zu Recht finde am Institut und ein bisschen auch in der Gruppe aufgenommen werde und (.) inzwischen muss ich sagen (.) läuft es schon ganz gut. Also das war in den ersten zwei Monaten sehr, sehr wichtig. 36 Prozent der ImpostorInnen und ein Viertel der Nicht-ImpostorInnen beschrieben die soziale Unterstützung als unzureichend. Ein Impostor äußerte seinen Unmut über die fehlende emotionale Unterstützung in folgender Form: Ich finde eben manchmal emotional eben nicht. Ich find man wird da doch ziemlich allein gelassen. (.) Es ist (.) Ich kann mir nicht vorstellen das ich allein bin mit, immer wieder mit Ängsten Zukunftsängsten, Zweifeln, Zweifel über die eigenen Fähigkeiten und so weiter. Als spezifische Ursache für fehlende fachliche Unterstützung werden fehlende AnsprechpartnerInnen aufgrund von Isolation im Themengebiet genannt. Ein Impostor schilderte diesen Umstand so: Es ist nur so, dass wir (.) dass auch selbst intern bekritteln, dass wir keinen fachlichen Austausch haben, weil jeder an einem anderen Fachgebiet arbeitet. Wir haben eigentlich (.) eine blöde Stellung. Das ist nur in unserer Fakultät so, dass eigentlich jeder für ein Themengebiet (.) verantwortlich ist und es kein (.) nicht zwei Leute in zwei Themengebieten, wo sie sich dann austauschen können. 71
80 Nennen ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen die Anwesenheit eines/r Mentors/in in ihrem Arbeitsumfeld? Um ein Fünftel mehr Nicht-ImpostorInnen (75%) als ImpostorInnen (55%) beschrieben, über eine Mentorin oder einen Mentor zu verfügen (Kein/e MentorIn: IP = 45 %, NIP = 25%). Welche Funktionen erfüllen MentorInnen für ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen? In den Angaben über die Funktion der MentorInnen unterschieden sich ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen kaum (siehe Tabelle 13). Betrachtet man ImpostorInnen jedoch nach ihrem Geschlecht, so wird deutlich, dass Impostorinnen ihre MentorInnen stärker in der Funktion als AustauschpartnerInnen für Fachliches wahrnehmen (weibliche IP = 57%, männliche IP = 25%). Eine unter dem IP leidende Doktoratsstudentin schildert diesen Aspekt folgendermaßen: Also, ich finde, dass ist wenn es um (.) konkrete Fragen was meine Dissertation angeht oder solche Situationen, kann ich mich schon an meinen Betreuer wenden. Und ich finde, dass er (...) also ich schätze ihn schon trotz dieser Machtposition, in der er sich befindet und wie die anderen von ihm abhängig sind. 72
81 Tabelle 13 Kategoriensystem "Soziale Unterstützung" mit absoluten und relativen Besetzungshäufigkeiten Oberkategorie Subkategorie 1 BH IP 1 % BH NIP 2 % Subkategorie 2 BH IP 1 % BH NIP 2 % Subkategorie 3 BH IP 1 % BH NIP 2 % Ausmaß der Unterstützung Soziale Unterstützung vorhanden 7 64% 6 75% Nicht näher spezifizierte Unterstützung 5 45% 7 88% Fachliche Unterstützung 7 64% 5 63% Emotionale Unterstützung 6 55% 6 75% Unzureichende soziale Unterstützung 4 36% 2 25% Nicht näher spezifizierte Unterstützung 2 18% 1 13% MentorIn MentorIn anwesend 6 55% 6 75% Kein/e MentorIn anwesend 5 45% 2 25% Emotionale Unterstützung 2 18% 0 0% Fachliche Unterstützung 3 27% 2 25% Nicht näher spezifizierte Unterstützung 1 9% 1 13% Unterstützung konkreter Arbeitsprozesse 3 27% 3 38% Orientierungsfunktion 4 36% 3 38% AustauschpartnerIn für Fachliches 5 45% 5 63% Anmerkung. 1 = Besetzungshäufigkeit von ImpostorInnen, n = 11; 2 = Besetzungshäufigkeit von Nicht-ImpostorInnen, n = 8. Beschreibung ohne Begründung Fehlende fachliche Ansprechpartner 3 27% 0 0% 2 18% 2 25% 73
82 6.2.4 Forschungsfrage 5: Feedback Wie beschreiben ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen Feedbackabläufe bezüglich der eigenen Arbeit? Wie Tabelle 14 zu entnehmen berichten 45 Prozent der ImpstorInnen gegenüber fast allen Nicht-ImpostorInnen (88%) prinzipiell Feedback von KollegInnen zu erhalten (Kein Feedback: IP = 36%, NIP = 25%). Auf informellem Wege erhalten dieses ein gutes Drittel der ImpostorInnen gegenüber 63 Prozent der Nicht-ImpostorInnen. Zudem gaben die Hälfte der Nicht-ImpostorInnen und nur etwas mehr als ein Viertel der ImpostorInnen (27%) an, selbst um Feedback zu bitten. Auch auf formellem Weg überwiegt der Anteil der Nicht- ImpostorInnen, die Feedback aus dem Kollegium erhalten (IP = 18%, NIP = 50%). Alle Nicht-ImpostorInnen und knapp Dreiviertel der ImpostorInnen (73%) schilderten Feedback von ihren ProfessorInnen bzw. DissertationsbetreuerInnen (Kein Feedback: IP = 27%, NIP = 13%). Von diesen gaben eine Mehrzahl der ImpostorInnen (64%) und ein noch deutlicherer Anteil der Nicht-ImpostorInnen (88%) an, dieses über informelle Kanäle zu erhalten. Auch in diesem Fall beschrieben Nicht-ImpostorInnen (63%) häufiger als ImpostorInnen (45%) um Feedback zu bitten. Feedback auf formellem Weg zu erhalten berichteten ca. die Hälfte der ImpostorInnen wie Nicht-ImpostorInnen (IP = 45%, NIP = 50). Eine nicht unter dem IP leidende Doktorandin beschrieb einen Feedbackablauf auf formeller und informeller Ebene folgendermaßen: [ ] wenn ich einfach ein Feedback brauche, dann melde ich mich bei ihm. Und, ich meine, ich habe im letzten Semester ein ganzes Seminar bei ihm gemacht (..) also, da habe ich ihn regelmäßig gesehen. Ja, das ist immer ganz verschieden. Aber ich kann jederzeit zu ihm kommen, wenn er da ist. Ein wenig mehr als die Hälfte der ImpostorInnen (55%) und 38 Prozent der Nicht- ImpostorInnen erwähnen informell mit Feedback von Personen außerhalb des Arbeitsumfeldes mit Feedback versorgt zu werden (Formell: IP = 36%, NIP = 25%). Ihre Motivation eigeninitiativ um Feedback anzusuchen, beschrieb eine Nicht-Impostorin so: Ich versuch mir das selbst zusammenzubasteln irgendwie. Ich habe mich in diesem Semester jetzt in drei Kolloquien gesetzt, damit ich unterschiedliche Inputs bekomme, weil ich es von meinem Professor eigentlich keines bekomme. 74
83 Welche emotionale Reaktion beschreiben ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen, nachdem sie Feedback erhalten haben? Nur 27 Prozent der ImpostorInnen gegenüber Dreiviertel der Nicht-ImpostorInnen nennen ein positives Gefühl nach Erhalt von Feedback. Als ambivalent schildern etwas mehr als ein Drittel der ImpostorInnen (36%) und ein Viertel der Nicht-ImpostorInnen ihre Emotion. Ebenfalls 36 Prozent der ImpostorInnen berichteten von explizit negativen Erlebniszuständen nach Feedback, während keine der Personen aus der Gruppe der Nicht-ImpostorInnen solche beschrieb. Eine Impostorin drückte dieses Gefühl wie folgt aus: Aber es ist natürlich auch wieder schwierig, weil dann denkt man sich oh mein Gott, das sollte ich vielleicht auch noch berücksichtigen und das auch; also ich habe schon auch das Gefühl, das man durch dieses Feedback dann schon aus der Bahn geworfen wird oder so. Sowohl etwas mehr als ein Viertel der ImpostorInnen (27%) und 38 Prozent der Nicht- ImpostorInnen schilderten, dass sie zu Beginn des Doktorats Schwierigkeiten im Umgang mit Feedback hatten. Ein Nicht-Impostor beschrieb dies so: [ ] beim ersten Mal ist es natürlich sowas noch (.) die ersten Dinge, die man zurück bekommt, denkt man sich "ja, ist das eigentlich ein Angriff oder?" und beim nächsten Mal sieht man eigentlich wenn man (unv.) "ja, lieber bisschen mehr Gas geben, dass man das nachher nicht drin hat und sich nachher die Blöße gibt". Wie bewerten ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen die Güte und den Fokus des Feedbacks, das sie erhalten? Konstruktives Feedback beschreiben ca. die Hälfte der ImpostorInnen (55%) und alle Nicht- ImpostorInnen. Dass der konstruktive Charakter des Feedbacks zumindest eingeschränkt ist, berichteten ein Viertel der ImpostorInnen (27%) und kein/e Nicht-ImpostorIn. Wertschätzung als Attribut des Feedbacks gaben die überwiegende Mehrheit der ImpostorInnen (64%) und Nicht-ImpostorInnen (63%) an. Dass sich das Feedback auf die Arbeit beziehe, benannten 45 Prozent der ImpostorInnen und dreiviertel der Nicht-ImpostorInnen, während 36 Prozent der ImpostorInnen und kein/e Nicht-ImpostorIn das Feedback auf ihre Person wahrnehmend berichten. 75
84 Dass diese Aspekte nicht voneinander trennbar betrachtet werden könnten, beschrieb ein Impostor folgendermaßen: Das ist ja in unserem Bereich kaum trennbar oder in unserem Berufsfeld, denk ich mir [ ] es ist natürlich im Gegensatz zu anderen Arbeitsfeldern gerade im wissenschaftlichen Bereich die Identifikation mit der Person, natürlich auch die Fremdidentifikation mit der Person sehr hoch, in dem Sinne, dass es halt eine sehr personalisierte Arbeit ist. 76
85 Tabelle 14 Kategoriensystem "Feedback" mit absoluten und relativen Besetzungshäufigkeiten Oberkategorie Subkategorie 1 Quelle des Feedbacks KollegInnen 5 45% 7 88% Kein Feedback von KollegInnen 4 36% 2 25% ProfessorInnen / BetreuerInnen 8 73% 8 100% Kein Feedback von ProfessorInnen / BetreuerInnen Fachpersonen außerhalb des Arbeitsumfeldes BH IP 1 % BH NIP 2 % Subkategorie 2 BH IP 1 % BH NIP 2 % Subkategorie 3 BH IP 1 % BH NIP 2 % 3 27% 1 13% 6 55% 3 38% Güte des Feedbacks Konstruktiv 6 55% 8 100% Eingeschränkt Konstruktiv 3 27% 0 0% Wertschätzend 7 64% 5 63% Fokus des Feedbacks Bezug auf Arbeit 5 45% 6 75% Bezug auf Person 4 36% 0 0% Nicht trennbar 2 18% 1 13% Emotionales Erleben Positiv 3 27% 6 75% Ambivalent 4 36% 2 25% Informelles Feedback 77 Formelles Feedback 2 18% 4 50% Informelles Feedback Formelles Feedback 5 45% 4 50% Informelles Feedback Formelles Feedback 4 36% 2 25% Negativ 4 36% 0 0% Schwierigkeiten im Umgang mit Feedback zu Doktoratsbeginn 3 27% 3 38% Anmerkung. 1 = Besetzungshäufigkeit von ImpostorInnen, n = 11; 2 = Besetzungshäufigkeit von Nicht-ImpostorInnen, n = % 5 63% Eigeninitiativ 3 27% 4 50% Initiative nicht näher spezifiziert 1 9% 2 25% 7 64% 7 88% Eigeninitiativ 5 45% 5 63% Initiative nicht näher spezifiziert 4 36% 3 38% 4 36% 3 38% Eigeninitiativ 2 18% 3 38% Initiative nicht näher spezifiziert 2 18% 1 13%
86 6.2.5 Forschungsfrage 6: Unterschiede zur Mehrheit der KollegInnen Beschreiben ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen Merkmalsunterschiede der eigenen Person im Vergleich zum Kollegium? Wie in Tabelle 15 ersichtlich, nehmen einen Unterschied zur Mehrheit der KollegInnen knapp Dreiviertel der ImpostorInnen (73%) und Zweidrittel der Nicht-ImpostorInnen (63%) wahr (Kein Unterschied: IP = 36%, NIP = 50%). In der Gruppe der ImpostorInnen zeigt sich ein Geschlechtsunterschied: Nur zwei Männer (50%) und sechs Frauen (86%) benannten überhaupt ein Unterscheidungsmerkmal. Während vergleichsweise mehr ImpostorInnen einen Unterschied beschrieben, der ein personenbezogenes Merkmal darstellt (IP = 45%, NIP = 38%), so nennen Nicht-ImpostorInnen eher professionsbezogene Unterscheidungsmerkmale (IP = 27%, NIP = 50%). Wie beschreiben ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen die Konsequenzen von Merkmalsunterschieden? ImpostorInnen bewerten diese Merkmalsunterschiede überwiegend als Nachteil (IP = 55%, NIP = 38%), während die Hälfte der Nicht-ImpostorInnen diese explizit als Vorteil schildern (IP = 36%, NIP = 50%). Eine Nicht-ImpostorIn beschreibt ein personenbezogenes Merkmal mit Auswirkungen als strukturellen Vorteil: [ ] 20 Prozent ungefähr sind Frauen [ ] die wollen 50% Frauen anstellen, das heißt wenn sie eine Frau finden die genau die gleichen Qualifikationen hat wie ein Mann, dann stellen sie die Frau an. Und es gibt Stipendien für Frauen, mehr Chancen für Frauen im Allgemeinen. Eine Impostorin beschreibt den sich als Benachteiligung durch die Fremdwahrnehmung auswirkenden Nachteil eines Unterschiedes so: [ ] ja, manchmal, es kommt darauf an, in welchem Rahmen es ist am Institut, manchmal habe ich schon das Gefühl, ich werde nicht so ernst genommen, wie die älteren Kollegen [ ] du möchtest was beitragen, du möchtest bei der Curricula Entwicklung, vielleicht hast du eine tolle Idee, wenn das der Professor X sagt, dann ist es interessant, wenn du es sagst, dann ist es vielleicht mal was anderes, aber nicht so umsetzbar, oder so. 78
87 Eine Benachteiligung durch Selbstwahrnehmung bezüglich eines professionsbezogenen Unterschiedes schildert ein Impostor wie folgt: Ich werfe mich im Lehrstuhl sozusagen, logischerweise, in einen Topf mit allen PhD- Studenten dort, wobei die anderen alle (..) mindestens 1 Jahr länger, sprich doppelt so lange wie ich, dabei sind, oder noch mehr. Und ich merke schon, wie ich selber den Anspruch habe sozusagen, mit denen auf einem Wissenslevel mitzuziehen, weil ich mir denke "ok, wir sind alle PhD-Studenten". Und das ist auch relativ schwierig, weil man, ich meine, die haben einfach sehr viel mehr Vorsprung im Erfassen von (..) von Wissen, von neuer Theorie. Ich kann mich unmöglich einfach in jedem Gebiet so gut auskennen wie die. Und sehe mich aber irgendwie sozusagen in dem Pool mit denen halt gemeinsam, ist aber definitiv nicht der Fall, weil ich kürzer dabei bin. (..) Teilweise noch überhaupt keinen Plan habe, was ja auch ok ist, aber (.) ja. Wie beschreiben ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen ihre Reaktion auf Konsequenzen von Merkmalsunterschieden? ImpostorInnen beschreiben in Reaktion auf den Nachteil eher passive Muster (Kategorie Relativieren und Zustand ertragen: IP = 45%, NIP = 13%). Eine Doktorandin aus der Gruppe der Nicht-ImpostorInnen, führt ihr Entgegenwirken bezüglich den Auswirkungen des Nachteils folgendermaßen aus: [ ] zum Beispiel wenn ich als Consultant arbeite oder wenn ich einen Beruf habe wo ich mich mit Klienten treffen muss, dann ist es ein Nachteil wenn man nicht perfekt Deutsch sprechen kann. [Rückfrage Interviewer: Was habe Sie da so gemacht, also wenn man das so merkt, wenn Sie zum Beispiel Dinge nicht verstehen?] Ich frage wieder. Ja ja, das war nie ein Problem mich anzupassen. Nein, nicht wirklich. 79
88 Tabelle 15 Kategoriensystem "Unterschiede zur Mehrheit der KollegInnen" mit absoluten und relativen Besetzungshäufigkeiten BH BH BH BH BH Oberkategorie IP 1 % NIP 2 % Subkategorie 1 IP 1 % NIP 2 % Subkategorie 2 IP 1 % Unterschied wahrgenommen 8 73% 5 63% BH NIP 2 % Subkategorie 3 BH IP 1 % BH NIP 2 % Personenbezogenes Unterscheidungsmerkmal 5 45% 3 38% Professionsbezogenes Unterscheidungsmerkmal 4 36% 4 50% Bewertung als Vorteil 4 36% 4 50% Auswirkungen 4 6% 4 50% Arbeitsprozess 1 9% 2 25% Karriereentwicklung 2 18% 2 25% Anforderungen des Arbeitsumfeldes 1 9% 1 13% Bewertung als Nachteil 6 55% 3 38% Ursprung des Nachteils Reaktion auf Benachteiligung Kein Vor-/Nachteil 2 18% 2 25% Kein Unterschied wahrgenommen 3 27% 3 38% Anmerkung. 1 = Besetzungshäufigkeit von ImpostorInnen, n = 11; 2 = Besetzungshäufigkeit von Nicht-ImpostorInnen, n = % 3 38% Strukturelle Vorteile 1 9% 2 25% Strukturelle Benachteiligung 1 9% 1 13% Benachteiligungen durch 3 27% 1 13% Fremdwahrnehmung Benachteiligung in Selbstwahrnehmung Benachteiligung in konkret praktischen Arbeitsprozessen 3 27% 0 0% 2 18% 1 13% 4 36% 2 25% Entgegenwirken 0 0% 1 13% Relativieren 2 18% 0 0% Zustand ertragen 3 27% 1 13% 80
89 6.2.6 Forschungsfrage 7: Charakteristika des IP zu Doktoratsbeginn Wie schätzen sich ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen bezüglich des IP zu Beginn des Doktorats ein? Fast die gesamte Gruppe der ImpostorInnen (91%) und mehr als die Hälfte der Nicht- ImpostorInnen (63%) identifizierten sich mit zumindest einem der Zitate bezüglich des Doktoratsbeginn (Keine Identifikation: IP = 9%, NIP = 38%). Explizit äußerten sich zudem Zweidrittel der ImpostorInnen, dass dieses Gefühl anhalte, ohne dass eine Nachfrage bestand (NIP = 0%).Von diesen waren 86 Prozent weiblich und nur eine Person männlich (25%). Welche Ursachen weisen ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen diesem Gefühl in der Retrospektive zu? 64 Prozent der ImpostorInnen und 63 Prozent der Nicht-ImpostorInnen begründeten ihre Zustimmung mit externalen Faktoren in ihrer Ursache. Ein Nicht-Impostor beschreibt seine Situation so: In der ersten Zeit schon sehr gut [ ] ich bin noch nie in meinem Leben auch in anderen Arbeitssituationen, noch nie so ins kalte Wasser geschmissen worden. [ ] In der ersten Woche, am ersten oder zweiten Tag bekomme ich vom Vorgänger einfach nur 10 Mappen hingestellt, also vom Chef und sagt "arbeite jetzt daran weiter". Die Software war nicht da, wo ich nicht gewusst habe, mit welcher soll ich arbeiten und ich war echt so, wo ich gesagt habe (.) "ich habe schon viel in meinem Leben erreicht, aber ich weiß eigentlich jetzt nicht, wie ich da weiter machen soll." Auf internale Faktoren attribuierten knapp Dreiviertel der ImpostorInnen, während kein/e Nicht-ImpostorIn dies beschreibt. Eine Impostorin schilderte dies wie folgt: [ ] ich habe Statistik studiert und habe keinen Schimmer gehabt, von Biologie und dann waren zum Teil so Vorträge über; Da waren halt Vorträge über Populationsgenetik und ich habe hingehen müssen und ich habe nach 5 Minuten nichts mehr verstanden, und zwar gar nichts. [ ] Am Anfang habe ich geglaubt ich müsste das verstehen und ich habe nicht mal das Gefühl gehabt, ich muss das vielleicht in einem Jahr verstehen, sondern ich habe das Gefühl gehabt, ich muss das jetzt verstehen. 81
90 Oberkategorie Identifikation mit Zitat Subkategorie 1 Vorhanden Nicht vorhanden BH IP 1 % BH NIP 2 % 1 9% 3 38% Subkategorie 2 Zeitliche Verortung der Identifikation Attribution der Ursache Tabelle 16 Kategoriensystem "Charakteristika des IP zu Doktoratsbeginn" mit absoluten und relativen Besetzungshäufigkeiten Subkategorie 3 Doktoratsbeginn Anhaltend präsent BH IP 1 % BH NIP 2 % 10 91% 5 63% 7 64% 0 0% External 7 64% 5 63% Internal 8 73% 0 0% Anmerkung. 1 = Besetzungshäufigkeit von ImpostorInnen, n = 11; 2 = Besetzungshäufigkeit von Nicht-ImpostorInnen, n = Forschungsfrage 8: Zukünftige berufliche Perspektive Welche emotionale Bewertung treffen ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen bezüglich der eigenen beruflichen Zukunft, und wie begründen sie diese? Ca. dreiviertel der ImpostorInnen und die Hälfte der Nicht-ImpostorInnen berichteten davon, unter Sorgen bezüglich der beruflichen Zukunft zu leiden. Befristete Arbeitsverträge (IP = 55%, NIP = 25%) und geringe Aufstiegsmöglichkeiten an Hochschulen (IP = 27%, NIP = 25%) zählen zu den häufigsten genannten Ursachen. Ihre Sorge aufgrund der Einschränkungen der Chancen am freien Arbeitsmarkt aufgrund von Qualifikationen schilderte eine Impostorin so: Ja, also ich weiß das das Doktorat am Arbeitsmarkt ein Nachteil ist, also aus drei Gründen finde ich. Also erstens weil viele Arbeitnehmer das nicht als Arbeitserfahrung sehen sondern als Studium, weil man die ganze Zeit studiert hat und viele wollen auch nicht so viel zahlen und in Österreich ist es auch der Erfahrung vieler Freunde nach so, dass die halt niemanden einstellen wollen als man selbst [ ] Dass explizit keine Sorge um die berufliche Zukunft bestehe, äußerten 27 Prozent der ImpostorInnen und 50 Prozent der Nicht-ImpostorInnen. Ursachlich wurden hierfür in erster Linie die Länge der Vertragslaufzeit und eine optimistische Grundhaltung genannt. Ein Impostor formulierte diese Haltung wie folgt: Ich bin erstens genügsam und zweitens habe ich immer irgendetwas gefunden. Und ich habe einfach auch für mich gelernt ich mache das was mir Spaß macht und dann kommt irgendwie so dann die; der Rest kommt dann von selber. 82
91 Für welchen Zeitrahmen beschreiben ImpostorInnen und Hochschulanstellung als gesichert? Nicht-ImpostorInnen ihre Wie in Tabelle 17 dargestellt, streuen in der Stichprobe der InterviewpartnerInnen die Vertragslaufzeiten breit. Mehr als 24 Monate wird von 45 Prozent der ImpostorInnen gegenüber 38 Prozent der Nicht-ImpostorInnen berichtet. Keine Nennung gab es für den Zeitraum zwischen 19 und 24 Monaten. Zwei ImpostorInnen (18%) und ein Nicht-Impostor (13%) gaben Laufzeiten zwischen 13 und 18 Monaten an, während kein/e ImpostorIn und 38 Prozent der Nicht-ImpostorInnen schilderten, weitere 7 bis 12 Monate an der Hochschule angestellt zu sein. Von 1 bis 6 Monaten Vertragsdauer berichteten drei ImpostorInnen (27%) und ein Impostor (13%), während eine Impostorin angab, dass sie mittlerweile ohne Anstellung sei (9%). Welche berufliche Perspektive sehen ImpostorInnen und Nicht-ImpostorInnen an der Hochschule für sich? Bezüglich einer Hochschulkarriere äußerten sich 45 Prozent der ImpostorInnen diese anzustreben (NIP = 38%), während nur ein Impostor (9%, NIP = 38%) angab noch unentschlossen zu sein. Knapp die Hälfte der Gruppe der Nicht-ImpostorInnen beschrieb, keine Hochschulkarriere anzustreben (45%, NIP = 25%). 83
92 Tabelle 17 Kategoriensystem "Zukünftige berufliche Perspektive" mit absoluten und relativen Besetzungshäufigkeiten Oberkategorie Subkategorie 1 Sorge bzgl. der beruflichen Zukunft Vorhanden BH IP 1 % BH NIP 2 % Subkategorie 2 Subkategorie 3 BH IP 1 % BH NIP 2 % 8 73% 4 50% Ursachenzuschreibung Unklarheit über beruflichen Ziele 1 9% 2 25% Befristete Arbeitsverträge 6 55% 2 25% Geringe Aufstiegsmöglichkeiten 3 27% 2 25% Einschränkungen aufgrund der Qualifikation am freien Arbeitsmarkt 2 18% 2 25% Einschränkungen der finanziellen Sicherheit 1 9% 2 25% Nicht vorhanden 3 27% 4 50% Ohne Begründung 3 27% 2 25% Ursachenzuschreibung Lange Vertragslaufzeit 1 9% 2 25% Positive Chancen am freien Arbeitsmarkt 1 9% 1 13% Zeitraum bis zum Auslaufen der Anstellung > 24 Monate 5 45% 3 38% Monate 0 0% 0 0% Monate 2 18% 1 13% 7-12 Monate 0 0% 3 38% 1-6 Monate 3 27% 1 13% Ohne 1 9% 0 0% Anstellung Hochschulkarriere Angestrebt 5 45% 3 38% Unentschlossen 1 9% 3 38% Nicht 5 45% 2 25% angestrebt Anmerkung. 1 = Besetzungshäufigkeit von ImpostorInnen, n = 11; 2 = Besetzungshäufigkeit von Nicht-ImpostorInnen, n = 8. Optimistische Grundhaltung 4 36% 1 13% Ohne Begründung 2 18% 3 38% 84
93 7 Diskussion Die vorliegende Studie stellt die erstmalige, empirische Untersuchung des Impostor Phänomens (IP) in Bezug auf relevante Aspekte des Arbeitsumfeldes dar. Zunächst wurden das Maß der Ausprägung und die Prävalenz des IP bei Doktoratsstudierenden erhoben, um dann Teilstichproben von DoktorandInnen in Hochschulanstellung bezüglich ihres Arbeitskontextes zu befragen. Die Auswertung der quantitativen Daten des Onlinefragebogens und der qualitativen Daten aus den problemzentrierten Interviews liefern eine Fülle von Forschungsergebnissen, die nun, der Stärke des Mixed Method Ansatzes entsprechend (Hussy et al., 2010), in Bezug zueinander interpretiert werden. Im Anschluss an Kapitel 7.1 werden Implikationen für die Praxis aufgezeigt, Limitationen der vorliegenden Studie diskutiert und es wird ein Forschungsausblick skizziert. 7.1 Interpretation der Ergebnisse Bisherige Forschungsbefunde, wonach junge WissenschaftlerInnen eine in hohem Maße vom IP betroffene Population darstellen (Jöstl et al., 2012; Mattie et al., 2008), werden von Ergebnissen dieser Studie bestätigt. So stützen die Resultate der statistischen Auswertungen einmal mehr die These, dass gesellschaftlich verbreitete Erwartungen an WissenschaftlerInnen (David, 2000; Macha, 1992) zu Zweifeln an den eigenen Fähigkeiten führen, sobald sie in Konfrontation mit dem Forschungsalltag geraten (Klinkhammer & Saul- Soprun, 2009). Die starke Verbreitung des IP unter Frauen in der Wissenschaft wurde ebenfalls repliziert. Dies spricht für die Thesen, dass fehlende weibliche Vorbilder (Miller & Kastberg, 1995), die eingeschränkten Möglichkeiten für berufliche Vernetzung (Kumar & Jagacinski, 2006) und die Bedrohung der Weiblichkeit durch Genderstereotype (Eagly & Karau, 2002) das IP besonders in einem wissenschaftlichen Berufskontext fördern. Die erhöhte Ausprägung des IP unter Doktoratsstudierenden in Hochschulanstellung im Vergleich zu hochschulexternen Promovierenden repliziert nicht nur die Ergebnisse von Jöstl et al. (2012), sondern untermauert deren Conclusio: Das Arbeitsumfeld Hochschule erhöht die Ausprägung des IP unter jungen WissenschaftlerInnen. Der, wenn auch nur geringe Zusammenhang zwischen dem Lebensalter sowie der fehlende zwischen akademischem Alter und dem IP widerspricht den bisherigen 85
94 Forschungsergebnissen aus dem Kontext von JungwissenschaftlerInnen (Mattie et al., 2008), welche einen signifikant negativen Zusammenhang fanden. Vielmehr stützen diese Ergebnisse die These von Thompson et al. (1998), wonach sich das IP bei Älteren aufgrund der höheren Wahrscheinlichkeit von positivem Feedback im Beruf schwächer ausprägt. Ursächlich für den nicht signifikanten Zusammenhang zwischen akademischem Alter und dem IP könnte die spezifische Ausbildungsstruktur der Stichprobe von DoktorandInnen sein. Stetig neue Herausforderungen für Promovierende sind bereits in Doktoratsprogrammen angelegt (z.b. Curriculum für das Doktoratsstudium der Philosophie in Geistes- und Kulturwissenschaften, Senat der Universität Wien, 2012) und prägen Forschungsprozesse über den gesamten Zeitraum der Promotion (Klinkhammer & Saul-Soprun, 2009). Dies könnte als Erklärung dafür dienen, dass sich mit der Zeit zunehmenden Routinen in ihrer Wirkung auf das IP bei Doktoratsstudierenden im Vergleich zu anderen Populationen nicht einstellt (siehe Kapitel 3.3.5). Aufbauend auf diesen Erkenntnissen galt es zu ergründen, welche möglichen Einflussgrößen des Arbeitsumfeldes Hochschule mit der Ausprägung des IP in Verbindung stehen. Wie angenommen sind solche DoktorandInnen stärker vom IP betroffen, die aufgrund von hoher Arbeitsbelastung Enttäuschungen ihres Arbeitsumfeldes erleben. Es liegt somit empirische Evidenz dafür vor, dass Promovierende mit Hochschulanstellung aufgrund von Berufsrollenkonflikten (Schulz, 2013) an ihren Fähigkeiten zur Erfüllung der Aufgaben als DoktorandInnen zweifeln (Klinkhammer & Saul-Soprun, 2009). Dass Rollenkonflikte zwischen Arbeits- und Privatleben nicht signifikant mit der Ausprägung des IP zusammenhängen, ist im Hinblick auf das Durchschnittsalter der Stichprobe erklärbar: Nach Byron (2005) werden diese erst bei Familiengründung und Kindern im Haushalt besonders relevant eine Lebensphase, die bei AkademikerInnen vergleichsweise spät beginnt (Wirth & Dümmler, 2004). In der Wahrnehmung von Konkurrenz im Arbeitsumfeld besteht kein direkter Zusammenhang mit der Ausprägung des IP. Wie in Kapitel beschrieben, scheint Konkurrenz eher einen moderierenden Einfluss auf das IP auszuüben. So könnte ausgeprägte Rivalität unter KollegInnen beispielsweise den Austausch über Schwierigkeiten verringern (Drago & Turnbull, 1991) und somit die Ausprägung des IP verstärken. Weiters zur Klärung der Ursache könnte der von Craddock et al. (2011) berichtete Befund sein, wonach DoktorandInnen von Konkurrenz in Bezug auf das IP im Besonderen zu Beginn des Doktorats 86
95 berichten. Diese zeitliche Komponente sowie mögliche moderierende Effekte von Konkurrenz im Arbeitsumfeld konnte in der Auswertung nicht berücksichtigt werden. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Arbeitsplatz Hochschule für DoktorandInnen mit häufigen Leistungsevaluationen verbunden ist (McCormick & Barnes, 2008). Dieser Umstand zählt quasi zum Alltag von Promovierenden in Hochschulanstellung, weshalb ein gewisser Gewöhnungseffekt an diesen Umstand denkbar ist und den nicht signifikanten Einfluss der Leistungsevaluation auf das IP erklärt. Sowohl in den qualitativen als auch in den quantitativen Daten findet sich kaum ein Hinweis darauf, dass soziale Unterstützung einen direkten Beitrag zur Erklärung des IP leistet. Einzig auf den Kategorien der emotionalen Unterstützung der Oberkategorie Ausmaß der Unterstützung berichten ImpostorInnen vermehrt von fehlender Unterstützung. Dieser Befund wird zwar von einem signifikant negativen Zusammenhang zwischen emotionaler Unterstützung durch KollegInnen gestützt, jedoch erklärt dieser nur einen sehr geringen Anteil der Varianz des IP unter Einbezug der in Forschungsfrage 2 aufgeführten Variablen (siehe Kapitel 4.2.2). Hingegen beschreiben ImpostorInnen in Konfrontation mit Schwierigkeiten, explizit deutlich seltener Hilfsangebote aus ihrem Arbeitsumfeld zu erhalten und schildern häufiger das Ausbleiben von Hilfsofferten (Kategoriensystem Schwierigkeiten im Arbeitsalltag). Dieses zunächst widersprüchlich erscheinende Resultat lässt sich nach den Forschungsergebnissen von Ferrari (2005) mittels erhöhter sozialer Erwünschtheit bei ImpostorInnen erklären: Werden vom IP Betroffene danach befragt, ob beispielsweise emotionale Unterstützung vorhanden sei, so antworten diese in Richtung des sozial Erwünschten tendenziell zustimmend. Werden diese nun aufgefordert Unterstützung aus dem Arbeitsumfeld bei konkreten Schwierigkeiten zu schildern, so rückt die Wirkung des Effekts in den Hintergrund. Die Analyse des Interviewmaterials bezüglich Schwierigkeiten im Arbeitsalltag stützt zudem die Formulierung einer neuen These: In Punkto Hilfe aus dem Arbeitsumfeld scheint es sich um eine Wechselwirkung mit dem IP zu handeln. Schließlich berichten ImpostorInnen nicht nur davon weniger Hilfe zu erfahren, sondern, mit der Begründung hierzu keine Möglichkeit zu sehen oder sich keine Besserung der Situation zu erwarten, explizit davon keine Hilfe einzufordern. Hypothesenkonform schildert die Gruppe der ImpostorInnen seltener eine Anwesenheit von MentorInnen in ihren Arbeitsumfeldern (Clance & O Toole, 1987; Whitman & Shanine, 2012). 87
96 Dass DoktorandInnen für ihre MentorInnen ausschließlich positive Funktionen formulierten lässt vermuten, dass deren Anwesenheit eine Ressource gegenüber der Ausprägung des IP darstellt: Zum einen impliziert die Unterstützung bei konkreten Aufgaben und in der Orientierung im Wissenschaftsbetrieb bereits die Vermittlung eines Gefühls der Wertschätzung und des Vertrauens bezüglich der Fähigkeiten der bzw. des Mentees wieder, an welchem es ImpostorInnen mangelt (z.b. Leary et al., 2000). Zum anderen wurden MentorInnen in Funktionen beschrieben, in denen sie als AustauschpartnerInnen dienen. Die Ergebnisse stützen somit die von ForscherInnen formulierte These, dass DoktorandInnen im fachlichen Dialog mit MentorInnen eine realistischere Einschätzung der eigenen Fähigkeiten gewinnen (Hooper et al., 2012; McCormick & Barnes, 2008). Bezüglich des Austausches über Schwierigkeiten im Kollegium zeichnet sich ein recht deutliches Bild ab: ImpostorInnen berichten seltener vom Stattfinden und häufiger explizit von Einschränkungen bzw. dem Ausbleiben eines solchen Austauschens. Das berufliche für sich behalten von Ängsten und Sorgen nährt hypothesenkonform Zweifel an den eigenen Fähigkeiten (Klinkhammer & Saul-Soprun, 2009; Studdard, 2002; Zorn, 2005). Dass unter dem IP leidende DoktorandInnen seltener positive und häufiger negative Folgen des Austausches schildern gibt zudem Anlass zur Vermutung, dass nicht die bloße Abwesenheit von Austauschmöglichkeiten allein, sondern auch deren Funktion eine Rolle zu spielen scheint. So könnte eine übermäßige Konfrontation mit den Schwierigkeiten anderer ebenfalls zu einer Verunsicherung bezüglich der eigenen Fähigkeiten führen. Die Beschreibungen von DoktorandInnen bezüglich Feedback zeichnet mit Blick auf Ausprägungen des IP ein einheitliches Bild: Nicht-ImpostorInnen äußern sowohl auf formellem, als auch auf informellem Wege häufiger Feedback von KollegInnen, wie auch von ProfessorInnen zu erhalten und berichten seltener vom expliziten Ausbleiben von Rückmeldung. Diese Erkenntnisse sind als Indizien dafür zu deuten, dass Personen mit weniger Feedback aus dem direkten Arbeitsumfeld von für die Karriere elementar wichtigen Personen eine relevante Kategorie in der Entstehung und Aufrechterhaltung des IP darstellen (Brems et al., 1994; Clance, 1985). Dass ImpostorInnen es eher vermeiden auf eigene Initiative hin um Rückmeldung zu bitten, wird mit der generell stärker ausgeprägten Angst vor Prüfungen (Kumar & Jagacinski, 2006), Misserfolg (Fried-Buchalter, 1997; Jöstl et al., 2012) und öffentlicher Leistungsbewertung (Leary et al., 2000) erklärbar: Aus Sorge vor 88
97 der Enthüllung eines vermeintlich intellektuellen Betruges meiden ImpostorInnen jene Situationen der Leistungsbewertung. Die Ergebnisse der Analyse der Interviews ergaben, dass auch die Güte des Feedbacks und dessen Fokus in Verbindung mit dem IP stehen. ImpostorInnen berichten seltener von konstruktivem bzw. häufiger von Einschränkungen der Konstruktivität des Feedbacks und nehmen ihre Person vermehrt als Ziel der Rückmeldung war. Dies ist als Hinweis dafür zu deuten, dass Feedback in negativer Qualität Zweifel an den eigenen Fähigkeiten verstärkt. Ob das eher negative emotionale Erleben von ImpostorInnen nach dem Erhalt von Rückmeldung in der Güte des Feedbacks oder als Folge des IP begründet liegt, kann in diesem methodischen Ansatz nicht abschließend geklärt werden. Denkbar wäre ebenfalls, dass ImpostorInnen in ihrer übergeneralisierenden Bewertung von Fehlern (Thompson et al., 2000) Kritikpunkten erhöhte Aufmerksamkeit schenken. Die Wahrnehmung von Insuffizienz der eigenen Fähigkeiten könnte die bewiesene, emotionale Betroffenheit hervorrufen (Cowman & Ferrari, 2002). Gemäß den Erwartungen nehmen angestellte ImpostorInnen häufiger Unterschiede zu ihrem Kollegium wahr, die sie als benachteiligend bewerten. Damit ist das Ergebnis als Indiz für die von Harvey und Katz (1985) geäußerte These zu werten, wonach die Selbstwahrnehmung als exponierte Minderheit Selbstzweifel an den eigenen Fähigkeiten erhöht (siehe Kapitel 3.3.9). Auswertungsergebnisse der Ursachen für Unterschiede zeigen, dass personenbezogene Merkmale, wie Alter, Geschlecht oder Herkunft eine gewichtige Rolle spielen. Deutlich wird jedoch auch, dass solche im Hochschulkontext um professionsbezogene Merkmale, wie beispielsweise eine Unterscheidung zum Kollegium bezüglich der wissenschaftlichen Disziplin im Grundstudium, erweitert werden müssen. In der Attribution des Nachteils entfaltet das qualitative Material ebenfalls Differenzen. Wenn gleich aufgrund der geringen Bezugshäufigkeit nicht kausal interpretierbar, ist die Analyse der Ursachen von wahrgenommenen Unterschieden in Bezug auf das IP aufschlussreich. ImpostorInnen differenzieren zwischen solchen Bewertungen, die durch das Arbeitsumfeld entstehen und solche die explizit durch die eigene Bewertung ihre Wirkung erzielen. Zudem geben die Befunde Anlass zur Vermutung, dass Erlebniszustände von ImpostorInnen für sich genommen als einen solchen Unterschied bildend fungieren können. So berichtet beispielsweise ein Impostor, dass der Unterschied zu seinen KollegInnen im eigenen 89
98 Anspruch darin besteht, zu den SpitzenleisterInnen des Instituts zu gehören, obwohl er erst seit kurzem Doktorand ist (siehe Kapitel 6.2.5). Was sich schon in der Analyse des Umgangs mit Schwierigkeiten im WissenschaftlerInnenalltag zeigt (Kategoriensystem Schwierigkeiten im Arbeitsalltag), ist auch in Betrachtung der Reaktionen auf als Nachteil empfundene Unterschiede zum Kollegium ersichtlich: ImpostorInnen unterscheiden sich in der Beschreibung von Handlungsstrategien im Umgang mit Hindernissen im Arbeitsalltag zu Nicht-ImpostorInnen kaum nennenswert. In diesem Ergebnis widerspiegelt sich einmal mehr, dass sich ImpostorInnen nicht primär in ihrem Verhalten von Nicht-ImpostorInnen unterscheiden, sondern in ihrem maladaptiven Attributionsstil bezüglich deren Folgen (z.b. Sonnak & Towell, 2001). Die Analyse der Interviews sprechen für die These, dass das IP in seiner Ausprägung ein situatives Moment besitzt (Clance, 1985; Harvey & Katz, 1985): Vom IP Betroffene, wie auch zum Zeitpunkt des Interviews nicht als ImpostorInnen geltende DoktorandInnen identifizieren sich in der allgemein als Herausforderung empfundenen Anfangsphase des Doktorats mit Charakteristiken des IP. Dass die Mehrheit der ImpostorInnen, insbesondere Frauen, hierbei explizit betonte bis dato unter Charakteristiken des IP zu leiden, ist Ausdruck von deren außerordentlichem Leidensdruck. In der Ursachenzuschreibung zeigt sich einmal mehr der maladaptive Attributionsstil von ImpostorInnen (z.b. Sightler & Wilson, 2001; Thompson et al., 1998): Während Nicht-ImpostorInnen ausschließlich externale Ursachen für die Ausprägung des IP zu Doktoratsbeginn schilderten, beschrieben die Mehrheit der ImpostorInnen solche, die in der eigenen Person lokalisiert sind. Was die Bewertung der beruflichen Zukunft betrifft ist festzuhalten, dass die Interviewten unabhängig davon ob sie unter dem IP leiden oder nicht, auffallend häufig von Sorgen berichten. Obwohl nach Abschluss des Doktorats zur Bildungsspitze des Landes gehörend, schilderte die Mehrheit der Promovierenden die beispielsweise bei Klinkhammer (2013) beschriebenen, kontextuellen Belastungsfaktoren in Wissenschaftskarrieren: Befristete Arbeitsverträge, geringe Aufstiegsmöglichkeiten und fehlende finanzielle Sicherheit mache den Arbeitsplatz Hochschule auf Dauer wenig attraktiv. Nicht verwunderlich ist deshalb, dass sich nur eine Minderheit sowohl der vom IP Betroffenen wie auch der nicht betroffenen DoktorandInnen, sich zum Interviewzeitpunkt bisher zu einer Hochschulkarriere entschlossen hatten. 90
99 In dieser Stichprobe zeigte sich jedoch nicht, dass ImpostorInnen prinzipiell seltener eine Hochschulkarriere anstreben. Dieses Ergebnis ist wenig überraschend, wenn man den Zeitraum zur Beendigung des Anstellungsverhältnisses betrachtet: Beinahe die Hälfte der interviewten ImpostorInnen stehen am Anfang ihres Doktorats, sprich eine endgültige Entscheidung für bzw. gegen eine Hochschulkarriere befand sich noch in weiter Ferne. Hinsichtlich der Klärung der Frage, ob das IP einen Selbstselektionseffekt für WissenschaftlerInnen begünstigt (Parkman & Beard, 2008), ist somit weiteres Forschungsbemühen notwendig. 7.2 Praktische Implikationen Die Befunde von Jöstl et al. (2012) sowie der vorliegenden Studie zeigen eindrucksvoll, dass dringender Handlungsbedarf im Hochschulkontext und insbesondere für Frauen in der Wissenschaft besteht. Aus den Forschungsergebnissen dieser Untersuchung lassen sich konkrete Vorschläge für die Praxis ableiten, von denen in weiterer Folge zwei exemplarisch beschrieben werden. Den Rahmen bildet das Strukturmodells der Bildungspsychologie (Spiel et al., 2008), in dem sich die Implikationen als Prävention und Intervention (Dimension Aufgabenbereiche) im Tertiärbereich (Dimension Bildungskarriere) auf Mikro- und Mesoebene (Dimension Handlungsebene) verorten lassen Intervention auf Mikroebene: DoktorandInnencoaching Coaching meint eine Form der Beratung, die im Einzelsetting auf Augenhöhe eine Möglichkeit zur (Selbst-) Reflexion im beruflichen Kontext (Klinkhammer, 2013, S. 311) bietet und laut Erfahrungen aus der Praxis, für IP betroffene WissenschaftlerInnen effektive Unterstützung leistet (Klinkhammer & Saul-Soprun, 2009). Aufgrund der unscharfen Definition von Coaching ist der Beratungsansatz in der Begleitung von ImpostorInnen entscheidend. Das hier vorgeschlagene, lösungsfokussierte Coaching legt einen Schwerpunkt auf das Arbeiten mit Stärken, Ressourcen und Potenzialen von KlientInnen (Furman & Ahola, 2010). Dieser Fokus bietet ImpostorInnen den Vorteil, mittels Reflexion der Erfolge und des eigenen Beitrages zu deren Ermöglichung, ein realistisches Bild der eigenen Fähigkeiten zu gewinnen. Die dem lösungsfokussierten Coaching zu Grunde liegende Haltung der Wertschätzung und Würdigung der Leistungen von KlientInnen wirkt zudem selbstwertstärkend (Klinkhammer & Saul-Soprun, 2009). 91
100 Neben diesen in der Begegnung des IP allgemein nützlichen Aspekten, bietet lösungsfokussiertes Coaching bezüglich der spezifischen Forschungsergebnisse dieser Studie weitere Vorteile: Der geschützte Rahmen eröffnet Raum für die Kommunikation über berufliche Schwierigkeiten und stimuliert gleichzeitig die Suche nach Lösungen. Das Ableiten praktischer Handlungsoptionen in Konfrontation beispielsweise mit Berufsrollenkonflikten, wäre eine konkrete Möglichkeit zur Reduktion des IP bei DoktorandInnen. Welche Quellen für konstruktives Feedback bestehen und wie Ressourcen für soziale Unterstützung genutzt werden könnten, kommen als weitere mögliche Themen im Rahmen eines lösungsfokussierten Coachings zur Reduktion des IP in Frage Prävention und Intervention auf Mesoebene: Mentoring Programme für DoktorandInnen Die Forschungsergebnisse geben deutliche Hinweise darauf, dass MentorInnen, neben praktischen Unterstützungen im ForscherInnenalltag (Schmidt & Richter, 2008) und Förderungen der Karriere (Jungbauer-Gans & Gross, 2013), auch eine Funktion in der Prävention und Intervention bezüglich des IP im Hochschulkontext zukommt. Es ist anzunehmen, dass der Austausch mit MentorInnen über Schwierigkeiten leichter fällt, da eine Vertrauensbasis, aber keine Abhängigkeit besteht. Vorbildfunktion und Unabhängigkeit von MentorInnen erleichtern es DoktorandInnen allgemein konstruktives Feedback anzunehmen sowie Lob und Anerkennung für die eigene Arbeit zu internalisieren (Clance & O Toole, 1987; Parkman & Beard, 2008). Emotionale Unterstützung ist in Beziehungen zu MentorInnen ebenfalls wahrscheinlicher. Dass Doktoratsstudierende in der Phase des Einstiegs ins Doktorat, welche für viele Promovierende generell eine Phase geringer Unterstützung darstellt (Schmidt, 2008), besonders häufig unter dem IP leiden, spricht für ein Mentoring Angebot ab Doktoratsbeginn. Der bereits von Jöstl et al. (2012) geäußerten Forderung nach flächendeckenden Mentoring Programmen für Promovierende an Hochschulen wird angesichts der Befunde dieser Studie Nachdruck verliehen. Im Rahmen von Veranstaltungen zur generellen Implementation entstünde zusätzlich Raum für Aufklärung von MentorInnen wie Mentees bezüglich Existenz und Wirkmechanismen des IP. Die alleinige Information über das Vorhandensein eines solchen Phänomens sowie die Tatsache, dass noch andere DoktorandInnen davon betroffen sind, erfüllt für ImpostorInnen bereits eine Entlastungsfunktion (Jöstl et al., 2012). 92
101 Das innovative Konzept des Mutual Mentoring der Universität von Massachusetts gilt als Mustereispiel für ein strukturiertes Mentoring Programm, da es nicht nur DoktorandInnen, sondern Personen der gesamten Hierarchiestruktur einer Hochschule zu Gute kommt (Yun & Scorcinelli, 2009). Diesem liegt die Prämisse zugrunde, dass alle MitarbeiterInnen in einer Organisationseinheit (z.b. einer Fakultät) TrägerInnen von spezifischem Wissen sind, das es durch Teilen und Erhalten zu nutzen gilt. Die Beziehung zwischen MentorInnen und Mentees werden entsprechend dieser Haltung auf gegenseitiges Lernen, unabhängig von akademischem Grad oder beruflicher Stellung, ausgerichtet. Junge WissenschafterInnen könnten so von einem Netz verschiedener Gruppen von MentorInnen (Professorinnen, Studierende etc.) profitieren, was zu einer verbesserten Kommunikation im gesamten Arbeitsumfeld führt (Yun & Scorcinelli, 2009). Neben den bereits genannten Effekten von MentorInnen bezüglich der Eindämmung des IP im Hochschulkontext, sind die Vorteile speziell des Mutual Mentorings in Anbetracht der Forschungsergebnisse dieser Studie folgende: Die Steigerung der Kommunikation mittels MentorInnenbeziehungen fördert den Austausch über Schwierigkeiten und verringert das Auftreten von Enttäuschungsgleichgewichten aufgrund von Berufsrollenkonflikten (siehe Kapitel 3.3.3), da MitarbeiterInnen in größerem Umfang von den Arbeitsbelastungen ihren KollegInnen erfahren würden. Weiters ist anzunehmen, dass die Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten möglicher Unterschiedsbildungen aufgrund von personen- und professionsbezogenen Merkmalen seltener stattfindet. Die Diversität würde in einem breiteren Kreis von KollegInnen und unter Einbezug alle Hierarchieebenen sichtbarer. Kumar und Jagacinski (2006) sehen zudem in den eben beschriebenen Netzwerken bezüglich der Eindämmung des IP insbesondere für Frauen ein besonderes Potential. 7.3 Limitationen Die Ergebnisse der ersten beiden Forschungsfragen wurden in Analyse von quantitativen Daten der Gesamt- (N = 561) bzw. der Teilstichprobe angestellter DoktorandInnen (n = 247) gefunden. Interpretationen dieser Befunde sind in ihrer Gültigkeit für die Population von österreichischen DoktorandInnen in wesentlich höherem Maße verallgemeinerbar, denn die Resultate aus den Interviews mit der um ein Vielfaches kleineren Teilstichprobe von 19 Promovierenden. Aufbauend auf den Ergebnissen der QIA ist nun die Konstruktion von 93
102 quantitativen Erhebungsinstrumenten notwendig, um die hier gewonnenen Erkenntnisse, insbesondere jene auf hypothetischem Niveau, an einer großen Stichprobe zu überprüfen. Das Interviewmaterial bildet primär die Wahrnehmung der Lebenswelten von DoktorandInnen bezüglich ihres Arbeitsumfeldes ab. Um die Aussagen der Interviewten zu objektivieren und zu validieren, müssten sie denen von KollegInnen oder Vorgesetzten gegenübergestellt werden. Eine solche Herangehensweise hätte zum Beispiel klären können, ob die Aussagen von ImpostorInnen, bezüglich Einschränkungen des Austausches über Schwierigkeiten von KollegInnen geteilt und damit auch für Nicht-ImpostorInnen vorhanden sind oder ob, bei mehrheitlichem Wiederspruch, diese Wahrnehmung eher ein Aspekt des Erlebens von IP Betroffenen darstellt. Diese Validierungsbemühung hätte jedoch nicht dem primär explorativen Charakter der Studie entsprochen. Zudem wäre allein durch die Ankündigung der Befragung von Personen des Arbeitsumfeldes der Aufbau einer Vertrauensbasis zwischen InterviewteilnehmerIn und Interviewer beeinträchtigt worden. Wahrscheinlicheres Verschweigen oder unwahrheitsgemäßes Antworten hätte die Validität der Aussagen geschmälert. Abschließend ist, wie in jeder Studie im Querschnittdesign inhärent (Bortz & Döring, 2006), auch in dieser Untersuchung die letzte Gewissheit bezüglich der Richtung der Kausalität als Einschränkung zu nennen. Ob nun beispielsweise fehlendes Feedback aus dem Arbeitsumfeld zur Ausprägung des IP beiträgt oder ob das Handeln von ImpostorInnen für das Ausbleiben von Rückmeldung verantwortlich ist, könnte abschließend nur in einer Längsschnittstudie geklärt werden. 7.4 Forschungsausblick Trotz der im vorangestellten Kapitel beschriebenen, methodischen Einschränkungen kann die Studie bezüglich ihrer Zielsetzung als insgesamt gelungen bewertet werden. Mit der Analyse und Interpretation des quantitativen, besonders jedoch des qualitativen Datenmaterials, wurde erstmalig eine breite Basis an empirischer Evidenz für Zusammenhänge zwischen Faktoren des Arbeitsumfeldes und dem IP geschaffen. Die Befunde dieser Studie stellen jedoch nur den Ausgangspunkt der Forschung bezüglich des IP in Verbindung mit Variablen des Arbeitsumfeldes Hochschule dar. Was nun folgen muss, ist die Prüfung der Erkenntnisse der qualitativen Auswertungen an einer größeren Stichprobe. Während die Verbreitung des IP bei DoktorandInnen sowie diesbezügliche 94
103 Geschlechterunterschiede und solche, die das Beschäftigungsverhältnis betreffen, nun ausreichend bestätigt wurden, ist die Prüfung der Gültigkeit der Ergebnisse der qualitativen Untersuchungen noch ausstehend. Daneben ist die Analyse von komplexeren Relationen zwischen den einzelnen Variablen des Arbeitsumfeldes Hochschule ausständig. So wären beispielsweise aufgrund einer gewissen inhaltlichen Ähnlichkeit der Konstrukte a) sozialer Unterstützung und b) Feedback aus dem Arbeitsumfeld, hier Interkorrelationen vorstellbar. Weitere Vorschläge für zukünftige Forschung und methodische Herangehensweisen finden sich im Rahmen der Diskussion der Limitationen in Kapitel 7.3. Abschließend ist festzustellen, dass das Arbeitsumfeld Hochschule ein hohes Erklärungspotential bezüglich der Entstehung und Aufrechterhaltung des IP bei DoktorandInnen in sich trägt. Diese Conclusio sollte die Forschungsgemeinschaft darin ermutigen, auch zukünftig Faktoren der Umgebung von ImpostorInnen in Untersuchungsplanungen miteinzubeziehen. 95
104 Literatur André, N., & Metzler, J. N. (2011). Gender differences in fear of success: A preliminary validation of the Performance Success Threat Appraisal Inventory. Psychology of Sport and Exercise, 12(4), doi: /j.psychsport Andrews, B., & Wilding, J. M. (2004). The relation of depression and anxiety to life-stress and achievement in students. British Journal of Psychology, 95(4), doi: / Antoine, D., Hutchison, M., & Follman, D. (2006). The undergraduate research experience as it relates to research-efficacy beliefs and the imposter phenomenon. In Proceedings of the 113th annual conference of the American society for engineering education. Austria Presse Agentur. (2012, April 11). Betrüger-Phänomen : Jungforscher mit chronischen Selbstzweifeln. Abgerufen von men_jungforscher-zweifeln-ob-ihnen-erfolg-zusteht Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52(1), doi: /annurev.psych Battle, J. (1978). Relationship between self-esteem and depression. Psychological Reports, 42(3), doi: /pr Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., & Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public Interest, 4(1), doi: / Bernard, N. S., Dollinger, S. J., & Ramaniah, N. V. (2002). Applying the big five personality factors to the impostor phenomenon. Journal of Personality Assessment, 78(2), doi: /s jpa7802_07 96
105 Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal an der Universität Wien. (2009). Regelung bei befristeten Verträgen. Abgerufen von ng.pdf Birney, R. C., Burdick, H., & Teevan, R. C. (1969). Fear of failure. NY, New York: Van Nostrand- Reinhold Co. Bortz, J., & Döring, N. (2006). Forschungsmethoden und Evaluation: Für Human- und Sozialwissenschaftler. Heidelberg: Springer. Brems, C., Baldwin, M. R., Davis, L., & Namyniuk, L. (1994). The imposter syndrome as related to teaching evaluations and advising relationships of university faculty members. The Journal of Higher Education, 65(2), doi: / Buchinger, K. (2000). Skizzen zur Frage der Identität. Gruppendynamik und Organisationsberatung, 31(4), doi: /s x Byron, K. (2005). A meta-analytic review of work family conflict and its antecedents. Journal of Vocational Behavior, 67(2), doi: /j.jvb Caselman, T. D., Self, P. A., & Self, A. L. (2006). Adolescent attributes contributing to the imposter phenomenon. Journal of Adolescence, 29(3), doi: /j.adolescence Chae, J.-H., Piedmont, R. L., Estadt, B. K., & Wicks, R. J. (1995). Personological evaluation of Clance s Imposter Phenomenon Scale in a Korean sample. Journal of Personality Assessment, 65(3), doi: /s jpa6503_7 Chayer, M.-H., & Bouffard, T. (2010). Relations between impostor feelings and upward and downward identification and contrast among 10- to 12-year-old students. European Journal of Psychology of Education, 25(1), doi: /s y 97
106 Chrisman, S. M., Pieper, W. A., Clance, P. R., Holland, C. L., & Glickauf-Hughes, C. (1995). Validation of the Clance Imposter Phenomenon Scale. Journal of Personality Assessment, 65(3), doi: /s jpa6503_6 Clance, P. R. (1985). The impostor phenomenon: Overcoming the fear that haunts your success. Atlanta, GA: Peachtree Publishers. Clance, P. R., Dingman, D., Reviere, S. L., & Stober, D. R. (1995). Impostor phenomenon in an interpersonal/social context: Origins and treatment. Women & therapy, 16(4), Clance, P. R., & Imes, S. A. (1978). The imposter phenomenon in high achieving women: Dynamics and therapeutic intervention. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 15(3), doi: /h Clance, P. R., & O Toole, M. A. (1987). The imposter phenomenon. Women & Therapy, 6(3), doi: /j015v06n03_05 Cohen, J. (1968). Weighted kappa: Nominal scale agreement provision for scaled disagreement or partial credit. Psychological Bulletin, 70(4), doi: /h Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), doi: / Conroy, D. E., Willow, J. P., & Metzler, J. N. (2002). Multidimensional fear of failure measurement: The performance failure appraisal inventory. Journal of Applied Sport Psychology, 14(2), doi: / Cowman, S. E., & Ferrari, J. R. (2002). Am I for real? Predicting impostor tendencies from self-handicapping and affective components. Social Behavior and Personality: an international journal, 30(2), doi: /sbp
107 Cozzarelli, C., & Major, B. (1990). Exploring the validity of the impostor phenomenon. Journal of Social and Clinical Psychology, 9(4), doi: /jscp Craddock, S., Birnbaum, M., Rodriguez, K., Cobb, C., & Zeeh, S. (2011). Doctoral students and the impostor phenomenon: Am I smart enough to be here? Journal of Student Affairs Research and Practice, 48(4), Craven, R. G., Marsh, H. W., & Debus, R. L. (1991). Effects of internally focused feedback and attributional feedback on enhancement of academic self-concept. Journal of Educational Psychology, 83(1), doi: / Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. David, H. (2000). Big Science und der Mythos von der Ehrlichkeit und Ehrenhaftigkeit der Wissenschaftler: das Beispiel Biomedizin. Hamburg: Akademos Wissenschaftsverlag. Deutsche Presse-Agentur. (2014, April 12). Was Lästern und Hochstapeln gemeinsam haben. Welt Online. Abgerufen von Laestern-und-Hochstapeln-gemeinsam-haben.html Drago, R., & Turnbull, G. K. (1991). Competition and cooperation in the workplace. Journal of Economic Behavior & Organization, 15(3), doi: / (91)90051-x Ducharme, L. J., & Martin, J. K. (2000). Unrewarding work, coworker support, and job satisfaction a test of the buffering hypothesis. Work and Occupations, 27(2), doi: / Dudău, D. P. (2014). The relation between perfectionism and impostor phenomenon. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 127, doi: /j.sbspro
108 Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. American Psychologist, 41(10), doi: / x Eagly, A., & Karau, S. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. Psychological Review, 109(3), doi: / x Feather, N. T., & Simon, J. G. (1973). Fear of success and causal attribution for outcome. Journal of Personality, 41(4), Feick, D. L., & Rhodewalt, F. (1997). The double-edged sword of self-handicapping: Discounting, augmentation, and the protection and enhancement of self-esteem. Motivation and Emotion, 21(2), doi: /a: Ferrari, J. R. (2005). Impostor tendencies and academic dishonesty: Do they cheat their way to success? Social Behavior and Personality: an international journal, 33(1), doi: /sbp Ferrari, J. R., & Thompson, T. (2006). Impostor fears: Links with self-presentational concerns and self-handicapping behaviours. Personality and Individual Differences, 40(2), doi: /j.paid Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics. CA, Thousand Oaks: SAGE Publications. Flett, G. L., Stainton, M., Hewitt, P. L., Sherry, S. B., & Lay, C. (2012). Procrastination automatic thoughts as a personality construct: An analysis of the procrastinatory cognitions inventory. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 30(4), doi: /s z Fräßdorf, A., Kaulisch, M., & Hornbostel, S. (2012). Armut und Ausbeutung? Die Finanzierungs- und Beschäftigungssituation von Promovierenden. Lehre & Forschung,
109 French, B. F., Ullrich-French, S. C., & Follman, D. (2008). The psychometric properties of the Clance Impostor Scale. Personality and Individual Differences, 44(5), doi: /j.paid Fried-Buchalter, S. (1997). Fear of success, fear of failure, and the imposter phenomenon among male and female marketing managers. Sex Roles, 37(11-12), doi: /bf Frone, M. R. (2000). Work-family conflict and employee psychiatric disorders: The national comorbidity survey. Journal of Applied Psychology, 85(6), Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14(5), doi: /bf Furman, B., & Ahola, T. (2010). Es ist nie zu spät, erfolgreich zu sein: Ein lösungsfokussiertes Programm für Coaching von Organisationen, Teams und Einzelpersonen. (N. Offermanns, Übers.). Heidelberg: Carl Auer Verlag. Gibson-Beverly, G., & Schwartz, J. P. (2008). Attachment, entitlement, and the impostor phenomenon in female graduate students. Journal of College Counseling, 11(2), Gillespie, N. A., Walsh, M., Winefield, A. H., Dua, J., & Stough, C. (2001). Occupational stress in universities: Staff perceptions of the causes, consequences and moderators of stress. Work & Stress, 15(1), doi: / Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10(1), doi: /amr Gschwandtner, U., Buchinger, B., & Gödl, D. (2002). Berufskarrieren von Frauen und Männern an Österreichs Universitäten. Wien: Kommissionsverlag. 101
110 Harter, S. (1993). Causes and consequences of low self-esteem in children and adolescents. In R. F. Baumeister (Hrsg.), Self-Esteem (S ). NY, New York: Springer. Harvey, J. C. (1981). The impostor phenomenon and achievement: A failure to internalize success (Unveröffentlichte Dissertation). Temple University, Philadelphia, PA. Harvey, J. C., & Katz, C. (1985). If I m so successful, why do I feel like a fake? The impostor phenomenon. New York, NY: St. Martin s Press. Hauss, K., Kaulisch, M., Zinnbauer, M., Tesch, J., Fräßdorf, A., Hinze, S., & Hornbostel, S. (2012). Promovierende im Profil: Wege, Strukturen und Rahmenbedingungen von Promotionen in Deutschland. Ergebnisse aus dem ProFile-Promovierendenpanel. ifq- Working Paper. Abgerufen von df Heckhausen, H. (1967). The anatomy of achievement motivation. New York, NY: Academic Press. Hendel, D. D., & Horn, A. S. (2008). The relationship between academic life conditions and perceived sources of faculty stress over time. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 17(1/2), doi: / Henning, K., Ey, S., & Shaw, D. (1998). Perfectionism, the impostor phenomenon and psychological adjustment in medical, dental, nursing and pharmacy students. Medical Education, 32(5), doi: /j x Holmes, S. W., Kertay, L., Adamson, L. B., Holland, C. L., & Clance, P. R. (1993). Measuring the impostor phenomenon: a comparison of Clance s IP Scale and Harvey s IP Scale. Journal of Personality Assessment, 60(1), doi: /s jpa6001_3 102
111 Hooper, L., Wright, V., & Burnham, J. (2012). Acculturating to the role of tenure-track assistant professor: A family systems approach to joining the academy. Contemporary Family Therapy: An International Journal, 34(1), doi: /s Horner, M. S. (1972). Toward an understanding of achievement related conflicts in women. Journal of Social Issues, 28(2), doi: /j tb00023.x Hussy, P. D. W., Schreier, P. D. M., & Echterhoff, P. D. G. (2010). Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor. Heidelberg: Springer. Jauhiainen, A., Jauhiainen, A., & Laiho, A. (2009). The dilemmas of the efficiency university policy and the everyday life of university teachers. Teaching in Higher Education, 14(4), doi: / Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research, 1(2), doi: / Jöstl, G., Bergsmann, E., Lüftenegger, M., Schober, B., & Spiel, C. (2012). When will they blow my cover? The impostor phenomenon among Austrian doctoral students. Zeitschrift für Psychologie, 220(2), doi: / /a Jungbauer-Gans, M., & Gross, C. (2013). Determinants of success in university careers: Findings from the German academic labor market. Zeitschrift Für Soziologie, 42(1), Kaiser, S. (2005). Das Impostor Phänomen: Wenn Lorbeeren sauer schmecken (Unveröffentlichte Diplomarbeit). Universität Wien, Wien. 103
112 Kamarzarrin, H., Khaledian, M., Shooshtari, M., Yousefi, E., & Ahrami, R. (2013). A study of the relationship between self-esteem and the imposter phenomenon in the physicians of Rasht city. European Journal of Experimental Biology, 3(2), King, J. E., & Cooley, E. L. (1995). Achievement orientation and the impostor phenomenon among college students. Contemporary Educational Psychology, 20(3), doi: /ceps Kistner, A. (2014, November 7). Hochstapler-Syndrom Die müssen doch merken, dass ich nichts kann. Spiegel Online. Abgerufen von Klinkhammer, M. (2013). Charakteristika und Belastungen des Arbeitsplatzes Hochschule. Organisationsberatung, Supervision, Coaching, 20(3), doi: /s x Klinkhammer, M., & Saul-Soprun, G. (2009). Das Hochstaplersyndrom in der Wissenschaft. Organisationsberatung, Supervision, Coaching, 16(2), doi: /s König, J. (2007). Kontextuelle Bedingungen von Zusammenhalt und Konkurrenz bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 10(4), doi: /s Kumar, S., & Jagacinski, C. M. (2006). Imposters have goals too: The imposter phenomenon and its relationship to achievement goal theory. Personality and Individual Differences, 40(1), doi: /j.paid Lamnek, S. (2005). Qualitative Sozialforschung. Weinheim: Beltz. 104
113 Leary, M. R., Patton, K. M., Orlando, A. E., & Wagoner Funk, W. (2000). The impostor phenomenon: Self-perceptions, reflected appraisals, and interpersonal strategies. Journal of Personality, 68(4), doi: / Love, K. M., Tatman, A. W., & Chapman, B. P. (2010). Role stress, interrole conflict, and job satisfaction among university employees: The creation and test of a model. Journal of Employment Counseling, 47(1), doi: /j tb00088.x Macha, H. (1992). Wissenschaftlerinnen in der Bundesrepublik. In B. Geiling-Maul, H. Macha, H. Schrutka-Rechtenstamm, & A. Vechtel (Hrsg.), Frauenalltag. Weibliche Lebenskultur in beiden Teilen Deutschlands (S ). Köln: Bund Verlag. Marsh, H. W. (1990). Causal ordering of academic self-concept and academic achievement: A multiwave, longitudinal panel analysis. Journal of Educational Psychology, 82(4), doi: / Marsh, H. W., & O Mara, A. (2008). Reciprocal effects between academic self-concept, selfesteem, achievement, and attainment over seven adolescent years: Unidimensional and multidimensional perspectives of self-concept. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(4), doi: / Mattie, C., Gietzen, J., Davis, S., & Prata, J. (2008). The Imposter Phenomenon: Self- Assessment And Competency to Perform as a Physician Assistant in the United States. Journal of Physician Assistant Education, 19(1), Mayring, P. (2010a). Qualitative Inhaltsanalyse. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), Handbuch qualitative Forschung in der Psychologie (S ). Wiesbaden: Springer. Mayring, P. (2010b). Qualitative Inhaltsanalyse. Wiesbaden: Springer. 105
114 McCormick, C. B., & Barnes, B. J. (2008). Getting started in Academia: A guide for educational psychologists. Educational Psychology Review, 20(1), doi: /s z McGregor, L. N., Gee, D. E., & Posey, K. E. (2008). I feel like a fraud and it depresses me: The relation between the imposter phenomenon and depression. Social Behavior and Personality: an international journal, 36(1), doi: /sbp Mey, G., & Mruck, K. (2010). Interviews. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), Handbuch qualitative Forschung in der Psychologie (S ). Wiesbaden: Springer. Miller, D. G., & Kastberg, S. M. (1995). Of blue collars and ivory towers: Women from bluecollar backgrounds in higher education. Roeper Review, 18(1), Morse, J. M. (1990). Approaches to qualitative-quantitative methodological triangulation. Nursing Research, 40(2), Netemeyer, R. G., Boles, J. S., & McMurrian, R. (1996). Development and validation of work family conflict and family work conflict scales. Journal of Applied Psychology, 81(4), doi: / Nir, A. E., & Zilberstein Levy, R. (2006). Planning for academic excellence: Tenure and professional considerations. Studies in Higher Education, 31(5), doi: / Oakes, P. J., Turner, J. C., & Haslam, S. A. (1991). Perceiving people as group members: The role of fit in the salience of social categorizations. British Journal of Social Psychology, 30(2), doi: /j tb00930.x Orth, U., Robins, R. W., & Roberts, B. W. (2008). Low self-esteem prospectively predicts depression in adolescence and young adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 95(3), doi: /
115 Parkman, A., & Beard, R. (2008). Succession planning and the imposter phenomenon in higher education. CUPA-HR Journal, 59(2), Penland, M., & McCammon, S. (1984). The impostor phenomenon: Feelings of intellectual phoniness in higher achievers. Gehalten auf der The second teaching/learning about women conference, Roanoke College, VA. Prata, J., & Gietzen, J. W. (2007). The imposter phenomenon in physician assistant graduates. The Journal of Physician Assistant Education, 18 (4), Prince, T. J. (1989). The imposor phenomenon rivisited: A validity study of Clance s IP Scale (Unveröffentlichte Masterarbeit). Georgia State University, GA, Atlanta. Reinert, L. M. (1991). Influences of family and work on women managers exhibiting the impostor phenomenon (Unveröffentlichte Dissertation). Temple University, PA, Philadelphia. Robinson, B. E. (2014). Chained to the desk: A guidebook for workaholics, their partners and children, and the clinicians who treat them. NY, New York: New York University Press. Ross, S.., & Krukowski, R.. (2003). The imposter phenomenon and maladaptive personality: type and trait characteristics. Personality and Individual Differences, 34(3), doi: /s (02) Ross, S. R., Stewart, J., Mugge, M., & Fultz, B. (2001). The imposter phenomenon, achievement dispositions, and the five factor model. Personality and Individual Differences, 31(8), doi: /s (00) Sakulku, J., & Alexander, J. (2011). The Impostor Phenomenon. International Journal of Behavioral Science, 6(1). 107
116 Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., van der Heijden, F. M. M. A., & Prins, J. T. (2009). Workaholism, burnout and well-being among junior doctors: The mediating role of role conflict. Work & Stress, 23(2), doi: / Schmidt, B. (2008). Ich war vor allem auf mich alleine gestellt. Die Einstiegsphase junger Nachwuchswissenschaftler/innen in den Arbeitsplatz Hochschule. Zeitschrift für Pädagogik, 54(5), Schmidt, B., & Richter, A. (2008). Unterstützender Mentor oder abwesender Aufgabenverteiler? Eine qualitative Interviewstudie zum Führungshandeln von Professorinnen und Professoren aus der Sicht von Promovierenden. Beiträge zur Hochschulforschung, 4(30), Schmieder, R. A., & Smith, C. S. (1996). Moderating effects of social support in shiftworking and non-shiftworking nurses. Work & Stress, 10(2), doi: / Schober, B. (2013). Erziehung und Bildung für Wissenschaft aus bildungspsychologischer Perspektive. In M. Haller (Hrsg.), Wissenschaft als Beruf. Bestandsaufnahme - Diagnosen - Empfehlungen (S ). Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. Schulz, J. (2013). The impact of role conflict, role ambiguity and organizational climate on the job satisfaction of academic staff in research-intensive universities in the UK. Higher Education Research & Development, 32(3), doi: / Senat der Universität Wien. (2012). Curriculum für das Doktoratsstudium der Philosophie in Geistes- und Kulturwissenschaften. Abgerufen von 108
117 R_GeistesKulturwissenschaftenPhilosophieBildungswissenschaft_01.pdf September, A. N., McCarrey, M., Baranowsky, A., Parent, C., & Schindler, D. (2001). The relation between well-being, impostor feelings, and gender role orientation among Canadian university students. The Journal of Social Psychology, 141(2), doi: / Sightler, K. W., & Wilson, M. G. (2001). Correlates of the impostor phenomenon among undergraduate entrepreneurs. Psychological Reports, 88(3), doi: /pr Sonnak, C., & Towell, T. (2001). The impostor phenomenon in British university students: Relationships between self-esteem, mental health, parental rearing style and socioeconomic status. Personality and Individual Differences, 31(6), doi: /s (00) Sowislo, J. F., & Orth, U. (2013). Does low self-esteem predict depression and anxiety? A meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 139(1), doi: /a Spiel, C., Reimann, R., Wagner, P., & Schober, B. (2008). Guest editorial: Bildung-Psychology: The substance and structure of an emerging discipline. Applied Developmental Science, 12(3), doi: / Stahl, J. M., Turner, H. M., Wheeler, A. E., & Elbert, P. B. (1980). The imposter phenomenon in high school and college science majors. Gehalten auf der Meeting of the American Psychological Association, Montreal. 109
118 Statistik Austria. (2011). Registerzählung 2011: Gemeindetabelle Österreich. Abgerufen von terreich_ pdf Statistik Austria. (2014). Studien an öffentlichen Universitäten. Abgerufen 26. März 2015, von Steigleder, S. (2008). Die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse im Praxistest. Marburg: Tectum-Verlag. Stoeber, J., & Damian, L. E. (in press). Perfectionism in employees: Work engagement, workaholism, and burnout. In F. M. Sirois & D. S. Molnar (Hrsg.), Perfectionism, health, and well-being. New York, NY: Springer. Studdard, E. S. S. (2002). Adult Women Students in the Academy: Impostors or Members? The Journal of Continuing Higher Education, 50(3), Surtees, P. G., Wainwright, N. W. J., & Pharoah, P. D. P. (2002). Psychosocial factors and sex differences in high academic attainment at Cambridge University. Oxford Review of Education, 28(1), doi: / Thompson, T., Davis, H., & Davidson, J. (1998). Attributional and affective responses of impostors to academic success and failure outcomes. Personality and Individual Differences, 25(2), doi: /s (98) Thompson, T., Foreman, P., & Martin, F. (2000). Impostor fears and perfectionistic concern over mistakes. Personality and Individual Differences, 29(4), doi: /s (99) Topping, M. (1983). The impostor phenomenon: A study of its construct and incidence in university faculty members (Unveröffentlichte Dissertation). University of South Florida, FL, Tampa. 110
119 Topping, M., & Kimmel, E. (1985). The imposter phenomenon: Feeling phony. Academic Psychology Bulletin, 7(2), Universität Wien. (2014). Leistungsbericht & Wissensbilanz 2013 der Universität Wien. Abgerufen von cht2013.pdf Volk, H. (2014, November 11). Hilfe gegen Versagensangst im Job. der Standard. Abgerufen von Want, J., & Kleitman, S. (2006). Imposter phenomenon and self-handicapping: Links with parenting styles and self-confidence. Personality and Individual Differences, 40(5), doi: /j.paid Whitman, M. V., & Shanine, K. K. (2012). Revisiting the impostor phenomenon: How individuals cope with feelings of being in over their heads. Research in Occupational Stress and Well-being, 10, doi: /s (2012) Wilkesmann, U., & Schmid, C. J. (2011). Teaching does (not) pay? Results of a nationwide survey on the effects of performance-oriented steering on academic teaching in Germany. Soziale Welt, 62(3), Winter, M. (2012). Wettbewerb im Hochschulwesen. Die Hochschule, 21(2), Wirth, H., & Dümmler, K. (2004). Zunehmende Tendenz zu späteren Geburten und Kinderlosigkeit bei Akademikerinnen : eine Kohortenanalyse auf der Basis von Mikrozensusdaten. Informationsdienst Soziale Indikatoren, (32), 1 6. Witzel, A. (2000). Das problemzentrierte Interview. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 1(1),
120 Yun, J. H., & Scorcinelli, M. D. (2009). When mentoring is the medium: Lessons learned from a faculty development initiative. In L. B. Nilson & J. E. Miller (Hrsg.), To improve the academy: Resources for faculty, instuctional, and organizational development (S ). San Francisco, CA: Jossey-Bass. Zall, A. A. (2014). Zum/r ImpostorIn erzogen (Unveröffentlichte Diplomarbeit). Universität Wien, Wien. Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25(1), doi: /ceps Zorn, D. (2005). Academic culture feeds the imposter phenomenon. Academic Leader: The Newsletter for Academic Deans and Department Chairs, 21(8),
121 Tabellenverzeichnis Tabelle 1 Faktorladungen der Skalen zu Aspekten des Arbeitsumfeldes Hochschule Tabelle 2 Statistische Kennwerte der im Onlinefragebogen verwendeten Skalen Tabelle 3 Übersicht der Intercoderreliabilitäten der Kategoriensysteme Tabelle 4 Übersicht des Kategoriensystems "Schwierigkeiten im Arbeitsalltag" Tabelle 5 Übersicht des Kategoriensystems "Soziale Unterstützung Tabelle 6 Übersicht des Kategoriensystems "Feedback" Tabelle 7 Übersicht des Kategoriensystems "Unterschiede zur Mehrheit der KollegInnen".. 59 Tabelle 8 Übersicht des Kategoriensystems "Charakteristika des IP zu Doktoratsbeginn" Tabelle 9 Übersicht des Kategoriensystems "Zukünftige berufliche Perspektive" Tabelle 10 Mittelwerte und Standardabweichungen nach Beschäftigungsstatus und Geschlecht Tabelle 11 Statistische Kennwerte der multiplen Regressionsanalyse Tabelle 12 Kategoriensystem "Schwierigkeiten im Arbeitsalltag" mit absoluten und relativen Besetzungshäufigkeiten Tabelle 13 Kategoriensystem "Soziale Unterstützung" mit absoluten und relativen Besetzungshäufigkeiten Tabelle 14 Kategoriensystem "Feedback" mit absoluten und relativen Besetzungshäufigkeiten Tabelle 15 Kategoriensystem "Unterschiede zur Mehrheit der KollegInnen" mit absoluten und relativen Besetzungshäufigkeiten Tabelle 16 Kategoriensystem "Charakteristika des IP zu Doktoratsbeginn" mit absoluten und relativen Besetzungshäufigkeiten Tabelle 17 Kategoriensystem "Zukünftige berufliche Perspektive" mit absoluten und relativen Besetzungshäufigkeiten Abbildungsverzeichnis Abbildung 1. Aufgaben von WissenschaftlerInnen im Überblick (Schober, 2013, S. 46) Abbildung 2. Chronologischer Untersuchungsablauf Abbildung 3. Operationalisierung der Erhebung der sozialen Unterstützung am Arbeitsplatz Abbildung 4. Inhaltsanalytisches Ablaufmodell dieser Untersuchung Abbildung 5. Verteilung der Gesamtstichprobe auf die Kategorien des Impostor Phänomens
122 Anhang Anhang 1 Einladungsschreiben zur Studie 115 Anhang 2 Online Fragebogen der vorliegenden Studie Anhang 3 Items der Clance Impostor Scale und der Skalen zu Aspekten des Arbeitsumfeldes Hochschule sowie deren statistische Kennwerte 125 Anhang 4 Interviewleitfaden. 129 Anhang 5 Kodierleitfaden 138 Anhang 6 Lebenslauf
123 Anhang 1: Einladungsschreiben zur Studie 115
124 Anhang 2: Online Fragebogen der vorliegenden Studie 116
125 117
126 118
127 119
128 120
129 121
130 122
131 123
132 124
3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung
 Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
- Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit bei arbeitslosen AkademikerInnen -
 - Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit bei arbeitslosen AkademikerInnen - Eine Evaluierungsstudie zum Einfluss der Trainingsmaßnahme Job-Coaching auf personale Variablen von arbeitssuchenden AkademikerInnen
- Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit bei arbeitslosen AkademikerInnen - Eine Evaluierungsstudie zum Einfluss der Trainingsmaßnahme Job-Coaching auf personale Variablen von arbeitssuchenden AkademikerInnen
Kausalattribution und Leistungsmotivation
 Professur für Allgemeine Psychologie Vorlesung im WS 2011/12 Motivation, Emotion, Volition Kausalattribution und Leistungsmotivation Prof. Dr. Thomas Goschke 1 Überblick und Lernziele Kognitive Ansätze
Professur für Allgemeine Psychologie Vorlesung im WS 2011/12 Motivation, Emotion, Volition Kausalattribution und Leistungsmotivation Prof. Dr. Thomas Goschke 1 Überblick und Lernziele Kognitive Ansätze
Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld
 Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Impressum:
 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
Laura Gunkel. Akzeptanz und Wirkung. von Feedback in. Potenzialanalysen. Eine Untersuchung zur Auswahl. von Führungsnachwuchs.
 Laura Gunkel Akzeptanz und Wirkung von Feedback in Potenzialanalysen Eine Untersuchung zur Auswahl von Führungsnachwuchs 4^ Springer VS Inhalt Danksagung 5 Inhalt 7 Tabellenverzeichnis 11 Abbildungsverzeichnis
Laura Gunkel Akzeptanz und Wirkung von Feedback in Potenzialanalysen Eine Untersuchung zur Auswahl von Führungsnachwuchs 4^ Springer VS Inhalt Danksagung 5 Inhalt 7 Tabellenverzeichnis 11 Abbildungsverzeichnis
Inhalt. Abkürzungsverzeichnis 11 Tabellen-und Abbildungsverzeichnis 13
 Inhalt Abkürzungsverzeichnis 11 Tabellen-und Abbildungsverzeichnis 13 1. Einleitung 15 1.1 Hauptschüler und ihre Vorstellungen von Arbeit und Arbeitslosigkeit I 18 1.2 Leitende Thesen der Untersuchung
Inhalt Abkürzungsverzeichnis 11 Tabellen-und Abbildungsverzeichnis 13 1. Einleitung 15 1.1 Hauptschüler und ihre Vorstellungen von Arbeit und Arbeitslosigkeit I 18 1.2 Leitende Thesen der Untersuchung
Akzeptanz und Barrieren der elektronischen Rechnung
 Harald Eike Schömburg Akzeptanz und Barrieren der elektronischen Rechnung Empirische Erkenntnisse, Technologieakzeptanzmodelle und praxisorientierte Handlungsempfehlungen Verlag Dr. Kovac Hamburg 2011
Harald Eike Schömburg Akzeptanz und Barrieren der elektronischen Rechnung Empirische Erkenntnisse, Technologieakzeptanzmodelle und praxisorientierte Handlungsempfehlungen Verlag Dr. Kovac Hamburg 2011
Methodologie Juvenir-Studie 4.0 Zuviel Stress zuviel Druck! Wie Schweizer Jugendliche mit Stress und Leistungsdruck umgehen.
 Juvenir-Studie 4.0 Zuviel Stress zuviel Druck! Wie Schweizer Jugendliche mit Stress und Leistungsdruck umgehen. Methodologie 2 1 Juvenir 1.0 4.0 3 Stress pur bei Schweizer Jugendlichen Häufigkeit von Stress
Juvenir-Studie 4.0 Zuviel Stress zuviel Druck! Wie Schweizer Jugendliche mit Stress und Leistungsdruck umgehen. Methodologie 2 1 Juvenir 1.0 4.0 3 Stress pur bei Schweizer Jugendlichen Häufigkeit von Stress
Zuviel Stress zuviel Druck! Einblicke in die Juvenir-Studie 4.0. Sören Mohr Freiburg,
 Zuviel Stress zuviel Druck! Einblicke in die Juvenir-Studie 4.0 Sören Mohr Freiburg, 23.09.2016 Das Thema Leistungsdruck in den Medien 2 Stichprobenstruktur 3 Methodik Befragungsdesign, Stichprobe, Gewichtung
Zuviel Stress zuviel Druck! Einblicke in die Juvenir-Studie 4.0 Sören Mohr Freiburg, 23.09.2016 Das Thema Leistungsdruck in den Medien 2 Stichprobenstruktur 3 Methodik Befragungsdesign, Stichprobe, Gewichtung
Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin
 Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin Vertrauensvolle Verständigung herstellen: Ein Modell interdisziplinärer Projektarbeit Dissertation zur Erlangung des akademischen
Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin Vertrauensvolle Verständigung herstellen: Ein Modell interdisziplinärer Projektarbeit Dissertation zur Erlangung des akademischen
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE & SOZIALISATION. Mädchenschachpatent 2015 in Nußloch Referentin: Melanie Ohme
 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE & SOZIALISATION 1 Mädchenschachpatent 2015 in Nußloch Referentin: Melanie Ohme ÜBERSICHT Entwicklungspsychologie Einführung Faktoren der Entwicklung Geschlechterunterschiede Diskussionen
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE & SOZIALISATION 1 Mädchenschachpatent 2015 in Nußloch Referentin: Melanie Ohme ÜBERSICHT Entwicklungspsychologie Einführung Faktoren der Entwicklung Geschlechterunterschiede Diskussionen
Diplomarbeit. Titel der Arbeit. zum Umgang mit wirtschaftlichen Krisen. Verfasserin. Alexandra Förster-Streffleur. Angestrebter akademischer Grad
 Diplomarbeit Titel der Arbeit Akzeptanzanalyse eines Lehrgangs für Führungskräfte zum Umgang mit wirtschaftlichen Krisen Verfasserin Alexandra Förster-Streffleur Angestrebter akademischer Grad Magistra
Diplomarbeit Titel der Arbeit Akzeptanzanalyse eines Lehrgangs für Führungskräfte zum Umgang mit wirtschaftlichen Krisen Verfasserin Alexandra Förster-Streffleur Angestrebter akademischer Grad Magistra
Committed to Burnout?
 Wirtschaft Stefan Reischl Committed to Burnout? Eine Untersuchung über den Zusammenhang von Organizational Commitment und Burnout Diplomarbeit Committed to Burnout? Eine Untersuchung über den Zusammenhang
Wirtschaft Stefan Reischl Committed to Burnout? Eine Untersuchung über den Zusammenhang von Organizational Commitment und Burnout Diplomarbeit Committed to Burnout? Eine Untersuchung über den Zusammenhang
Arbeiten trotz Krankheit
 Arbeiten trotz Krankheit Wie verbreitet ist Präsentismus in Deutschland? Wer krank zur Arbeit geht, nimmt eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes in Kauf, hat ein größeres Fehler- und Unfallrisiko
Arbeiten trotz Krankheit Wie verbreitet ist Präsentismus in Deutschland? Wer krank zur Arbeit geht, nimmt eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes in Kauf, hat ein größeres Fehler- und Unfallrisiko
Themen für Bachelor-Arbeiten (Betreuung S. Tittlbach) Motorische und psychosoziale Entwicklung von Nachwuchs-Fußballspielern
 INSTITUT FÜR SPORTWISSENSCHAFT Lehrstuhl Sportwissenschaft III Sozial- und Gesundheitswissenschaften des Sports Prof. Dr. Susanne Tittlbach Telefon Sekretariat: 0921/ 55-3461 Email: susanne.tittlbach@uni-bayreuth.de
INSTITUT FÜR SPORTWISSENSCHAFT Lehrstuhl Sportwissenschaft III Sozial- und Gesundheitswissenschaften des Sports Prof. Dr. Susanne Tittlbach Telefon Sekretariat: 0921/ 55-3461 Email: susanne.tittlbach@uni-bayreuth.de
Motivation. Intensität und Ausdauer, mit der bestimmte Zustände angestrebt oder gemieden werden.
 Motivation Intensität und Ausdauer, mit der bestimmte Zustände angestrebt oder gemieden werden. Beeinflusst durch: Interne Variablen: Bedürfnisse / Motive des Handelnden: - Physiologisch (Hunger, Durst,
Motivation Intensität und Ausdauer, mit der bestimmte Zustände angestrebt oder gemieden werden. Beeinflusst durch: Interne Variablen: Bedürfnisse / Motive des Handelnden: - Physiologisch (Hunger, Durst,
Inhalt 1. Einleitung: Kontrollverlust durch Social Media? Unternehmenskommunikation als wirtschaftliches Handeln 21
 Inhalt Vorwort 11 1. Einleitung: Kontrollverlust durch Social Media? 15 1.1 Forschungsinteresse: Social Media und Anpassungen des Kommunikationsmanagements 16 1.2 Vorgehensweise der Untersuchung 18 2.
Inhalt Vorwort 11 1. Einleitung: Kontrollverlust durch Social Media? 15 1.1 Forschungsinteresse: Social Media und Anpassungen des Kommunikationsmanagements 16 1.2 Vorgehensweise der Untersuchung 18 2.
The promotion of perceived physical ability via an intervention using internal teacher frame of reference in
 The promotion of perceived physical ability via an intervention using internal teacher frame of reference in physical education Esther Oswald Institut für Sportwissenschaft, Universität Bern SGS-Tagung,
The promotion of perceived physical ability via an intervention using internal teacher frame of reference in physical education Esther Oswald Institut für Sportwissenschaft, Universität Bern SGS-Tagung,
Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
 Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Fachtagung 17.09.2008, Luzern Alles too much! Stress, Psychische Gesundheit, Früherkennung und Frühintervention in Schulen Barbara Fäh, Hochschule für
Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Fachtagung 17.09.2008, Luzern Alles too much! Stress, Psychische Gesundheit, Früherkennung und Frühintervention in Schulen Barbara Fäh, Hochschule für
Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen
 Zeno Kupper Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen PABST SCIENCE PUBLISHERS Lengerich, Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Riga, Scottsdale (USA), Wien, Zagreb Inhaltsverzeichnis Einleitung und
Zeno Kupper Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen PABST SCIENCE PUBLISHERS Lengerich, Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Riga, Scottsdale (USA), Wien, Zagreb Inhaltsverzeichnis Einleitung und
Psychosoziale Risiken und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit Herausforderungen für die Mediziner 14. SIZ-Care Forum
 Psychosoziale Risiken und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit Herausforderungen für die Mediziner 14. SIZ-Care Forum Dr. med. Andreas Canziani FMH Psychiatrie und Psychotherapie Themen Was sind
Psychosoziale Risiken und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit Herausforderungen für die Mediziner 14. SIZ-Care Forum Dr. med. Andreas Canziani FMH Psychiatrie und Psychotherapie Themen Was sind
Continental Karriere-Umfrage 2016 Digitalisierung der Arbeitswelt
 Continental Karriere-Umfrage 2016 Digitalisierung der Arbeitswelt Die Umfrage Schwerpunkt der 13. Ausgabe der Continental Karriere-Umfrage ist Digitalisierung. Das Institut für angewandte Sozialwissenschaft
Continental Karriere-Umfrage 2016 Digitalisierung der Arbeitswelt Die Umfrage Schwerpunkt der 13. Ausgabe der Continental Karriere-Umfrage ist Digitalisierung. Das Institut für angewandte Sozialwissenschaft
Vermutet haben wir es schon lange, nun gibt es die offizielle Bestätigung:
 Salzburger Polizistinnen und Polizisten sind stark Burnout gefährdet! Das belegte eine von uns ( PV und Polizeigewerkschaft ) beim Marktforschungsinstitut Karmasin in Auftrag gegebene landesweite Bournout-Studie.
Salzburger Polizistinnen und Polizisten sind stark Burnout gefährdet! Das belegte eine von uns ( PV und Polizeigewerkschaft ) beim Marktforschungsinstitut Karmasin in Auftrag gegebene landesweite Bournout-Studie.
Mobbing/Bullying am Arbeitsplatz
 Klaus Niedl Mobbing/Bullying am Arbeitsplatz Eine empirische Analyse zum Phänomen sowie zu personalwirtschaftlich relevanten Effekten von systematischen Feindseligkeiten Rainer Hampp Verlag München und
Klaus Niedl Mobbing/Bullying am Arbeitsplatz Eine empirische Analyse zum Phänomen sowie zu personalwirtschaftlich relevanten Effekten von systematischen Feindseligkeiten Rainer Hampp Verlag München und
Value of Failure! Students Course! Modul 2: Was ist Scheitern?!
 Value of Failure Students Course Modul 2: Was ist Scheitern? Modul 2: Was ist Scheitern? Inhalt 1. Definitionen des Scheiterns 2. Gegenteil von Erfolg? 3. Produktives Scheitern Modul 2: Was ist Scheitern?
Value of Failure Students Course Modul 2: Was ist Scheitern? Modul 2: Was ist Scheitern? Inhalt 1. Definitionen des Scheiterns 2. Gegenteil von Erfolg? 3. Produktives Scheitern Modul 2: Was ist Scheitern?
Bedingungen und Folgen des Arbeitsengagements in einem Unternehmen der Automobilbranche
 Mareen Sturm Arbeitgeberattraktivität und Unternehmenserfolg Bedingungen und Folgen des Arbeitsengagements in einem Unternehmen der Automobilbranche Logos Verlag Berlin Arbeitgeberattraktivität und Unternehmenserfolg
Mareen Sturm Arbeitgeberattraktivität und Unternehmenserfolg Bedingungen und Folgen des Arbeitsengagements in einem Unternehmen der Automobilbranche Logos Verlag Berlin Arbeitgeberattraktivität und Unternehmenserfolg
Ein handlungspsychologisches Modell der beruflichen Entwicklung. Seminar: Erwerbsbiographien der Zukunft Referentin: Sarah Quappen 9.11.
 Ein handlungspsychologisches Modell der beruflichen Entwicklung Seminar: Erwerbsbiographien der Zukunft Referentin: Sarah Quappen 9.11.2007 Gliederung 1. Darstellung des ersten Teilmodells (Rahmenmodell
Ein handlungspsychologisches Modell der beruflichen Entwicklung Seminar: Erwerbsbiographien der Zukunft Referentin: Sarah Quappen 9.11.2007 Gliederung 1. Darstellung des ersten Teilmodells (Rahmenmodell
Berufliche Umbrüche als Chance Gesund bleiben und für Karriereerfolg nutzen
 Berufliche Umbrüche als Chance Gesund bleiben und für Karriereerfolg nutzen Karrierestufe/Gehalt Berufliche Umbrüche als Chance Gesund bleiben und für Karriereerfolg nutzen UMBRÜCHE UND WECHSEL IN KARRIEREN
Berufliche Umbrüche als Chance Gesund bleiben und für Karriereerfolg nutzen Karrierestufe/Gehalt Berufliche Umbrüche als Chance Gesund bleiben und für Karriereerfolg nutzen UMBRÜCHE UND WECHSEL IN KARRIEREN
Prävention von Mobbing in Krankenhäusern Ergebnisse einer Feldstudie
 Prävention von Mobbing in Krankenhäusern Ergebnisse einer Feldstudie Visselhövede 06.07.2007 Dipl.-Psych. Susanne Roscher Fachbereich Psychologie Arbeitsbereich Arbeits-, Betriebs- und Umweltpsychologie
Prävention von Mobbing in Krankenhäusern Ergebnisse einer Feldstudie Visselhövede 06.07.2007 Dipl.-Psych. Susanne Roscher Fachbereich Psychologie Arbeitsbereich Arbeits-, Betriebs- und Umweltpsychologie
Kinder machen Stress - aber schützen vor Burnout!
 Kinder machen Stress - aber schützen vor Burnout! Dr. Dagmar Siebecke, Technische Universität Dortmund Zahlreiche Studien belegen, dass der soziale Rückhalt in einer Partnerschaft eine wichtige die Gesundheit
Kinder machen Stress - aber schützen vor Burnout! Dr. Dagmar Siebecke, Technische Universität Dortmund Zahlreiche Studien belegen, dass der soziale Rückhalt in einer Partnerschaft eine wichtige die Gesundheit
Titel der Dissertation Interpersonale Beziehungsgestaltung und Depression: Eine kulturvergleichende Untersuchung in Chile und Deutschland
 Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Doktorgrades (Dr. phil.) im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhaltens- und Empirische Kulturwissenschaften der Ruprecht-Karls-U niversität Heidelberg
Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Doktorgrades (Dr. phil.) im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhaltens- und Empirische Kulturwissenschaften der Ruprecht-Karls-U niversität Heidelberg
Psychische Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz. Jan Klapproth
 Wirtschaft Jan Klapproth Psychische Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz Ursachen, Problematik und Lösungsmöglichkeiten aus personalwirtschaftlicher und organisationaler Sicht Bachelorarbeit Fachbereich
Wirtschaft Jan Klapproth Psychische Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz Ursachen, Problematik und Lösungsmöglichkeiten aus personalwirtschaftlicher und organisationaler Sicht Bachelorarbeit Fachbereich
Anreize und finanzielles Entscheidungsverhalten
 Institut für Banking und Finance Executive Summary Anreize und finanzielles Entscheidungsverhalten Direktor Prof. Dr. Thorsten Hens Betreuerin: Dr. Kremena Bachmann Verfasser: Oliver Merz Executive Summary
Institut für Banking und Finance Executive Summary Anreize und finanzielles Entscheidungsverhalten Direktor Prof. Dr. Thorsten Hens Betreuerin: Dr. Kremena Bachmann Verfasser: Oliver Merz Executive Summary
Modul Psychische Gesundheit (Bella-Studie)
 U. Ravens-Sieberer, N. Wille, S. Bettge, M. Erhart Modul Psychische Gesundheit (Bella-Studie) Korrespondenzadresse: Ulrike Ravens-Sieberer Robert Koch - Institut Seestraße 13353 Berlin bella-studie@rki.de
U. Ravens-Sieberer, N. Wille, S. Bettge, M. Erhart Modul Psychische Gesundheit (Bella-Studie) Korrespondenzadresse: Ulrike Ravens-Sieberer Robert Koch - Institut Seestraße 13353 Berlin bella-studie@rki.de
Evaluation Textbaustein
 Evaluation Textbaustein Seit 2002 arbeiten wellcome-teams in Schleswig-Holstein. wellcome wurde im ersten Halbjahr 2006 durch die Universität Kiel wissenschaftlich evaluiert. Untersucht wurde u.a. die
Evaluation Textbaustein Seit 2002 arbeiten wellcome-teams in Schleswig-Holstein. wellcome wurde im ersten Halbjahr 2006 durch die Universität Kiel wissenschaftlich evaluiert. Untersucht wurde u.a. die
Inhaltsverzeichnis. Bibliografische Informationen digitalisiert durch
 Inhaltsverzeichnis 1 Annäherung an ein Konstrukt 15 1.1 Lehrer-Engagement 15 1.2 Facetten des Disengagements 19 2.2.2 Typische Merkmale 19 1.2.2 Definitionen der Inneren Kündigung 22 1.3 Bisherige Erklärungen
Inhaltsverzeichnis 1 Annäherung an ein Konstrukt 15 1.1 Lehrer-Engagement 15 1.2 Facetten des Disengagements 19 2.2.2 Typische Merkmale 19 1.2.2 Definitionen der Inneren Kündigung 22 1.3 Bisherige Erklärungen
Geisteswissenschaft. Sandra Päplow. Werde der Du bist! Die Moderation der Entwicklungsregulation im Jugendalter durch personale Faktoren.
 Geisteswissenschaft Sandra Päplow Werde der Du bist! Die Moderation der Entwicklungsregulation im Jugendalter durch personale Faktoren Diplomarbeit Universität Bremen Fachbereich 11: Human-und Gesundheitswissenschaften
Geisteswissenschaft Sandra Päplow Werde der Du bist! Die Moderation der Entwicklungsregulation im Jugendalter durch personale Faktoren Diplomarbeit Universität Bremen Fachbereich 11: Human-und Gesundheitswissenschaften
Serdar Coskun. Auswirkungen monetärer Belohnungen auf die intrinsische Motivation von (ehrenamtlichen) Übungsleitern.
 Serdar Coskun Auswirkungen monetärer Belohnungen auf die intrinsische Motivation von (ehrenamtlichen) Übungsleitern Iii AVM press VIII Inhaltsverzeichnis DANKSAGUNG UND WIDMUNG ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Serdar Coskun Auswirkungen monetärer Belohnungen auf die intrinsische Motivation von (ehrenamtlichen) Übungsleitern Iii AVM press VIII Inhaltsverzeichnis DANKSAGUNG UND WIDMUNG ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Was ist ein Test? Grundlagen psychologisch- diagnostischer Verfahren. Rorschach-Test
 Was ist ein Test? Ein Test ist ein wissenschaftliches Routineverfahren zur Untersuchung eines oder mehrerer empirisch abgrenzbarer Persönlichkeitsmerkmale mit dem Ziel einer möglichst quantitativen Aussage
Was ist ein Test? Ein Test ist ein wissenschaftliches Routineverfahren zur Untersuchung eines oder mehrerer empirisch abgrenzbarer Persönlichkeitsmerkmale mit dem Ziel einer möglichst quantitativen Aussage
EHL GHU (UIROJVDWWULEXWLRQ YRQ
 1 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis...III Abbildungsverzeichnis... IX Tabellenverzeichnis...XVI 1 Einleitung...1 1.1 Aufbau und Gliederung der vorliegenden Arbeit...2 2 Führungskräfte...5 2.1 Fach-
1 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis...III Abbildungsverzeichnis... IX Tabellenverzeichnis...XVI 1 Einleitung...1 1.1 Aufbau und Gliederung der vorliegenden Arbeit...2 2 Führungskräfte...5 2.1 Fach-
procrastinare (lat.): auf morgen vertagen
 procrastinare (lat.): auf morgen vertagen Reflektiertes Aufschieben von schwerwiegenden Entscheidungen auf einen günstigeren Zeitpunkt, der einer Handlung mehr Erfolg sichert. Entscheidung zwischen verschiedenen
procrastinare (lat.): auf morgen vertagen Reflektiertes Aufschieben von schwerwiegenden Entscheidungen auf einen günstigeren Zeitpunkt, der einer Handlung mehr Erfolg sichert. Entscheidung zwischen verschiedenen
Anne-Kathrin Bühl & Judith Volmer
 Anne-Kathrin Bühl & Judith Volmer Relevanz 2 Positive Auswirkungen von Erholung auf: Positiven Affekt (Sonnentag, Binnewies,& Mojza, 2008), Arbeitsengagement, prosoziales Verhalten (Sonnentag, 2003), Verbesserte
Anne-Kathrin Bühl & Judith Volmer Relevanz 2 Positive Auswirkungen von Erholung auf: Positiven Affekt (Sonnentag, Binnewies,& Mojza, 2008), Arbeitsengagement, prosoziales Verhalten (Sonnentag, 2003), Verbesserte
Auswirkungen des Pendelns auf das subjektive Wohlbefinden
 Naturwissenschaft Franziska Schropp Auswirkungen des Pendelns auf das subjektive Wohlbefinden Das Pendler Paradoxon und andere Methoden im Vergleich Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen
Naturwissenschaft Franziska Schropp Auswirkungen des Pendelns auf das subjektive Wohlbefinden Das Pendler Paradoxon und andere Methoden im Vergleich Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen
Arbeit, Karriere oder Berufung?
 Arbeit, Karriere oder Berufung? Daniela Blickhan 2012 Meine Arbeit macht mir Freude und ich sehe, was ich dadurch bewirken kann. Diese Einstellung ist nicht nur persönlich positiv, sondern hält auch langfristig
Arbeit, Karriere oder Berufung? Daniela Blickhan 2012 Meine Arbeit macht mir Freude und ich sehe, was ich dadurch bewirken kann. Diese Einstellung ist nicht nur persönlich positiv, sondern hält auch langfristig
Lehrergesundheit und Unterrichtshandeln: Hat Burnout von Lehrkräften Folgen für die Leistung der Schülerinnen und Schüler?
 Lehrergesundheit und Unterrichtshandeln: Hat Burnout von Lehrkräften Folgen für die Leistung der Schülerinnen und Schüler? Prof. Dr. Uta Klusmann Leibniz Institute for Science and Mathematics Education,
Lehrergesundheit und Unterrichtshandeln: Hat Burnout von Lehrkräften Folgen für die Leistung der Schülerinnen und Schüler? Prof. Dr. Uta Klusmann Leibniz Institute for Science and Mathematics Education,
Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz
 Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freie Universität Berlin Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktorin der Philosophie
Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freie Universität Berlin Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktorin der Philosophie
Fhr ZINKL Thomas ABSTRACT -1-
 ABSTRACT -1- Inhaltsverzeichnis 1 Abstract...3 1.1 Handlungsleitendes Interesse...3 1.2 Hypothese...3 1.3 Forschungsleitende Fragen...3 1.4 Methodendiskussion...4 1.5 Ziel der empirischen Untersuchung...5
ABSTRACT -1- Inhaltsverzeichnis 1 Abstract...3 1.1 Handlungsleitendes Interesse...3 1.2 Hypothese...3 1.3 Forschungsleitende Fragen...3 1.4 Methodendiskussion...4 1.5 Ziel der empirischen Untersuchung...5
Tobias Stächele (Autor) Workload und Interaktionsarbeit als Prädiktoren emotionaler Erschöpfung von Klinikärzten
 Tobias Stächele (Autor) Workload und Interaktionsarbeit als Prädiktoren emotionaler Erschöpfung von Klinikärzten https://cuvillier.de/de/shop/publications/88 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette
Tobias Stächele (Autor) Workload und Interaktionsarbeit als Prädiktoren emotionaler Erschöpfung von Klinikärzten https://cuvillier.de/de/shop/publications/88 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette
14 Santé. Psychosoziale Belastungen am Arbeitsplatz: ein Gesundheitsrisiko COMMUNIQUÉ DE PRESSE MEDIENMITTEILUNG COMUNICATO STAMPA
 Office fédéral de la statistique Bundesamt für Statistik Ufficio federale di statistica Uffizi federal da statistica Swiss Federal Statistical Office COMMUNIQUÉ DE PRESSE MEDIENMITTEILUNG COMUNICATO STAMPA
Office fédéral de la statistique Bundesamt für Statistik Ufficio federale di statistica Uffizi federal da statistica Swiss Federal Statistical Office COMMUNIQUÉ DE PRESSE MEDIENMITTEILUNG COMUNICATO STAMPA
Von der Fakultät für Lebenswissenschaften. der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina. zu Braunschweig. zur Erlangung des Grades
 Eine Darstellung von Problemen der Flow-Forschung und möglichen Lösungsansätzen anhand einer Re-Modellierung von Flow unter Einbezug einer Befragung von leistungsorientierten Kanurennsportler/innen Von
Eine Darstellung von Problemen der Flow-Forschung und möglichen Lösungsansätzen anhand einer Re-Modellierung von Flow unter Einbezug einer Befragung von leistungsorientierten Kanurennsportler/innen Von
Das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern
 Referat an der Eröffnungstagung des Kantonalen Netzwerkes Gesundheitsfördernder Schulen, 20. Januar 2007, Tagungszentrum Schloss Au / ZH Das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern Tina Hascher (tina.hascher@sbg.ac.at)
Referat an der Eröffnungstagung des Kantonalen Netzwerkes Gesundheitsfördernder Schulen, 20. Januar 2007, Tagungszentrum Schloss Au / ZH Das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern Tina Hascher (tina.hascher@sbg.ac.at)
Neue Theorieströmungen zum Studienabbruch
 Neue Theorieströmungen zum Studienabbruch Herkunft, Genese und Potenziale für die Studienabbruch- und Hochschulforschung Kassel, 10.4.2015 Gliederung 1. Definition/Häufigkeit/Relevanz 2. Spezifische und
Neue Theorieströmungen zum Studienabbruch Herkunft, Genese und Potenziale für die Studienabbruch- und Hochschulforschung Kassel, 10.4.2015 Gliederung 1. Definition/Häufigkeit/Relevanz 2. Spezifische und
Gabriel Duttler (Autor) Bindung an Gesundheitssport Qualitative Analyse gelingender Bindung unter besonderer Beachtung der Sportfreude
 Gabriel Duttler (Autor) Bindung an Gesundheitssport Qualitative Analyse gelingender Bindung unter besonderer Beachtung der Sportfreude https://cuvillier.de/de/shop/publications/6277 Copyright: Cuvillier
Gabriel Duttler (Autor) Bindung an Gesundheitssport Qualitative Analyse gelingender Bindung unter besonderer Beachtung der Sportfreude https://cuvillier.de/de/shop/publications/6277 Copyright: Cuvillier
WIRkung entfalten - Selbstwirksamkeit stärken
 WIRkung entfalten - Selbstwirksamkeit stärken LdE als Instrument zur Resilienzförderung Anne Seifert Freudenberg Stiftung Überblick WIRkung entfalten? Resilienzforschung + Selbstwirksamkeit Wie kann Selbstwirksamkeit
WIRkung entfalten - Selbstwirksamkeit stärken LdE als Instrument zur Resilienzförderung Anne Seifert Freudenberg Stiftung Überblick WIRkung entfalten? Resilienzforschung + Selbstwirksamkeit Wie kann Selbstwirksamkeit
Beeinflusst der Enthusiasmus einer Lehrperson deren unterrichtliches Handeln?
 Beeinflusst der einer Lehrperson deren unterrichtliches Handeln? Victoria Neuber 1, Josef Künsting 2, Frank Lipowsky 1 1 Universität Kassel, 2 Universität Regensburg Gliederung 1. Theorie und Forschungsstand
Beeinflusst der einer Lehrperson deren unterrichtliches Handeln? Victoria Neuber 1, Josef Künsting 2, Frank Lipowsky 1 1 Universität Kassel, 2 Universität Regensburg Gliederung 1. Theorie und Forschungsstand
Die Wirkung von Gamification auf Motivation und Leistung. - Kapitel 3 -
 Die Wirkung von Gamification auf Motivation und Leistung - Kapitel 3 - Übersicht Forschungsstand Anwendungskontexte Arbeit Bildung Crowdsourcing Datenerhebungen und Umfragen Gesundheit Marketing Online-Communities
Die Wirkung von Gamification auf Motivation und Leistung - Kapitel 3 - Übersicht Forschungsstand Anwendungskontexte Arbeit Bildung Crowdsourcing Datenerhebungen und Umfragen Gesundheit Marketing Online-Communities
"Experimentelle Grundlagenforschung zur Validierung der wingwave-
 Methode", Dr. Marco Rathschlag, Forschungen an der Deutschen Sporthochschule Köln von 2010 bis 2013. wingwave nutzt drei Methodenbestandteile, über die als Mono-Disziplinen bereits signifikante wissenschaftliche
Methode", Dr. Marco Rathschlag, Forschungen an der Deutschen Sporthochschule Köln von 2010 bis 2013. wingwave nutzt drei Methodenbestandteile, über die als Mono-Disziplinen bereits signifikante wissenschaftliche
Nachhaltige Personalentwicklung
 Maren Lay Nachhaltige Personalentwicklung an Universitäten Konzeptionelle Grundlagen und empirische Untersuchungen vor dem Hintergrund befristeter Beschäftigungsverhältnisse von Wissenschaftlerinnen und
Maren Lay Nachhaltige Personalentwicklung an Universitäten Konzeptionelle Grundlagen und empirische Untersuchungen vor dem Hintergrund befristeter Beschäftigungsverhältnisse von Wissenschaftlerinnen und
Workshop 1: Online-Tools und Benchmark zur Diagnose der Resilienz
 Workshop 1: Online-Tools und Benchmark zur Diagnose der Resilienz Dr. Roman Soucek Dr. Nina Pauls Ablauf des Workshops Einstieg ins Thema Zeit zum Testen Fragen und Diskussion Interpretation und Einsatz
Workshop 1: Online-Tools und Benchmark zur Diagnose der Resilienz Dr. Roman Soucek Dr. Nina Pauls Ablauf des Workshops Einstieg ins Thema Zeit zum Testen Fragen und Diskussion Interpretation und Einsatz
Lebenssinn bei Demenz eine psychologische Betrachtung
 Lebenssinn bei Demenz eine psychologische Betrachtung Dr. Stefanie Becker, Geschäftsleiterin Schweizerische Alzheimervereinigung Ökumenische Spitalseelsorgetagung Zollikerberg, 19. April 2016 Überblick
Lebenssinn bei Demenz eine psychologische Betrachtung Dr. Stefanie Becker, Geschäftsleiterin Schweizerische Alzheimervereinigung Ökumenische Spitalseelsorgetagung Zollikerberg, 19. April 2016 Überblick
Familiäre Pflege: Welche Bedeutung haben Ressourcen für pflegende Angehörige? Assessment zur Erfassung Ressourcen pflegender Angehöriger (RPA)
 Familiäre Pflege: Welche Bedeutung haben Ressourcen für pflegende Angehörige? Assessment zur Erfassung Ressourcen pflegender Angehöriger (RPA) Prof. Dr. rer. medic. Claudia Mischke, MPH Swiss Congress
Familiäre Pflege: Welche Bedeutung haben Ressourcen für pflegende Angehörige? Assessment zur Erfassung Ressourcen pflegender Angehöriger (RPA) Prof. Dr. rer. medic. Claudia Mischke, MPH Swiss Congress
Attribution. Unterschied zwischen Akteur und Beobachter
 Attribution Unterschied zwischen Akteur und Beobachter Christine Faist & Carina Gottwald Seminar: Soziale Kognition 2.Fachsemester Datum: 25.04.2012, 10.00 12.00 Überblick Hypothese Nisbett und Jones Watson
Attribution Unterschied zwischen Akteur und Beobachter Christine Faist & Carina Gottwald Seminar: Soziale Kognition 2.Fachsemester Datum: 25.04.2012, 10.00 12.00 Überblick Hypothese Nisbett und Jones Watson
Berufseintritt nach dem Studium in der Sozialen Arbeit. Anleitertagung 09. November 2011 DHBW Stuttgart Fakultät Sozialwesen
 Berufseintritt nach dem Studium in der Sozialen Arbeit Anleitertagung 09. November 2011 DHBW Stuttgart Fakultät Sozialwesen Panelstudie Befragung der Absolvent/innen des Bachelorstudienganges Soziale Arbeit
Berufseintritt nach dem Studium in der Sozialen Arbeit Anleitertagung 09. November 2011 DHBW Stuttgart Fakultät Sozialwesen Panelstudie Befragung der Absolvent/innen des Bachelorstudienganges Soziale Arbeit
Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen
 Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen Hintergrund Videospiele stellen die in ihnen handelnden Figuren häufig stereotyp
Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen Hintergrund Videospiele stellen die in ihnen handelnden Figuren häufig stereotyp
Einstellungen von Lehrkräften zu Inklusion und deren Bedeutung. für den schulischen Implementierungsprozess - Entwicklung,
 Einstellungen von Lehrkräften zu Inklusion und deren Bedeutung für den schulischen Implementierungsprozess - Entwicklung, Validierung und strukturgleichungsanalytische Modellierung der Skala EFI-L Von
Einstellungen von Lehrkräften zu Inklusion und deren Bedeutung für den schulischen Implementierungsprozess - Entwicklung, Validierung und strukturgleichungsanalytische Modellierung der Skala EFI-L Von
Wahrnehmung von Emotionen und Veränderungen im Wohlbefinden bei alten und jungen Menschen
 Wahrnehmung von Emotionen und Veränderungen im Wohlbefinden bei alten und jungen Menschen Dr. Christina Röcke Vortrag im Rahmen der ZfG Ringvorlesung Wahrnehmung im Alter und des Alters 19. Februar 2014
Wahrnehmung von Emotionen und Veränderungen im Wohlbefinden bei alten und jungen Menschen Dr. Christina Röcke Vortrag im Rahmen der ZfG Ringvorlesung Wahrnehmung im Alter und des Alters 19. Februar 2014
Markenpersönlichkeit - Persönlichkeitsorientiertes Markenmanagement
 Wirtschaft Gérald Marolf Markenpersönlichkeit - Persönlichkeitsorientiertes Markenmanagement Vordiplomarbeit Universität Zürich Institut für Strategie und Unternehmensökonomik SS 2005 Semesterarbeit Lehrstuhl
Wirtschaft Gérald Marolf Markenpersönlichkeit - Persönlichkeitsorientiertes Markenmanagement Vordiplomarbeit Universität Zürich Institut für Strategie und Unternehmensökonomik SS 2005 Semesterarbeit Lehrstuhl
Funktion der Mindestreserve im Bezug auf die Schlüsselzinssätze der EZB (German Edition)
 Funktion der Mindestreserve im Bezug auf die Schlüsselzinssätze der EZB (German Edition) Philipp Heckele Click here if your download doesn"t start automatically Download and Read Free Online Funktion
Funktion der Mindestreserve im Bezug auf die Schlüsselzinssätze der EZB (German Edition) Philipp Heckele Click here if your download doesn"t start automatically Download and Read Free Online Funktion
Versteckte Signale der Ovulation - Verhalten und Selbstwahrnehmung in Abhängigkeit vom Menstruationszyklus
 Geisteswissenschaft Melanie Denk Versteckte Signale der Ovulation - Verhalten und Selbstwahrnehmung in Abhängigkeit vom Menstruationszyklus Diplomarbeit INHALTSVERZEICHNIS - 1 - BERGISCHE UNIVERSITÄT
Geisteswissenschaft Melanie Denk Versteckte Signale der Ovulation - Verhalten und Selbstwahrnehmung in Abhängigkeit vom Menstruationszyklus Diplomarbeit INHALTSVERZEICHNIS - 1 - BERGISCHE UNIVERSITÄT
Die Gleichaltrigen. LS Entwicklungs- und Pädagogische Psychologie
 Die Gleichaltrigen 1 Bedeutung der Bedeutung der Gleichaltrigen- Beziehungen für die kindliche Entwicklung Peers = Kinder ungefähr gleichen Alters Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten
Die Gleichaltrigen 1 Bedeutung der Bedeutung der Gleichaltrigen- Beziehungen für die kindliche Entwicklung Peers = Kinder ungefähr gleichen Alters Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten
Traumjob Wissenschaft 15
 Traumjob Wissenschaft 15 senschaftssystem finden Sie hier auch die entsprechenden Informationen für Österreich und die Schweiz. Für die vertiefte Lektüre zu einzelnen Aspekten der Wissenschaftskarriere
Traumjob Wissenschaft 15 senschaftssystem finden Sie hier auch die entsprechenden Informationen für Österreich und die Schweiz. Für die vertiefte Lektüre zu einzelnen Aspekten der Wissenschaftskarriere
Klagenfurt, 19. Mai Input: Dr in Birgit Buchinger.
 Gute Arbeit gutes Leben im Wissenschaftsbetrieb 5. Gesundheitstag zum Thema Gesundheit im Setting Hochschule unter Berücksichtigung der Kategorie Geschlecht Klagenfurt, 19. Mai 2010 Input: Dr in Birgit
Gute Arbeit gutes Leben im Wissenschaftsbetrieb 5. Gesundheitstag zum Thema Gesundheit im Setting Hochschule unter Berücksichtigung der Kategorie Geschlecht Klagenfurt, 19. Mai 2010 Input: Dr in Birgit
WAS IST LEBENSQUALITÄT? DIPL. PGW R. BECKER
 WAS IST LEBENSQUALITÄT? DIPL. PGW R. BECKER FÜR SIE PERSÖNLICH? DAS KONZEPT DER LEBENSQUALITÄT LEBENSQUALITÄT EIN MULTIDIMENSIONALES KONSTRUKT WHO KÖRPERLICHE, MENTALE, SOZIALE, SPIRITUELLE UND VERHALTENSBEZOGENE
WAS IST LEBENSQUALITÄT? DIPL. PGW R. BECKER FÜR SIE PERSÖNLICH? DAS KONZEPT DER LEBENSQUALITÄT LEBENSQUALITÄT EIN MULTIDIMENSIONALES KONSTRUKT WHO KÖRPERLICHE, MENTALE, SOZIALE, SPIRITUELLE UND VERHALTENSBEZOGENE
Verleihung des BKK Innovationspreises Gesundheit 2016 Armut und Gesundheit am 13. September 2017 in Frankfurt a. M.
 Verleihung des BKK Innovationspreises Gesundheit 2016 Armut und Gesundheit am 13. September 2017 in Frankfurt a. M. 1. Preisträger: Tanja Krause Thema: Gesundheit Behinderung Teilhabe. Soziale Ungleichheit
Verleihung des BKK Innovationspreises Gesundheit 2016 Armut und Gesundheit am 13. September 2017 in Frankfurt a. M. 1. Preisträger: Tanja Krause Thema: Gesundheit Behinderung Teilhabe. Soziale Ungleichheit
Edenred-Ipsos Barometer 2016 Wohlbefinden am Arbeitsplatz messen und fördern. Mai 2016
 Edenred-Ipsos Barometer 2016 Wohlbefinden am Arbeitsplatz messen und fördern Mai 2016 Fakten und Hintergrund Unternehmen, die mit unsicheren Märkten kämpfen, sind immer mehr auf die Bereitschaft ihrer
Edenred-Ipsos Barometer 2016 Wohlbefinden am Arbeitsplatz messen und fördern Mai 2016 Fakten und Hintergrund Unternehmen, die mit unsicheren Märkten kämpfen, sind immer mehr auf die Bereitschaft ihrer
Scham - angeboren oder anerzogen?
 Geisteswissenschaft Sarah Trenkmann Scham - angeboren oder anerzogen? Ein Versuch der kritischen Auseinandersetzung anhand der Werke von Elias, Duerr und Simmel Studienarbeit Friedrich-Schiller-Universität
Geisteswissenschaft Sarah Trenkmann Scham - angeboren oder anerzogen? Ein Versuch der kritischen Auseinandersetzung anhand der Werke von Elias, Duerr und Simmel Studienarbeit Friedrich-Schiller-Universität
Führung und Gesundheit aus Sicht der Wissenschaft
 Führung und Gesundheit aus Sicht der Wissenschaft Dr. Sylvie Vincent-Höper HAW BGM Ringvorlesung Führung, Management und Gesundheit 04.11.2015 1 Gibt es einen Zusammenhang zwischen Führung und Mitarbeitergesundheit?
Führung und Gesundheit aus Sicht der Wissenschaft Dr. Sylvie Vincent-Höper HAW BGM Ringvorlesung Führung, Management und Gesundheit 04.11.2015 1 Gibt es einen Zusammenhang zwischen Führung und Mitarbeitergesundheit?
Zwischenergebnisse 5 Berufseinstieg und subjektive Verunsicherung
 Zwischenergebnisse 5 Berufseinstieg und subjektive Verunsicherung Die Folgen der Finanzkrise verunsichern viele Menschen. Vor allem Berufseinsteiger sind bei möglichen Entlassungen als erste betroffen.
Zwischenergebnisse 5 Berufseinstieg und subjektive Verunsicherung Die Folgen der Finanzkrise verunsichern viele Menschen. Vor allem Berufseinsteiger sind bei möglichen Entlassungen als erste betroffen.
3. Wieweit kann ich Entscheidungen selbst treffen und Vorgehensweisen selbst festlegen?...
 Ihre persönliche Standortbestimmung 3. Wieweit kann ich Entscheidungen selbst treffen und Vorgehensweisen selbst festlegen?... 4. Wie funktioniert die Kommunikation in meiner Einrichtung (Kindergarten,
Ihre persönliche Standortbestimmung 3. Wieweit kann ich Entscheidungen selbst treffen und Vorgehensweisen selbst festlegen?... 4. Wie funktioniert die Kommunikation in meiner Einrichtung (Kindergarten,
Sexueller Missbrauch - Mediendarstellung und Medienwirkung
 Bertram Scheufeie Sexueller Missbrauch - Mediendarstellung und Medienwirkung VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN 1 Einleitung 9 2 Definition «Sexueller Missbrauch' 11 2.1 Juristische Perspektive 11 2.1.1
Bertram Scheufeie Sexueller Missbrauch - Mediendarstellung und Medienwirkung VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN 1 Einleitung 9 2 Definition «Sexueller Missbrauch' 11 2.1 Juristische Perspektive 11 2.1.1
Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz
 Kolloquium Fremdsprachenunterricht 56 Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz Ein Beitrag zur Theoriebildung Bearbeitet von Nadine Stahlberg 1. Auflage 2016. Buch. 434 S. Hardcover ISBN 978 3 631 67479
Kolloquium Fremdsprachenunterricht 56 Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz Ein Beitrag zur Theoriebildung Bearbeitet von Nadine Stahlberg 1. Auflage 2016. Buch. 434 S. Hardcover ISBN 978 3 631 67479
Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)
 Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,
Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,
Junior physician s workplace experiences in clinical fields in German-speaking Switzerland
 Junior physician s workplace experiences in clinical fields in German-speaking Switzerland (Barbara Buddeberg-Fischer, Richard Klaghofer, Thomas Abel, Claus Buddeberg, 2003) Ziel der Studie: Erfahrungen
Junior physician s workplace experiences in clinical fields in German-speaking Switzerland (Barbara Buddeberg-Fischer, Richard Klaghofer, Thomas Abel, Claus Buddeberg, 2003) Ziel der Studie: Erfahrungen
"Django Unchained" trifft Ludwig van Beethoven
 Medienwissenschaft Anonym "Django Unchained" trifft Ludwig van Beethoven Der Einfluss von Filmbildern auf die Musikwahrnehmung Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche
Medienwissenschaft Anonym "Django Unchained" trifft Ludwig van Beethoven Der Einfluss von Filmbildern auf die Musikwahrnehmung Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche
Stress bei Frauen ist anders bei Führungsfrauen erst recht
 2 Stress bei Frauen ist anders bei Führungsfrauen erst recht Sie werden sicherlich sagen, Stress ist Stress und bei Männern und Frauen gibt es kaum Unterschiede. Tatsache ist, dass es kaum Untersuchungen
2 Stress bei Frauen ist anders bei Führungsfrauen erst recht Sie werden sicherlich sagen, Stress ist Stress und bei Männern und Frauen gibt es kaum Unterschiede. Tatsache ist, dass es kaum Untersuchungen
Glossar. Cause of Effects Behandelt die Ursache von Auswirkungen. Debriefing Vorgang der Nachbesprechung der experimentellen Untersuchung.
 Abhängige Variable Die zu untersuchende Variable, die von den unabhängigen Variablen in ihrer Ausprägung verändert und beeinflusst wird (siehe auch unabhängige Variable). Between-Subjects-Design Wenn die
Abhängige Variable Die zu untersuchende Variable, die von den unabhängigen Variablen in ihrer Ausprägung verändert und beeinflusst wird (siehe auch unabhängige Variable). Between-Subjects-Design Wenn die
Resilienz-Modell und Diagnoseinstrumente
 Resilienz-Modell und Diagnoseinstrumente Dr. Roman Soucek Dr. Nina Pauls Was ist Resilienz? Der Begriff Resilienz Lat. resilire = zurückspringen, abprallen Resilienz als psychische Widerstandsfähigkeit/-kraft
Resilienz-Modell und Diagnoseinstrumente Dr. Roman Soucek Dr. Nina Pauls Was ist Resilienz? Der Begriff Resilienz Lat. resilire = zurückspringen, abprallen Resilienz als psychische Widerstandsfähigkeit/-kraft
Intelligenz: Gf, Gc oder?
 Intelligenz: Gf, Gc oder? Präsentation FLS Theresa Ehsani Julia Khayat Drei Faktoren der Intelligenz nach Cattell Gc kristalline Intelligenz Verbale Intelligenz sprach- und bildungsabhängig Im Laufe des
Intelligenz: Gf, Gc oder? Präsentation FLS Theresa Ehsani Julia Khayat Drei Faktoren der Intelligenz nach Cattell Gc kristalline Intelligenz Verbale Intelligenz sprach- und bildungsabhängig Im Laufe des
Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement
 Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Mitbestimmt geht s mir besser! Seite 1 Leitlinien für Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Beteiligung: Marginalisierten Gruppen eine Stimme geben!
Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Mitbestimmt geht s mir besser! Seite 1 Leitlinien für Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Beteiligung: Marginalisierten Gruppen eine Stimme geben!
Emotionsarbeit und Emotionsregulation Zwei Seiten der selben Medaille?
 Emotionsarbeit und Emotionsregulation Zwei Seiten der selben Medaille? Christian von Scheve Institut für Soziologie, Universität Wien Die Soziologie der Emotionsarbeit Die Soziale Ordnung der Gefühle There
Emotionsarbeit und Emotionsregulation Zwei Seiten der selben Medaille? Christian von Scheve Institut für Soziologie, Universität Wien Die Soziologie der Emotionsarbeit Die Soziale Ordnung der Gefühle There
Glück ist machbar - vom Sinn und Nutzen Beruflicher Rehabilitation. Mag. Roman Pöschl
 Glück ist machbar - vom Sinn und Nutzen Beruflicher Rehabilitation Mag. Roman Pöschl Glück ist machbar Ergebnisse der Evaluationsstudie von SYNTHESISFORSCHUNG und IBE Im Auftrag des BBRZ Mai 2015 Was wir
Glück ist machbar - vom Sinn und Nutzen Beruflicher Rehabilitation Mag. Roman Pöschl Glück ist machbar Ergebnisse der Evaluationsstudie von SYNTHESISFORSCHUNG und IBE Im Auftrag des BBRZ Mai 2015 Was wir
Wie beurteilen Studierende computergestützte Prüfungen? Erste Ergebnisse der Evaluation der E-Examinations an der Freien Universität Berlin
 Wie beurteilen Studierende computergestützte Prüfungen? Erste Ergebnisse der Evaluation der E-Examinations an der Freien Universität Berlin Dr. Susanne Bergann Arbeitsstelle Lehr- und Studienqualität Fachbereich
Wie beurteilen Studierende computergestützte Prüfungen? Erste Ergebnisse der Evaluation der E-Examinations an der Freien Universität Berlin Dr. Susanne Bergann Arbeitsstelle Lehr- und Studienqualität Fachbereich
Sexuelle Traumatisierung und ihre Folgen
 Rita Völker Sexuelle Traumatisierung und ihre Folgen Die emotionale Dimension des sexuellen Missbrauchs.' '. T. J -.\.A-:! Leske + Budrich, Opladen 2002 Inhalt Vorwort 13 Christina 15 1. Der sexuelle Missbrauch
Rita Völker Sexuelle Traumatisierung und ihre Folgen Die emotionale Dimension des sexuellen Missbrauchs.' '. T. J -.\.A-:! Leske + Budrich, Opladen 2002 Inhalt Vorwort 13 Christina 15 1. Der sexuelle Missbrauch
Tutorium zur Vorlesung Differentielle Psychologie
 Tutorium zur Vorlesung Differentielle Psychologie Heutiges Thema: Ängstlichkeit & Aggressivität Larissa Fuchs Gliederung 1. Wiederholung Davidson: Frontale Asymmetrie 2. Ängstlichkeit 3. Aggressivität
Tutorium zur Vorlesung Differentielle Psychologie Heutiges Thema: Ängstlichkeit & Aggressivität Larissa Fuchs Gliederung 1. Wiederholung Davidson: Frontale Asymmetrie 2. Ängstlichkeit 3. Aggressivität
MEINE ABSCHLUSSARBEIT
 MEINE ABSCHLUSSARBEIT Content Guideline Dr. Solmaz Alevifard IMPRESSUM Herausgeber ALEVIFARD COACHING Dr. Solmaz Alevifard www.alevifard.com 6. April 2017 Seite 2! von! 9 INHALT 1. Das Inhaltsverzeichnis
MEINE ABSCHLUSSARBEIT Content Guideline Dr. Solmaz Alevifard IMPRESSUM Herausgeber ALEVIFARD COACHING Dr. Solmaz Alevifard www.alevifard.com 6. April 2017 Seite 2! von! 9 INHALT 1. Das Inhaltsverzeichnis
Gletscher und Eiszeiten"
 Dirk Felzmann Didaktische Rekonstruktion des Themas Gletscher und Eiszeiten" für den Geographieunterricht Didaktisches Zentrum Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Geowissenschaften" Inhaltsverzeichnis
Dirk Felzmann Didaktische Rekonstruktion des Themas Gletscher und Eiszeiten" für den Geographieunterricht Didaktisches Zentrum Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Geowissenschaften" Inhaltsverzeichnis
4.5. Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick
 4.5. Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick Bei der Untersuchung zur Psychologie der persönlichen Konstrukte mit dem REP- GRID zeigten sich folgende Ergebnisse: PDS-Patienten konstruieren die Situation,
4.5. Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick Bei der Untersuchung zur Psychologie der persönlichen Konstrukte mit dem REP- GRID zeigten sich folgende Ergebnisse: PDS-Patienten konstruieren die Situation,
1 Einleitung Erster Teil: Theoretischer Hintergrund Warum Mathematik? - Bedeutung des Faches Mathematik... 14
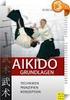 Inhaltsverzeichnis 3 INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung... 11 Erster Teil: Theoretischer Hintergrund... 14 2 Warum Mathematik? - Bedeutung des Faches Mathematik... 14 2.1 Sieben Gründe für den Mathematikunterricht
Inhaltsverzeichnis 3 INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung... 11 Erster Teil: Theoretischer Hintergrund... 14 2 Warum Mathematik? - Bedeutung des Faches Mathematik... 14 2.1 Sieben Gründe für den Mathematikunterricht
MITARBEITERMOTIVATION:
 MITARBEITERMOTIVATION: EMOTIONEN SIND ENTSCHEIDEND Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_111512_wp WARUM EMOTIONEN
MITARBEITERMOTIVATION: EMOTIONEN SIND ENTSCHEIDEND Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_111512_wp WARUM EMOTIONEN
