Aus dem Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br.
|
|
|
- Krista Kurzmann
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Aus dem Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. 3,4-Diaminopyridin evozierte Freisetzung von Neurotransmittern aus Hirnschnitten von Ratten: Untersuchungen im Kortex und Hippocampus an alten Ratten, sowie an Ratten mit serotonergen Läsionen hippocampaler Afferenzen und intrahippocampalen Raphé-Transplantaten INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung des Medizinischen Doktorgrades der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.br. Vorgelegt 2004 von Theresa Schweizer geboren in Wolfach
2 Dekan: Prof. Dr. med. Christoph Peters 1. Gutachter: Prof. Dr. med Rolf Jackisch 2. Gutachter: Prof. Dr. med Gisa Fleckenstein-Grün Jahr der Promotion: 2005
3 III Teile der Arbeit wurden veröffentlicht: Zeitschriftenartikel: SCHWEIZER, T., BIRTHELMER, A., JELTSCH, H., CASSEL, J.C. & JACKISCH, R. (2002). Raphe grafts and 3,4-diaminopyridine-evoked overflow of serotonin in the rat hippocampus after 5,7-dihydroxytryptamine lesions: evidence for 5-HT1A autoreceptors. Neuroreport, 13, SCHWEIZER, T., BIRTHELMER, A, LAZARIS, A., CASSEL, J.C., JACKISCH, R. (2003). 3,4- DAP evoked transmitter release in hippocampal slices of aged rats with impaired memory. Brain Research Bulletin, 62, BIRTHELMER, A., SCHWEIZER, T., JELTSCH, H., JACKISCH, R. & CASSEL, J.C. (2002). 5,7- dihydroxytryptamine lesions enhance and serotonergic grafts normalize the evoked overflow of acetylcholine in rat hippocampal slices. Eur J Neurosci, 16, BIRTHELMER, A., LAZARIS, A., SCHWEIZER, T., JACKISCH, R. & CASSEL, J.C. (2003). Presynaptic regulation of neurotransmitter release in the Kortex of aged rats with differential memory impairments. Pharmacol Biochem Behav, 75, CASSEL, J.C., SCHWEIZER, T., LAZARIS, A., KNORLE, R., BIRTHELMER, A., GODTEL- ARMBRUST, U., FORSTERMANN, U. & JACKISCH, R. (2005). Cognitive deficits in aged rats correlate with levels of L-arginine, not with nnos expression or 3,4-DAP-evoked transmitter release in the frontoparietal cortex. Eur Neuropsychopharmacol, 15, Abstracts von Postern: Birthelmer A, Schweizer T, Jeltsch H, Jackisch R, Cassel JC 5,7-Dihydroxytryptamine lesions enhance and serotonergic grafts normalize the evoked overflow of acetylcholine in rat hippocampus slices Frühjahrstagung der DGPT, Naunyn-Schmiedeberg s Archive of Pharmacology 367 (Suppl.) R85 [2003]
4 IV Meinen Eltern
5 V Teile der Arbeit wurden veröffentlicht:...iii Abkürzungsverzeichnis... VIII 1 Einleitung Vorbemerkung Altern und Demenz Gedächtnis Neuron und Synapse Rezeptoren Hirnregionen Hippocampus/ Limbisches System Kortex Septumregion Basale Vorderhirnstrukturen Raphékerne Neurotransmitter Acetylcholin Noradrenalin Serotonin Serotoninrezeptoren Modell der 3,4-DAP evozierten Transmitterfreisetzung Kaliumkanäle Klinische Anwendung von 3,4-DAP Altersforschung Fragestellungen der einzelnen Teile der vorliegenden Arbeit Teil A - Kortex Teil B Hippocampus Teil C - Serotonerge Läsion/ Transplantation Zusammenfassende Darstellung der Fragestellung Material und Methoden Chemikalien und Substanzen Übersicht über die in den Experimenten eingesetzten Pharmaka und deren Herkunft Übersicht über die in den Experimenten eingesetzten radioaktiven Stoffe und deren Herkunft Versuchstiere Alte Ratten/ Kortex (im Folgenden Teil A) Alte Ratten/ Hippocampus (im Folgenden Teil B) Serotonerge Läsion/ Transplantation (im Folgenden Teil C) Läsion und Transplantation Intrazerebroventrikuläre Läsion mit 5,7-DHT und anschließende intrahippocampale Transplantation von Zellsuspensionen reich an serotonergen Neuronen Läsion Transplantation von Zellsuspensionen reich an serotonergen Neuronen Herstellung der Zellsuspension Zahl transplantierter Zellen und Bestimmung deren Viabilität Injektion der Zellsuspension Morris-Water-Maze Die Versuchsanlage Training und Quantifizierung Präparation der Gewebeschnitte Hippocampus Kortex Herstellung von Homogenaten des ventralen Hippocampus bzw. der Kortexscheiben... 26
6 VI 2.6 Inkubations- und Superfusionsmedium Zusammensetzung des modifizierten Krebs-Henseleit-Puffers Superfusion Allgemein Vorperfusion Zeitlicher Ablauf der Superfusionsexperimente Superfusionskammern Auswertung der Superfusionsversuche Bestimmung des Tritiumgehaltes Berechnung der relativen Tritiumfreisetzung einer Fraktion (fractional rate) Berechnung des Basaleffluxquotienten Berechnung der evozierten Tritiumabgabe Berechnung von Substanzeffekten Proteinbestimmung HPLC Bestimmung der Cholinacetyltransferase-Aktivität (ChAT) Bestimmung der ChAT-Aktivität Berechnung der spezifischen ChAT-Aktivität Acetylcholinesterase- Assay Statistik Statistik der Studien an alten Ratten (Teil A & B) Statistik des Läsions-/ Transplantationsmodells (Teil C) Ergebnisse ,4-DAP evozierte Freisetzung von ACh, 5-HT und NA im Kortex alter Ratten (Teil A) Tetrodotoxin-Sensitivität und Kalzium-Abhängigkeit Einteilung der Ratten nach dem Verhalten im Morris-Water-Maze (MWM) (Abb.15; Tab.8) Freisetzung von [³H]ACh (Abb.16 und Tab.9) Freisetzung von [³H]NA (Abb.17 und Tab.9) Freisetzung von [³H]5-HT (Abb.18 und Tab.9) Korrelation der Leistungen im MWM mit der evozierten Freisetzung Neurochemische Untersuchungen ChAT- und AChE-Aktivität Konzentration der Monoamine ,4-DAP evozierte Freisetzung von ACh, 5-HT und NA im Hippocampus alter Ratten (Teil B) Tetrodotoxin-Sensitivität und Kalzium-Abhängigkeit der [ 3 H]ACh-Freisetzung Einteilung der Ratten nach dem Verhalten im MWM (Tab.12) Freisetzung von [³H]ACh (Abb.19 und Tab.13) Freisetzung von [³H]NA (Abb.20 und Tab.13) Freisetzung von [³H]5-HT (Abb.21 und Tab.13) Korrelation der Leistungen im MWM mit der evozierten Freisetzung (Spearman Korrelationen) ,4-DAP evozierte Freisetzung von 5-HT im Hippocampus läsionierter/ Raphé-transplantierter Ratten (Teil C) TTX-Sensitivität, Kalzium-Abhängigkeit und Modulation über 5-HT-Autorezeptoren (Abb.23, 24 und Tab.14) Freisetzung von [³H]5-HT (Abb.25 und Tab.15) Effekte von 8-OH-DPAT auf die 3,4-DAP evozierte Freisetzung (Abb.26 und Tab.16) Diskussion Das Modell der 3,4-DAP evozierten Transmitterfreisetzung Alte Ratten Kortex und Hippocampus (Teil A & B) Altersbedingte kognitive Defizite Kortex Hippocampus... 88
7 VII ACh HT ACh/ 5-HT-Interaktion Altern und cholinerge/ monoaminerge Marker im frontoparietalen Kortex Schlussfolgerung (Teil 4.2) Serotonerge Läsion/ Transplantation (Teil C) Schlussfolgerung (Teil 4.3) Zusammenfassung Literaturverzeichnis Danksagung Lebenslauf...108
8 VIII Abkürzungsverzeichnis [ 3 H] Tritium [ 3 H]5-HT tritiummarkiertes 5-Hydroxytryptamin C Grad Celsius µl Mikroliter µm Mikromol/ Liter 3,4-DAP 3,4-Diaminopyridin 5,7-DHT 5,7-Dihydroxytryptamin 5-HIAA 5-Hydroxyindolessigsäure 5-HT 5-Hydroxytryptamin, Serotonin 6-NQ 6-Nitroquipazin Abb. Abbildung ACh Acetylcholin AChe Acetylcholinesterase AI aged impaired AMI aged moderately impaired ANOVA Analysis of Variances AP Aktionspotential ASI aged severely impaired AU aged unimpaired BChE Butyrylcholinesterase cdna kodierende DNA (Desoxyribonukleinsäure) ChAT Cholinacetyltransferase Ci Curie CO 2 Kohlenstoffdioxid DBB Diagonales Band von Broca Dpm disintegration per minute ED embryonic day GRAFT mit 5,7-DHT läsionierte Ratten, die ein Raphétransplantat erhielten HEPES N-2-Hydroxyethylpiperazin-N -2-ethansulfonsäure HPLC High Performance Liquid Chromatography LES mit 5,7-DHT läsionierte Ratten
9 IX mm MS MWM n N NA NBM nci pmol SHAM SEM Tab. TTX ZNS Millimol/ Liter Mediales Septum Morris Water Maze Anzahl Normalität, Äquivalentmengen- Konzentration Noradrenalin Nucleus basalis magnocellularis Nanocurie Picomol scheinoperierte Ratten Standardabweichung des Mittelwerts Tabelle Tetrodotoxin Zentralnervensystem
10 1 1 Einleitung 1.1 Vorbemerkung Das Gehirn und das Nervensystem der Tiere und Menschen sind wohl die erstaunlichsten Organe, die das Leben hervorgebracht hat. Das menschliche Gehirn wiegt etwa 1500 Gramm und enthält schätzungsweise hundert Milliarden Nervenzellen. Das sind etwa ebenso viele Zellen, wie es Sterne in der Milchstraße gibt (Stevens, 1980). Natürlich entzündet sich die Faszination an den Leistungen, die diese Gewebe auszuführen im Stande sind. Unser Denken, Fühlen, Lernen, Erinnern und das Bewusstsein, das uns erst zum Menschen macht, werden durch diese Organe getragen. Die zugrundeliegenden Mechanismen sind so komplex, dass die Wissenschaft nach wie vor nur einen kleinen Teil davon versteht. Gerade deshalb ist das Gebiet der Neurowissenschaften aber auch so spannend (Greenfield, 2003). Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Eigenschaften der durch 3,4- Diaminopyridin evozierten Freisetzung von Serotonin, Acetylcholin und Noradrenalin im Hippocampus und Neokortex der Ratte. Zunächst soll ein Überblick über die in der Arbeit behandelten Themen gegeben werden, bevor dann die hier bearbeiteten Fragestellungen formuliert werden (s. Kap. 1.11). 1.2 Altern und Demenz Dank besserer Ernährung und Hygieneverhältnisse und einer immer kenntnisreicheren medizinischen Versorgung werden die Menschen heute nach aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik im Schnitt 77,8 Jahre alt - das sind gut 30 Jahre mehr als noch vor 100 Jahren. Dies bedeutet neben gesellschaftspolitischen Konsequenzen auch, dass der Alterungsprozess und die bei manchen Menschen auftretende Demenz wie beispielsweise der Morbus Alzheimer eine immer bedeutendere Rolle spielen, was die Erforschung gerade dieser Vorgänge verstärkt ins Zentrum des Interesses rückt. Die deutsche Alzheimer-Gesellschaft spricht von unter zwei Prozent an Alzheimer erkrankten Menschen bei den jährigen, bei den jährigen steigt der Prozentsatz auf sechs Prozent und bei den über 90 -jährigen sind schließlich über ein Drittel erkrankt. Einleitung
11 2 Alter per se ist natürlich keine Krankheit und eine Demenz nicht zwangsläufige Folge des Alterns. Der M. Alzheimer ist hingegen eine Krankheitsentität, an der insbesondere ältere Menschen erkranken. Dementielle Erkrankungen sind für die Betroffenen und die Angehörigen deshalb so tragisch, weil sie die Persönlichkeit des Patienten verändern und die für das Menschsein so wichtigen Fähigkeiten wie das Erinnern und Lernen beeinträchtigen. 1.3 Gedächtnis Die Fähigkeit, sich an etwas zu erinnern nennen wir Gedächtnis. Dabei wird grundsätzlich zwischen dem Kurzzeitgedächtnis (Sekunden bis Minuten), der Gedächtniskonsolidierung (Tage bis Monate) und dem Langzeitgedächtnis unterschieden. Das Kurzzeitgedächtnis scheint unter anderem eine Leistung des Hippocampus als Teil des limbischen Systems (s.1.6.1) zu sein. Das Langzeitgedächtnis dagegen ist eine Leistung der Großhirnrinde als Ganzes, je nach Gedankeninhalt vorwiegend der motorischen Rinde, Sehrinde usw. Für die Überführung vom Kurz- in das Langzeitgedächtnis (sog. Gedächtniskonsolidierung), also das Lernen im engeren Sinne, sind ebenfalls je nach Gedächtnisinhalt verschiedene Gehirnareale verantwortlich. Dabei ist es wichtig, nach folgenden Kategorien zu trennen: rationale, emotionale oder motorische Gedächtnisinhalte. Rationale werden auch als explizit, die übrigen Gedächtnisinhalte als implizit bezeichnet. Motorische Lernvorgänge, wie sie in dieser Arbeit auch eine Rolle spielen, das heißt die Überführung motorischer Gedächtnisinhalte vom Kurz- in das Langzeitgedächtnis, manifestieren sich über Wechselwirkungen der Basalganglien mit sensorischen Kortexarealen (vor allem afferent) und motorischen Kortexarealen (vor allem efferent über den Thalamus). Auch das Kleinhirn spielt eine wichtige Rolle (Trepel, 1999). 1.4 Neuron und Synapse Die funktionelle Grundeinheit des Nervensystems ist die Nervenzelle (Neuron) (Abb.1), welche durch ihre Vernetzung die Funktion und Arbeitsweise des Gehirns überhaupt erst möglich macht. Von verschiedensten Variationen abgesehen besteht ein Neuron aus zwei Grundelementen: dem Zellkörper (Soma), der den Zellkern enthält und einem oder mehreren Fortsätzen. Die Fortsätze werden unterteilt in Einleitung
12 3 Dendriten, die dem Signalempfang dienen und den Axonen, die für die Signalweitergabe zuständig sind. Abb.1: Neuron Dendriten Abb.2: Synapse Axon Soma Synaptische Endknöpfchen Die Kontaktstelle zweier Neurone, an der ein Nervenimpuls fortgeleitet wird, nennt man Synapse. Dabei gibt es zwei Arten von Synapsen: eine elektrische Synapse, bei der das Signal über interzelluläre Ionenkanäle fortgeleitet wird, sowie das weitaus häufiger anzutreffende Prinzip der chemischen Synapse, bei der die Signalübertragung über Botenstoffe erfolgt, den sogenannten Neurotransmittern (Abb.2). Der elektrische Impuls (Aktionspotential (AP)) kommt im synaptischen Endknöpfchen an, bewirkt einen Kalziumeinstrom an der präsynaptischen Membran, was schließlich zur Freisetzung der Neurotransmitter aus kleinen Speichervesikeln in den synaptischen Endknöpfchen in den synaptischen Spalt führt. Die Neurotransmitter besetzen daraufhin spezifische Rezeptoren auf der Membran des postsynaptischen Neurons und führen zu einer Erregung derselben, wodurch der Nervenimpuls weitergeleitet wird. Neurone können nicht nur ihr eigenes Signal weitergeben, sondern auch die Nachrichtenübertragung anderer Neurone beeinflussen beispielsweise im Sinne einer Abschwächung (Inhibition). Einleitung
13 4 1.5 Rezeptoren Rezeptoren sind Proteinstrukturen, die eine Signalübertragung von einer Zelle zur nächsten möglich machen. Im Falle der Nervenzellen sind sie für spezifische Neurotransmitter empfindlich und somit in der Lage, Impulse von einer Zelle zur nächsten weiterzuleiten. Dabei unterscheidet man die postsynaptischen Rezeptoren, die sich auf Zellkörper oder Dendriten befinden, also eingehende Impulse empfangen, von den präsynaptischen Rezeptoren, welche auf Axon bzw. Axonendigung lokalisiert sind. Die präsynaptischen Rezeptoren modulieren die Menge an Transmitter, die pro Aktionspotential freigesetzt wird. Ein präsynaptischer Rezeptor wird Autorezeptor (Chesselet, 1984; Illes, 1986; Langer, 1981; Starke, 1981; Starke, 1979; Starkeet al., 1989) genannt, wenn er die Freisetzung seines eigenen Transmitters reguliert, wohingegen ein präsynaptischer Heterorezeptor die Freisetzung anderer Transmitter steuert (Zimmermann, 1993). Ein Serotoninrezeptor auf einem cholinergen Neuron beispielsweise erfüllt die Kriterien eines Heterorezeptors. 1.6 Hirnregionen Hippocampus/ Limbisches System Der Hippocampus ist Teil des limbischen Systems, das ein System funktionell in Verbindung stehender Gehirnteile beschreibt und dem die Regulation von Emotion, Affektverhalten, Antrieb und Gedächtnis zugeschrieben wird. Dabei kommt dem Hippocampus, der seinen Namen aufgrund seiner sichelförmig gekrümmten (Seepferdchen-ähnlichen) Form erhielt, entscheidende Funktion bei der Gedächtnisbildung zu. Bei einem Ausfall des Hippocampus ist insbesondere die Überführung von Gedächtnisinhalten vom Kurz- in das Langzeitgedächtnis gestört. Das limbische System befindet sich am Boden des Unterhorns des Seitenventrikels des Gehirns und ist Teil des Gyrus parahippocampalis. Abbildung 3 zeigt das limbische System beim Menschen, das sich aber in seinen wesentlichen Eigenheiten nicht von dem der Ratte unterscheidet. Einleitung
14 5 Abb.3: Limbisches System Afferenzen, also zuleitende Impulse, erhält der Hippocampus unter anderem aus dem Gyrus parahippocampalis, dem medialen Septum (MS) und dem diagonalen Band von Broca (DBB), wodurch ihn Signale aus dem Riechhirn, den Amygdala und dem Neokortex erreichen. Somit erhält der Hippocampus somatische, visuelle, auditorische, olfaktorische und motorische Impulse. Die Efferenzen verlaufen fast ausschließlich im Fornix, welcher über die Corpora mamillaria und den Thalamus zum Gyrus cinguli projiziert. Von dort schließt sich der Neuronenkreis (Papez-Neuronenkreis) zurück zum Hippocampus. Fällt nur eines der Glieder des genannten Neuronenkreises aus, kommt es zu erheblichen Störungen der Gedächtnisbildung (Lernen) und des Gedächtnisabrufens (Erinnern) Kortex Der Kortex ist die graue, Nervenzellen und Nervenfasern enthaltende Großhirnrinde. Von außen lässt er sich in zwei Hemisphären gliedern und in vier Lappen (Frontal-, Parietal-, Temporal- und Okzipitallappen) einteilen. Im Kortex vereinigen sich mannigfaltige Funktionen wie die Motorik, Sensibilität, Sehen, Hören und Assoziationsbereiche. Abb.4 zeigt die Untergliederung des Kortex beim Säugetier am Beispiel des Menschen. Einleitung
15 6 Abb.4: Kortex Septumregion Die Septumregion befindet sich überwiegend an der medialen Hemisphärenwand unterhalb der Commissura anterior und besteht aus kortikalen und subkortikalen Anteilen. Einer dieser Anteile ist das größere Kerngebiet des diagonalen Bandes von Broca (DBB). Die Septumkerne sind afferent und efferent vor allem mit Anteilen des limbischen Systems verbunden Basale Vorderhirnstrukturen Unter den basalen Vorderhirnstrukturen versteht man eine Gruppe von Kernen, die sich medial zur Amygdala an der Basis des Frontallappens erstrecken. Ein besonders hervorzuhebender Kern ist der Nucleus basalis magnocellularis (NBM), der zu 90% aus cholinergen Neuronen besteht. Er weist intensive afferente Faserbeziehungen zu Zentren des limbischen Systems auf und projiziert efferent in nahezu alle Bereiche des Neokortex und wird somit als Bindeglied zwischen diesen Hirnbereichen angesehen Raphékerne Die Raphékerne sind Kerngebiete, die sich im Hirnstamm befinden und aus denen die serotonergen Neurone (aber auch andere) vorwiegend entspringen. Die serotonergen Bahnen erreichen auf- und absteigend fast das ganze Zentralnervensystem. Diese Kerne sind beteiligt an der Schmerzverarbeitung, der Einleitung
16 7 Steuerung des Schlaf-Wach-Zustandes und über ihre Efferenzen zum Hippocampus und damit dem limbischen System auch an der Gedächtnisbildung, der Emotionsregulation und vielem mehr (Rummel, 2001). 1.7 Neurotransmitter Acetylcholin Acetylcholin (ACh) wird aus Cholin und Acetyl-CoA durch die Cholinacetyltransferase synthetisiert und ist als Neurotransmitter an vielen Stellen des menschlichen Körpers wirksam: im ZNS, im Darmnervensystem, an cholinergen Synapsen des Parasympathikus und der präganglionären Sympathikusfasern und an den motorischen Endplatten. Als sog. Vaguswirkstoff wirkt es auf die Zielorgane des Parasympathikus mit unter anderem folgenden Effekten: Herzfrequenzverlangsamung, Blutdruckabfall, Kontraktion glatter Muskulatur (z.b. Blase, Pupille), Zunahme der Sekretion der Speichel-, Bronchial-, Darm- sowie der Schweißdrüsen. Eine Vergiftung mit ACh (meist als Autointoxikation, z.b. nach suizidaler Einnahme von Phosphorsäureestern, die als Hemmstoffe der AChabbauenden Acetylcholinesterase wirken) kann mit Atropin antagonisiert werden Noradrenalin Noradrenalin (NA) ist ein Hormon des Nebennierenmarks und ist wirksam als Neurotransmitter an den postganglionären Synapsen des sympathischen Nervensystems. Es zählt wie das Adrenalin zu den Katecholaminen, die auch Streßhormone genannt werden, da sie den Körper in einen Zustand erhöhter Leistungsfähigkeit versetzen. Durch unter anderem eine Verbesserung der Herzleistung, eine Erweiterung der Bronchien und einer Hemmung der bei Aktivität hinderlichen Darmtätigkeit werden so evolutionär gesehen Kampf- oder Fluchthandlungen möglich gemacht. Im Locus coeruleus, einer relativ kleinen, dunkelfarbigen Zellgruppe im Mittelhirn, wird ein Großteil des Noradrenalins des ZNS produziert. Therapeutisch wird es angewendet bei verschiedenen Formen des Schocks. Einleitung
17 Serotonin Serotonin, auch 5-Hydroxytryptamin (5-HT) genannt, ist ein Gewebshormon, das im Organismus aus Tryptophan entsteht, einer essentiellen Aminosäure, die in pflanzlichen und tierischen Geweben vorkommt und mit der Nahrung aufgenommen wird. Serotonin wird im Gehirn, in der Darmschleimhaut und in den Blutplättchen gespeichert. Aus Speichern freigesetztes Serotonin bindet an Serotoninrezeptoren, von denen es mindestens sieben verschiedene gibt. 5-HT ist wirksam als Neurotransmitter und hat je nach Rezeptorart unterschiedliche Wirkungen: Aus Blutplättchen freigesetztes Serotonin bewirkt lokal eine Gefäßverengung zur Blutstillung. In Skelettmuskeln sitzende Serotoninrezeptoren vermitteln eine Erweiterung der Arterien. Serotonin hemmt Magen- und Dickdarmbewegungen und fördert die Verdauungstätigkeit des Dünndarms. Inaktivierung und Abbau erfolgen durch Monoaminooxidasen und Aldehydoxidasen (zu Hydroxyindolessigsäure). Die größte Serotoninmenge findet man im Gehirn, wo es Stimmung, Schmerzwahrnehmung, Körpertemperatur, Nahrungsaufnahme und den Schlaf- Wach-Rhythmus beeinflusst. Mangel an Serotonin wird als eine der Hauptursachen für Depression und Angstzustände angesehen. Die Therapie dieser Erkrankungen erfolgt mit Substanzen, die den Serotoninspiegel an Rezeptoren im Gehirn erhöhen (Mutschler, 1996; Pschyrembel, 2002; Roche, 1999) Serotoninrezeptoren Die Serotoninrezeptoren sind nach ihren pharmakologischen Profilen, den cdnaabgeleiteten Primärsequenzen und ihren Signaltransduktionsmechanismen in sieben Klassen (Abb.5) eingeteilt. Mit Ausnahme des 5-HT 3 -Rezeptors, der einen ligandengesteuerten Ionenkanal darstellt, gehören alle 5-HT-Rezeptoren zur Superfamilie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren mit sieben transmembranären Domänen. In dieser Arbeit sind der 5-HT 1A - (und 5-HT 1B -) Rezeptor von besonderem Interesse. Dies sind inhibitorische Autorezeptoren mit spezifischer Verteilung auf dem Neuron: Die 5-HT 1A -Rezeptoren finden sich auf Soma und Dendriten, die 5- HT 1B -Rezeptoren auf den Endknöpfchen. Beide Rezeptoren (5-HT 1A - und 5-HT 1B - Rezeptor) sind G i -gekoppelt, das heißt ein Andocken von 5-HT führt durch die nachfolgende Signalkaskade zur Aktivierung eines einwärts gleichrichtenden K + - Kanals. Dies wiederum führt zur Hyperpolarisation und damit verminderten Einleitung
18 9 Erregbarkeit der neuronalen Zellmembran und damit zur Herabsetzung der Feuerungsrate des Neurons. Abb.5: Aktuelle Einteilung der Serotoninrezeptoren Rezeptortyp 5-HT 1 5-HT 2 5-HT 3 5-HT 4 5-HT 5 5-HT 6 5-HT 7 Effektor AC PLC Ionenkanal AC AC? AC AC (G i /G o ) (G q ) Na + /K + /Ca + (G S ) (G S ) (G S ) (G S ) Subtyp 5-HT 1A 5-HT 1B 5-HT 1D 5-HT 1E 5-HT 1F 5-HT 2A 5-HT 2B 5-HT 2C 5-HT 5A 5-HT 5B Die 5-HT 1A -Rezeptoren sitzen nur auf den Zellkörpern und nicht auf den Nervenendigungen der jeweiligen Neurone. Die Zellkörper der serotonergen Neuronen befinden sich in den Raphékernen, die in den Hippocampus projizieren. Daher sollten diese Rezeptoren somit nur in Tieren zu finden sein, die nach Läsion des serotonergen Systems auch eine Transplantation mit serotonergen Neuronen einschließlich deren Zellkörper erhielten. 1.8 Modell der 3,4-DAP evozierten Transmitterfreisetzung Die physiologische Transmitterfreisetzung wird im in vitro Modell meist mit der elektrisch evozierten Freisetzung als der bestuntersuchten Methode durchgeführt. Daneben gibt es im wesentlichen drei Formen der chemisch evozierten Freisetzung. Die Erhöhung der extrazellulären Kaliumkonzentration führt direkt zur Dauerdepolarisation der Nervenendigungen. Das Alkaloid Veratridin hemmt die Inaktivierung spannungsabhängiger Natriumkanäle und führt zu einer permanenten Depolarisation. In dieser Arbeit ist die Blockade von Kaliumkanälen durch 3,4-Diaminopyridin (3,4-3,4-DAP) die Grundlage der angewandten Methode. Das Modell der 3,4-DAP evozierten Transmitterfreisetzung wurde erstmals von (Huanget al., 1989) beschrieben. Durch die Blockade von Kaliumkanälen, die beim Ruhemembranpotential geöffnet sind, kommt es zu einer Depolarisation der Zellmembran und konsekutiv zu Auslösung spontaner repetitiver Aktionspotentiale. Dabei führt der Einstrom von Kalziumionen zur exozytotischen Freisetzung des Transmitters. Der Vorteil von 3,4-DAP liegt in einer physiologischeren Nachahmung Einleitung
19 10 des Depolarisationsablaufes, möglicherweise auch die Mechanismen der präsynaptischen Modulation betreffend, da es nicht zu synchronen Aktionspotentialen wie bei der Elektrostimulation oder zur Dauerdepolarisation wie bei der Veratridin induzierten Freisetzung führt (McMahonet al., 1991; Nichollset al., 1994). Aminopyridine weisen eine stimulatorische Wirkung auf das ZNS auf, die in Ruhelosigkeit, Schlaflosigkeit, Angstzuständen und einer Herabsetzung der Krampfschwelle (Glover, 1982; Paskov DS, 1986) ihren Ausdruck findet und ebenfalls auf eine Hemmung von Kaliumkanälen zurückzuführen ist (Cook, 1988; Rudy, 1988) Kaliumkanäle Das Ruhepotential erregbarer Zellen ist ein Diffusionspotential für durch die Membrankanäle permeable Ionen. In Ruhe überwiegt die Leitfähigkeit für Kalium, weshalb das Ruhepotential in erster Näherung von dem Konzentrationsgradienten für Kalium über die Membran bestimmt wird (Dudel, 1993). Die Leitfähigkeit der Membran für Kalium ist abhängig von der Anzahl offener oder aktivierter Kaliumkanäle. Kaliumleitfähigkeit und Verhältnis zwischen intra- und extrazellulärer Kaliumkonzentration beeinflussen das Membranpotential und damit die Erregbarkeit der Zelle entscheidend. In der Steuerung der neuronalen Erregbarkeit spielen Kaliumkanäle eine wichtige Rolle (Rudy, 1988). Die vielen verschiedenen Kanäle werden nach ihren Eigenschaften eingeteilt. Zum einen gibt es spannungsabhängige Kaliumkanäle, die durch eine Änderung des Membranpotentials aktiviert oder inaktiviert werden. Dahingegen werden Kalzium aktivierte Kaliumkanäle durch eine Erhöhung des intrazellulären Kalziums aktiviert, und rezeptorgekoppelte Kanäle werden durch die Aktivierung ihrer Rezeptoren gesteuert. Neben diesen drei Hauptgruppen gibt es noch weitere Arten von Kaliumkanälen, die durch andere Eigenschaften charakterisiert werden. 3,4-DAP blockt verschiedene K + -Kanäle in unterschiedlicher Ausprägung. Partiell blockiert wird der I A -Kanal, ein spannungsabhängiger auswärtsgerichteter (A) K + - Kanal, der sich durch die Eigenschaft der schnellen Aktivierung durch Depolarisation nach vorausgegangener Hyperpolarisation und durch eine schnelle Inaktivierung auszeichnet. Die Funktion des I A -Kanals ist die Unterdrückung und Verlangsamung Einleitung
20 11 repetitiver APs, die Erhaltung eines stabilen Membranpotentials und damit Regulation der neuronalen Erregbarkeit. Eine Aktivierung dieses Kanals führt zum K + -Ausstrom und damit zur Negativierung des Ruhepotentials. Die Erzeugung spontaner Aktionspotentiale durch 3,4-DAP wird über Blockade dieses Kanals erklärt. Nahezu vollständig wird der I D -Kanal geblockt, ein spannungsabhängiger K + -Kanal, der durch Depolarisation (D) schnell aktiviert und langsam inaktiviert wird. Seine Aktivierung führt zu einer Negativierung des Ruhepotentials. Wegen seiner langen Inaktivierungsdauer kommt ihm die Funktion der zeitlichen Integration und Summation afferenter depolarisierender Impulse zu. Nicht blockiert wird der I KV -Kanal, ein verzögert repolarisierender, spannungsabhängiger auswärtsgerichteter Kanal, der für die Repolarisation nach dem Aktionspotential zuständig ist ( der Kalium-Kanal des APs). 1.9 Klinische Anwendung von 3,4-DAP In der Klinik findet 3,4-DAP bei der Behandlung von Störungen der neuromuskulären Übertragung Anwendung. Das Lambert-Eaton-Syndrom ist eine Autoimmunkrankheit, bei der der Körper Autoantikörper gegen den spannungsabhängigen Kalziumkanal (VGCC= voltage gated calcium channel) der präsynaptischen Membran bildet, was schließlich die Ausschüttung von Acetylcholin vermindert und zu myasthenen Symptomen führt. 3,4-DAP wird hierbei als Therapeutikum verwendet, da es durch eine Erleichterung der synaptischen Transmission zu einer erhöhten Acetylcholinausschüttung kommt (Besinger, 1992). Der Botulismus ist eine Vergiftung, die nach dem Genuss verdorbener Lebensmittel auftreten kann. Dabei blockiert ein Bakterientoxin (Botulinumtoxin) die Exozytose der präsynaptischen Membranvesikel, was die Acetylcholinfreisetzung hemmt. Dadurch kommt es zu charakteristischen Lähmungserscheinungen, die sich ebenfalls durch die Gabe von 3,4-DAP bessern lassen (Besinger, 1992) Altersforschung Ein Teil der Altersforschung hat sich mit den Beziehungen zwischen Gedächtnisdefiziten und basalen Vorderhirndysfunktionen beschäftigt (Bartus, 2000). Das mediale Septum (MS), das diagonale Band von Broca (DBB) und der Nucleus Einleitung
21 12 basalis magnocellularis (NBM) sind cholinerge Kerne der Hirnregion, die den Hippocampus (MS und DBB) oder den Neokortex innervieren (NBM). All diese Systeme spielen bei Tieren eine Rolle in Bezug auf kognitive Funktionen (Baxteret al., 1999; Sarteret al., 1999) und unterliegen möglicherweise altersabhängigen Veränderungen (Bartus, 2000). Alte Ratten zeigen, wie Menschen, Beeinträchtigungen im Lernen und bei Gedächtnisaufgaben (Gallagheret al., 1988; van der Staayet al., 1993) und es ist wieder wie beim Menschen- bekannt, dass diese Beeinträchtigungen in einer Population heterogen verteilt sind (Gallagheret al., 1989; Stemmelinet al., 2000), was auf unterschiedliche Grade der Hirnveränderungen hinweist. Die neurobiologische Grundlage für letzteres ist nach wie vor unklar Fragestellungen der einzelnen Teile der vorliegenden Arbeit Teil A - Kortex Francis und Mitarbeiter schlugen 1999 vor, dass kognitive Beeinträchtigungen bei Alzheimerpatienten möglicherweise auf einer Depression des exzitatorischen Tonus im Kortex beruhen. Dieser verminderte Tonus resultiere aus einer Degeneration pyramidaler Neurone und cholinerger Afferenzen, welche exzitatorischer Natur sind, während die inhibitorischen serotonergen Afferenzen relativ erhalten seien. Bei Betrachtung der Referenzgedächtnisleistungen der Ratten im MWM (siehe 2.4) zeigte eine Gruppenanalyse (Ghirardiet al., 1992b) verschiedene Subpopulationen alter Ratten (25-27 Monate) mit normalen, mäßig oder schwer beeinträchtigten kognitiven Fähigkeiten. Auf dem von (Franciset al., 1999) vorgeschlagenen theoretischen Hintergrund sollte die vorliegende Arbeit die evozierte Freisetzung von Acetylcholin, Serotonin, aber auch Noradrenalin in Schnitten des frontoparietalen Kortex alter Ratten im Vergleich zu jungen adulten Tieren (3-5 Monate) untersuchen. Die Schnitte wurden mit [³H]Cholin, [³H]Serotonin oder [³H]Noradrenalin vorbeladen. Die Freisetzung der Neurotransmitter sollte durch die Zugabe von 3,4-DAP evoziert werden. Solche Stimulationsbedingungen wurden bisher selten benutzt, um die Freisetzung von 5-HT (Schechter, 1997) oder anderen Transmittern hervorzurufen. Daher war das Ziel des ersten Schrittes zu zeigen, dass diese Freisetzung Kalzium-abhängig und Einleitung
22 13 Tetrodotoxin (TTX)-sensitiv war. Damit sollte ein physiologischer Mechanismus der Transmitterfreisetzung nachgewiesen werden Teil B Hippocampus In einer Studie (Birthelmeret al., 2003a), bei der eine Superfusionstechnik mit elektrischer Stimulation von Hippocampusschnitten angewandt wurde, fand man heraus, dass gealterte Ratten (25-27 Monate) im Vergleich zu jungen adulten Tieren (3-5 Monate) eine verminderte Akkumulation von [ 3 H]Cholin und [ 3 H]5-HT, eine erhöhte Akkumulation von [ 3 H]NA, und eine schwächere evozierte Freisetzung von sowohl [ 3 H]ACh als auch [ 3 H]5-HT aufwiesen. Die ChAT oder AChE Aktivität wie auch die 5-HT- Konzentration waren in Hippocampushomogenaten alter Ratten nicht signifikant verändert, die Konzentration von NA war vermindert. Diese altersabhängigen Veränderungen zeigten jedoch keine Beziehung zum Ausmaß der Defizite des räumlichen Referenzgedächtnisses, welches man im Wasserlabyrinth (siehe 2.4) erfasst hatte. Daher sollte in der vorliegenden Arbeit die Experimente von (Birthelmer et al., 2003a) an einer anderen Rattengruppe wiederholt werden, aber unter Verwendung von 3,4-DAP zur Stimulation der Transmitterfreisetzung. Es wurde dabei auch vermutet, dass mit dieser Technik auch altersabhängige Veränderungen der Dichte präsynaptischer K + -Kanäle in der neuronalen Erregbarkeit nachweisbar sind. Mit Hilfe dieser Methode wurden schon in der Vergangenheit neuropharmakologische Modulationsmechanismen gezeigt, die mit der elektrischen Stimulation nicht nachgewiesen werden konnten (Lauthet al., 1995; Schweizeret al., 2002). Daher erwarteten wir feinere altersabhängige Veränderungen erfassen zu können, die durch die elektrische Stimulation möglicherweise überlagert wurden Teil C - Serotonerge Läsion/ Transplantation Die hippocampale Denervation wurde oft benutzt, um die funktionalen Eigenschaften intrahippocampaler Transplantate, die serotonerge Neurone enthalten, zu untersuchen (Casselet al., 1997). Diese Studien ermöglichten die Charakterisierung von sich aus dem Transplantat ableitenden Funktionen auf verschiedenen Ebenen der Gehirn- und Verhaltensanalyse, einschließlich der Transmitterfreisetzung. Nach aspirativen Läsionen der Fimbria-Fornix und anschließenden Transplantaten von nur fetalen serotonergen Neuronen fand sich, dass 5-HT 1B -Autorezeptoren auf Einleitung
23 14 den vom Transplantat stammenden serotonergen Terminalen normal funktionierten (Suhret al., 1999). Des weiteren stellte sich die Frage, ob die Serotoninfreisetzung transplantierter Neurone auf die Aktivierung von 5-HT 1A -Rezeptoren empfindlich reagieren würde. Solche Rezeptoren kommen auf serotonergen Terminalen im Hippocampus nicht vor (s ). Ihre Anwesenheit war jedoch auf transplantierten Neuronen zu erwarten, da sie auf den Dendriten und Zellkörpern serotonerger Raphé Neurone zu finden sind (Chalmerset al., 1991). Es fand sich aber bisher kein Beweis für ein Vorkommen 5-HT 1A -vermittelter Modulation der 5-HT-Freisetzung in superfundierten elektrisch stimulierten Hippocampusschnitten ((Suhr et al., 1999)). Es gab jedoch zwei Probleme in der Studie von (Suhr et al., 1999). Zum einen mangelte es der Schädigung aufgrund der Läsionstechnik an neurochemischer Selektivität, wodurch die Effekte möglicherweise durch Änderungen anderer Transmittersysteme verwischt wurden. Die Verwendung der elektrischen Stimulation bewirkte andererseits, dass eine Hemmung der Freisetzung durch das Ansprechen dendritischer und somatischer 5- HT 1A -Rezeptoren möglicherweise durch den vorherrschenden Einfluss der Stimulation der zahlenmäßig überlegenen serotonergen Terminalen überdeckt wurde. Es kommt hinzu, dass somatodendritische 5-HT 1A -Rezeptoren die Feuerrate serotonerger Neurone im Sinne einer Reduktion modulieren (Sprouseet al., 1987) und damit auch die Freisetzung von 5-HT an den Axonterminalen. Dadurch kann ihre Aktivität nicht so einfach mit Stimulationsparadigmen nachgewiesen werden, bei denen den Hirnschnitten extrinsische elektrische Felder mit aufgezwungener Frequenz zugeführt werden. In der vorliegenden Arbeit sollten daher serotonerge Transplantate nach 5,7- Dihydroxytryptamin (5,7-DHT) (und damit selektiver) Läsion aszendierender serotonerger Neurone verwendet werden, und weiterhin die Freisetzung von 5-HT durch Applikation von 3,4-Diaminopyridin evoziert werden. Der erste Schritt hatte wiederum den Nachweis zum Ziel, dass diese Freisetzung Kalzium-abhängig, TTXsensitiv und durch Substanzen modulierbar war, die am 5-HT 1B -Autorezeptor (Viziet al., 1998) angreifen. Erst im zweiten Schritt waren die Charakterisierung der Effekte der 5,7-DHT Läsionen und der serotonergen Transplantationen auf die Akkumulation, die basale Einleitung
24 15 und 3,4-DAP evozierte Freisetzung von [³H]5-HT als Gegenstand der Untersuchung vorgesehen. Weiterhin sollte diese Freisetzung in Gegenwart des 5-HT 1A -Agonisten, 8-OH-DPAT gemessen werden Zusammenfassende Darstellung der Fragestellung Aminopyridine führen zu einer Transmitterfreisetzung aus neuronalem Gewebe. Die 3,4-DAP evozierte Freisetzung von NA in Hippocampusschnitten der Ratte und des Kaninchens erwies sich schon in der Vergangenheit als ein geeignetes Modell zur physiologischen Transmitterfreisetzung (Huanget al., 1991; Huang et al., 1989; Jackischet al., 1992). Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der 3,4-DAP induzierten Freisetzung von Noradrenalin und zweier weiterer Transmitter, Serotonin und Acetylcholin, in Schnitten des Hippocampus und des Kortex der Ratte. Die durchgeführten Untersuchungen orientierten sich an den bereits formulierten, aber auch an folgenden übergeordneten Fragestellungen. 1. Wie ist der Mechanismus der 3,4-DAP evozierten Freisetzung : Sind spannungsabhängige Natriumkanäle an der 3,4-DAP induzierten Freisetzung beteiligt? Welche Rolle spielt die extrazelluläre Kalziumkonzentration? 2. Gibt es eine Korrelation zwischen den Leistungen alter Ratten im Morris- Wasserlabyrinth und dem Ausmaß der Freisetzung der Neurotransmitter Serotonin, Noradrenalin und Acetylcholin in Hippocampus und Kortex bei diesen Tieren? 3. Lassen sich bei Ratten mit spezifischer Läsion des serotonergen Systems und anschließender intrahippocampaler Transplantation von Zellsuspensionen reich an serotonergen Neuronen 5-HT 1A -Rezeptoren im Hippocampus nachweisen? Einleitung
25 16 2 Material und Methoden 2.1 Chemikalien und Substanzen Die Bezugsquellen der in den Experimenten eingesetzten Substanzen sind untenstehenden Aufstellungen zu entnehmen. Alle Substanzen wurden unmittelbar vor den Versuchen entweder in bidestilliertem Wasser (Milli-Q Biocell ; Filter: Millipak 40, 0,22 µm, Millipore, Großbritannien) oder in modifiziertem Krebs-Henseleit Puffermedium (vergleiche 2.6.1) gelöst. Sonstige Chemikalien wurden, soweit nicht anderweitig aufgeführt, von MERCK, Deutschland erworben Übersicht über die in den Experimenten eingesetzten Pharmaka und deren Herkunft Tabelle 1 Substanz Molekulargewicht Bezugsquelle Wiederaufnahmehemmer [g/mol] Desipramin Hydrochlorid 302,8 Sigma, Deutschland Hemicholinium-3 574,4 Chemcon, Deutschland 6-Nitroquipazin 374,4 Sigma, Deutschland (6-Nitro-2-(1-piperazinyl)-quinolin) Rezeptorliganden Atropin 695 Sigma, USA CP 93, Pfizer Inc., USA (3-(1,2,5,6-tetrahydropyrid-4-yl)pyrollo[3,2b]pyrid-5-on) Methiotepin Mesylat 452,6 Sigma, Deutschland R(+)-8-OH-DPAT 328,3 RBI Biotrend, USA ((R(+)-8-Hydroxy-2-n-propylamino)tetralin HBr) Oxotremorin Sesquifumarat 380,4 Sigma, Deutschland Physostigmin Hemisulfat 324,4 Sigma, Deutschland UK 14, ,2 Pfizer, UK (5-bromo-6-(2-imidazolin-2-ylamino)-quinoxalin Tartrat) Andere 3,4-Diaminopyridin (3,4-DAP) 109,1 Sigma, St.Louis, USA Tetrodotoxin (TTX) 319,3 Sigma, USA Material & Methoden
26 Übersicht über die in den Experimenten eingesetzten radioaktiven Stoffe und deren Herkunft Tabelle 2 Substanz Spezifische Aktivität Bezugsquelle [Ci/ mmol] [ 14 C]Acetyl Coenzym A 52 Amersham-Pharmacia, Deutschland [ 3 H]Methyl-Cholin Chlorid 79; 82 Amersham-Pharmacia, Deutschland [ 3 H]5-HT 21,8; 25,5 NEN Life Sciences, 5-[1,2-3 H(N)]Hydroxytryptamin Kreatinin Sulfat Deutschland [ 3 H]Norepinephrin 55; 56,4 Amersham 2.2 Versuchstiere Alle Vorgänge, an denen Tiere beteiligt waren, wurden in Konformität mit institutionellen Richtlinien durchgeführt (NIH Publikation n 80-23, 1996 überarbeitet). Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um in Hinblick auf statistische Beschränkungen so wenig Tiere wie möglich zu opfern und um ein Leiden während der Experimente so gering wie möglich zu halten. Abb. 6: Long Evans Ratte Material & Methoden
27 Alte Ratten/ Kortex (im Folgenden Teil A) Für den ersten Versuchsteil (Validierung des 3,4-DAP evozierten Freisetzungsmodells) wurden acht unversehrte weibliche Long-Evans Ratten im Alter von etwa 12 Monaten verwendet (R. Janvier, Frankreich). Im zweiten Teil (Alterseffekte) wurden acht junge adulte (3-5 Monate) und 24 alte (25-27 Monate) weibliche Long-Evans Ratten verwendet (gleicher Lieferant). Die alten Ratten erreichten das Labor im Alter von 3 Monaten. Vor dem Training im MWM wurden die Ratten des zweiten Experiments zu dritt in einem Käfig untergebracht (42 x 26 x 15 cm) mit Futter und Wasser ad libitum. Die Kolonie und der Übungsraum waren einem 12 Stunden Tag-Nacht-Rhythmus (Licht an um 7 Uhr morgens) mit kontrollierter Temperatur (22 C) unterworfen. Die jungen Ratten erreichten das Labor im Alter von 2,5 Monaten. Diese wurden zwei Wochen zu sechst untergebracht, zur Testung im MWM dann zu dritt pro Käfig Alte Ratten/ Hippocampus (im Folgenden Teil B) Im ersten Teil der Experimente (Validierung der 3,4-DAP evozierten Freisetzung von ACh) wurde eine weibliche Long-Evans Ratte im Alter von ca. 12 Monaten verwendet. Die 3,4-DAP evozierte Freisetzung von [³H]NA und [³H]5-HT in Hippocampusschnitten wurde in früheren Experimenten bereits validiert. Für den zweiten Teil der Versuchsreihe (Alterseffekt) wurden 10 junge adulte (3-5 Monate) und 20 alte (25-27 Monate) weibliche Long-Evans Ratten verwendet (Lieferant s. Teil A). Alter der Ratten bei Ankunft im Labor und Unterbringung siehe Serotonerge Läsion/ Transplantation (im Folgenden Teil C) Für den ersten Versuchsteil (Validierung des 3,4-DAP evozierten Freisetzungsmodells) wurden acht unversehrte männliche Long-Evans Ratten im Alter von etwa 3 Monaten verwendet (R. Janvier, Frankreich). Im zweiten Teil (Läsion/ Transplantation) wurden 25 männliche Long-Evans Ratten verwendet, die zum Zeitpunkt der Operation 3 Monate alt waren (gleicher Lieferant). Bis zur Tötung oder zur OP waren alle Ratten einzeln in transparenten Makrolon Käfigen (42 x 26 x 15 cm) untergebracht. Die Tiere waren einem 12 Stunden Tag- Material & Methoden
28 19 Nacht-Rhythmus (Licht an um 7 Uhr morgens) bei konstanten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen unterworfen. Futter und Wasser standen ad libitum zur Verfügung. Drei Tage nach der OP (Exp.2) wurden die Ratten in Gruppen von vier oder fünf pro Käfig zusammengefasst (59 x 38 x 20 cm) 2.3 Läsion und Transplantation Alle Läsions- und Transplantationsoperationen wurden in dem verhaltenspsychologischen Labor in Straßburg unter der Leitung von Jean- Christophe Cassel durchgeführt. Im Zuge der zu Grunde liegenden Arbeit bedienten wir uns eines Läsions- Transplantationsmodells, um Pathologien wie die Alzheimer sche Erkrankung und Altersdemenz im Tiermodell nachzuahmen und daraufhin Veränderungen in verschiedenen Transmittersystemen und eventuelle Rezeptormodulationen untersuchen zu können. Im Gegensatz zu früheren Arbeiten in diesem Labor wurden den Tieren diese Läsionen nicht mechanisch (aspirative (Balseet al., 1999) oder elektrolytische Läsion) beigebracht, sondern mit Hilfe von Neurotoxinen, die spezifisch einzelne Transmittersysteme (serotonerges System) schädigen sollten. Das hier verwendete Neurotoxin war 5,7-Dihydroxytryptamin (5,7-DHT), das von den serotonergen Zellen via Wiederaufnahme inkorporiert wird und über nicht ganz geklärte Mechanismen zum oxidativen Zelltod führt. 5,7-DHT wird auch von noradrenergen Neuronen aufgenommen, deshalb wurden diese zuvor durch Desipramin (einen Wiederaufnahmehemmer) geschützt Intrazerebroventrikuläre Läsion mit 5,7-DHT und anschließende intrahippocampale Transplantation von Zellsuspensionen reich an serotonergen Neuronen Läsion Sämtliche chirurgischen Schritte wurden unter aseptischen Bedingungen durchgeführt. Für die Studie wurden insgesamt 25 männliche Long-Evans Ratten verwendet. Im Alter von ca. 90 Tagen (Gewicht 358 ± 4,7 g) wurden die Ratten unter Narkose operiert und die spezifischen Läsionen mit 5,7-DHT durchgeführt. Zur Material & Methoden
29 20 Anästhesie der Tiere wurde eine Mischung aus Xylazin und Ketamin verwendet (0,85 mg/kg und respektive 6,38 mg/kg, intraperitoneal (i.p.)). 17 Ratten wurde insgesamt 150 µg freie Base 5,7-DHT (Kreatininsulfat; 338 µg gelöst in 20 µl physiologischer Kochsalzlösung, welche 0,02 mg/ml Ascorbinsäure enthielt, Sigma) in die lateralen Ventrikel injiziert, d.h. 75 µg 5,7-DHT pro Seite. Die Injektionen wurden stereotaktisch mit einer 10 µl Hamilton Spritze durchgeführt. Die Koordinaten waren (in mm vom Bregma, Schneidezahnlinie 3,3 mm unterhalb der interauralen Linie (Paxinoset al., 1986)): A = - 0,8; L = ± 1,4; V = 4,3. Nach jeder Injektion wurde die Nadel für fünf Minuten in situ belassen, 2 mm zurückgezogen und nach einer zweiten Verzögerung von 4 Minuten komplett aus dem Injektionsgebiet zurückgezogen. Alle Ratten, die dieser Läsion unterzogen wurden, erhielten 20 Minuten vor der Narkose eine Injektion mit Desipramin (25 mg/kg), um das noradrenerge System zu schützen (MacDonaldet al., 1993). 8 Ratten dienten zur Kontrolle. Sie wurden der gleichen Prozedur unterzogen, also schein-operiert (SHAM), jedoch wurde anstatt 5,7 DHT nur dessen Lösungsmittel (physiologische Kochsalzlösung) injiziert Transplantation von Zellsuspensionen reich an serotonergen Neuronen Die zur Transplantation vorgesehenen Zellen wurden aus den Gehirnen von 13 Tage alten Long-Evans Feten präpariert (ED ( embryonic day ) 13, durchschnittliche Schädelsteißlänge = 12,5 mm) Herstellung der Zellsuspension Die Technik zur Präparation der mesenzephalen Raphé, einem Gewebe reich an serotonergen Neuronen, wurde durchgeführt wie beschrieben durch (Dunnettet al., 1992). Die entnommenen Gewebestücke wurden in steriler, glykolisierter (0,6 %) physiologischer Kochsalzlösung bis zum Ende der Präparation gesammelt. Dann wurden sie in eine 0,1 %-Trypsinlösung (Sigma, USA; Grad II, in 0,6 % Glucose- Kochsalzlösung) überführt und dort für 30 min bei 37 C und 5 % CO 2 inkubiert. Durch dreimaliges Waschen der Gewebeteile mit jeweils 5 ml der 0,6 % Glucose- Kochsalzlösung wurde das Inkubationsmedium entfernt. Anschließend erfolgte mit dieser Lösung die Auffüllung auf die Endvolumina von 20 µl pro serotonergem Gewebestück. Langsames Ansaugen und Evakuieren mit Hilfe einer feuerpolierten Material & Methoden
30 21 Pasteurpipette dissoziierte die Präparate zu einer gleichmäßig milchig trüben Suspension Zahl transplantierter Zellen und Bestimmung deren Viabilität Die Zellzahl betrug Zellen/ µl, von denen 90 % intakt waren. Die Zahl der intakten Zellen blieb 3,5 Stunden nach der Präparation der Suspension relativ konstant. Die Zellsuspension wurde innerhalb von maximal 2,5 Stunden genutzt. Die Menge injizierter Zellen wurde auf Zellen/ µl beschränkt, da in früheren Experimenten Suspensionstransplantate mit größeren Zellzahlen ein enormes Reinnervierungspotenzial besaßen und die läsionsinduzierten neurochemischen Defizite stark überkompensierten (Balse et al., 1999; Jeltschet al., 1994) Injektion der Zellsuspension Zwei Wochen nach der Läsion erhielten acht der zuvor 17 läsionierten Ratten bilaterale intrahippocampale Transplantate der oben beschriebenen Zellsuspension. Die verbliebenen neun Tiere dieser Gruppe erhielten Scheintransplantationen, in denen sie statt der Zellsuspension beidseits eine intrahippocampale Injektion einer 0,6 %igen Glucose-Kochsalzlösung erhielten, die keine Zellen enthielt. Die acht Kontrollratten erhielten ebenfalls diese Scheintransplantatoperation. Die Injektionen (2 µl/ Injektionsstelle, 1 µl/ min) der hergestellten Zellsuspension wurden stereotaktisch mit Hilfe einer 10 µl Hamiltonspritze an zwei Punkten in den dorsalen Hippocampus durchgeführt. Die Koordinaten für die Injektionen waren wie folgt (in mm von Lambda): A = 3,7; L = ± 1,8; V = -3,6 und A = 2,8; L = ± 2,6; V = -3,4 (Paxinos et al., 1986). Die Spritze wurde nach der Injektion für zwei Minuten in situ belassen. 10,5 bis 11,5 Monate nach der Transplantationsoperation wurden die Ratten dekapitiert und ihr Gehirn wurde wie in 2.5 beschrieben behandelt. Material & Methoden
31 22 Abb. 8: David Kopf stereotaktisches Instrument Die Abbildung zeigt ein stereotaktisches Instrument, das 1963 von David Kopf entwickelt wurde. Mit dessen Hilfe können die Injektionen der Neurotoxine oder der fetalen Zellsuspensionen exakt platziert werden. Das Instrument besteht aus einem stabilen U - Rahmen. Am Manipulator sind Stellschrauben, die es erlauben, die eingelegte Spritze befüllt mit dem Neurotoxin 80 mm in der vertikalen, lateral und in der in A-und P- (anterior und posterior) Ebene zu bewegen. Jede Ebene besitzt eine 0,1 mm Feineinstellung. Abb. 9: Orientierungspunkte zur stereotaktischen Injektion von Neurotoxinen bei der Ratte Rand der Kopfhautinzision Lambda Koronarnaht Sagittal - naht Bregma Beispiel für Bohrlöcher, in die die Injektionsnadel eingeführt wird Material & Methoden
32 Morris-Water-Maze In einigen Studien der vorliegenden Arbeit wurden den in diesem Labor ermittelten Daten Ergebnisse aus der Verhaltensforschung gegenübergestellt und mit den neuropharmakologischen bzw. neurochemischen Daten in Zusammenhang gebracht. Dieser Teil der Experimente wurde in dem verhaltenspsychologischen Labor in Straßburg (LN2C, UMR 7521, CNRS/ Université Louis Pasteur, 12 rue Goethe, F Strasbourg, France) unter der Leitung von Jean-Christophe Cassel durchgeführt Die Versuchsanlage Das Morris Wasserlabyrinth ( Morris-Water-Maze = MWM; Abb.7) ist eine der am häufigsten benutzten Methoden in der Verhaltensforschung der Neurobiologie und Neuropharmakologie. Mit ihrer Hilfe werden Veränderungen des räumlichen Lernens und Gedächtnisses gemessen. Sie wird ebenfalls für die Bewertung von Tiermodellen für neurokognitive Fehlsteuerungen eingesetzt. Das MWM wurde das erste Mal vor gut zwanzig Jahren als eine Methode beschrieben, räumliches Lernen und Gedächtnis von Laborratten zu untersuchen (Morris, 1981). Es besteht aus einem kreisförmigen Becken, das mit Wasser gefüllt ist. Das Wasser ist durch Milchpulver getrübt. In dem Becken befindet sich weiterhin eine ein Zentimeter unter der Wasseroberfläche verborgene Plattform, die als Zufluchtspunkt für die Ratte dient. Während einer Reihe von Trainingsläufen erlernen die Tiere, die Plattform zu finden und aus dem auf 20 C temperierten Wasser zu entkommen. Das Ziel des Tieres ist es also, auf dem direkt möglichsten Wege die Plattform zu erreichen. Die Lösung dieser Aufgabe hängt sehr stark von der Fähigkeit des Tieres ab, sich eine kognitive Karte der Umgebung zu erstellen und diese mit Hilfe von umgebenden Orientierungspunkten zu ermitteln, die außerhalb des Beckens angeordnet sind. In diesem Test ist die Motivation aversiv, das heißt, das Versuchstier will sich aus einer bedrängenden Situation befreien. Material & Methoden
33 Training und Quantifizierung Während des Trainings wird das Versuchstier wiederholt in das Becken gesetzt und muss lernen, aus dem Wasser zu entkommen, indem es die ein Zentimeter unter der Wasseroberfläche versteckte Plattform lokalisiert. Jede Ratte wurde an fünf Tagen mit vier aufeinanderfolgenden Trainingsläufen gemäß eines Standardprotokolls getestet. Für jeden Trainingslauf wurde die Ratte an einem zufällig ausgewählten Startpunkt mit dem Gesicht zur Wand des Beckens in dieses eingesetzt, von dem sie dann losgelassen wurde. Sie bekam 60 Sekunden Zeit, die Plattform zu finden, die sich immer an der gleichen Position befand. Wenn die Ratte die Plattform gefunden hatte, wurde sie dort für 10 Sekunden belassen und dann erneut in das Becken gesetzt. Wenn die Ratte die Plattform nicht rechtzeitig gefunden hatte, wurde sie von dem Experimentator nach 60 Sekunden auf die Plattform gesetzt und ebenfalls für 10 Sekunden dort belassen. Die geschwommenen Wege wurden durch ein Video-Aufzeichnungssystem (Ethovision, Noldus, Niederlande) registriert. Abb. 7 : Das Morris Wasserlabyrinth Versteckte Plattform Wasserbecken Vor dem Training Nach dem Training Schematische Darstellung des Morris Wasserlabyrinths. Das Becken hat einen Durchmesser von 160 cm und eine Höhe von 60 cm. Der Durchmesser der (bei uns kreisförmigen) Plattform beträgt 11 cm. 180 cm über der Mitte des Beckens wird der Raum durch ein Neonlicht beleuchtet. Die Wassertemperatur beträgt 20 C. Das Versuchstier wird an verschiedenen Stellen des Beckens eingesetzt und muss von diesen Startpunkten aus die versteckte Plattform finden lernen. Als Orientierungshilfe dienen Gegenstände, die außerhalb des Labyrinths im Testraum verteilt sind. Material & Methoden
Erregungsübertragung an Synapsen. 1. Einleitung. 2. Schnelle synaptische Erregung. Biopsychologie WiSe Erregungsübertragung an Synapsen
 Erregungsübertragung an Synapsen 1. Einleitung 2. Schnelle synaptische Übertragung 3. Schnelle synaptische Hemmung chemische 4. Desaktivierung der synaptischen Übertragung Synapsen 5. Rezeptoren 6. Langsame
Erregungsübertragung an Synapsen 1. Einleitung 2. Schnelle synaptische Übertragung 3. Schnelle synaptische Hemmung chemische 4. Desaktivierung der synaptischen Übertragung Synapsen 5. Rezeptoren 6. Langsame
neurologische Grundlagen Version 1.3
 neurologische Grundlagen Version 1.3 ÜBERBLICK: Neurone, Synapsen, Neurotransmitter Neurologische Grundlagen Zentrale Vegetatives Peripheres Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn
neurologische Grundlagen Version 1.3 ÜBERBLICK: Neurone, Synapsen, Neurotransmitter Neurologische Grundlagen Zentrale Vegetatives Peripheres Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn
neurologische Grundlagen Version 1.3
 neurologische Version 1.3 ÜBERBLICK: Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn Rückenmark PNS VNS Hirnnerven Sympathicus Spinalnerven Parasympathicus 1 ÜBERBLICK: Neurone = Nervenzellen
neurologische Version 1.3 ÜBERBLICK: Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn Rückenmark PNS VNS Hirnnerven Sympathicus Spinalnerven Parasympathicus 1 ÜBERBLICK: Neurone = Nervenzellen
Synaptische Transmission
 Synaptische Transmission Wie lösen APe, die an den Endknöpfchen der Axone ankommen, die Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt aus (chemische Signalübertragung)? 5 wichtige Aspekte:
Synaptische Transmission Wie lösen APe, die an den Endknöpfchen der Axone ankommen, die Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt aus (chemische Signalübertragung)? 5 wichtige Aspekte:
BK07_Vorlesung Physiologie. 05. November 2012
 BK07_Vorlesung Physiologie 05. November 2012 Stichpunkte zur Vorlesung 1 Aktionspotenziale = Spikes Im erregbaren Gewebe werden Informationen in Form von Aktions-potenzialen (Spikes) übertragen Aktionspotenziale
BK07_Vorlesung Physiologie 05. November 2012 Stichpunkte zur Vorlesung 1 Aktionspotenziale = Spikes Im erregbaren Gewebe werden Informationen in Form von Aktions-potenzialen (Spikes) übertragen Aktionspotenziale
1 Bau von Nervenzellen
 Neurophysiologie 1 Bau von Nervenzellen Die funktionelle Einheit des Nervensystems bezeichnet man als Nervenzelle. Dendrit Zellkörper = Soma Zelllkern Axon Ranvier scher Schnürring Schwann sche Hüllzelle
Neurophysiologie 1 Bau von Nervenzellen Die funktionelle Einheit des Nervensystems bezeichnet man als Nervenzelle. Dendrit Zellkörper = Soma Zelllkern Axon Ranvier scher Schnürring Schwann sche Hüllzelle
Biopsychologie als Neurowissenschaft Evolutionäre Grundlagen Genetische Grundlagen Mikroanatomie des NS
 1 1 25.10.06 Biopsychologie als Neurowissenschaft 2 8.11.06 Evolutionäre Grundlagen 3 15.11.06 Genetische Grundlagen 4 22.11.06 Mikroanatomie des NS 5 29.11.06 Makroanatomie des NS: 6 06.12.06 Erregungsleitung
1 1 25.10.06 Biopsychologie als Neurowissenschaft 2 8.11.06 Evolutionäre Grundlagen 3 15.11.06 Genetische Grundlagen 4 22.11.06 Mikroanatomie des NS 5 29.11.06 Makroanatomie des NS: 6 06.12.06 Erregungsleitung
Transmitterstoff erforderlich. und Tremor. Potenziale bewirken die Erregungsübertragung zwischen den Nervenzellen. Begriffen
 4 Kapitel 2 Nervensystem 2 Nervensystem Neurophysiologische Grundlagen 2.1 Bitte ergänzen Sie den folgenden Text mit den unten aufgeführten Begriffen Das Nervensystem besteht aus 2 Komponenten, dem und
4 Kapitel 2 Nervensystem 2 Nervensystem Neurophysiologische Grundlagen 2.1 Bitte ergänzen Sie den folgenden Text mit den unten aufgeführten Begriffen Das Nervensystem besteht aus 2 Komponenten, dem und
Übertragung zwischen einzelnen Nervenzellen: Synapsen
 Übertragung zwischen einzelnen Nervenzellen: Synapsen Kontaktpunkt zwischen zwei Nervenzellen oder zwischen Nervenzelle und Zielzelle (z.b. Muskelfaser) Synapse besteht aus präsynaptischen Anteil (sendendes
Übertragung zwischen einzelnen Nervenzellen: Synapsen Kontaktpunkt zwischen zwei Nervenzellen oder zwischen Nervenzelle und Zielzelle (z.b. Muskelfaser) Synapse besteht aus präsynaptischen Anteil (sendendes
M 3. Informationsübermittlung im Körper. D i e N e r v e n z e l l e a l s B a s i s e i n h e i t. im Überblick
 M 3 Informationsübermittlung im Körper D i e N e r v e n z e l l e a l s B a s i s e i n h e i t im Überblick Beabeablog 2010 N e r v e n z e l l e n ( = Neurone ) sind auf die Weiterleitung von Informationen
M 3 Informationsübermittlung im Körper D i e N e r v e n z e l l e a l s B a s i s e i n h e i t im Überblick Beabeablog 2010 N e r v e n z e l l e n ( = Neurone ) sind auf die Weiterleitung von Informationen
Neuronale Grundlagen bei ADHD. (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung. Dr. Lutz Erik Koch
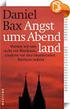 Neuronale Grundlagen bei ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung Dr. Lutz Erik Koch Die Verschreibung von Ritalin bleibt kontrovers Jeden Tag bekommen Millionen von
Neuronale Grundlagen bei ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung Dr. Lutz Erik Koch Die Verschreibung von Ritalin bleibt kontrovers Jeden Tag bekommen Millionen von
Passive und aktive elektrische Membraneigenschaften
 Aktionspotential Passive und aktive elektrische Membraneigenschaften V m (mv) 20 Overshoot Aktionspotential (Spike) V m Membran potential 0-20 -40 Anstiegsphase (Depolarisation) aktive Antwort t (ms) Repolarisation
Aktionspotential Passive und aktive elektrische Membraneigenschaften V m (mv) 20 Overshoot Aktionspotential (Spike) V m Membran potential 0-20 -40 Anstiegsphase (Depolarisation) aktive Antwort t (ms) Repolarisation
Wissen. Demenz Was ist das?
 19 Wissen Demenz Was ist das? Demenz Wie häufig tritt sie auf? Demenz Welche Formen sind bekannt? Demenz Welche Phasen gibt es? Demenz Wie kommt der Arzt zu einer Diagnose? Demenz Welche Therapien gibt
19 Wissen Demenz Was ist das? Demenz Wie häufig tritt sie auf? Demenz Welche Formen sind bekannt? Demenz Welche Phasen gibt es? Demenz Wie kommt der Arzt zu einer Diagnose? Demenz Welche Therapien gibt
Entdeckungen unter der Schädeldecke. Jean-Marc Fritschy Institut für Pharmakologie und Toxikologie
 Entdeckungen unter der Schädeldecke Jean-Marc Fritschy Institut für Pharmakologie und Toxikologie Inhalt 1. GFP, das Wunderprotein 2. Die Nervenzellen bei der Arbeit beobachten 3. Nervenzellen mit Licht
Entdeckungen unter der Schädeldecke Jean-Marc Fritschy Institut für Pharmakologie und Toxikologie Inhalt 1. GFP, das Wunderprotein 2. Die Nervenzellen bei der Arbeit beobachten 3. Nervenzellen mit Licht
Matthias Birnstiel Modul Nervensystem Medizinisch wissenschaftlicher Lehrgang Wissenschaftliche Lehrmittel, Medien, Aus- und Weiterbildung
 Matthias Birnstiel Modul Nervensystem Medizinisch wissenschaftlicher Lehrgang CHRISANA Wissenschaftliche Lehrmittel, Medien, Aus- und Weiterbildung Inhaltsverzeichnis des Moduls Nervensystem Anatomie des
Matthias Birnstiel Modul Nervensystem Medizinisch wissenschaftlicher Lehrgang CHRISANA Wissenschaftliche Lehrmittel, Medien, Aus- und Weiterbildung Inhaltsverzeichnis des Moduls Nervensystem Anatomie des
Second Messenger keine camp, cgmp, Phospholipidhydrolyse (Prozess) Aminosäuren (Glutamat, Aspartat; GABA, Glycin),
 Neurotransmitter 1. Einleitung 2. Unterscheidung schneller und langsamer Neurotransmitter 3. Schnelle Neurotransmitter 4. Acetylcholin schneller und langsamer Neurotransmitter 5. Langsame Neurotransmitter
Neurotransmitter 1. Einleitung 2. Unterscheidung schneller und langsamer Neurotransmitter 3. Schnelle Neurotransmitter 4. Acetylcholin schneller und langsamer Neurotransmitter 5. Langsame Neurotransmitter
Zentrales Nervensystem
 Zentrales Nervensystem Funktionelle Neuroanatomie (Struktur und Aufbau des Nervensystems) Neurophysiologie (Ruhe- und Aktionspotenial, synaptische Übertragung) Fakten und Zahlen (funktionelle Auswirkungen)
Zentrales Nervensystem Funktionelle Neuroanatomie (Struktur und Aufbau des Nervensystems) Neurophysiologie (Ruhe- und Aktionspotenial, synaptische Übertragung) Fakten und Zahlen (funktionelle Auswirkungen)
Übung 6 Vorlesung Bio-Engineering Sommersemester Nervenzellen: Kapitel 4. 1
 Bitte schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf das Übungsblatt. Falls Sie mehr Platz brauchen verweisen Sie auf Zusatzblätter. Vergessen Sie Ihren Namen nicht! Abgabe der Übung bis spätestens 21. 04. 08-16:30
Bitte schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf das Übungsblatt. Falls Sie mehr Platz brauchen verweisen Sie auf Zusatzblätter. Vergessen Sie Ihren Namen nicht! Abgabe der Übung bis spätestens 21. 04. 08-16:30
Synaptische Übertragung und Neurotransmitter
 Proseminar Chemie der Psyche Synaptische Übertragung und Neurotransmitter Referent: Daniel Richter 1 Überblick Synapsen: - Typen / Arten - Struktur / Aufbau - Grundprinzipien / Prozesse Neurotransmitter:
Proseminar Chemie der Psyche Synaptische Übertragung und Neurotransmitter Referent: Daniel Richter 1 Überblick Synapsen: - Typen / Arten - Struktur / Aufbau - Grundprinzipien / Prozesse Neurotransmitter:
Aus dem Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br.
 Aus dem Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. Neurotransmitterfreisetzung und ihre präsynaptische Modulation im Hippocampus und anderen
Aus dem Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. Neurotransmitterfreisetzung und ihre präsynaptische Modulation im Hippocampus und anderen
Das Wichtigste: 3 Grundlagen der Erregungs- und Neurophysiologie. - Erregungsausbreitung -
 Das Wichtigste Das Wichtigste: 3 Grundlagen der Erregungs- und Neurophysiologie - Erregungsausbreitung - Das Wichtigste: 3.4 Erregungsleitung 3.4 Erregungsleitung Elektrotonus Die Erregungsausbreitung
Das Wichtigste Das Wichtigste: 3 Grundlagen der Erregungs- und Neurophysiologie - Erregungsausbreitung - Das Wichtigste: 3.4 Erregungsleitung 3.4 Erregungsleitung Elektrotonus Die Erregungsausbreitung
Synaptische Transmission
 Synaptische Transmission Wie lösen APe, die an den Endknöpfchen der Axone ankommen, die Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt aus (chemische Signalübertragung)? 5 wichtige Aspekte:
Synaptische Transmission Wie lösen APe, die an den Endknöpfchen der Axone ankommen, die Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt aus (chemische Signalübertragung)? 5 wichtige Aspekte:
Vorlesung Einführung in die Biopsychologie. Kapitel 4: Nervenleitung und synaptische Übertragung
 Vorlesung Einführung in die Biopsychologie Kapitel 4: Nervenleitung und synaptische Übertragung Prof. Dr. Udo Rudolph SoSe 2018 Technische Universität Chemnitz Grundlage bisher: Dieser Teil nun: Struktur
Vorlesung Einführung in die Biopsychologie Kapitel 4: Nervenleitung und synaptische Übertragung Prof. Dr. Udo Rudolph SoSe 2018 Technische Universität Chemnitz Grundlage bisher: Dieser Teil nun: Struktur
 Abbildungen Schandry, 2006 Quelle: www.ich-bin-einradfahrer.de Abbildungen Schandry, 2006 Informationsvermittlung im Körper Pioniere der Neurowissenschaften: Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Camillo
Abbildungen Schandry, 2006 Quelle: www.ich-bin-einradfahrer.de Abbildungen Schandry, 2006 Informationsvermittlung im Körper Pioniere der Neurowissenschaften: Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Camillo
Die Hauptstrukturen des Gehirns
 Wir unterscheiden 4 grosse Lappen (cortical): Frontallappen, Parietallappen, Temporallappen und Occipitallappen! Markante Gyri sind: Gyrus precentralis, Gyrus postcentralis und Gyrus temporalis superior
Wir unterscheiden 4 grosse Lappen (cortical): Frontallappen, Parietallappen, Temporallappen und Occipitallappen! Markante Gyri sind: Gyrus precentralis, Gyrus postcentralis und Gyrus temporalis superior
postsynaptische Potentiale graduierte Potentiale
 postsynaptische Potentiale graduierte Potentiale Postsynaptische Potentiale veraendern graduierte Potentiale aund, wenn diese Aenderungen das Ruhepotential zum Schwellenpotential hin anheben, dann entsteht
postsynaptische Potentiale graduierte Potentiale Postsynaptische Potentiale veraendern graduierte Potentiale aund, wenn diese Aenderungen das Ruhepotential zum Schwellenpotential hin anheben, dann entsteht
Biologische Psychologie II
 Biologische Psychologie II Kapitel 11 Lernen, Gedä Gedächtnis und Amnesie Lernen Erfahrung verändert das Gehirn! Gedächtnis Veränderungen werden gespeichert und können später reaktiviert werden! Patienten
Biologische Psychologie II Kapitel 11 Lernen, Gedä Gedächtnis und Amnesie Lernen Erfahrung verändert das Gehirn! Gedächtnis Veränderungen werden gespeichert und können später reaktiviert werden! Patienten
Kein Hinweis für eine andere Ursache der Demenz
 die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
Aufbau und Funktionweise der Nervenzelle - Wiederholung Vorlesung -
 Aufbau und Funktionweise der Nervenzelle - Wiederholung Vorlesung - Fragen zur Vorlesung: Welche Zellen können im Nervensystem unterschieden werden? Aus welchen Teilstrukturen bestehen Neuronen? Welche
Aufbau und Funktionweise der Nervenzelle - Wiederholung Vorlesung - Fragen zur Vorlesung: Welche Zellen können im Nervensystem unterschieden werden? Aus welchen Teilstrukturen bestehen Neuronen? Welche
Neuronale Signalverarbeitung
 neuronale Signalverarbeitung Institut für Angewandte Mathematik WWU Münster Abschlusspräsentation am 08.07.2008 Übersicht Aufbau einer Nervenzelle Funktionsprinzip einer Nervenzelle Empfang einer Erregung
neuronale Signalverarbeitung Institut für Angewandte Mathematik WWU Münster Abschlusspräsentation am 08.07.2008 Übersicht Aufbau einer Nervenzelle Funktionsprinzip einer Nervenzelle Empfang einer Erregung
abiweb NEUROBIOLOGIE 17. März 2015 Webinar zur Abiturvorbereitung
 abiweb NEUROBIOLOGIE 17. März 2015 Webinar zur Abiturvorbereitung Bau Nervenzelle Neuron (Nervenzelle) Dentrit Zellkörper Axon Synapse Gliazelle (Isolierung) Bau Nervenzelle Bau Nervenzelle Neurobiologie
abiweb NEUROBIOLOGIE 17. März 2015 Webinar zur Abiturvorbereitung Bau Nervenzelle Neuron (Nervenzelle) Dentrit Zellkörper Axon Synapse Gliazelle (Isolierung) Bau Nervenzelle Bau Nervenzelle Neurobiologie
Anatomie des Nervensystems
 Anatomie des Nervensystems Gliederung Zentrales Nervensystem Gehirn Rückenmark Nervensystem Peripheres Nervensystem Somatisches Nervensystem Vegetatives Nervensystem Afferente Nerven Efferente Nerven Afferente
Anatomie des Nervensystems Gliederung Zentrales Nervensystem Gehirn Rückenmark Nervensystem Peripheres Nervensystem Somatisches Nervensystem Vegetatives Nervensystem Afferente Nerven Efferente Nerven Afferente
Die Entwicklung der Gefühle: Aspekte aus der Hirnforschung. Andreas Lüthi, Friedrich Miescher Institut, Basel
 Die Entwicklung der Gefühle: Aspekte aus der Hirnforschung Andreas Lüthi, Friedrich Miescher Institut, Basel Wie lernen wir Angst zu haben? Wie kann das Gehirn die Angst wieder loswerden? Angst und Entwicklung
Die Entwicklung der Gefühle: Aspekte aus der Hirnforschung Andreas Lüthi, Friedrich Miescher Institut, Basel Wie lernen wir Angst zu haben? Wie kann das Gehirn die Angst wieder loswerden? Angst und Entwicklung
Exzitatorische (erregende) Synapsen
 Exzitatorische (erregende) Synapsen Exzitatorische Neurotransmitter z.b. Glutamat Öffnung von Na+/K+ Kanälen Membran- Potential (mv) -70 Graduierte Depolarisation der subsynaptischen Membran = Erregendes
Exzitatorische (erregende) Synapsen Exzitatorische Neurotransmitter z.b. Glutamat Öffnung von Na+/K+ Kanälen Membran- Potential (mv) -70 Graduierte Depolarisation der subsynaptischen Membran = Erregendes
vorgelegt von Sophia Fischer von Weikersthal aus Ludwigshafen
 Differentielle Normale Pulsvoltametrie - Eine Methode zur Untersuchung funktionaler Parameter der dopaminergen und serotoninergen Neurotransmission sowie deren pharmakologischer Beeinflussung lnaugural-dissertation
Differentielle Normale Pulsvoltametrie - Eine Methode zur Untersuchung funktionaler Parameter der dopaminergen und serotoninergen Neurotransmission sowie deren pharmakologischer Beeinflussung lnaugural-dissertation
Das Ruhemembranpotential eines Neurons
 Das Ruhemembranpotential eines Neurons Genaueres zu den 4 Faktoren: Faktor 1: Die so genannte Brown sche Molekularbewegung sorgt dafür, dass sich Ionen (so wie alle Materie!) ständig zufällig bewegen!
Das Ruhemembranpotential eines Neurons Genaueres zu den 4 Faktoren: Faktor 1: Die so genannte Brown sche Molekularbewegung sorgt dafür, dass sich Ionen (so wie alle Materie!) ständig zufällig bewegen!
1. Kommunikation Informationsweiterleitung und -verarbeitung
 1. Kommunikation Informationsweiterleitung und -verarbeitung Sinnesorgane, Nervenzellen, Rückenmark, Gehirn, Muskeln und Drüsen schaffen die Grundlage um Informationen aus der Umgebung aufnehmen, weiterleiten,
1. Kommunikation Informationsweiterleitung und -verarbeitung Sinnesorgane, Nervenzellen, Rückenmark, Gehirn, Muskeln und Drüsen schaffen die Grundlage um Informationen aus der Umgebung aufnehmen, weiterleiten,
Neurobiologie des Lernens. Hebb Postulat Die synaptische Verbindung von zwei gleichzeitig erregten Zellen wird verstärkt
 Neurobiologie des Lernens Hebb Postulat 1949 Die synaptische Verbindung von zwei gleichzeitig erregten Zellen wird verstärkt Bliss & Lomo fanden 1973 langdauernde Veränderungen der synaptischen Aktivität,
Neurobiologie des Lernens Hebb Postulat 1949 Die synaptische Verbindung von zwei gleichzeitig erregten Zellen wird verstärkt Bliss & Lomo fanden 1973 langdauernde Veränderungen der synaptischen Aktivität,
Übungsfragen, Neuro 1
 Übungsfragen, Neuro 1 Grundlagen der Biologie Iib FS 2012 Auf der jeweils folgenden Folie ist die Lösung markiert. Die meisten Neurone des menschlichen Gehirns sind 1. Sensorische Neurone 2. Motorische
Übungsfragen, Neuro 1 Grundlagen der Biologie Iib FS 2012 Auf der jeweils folgenden Folie ist die Lösung markiert. Die meisten Neurone des menschlichen Gehirns sind 1. Sensorische Neurone 2. Motorische
Aus dem Julius-Bernstein-Institut für Physiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. habil. G.
 Aus dem Julius-Bernstein-Institut für Physiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. habil. G. Isenberg) Der desynchronisierende Effekt des Endothels auf die Kinetik
Aus dem Julius-Bernstein-Institut für Physiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. habil. G. Isenberg) Der desynchronisierende Effekt des Endothels auf die Kinetik
Das Zentralnervensystem des Menschen
 R.Nieuwenhuys J.Voogd Chr. van Huijzen Das Zentralnervensystem des Menschen Ein Atlas mit Begleittext Übersetzt von W. Lange Zweite, vollständig überarbeitete Auflage Mit 217 Abbildungen Springer-Verlag
R.Nieuwenhuys J.Voogd Chr. van Huijzen Das Zentralnervensystem des Menschen Ein Atlas mit Begleittext Übersetzt von W. Lange Zweite, vollständig überarbeitete Auflage Mit 217 Abbildungen Springer-Verlag
Einführung in die moderne Psychologie
 WZ 04 Donald O. Hebb Einführung in die moderne Psychologie Neu übersetzt nach der dritten völlig überarbeiteten Auflage von Hermann Rademacker A 015784 Landes-Lehrer-Bibliothek des Fürstentums Li2ci:tcnstsin
WZ 04 Donald O. Hebb Einführung in die moderne Psychologie Neu übersetzt nach der dritten völlig überarbeiteten Auflage von Hermann Rademacker A 015784 Landes-Lehrer-Bibliothek des Fürstentums Li2ci:tcnstsin
KURS 3: NEUROBIOLOGIE
 Inhalt 1 KURS 3: NEUROBIOLOGIE Allgemeines - eine kleine Zusammenfassung der Neurobiologie Das Gehirn Der Cortex Das Kleinhirn Neurogenese - Der Hippocampus Neurodegenera@on - Morbus Alzheimer Berit Jungnickel
Inhalt 1 KURS 3: NEUROBIOLOGIE Allgemeines - eine kleine Zusammenfassung der Neurobiologie Das Gehirn Der Cortex Das Kleinhirn Neurogenese - Der Hippocampus Neurodegenera@on - Morbus Alzheimer Berit Jungnickel
Neurobiologische Grundlagen einfacher Formen des Lernens
 Professur für Allgemeine Psychologie Vorlesung im WS 2011/12 Lernen und Gedächtnis Neurobiologische Grundlagen einfacher Formen des Lernens Prof. Dr. Thomas Goschke Neurowissenschaftliche Gedächtnisforschung
Professur für Allgemeine Psychologie Vorlesung im WS 2011/12 Lernen und Gedächtnis Neurobiologische Grundlagen einfacher Formen des Lernens Prof. Dr. Thomas Goschke Neurowissenschaftliche Gedächtnisforschung
was sind Neurotransmitter? vier wichtige Eigenschaften von Neurotransmittern Neurotransmitterklassen Klassische Neurotransmitter Peptidtransmitter
 was sind Neurotransmitter? vier wichtige Eigenschaften von Neurotransmittern Neurotransmitterklassen Klassische Neurotransmitter Peptidtransmitter unkonventionelle Transmitter Neurotransmitter sind heterogene
was sind Neurotransmitter? vier wichtige Eigenschaften von Neurotransmittern Neurotransmitterklassen Klassische Neurotransmitter Peptidtransmitter unkonventionelle Transmitter Neurotransmitter sind heterogene
Ringvorlesung - Teil Neurobiologie Übungsfragen und Repetitorium
 Ringvorlesung - Teil Neurobiologie Übungsfragen und Repetitorium Termin 1: Neuronen, Synapsen und Signalgebung (Kapitel 48) 1. Wie unterscheiden sich funktionell Dendriten vom Axon? 2. Wo wird ein Aktionspotenzial
Ringvorlesung - Teil Neurobiologie Übungsfragen und Repetitorium Termin 1: Neuronen, Synapsen und Signalgebung (Kapitel 48) 1. Wie unterscheiden sich funktionell Dendriten vom Axon? 2. Wo wird ein Aktionspotenzial
Physiologische Grundlagen. Inhalt
 Physiologische Grundlagen Inhalt Das Ruhemembranpotential - RMP Das Aktionspotential - AP Die Alles - oder - Nichts - Regel Die Klassifizierung der Nervenfasern Das Ruhemembranpotential der Zelle RMP Zwischen
Physiologische Grundlagen Inhalt Das Ruhemembranpotential - RMP Das Aktionspotential - AP Die Alles - oder - Nichts - Regel Die Klassifizierung der Nervenfasern Das Ruhemembranpotential der Zelle RMP Zwischen
Übungsfragen zur Vorlesung "Grundlagen der Neurobiologie" (R. Brandt) 1. Aus welchen Geweben können adulte Stammzellen entnommen werden?
 Übungsfragen zur Vorlesung "Grundlagen der Neurobiologie" (R. Brandt) Stammzellen und neuronale Differenzierung Parkinson 1. Aus welchen Geweben können adulte Stammzellen entnommen werden? 2. Nennen Sie
Übungsfragen zur Vorlesung "Grundlagen der Neurobiologie" (R. Brandt) Stammzellen und neuronale Differenzierung Parkinson 1. Aus welchen Geweben können adulte Stammzellen entnommen werden? 2. Nennen Sie
Vorlesung Neurophysiologie
 Vorlesung Neurophysiologie Detlev Schild Abt. Neurophysiologie und zelluläre Biophysik dschild@gwdg.de Vorlesung Neurophysiologie Detlev Schild Abt. Neurophysiologie und zelluläre Biophysik dschild@gwdg.de
Vorlesung Neurophysiologie Detlev Schild Abt. Neurophysiologie und zelluläre Biophysik dschild@gwdg.de Vorlesung Neurophysiologie Detlev Schild Abt. Neurophysiologie und zelluläre Biophysik dschild@gwdg.de
Hyperforin aktiviert TRP-Kanäle - ein neuer antidepressiver. Wirkmechanismus? Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften
 Hyperforin aktiviert TRP-Kanäle - ein neuer antidepressiver Wirkmechanismus? Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften Vorgelegt beim Fachbereich Biochemie, Chemie und Pharmazie
Hyperforin aktiviert TRP-Kanäle - ein neuer antidepressiver Wirkmechanismus? Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften Vorgelegt beim Fachbereich Biochemie, Chemie und Pharmazie
Wiederholung: Dendriten
 Wiederholung: Dendriten Neurone erhalten am Dendriten und am Zellkörper viele erregende und hemmende Eingangssignale (Spannungsänderungen) Die Signale werden über Dendrit und Zellkörper elektrisch weitergeleitet.
Wiederholung: Dendriten Neurone erhalten am Dendriten und am Zellkörper viele erregende und hemmende Eingangssignale (Spannungsänderungen) Die Signale werden über Dendrit und Zellkörper elektrisch weitergeleitet.
Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen. R. Brandt
 Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen R. Brandt Synaptische Verbindungen - Synapsen, Dornen und Lernen - Alzheimer Krankheit und Vergessen
Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen R. Brandt Synaptische Verbindungen - Synapsen, Dornen und Lernen - Alzheimer Krankheit und Vergessen
Biologische Psychologie II
 Letztes Mal: H.M. Mediale Temporallappenamnesie Tiermodell (Objekterkennung!) Delayed-nonmatching-to-sample-Test Hippocampusläsion bei Affen und bei Ratten Wir machen weiter mit dem Gedächtnis für Objekterkennung:
Letztes Mal: H.M. Mediale Temporallappenamnesie Tiermodell (Objekterkennung!) Delayed-nonmatching-to-sample-Test Hippocampusläsion bei Affen und bei Ratten Wir machen weiter mit dem Gedächtnis für Objekterkennung:
Modul 4:Pathophysiologie der Alzheimer- Demenz
 Modul 4:Pathophysiologie der Alzheimer- Demenz 10.12.2016 1 Morphologie 10.12.2016 2 Alzheimer-Demenz: Veränderungen des Gehirns gesund gesund Krank, Gehirnschwund Krank, Gehirnschwund 10.12.2016 3 Betroffene
Modul 4:Pathophysiologie der Alzheimer- Demenz 10.12.2016 1 Morphologie 10.12.2016 2 Alzheimer-Demenz: Veränderungen des Gehirns gesund gesund Krank, Gehirnschwund Krank, Gehirnschwund 10.12.2016 3 Betroffene
Vorlesung Einführung in die Biopsychologie
 Vorlesung Einführung in die Biopsychologie Kapitel 3: Anatomie des Nervensystems Prof. Dr. Udo Rudolph Technische Universität Chemnitz, Germany Anatomie des Nervensystems INPUT: Wie viele Nervenleitungen
Vorlesung Einführung in die Biopsychologie Kapitel 3: Anatomie des Nervensystems Prof. Dr. Udo Rudolph Technische Universität Chemnitz, Germany Anatomie des Nervensystems INPUT: Wie viele Nervenleitungen
Weitere Nicht-Opioid-Analgetika
 Analgetika II apl. Prof. Dr. med. A. Lupp Institut für Pharmakologie und Toxikologie Universitätsklinikum Jena Drackendorfer Str. 1, 07747 Jena Tel.: (9)325678 oder -88 e-mail: Amelie.Lupp@med.uni-jena.de
Analgetika II apl. Prof. Dr. med. A. Lupp Institut für Pharmakologie und Toxikologie Universitätsklinikum Jena Drackendorfer Str. 1, 07747 Jena Tel.: (9)325678 oder -88 e-mail: Amelie.Lupp@med.uni-jena.de
7 Neurobiologie. 7.1 Die Nervenzelle. Aufgabe 7.1-1: Bau der Nervenzelle
 7 Neurobiologie 7.1 Die Nervenzelle Aufgabe 7.1-1: Bau der Nervenzelle a) Benenne die Bestandteile der Nervenzelle! b) Welche Aufgaben haben die einzelnen Bestandteile der Nervenzelle? c) Fertige von den
7 Neurobiologie 7.1 Die Nervenzelle Aufgabe 7.1-1: Bau der Nervenzelle a) Benenne die Bestandteile der Nervenzelle! b) Welche Aufgaben haben die einzelnen Bestandteile der Nervenzelle? c) Fertige von den
Synaptische Verbindungen - Alzheimer
 Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen - Alzheimer R. Brandt (Email: brandt@biologie.uni-osnabrueck.de) Synaptische Verbindungen - Synapsen,
Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen - Alzheimer R. Brandt (Email: brandt@biologie.uni-osnabrueck.de) Synaptische Verbindungen - Synapsen,
John C. Eccles. Das Gehirn. des Menschen. Das Abenteuer de r modernen Hirnforschung
 John C. Eccles Das Gehirn des Menschen Das Abenteuer de r modernen Hirnforschung Kapitel I : Neurone, Nervenfasern und der Nervenimpuls 1 7 A. Einführung 1 7 B. Das Neuron........................... 1
John C. Eccles Das Gehirn des Menschen Das Abenteuer de r modernen Hirnforschung Kapitel I : Neurone, Nervenfasern und der Nervenimpuls 1 7 A. Einführung 1 7 B. Das Neuron........................... 1
Neurobiologische Grundlagen einfacher Formen des Lernens
 Professur für Allgemeine Psychologie Vorlesung im WS 2011/12 Lernen und Gedächtnis Neurobiologische Grundlagen einfacher Formen des Lernens Prof. Dr. Thomas Goschke Literaturempfehlung Gluck, M.A., Mercado,
Professur für Allgemeine Psychologie Vorlesung im WS 2011/12 Lernen und Gedächtnis Neurobiologische Grundlagen einfacher Formen des Lernens Prof. Dr. Thomas Goschke Literaturempfehlung Gluck, M.A., Mercado,
Biologische Psychologie II
 Parkinson-Erkrankung: Ca. 0,5% der Bevölkerung leidet an dieser Krankheit, die bei Männern ungefähr 2,5 Mal häufiger auftritt als bei Frauen! Die Krankheit beginnt mit leichter Steifheit oder Zittern der
Parkinson-Erkrankung: Ca. 0,5% der Bevölkerung leidet an dieser Krankheit, die bei Männern ungefähr 2,5 Mal häufiger auftritt als bei Frauen! Die Krankheit beginnt mit leichter Steifheit oder Zittern der
Neurobiologie und Rauchen. Der Nikotinrezeptor Grundlage der neurobiologischen Wirkung des Rauchens Anil Batra
 Neurobiologie und Rauchen Der Nikotinrezeptor Grundlage der neurobiologischen Wirkung des Rauchens Anil Batra Nicotin - Wirkstoff im Tabakrauch Resorption Zigarettenrauch enthält 30% des Nicotins einer
Neurobiologie und Rauchen Der Nikotinrezeptor Grundlage der neurobiologischen Wirkung des Rauchens Anil Batra Nicotin - Wirkstoff im Tabakrauch Resorption Zigarettenrauch enthält 30% des Nicotins einer
Kulturen von humanen Nabelschnur-Endothelzellen (HUVEC) produzieren konstant Endothelin-1 (ET-1) und geben dieses in das Kulturmedium ab.
 4 ERGEBNISSE 4.1 Endothelin Kulturen von humanen Nabelschnur-Endothelzellen (HUVEC) produzieren konstant Endothelin-1 (ET-1) und geben dieses in das Kulturmedium ab. 4.1.1 Dosisabhängige Herabregulation
4 ERGEBNISSE 4.1 Endothelin Kulturen von humanen Nabelschnur-Endothelzellen (HUVEC) produzieren konstant Endothelin-1 (ET-1) und geben dieses in das Kulturmedium ab. 4.1.1 Dosisabhängige Herabregulation
Biologische Psychologie II
 Wo sind denn nun Erinnerungen im gesunden Gehirn gespeichert? Es wurde bereits die Idee erwähnt, dass Erinnerungen im Rahmen der Strukturen gespeichert sind, die an der ursprünglichen Erfahrung beteiligt
Wo sind denn nun Erinnerungen im gesunden Gehirn gespeichert? Es wurde bereits die Idee erwähnt, dass Erinnerungen im Rahmen der Strukturen gespeichert sind, die an der ursprünglichen Erfahrung beteiligt
Nanostrukturphysik II Michael Penth
 16.07.13 Nanostrukturphysik II Michael Penth Ladungstransport essentiell für Funktionalität jeder Zelle [b] [a] [j] de.academic.ru esys.org giantshoulders.wordpress.com [f] 2 Mechanismen des Ionentransports
16.07.13 Nanostrukturphysik II Michael Penth Ladungstransport essentiell für Funktionalität jeder Zelle [b] [a] [j] de.academic.ru esys.org giantshoulders.wordpress.com [f] 2 Mechanismen des Ionentransports
Vom Reiz zum Aktionspotential. Wie kann ein Reiz in ein elektrisches Signal in einem Neuron umgewandelt werden?
 Vom Reiz zum Aktionspotential Wie kann ein Reiz in ein elektrisches Signal in einem Neuron umgewandelt werden? Vom Reiz zum Aktionspotential Primäre Sinneszellen (u.a. in den Sinnesorganen) wandeln den
Vom Reiz zum Aktionspotential Wie kann ein Reiz in ein elektrisches Signal in einem Neuron umgewandelt werden? Vom Reiz zum Aktionspotential Primäre Sinneszellen (u.a. in den Sinnesorganen) wandeln den
Zentrales Nervensystem
 Zentrales Nervensystem Funktionelle Neuroanatomie (Struktur und Aufbau des Nervensystems) Evolution des Menschen Neurophysiologie (Ruhe- und Aktionspotenial, synaptische Übertragung) Fakten und Zahlen
Zentrales Nervensystem Funktionelle Neuroanatomie (Struktur und Aufbau des Nervensystems) Evolution des Menschen Neurophysiologie (Ruhe- und Aktionspotenial, synaptische Übertragung) Fakten und Zahlen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: 5511240 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Schlagwörter Adrenalin; Aminosäuren; Aminosäurederivate; autokrin;
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: 5511240 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Schlagwörter Adrenalin; Aminosäuren; Aminosäurederivate; autokrin;
Expression und Funktion. von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten. Hirngewebe der Maus
 Expression und Funktion von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten Hirngewebe der Maus Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) von Dipl.-Biochem.
Expression und Funktion von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten Hirngewebe der Maus Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) von Dipl.-Biochem.
Beide bei Thieme ebook
 Beide bei Thieme ebook Neurophysiologie 1) Funktionelle Anatomie 2) Entstehung nervaler Potentiale 3) Erregungsfortleitung 4) Synaptische Übertragung 5) Transmitter und Reflexe 6) Vegetatives Nervensystem
Beide bei Thieme ebook Neurophysiologie 1) Funktionelle Anatomie 2) Entstehung nervaler Potentiale 3) Erregungsfortleitung 4) Synaptische Übertragung 5) Transmitter und Reflexe 6) Vegetatives Nervensystem
1. Welche Arten von Zell Zell Verbindungen kennen Sie und was sind ihre Hauptaufgaben? Verschliessende Verbindungen (Permeabilitätseinschränkung)
 Fragen Zellbio 2 1. Welche Arten von Zell Zell Verbindungen kennen Sie und was sind ihre Hauptaufgaben? Verschliessende Verbindungen (Permeabilitätseinschränkung) Haftende Verbindungen (Mechanischer Zusammenhalt)
Fragen Zellbio 2 1. Welche Arten von Zell Zell Verbindungen kennen Sie und was sind ihre Hauptaufgaben? Verschliessende Verbindungen (Permeabilitätseinschränkung) Haftende Verbindungen (Mechanischer Zusammenhalt)
Wie viele Neuronen hat der Mensch? a b c
 Wie viele Neuronen hat der Mensch? a. 20 000 000 000 b. 500 000 000 000 c. 100 000 000 000 000 Aus Eins mach Viele Konzentration und Spezialisierung Alle Neurone = Nervensystem Axone Nerven Zellkörper
Wie viele Neuronen hat der Mensch? a. 20 000 000 000 b. 500 000 000 000 c. 100 000 000 000 000 Aus Eins mach Viele Konzentration und Spezialisierung Alle Neurone = Nervensystem Axone Nerven Zellkörper
Junge Zellen lernen leichter: Adulte Neurogenese im Hippocampus
 Junge Zellen lernen leichter: Adulte Neurogenese im Hippocampus Prof. Dr. Josef Bischofberger Physiologisches Institut Departement Biomedizin Universität Basel Junge Zellen lernen leichter: Adulte Neurogenese
Junge Zellen lernen leichter: Adulte Neurogenese im Hippocampus Prof. Dr. Josef Bischofberger Physiologisches Institut Departement Biomedizin Universität Basel Junge Zellen lernen leichter: Adulte Neurogenese
Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus. von Dihydroergocristin an der. spontan hypertensiven Ratte
 Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus von Dihydroergocristin an der spontan hypertensiven Ratte Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) der Fakultät für Chemie
Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus von Dihydroergocristin an der spontan hypertensiven Ratte Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) der Fakultät für Chemie
Generierung eines APs
 Generierung eines APs Interessante Bemerkungen: Die Zahl der Ionen, die während eines Aps in Bewegung sind, ist verglichen mit der Gesamtzahl der Ionen innerhalb und außerhalb eines Neurons sehr gering!
Generierung eines APs Interessante Bemerkungen: Die Zahl der Ionen, die während eines Aps in Bewegung sind, ist verglichen mit der Gesamtzahl der Ionen innerhalb und außerhalb eines Neurons sehr gering!
7.1. Die Rückenmarknerven (Die Spinalnerven): Siehe Bild Nervenbahnen
 7. Das periphere Nervensystem: 7.1. Die Rückenmarknerven (Die Spinalnerven): Siehe Bild Nervenbahnen 7.2. Die Hirnnerven: Sie stammen aus verschiedenen Zentren im Gehirn. I - XII (Parasympathikus: 3,7,9,10)
7. Das periphere Nervensystem: 7.1. Die Rückenmarknerven (Die Spinalnerven): Siehe Bild Nervenbahnen 7.2. Die Hirnnerven: Sie stammen aus verschiedenen Zentren im Gehirn. I - XII (Parasympathikus: 3,7,9,10)
Neurobiologie. Prof. Dr. Bernd Grünewald, Institut für Bienenkunde, FB Biowissenschaften
 Neurobiologie Prof. Dr. Bernd Grünewald, Institut für Bienenkunde, FB Biowissenschaften www.institut-fuer-bienenkunde.de b.gruenewald@bio.uni-frankfurt.de Synapsen II Die postsynaptische Membran - Synapsentypen
Neurobiologie Prof. Dr. Bernd Grünewald, Institut für Bienenkunde, FB Biowissenschaften www.institut-fuer-bienenkunde.de b.gruenewald@bio.uni-frankfurt.de Synapsen II Die postsynaptische Membran - Synapsentypen
Postsynaptische Potenziale
 Postsynaptisches Potenzial Arbeitsblatt Nr 1 Postsynaptische Potenziale Links ist eine Versuchsanordnung zur Messung der Membranpotenziale an verschiedenen Stellen abgebildet. Das Axon links oben wurde
Postsynaptisches Potenzial Arbeitsblatt Nr 1 Postsynaptische Potenziale Links ist eine Versuchsanordnung zur Messung der Membranpotenziale an verschiedenen Stellen abgebildet. Das Axon links oben wurde
Biologische Psychologie I
 Biologische Psychologie I Kapitel 7 Mechanismen der Wahrnehmung, des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit Organisationsprinzipien eines sensorischen Systems: Primärer und sekundärer sensorischer Kortex
Biologische Psychologie I Kapitel 7 Mechanismen der Wahrnehmung, des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit Organisationsprinzipien eines sensorischen Systems: Primärer und sekundärer sensorischer Kortex
Neurale Grundlagen kognitiver Leistungen II
 Neurale Grundlagen kognitiver Leistungen II Inhalt: 1. Lernen und Gedächtnis: Hirnregionen und wichtige Bahnen 2. Aufbau der Hippocampusformation 2.1 Anatomie und Mikroanatomie der Hippocampusformation
Neurale Grundlagen kognitiver Leistungen II Inhalt: 1. Lernen und Gedächtnis: Hirnregionen und wichtige Bahnen 2. Aufbau der Hippocampusformation 2.1 Anatomie und Mikroanatomie der Hippocampusformation
abiweb NEUROBIOLOGIE Abituraufgaben 17. März 2015 Webinar zur Abiturvorbereitung
 abiweb NEUROBIOLOGIE Abituraufgaben 17. März 2015 Webinar zur Abiturvorbereitung Vergleichen Sie die Leitungsgeschwindigkeiten der myelinisierten (blau/ grau) und nicht myelinisierten (helles blau) Nervenbahnen!
abiweb NEUROBIOLOGIE Abituraufgaben 17. März 2015 Webinar zur Abiturvorbereitung Vergleichen Sie die Leitungsgeschwindigkeiten der myelinisierten (blau/ grau) und nicht myelinisierten (helles blau) Nervenbahnen!
Inhaltsfeld: IF 4: Neurobiologie
 Unterrichtsvorhaben IV: Thema/Kontext: Molekulare und zellbiologische Grundlagen der neuronalen Informationsverarbeitung Wie ist das Nervensystem Menschen aufgebaut und wie ist organisiert? Inhaltsfeld:
Unterrichtsvorhaben IV: Thema/Kontext: Molekulare und zellbiologische Grundlagen der neuronalen Informationsverarbeitung Wie ist das Nervensystem Menschen aufgebaut und wie ist organisiert? Inhaltsfeld:
Epilepsie. ein Vortrag von Cara Leonie Ebert und Max Lehmann
 Epilepsie ein Vortrag von Cara Leonie Ebert und Max Lehmann Inhaltsverzeichnis Definition Epilepsie Unterschiede und Formen Ursachen Exkurs Ionenkanäle Diagnose Das Elektroenzephalogramm (EEG) Therapiemöglichkeiten
Epilepsie ein Vortrag von Cara Leonie Ebert und Max Lehmann Inhaltsverzeichnis Definition Epilepsie Unterschiede und Formen Ursachen Exkurs Ionenkanäle Diagnose Das Elektroenzephalogramm (EEG) Therapiemöglichkeiten
NaCl. Die Originallinolschnitte, gedruckt von Marc Berger im V.E.B. Schwarzdruck Berlin, liegen als separate Auflage in Form einer Graphikmappe vor.
 NaCl Künstlerische Konzeption: Xenia Leizinger Repros: Roman Willhelm technische Betreuung und Druck: Frank Robrecht Schrift: Futura condensed, Bernhard Modern Papier: Igepa Design Offset naturweiß 120
NaCl Künstlerische Konzeption: Xenia Leizinger Repros: Roman Willhelm technische Betreuung und Druck: Frank Robrecht Schrift: Futura condensed, Bernhard Modern Papier: Igepa Design Offset naturweiß 120
Was versteht man unter partiellen (fokalen) epileptischen Anfällen? Welche Unterformen gibt es?
 Was versteht man unter partiellen (fokalen) epileptischen Anfällen? Welche Unterformen gibt es? Nennen Sie zwei genetische Faktoren, die zu einer Hirnschädigung führen können. Geben Sie je ein Beispiel
Was versteht man unter partiellen (fokalen) epileptischen Anfällen? Welche Unterformen gibt es? Nennen Sie zwei genetische Faktoren, die zu einer Hirnschädigung führen können. Geben Sie je ein Beispiel
Die Schizophrenie und das Glutamat: Neue Medikamente jenseits vom Dopamin?
 Die Schizophrenie und das Glutamat: Neue Medikamente jenseits vom Dopamin? Prof. Dr. Walter E. Müller Department of Pharmacology Biocentre of the University 60439 Frankfurt / M Die Dopaminhypothese der
Die Schizophrenie und das Glutamat: Neue Medikamente jenseits vom Dopamin? Prof. Dr. Walter E. Müller Department of Pharmacology Biocentre of the University 60439 Frankfurt / M Die Dopaminhypothese der
Das Nervensystem. Die Unterteilung des ZNS
 Das Nervensystem Die Unterteilung des ZNS 1. Vorderhirn 1a. Telencephalon 1. Neocortex, Basalggl. Seitenventrikel (Prosencephalon) (Endhirn) limbisches System Bulbus olfact 1b. Diencephalon 2. Thalamus
Das Nervensystem Die Unterteilung des ZNS 1. Vorderhirn 1a. Telencephalon 1. Neocortex, Basalggl. Seitenventrikel (Prosencephalon) (Endhirn) limbisches System Bulbus olfact 1b. Diencephalon 2. Thalamus
Die motorische Endplatte und die Steuerung der Muskelkontraktion
 Die motorische Endplatte und die Steuerung der Muskelkontraktion 1. Aufbau des Muskels 2. Mechanismus und Steuerung der Muskelkontraktion 2.1 Gleitfilamenttheorie 2.2 Zyklus der Actin-Myosin Interaktion
Die motorische Endplatte und die Steuerung der Muskelkontraktion 1. Aufbau des Muskels 2. Mechanismus und Steuerung der Muskelkontraktion 2.1 Gleitfilamenttheorie 2.2 Zyklus der Actin-Myosin Interaktion
Zelltypen des Nervensystems
 Zelltypen des Nervensystems Im Gehirn eines erwachsenen Menschen: Neurone etwa 1-2. 10 10 Glia: Astrozyten (ca. 10x) Oligodendrozyten Mikrogliazellen Makrophagen Ependymzellen Nervenzellen Funktion: Informationsaustausch.
Zelltypen des Nervensystems Im Gehirn eines erwachsenen Menschen: Neurone etwa 1-2. 10 10 Glia: Astrozyten (ca. 10x) Oligodendrozyten Mikrogliazellen Makrophagen Ependymzellen Nervenzellen Funktion: Informationsaustausch.
Neuro- und Sinnesphysiologie
 Robert F. Schmidt (Hrsg) Hans-Georg Schaible (Hrsg) Neuro- und Sinnesphysiologie Mit Beiträgen von N. Birbaumer, V. Braitenberg, H. Brinkmeier, J. Dudel, U. Eysel, H.O. Handwerker, H. Hatt, M. liiert,
Robert F. Schmidt (Hrsg) Hans-Georg Schaible (Hrsg) Neuro- und Sinnesphysiologie Mit Beiträgen von N. Birbaumer, V. Braitenberg, H. Brinkmeier, J. Dudel, U. Eysel, H.O. Handwerker, H. Hatt, M. liiert,
Untersuchungen zur Wirkung von Pasteurella multocida Toxin
 Institut fiir Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie der Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg Untersuchungen zur Wirkung von Pasteurella multocida Toxin Dissertation zur Erlangung des
Institut fiir Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie der Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg Untersuchungen zur Wirkung von Pasteurella multocida Toxin Dissertation zur Erlangung des
Peter Walla. Die Hauptstrukturen des Gehirns
 Die Hauptstrukturen des Gehirns Die Hauptstrukturen des Gehirns Biologische Psychologie I Kapitel 4 Nervenleitung und synaptische Übertragung Nervenleitung und synaptische Übertragung Wie werden Nervensignale
Die Hauptstrukturen des Gehirns Die Hauptstrukturen des Gehirns Biologische Psychologie I Kapitel 4 Nervenleitung und synaptische Übertragung Nervenleitung und synaptische Übertragung Wie werden Nervensignale
Gerhard Roth Fühlen, Denken, Handeln
 Gerhard Roth Fühlen, Denken, Handeln Wie das Gehirn unser Verhalten steuert Neue, vollständig überarbeitete Ausgabe Suhrkamp Inhalt Vorwort zur überarbeiteten Auflage n Vorwort 15 Einleitung 18 1. Moderne
Gerhard Roth Fühlen, Denken, Handeln Wie das Gehirn unser Verhalten steuert Neue, vollständig überarbeitete Ausgabe Suhrkamp Inhalt Vorwort zur überarbeiteten Auflage n Vorwort 15 Einleitung 18 1. Moderne
Alle(s) Zucker oder was?
 Alle(s) Zucker oder was? Ein gesundes Gehirn Alles eine Frage des Zuckers? Werner Reutter Institut für Biochemie und Molekularbiologie Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin Konstanz
Alle(s) Zucker oder was? Ein gesundes Gehirn Alles eine Frage des Zuckers? Werner Reutter Institut für Biochemie und Molekularbiologie Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin Konstanz
Grundlagen Aufbau des vegetativen Nervensystems
 Grundlagen Aufbau des vegetativen Nervensystems David P. Wolfer Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, D-HEST, ETH Zürich Anatomisches Institut, Medizinische Fakultät, Universität Zürich 77-007-00
Grundlagen Aufbau des vegetativen Nervensystems David P. Wolfer Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, D-HEST, ETH Zürich Anatomisches Institut, Medizinische Fakultät, Universität Zürich 77-007-00
Seminar. LV Entwicklungswissenschaft I: Biopsychosoziale Grundlagen der Entwicklung. Gliederung. Prof. Dr. phil. Herbert Scheithauer
 Seminar Prof. Dr. phil. Herbert Scheithauer Arbeitsbereich Entwicklungswissenschaft und Angewandte Entwicklungspsychologie LV 12-526 Entwicklungswissenschaft I: Biopsychosoziale Grundlagen der Entwicklung
Seminar Prof. Dr. phil. Herbert Scheithauer Arbeitsbereich Entwicklungswissenschaft und Angewandte Entwicklungspsychologie LV 12-526 Entwicklungswissenschaft I: Biopsychosoziale Grundlagen der Entwicklung
Biopsychologie als Neurowissenschaft Evolutionäre Grundlagen Genetische Grundlagen Mikroanatomie des NS
 1 25.10.06 Biopsychologie als Neurowissenschaft 2 8.11.06 Evolutionäre Grundlagen 3 15.11.06 Genetische Grundlagen 4 22.11.06 Mikroanatomie des NS 5 29.11.06 Makroanatomie des NS: 6 06.12.06 Erregungsleitung
1 25.10.06 Biopsychologie als Neurowissenschaft 2 8.11.06 Evolutionäre Grundlagen 3 15.11.06 Genetische Grundlagen 4 22.11.06 Mikroanatomie des NS 5 29.11.06 Makroanatomie des NS: 6 06.12.06 Erregungsleitung
