George Edward Moore: Leben und Werk
|
|
|
- Fanny Schulze
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Joachim Stiller George Edward Moore: Leben und Werk Materialien zu Leben und Werk von George Edward Moore Alle Rechte vorbehalten
2 George Edward Moore Ich lasse nun einen Text von Ehlen, Haeffner und Ricken folgen (Philosophie des 20. Jahrhunderts) 1. Die Ausgangssituation Fragt man nach Gemeinsamkeiten die es rechtfertigen eine Vielzahl unterschiedlicher philosophischer Richtungen unter dem Begriff der Analytischen Philosophie zusammenzufassen, so ist der Hinweis auf den Gegner, gegen den die Anfänge der Analytischen Philosophie in Cambridge und Oxford am Beginn dieses Jahrhunderts sich richten, eine erste Antwort. Eine der Programmschriften der Analytischen Philosophie trägt den Titel "Die Widerlegung des Idealismus". Der Idealismus Hegelscher Prägung war um die Jahrhundertwende die in Oxford und Cambridge führende philosophische Richtung. Moore und Russell waren in Cambridge Schüler von John McTaggart Ellis McTaggart ( ), und beide berichten von ihrer Bewunderung für Francis Herbert Bradley ( ), Fellow des Merton College in Oxford. Bradley und McTaggart bestreiten die Realität der Erfahrungswelt. Nach dem Wiki-Artikel zu urteilen, hat sich Moore vor allem mit ethischen Fragen beschäftigt...mir selbst seit längerem bekannt ist "Moores Problem" dass sich vor allem auf Kant bezieht. Ich hänge gleich einen kurzen Text dazu an. Bradley versucht zu zeigen, dass der Begriff der Relation in sich widersprüchlich ist. Dieser Widerspruch sei ausreichend, um die Relation vieler Phänomene zu bestreiten bzw. die Widersprüchlichkeit grundlegender Begriffe zur Erfassung der Erfahrungswelt, z.b. Ursache, Raum, Zeit, Ding, Selbst, aufzuzeigen, da diese Relationen implizieren. Eines der am meisten diskutierten Argumente McTaggarts ist sein Beweis für die Widersprüchlichkeit der Zeit. Widerspruchsfrei kann die Realität nach Bradley nicht als Vielheit voneinander unabhängiger Substanzen sondern nur als das eine allumfassende Absolute gedacht werden. Analogien des Absoluten sind Erfahrung und Empfindung. Das Absolute ist Geist außer dem Geist kann es keine Realität geben. Im Unterschied zu Bradleys Monismus vertritt McTaggart einen pluralistischen Idealismus. Das Universum ist eine Gemeinschaft vollkommener ewiger Personen die durch Liebe miteinander verbunden sind. jeder menschliche Geist ist mit einer dieser Personen identisch. George Edward Moore (geboren am in London gestorben am in Cambridge)studierte nach seiner Aufnahme ins Trinity College in Cambridge (1892) zunächst Klassische Philologie. Am Ende seines ersten Studienjahres lernte er Russell kennen und er schrieb es vor allem dessen Rat und Ermutigung zu, dass er sich der Philosophie zuwandte. Moore studierte Lotzes Metaphysik, Hegel Platon und Aristoteles. Von seinen Lehrern übte McTaggart durch sein Bemühen um Klarheit den größten Einfluss auf ihn aus. Nach seinen ersten Studienjahren hat Moore es nicht mehr der Mühe wert erachtet sich mit Hegel zu befassen, während er Platon und Aristoteles immer wieder studiert hat. Aufgrund einer Abhandlung über Kants Ethik wurde Moore 1898 für sechs Jahre zum Fellow des Trinity College gewählt. Mit "The Nature of Judgement" (in: Mind 8 [1899]) begann seine Abkehr von Bradley. Moore vertritt dort einen absoluten Realismus: Die Universalien sind wirklich und in ihnen erschöpft sich die gesamte Wirklichkeit erschienen die "Principia Ethica"
3 Moores bekanntestes Werk, dass die These vertritt 'gut' bezeichne eine unanalysierbare nur in einer geistigen Intuition zu erfassende Eigenschaft, und "The Refutation of Idealism" (in: Mind 12 [1903]). Von 1904 bis 1911 lebte Moore in Edinburgh und London. Seine Vorlesungen am Morley College in London im Winter 1910/11 die 1953 unter dem Titel "Some Main Problems of Philosophie" veröffentlicht wurden sind die ausführlichste Darstellung seiner Ontologie und Erkenntnistheorie. In London entstand auch der kleine Band "Ethics" (1912). Von 1911 bis zu seiner Emeritierung 1939 lehrte Moore in Cambridge ab 1925 als Professor für Philosophie des Geistes und Logik. Die in dieser Zeit veröffentlichten Abhandlungen zur Erkenntnistheorie Ontologie und Ethik hat Moore, zusammen mit früheren Arbeiten in den "Philosophical Studies" (1922) und den "Philosophical Papers" (1959) zusammengestellt. Für das von P. A. Schilpp herausgegebene Sammelwerk "The Philosophy of G.E. Moore" (1942) schrieb er eine Autobiographie und eine ausführliche Erwiderung an seine Kritiker. 2. Widerlegung des Idealismus Am Anfang seiner Vorlesung von fragt Moore was Philosophie sei. Die wichtigste und interessanteste Aufgabe der Philosophie sei es eine allgemeine Beschreibung des gesamten Universums zu geben indem sie die wichtigsten Arten der Dinge von denen wir wissen dass sie in ihm sind, aufführen und die wichtigsten Beziehungen dieser verschiedenen Arten von Dingen betrachten. Mittelpunkt der Philosophie ist nach Moore also die Disziplin die nach dem Seienden in seiner Gesamtheit fragt die Metaphysik oder Ontologie. Die anderen Fragen der Philosophie ergeben sich aus der metaphysischen. Wenn der Metaphysiker Aussagen über das Universum macht so werden wir ihn fragen woher er das wissen und ihm damit die drei Fragen nach dem Begriff des Wissens nach dem Begriff der Wahrheit und nach der Begründung einer als wahr behaupteten Aussage stellen (...). Die in den Wandlungen von Moores Metaphysik sich durchhaltende Linie ist sein Realismus. Er verteidigt die Annahme des gesunden Menschenverstandes, dass es eine bewusstseinsunabhängige Wirklichkeit gibt, gegen alle Philosophen, die sie bestreiten. Ja, damit stimme ich absolut überein. Mit "The Refutation of Idealism" (1003 in: 1922) hat Moore seine eigene ontologische Position gefunden... Der Aufsatz zeigt gegen welche philosophischen Richtungen Moore sich wendet. Er verdient auch unter methodischer Rücksicht Beachtung. Den verschiedenen Ausprägungen des Idealismus ist die These "Das Universum ist geistig" gemeinsam. [Ist es ja auch, aber darauf kommt es nicht an] Sie wird nach Moore nicht nur von Bradley und McTaggart vertreten, sondern ebenso von Berkeley, den Empiristen, Kant und dem Psychologismus. Es ist für Moores Methode kennzeichnend, dass er, auf alle historische Gelehrsamkeit verzichtend, nach dem notwendigen und wesentlichen Schritt aller idealistischen Argumente fragt, um seinen Angriff ausschließlich gegen ihn zu richten. [Fragt sich nur, wozu das gut sein soll...] Alle Beweise für jegliche Form des Idealismus beruhen notwendig auf der Prämisse 'esse est percipi' ('Sein ist Wahrgenommenwerden; dabei umfasst 'wahrnehmen' die sinnliche Wahrnehmung und das Denken'): Alle Wirklichkeit erschöpft sich im Akt des Bewusstseins und dessen Inhalt. [Ach so... Ja sicher... Man muss allerdings zwischen Wirklichkeit und Realität unterscheiden...] (Diese ontologische Aussage lässt sich umformen in eine skeptische erkenntnistheoretische These: "Akt und Inhalt des
4 Bewusstseins sind die einzige unserer Erkenntnis zugängliche Wirklichkeit'. [Das heißt bloß nichts...] Moores Kritik beginnt mit einer Analyse der Aussage 'esse est percipi'. Sie klärt die genaue Bedeutung der drei mehrdeutigen Termini und stellt fest, dass es sich nach Ansicht der Idealisten um eine analytische, d.h. eine Aussage handelt, deren Negation einen Widerspruch ergibt. Die Idealisten behaupten, der Begriff des Objektes könne nicht ohne den des Subjekts gedacht werde; das Objekt sei, was es [auch immer] ist, ausschließlich durch seine Beziehung zum Subjekt. [Man sollte übrigens nicht "nur" von Idealismus sprechen, sondern immer dazu sagen, welchen Idealismus man denn genau meint. In diesem Fall wären das der erkenntnistheoretische Idealismus (Kant) und der ontologische Idealismus (Berkeley). Und daher könnte man hier sogar viel besser einfach von "Phänomenalismus" (ganz allgemein) sprechen...] Moore entwickelt seien Gegenposition anhand einer Analyse der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung von Blau unterscheidet sich von der von Grün. Dennoch fallen beide unter den Begriff der Wahrnehmung. Folglich sind in jeder Wahrnehmung zwei Elemente zu unterscheiden: 1. das Bewusstsein, in dem alle Wahrnehmungen übereinkommen; 2. das Objekt der Wahrnehmung, durch das die Wahrnehmung sich unterscheidet (das Blau bzw. Grün). Die umstrittene Frage lautet, ob das Objekt der Wahrnehmung eine vom Bewusstsein unabhängige Existenz hat. Sie wird von Moore gegenüber den Idealisten mit allem Nachdruck bejaht. Die Idealisten [Phänomenalisten] begehen den Fehler, dass sie den Gegenstand der Erfahrung mit der Erfahrung des Gegenstandes gleichsetzen. [Ja, hört sich gut an... Das ist übrigens auch grundsätzlich meine Kritik...] Nach Moore gehört es zum Wesen der Wahrnehmung, dass in ihr der Gegenstand der Wahrnehmung als vom Bewusstsein unabhängig erfahren wird. [Ja, genau das...] Die erkenntnistheoretische Frage, wie wir aus dem Kreis unserer eigenen Vorstellung und Wahrnehmungen herauskommen, ist ein Scheinproblem. Eine Wahrnehmung zu haben beutet bereits, außerhalb dieses Kreises zu sein. [Ganz genau... Moore hätte natürlich auch auf den gerade von ihm vertretenen gesunden Menschenverstand (common sense) verweisen können...aber eine echte Beweisführung ist natürlich eleganter...] 3. Die Philosophie des Common Sense Mit einer anderen Methode geht Moore das Realismusproblem in "A Defence of Common Sense" (1925; in: 1959) an. Wittgenstein geht in seinem letzten Werk "Über Gewissheit" von diesem Aufsatz aus. N. Malcolm (in: Schilpp 1968) meint, Moore vertrete hier eine Philosophie der Alltagssprache. Moore beginnt mit einer Liste von Aussagen, von denen er behauptet, er wissen mit Sicherheit, dass sie wahr sind. "Es existieren jetzt ein lebender menschlicher Körper, der mein Körper ist. Dieser Körper wurde zu einer bestimmten Zeit in der Vergangenheit geboren und existiert seitdem kontinuierlich, wenn auch nicht ohne Veränderungen... Seit er geboren wurde, befindet er sich im Kontakt mit oder nicht weit von der Oberfläche der Erde... Unter den Dingen, die.. einen Teil seiner Umgebung bilden, sind in jedem Augenblick seit seiner Geburt in großer Zahle andere lebende Menschliche Körper gewesen... Die Erde hat viele Jahre, bevor mein Körper geboren wurde, existiert usw." Moore behauptet zweitens zu wissen, dass viele andere Menschen oft bezüglich ihrer eigenen Person und ihres eigenen Körpers das entsprechende Wissen (gehabt) haben. Aufgrund dieses Wissens lehnt Motte die philosophischen Auffassungen, dass die aufgeführten Aussagen zumindest zum Teil falsch seien oder dass ihre Wahrheit nicht mit Gewissheit erkannt werden könne, ab. [Jawohl... Großartig... Guter Mann...]
5 Philosophie bedeutet nicht, das Selbstverständliche in Frage zu stellen, sondern darüber hinauszuschreiten. Für Moore folgt aus der Tatsache, dass eine Aussage zum Weltbild des gesunden Menschenverstandes gehört, dass sie wahr ist. Wie kann er das begründen? Ist er ein naiver oder dogmatischer Philosoph in dem Sinn, dass er ohne weitere Reflexion die Auffassungen des gesunden Menschenverstandes als nicht mehr hinterfragbare Gewissheiten annimmt? Für einige seiner Aussagen führt Motte als Begründung an, dass ihre Bestreitung zu einem Widerspruch führen würde. Der Philosoph, der die Existenz anderer Menschen bestreitet, will diese These anderen Menschen plausibel machen uns setzt insofern deren Existenz voraus. Aber diese Begründung macht Moore nicht für alle von ihm als wahr behaupteten Aussagen geltend. Wir sind daher auf Interpretationen angewiesen. Nach Malcolm ist die letzte Instanz für Moore die Umgangssprache; wer behauptet, er glaube, dass er einen Körperhabe, kenne eben die Bedeutung von 'glauben' und 'wissen' nicht. Eine bessere Deutung ist es, den von Moore selbst eingeschlagenen Begründungsweg weiterzugehen. Wir könnten fragen, ob Bradley oder McTaggart jemals bereit gewesen wären, entsprechend ihrer Bestreitung der Alltagswirklichkeit zu handeln... Es wäre dann Moores Anliegen, ihnen nachzuweisen, dass sie die von ihnen philosophisch bestrittenen Aussagen ihrem alltäglichen Verhalten als unerschütterliche Gewissheit zugrunde legten. Wir verstehen die Bedeutung der Aussagen des Common Sense. Davon ist nach Moore jedoch die Frage zu unterscheiden, wie sie zu analysieren sind. Sie sei bisher noch nicht befriedigend beantwortet worden. Das führt zu der vieldiskutierten Frage, was Moore unter "Analyse" versteht. In der Erwiderung an seine Kritiker betont Moore wiederholt, es sei ihm niemals um die Analyse sprachlicher Ausdrücke, sondern immer um die Analyse von Begriffen und Sachverhalten gegangen (Schilpp 1968, ). Er nennt drei Bedingungen einer Analyse: 1. Das analysandum und das analysans müssen beides Begriffe sein; bei einer korrekten Analyse muss es sich um denselben Begriff handeln. 2. Der Ausdruck für das analysandum muss sich von dem für das analysans unterscheiden. 3. Der Ausdruck für das analysans muss ausdrücklich Begriffe erwähnen, die der Ausdruck für das analysandum nicht ausdrücklich erwähnt. In "The Refutation of Idealism" schreibt Moore, seine Analyse der Wahrnehmung verstoße gegen die Sprache, die es nicht erlaube, Rot oder Grün als Objekte zu bezeichnen (1922, 19). Teil IV von "A Defence of Common Sense" diskutiert die Analyse der Aussage "Materielle Dinge existieren". Sie ist auf Aussagen über einzelne Wahrnehmungsgegenstände, z.b. eine Hand, zurückzuführen und diese wiederum auf Aussagen über Sinnesdaten. Wie aber verhalten die einzelnen Sinnesdaten sich zum Wahrnehmungsgegenstand als ganzem, die Hand? Moore diskutiert verschiedene Lösungsmöglichkeiten und zeigt deren Schwierigkeiten. Wichtiger ist die Frage, ob Moore mit der Analyse in Sinnesdaten die These von der bewusstseinsunabhängigen Wirklichkeit nicht aufgibt und zum idealistischen "esse est perzipi" zurückkehrt. In der Antwort an seine Kritiker vertritt Moore zwei, wie er selbst sieht, miteinander unvereinbare Auffassungen (Schilpp 1968, 658 f.). Er hält einerseits an der realistischen These fest: Im Sinnesdatum wird unmittelbar die Oberfläche eines physikalischen Körpers erfasst. Er neigt aber zugleich der idealistischen These zu, dass dem Sinnesdatum unabhängig von Wahrnehmungsakt keine Wirklichkeit zukomme. Wie bei Moores Begriff der Analyse stehen wir auch hier noch vor ungeklärten Fragen. Wie wäre es da mit kritischem Realismus bzw. mentalem Repräsentationalismus. Das hätte den Widerspruch vielleicht aufgehoben.
6 Moore schreibt in seiner Autobiographie, dass es die provozierenden Äußerungen der Philosophen, wie McTaggarts Bestreitung der Wirklichkeit der Zeit, und nicht Lebensprobleme waren, die ihn zum Philosophieren brachten. Sein Interesse war vor allem kritisch, und als Werkzeug der Kritik diente ihm die Analyse. Er wollte weniger Antworten geben als Fragestellungen und Begriffe klären und Fehlschlüsse aufdecken. Vieles bleibt bei ihm offen, auch in seiner Methode. Auch seinen eigenen Auffassungen und Arbeiten stand Moore immer in kritischer Distanz gegenüber. Durch sein auch die Grenze zur Trivialität nicht scheuendes Ringen um Klarheit und Eindeutigkeit, das sich in der Einfachheit seines Stils spiegelt, hat er, vor allem als Lehrer, einen kaum zu überschätzenden Einfluss auf die englische Philosophie in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Es gibt keinen naturalistischen Fehlschluss Ursprünglich hatte ich vor, hier einen Auszug aus dem ersten Teil der 2. Vorlesung der Einführung in die praktische Philosophie zu transkribieren, die Dietmar Hübner im Sommersemester 2014 an der Leibniz-Universität Hannover hielt Ich sehe jetzt doch einmal davon ab und verweise nur auf den Link zu dem Vortrag Entscheidend sind die Minuten 8.00 bis Hier ein Auszug daraus: "Fangen wir an mit dem naturalistischen Fehlschluss. Das ist ein sehr wichtiges, ein sehr bekanntes Konzept, denn wer so einen Fehlschluss begeht, macht nach Auffassung vieler Philosophen einen Anfängerfehler." (Hübner) (...) "Der grundsätzliche Gedanke hinter diesem Konzept ist: - aus bloßen Fakten folgen keine Normen - aus bloßen Tatsachenbehauptungen folgen keine Werturteile - aus bloßen Indikativen folgen keine Imperative - aus bloßen Seinsaussagen folgen keine Sollensaussagen Man spricht auch von Sein-Sollen-Fehlschluss (Humes Gesetz)..." (Hübner) Zwei Namen sind mit diesem Konzept insbesondere verbunden: einmal George Edward Moore, Philosoph aus dem frühen 20. Jahrhundert - von dem stammt der Begriff "naturalistischer Fehlschluss" - und zweitens David Hume, Philosoph aus dem 18. Jahrhundert; bei dem findet man schon das Konzept eines Sein-Sollen-Fehlschlusses" (Hübner) "Und weil das beides so nah miteinander verwandt ist, taucht häufig die Frage auf: Was hat denn Moore eigentlich Neues zu bieten gegenüber dem Hume. (...) Aber wir werden sehen, wenn wir genauer hinschauen, Moore hat durchaus ein bisschen etwas anderes zu bieten als Hume." (Hübner) Den klassischen Sein-Sollen-Fehlschluss bei Hume übergehe ich jetzt mal... "Selbst wenn man den Sein-Sollen-Fehlschluss vermeidet, kann man noch etwas falsch machen. Und das, was man dann falsch machen kann, das ist es, was Moore "naturalistischen Fehlschluss nennt. Und das hat er beschrieben in seinem berühmten Hauptwerk "Principia
7 Ethica": Es mag sein, dass alle Dinge, die Gut sind, auch etwas anderes und (nämlich Q). und es steht fest, dass die Ethik entdecken will, welches diese anderen Eigenschaften sind, die allen Dingen, die gut sind, zukommen. Aber viel zu viele Philosophen haben gemeint, dass sie, wenn sie dies anderen Eigenschaften nennen, tatsächlich "gut" definieren. Dass diese Eigenschaften in Wirklichkeit nicht andere seinen, sondern absolut und vollständig gleichbedeutend sind mit "Gutheit", diese Ansicht möchte ich den naturalistischen Fehlschluss nennen. (Moore) Das ist [also] der naturalistische Fehlschluss nach Moore." (Hübner) Moor ist der Meinung, dass der deontische Schluss zwar korrekt ist, aber "gut" nicht definiert werden kann... Wer also als Obersatz eines normativen Schlusses eine Definition von gut einsetzt, begeht - so Moore - den naturalistischen Fehlschluss... Das Problem ist, dass Moore sich das lediglich ausdenkt... Natürlich kann man "gut" definieren... Warum sollte man nicht? Alles ist definierbar... Auch der Begriff "gut"... Moore stellt hier einfach einen Behauptung auf, die absolut nicht begründet ist... Nur weil bis zu seiner Zeit der begriff "gut" nicht befriedigend definiert worden ist, heißt das doch nicht, dass eine Definition generell unmöglich ist... Aber dann auch noch die Frechheit zu besitzen, jedem anderen Philosophen einen Definitionsversuch von vornherein zu untersagen, ist einfach eine Dreistigkeit... Und so etwas stellt niemand in Frage? Seid Ihr eigentlich noch zu retten? Jetzt mal im Ernst... Dem hätte ich sofort und unbesehen eine Absage erteilt... Heute sind wir da wohl in einer ungleich komfortableren Situation, denn inzwischen steht uns eine echte und brauchbare Definition von Gut zur Verfügung: Gut ist, was niemandem schadet... Hätte Moore das ernsthaft bestreiten wollen? So ein Affentheater um nichts... Joachim Stiller Münster, 2016 Ende Zurück zur Startseite
Kunst, Wirklichkeit und Affirmation
 Kunst, Wirklichkeit und Affirmation Einige Gedanken zu Heideggers Kunstwerkaufsatz THOMAS HILGERS In welchem Verhältnis stehen Kunst, Wirklichkeit und Affirmation? Gehen wir davon aus, dass es hier überhaupt
Kunst, Wirklichkeit und Affirmation Einige Gedanken zu Heideggers Kunstwerkaufsatz THOMAS HILGERS In welchem Verhältnis stehen Kunst, Wirklichkeit und Affirmation? Gehen wir davon aus, dass es hier überhaupt
DIALOGE ÜBER NATÜRLICHE RELIGION
 DAVID HUME DIALOGE ÜBER NATÜRLICHE RELIGION NEUNTER TEIL, SEITEN 73-78 DER A PRIORI BEWEIS DER EXISTENZ GOTTES UND SEINER UNENDLICHEN ATTRIBUTE S. 73-74 Demea : Die Schwächen des a posteriori Beweises
DAVID HUME DIALOGE ÜBER NATÜRLICHE RELIGION NEUNTER TEIL, SEITEN 73-78 DER A PRIORI BEWEIS DER EXISTENZ GOTTES UND SEINER UNENDLICHEN ATTRIBUTE S. 73-74 Demea : Die Schwächen des a posteriori Beweises
Einführung in die Argumentationslehre
 Joachim Stiller Einführung in die Argumentationslehre Präsentation Alle Rechte vorbehalten 3.1 Argumentationslehre: Übersicht - Fehlargumente - Persönlicher Angriff, Argumentum ad personam - Totschlagargument
Joachim Stiller Einführung in die Argumentationslehre Präsentation Alle Rechte vorbehalten 3.1 Argumentationslehre: Übersicht - Fehlargumente - Persönlicher Angriff, Argumentum ad personam - Totschlagargument
Bertrand Russell: Leben und Werk
 Joachim Stiller Bertrand Russell: Leben und Werk Materialien zu Leben und Werk von Bertrand Russell Alle Rechte vorbehalten Bertrand Russell Leben und Werk Ich lasse nun einen Text von Ehlen, Haeffner
Joachim Stiller Bertrand Russell: Leben und Werk Materialien zu Leben und Werk von Bertrand Russell Alle Rechte vorbehalten Bertrand Russell Leben und Werk Ich lasse nun einen Text von Ehlen, Haeffner
Materialistische (physikalistische, naturalistische) Theorieansätze zum ontologischen Status von Bewusstsein
 2 Materialistische (physikalistische, naturalistische) Theorieansätze zum ontologischen Status von Bewusstsein 1. Der logische Behaviourismus Hauptvertreter: Gilbert Ryle, Carl Gustav Hempel Blütezeit:
2 Materialistische (physikalistische, naturalistische) Theorieansätze zum ontologischen Status von Bewusstsein 1. Der logische Behaviourismus Hauptvertreter: Gilbert Ryle, Carl Gustav Hempel Blütezeit:
Technische Universität Dresden Philosophische Fakultät Institut für Philosophie Professur für Wissenschaftstheorie und Logik
 Technische Universität Dresden Philosophische Fakultät Institut für Philosophie Professur für Wissenschaftstheorie und Logik Kausaltheorien Dr. Uwe Scheffler Referentinnen: Teresa Bobach & Mandy Hendel
Technische Universität Dresden Philosophische Fakultät Institut für Philosophie Professur für Wissenschaftstheorie und Logik Kausaltheorien Dr. Uwe Scheffler Referentinnen: Teresa Bobach & Mandy Hendel
Paradoxien der Replikation
 Joachim Stiller Paradoxien der Replikation Alle Rechte vorbehalten Paradoxien Die Paradoxien (Wiki) Hier einmal Auszüge aus dem Wiki-Artikel zum Begriff Paradoxon Ein Paradox(on) (auch Paradoxie, Plural
Joachim Stiller Paradoxien der Replikation Alle Rechte vorbehalten Paradoxien Die Paradoxien (Wiki) Hier einmal Auszüge aus dem Wiki-Artikel zum Begriff Paradoxon Ein Paradox(on) (auch Paradoxie, Plural
4. Das Problem der möglichen und unmöglichen Gegenstände
 4. Das Problem der möglichen und unmöglichen Gegenstände Betrachten wir folgende Sätze: (1) Der goldene Berg ist golden. (2) Das runde Viereck ist rund. (3) Das Perpetuum mobile ist identisch mit dem Perpetuum
4. Das Problem der möglichen und unmöglichen Gegenstände Betrachten wir folgende Sätze: (1) Der goldene Berg ist golden. (2) Das runde Viereck ist rund. (3) Das Perpetuum mobile ist identisch mit dem Perpetuum
Mathem.Grundlagen der Computerlinguistik I, WS 2004/05, H. Leiß 1
 Mathem.Grundlagen der Computerlinguistik I, WS 2004/05, H. Leiß 1 1 Vorbemerkungen Mathematische Begriffe und Argumentationsweisen sind in vielen Fällen nötig, wo man über abstrakte Objekte sprechen und
Mathem.Grundlagen der Computerlinguistik I, WS 2004/05, H. Leiß 1 1 Vorbemerkungen Mathematische Begriffe und Argumentationsweisen sind in vielen Fällen nötig, wo man über abstrakte Objekte sprechen und
Taalfilosofie 2009/2010
 Taalfilosofie 2009/2010 Thomas.Mueller@phil.uu.nl 24 februari 2010: Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus http://www.phil.uu.nl/taalfilosofie/2009/ Tractatus: Ontologie 1 Die Welt ist alles,
Taalfilosofie 2009/2010 Thomas.Mueller@phil.uu.nl 24 februari 2010: Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus http://www.phil.uu.nl/taalfilosofie/2009/ Tractatus: Ontologie 1 Die Welt ist alles,
Die Einheit der Natur
 Die Einheit der Natur Studien von Carl Friedrich von Weizsäcker Deutscher Taschenbuch Verlag Vorwort 9 Einleitung 11 Teill. Wissenschaft, Sprache und Methode 17 I 1. Wie wird und soll die Rolle der Wissenschaft
Die Einheit der Natur Studien von Carl Friedrich von Weizsäcker Deutscher Taschenbuch Verlag Vorwort 9 Einleitung 11 Teill. Wissenschaft, Sprache und Methode 17 I 1. Wie wird und soll die Rolle der Wissenschaft
Erkenntnis: Was kann ich wissen?
 Erkenntnis: Was kann ich wissen? Philosophie Die Grundfragen Immanuel Kants Hochschule Aalen, 26.03.18 Karl Mertens Immanuel Kant, Logik (AA IX, 23-25, bes. 25): "Philosophie ist also das System der philosophischen
Erkenntnis: Was kann ich wissen? Philosophie Die Grundfragen Immanuel Kants Hochschule Aalen, 26.03.18 Karl Mertens Immanuel Kant, Logik (AA IX, 23-25, bes. 25): "Philosophie ist also das System der philosophischen
EINFÜHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE
 EDITH STEIN EINFÜHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE NACHWORT VON HANNA-BARBARA GERL HERDER FREIBURG BASEL WIEN Vorwort 5 Einleitung der Herausgeber 7 EINFÜHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE Einleitung: A. Aufgabe der Philosophie
EDITH STEIN EINFÜHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE NACHWORT VON HANNA-BARBARA GERL HERDER FREIBURG BASEL WIEN Vorwort 5 Einleitung der Herausgeber 7 EINFÜHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE Einleitung: A. Aufgabe der Philosophie
Anselm von Canterbury
 Anselm von Canterbury *1034 in Aosta/Piemont Ab 1060 Novize, dann Mönch der Benediktinerabtei Bec ab 1078: Abt des Klosters von Bec 1093: Erzbischof von Canterbury *1109 in Canterbury 1076 Monologion (
Anselm von Canterbury *1034 in Aosta/Piemont Ab 1060 Novize, dann Mönch der Benediktinerabtei Bec ab 1078: Abt des Klosters von Bec 1093: Erzbischof von Canterbury *1109 in Canterbury 1076 Monologion (
Wissenschaftstheorie und Ethik
 Wissenschaftstheorie und Ethik Kritischer Rationalismus (KR) Doz. Dr. Georg Quaas: Wissenschaftstheorie und Ethik, SoSe 2012 1 3.4 Kritik des Psychologismus in der Erkenntnistheorie Gegenstand: Erkenntnis
Wissenschaftstheorie und Ethik Kritischer Rationalismus (KR) Doz. Dr. Georg Quaas: Wissenschaftstheorie und Ethik, SoSe 2012 1 3.4 Kritik des Psychologismus in der Erkenntnistheorie Gegenstand: Erkenntnis
INHALTSVERZEICHNIS ERSTER TEIL: KANT VORWORT... 7 INHALTSVERZEICHNIS... 9 SIGLENVERZEICHNIS... 15
 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT... 7 INHALTSVERZEICHNIS... 9 SIGLENVERZEICHNIS... 15 EINLEITUNG: DIE KOPERNIKANISCHE WENDE IN DER PHILOSOPHIE... 17 ZUSAMMENFASSUNG... 27 ERSTER TEIL: KANT... 31 KAPITEL 1 EINFÜHRUNG
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT... 7 INHALTSVERZEICHNIS... 9 SIGLENVERZEICHNIS... 15 EINLEITUNG: DIE KOPERNIKANISCHE WENDE IN DER PHILOSOPHIE... 17 ZUSAMMENFASSUNG... 27 ERSTER TEIL: KANT... 31 KAPITEL 1 EINFÜHRUNG
Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori
 Geisteswissenschaft Pola Sarah Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori Essay Essay zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a
Geisteswissenschaft Pola Sarah Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori Essay Essay zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a
Zu "Ein Brief über Toleranz" von John Locke
 Geisteswissenschaft Nicole Lenz Zu "Ein Brief über Toleranz" von John Locke Essay Wörter: 3460 Diskussion/Essay zum Text Ein Brief über Toleranz" von John Locke 0 Ich habe den Text "Ein Brief über Toleranz"
Geisteswissenschaft Nicole Lenz Zu "Ein Brief über Toleranz" von John Locke Essay Wörter: 3460 Diskussion/Essay zum Text Ein Brief über Toleranz" von John Locke 0 Ich habe den Text "Ein Brief über Toleranz"
Grundlagen der Philosophie
 1 Grundlagen der Philosophie Was ist ein Philosoph? Nennen Sie zwei Bedeutungen. Elenktik? Maieutik? Charakterisieren Sie den Begriff des Staunens. Stellen Sie fünf typische philosophische Fragen. Erklären
1 Grundlagen der Philosophie Was ist ein Philosoph? Nennen Sie zwei Bedeutungen. Elenktik? Maieutik? Charakterisieren Sie den Begriff des Staunens. Stellen Sie fünf typische philosophische Fragen. Erklären
Versuch einer Annäherung an den Begriff der Monade und an die Beziehung zwischen Seele und Körper in der Monadologie von Leibniz
 Versuch einer Annäherung an den Begriff der Monade und an die Beziehung zwischen Seele und Körper in der Monadologie von Leibniz Der Lernende versucht im ersten Teil zu verstehen, wie Leibniz die Monade
Versuch einer Annäherung an den Begriff der Monade und an die Beziehung zwischen Seele und Körper in der Monadologie von Leibniz Der Lernende versucht im ersten Teil zu verstehen, wie Leibniz die Monade
PHÄNOMENOLOGIE UND IDEE
 JÜRGEN BRANKEL PHÄNOMENOLOGIE UND IDEE VERLAG TURIA + KANT WIEN BERLIN Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
JÜRGEN BRANKEL PHÄNOMENOLOGIE UND IDEE VERLAG TURIA + KANT WIEN BERLIN Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Paradoxien der falschen Meinung in Platons "Theätet"
 Geisteswissenschaft Anonym Paradoxien der falschen Meinung in Platons "Theätet" Essay Paradoxien der falschen Meinung in Platons Theätet Einleitung (S.1) (I) Wissen und Nichtwissen (S.1) (II) Sein und
Geisteswissenschaft Anonym Paradoxien der falschen Meinung in Platons "Theätet" Essay Paradoxien der falschen Meinung in Platons Theätet Einleitung (S.1) (I) Wissen und Nichtwissen (S.1) (II) Sein und
Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare
 Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare *1919 Bristol während des 2. Weltkriegs mehr als drei Jahre in japanischer Kriegsgefangenschaft 1947 Abschluss seines Studiums in Philosophie und Altphilologie
Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare *1919 Bristol während des 2. Weltkriegs mehr als drei Jahre in japanischer Kriegsgefangenschaft 1947 Abschluss seines Studiums in Philosophie und Altphilologie
Die neue Prädikatenlogik P2
 Joachim Stiller Die neue Prädikatenlogik P2 Versuch einer Begründung Alle Rechte vorbehalten Die neue Prädikatenlogik P2 In diesem Aufsatz möchte ich einmal versuchen, meine neue Prädikatenlogik P2 zu
Joachim Stiller Die neue Prädikatenlogik P2 Versuch einer Begründung Alle Rechte vorbehalten Die neue Prädikatenlogik P2 In diesem Aufsatz möchte ich einmal versuchen, meine neue Prädikatenlogik P2 zu
Einführung in die Logik
 Einführung in die Logik Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2001/2 Allgemeines vorab Wie es abläuft Vorlesung (Grundlage: Ansgar Beckermann. Einführung in die Logik. (Sammlung Göschen Bd. 2243)
Einführung in die Logik Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2001/2 Allgemeines vorab Wie es abläuft Vorlesung (Grundlage: Ansgar Beckermann. Einführung in die Logik. (Sammlung Göschen Bd. 2243)
Einführung in das Recht und die Rechtswissenschaft
 Einführung in das Recht und die Rechtswissenschaft 12. Dezember 2018 07.45 bis 09.00 Uhr Simplex sigillum veri. Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, Bd. II, 121 Wintersemester 2018/2019 Universität
Einführung in das Recht und die Rechtswissenschaft 12. Dezember 2018 07.45 bis 09.00 Uhr Simplex sigillum veri. Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, Bd. II, 121 Wintersemester 2018/2019 Universität
Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat?
 Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Thomas von Aquin. Einer der wichtigsten Philosophen der Scholastik; verbindet Philosophie des Aristoteles mit christlicher Theologie
 Thomas von Aquin *1224 (1225?) bei Aquino ab ca. 1230 Schüler des Benediktinerklosters auf dem Monte Cassino Studium in Neapel 1243: Eintritt in den Dominikanerorden ab 1244 Studien in Bologna, Paris und
Thomas von Aquin *1224 (1225?) bei Aquino ab ca. 1230 Schüler des Benediktinerklosters auf dem Monte Cassino Studium in Neapel 1243: Eintritt in den Dominikanerorden ab 1244 Studien in Bologna, Paris und
DAS PLURALISTISCHE UNIVERSUM
 WILLIAM JAMES DAS PLURALISTISCHE UNIVERSUM Vorlesungen über die gegenwärtige Lage der Philosophie Ins Deutsche übertragen von JULIUS GOLDSTEIN Mit einer neuen Einführung herausgegeben von KLAUS SCHUBERT
WILLIAM JAMES DAS PLURALISTISCHE UNIVERSUM Vorlesungen über die gegenwärtige Lage der Philosophie Ins Deutsche übertragen von JULIUS GOLDSTEIN Mit einer neuen Einführung herausgegeben von KLAUS SCHUBERT
Entwicklung der modernen Naturwissenschaft (speziell der Physik/Mechanik) in Abgrenzung von der mittelalterlich-scholastischen Naturphilosophie
 René Descartes (1596-1650) Meditationen über die Grundlagen der Philosophie (1641) Geistes- bzw. wissenschaftsgeschichtlicher Hintergrund Entwicklung der modernen Naturwissenschaft (speziell der Physik/Mechanik)
René Descartes (1596-1650) Meditationen über die Grundlagen der Philosophie (1641) Geistes- bzw. wissenschaftsgeschichtlicher Hintergrund Entwicklung der modernen Naturwissenschaft (speziell der Physik/Mechanik)
Der metaethische Relativismus
 Geisteswissenschaft Julia Pech Der metaethische Relativismus Was spricht für/gegen eine relativistische Position in der Moral? Essay Julia Pech 8.5.2011 Universität Stuttgart Proseminar: Einführung in
Geisteswissenschaft Julia Pech Der metaethische Relativismus Was spricht für/gegen eine relativistische Position in der Moral? Essay Julia Pech 8.5.2011 Universität Stuttgart Proseminar: Einführung in
Die franz. Materialisten
 Die franz. Materialisten Julien-Offray de la Mettrie *1709 St. Malo, 1751 Berlin Claude Adrien Helvetius *1715 Paris, 1771 Versailles 1 La Mettrie Hauptwerke: Naturgeschichte der Seele, 1745 Der Mensch
Die franz. Materialisten Julien-Offray de la Mettrie *1709 St. Malo, 1751 Berlin Claude Adrien Helvetius *1715 Paris, 1771 Versailles 1 La Mettrie Hauptwerke: Naturgeschichte der Seele, 1745 Der Mensch
Was es gibt und wie es ist
 Was es gibt und wie es ist Dritte Sitzung Existenzfragen 0. Zur Erinnerung Benjamin Schnieder Philosophisches Seminar der Universität Hamburg 0 1 Was ist die Ontologie? Platons Bart Eine Standard-Antwort
Was es gibt und wie es ist Dritte Sitzung Existenzfragen 0. Zur Erinnerung Benjamin Schnieder Philosophisches Seminar der Universität Hamburg 0 1 Was ist die Ontologie? Platons Bart Eine Standard-Antwort
EDITH SCHMID UND EMIL KRAUCH FREGE II SINN UND BEDEUTUNG
 EDITH SCHMID UND EMIL KRAUCH FREGE II SINN UND BEDEUTUNG AUFBAU Einführung Ausgangslage Problemstellung Sinn und Bedeutung Freges Argument vom Erkenntniswert Exkurs: Semiotik Sätze Zusammenfassung Reflexion
EDITH SCHMID UND EMIL KRAUCH FREGE II SINN UND BEDEUTUNG AUFBAU Einführung Ausgangslage Problemstellung Sinn und Bedeutung Freges Argument vom Erkenntniswert Exkurs: Semiotik Sätze Zusammenfassung Reflexion
DER INDIVIDUELLE MYTHOS DES NEUROTIKERS
 DER INDIVIDUELLE MYTHOS DES NEUROTIKERS LACANS PARADOXA Was Sie eine Analyse lehrt, ist auf keinem anderen Weg zu erwerben, weder durch Unterricht noch durch irgendeine andere geistige Übung. Wenn nicht,
DER INDIVIDUELLE MYTHOS DES NEUROTIKERS LACANS PARADOXA Was Sie eine Analyse lehrt, ist auf keinem anderen Weg zu erwerben, weder durch Unterricht noch durch irgendeine andere geistige Übung. Wenn nicht,
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
sich die Schuhe zubinden können den Weg zum Bahnhof kennen die Quadratwurzel aus 169 kennen
 Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // lehre@nimtz.net Grundfragen der Erkenntnistheorie Kapitel 2: Die klassische Analyse des Begriffs des Wissens 1 Varianten des Wissens 2 Was ist das Ziel der Analyse
Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // lehre@nimtz.net Grundfragen der Erkenntnistheorie Kapitel 2: Die klassische Analyse des Begriffs des Wissens 1 Varianten des Wissens 2 Was ist das Ziel der Analyse
Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.
 16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie
 1 Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie Einführungsphase EPH.1: Einführung in die Philosophie Was ist Philosophie? (Die offene Formulierung der Lehrpläne der EPH.1 lässt hier die Möglichkeit,
1 Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie Einführungsphase EPH.1: Einführung in die Philosophie Was ist Philosophie? (Die offene Formulierung der Lehrpläne der EPH.1 lässt hier die Möglichkeit,
die Klärung philosophischer Sachfragen und Geschichte der Philosophie
 Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // christian.nimtz@phil.uni erlangen.de Theoretische Philosophie der Gegenwart 1 2 3 Unser Programm in diesem Semester Einführung Man unterscheidet in der Philosophie
Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // christian.nimtz@phil.uni erlangen.de Theoretische Philosophie der Gegenwart 1 2 3 Unser Programm in diesem Semester Einführung Man unterscheidet in der Philosophie
Wissenschaftliches Arbeiten
 Teil 7: Argumentieren und Begründen 1 Grundregel: Spezifisch argumentieren Wissenschaftliches Arbeiten Nie mehr zeigen, als nötig oder gefragt ist. Sonst wird das Argument angreifbar und umständlich. Schwammige
Teil 7: Argumentieren und Begründen 1 Grundregel: Spezifisch argumentieren Wissenschaftliches Arbeiten Nie mehr zeigen, als nötig oder gefragt ist. Sonst wird das Argument angreifbar und umständlich. Schwammige
Immanuel Kant. *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg
 Immanuel Kant *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg ab 1770 ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik an der Universität Königsberg Neben Hegel wohl der bedeutendste deutsche
Immanuel Kant *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg ab 1770 ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik an der Universität Königsberg Neben Hegel wohl der bedeutendste deutsche
Geisteswissenschaft. Carolin Wiechert. Was ist Sprache? Über Walter Benjamins Text Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen.
 Geisteswissenschaft Carolin Wiechert Was ist Sprache? Über Walter Benjamins Text Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen Essay Veranstaltung: W. Benjamin: Über das Programm der kommenden
Geisteswissenschaft Carolin Wiechert Was ist Sprache? Über Walter Benjamins Text Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen Essay Veranstaltung: W. Benjamin: Über das Programm der kommenden
Themenvorschläge Philosophie
 Themenvorschläge Philosophie Der Philosophieunterricht: Wie wurde in den vergangenen Jahrhunderten an den Gymnasien des Kantons Luzern Philosophie unterrichtet? Welche Lehrbücher wurden verwendet? Was
Themenvorschläge Philosophie Der Philosophieunterricht: Wie wurde in den vergangenen Jahrhunderten an den Gymnasien des Kantons Luzern Philosophie unterrichtet? Welche Lehrbücher wurden verwendet? Was
David Hume zur Kausalität
 David Hume zur Kausalität Und welcher stärkere Beweis als dieser konnte für die merkwürdige Schwäche und Unwissenheit des Verstandes beigebracht werden? Wenn irgend eine Beziehung zwischen Dingen vollkommen
David Hume zur Kausalität Und welcher stärkere Beweis als dieser konnte für die merkwürdige Schwäche und Unwissenheit des Verstandes beigebracht werden? Wenn irgend eine Beziehung zwischen Dingen vollkommen
Prof. Dr. Tim Henning
 Prof. Dr. Tim Henning Vorlesung Einführung in die Metaethik 127162001 Mittwoch, 11.30-13.00 Uhr M 18.11 19.10.2016 PO 09 / GymPO PO 14 / BEd 1-Fach-Bachelor: BM4 KM2 Bachelor Nebenfach (neu): KM2 KM2 Lehramt:
Prof. Dr. Tim Henning Vorlesung Einführung in die Metaethik 127162001 Mittwoch, 11.30-13.00 Uhr M 18.11 19.10.2016 PO 09 / GymPO PO 14 / BEd 1-Fach-Bachelor: BM4 KM2 Bachelor Nebenfach (neu): KM2 KM2 Lehramt:
Untersuchung zur ontologischen Wahrheit der menschlichen Person:
 Untersuchung zur ontologischen Wahrheit der menschlichen Person: Gutsein als Berufung der menschlichen Person Raphael E. Bexten Betreuer: Prof. Dr. Michael Wladika Universität Wien Institut für Philosophie
Untersuchung zur ontologischen Wahrheit der menschlichen Person: Gutsein als Berufung der menschlichen Person Raphael E. Bexten Betreuer: Prof. Dr. Michael Wladika Universität Wien Institut für Philosophie
Ethik. Kritischer Rationalismus (KR) Doz. Dr. Georg Quaas: Vorlesung zur Wissenschaftstheorie und Ethik 1
 Wissenschaftstheorie und Ethik Kritischer Rationalismus (KR) Doz. Dr. Georg Quaas: Vorlesung zur Wissenschaftstheorie und Ethik 1 13. Kausale Erklärung Erklärung und Prognose: zwei fundamentale Leistungen
Wissenschaftstheorie und Ethik Kritischer Rationalismus (KR) Doz. Dr. Georg Quaas: Vorlesung zur Wissenschaftstheorie und Ethik 1 13. Kausale Erklärung Erklärung und Prognose: zwei fundamentale Leistungen
Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie
 Philosophie schulinternes Curriculum für die EF Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie - unterscheiden philosophische Fragen
Philosophie schulinternes Curriculum für die EF Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie - unterscheiden philosophische Fragen
Die naturalistische Verteidigung des wissenschaftlichen Realismus
 Christian Suhm Westfälische Wilhelms-Universität Münster Philosophisches Seminar Domplatz 23 48143 Münster Email: suhm@uni-muenster.de Anhörungsvortrag am Institut für Philosophie in Oldenburg (04.02.2004)
Christian Suhm Westfälische Wilhelms-Universität Münster Philosophisches Seminar Domplatz 23 48143 Münster Email: suhm@uni-muenster.de Anhörungsvortrag am Institut für Philosophie in Oldenburg (04.02.2004)
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase
 Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Inhalt. II. Hegels Phänomenologie des Geistes" Interpretation der Einleitung" und der Teile Bewußtsein", Selbstbewußtsein" und Vernunft"
 Inhalt I. Erläuternde Vorbemerkungen zum kosmo-ontologischen Denkansatz in Hegels Phänomenologie des Geistes" und zum Zugang über eine phänomenologisdie Interpretation /. Die phänomenologische Methode
Inhalt I. Erläuternde Vorbemerkungen zum kosmo-ontologischen Denkansatz in Hegels Phänomenologie des Geistes" und zum Zugang über eine phänomenologisdie Interpretation /. Die phänomenologische Methode
Profilkurs. Schulinternes Curriculum Philosophie. Einführung in das Philosophieren
 Schulinternes Curriculum Philosophie Profilkurs Einführung in das Philosophieren Anhand der vier Fragen Kants Philosophiegeschichte im Überblick sowie Überblick über die zentralen Fragen der Reflexionsbereiche
Schulinternes Curriculum Philosophie Profilkurs Einführung in das Philosophieren Anhand der vier Fragen Kants Philosophiegeschichte im Überblick sowie Überblick über die zentralen Fragen der Reflexionsbereiche
Schließt die Wissenschaft die Existenz Gottes aus?
 Schließt die Wissenschaft die Existenz Gottes aus? Raphael E. Bexten Gespräch mit Jugendlichen herausgeber@xyz.de (ersetze XYZ durch aemaet ) urn:nbn:de:0288-20130928923 19.03.2015 Raphael E. Bexten (http://aemaet.de)
Schließt die Wissenschaft die Existenz Gottes aus? Raphael E. Bexten Gespräch mit Jugendlichen herausgeber@xyz.de (ersetze XYZ durch aemaet ) urn:nbn:de:0288-20130928923 19.03.2015 Raphael E. Bexten (http://aemaet.de)
Wie verstehen wir etwas? sprachliche Äußerungen. Sprachphilosophie, Bedeutungstheorie. Personen mit ihren geistigen Eigenschaften in der Welt
 Donald Davidson *1917 in Springfield, Massachusetts, USA Studium in Harvard, 1941 abgeschlossen mit einem Master in Klassischer Philosophie 1949 Promotion in Harvard über Platons Philebus Unter Quines
Donald Davidson *1917 in Springfield, Massachusetts, USA Studium in Harvard, 1941 abgeschlossen mit einem Master in Klassischer Philosophie 1949 Promotion in Harvard über Platons Philebus Unter Quines
Die Anfänge der Logik
 Die Anfänge der Logik Die Entwicklung des logischen Denkens vor Aristoteles Holger Arnold Universität Potsdam, Institut für Informatik arnold@cs.uni-potsdam.de Grundfragen Was ist Logik? Logik untersucht
Die Anfänge der Logik Die Entwicklung des logischen Denkens vor Aristoteles Holger Arnold Universität Potsdam, Institut für Informatik arnold@cs.uni-potsdam.de Grundfragen Was ist Logik? Logik untersucht
Essaypreis des Zentrums für Wissenschaftstheorie, Münster im Wintersemester 2010/ Platz. Helen Wagner
 Essaypreis des Zentrums für Wissenschaftstheorie, Münster im Wintersemester 2010/11 3. Platz Helen Wagner Ein Vergleich zwischen Pragmatismus und Rationalismus anhand der Pragmatismustheorie von William
Essaypreis des Zentrums für Wissenschaftstheorie, Münster im Wintersemester 2010/11 3. Platz Helen Wagner Ein Vergleich zwischen Pragmatismus und Rationalismus anhand der Pragmatismustheorie von William
Literatur. Prof. Dr. Christian Nimtz //
 Literatur Prof. Dr. Christian Nimtz www.nimtz.net // lehre@nimtz.net Philosophie des Geistes Kapitel 5: Einwände gegen die Identitätstheorie I: Smarts klassische Einwände J.J.C. Smart: Sensations and Brain
Literatur Prof. Dr. Christian Nimtz www.nimtz.net // lehre@nimtz.net Philosophie des Geistes Kapitel 5: Einwände gegen die Identitätstheorie I: Smarts klassische Einwände J.J.C. Smart: Sensations and Brain
annehmen müssen, um dem Bild des Universums, das uns von kosmologischen Beobachtungen nahegelegt wird, einen Sinn abzugewinnen. Das ist es, was ich
 annehmen müssen, um dem Bild des Universums, das uns von kosmologischen Beobachtungen nahegelegt wird, einen Sinn abzugewinnen. Das ist es, was ich unter der Wiedergeburt der Zeit verstehe. Ein Großteil
annehmen müssen, um dem Bild des Universums, das uns von kosmologischen Beobachtungen nahegelegt wird, einen Sinn abzugewinnen. Das ist es, was ich unter der Wiedergeburt der Zeit verstehe. Ein Großteil
Was ist Zeit? BA-Seminar Dienstags, Uhr c.t. Raum E006
 BA-Seminar Dienstags, 12-14 Uhr c.t. Raum E006 Wie sollten wir über die Zeit reden? Ist sie eine Substanz oder ein Subjekt? Können wir überhaupt die Zeit nicht-metaphorisch beschreiben? Ist die Zeit ein
BA-Seminar Dienstags, 12-14 Uhr c.t. Raum E006 Wie sollten wir über die Zeit reden? Ist sie eine Substanz oder ein Subjekt? Können wir überhaupt die Zeit nicht-metaphorisch beschreiben? Ist die Zeit ein
Einführung in die Metaphysik
 Joachim Stiller Einführung in die Metaphysik Präsentation Alle Rechte vorbehalten 5.1 Metaphysik (Ontologie): Übersicht - Seinsontologie - Sein, Seiendes (ontologische Differenz) - Substanzontologie -
Joachim Stiller Einführung in die Metaphysik Präsentation Alle Rechte vorbehalten 5.1 Metaphysik (Ontologie): Übersicht - Seinsontologie - Sein, Seiendes (ontologische Differenz) - Substanzontologie -
Ἀταραξία (Ataraxia/Gelassenheit) und Anything goes Sextus Empiricus und Paul Feyerabend
 Vorbemerkung Ἀταραξία (Ataraxia/Gelassenheit) und Anything goes Sextus Empiricus und Paul Feyerabend Sextus Empiricus Griechischer Arzt und Skeptischer Philosoph Um 200-250 n.chr. Setzte sich zb in Adversus
Vorbemerkung Ἀταραξία (Ataraxia/Gelassenheit) und Anything goes Sextus Empiricus und Paul Feyerabend Sextus Empiricus Griechischer Arzt und Skeptischer Philosoph Um 200-250 n.chr. Setzte sich zb in Adversus
Physik und Metaphysik
 WWU Münster Studium im Alter Eröffnungsvortrag 27. März 2007 Physik und Metaphysik Prof. Dr. G. Münster Institut für Theoretische Physik Zentrum für Wissenschaftstheorie Was ist Physik? Was ist Metaphysik?
WWU Münster Studium im Alter Eröffnungsvortrag 27. März 2007 Physik und Metaphysik Prof. Dr. G. Münster Institut für Theoretische Physik Zentrum für Wissenschaftstheorie Was ist Physik? Was ist Metaphysik?
DER DEUTSCHE IDEALISMUS (FICHTE, SCHELLING, HEGEL) UND DIE PHILOSOPHISCHE PROBLEMLAGE DER GEGENWART
 MARTIN HEIDEGGER DER DEUTSCHE IDEALISMUS (FICHTE, SCHELLING, HEGEL) UND DIE PHILOSOPHISCHE PROBLEMLAGE DER GEGENWART El VITTORIO KLOSTERMANN FRANKFURT AM MAIN L }0 -/* INHALT EINLEITUNG Die gegenwärtige
MARTIN HEIDEGGER DER DEUTSCHE IDEALISMUS (FICHTE, SCHELLING, HEGEL) UND DIE PHILOSOPHISCHE PROBLEMLAGE DER GEGENWART El VITTORIO KLOSTERMANN FRANKFURT AM MAIN L }0 -/* INHALT EINLEITUNG Die gegenwärtige
Einführungsphase. Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was ist und was soll Philosophie? Mythos, Religion und Wissenschaft
 Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was ist und was soll Philosophie? Mythos, Religion und Wissenschaft erkennen die Besonderheit philosophischen Denkens und d.h. philosophischen Fragens und
Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was ist und was soll Philosophie? Mythos, Religion und Wissenschaft erkennen die Besonderheit philosophischen Denkens und d.h. philosophischen Fragens und
Ein Gottesbeweis. Die Voraussetzung des Seins ist das Nichts. 1. Die Verachtung des Immateriellen
 Ein Gottesbeweis Die Voraussetzung des Seins ist das Nichts 1. Die Verachtung des Immateriellen Das einheitliche Weltbild des Westens ist der philosophische Materialismus. Fragen nach dem Immateriellen
Ein Gottesbeweis Die Voraussetzung des Seins ist das Nichts 1. Die Verachtung des Immateriellen Das einheitliche Weltbild des Westens ist der philosophische Materialismus. Fragen nach dem Immateriellen
Die analytische Tradition
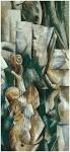 Die analytische Tradition lingustic turn : Wende von der Bewusstseins- zur Sprachphilosophie ab Ende des 19. bzw. Beginn des 20. Jahrhunderts Die analytische Tradition Die Philosophie ist ein Kampf gegen
Die analytische Tradition lingustic turn : Wende von der Bewusstseins- zur Sprachphilosophie ab Ende des 19. bzw. Beginn des 20. Jahrhunderts Die analytische Tradition Die Philosophie ist ein Kampf gegen
Ergänzungsfach Philosophie
 Raffael, School of Athens, Central Gro. Retrieved from Encyclopædia Britannica ImageQuest. https://quest.eb.com/search/109_240939/1/109_240939. 2018/01/31/ Philosophie Die Philosophie (griechisch: Liebe
Raffael, School of Athens, Central Gro. Retrieved from Encyclopædia Britannica ImageQuest. https://quest.eb.com/search/109_240939/1/109_240939. 2018/01/31/ Philosophie Die Philosophie (griechisch: Liebe
Grundkurs Mystik Mystik für Praktiker
 1 Copyright Disclaimer Grundkurs Mystik Mystik für Praktiker" Ein E-Book der Hohen Feste http://www.hohe-feste.at Erlaube dir selbst, große Träume zu haben. Denn nur sie, helfen dir dabei, dein wahres
1 Copyright Disclaimer Grundkurs Mystik Mystik für Praktiker" Ein E-Book der Hohen Feste http://www.hohe-feste.at Erlaube dir selbst, große Träume zu haben. Denn nur sie, helfen dir dabei, dein wahres
Physikalismus. Vorlesung: Was ist Naturalismus? FS 13 / Di / Markus Wild & Rebekka Hufendiek. Sitzung 7 ( )
 Physikalismus Vorlesung: Was ist Naturalismus? FS 13 / Di 10-12 / Markus Wild & Rebekka Hufendiek Sitzung 7 (26.3.13) Physikalismus? Allgemeine metaphysische These (Metaphysica generalis): Alles, was existiert,
Physikalismus Vorlesung: Was ist Naturalismus? FS 13 / Di 10-12 / Markus Wild & Rebekka Hufendiek Sitzung 7 (26.3.13) Physikalismus? Allgemeine metaphysische These (Metaphysica generalis): Alles, was existiert,
Entwicklung der modernen Naturwissenschaft (speziell der Physik/Mechanik) in Abgrenzung von der mittelalterlich-scholastischen Naturphilosophie
 René Descartes (Rationalismus, Leib-Seele-Dualismus) *31. März 1596 (Le Haye) 1604-1612 Ausbildung im Jesuitenkolleg La Flêche 1616 Baccalaureat und Lizenziat der Rechte an der Fakultät zu Poitiers. Vielfältige
René Descartes (Rationalismus, Leib-Seele-Dualismus) *31. März 1596 (Le Haye) 1604-1612 Ausbildung im Jesuitenkolleg La Flêche 1616 Baccalaureat und Lizenziat der Rechte an der Fakultät zu Poitiers. Vielfältige
Sicherer, nicht sinnvoll bezweifelbarer Ausgangspunkt des Denkens: Ich existiere.
 Descartes, Zweite Meditation Sicherer, nicht sinnvoll bezweifelbarer Ausgangspunkt des Denkens: Ich existiere. Das ist selbst dann nicht bezweifelbar, wenn ich in Betracht ziehe, dass es einen allmächtigen
Descartes, Zweite Meditation Sicherer, nicht sinnvoll bezweifelbarer Ausgangspunkt des Denkens: Ich existiere. Das ist selbst dann nicht bezweifelbar, wenn ich in Betracht ziehe, dass es einen allmächtigen
Schulinterner Lehrplan Gymnasium Lohmar zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe. Philosophie
 Schulinterner Lehrplan Gymnasium Lohmar zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Philosophie Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben EF Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was können wir mit Gewissheit erkennen?
Schulinterner Lehrplan Gymnasium Lohmar zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Philosophie Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben EF Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was können wir mit Gewissheit erkennen?
PROSEMINAR: BRITISCHER EMPIRISMUS LOCKE, BERKELEY, HUME
 HS 2014 Dienstag, 15 17, wöchentlich Raum MIS03 3026 PROSEMINAR: BRITISCHER EMPIRISMUS LOCKE, BERKELEY, HUME SEMINARPLAN Florian Wüstholz, MA Büro 5242A Sprechstunde: Freitag 10 11 (oder nach Vereinbarung)
HS 2014 Dienstag, 15 17, wöchentlich Raum MIS03 3026 PROSEMINAR: BRITISCHER EMPIRISMUS LOCKE, BERKELEY, HUME SEMINARPLAN Florian Wüstholz, MA Büro 5242A Sprechstunde: Freitag 10 11 (oder nach Vereinbarung)
Methoden des Wissenschaftlichen Arbeitens Vorlesung im Sommersemester VL 2: Was ist Wissenschaft?
 Methoden des Wissenschaftlichen Arbeitens Vorlesung im Sommersemester 2017 04.05.17 VL 2: Was ist Wissenschaft? Prof. Dr. Riklef Rambow Fachgebiet Architekturkommunikation Institut Entwerfen, Kunst und
Methoden des Wissenschaftlichen Arbeitens Vorlesung im Sommersemester 2017 04.05.17 VL 2: Was ist Wissenschaft? Prof. Dr. Riklef Rambow Fachgebiet Architekturkommunikation Institut Entwerfen, Kunst und
Donald Davidson ( )
 Foliensatz Davidson zur Einführung.doc Jasper Liptow 1/9 Donald Davidson (1917-2003) Geb. am 6. März 1917 in Springfield, Mass. Studium der Literaturwissenschaft und Philosophiegeschichte (u.a. bei A.
Foliensatz Davidson zur Einführung.doc Jasper Liptow 1/9 Donald Davidson (1917-2003) Geb. am 6. März 1917 in Springfield, Mass. Studium der Literaturwissenschaft und Philosophiegeschichte (u.a. bei A.
Paul Natorp. Philosophische Propädeutik. in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen
 Paul Natorp Philosophische Propädeutik (Allgemeine Einleitung in die Philosophie und Anfangsgründe der Logik, Ethik und Psychologie) in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen C e l t i s V e r l a g Bibliografische
Paul Natorp Philosophische Propädeutik (Allgemeine Einleitung in die Philosophie und Anfangsgründe der Logik, Ethik und Psychologie) in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen C e l t i s V e r l a g Bibliografische
Wissenschaftstheorie und Ethik
 Wissenschaftstheorie und Ethik Kritischer Rationalismus (KR) Doz. Dr. Georg Quaas: Vorlesung zur Wissenschaftstheorie und Ethik 1 Wissenschaftstheorie - Vorlesung 2 und 3 [Vorlesung 1: 1. Einführung 2.
Wissenschaftstheorie und Ethik Kritischer Rationalismus (KR) Doz. Dr. Georg Quaas: Vorlesung zur Wissenschaftstheorie und Ethik 1 Wissenschaftstheorie - Vorlesung 2 und 3 [Vorlesung 1: 1. Einführung 2.
Logik, Sprache, Philosophie
 FRIEDRICH WAISMANN Logik, Sprache, Philosophie Mit einer Vorrede von Moritz Schlick herausgegeben von Gordon P. Baker und Brian McGuinness unter Mitwirkung von Joachim Schulte PHILIPP RECLAM ]UN. STUTTGART
FRIEDRICH WAISMANN Logik, Sprache, Philosophie Mit einer Vorrede von Moritz Schlick herausgegeben von Gordon P. Baker und Brian McGuinness unter Mitwirkung von Joachim Schulte PHILIPP RECLAM ]UN. STUTTGART
Ludwig Wittgenstein - alle Philosophie ist Sprachkritik
 Ludwig Wittgenstein - alle Philosophie ist Sprachkritik Andreas Hölzl 15.05.2014 Institut für Statistik, LMU München 1 / 32 Gliederung 1 Biographie Ludwig Wittgensteins 2 Tractatus logico-philosophicus
Ludwig Wittgenstein - alle Philosophie ist Sprachkritik Andreas Hölzl 15.05.2014 Institut für Statistik, LMU München 1 / 32 Gliederung 1 Biographie Ludwig Wittgensteins 2 Tractatus logico-philosophicus
7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten
 7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten Zwischenresümee 1. Logik ist ein grundlegender Teil der Lehre vom richtigen Argumentieren. 2. Speziell geht es der Logik um einen spezifischen Aspekt der Güte
7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten Zwischenresümee 1. Logik ist ein grundlegender Teil der Lehre vom richtigen Argumentieren. 2. Speziell geht es der Logik um einen spezifischen Aspekt der Güte
Analytische Erkenntnistheorie & Experimentelle Philosophie
 Analytische Erkenntnistheorie & Experimentelle Philosophie Klassische Analyse von Wissen Die Analyse heisst klassisch, weil sie auf Platon zurück geht (Theaitetos) Sokrates will wissen, was das Wissen
Analytische Erkenntnistheorie & Experimentelle Philosophie Klassische Analyse von Wissen Die Analyse heisst klassisch, weil sie auf Platon zurück geht (Theaitetos) Sokrates will wissen, was das Wissen
Joachim Stiller. Platon: Menon. Eine Besprechung des Menon. Alle Rechte vorbehalten
 Joachim Stiller Platon: Menon Eine Besprechung des Menon Alle Rechte vorbehalten Inhaltliche Gliederung A: Einleitung Platon: Menon 1. Frage des Menon nach der Lehrbarkeit der Tugend 2. Problem des Sokrates:
Joachim Stiller Platon: Menon Eine Besprechung des Menon Alle Rechte vorbehalten Inhaltliche Gliederung A: Einleitung Platon: Menon 1. Frage des Menon nach der Lehrbarkeit der Tugend 2. Problem des Sokrates:
PAUL HABERLIN I PHILOSOPHIA PERENNIS
 PAUL HABERLIN I PHILOSOPHIA PERENNIS PAUL HABERLIN PHILOSOPHIA PERENNIS EINE ZUSAMMENFASSUNG SPRINGER-VERLAG BERLIN GOTTINGEN. HEIDELBERG 195 2 ISBN 978-3-642-49531-1 DOl 10.1007/978-3-642-49822-0 ISBN
PAUL HABERLIN I PHILOSOPHIA PERENNIS PAUL HABERLIN PHILOSOPHIA PERENNIS EINE ZUSAMMENFASSUNG SPRINGER-VERLAG BERLIN GOTTINGEN. HEIDELBERG 195 2 ISBN 978-3-642-49531-1 DOl 10.1007/978-3-642-49822-0 ISBN
H e r a u s g e b e r
 West-Europa-Mission e.v. Postfach 2907 35539 Wetzlar WEM e.v., 2006 Tel. 0 64 41/4 28 22 Fax 0 64 41/4 31 79 email: info@wem-online.de Internet: www.wem-online.de H e r a u s g e b e r D i e W e t t e
West-Europa-Mission e.v. Postfach 2907 35539 Wetzlar WEM e.v., 2006 Tel. 0 64 41/4 28 22 Fax 0 64 41/4 31 79 email: info@wem-online.de Internet: www.wem-online.de H e r a u s g e b e r D i e W e t t e
Unterrichtsvorhaben I
 Lehrplan Philosophie für die Einführungsphase (Jgst. 10) Übersichtsraster der verbindlichen Unterrichtsvorhaben Thema: Was ist Philosophie? Unterrichtsvorhaben I arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt
Lehrplan Philosophie für die Einführungsphase (Jgst. 10) Übersichtsraster der verbindlichen Unterrichtsvorhaben Thema: Was ist Philosophie? Unterrichtsvorhaben I arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt
Thema: Was heißt es, zu philosophieren? - Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie (Einführungsphase) Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg Stand: 6. September 2016 Unterrichtsvorhaben 1 Thema: Was heißt es, zu philosophieren? - Welterklärungen
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie (Einführungsphase) Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg Stand: 6. September 2016 Unterrichtsvorhaben 1 Thema: Was heißt es, zu philosophieren? - Welterklärungen
Frege löst diese Probleme, indem er zusätzlich zum Bezug (Bedeutung) sprachlicher Ausdrücke den Sinn einführt.
 1 Vorlesung: Denken und Sprechen. Einführung in die Sprachphilosophie handout zum Verteilen am 9.12.03 (bei der sechsten Vorlesung) Inhalt: die in der 5. Vorlesung verwendeten Transparente mit Ergänzungen
1 Vorlesung: Denken und Sprechen. Einführung in die Sprachphilosophie handout zum Verteilen am 9.12.03 (bei der sechsten Vorlesung) Inhalt: die in der 5. Vorlesung verwendeten Transparente mit Ergänzungen
Themen Kompetenzen Methoden/Aufgaben Leistungsüberprüfung Der Mensch im Spiegel seiner Bezüge
 Schulinternes Fachcurriculum der Klaus-Groth-Schule Philosophie: Klasse 10/ 1. Halbjahr Einführung in das philosophische Denken (Anthropologischer Reflexionsbereich) Der Mensch im Spiegel seiner Bezüge
Schulinternes Fachcurriculum der Klaus-Groth-Schule Philosophie: Klasse 10/ 1. Halbjahr Einführung in das philosophische Denken (Anthropologischer Reflexionsbereich) Der Mensch im Spiegel seiner Bezüge
Funktionale Prädikate sind Begriffe, die die kausale Rolle eines Systems beschreiben.
 1 Transparente, 7. Vorlesung, M.Nida-Rümelin, Winter 04-05, Die kausale Rolle eines internen Zustandes eines Systems S ist die Gesamtheit seiner Kausalverbindungen zu inputs, outputs, und anderen internen
1 Transparente, 7. Vorlesung, M.Nida-Rümelin, Winter 04-05, Die kausale Rolle eines internen Zustandes eines Systems S ist die Gesamtheit seiner Kausalverbindungen zu inputs, outputs, und anderen internen
Formale Logik. 1. Sitzung. Allgemeines vorab. Allgemeines vorab. Terminplan
 Allgemeines vorab Formale Logik 1. Sitzung Prof. Dr. Ansgar Beckermann Sommersemester 2005 Wie es abläuft Vorlesung Übungszettel Tutorien Es gibt ca. in der Mitte und am Ende des Semesters je eine Klausur
Allgemeines vorab Formale Logik 1. Sitzung Prof. Dr. Ansgar Beckermann Sommersemester 2005 Wie es abläuft Vorlesung Übungszettel Tutorien Es gibt ca. in der Mitte und am Ende des Semesters je eine Klausur
Die Frage nach dem Sinn des Seins Antworten der Metaphysik Europas
 Die Frage nach dem Sinn des Seins Antworten der Metaphysik Europas Prof. Dr. Gerald Weidner Metapysik Definition Metaphysik war seit Aristoteles die erste Philosophie, weil sie Fragen der allgemeinsten
Die Frage nach dem Sinn des Seins Antworten der Metaphysik Europas Prof. Dr. Gerald Weidner Metapysik Definition Metaphysik war seit Aristoteles die erste Philosophie, weil sie Fragen der allgemeinsten
Ende und Schluß. Dr. Uwe Scheffler. Januar [Technische Universität Dresden]
![Ende und Schluß. Dr. Uwe Scheffler. Januar [Technische Universität Dresden] Ende und Schluß. Dr. Uwe Scheffler. Januar [Technische Universität Dresden]](/thumbs/94/122345206.jpg) Ende und Schluß Dr. Uwe Scheffler [Technische Universität Dresden] Januar 2011 Bestimmte Kennzeichnungen 1. Dasjenige, über welches hinaus nichts größeres gedacht werden kann, ist Gott. 2. Die erste Ursache
Ende und Schluß Dr. Uwe Scheffler [Technische Universität Dresden] Januar 2011 Bestimmte Kennzeichnungen 1. Dasjenige, über welches hinaus nichts größeres gedacht werden kann, ist Gott. 2. Die erste Ursache
Klausurrelevante Zusammenfassung WS Kurs Teil 2 Modul 1A B A 1 von
 Klausurrelevante Zusammenfassung WS 2010 2011 Kurs 33042 Teil 2 Modul 1A B A 1 von 12-21.02.11 Lernzusammenfassung Dilthey und der hermeneutische Zirkel - 33042 - T2...3 Lebensphilosophie Dilthey - (3)...3
Klausurrelevante Zusammenfassung WS 2010 2011 Kurs 33042 Teil 2 Modul 1A B A 1 von 12-21.02.11 Lernzusammenfassung Dilthey und der hermeneutische Zirkel - 33042 - T2...3 Lebensphilosophie Dilthey - (3)...3
Klassikerseminar: Karl R. Popper Realismus (Zusammenfassung )
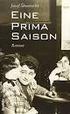 1 Einführung TU Dortmund, Wintersemester 2011 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Klassikerseminar: Karl R. Popper Realismus (Zusammenfassung 28.11.2011) Obwohl für Popper das
1 Einführung TU Dortmund, Wintersemester 2011 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Klassikerseminar: Karl R. Popper Realismus (Zusammenfassung 28.11.2011) Obwohl für Popper das
Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft
 Joachim Stiller Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft Eine Untersuchung Alle Rechte vorbehalten Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft Was ist der Unterschied zwischen Verstand und Vernunft? Zunächst
Joachim Stiller Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft Eine Untersuchung Alle Rechte vorbehalten Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft Was ist der Unterschied zwischen Verstand und Vernunft? Zunächst
Wenn alle Bären pelzig sind und Ned ein Bär ist, dann ist Ned pelzig.
 2.2 Logische Gesetze 19 auch, was für Sätze logisch wahr sein sollen. Technisch gesehen besteht zwar zwischen einem Schluss und einem Satz selbst dann ein deutlicher Unterschied, wenn der Satz Wenn...dann
2.2 Logische Gesetze 19 auch, was für Sätze logisch wahr sein sollen. Technisch gesehen besteht zwar zwischen einem Schluss und einem Satz selbst dann ein deutlicher Unterschied, wenn der Satz Wenn...dann
Erläuterung zum Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch
 TU Dortmund, Wintersemester 2010/11 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Aristoteles, Metaphysik Der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch (Buch 4/Γ; Woche 4: 8. 9.11.2010) I. Der
TU Dortmund, Wintersemester 2010/11 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Aristoteles, Metaphysik Der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch (Buch 4/Γ; Woche 4: 8. 9.11.2010) I. Der
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock
 Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
