Sportpädagogik als Erfahrungswissenschaft? Annäherungen zwischen Sollen und Sein
|
|
|
- Hinrich Schulze
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Vortrag auf der Jahrestagung der Sektion Sportpädagogik in der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft am in Bielefeld. Sportpädagogik als Erfahrungswissenschaft? Annäherungen zwischen Sollen und Sein Prof. Dr. Nils Neuber, Institut für Sportwissenschaft, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 1 Einleitung Wir kennen die Sportpädagogik als Handlungswissenschaft von der Praxis für die Praxis (Meinberg, 1996, S. 20) Wir kennen sie als Begründungs-, Orientierungs-, Tatsachen- und Beratungswissenschaft (Prohl, 2006, S. 15) Wir kennen sie auch als Teil der Erziehungs- und Sportwissenschaft (Grupe & Krüger, 2007, S. 14) und jetzt sollen wir die Sportpädagogik auch noch als Erfahrungswissenschaft kennenlernen?! Gibt man den Begriff in eine Suchmaschine ein, so findet man einige ältere Hinweise zu Psychologie oder Soziologie als Erfahrungswissenschaft ; von Sportpädagogik ist hier nicht die Rede. Allenfalls die Suchergebnisse zu Yoga oder Schamanismus als Erfahrungswissenschaft beide übrigens neueren Datums könnten auf eine gewisse, wenngleich diskussionswürdige Nähe zum sportlichen Bewegungshandeln hindeuten. Der Begriff der Erfahrungswissenschaft scheint jedoch insgesamt nicht im Mainstream der aktuellen wissenschaftstheoretischen Diskussion zu liegen. Historisch betrachtet werden Erfahrungs- und Vernunftwissenschaften unterschieden. Während die einen ihre Erkenntnisse über Erfahrungen in der Wirklichkeit erlangen, beschäftigen sich die anderen mit abstrakten Gedankengängen. Der Philosoph Wilhelm Windelband differenziert die Erfahrungswissenschaften noch einmal in Gesetzeswissenschaften, die das Allgemeine in Form von Naturgesetzen suchen, und Ereigniswissenschaften, die das Individuelle und Einmalige beschreiben. Sein Verweis auf nomothetische und ideografische Zugänge mag Bestand haben zitiert wird allerdings Windelbands Straßburger Rektoratsrede von 1894 (Kron, 1999, S ). Ist der Begriff Erfahrungswissenschaft als Leitidee unserer Tagung also unglücklich gewählt? Ich meine nicht. Der Erfahrungsbegriff ist mindestens in zweifacher Hinsicht leitend für unser Fach: Leibliche Erfahrung ist konstitutiv für unseren Gegenstand und empirische Erfahrung ist konstitutiv für unser Wissenschaftsverständnis. Beides soll im Folgenden näher untersucht und anschließend aufeinander bezogen werden. 2 Erfahrung als normativer Leitbegriff der Sportpädagogik Ganz gleich, ob wir den Gegenstand unseres Fachs im sportlichen und spielerischen Bewegungshandeln (Meinberg, 1996, S. 17), in Leiblichkeit und Sich-Bewegen (Prohl, 2006, S. 221) oder in Erziehungs- und Bildungsprozessen im und durch Sport (Grupe & Krüger, 2007, S. 48) sehen Erfahrung spielt dabei immer eine zentrale Rolle. Pädagogische Wirkungen ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt können nur oder zumindest fast nur über subjektive Erfahrungen erzielt werden. Alle Lernprozesse, zumal originär körperbezogene, beruhen auf der Verarbeitung und Integration von Erfahrungen, die das Individuum macht. In einem ersten Schritt können wir Erfahrung definieren als die Wahrnehmung, das Erleben, das (oft unspezifische) Empfinden von zusammenhängenden Sachverhalten und Situationen in Bezug auf unsere Person (Grupe, 1995, S. 21). Diese Definition stammt von einem bekannten Sportpädagogen, unserem Ehrenmitglied Ommo Grupe, der weitergehend folgert: Unmittelbare Erfahrungen, wie man sie im Sport machen kann, sind oft wirksamer als Worte und 1
2 Empfehlungen. Erfahrungen ermöglichen Lernprozesse, und nicht selten sind sie Ausgangspunkt und Grundlage von Urteilen, Erkenntnissen und Einsichten (Grupe, 1995, S. 21). Ein noch nicht ganz so bekannter, wenngleich ebenfalls scharfsinniger Sportpädagoge, der zugleich unser erster Ommo-Grupe-Preisträger ist Martin Giese greift diesen Gedanken auf: Was aus eigener Erfahrung gelernt, mit den eigenen Sinnen und dem eigenen Körper erfahren wurde, scheint eine ganz besondere Bedeutung zu haben und ist tief und nachhaltig im Bewusstsein verankert. Da sich Erfahrung durch eine besondere Bindung an Körperlichkeit auszeichnet, verwundert es kaum, dass vor allem Sport- und Bewegungspädagogen in ihr seit jeher ein originäres Betätigungsfeld sehen und dass in der Sport- und Bewegungspädagogik eine Vielzahl an Erfahrungskonzeptionen existiert (Giese, 2009, S. 13; Hervorhebung N.N.). Tatsächlich gibt es zahlreiche sportpädagogische Ansätze, die sich auf die Erfahrung berufen von anthropologischen und philosophischen, über pragmatische und praxeologische bis hin zu zivilisationskritischen und utopischen Ausformungen ist alles dabei: Leibliche Erfahrung, materiale Erfahrung, soziale Erfahrung, personale Erfahrung, Körpererfahrung, Bewegungserfahrung, sanfte Körpererfahrung, Selbsterfahrung u.v.m. (vgl. im Überblick Giese, 2008, S ). Ein einheitliches Konzept zur Begründung des Erfahrungslernens im Sport ist bei einer derartigen Vielfalt an Zugängen kaum zu erwarten. Am fundiertesten erscheint noch die bildungstheoretische Verortung des Erfahrungsbegriffs. Ohne an dieser Stelle vertiefend darauf eingehen zu können: Leitend ist in einem aisthetischen Sinne der Dreischritt von Wahrnehmung, Erfahrung und Gestaltung (vgl. Beckers, 1997). Ausgangs- und Bezugspunkt ist das Subjekt mit seinen je individuellen Fähigkeiten und Haltungen in der realen Welt. Die Zielsetzung besteht nach Edgar Beckers darin, das Subjekt zu einer Selbstgestaltung mit individueller Sinngebung innerhalb sozialer Verantwortung zu befähigen (Beckers, 1997, S. 20). Der Bildungsprozess ereignet sich nun über die Wahrnehmung des individuell Neuen, des für mich Außer- und Un-Gewöhnlichen, des Widersprechenden (Beckers, 1997, S. 21; Hervorhebung im Original). Erst wenn Unordnung in die gewohnte (Wahrnehmungs-)Welt gebracht wird, werden Bildungsprozesse angeregt. Dazu bedarf es weiterhin der Verarbeitung von Wahrnehmungen zu Erfahrungen, die dann wiederum in eine neue Ordnung gebracht werden müssen, um zur Gestaltung der individuellen Lebenswelt beitragen zu können. In einem zweiten Schritt kann Erfahrung damit als individuell verarbeitete, generalisierte Wahrnehmung verstanden werden. Konstitutiv für diesen Bildungsbegriff ist seine Ordnungsfunktion für [das] Selbst- und Weltverstehen des Subjekts. Entsprechend ist auch Bewegung nur dann bildungsbedeutsam, wenn über sie Erfahrungen eröffnet werden, die solche Ordnung ermöglichen (Schmidt- Millard, 2005, S. 145). Erfahrungen haben also im bildungstheoretischen Sinne keinen Selbstzweck; sie sind nur dann bildungsrelevant, wenn sie zu inneren Widerständen und Konflikten zum Erfahren von Fremdheit führen, die wiederum eine Veränderung oder Neuorientierung des Subjekts befördern. Der Weg von der Wahrnehmung zur Erfahrung ist damit nicht beliebig, sondern er bedarf der Reflexion, die zumindest im bildungstheoretischen Sinne auch pädagogisch zu verantworten ist. Das Besondere an den Erfahrungen im Fach Sport liegt nun in ihrer spezifischen Reflexivität. Nach Elk Franke geht es um die Erfahrung des einzelnen mit der Erfahrung [selbst]. Dies bedeutet, Kompetenzen in ästhetisch-expressiven Fächern lassen sich nicht nur dadurch kennzeichnen, dass dort ( ) explizit körperbezogene Erfahrungen gemacht werden, sondern dass diese Erfahrungen in einer besonderen Weise reflexiv sein können, d.h. ihnen damit eine spezifische bildungstheoretische Bedeutung zugeschrieben werden kann (Franke, 2008, S. 199; Hervorhebungen im Original). 2
3 Bildungsrelevante Reflexionen können demnach nicht nur über diskursive Prozesse in Gang gebracht werden, sondern sie ereignen sich auch präverbal im Sinne einer Bildung durch den Körper (vgl. Franke, 2008). Folgt man diesem Gedanken, vollziehen sich leibliche Erfahrungen im Sport in einem spezifischen Modus der Weltbegegnung, den Jürgen Baumert die ästhetisch-expressive Begegnung mit und Gestaltung von Welt nennt weitere Modalitäten sind die kognitiv-instrumentelle, die normativ-evaluative und die existenziell-konstitutive Modellierung der Welt (vgl. Tenorth, 2008, S ). Hierin liegen sicherlich lohnende Potenziale für die weitere Auseinandersetzung mit einem fachspezifischen Erfahrungsbegriff. Mit André Gogoll möchte ich zugleich aber vor einer Vereinseitigung der Diskussion warnen: Das Fach Sport macht schließlich nicht nur körperliche Bewegung, sondern eine ganze kulturelle Praxis zum Gegenstand des Unterrichts. Die Auseinandersetzung mit diesem Gegenstand erschöpft sich ( ) nicht im Modus ästhetisch-expressiver Begegnung und Gestaltung, sondern kann prinzipiell auch in allen weiteren Modi der Weltbegegnung erfolgen (Gogoll, 2009, S. 60). Am Rande bemerkt: Die außerschulische Bildungsdebatte verfolgt zurzeit ebenfalls einem stark handlungsbezogenen Bildungsbegriff, der sich wiederum auf andere Dimensionen des Weltbezugs beruft (vgl. Heim, 2008). Kehren wir zurück zu den sportpädagogischen Konzepten eines erfahrungsorientierten Unterrichts. Die Gretchenfrage scheint mir in der didaktisch-methodischen Umsetzung, der pädagogisch verantworteten Inszenierung von Erfahrungen im Sportunterricht zu liegen. Feststeht, dass man Erfahrungen nicht erzwingen kann: Wo Erfahrung planmäßig gesucht wird, kommt es zu keiner (Dieckmann, 1994, S. 79). Gleichwohl können die Bedingungen für das Machen von Erfahrungen gestaltet werden. Neben günstigen räumlichen und sozialen Voraussetzungen geht es darum, Unordnung in die gewohnte Ordnung zu bringen, Stolpersteine auszulegen, um das Sich-Einlassen zu vertiefen. Die Sport- und Theaterpädagogin Christine Bernd formuliert es aus ästhetischer Perspektive z.b. so: Statt raschem Abhaken und routinisiertem Einordnen in Stereotype werden Reibungsflächen geschaffen... Die Verlangsamung und Erschwerung der Auseinandersetzung kann so zu einer Herausforderung werden, sich neu mit einer Sache zu beschäftigen und ihr bisher nicht beachtete Seiten abzugewinnen (Bernd, 1993, S ). Darüber hinaus ist der Weg von der Wahrnehmung zur Erfahrung durch angemessene Reflexionen zu gestalten. Ein solches Arbeiten ist nicht unbedingt einfach, unterscheidet es sich doch stark von traditionellen Lehrarrangements mit Bewegungsanweisungen oder methodischen Reihen. Martin Giese kommt denn auch zu dem Schluss, dass es neben theoretischer Fundierung auch an praktischer Unterstützung mangele: Viele relevante Fragen bleiben weitgehend unbeantwortet und der Erfahrungsbegriff merkwürdig unbestimmt und konturlos: Was ist eigentlich Erfahrung? Wie entstehen Erfahrungen? Kann der real existierende Sportunterricht die Entstehung von Erfahrungen unterstützen? (Giese, 2009, S. 14). Bleibt man im Dunstkreis bildungstheoretischer Begründungen, ist diese ernüchternde Bilanz durchaus nachvollziehbar Vermittlungsmethoden bilden nach wie vor eine nicht zu leugnende Lücke in der Bildungstheorie des Sportunterrichts (Prohl, 2004). Geht man jedoch auf die Ebene der fachdidaktischen Konzepte, so kann ich die Negativbilanz nicht teilen. Auch wenn nicht alle Ansätze so dezidiert begründet werden, wie Gieses Erfahrungsorientierter und bildender Sportunterricht (Giese, 2009), gibt es doch eine ganze Reihe an sportpädagogischen Zugängen zum Erfahrungsthema, die theoretisch eingebunden und didaktisch-methodisch differenziert sind. Zu nennen sind etwa die bereits erwähnten Ansätze ästhetischer Bewegungserziehung (z.b. Fritsch, 2007), aber auch erlebnispädagogische (z.b. Gieß-Stüber, 1998), psychomotorische (z.b. Zimmer, 1999) oder körper- und gesundheitsbezogene Konzepte (z.b. Kolb, 1994; Brodtmann, 1998). 3
4 Insgesamt erweist sich der Erfahrungsbegriff damit in der sportpädagogischen Diskussion als vergleichsweise differenziert. Bildungstheoretische Begründungen verweisen sozusagen als Basistheorie auf die Bedeutsamkeit subjektiver Erfahrungen für die Entwicklung individueller Gestaltungsfähigkeit und stellen die Spezifika leiblicher Erfahrungen im Sport heraus. Bei näherer Betrachtung zeigt sich zudem, dass es um die didaktisch-methodische Aufbereitung in vielen Fällen nicht so schlecht bestellt ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Trotz aller Heterogenität kann die Erfahrungsorientierung damit guten Gewissens als eine normative Leitidee der Sportpädagogik betrachtet werden. Ihr Credo lautet: Du sollst erfahren!. Oder aus der Perspektive der Lehrkräfte: Du sollst deine Schüler selbst erfahren lassen und eben nicht: Du sollst sie belehren! Diese Haltung hat mit dem Prinzip der Erfahrungs- und Handlungsorientierung mittlerweile auch Einzug in zahlreiche Curricula gefunden (z.b. MSWWF NRW, 1999). Es stellt sich allerdings die Frage, wie es um die empirische Evidenz unserer Erfahrungskonjunktur bestellt ist. Gibt es erfahrungswissenschaftliche Belege dafür, dass ein erfahrungsorientierter Sportunterricht tatsächlich die gewünschten Wirkungen erzielt? 3 Erfahrung als empirischer Leitbegriff der Sportpädagogik Die Forderung nach einer Überprüfung intendierter Wirkungen des Sportunterrichts ist nicht neu. So hat Karlheinz Scherler schon 1997 darauf hingewiesen, dass Wirkungsversprechen ganz gleich wie gut sie begründet sein mögen alleine nicht ausreichen, um das Fach zu legitimieren: Notwendig ist eine Evaluation des Schulsports, die darüber Auskunft gibt, ob die proklamierten Ziele erreicht werden, ob der Schulsport leistet, was er zu leisten vorgibt (Scherler, 1997, S. 11). Die Forderung nach einer empirischen Schulsportforschung wurde in der Folge fast schon gebetsmühlenartig wiederholt, gleichwohl kam es nicht zu dem erhofften Boom entsprechender Forschungsprojekte. Dabei wären Belege für den pädagogischen Outcome des Sportunterrichts mit Blick auf die schulpädagogische Legitimationsdebatte gerade jetzt wieder besonders hilfreich. Wie ist es um die empirische Schulsportforschung bestellt? Welche Gründe gibt es für die zweifellos vorhandenen Defizite? Und welche Rolle könnte der Erfahrungsbegriff in der sportpädagogischen Forschung spielen? In einer vergleichsweise aktuellen Quellenanalyse hat Andreas Hoffmann (2008; 2009) vier zentrale Zeitschriften Sportpädagogik, Sportunterricht, Sportwissenschaft und Spectrum der Sportwissenschaft sowie die Tagungsbände unserer Sektion über einen Zeitraum von zehn Jahren untersucht. Über alle fünf Quellen hinweg zeigt sich zunächst, dass rund 60% der insgesamt 1200 analysierten Beiträge den Schulsport thematisieren; er kann damit nach wie vor als der zentrale Gegenstand sportpädagogischer Arbeiten bezeichnet werden. Allerdings greifen weniger als 20% der Veröffentlichungen auf eigene empirische Erhebungen zurück. Auffällig ist darüber hinaus, dass in den beiden stärker wissenschaftlich orientierten Zeitschriften Sportwissenschaft und Spectrum der Sportwissenschaft kaum quantitative Untersuchungen vorgestellt werden und dass zudem schließende Auswertungsverfahren besonders selten vorkommen das mitunter beklagte Übergewicht quantitativer Studien lässt sich damit nicht belegen. Insgesamt so resümiert Hoffmann bestätige sich der Eindruck, dass sozialwissenschaftlich-empirische Arbeiten in der Sportpädagogik [nach wie vor] eher in der Minderheit sind (Hoffmann, 2009, S. 27; Ergänzung N.N.). Die Gründe für die empirischen Defizite sind vielfältig: Zunächst unterliegt eine Sportpädagogik, die sich als empirische Wissenschaft versteht, denselben Unzulänglichkeiten wie die Erziehungswissenschaft. Sie hat es mit höchst komplexen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen zu tun, die empirisch nur schwer abzubilden sind. Zudem befasst sie sich in der Regel mit partikularen Problemen, was die Generalisierung von Ergebnissen nicht eben erleichtert. Und 4
5 schließlich sie ist im Gegensatz zu psychologischen oder soziologischen Zugängen grundsätzlich normativ eingebunden; pädagogisches Denken und Handeln zielt letztlich immer auf eine Verbesserung der Praxis. Aufgrund dieser Komplexität zweifelt der Erziehungswissenschaftler Wolfgang Böttcher (2006, S. 21) die gängige Unterscheidung von harten naturwissenschaftlichen und weichen sozialwissenschaftlichen Wissenschaften an; in Anlehnung an David Berliner hält er die Erziehungswissenschaft sogar für die hardest-to-do science of them all. Im Fall der Sportpädagogik kommt sogar noch eine weitere Ebene hinzu: Wenn wir wie oben beschrieben davon ausgehen, dass sich zumindest Teile der Bewegungspraxis einer diskursiven Reflexion entziehen wie sollen wir sie dann mit rationalen Forschungsmethoden erfassen? An dieser Stelle setzt ein häufig geäußerter Einwand an: Das sportpädagogische Handeln so heißt es sei so komplex, dass es sich empirisch überhaupt nicht erfassen lasse. Empirische Forschung und insbesondere empirisch-analytische Forschung reduziere den Gegenstand in unzulässiger Weise. Ohne an dieser Stelle erschöpfend darauf antworten zu können: Das Reduktionsproblem ist sicherlich ein zentrales Forschungsproblem, letztlich unterliegt jedoch jegliches menschliche Handeln der Reduktion allein, im Forschungsprozess muss der gewählte Ausschnitt von Wirklichkeit begründet werden (vgl. Erdmann, 1998). Zwei weitere Gründe für die empirischen Desiderate will ich zumindest noch ansprechen: Zum einen ist das die politische Unterbelichtung der Schulsportforschung: Zwar werden entsprechende Untersuchungen immer wieder gefordert, sie werden jedoch kaum adäquat gefördert. Wer Drittmittel sucht, wird sie kaum im Bereich der Schulsportforschung finden! Zum anderen mangelt es uns Sportpädagogen womöglich auch an fundierten sozialwissenschaftlichen Methodenkenntnissen diesen Vorwurf von Wolf Brettschneider und Albrecht Hummel (2010, S. 50) sollten wir m.e. nicht vorschnell beiseite schieben. Zumindest investieren anderen Disziplinen deutlich mehr in die forschungsmethodische Ausbildung ihres wissenschaftlichen Nachwuchses! Bei einer derart durchwachsenen Gemengelage aus Fakten und Hintergründen verwundet es nicht, wenn der Ruf der sportpädagogischen Unterrichtsforschung nicht unbedingt der beste ist. Kritik kommt sowohl von innen als auch von außen. Jörg Thiele (2008, S. 59) diagnostiziert bspw. im Dortmunder Band zur Schulsportforschung eine mangelnde methodologische Reflexion sportpädagogischer Studien. Insbesondere quantitative Untersuchungen blenden nach seiner Wahrnehmung vieles von dem aus, was auf einer methodologischen oder auch wissenschaftstheoretischen Ebene und damit auch zur genaueren Bestimmung der jeweiligen Möglichkeiten und Begrenzungen der gewählten Herangehensweise durchaus von Bedeutung wäre (Thiele, 2008, S. 59). Allein dem qualitativen Zugang attestiert er den eigentlich wünschenswerten Normalfall der gründlicheren Explikation des eigenen Selbstverständnisses (Thiele, 2008, S. 62). Erstaunlich ist aus meiner Sicht die Selbstverständlichkeit, mit der Thiele auf der Grundlage einer Analyse von lediglich zwei empirischen Untersuchungen die Augsburger und die Konstanzer Schulsportstudie (Altenberger et al., 2005; Miethling & Krieger, 2004) in alte Schwarz-Weiß-Schemata zurückfällt. Mit Meinberg (1996, S ) lässt sich fragen: Bedeutet der gegenwärtige Trend, qualitative Forschungsmethoden gegen quantitative auszuspielen, vielleicht nicht auch so etwas wie die heimliche Neuauflage und Fortsetzung des Positivismusstreits mit anderen Mitteln? Nebenbei bemerkt: Meinberg hat diese Frage vor fast 20 Jahren gestellt! In einer weiteren Analyse der bisherigen empirischen Schulsportforschung kommt Achim Conzelmann (2008, S. 162) zu vier Feststellungen: (1) Empirische Studien zur Legitimation des Schulsports sind innerhalb der Sportpädagogik selten, (2) vorhandene Studien orientieren sich vorrangig an (sport-)psychologischen Zugängen, (3) empirische Nachweise für die persönlichkeitsbildende Wirkung des Schulsports konnten bislang nicht geliefert werden und (4) 5
6 konkrete Handlungsanweisungen zum Erreichen postulierter Ziele liegen kaum vor. Auch dieser ernüchternden Bilanz kann ich nur teilweise zustimmen. So liegen sehr wohl erste empirische Wirkungsnachweise für die Schulsportpraxis vor, wie ich gleich zeigen werde. Zudem sind die von Conzelmann (2008, S ) im Folgenden entwickelten Lösungsvorschläge aus sportpädagogischer Perspektive mit Vorsicht zu genießen. Sowohl sein Hinweis auf dynamisch-interaktionistische Entwicklungstheorien als auch sein Plädoyer für komplexe, mehrstufige Auswertungsstrategien lässt sich mit unseren Zugängen nur teilweise in Deckung bringen (vgl. Neuber, 2002). Gleichwohl verweist Conzelmanns Analyse auf drei zentrale Problemfelder sportpädagogischer Bildungs- und Unterrichtsforschung. Zunächst ist die Theoriefrage zu klären. Empirische Daten ganz gleich welcher Ausprägung müssen theorieabhängig ausgewählt und interpretiert werden. Im pädagogischen Kontext ist der theoretische Rahmen zudem Voraussetzung dafür, dass über die Beschreibung der Gegenwart hinaus zukunftgerichtete Folgerungen für die Praxis gezogen werden können (Erdmann, 1998, S ). Mit Blick auf die Wirkungen des Sportunterrichts ist eine sportpädagogische Theorie also wohlüberlegt auszuwählen. Bildungstheoretische Ansätze helfen hier nur bedingt weiter, weil ihr normativer Impetus kaum operationalisierbar ist. Sie müssen erziehungstheoretisch gewendet werden, um sie ü- berprüfbar zu machen (vgl. Prohl, 2006). Entwicklungsfortschritte lassen sich sowohl mit sozialisationstheoretischen Ansätzen als auch mit interaktionistischen Entwicklungstheorien erfassen (z.b. Conzelmann, 2008). In pädagogischer Hinsicht helfen die Ansätze jedoch ebenfalls nur bedingt weiter, weil sie kein Konzept von Unterricht haben. Insofern verwundert es wenig, wenn schulsportliche Wirkungsanalysen auf dieser Basis kaum zu signifikanten Befunden kommen. Es bedarf einer Theorie der pädagogischen Intervention, die empirisch ü- berprüfbar ist. Oder mit Karlheinz Scherler: In sportpädagogischer Perspektive sollte Jugend nicht an und für sich erforscht [werden], sondern im Hinblick auf Erziehungs- und Bildungsprozesse mit Jugendlichen (Scherler 1993, S. 21). Eng verknüpft mit der Frage nach der angemessenen Theorie ist die Designfrage. Bisherige Schulsportstudien sind zumeist querschnittlich angelegt. Damit lässt sich zwar ein allgemeines Bild des Schulsports zeichnen, Wirkungen im Sinne von Entwicklungsfortschritten können jedoch kaum anders als längsschnittlich erfasst werden. Dazu sind vor allem quasi-experimentelle Untersuchungspläne erforderlich (Conzelmann, 2008, S. 168). Dass das in der Schulsportpraxis sehr aufwändig ist, liegt auf der Hand. Nicht nur das Gewinnen geeigneter Stichproben, auch das Durchführen einer definierten Intervention ist im Schulalltag schwierig. Kleinere Studien mit begrenztem Aufwand erscheinen vor diesem Hintergrund erfolgversprechender als großangelegte Untersuchungen. Sie erhalten ihr Gewicht nicht aus der Repräsentativität großer Probandenzahlen deren empirischer Gehalt ohnehin umstritten ist (Bortz, 1999, S ), sondern aus der Kohärenz von Einzelbefunden ähnlicher, miteinander verzahnter Studien (Erdmann, 1988). Von zentraler Bedeutung sind allerdings begründete Entscheidungen bezüglich Eingrenzung, Operationalisierung und Stichprobenwahl (Reduktions-, Indikator- und Stichprobenproblem) (vgl. Erdmann, 1987). Die Methodenfrage schließlich ist wiederum eng mit der Theorie- und der Designfrage verbunden. Pädagogisches Handeln zielt in aller Regel auf die Förderung von Individuen im Gruppenkontext (vgl. Helsper, 2004). Das Ziel (einzel-)fallorientierter Studien mit qualitativer Methodik ist es, einen sinnverstehenden Zugang zur sozialen Wirklichkeit von Individuen zu finden. Dem subjektiven Erleben Einzelner können diese Studien auch im pädagogischen Kontext sehr nahe kommen (z.b. Miethling & Krieger, 2004). Allerdings unterliegen sie der Gefahr, Wirkungsweisen pädagogischer Intervention im Gruppenzusammenhang auszublenden. Dabei liegt jeder pädagogischen Maßnahme die Vermutung von Wirkungszusammen- 6
7 hängen zugrunde, die über die Einzigartigkeit der Person bzw. Situation hinausreicht (Erdmann, 1998, S. 61). Gerade wenn es darum geht, postulierte Effekte des Sportunterrichts zu belegen, wird man daher um quantitative Methoden nicht umhin kommen: Es gilt, Erklärungen, Regelhaftigkeiten zu entwickeln bzw. zu identifizieren, die bei aller Unvollkommenheit Hilfen und Anregungen für absichtsvolles und verantwortliches Handeln liefern (Erdmann, 1987, S. 59). Kehren wir zurück zur Ausgangsfrage nach dem Stand der empirischen Schulsportforschung. Ist es tatsächlich so schlecht um sie bestellt, wie die Analysen vermuten lassen? Auch hier teile ich die grundsätzliche Skepsis mancher Kollegen nicht. Natürlich sind die von Hoffmann erhobenen Zahlen nicht erfreulich. Und selbstverständlich gibt es sportpädagogische Untersuchungen, die nicht mit der notwendigen Sorgfalt durchgeführt wurden wobei mir da sowohl quantitative als auch qualitative Arbeiten einfallen würden! Trotzdem gibt es eine ganze Reihe an sportpädagogischen Studien, die differenzierte Antworten auf die Theorie-, die Designund die Methodenfrage geben. Eine Übersicht kann und will ich hier nicht leisten (vgl. dazu u.a. Balz, 1997; Erdmann, 1998; Miethling, 2006; Hummel & Schierz, 2006; Gröben, 2007; Miethling & Schierz, 2008). Gleichwohl möchte ich exemplarisch auf einige Studien hinweisen, die explizit einer sportpädagogischen Interventionsperspektive folgen. Zu nennen sind hier bspw. die Kölner Untersuchungen zu Motiven und Einstellungen im Sport (Erdmann, 1983), die Studien zu Motorik und Persönlichkeitsentwicklung im Kindergarten, die sogar repliziert wurden (Zimmer, 1981; Prohl, 2006), Untersuchungen zum sozialen und jüngst zum kooperativen Lernen (Ungerer-Röhrich, 1984; Bähr, Gröben & Prohl, 2008), unsere eigenen Untersuchungen zur Kreativen Bewegungserziehung (Neuber, 2000) oder neuere Studien zur Interkulturalität im Schulsport (Grimminger & Gieß-Stüber, 2009). Die Zusammenstellung zeigt, dass es durchaus empirische Untersuchungen in der Sportpädagogik gibt, die theoretisch begründet und methodologisch reflektiert pädagogische Wirkungen untersuchen. Womöglich liegen diese Studien nicht immer im Mainstream der Fachdiskussion, dennoch sollte man ihr pädagogisches Gewicht nicht unterschätzen. Erfahrungswissenschaftliche, pädagogische Zugänge existieren damit durchaus Erfahrung ist also auch ein empirischer Leitbegriff der Sportpädagogik, wenngleich ich zugestehe, dass hier noch viel zu tun ist. Wie ist es nun um die Erforschung der Erfahrung selbst bestellt? Hier muss zunächst nüchtern festgehalten werden, dass es praktisch keine Untersuchungen zum Erfahrungsprozess an sich gibt insofern sind die zahlreichen normativen Hoffnungen, die an die Erfahrungsorientierung gerichtet werden, bislang empirisch ungeprüft! Wir wissen allerdings einiges über das Erleben von Individuen in sportbezogenen Settings (z.b. Miethling & Krieger, 2004; Neuber, Breuer, Derecik, Golenia & Wienkamp, 2010; Bindel, 2008). Erfahrungen als subjektive Verarbeitungsprozesse von Erlebnissen können daher zumindest in Teilen, z.b. biografisch, nachgezeichnet werden. Die Wirkungen erfahrungsorientierter Konzepte sind dagegen vergleichsweise einfach empirisch zu erfassen, und sie sollten auch erfasst werden, wenn die Konzepte nicht auf dem Stand einer Meisterlehre verharren wollen: Eine Weiterentwicklung von Didaktik und Methodik kann nur dann über das Niveau von Alltagstheorien ( ) hinausreichen, wenn eine systematische, verallgemeinerbare eben empirische Rückanbindung an die Realität erfolgt (Hoffmann, 2009, S. 31). 4 Zwischenfazit Den Ausgangspunkt meiner Überlegungen bildete die Frage nach einer Bestimmung der Sportpädagogik als Erfahrungswissenschaft. Im ersten Teil habe ich gezeigt, dass der Erfahrungsbegriff im sportpädagogischen Diskurs allgegenwärtig ist. Die gängige Norm lautet: Du 7
8 sollst deinen Unterricht erfahrungsorientiert inszenieren! Im zweiten Teil habe ich gezeigt, dass der Erfahrungsbegriff im Sinne einer Erfahrungswissenschaft auch in der empirischen Forschung zum sportpädagogischen Bestand gehört, auch wenn dabei noch einiges im Argen liegt. Die gängige Norm lautet hier: Du sollst die Wirkungen deines Unterrichts in der Realität überprüfen! Es stellt sich nun die Frage, wie normative Zielvorstellungen und empirische Wirklichkeit zueinander gebracht werden können. Oder mit Ingrid Bähr: Es gilt, den philosophisch-anthropologisch und pädagogisch orientierten ( ) Sollens-Aussagen der Sportpädagogik auch Seins-Aussagen in Form empirisch gesicherter Tatsachen an die Seite und ggf. gegenüber zu stellen (Bähr, 2009, S. 142). Sollen und Sein oder normative und empirische Sportpädagogik beäugen einander indes noch immer argwöhnisch. Während die einen den Erbsenzählern methodologische Selbstgenügsamkeit und Saturiertheit vorhalten (Thiele, 2008, S. 62), werfen die anderen den Hermeneutikern mangelnden Praxisbezug und Feiertagsdidaktik vor (Bähr, 2009, S. 142). Womöglich muss Eckart Meinbergs Verweis auf die Fortsetzung des Positivismusstreits in der Sportpädagogik noch ausgeweitet werden. Dabei hatte er selbst schon 1991 unter Rückgriff auf Konrad Widmer eine vermittelnde Position vorgeschlagen: Wenn bei Widmer von dialektischer Komplementarität die Rede ist, so bezieht er dies auf die Forschungsmethoden Empirie und Hermeneutik. Diese beiden Methodenkomplexe sind zu vermitteln, weil nur so der Gegenstandsbereich der Sportpädagogik angemessen aufgeschlossen werden könne (Meinberg, 1996, S. 38). Mein Vermittlungsvorschlag geht in eine ähnliche Richtung, bezieht sich mit Heinrich Roth aber auf einen anderen Erziehungswissenschaftler, und zwar auf einen, der in den 1960er Jahren die empirische Wendung der Pädagogik maßgeblich mit vorangetrieben hat. 5 Integration von Sollen und Sein in der Entwicklungspädagogik Heinrich Roths Heinrich Roth, der von 1906 bis 1983 lebte, gilt als einer der einflussreichsten Bildungsreformer des 20. Jahrhunderts. Er lehrte an den Universitäten Frankfurt und Göttingen und war u.a. Mitglied der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrats. Seine Arbeitsschwerpunkte lagen in der anthropologischen Begründung und empirischen Erforschung von Lehr- Lern-Prozessen (vgl. Jungmann & Huber, 2009). In der Sportpädagogik wurde bspw. seine Leitidee einer Erziehung zur Mündigkeit, die er in Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz differenziert, aufgegriffen (Roth, 1976, S. 180). Heinrich Roth setzte sich zeitlebens für eine Integration normativer und empirischer Zugänge ein. Auf der Basis ihres geisteswissenschaftlichen Fundaments wollte er die Pädagogik zu einer Erziehungswissenschaft weiterentwickeln: In diesem Schritt steckt ein Bekenntnis zur Verwandlung der Pädagogik in eine Erfahrungswissenschaft, vorsichtiger gesagt: die Anerkennung des der Erfahrung zugänglichen Anteils der Erziehung als eines zur erfahrungswissenschaftlichen Erforschung aufgegebenen Anteils (Roth, 1966/2009, S. 66; Hervorhebung N.N.). Dazu müsse die Erziehungswissenschaft zwangsläufig näher an die Psychologie und Soziologie heranrücken. Zugleich sei ihre Position im Vergleich zu diesen beiden Wissenschaften jedoch entschiedener und komplizierter. Entschiedener sei sie deshalb, weil sie grundsätzlich normativ verankert ist: Die Erziehungswissenschaft kann keine wertfreie Wissenschaft sein, und sie kann den Charakter ihrer Erkenntnisse als direkte oder indirekte Handlungsanweisungen nicht verleugnen. ( ) [D]ie Einbeziehung erfahrungswissenschaftlich erforschter Fakten in den hermeneutischen Zirkel ihres Denkens schließt kein Verbot ein, die erforschten facts nicht zu kritisieren, im Gegenteil: die Erziehungswissenschaft ist ihr eigener Auftraggeber, stellt ihre Fragen selbst, und ihr Wertbezug auf den mündigen Menschen in einer freien Ge- 8
9 sellschaft impliziert nicht als solcher schon falsche Forschungsergebnisse (Roth, 1966/2009, S. 67). Komplizierter sei die Aufgabe der Erziehungswissenschaft aufgrund ihrer Komplexität: Pädagogik hat es ebenso mit dem einzelnen zu tun wie mit der Gesellschaft, außerdem noch ( ) mit dem, was Natur und Kultur heißen mag. ( ) Erziehungswissenschaft muss außerdem anders als die Pädagogik die Phänomene der Erziehung methodisch einer nachkontrollierbaren Erfahrung zugänglich machen (Roth, 1966/2009, S. 68) die hardest science of them all lässt grüßen! Zur Begründung von Erziehungszielen macht Roth einen Vorschlag, der nicht nur für seine Zeit progressiv ist: Er kombiniert präskriptive und deskriptive Vorgehensweisen. Neben der Forderung nach einer intensiveren Reflexion über Erziehungsziele und -methoden stellt er die provokante Frage: Gibt es empirisch abzusichernde Aussagemöglichkeiten über das Entwicklungssoll, das (...) jeweils erreicht werden kann? (Roth, 1976, S. 28; Hervorhebung im Original). Dem nicht nur damals geäußerten Einwand, dass man vom Sein nicht auf das Sollen schließen könne, begegnet Roth dialektisch: Auf diese Frage sind manche Gegner der empirischen Forschung besonders stolz, ohne gewahr zu werden, dass sie im gleichen Augenblick gegen ihr eigenes dialektisches Denken verstoßen. Die Gegenfrage muss dann nämlich lauten: wie sollen wir je aus einer Erziehungsphilosophie erfahren, die sich nur um das Seinsollen bekümmert ( ), was ist oder möglich ist? (Roth, 1958/2009, S. 38). Und weiter: Das Sollen stammt weder aus dem reinen Gedankenhimmel pädagogischer Philosophen, noch gestalten die Praktiker die Praxis in der reinen Hingabe an die Tatsachen ( ). [Das], was sein soll, entspringt oft gerade aus der Konfrontation mit der so genannten pädagogischen Wirklichkeit (Roth, 1958/2009, S ). Mit anderen Worten: Sollen und Sein sind sowohl in der Praxis als auch in der Theorie untrennbar miteinander verbunden. Insofern ist es nur schlüssig, wenn sie auch in der erziehungswissenschaftlichen Forschung reflektiert und mit der nötigen Sorgfalt kombiniert werden. Heinrich Roth entwirft auf dieser Basis die Grundlagen einer Entwicklungspädagogik, deren Ziel die Entwicklungsförderung ist und die dabei sowohl die individuellen als auch die gesellschaftlichen Voraussetzungen berücksichtigt. Als integratives Konzept verweist er auf die Idee der Entwicklungsaufgabe (vgl. Neuber, 2007). Auch wenn sich der Ansatz bislang nicht flächendeckend durchgesetzt hat, könnte das Aufeinanderbeziehen von Seins- und Sollens-Fragen, die Abklärung des Verhältnisses von Möglichem und Machbarem ( ) entscheidende Impulse für die Erziehungswissenschaft abgeben, so der Entwickungspädagoge Stefan Aufenanger (Aufenanger, 1992, S. 27). 6 Erfahrungswissenschaftliche Perspektiven der Sportpädagogik Heinrich Roth baut uns eine erziehungswissenschaftliche Brücke zwischen normativen Zielbestimmungen und empirischen Fakten wie könnte eine Sportpädagogik, die sich als Erfahrungswissenschaft in diesem Sinne versteht, diese Brücke nutzen? Anwendungsfelder gäbe es genug: Angefangen beim Dicke-Kinder-Diskurs über Themen einer geschlechtsbezogenen Sportpädagogik bis hin zu Fragen des guten Sportunterrichts und damit einhergehender Qualitätsstandards. Ich greife ein anderes zentrales Feld heraus: die Bildungsdiskussion. Die normative Zielvorstellung lässt sich zumindest allgemein definieren: Die Fähigkeit des Individuums, sein Leben unter Wahrung sozialer Verantwortung selbstbestimmt gestalten zu können. Über die tatsächliche Umsetzung dieser Leitidee wissen wir wie gesagt wenig bis gar nichts; die empirische Befundlage tendiert gegen Null. Was spricht nun dagegen, die Bildungssubjekte selbst zu befragen, welche Lernprozesse sie in bestimmten Settings erfahren haben? Oder einen Ausschnitt aus dem Spektrum möglicher Wirkungen herauszugreifen 9
10 etwa das Selbstkonzept, die soziale Kompetenz oder die körperbezogene Entwicklungsaufgabe und diesen Ausschnitt exemplarisch für die Erfahrungen des Individuums im gesamten Bildungsprozess zu untersuchen? Klassische sportpädagogische Einwände dagegen sind etwa diese: Der Bildungsprozess an sich ist zwar eine Leistung des Subjekts, aber er kann nur gelingen, wenn er normativ begründet und pädagogisch verantwortet wird. Wie soll das (heranwachsende) Subjekt da einschätzen können, was es gelernt hat? Oder: Bildung ist ein ganzheitlicher, höchst subjektiver Prozess. Wie kann der auf einen Fragebogen zu einer Entwicklungsaufgabe reduziert werden? Vor dem Hintergrund einer erfahrungswissenschaftlich fundierten Sportpädagogik lassen sich diese Vorbehalte nun entkräften. Zum einen sprechen entwicklungstheoretische Ansätze über die Fachrichtungen hinweg für eine zunehmende Autonomie des Subjekts in modernen Gesellschaften (vgl. Neuber, 2007). Es gibt also eine fundierte theoretische Basis für die empirische Frage nach den Erfahrungen bzw. Lernprozessen von Individuen. Zu wissen, unter welchen spezifischen Bedingungen bspw. Jugendliche aus ihrer Perspektive soziale Kompetenzen erwerben, kann für die Inszenierung entsprechender Arrangements und damit letztlich auch für deren pädagogische Begründung sehr hilfreich sein (z.b. Neuber et al., 2010). Zum anderen unterliegen Forschungsprozesse wie bereits angesprochen immer einer Reduktion sie können niemals das Ganze erfassen. Insofern ist der Fragebogen zur Entwicklungsaufgabe ein kleiner, aber wohl definierter Ausschnitt der sportpädagogischen Wirklichkeit, der Auskunft über die Einschätzung einer Zielgruppe und im Längsschnitt sogar über deren Entwicklung geben kann. Diese Fakten alleine erlauben noch keine pädagogischen Rückschlüsse. Eingebunden in eine entsprechende Theorie der Entwicklungsförderung können aber sehr wohl vorsichtige Schlussfolgerungen in Bezug auf die Gestaltung der Praxis gezogen werden (vgl. Neuber, 2007). Einer erfahrungswissenschaftlich fundierten Sportpädagogik im Roth schen Sinne käme damit die Aufgabe zu, normativ begründete Ziele in Bezug zu empirisch zugänglichen Ausschnitten von Wirklichkeit zu setzen, um damit letztlich beide sportpädagogischen Zugänge voranzubringen. Oder ein letztes Mal mit Roth (1958/2009, S. 39): Dogmatischer Apriorismus ist ebenso falsch wie dogmatischer Empirismus. Es gilt, das Gesollte in der Idee und in der Wirklichkeit ( ) zu erforschen. Literatur Altenberger, H., Erdnüß, S., Fröbus, R., Höss-Jelten, C., Oesterhelt, V., Siglreitmaier, F. & Stefl, A. (2005). Augsburger Studie zum Schulsport in Bayern Ein Beitrag zur Qualitätssicherung und Schulsportentwicklung. Donauwörth: Auer. Aufenanger, S. (1992). Entwicklungspädagogik Die soziogenetische Perspektive. Weinheim: Deutscher Studien Verlag. Bähr, I. (2009). Beiträge einer Evaluationsforschung in der Sportpädagogik. In E. Balz (Hrsg.), Sollen und Sein in der Sportpädagogik Beziehungen zwischen Normativem und Empirischem (S ). Aachen: Shaker. Bähr, I, Prohl, R. & Gröben, B. (2008). Prozesse und Effekte Kooperativen Lernens im Sportunterricht. Unterrichtswissenschaft, 36, Balz, E. (1997). Zur Entwicklung der sportwissenschaftlichen Unterrichtsforschung in Westdeutschland. Sportwissenschaft, 27, Beckers, E. (1997). Über das Bildungspotential des Sportunterrichts. In E. Balz & P. Neumann (Hrsg.), Wie pädagogisch soll der Schulsport sein? (S ). Schorndorf: Hofmann. Bernd, C. (1993). Theaterspielen in der Bewegungserziehung oder: Am Anfang steht der Anspruch... In R. Prohl (Hrsg.), Facetten der Sportpädagogik. Beiträge zur pädagogischen Diskussion des Sports (S ). Schorndorf: Hofmann. Bindel, T. (2008). Soziale Regulierung in informellen Sportgruppen (Forum Sportwissenschaft, 15). Hamburg: Czwalina. 10
11 Bortz, J. (1999). Statistik für Sozialwissenschaftler (5., vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Berlin u.a.: Springer. Böttcher, W. (2006). Empirische Erziehungswissenschaft: Kritiker, Verteidiger, Herausforderungen. In M. Kolb (Hrsg.), Empirische Schulsportforschung (Jahrbuch Bewegungs- und Sportpädagogik, 5, S ). Butzbach-Griedel: Afra. Brettschneider, W.-D. & Hummel, A. (2007/2010). Sportwissenschaft und Schulsport: Trends und Orientierungen (7): Sportpädagogik. Sportunterricht (Sonderheft Trendberichte 2010), Brodtmann, D. (1998). Gesundheitsförderung im Schulsport. Sportpädagogik, 22 (3), Conzelmann, A. (2008). Persönlichkeitsentwicklung durch Schulsport pädagogisches Postulat ohne empirische Evidenz? In H.-P. Brandl-Bredenbeck (Hrsg.), Bewegung, Spiel und Sport in Kindheit und Jugend Eine europäische Perspektive (S ). Aachen: Meyer & Meyer. Dieckmann, B. (1994). Der Erfahrungsbegriff in der Pädagogik. Weinheim: Deutscher Studien Verlag. Erdmann, R. (Hrsg.). (1983). Motive und Einstellungen im Sport Ein Erklärungsansatz für die Sportpraxis (Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport, 85). Schorndorf: Hofmann. Erdmann, R. (1987). Relativierte Macht Das Machtmotiv und seine sportpädagogische Bedeutung (Schriften der Deutschen Sporthochschule, 19). St. Augustin: Richarz. Erdmann, R. (1988). Die Bedeutung empirischer Studien mit kleinen Stichproben für die Theoriebildung im sozialwissenschaftlichen Bereich. Sportwissenschaft, 18, Erdmann, R. (1998). Empirische Sportpädagogik Bilanz und Perspektive. In J. Thiele & M. Schierz (Hrsg.), Standortbestimmung der Sportpädagogik: Zehn Jahre danach (Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, 97, S ). Hamburg: Czwalina. Franke, E. (2008). Erfahrungsbasierte Voraussetzungen ästhetisch-expressiver Bildung zur Entwicklung einer domänenspezifischen Sprache physischer Expression. In E. Franke (Hrsg.), Erfahrungsbasierte Bildung im Spiegel der Standardisierungsdebatte (Jahrbuch Bewegungs- und Sportpädagogik, 7, S ). Hohengehren: Schneider. Fritsch, U. (2007). Ästhetische Erziehung. In R. Laging (Hrsg.), Neues Taschenbuch des Sportunterrichts. Kompaktausgabe (3., veränderte und korrigierte Aufl., S ). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. Giese, M. (2008). Theoretische Grundlagen eines erfahrungsorientierten und bildenden Sportunterrichts. In M. Giese (Hrsg.), Erfahrungsorientierter und bildender Sportunterricht Ein theoriegeleitetes Praxishandbuch (S ). Aachen: Meyer & Meyer. Giese, M. (2009). Erfahrung als Bildungskategorie Eine sportsemiotische Untersuchung in unterrichtspraktischer Absicht (Sportforum, 17). Aachen: Meyer & Meyer. Gieß-Stüber, P. (1998). Unsicherheit macht Schule Erlebnis, Abenteuer, Risiko im Sportunterricht. In H. Allmer & N. Schulz (Hrsg.), Erlebnissport Erlebnis Sport (Brennpunkte der Sportwissenschaft, 9, S ). St. Augustin: Academia. Gogoll, A. (2009). Kompetenzmodelle für das Schulfach Sport zur Fundierung und Empirisierung sportpädagogischer Bildungserwartungen. In E. Balz (Hrsg.), Sollen und Sein in der Sportpädagogik Beziehungen zwischen Normativem und Empirischem (S ). Aachen: Shaker. Grimminger, E. & Gieß-Stüber, P. (2009). Anerkennung und Zugehörigkeit im Schulsport Überlegungen zu einer (Sport-)Pädagogik der Anerkennung. In U. Gebken & N. Neuber (Hrsg.), Anerkennung als sportpädagogischer Begriff (Jahrbuch Bewegungs- und Sportpädagogik, 8, 31-51). Hohengehren: Schneider. Gröben, B. (2007). Sportunterricht im Spiegel der Unterrichtsforschung. In V. Scheid (Hrsg.), Sport und Bewegung vermitteln (Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, 165, S ). Hamburg: Czwalina. Grupe, O. (1995). Erfahrungen im Sport: Haben sie eine besondere Bedeutung? In H.-J. Schaller & D. Pache (Hrsg.), Sport als Bildungschance und Lebensform (S ). Schorndorf: Hofmann. Grupe, O. & Krüger, M. (2007). Einführung in die Sportpädagogik (3., neu bearbeitete Aufl.). Reihe Sport und Sportunterricht; 6. Schorndorf: Hofmann. Heim, R. (2008). Bewegung, Spiel und Sport im Kontext von Bildung. In W. Schmidt (Hrsg.), Zweiter Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht, Schwerpunkt: Kindheit (S ). Schorndorf: Hofmann. Helsper, W. (2004). Pädagogisches Handeln in den Antinomien der Moderne. In H.-H. Krüger & W. Helsper (Hrsg.), Einführung in die Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft (6. überarbeitete und aktualisierte Aufl., S ). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Hoffmann, A. (2008). Publikationen und empirische Forschung Wie päsentiert sich die deutsche Sportpädagogik? In V. Osterhelt, J. Hoffmann, M. Schimanski, M. Scholz & H. Altenberger (Hrsg.), Sportpädagogik im Spannungsfeld gesellschaftlicher Erwartungen, wissenschaftlicher Ansprüche und empirischer Befunde (Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, 175, S ). Hamburg: Czwalina. Hoffmann, A. (2009). Empirische Desiderate einer normativen Fachdidaktik. In E. Balz (Hrsg.), Sollen und Sein in der Sportpädagogik Beziehungen zwischen Normativem und Empirischem (S ). Aachen: Shaker. Hummel, A. & Schierz, M. (Hrsg.). (2006). Studien zur Schulsportentwicklung in Deutschland. Schorndorf: Hofmann. 11
12 Jungmann, W. & Huber, K. (Hrsg.). (2009). Heinrich Roth moderne Pädagogik als Wissenschaft. Weinheim, München: Juventa. Kolb, M. (1994). Methodische Prinzipien zur Entwicklung der Körperwahrnehmung. In M. Schierz, A. Hummel & E. Balz (Hrsg.), Sportpädagogik Orientierungen, Leitideen, Konzepte (Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, 58, S ). St. Augustin: Academia. Kron, F. W. (1999). Wissenschaftstheorie für Pädagogen. München, Basel: Reinhardt. Meinberg, E. (1996). Hauptprobleme der Sportpädagogik Eine Einführung (3., unveränderte Aufl.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Miethling, W.-D. (2006). Forschungstrend in der Sportpädagogik. Zephir, 13 (1), Miethling, W.-D. & Krieger, C. (2004). Schüler im Sportunterricht Die Rekonstruktion relevanter Themen und Situationen des Sportunterrichts aus Schülersicht (RETHESIS) (Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport, 140). Schorndorf: Hofmann. Miethling, W.-D. & Schierz, M. (Hrsg.). (2008). Qualitative Forschungsmethoden in der Sportpädagogik. Schorndorf: Hofmann. Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSWWF NRW) (Hrsg.). (1999). Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule. Richtlinien und Lehrpläne. Düsseldorf. Neuber, N. (2000). Kreativität und Bewegung Grundlagen kreativer Bewegungserziehung und empirische Befunde (Schriften der Deutschen Sporthochschule, 45). St. Augustin: Academia. Neuber, N. (2002). Auf der Suche nach dem verlorenen Schatz Ein Plädoyer für das Pädagogische in der sportwissenschaftlichen Jugendforschung. In P. Elflein, P. Gieß-Stüber, R. Laging & W.-D. Miethling (Hrsg.), Qualitative Ansätze und Biographieforschung in der Bewegungs- und Sportpädagogik (Jahrbuch Bewegungs- und Sportpädagogik in Theorie und Forschung, 1, S ). Butzbach-Griedel: Afra. Neuber, N. (2007). Entwicklungsförderung im Jugendalter Theoretische Grundlagen und empirische Befunde aus sportpädagogischer Perspektive (Wissenschaftliche Schriftenreihe des Deutschen Olympischen Sportbundes, 35). Schorndorf: Hofmann. Neuber, N., Breuer, M., Derecik, A., Golenia, M. & Wienkamp, F. (2010). Kompetenzerwerb im Sportverein Empirische Studie zum informellen Lernen im Jugendalter. Wiesbaden: VS. Prohl, R. (2004). Vermittlungsmethoden eine erziehungswissenschaftliche Lücke in der Bildungstheorie des Sportunterrichts. In M. Schierz & P. Frei (Hrsg.), Sportpädagogisches Wissen Spezifik Transfer Transformationen (Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, 141, ). Hamburg: Czwalina. Prohl, R. (2006). Grundriss der Sportpädagogik (2., stark überarb. Aufl.). Wiebelsheim: Limpert. Roth, H. (1958/2009). Die Bedeutung der empirischen Forschung für die Pädagogik. In W. Jungmann & K. Huber (Hrsg.), Heinrich Roth moderne Pädagogik als Wissenschaft (S ). Weinheim, München: Juventa. Roth, H. (1966/2009). Erziehungswissenschaft zwischen Psychologie und Soziologie. In W. Jungmann & K. Huber (Hrsg.), Heinrich Roth moderne Pädagogik als Wissenschaft (S ). Weinheim, München: Juventa. Roth, H. (1976). Pädagogische Anthropologie Band II: Entwicklung und Erziehung. Grundlagen einer Entwicklungspädagogik (2. Aufl.). Hannover: Schroedel. Scherler, K. (1993). Normative Jugendforschung? In W.-D. Brettscheider & M. Schierz (Hrsg.), Kindheit und Jugend im Wandel Konsequenzen für die Sportpädagogik? (Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, 52, S. 9-24). St. Augustin: Academia. Scherler, K. (1997). Die Instrumentalisierungsdebatte in der Sportpädagogik. Sportpädagogik, 21 (2), Schmidt-Millard, T. (2005). Bildung im Kontext einer Bewegungspädagogik. In J. Bietz, R. Laging, M. Roscher (Hrsg.), Bildungstheoretische Grundlagen der Bewegungs- und Sportpädagogik (S ). Hohengehren: Schneider. Tenorth. H.-E. (2008). Sport im Kanon der Schule Die Dimension des Ästhetisch-Expressiven. Über vernachlässigte Dimensionen der Bildungsdebatte und -theorie. In E. Franke (Hrsg.), Erfahrungsbasierte Bildung im Spiegel der Standardisierungsdebatte (Jahrbuch Bewegungs- und Sportpädagogik, 7, S ). Hohengehren: Schneider. Thiele, J. (2008). Formen der Erkenntnisgenerierung in der Schulsportforschung - Methodologie und Methoden. In Dortmunder Zentrum für Schulsportforschung (Hrsg.), Schulsportforschung Grundlagen, Perspektiven und Anregungen (S Aachen: Meyer & Meyer. Ungerer-Röhrich, U. (1984). Eine Konzeption zum sozialen Lernen im Sportunterricht und ihre empirische Ü- berprüfung (Unveröffentlichte Dissertation) Darmstadt: TH Darmstadt. Zimmer, R. (1981). Motorik und Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern im Vorschulalter (Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport, 80/81). Schorndorf: Hofmann. Zimmer, R. (1999). Handbuch der Psychomotorik Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern. Freiburg: Herder. 12
Grundriss der Sportpädagogik
 Robert Prohl Grundriss der Sportpädagogik 2., stark überarbeitete Auflage Limpert Verlag Wiebelsheim Inhalt 1. Einführung: Was bedeutet Sportpädagogik? 9 1.1 Funktionen einer wissenschaftlichen Betrachtung
Robert Prohl Grundriss der Sportpädagogik 2., stark überarbeitete Auflage Limpert Verlag Wiebelsheim Inhalt 1. Einführung: Was bedeutet Sportpädagogik? 9 1.1 Funktionen einer wissenschaftlichen Betrachtung
Vorlesung 9 Sportpädagogik als Wissenschaft - zwischen Theorie und praktischer Anleitung
 Vorlesung 9 als Wissenschaft - zwischen Theorie und praktischer Anleitung Literaturhinweise zur als Praxisanleitung als Wissenschaft Aufgaben der Betrachtungsweisen der Systematische Einordnung der Literaturempfehlung
Vorlesung 9 als Wissenschaft - zwischen Theorie und praktischer Anleitung Literaturhinweise zur als Praxisanleitung als Wissenschaft Aufgaben der Betrachtungsweisen der Systematische Einordnung der Literaturempfehlung
Qualitätsdimensionen für Sportunterricht ein Entwurf auf fachdidaktischer Grundlage. Petra Wolters
 Qualitätsdimensionen für Sportunterricht ein Entwurf auf fachdidaktischer Grundlage Petra Wolters Kiel, 12.1.2015 Gliederung 1 Problemstellung 2 Bildungsstandards und Kompetenzen 2.1 Bildungspolitischer
Qualitätsdimensionen für Sportunterricht ein Entwurf auf fachdidaktischer Grundlage Petra Wolters Kiel, 12.1.2015 Gliederung 1 Problemstellung 2 Bildungsstandards und Kompetenzen 2.1 Bildungspolitischer
Grundriß der Sportpädagogik
 Robert Prohl Grundriß der Sportpädagogik Limpert Verlag Inhalt Vorwort 5 1. Einführung: Was bedeutet Sportpädagogik"? 13 TeilA: 1.1 Funktionen einer wissenschaftlichen Betrachtung der Bewegungskultur 14
Robert Prohl Grundriß der Sportpädagogik Limpert Verlag Inhalt Vorwort 5 1. Einführung: Was bedeutet Sportpädagogik"? 13 TeilA: 1.1 Funktionen einer wissenschaftlichen Betrachtung der Bewegungskultur 14
Grundriss der Sportpadagogik
 Robert Prohl Grundriss der Sportpadagogik 2., stark iiberarbeitete Auflage Limpert Verlag Wiebelsheim Inhalt 1. Einfiihrung: Was bedeutet Sportpadagogik? 9 1.1 Funktionen einer wissenschaftlichen Betrachtung
Robert Prohl Grundriss der Sportpadagogik 2., stark iiberarbeitete Auflage Limpert Verlag Wiebelsheim Inhalt 1. Einfiihrung: Was bedeutet Sportpadagogik? 9 1.1 Funktionen einer wissenschaftlichen Betrachtung
Mündigkeit im und durch Sportunterricht
 Dr. Hans-Jürgen Wagner, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg Mündigkeit im und durch Sportunterricht Erziehung zur Mündigkeit ist ein zentrales und zeitloses Bildungsziel. In fast allen Lehrund Bildungsplänen
Dr. Hans-Jürgen Wagner, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg Mündigkeit im und durch Sportunterricht Erziehung zur Mündigkeit ist ein zentrales und zeitloses Bildungsziel. In fast allen Lehrund Bildungsplänen
SpielRaum Grünau - Bewegungsförderung im öffentlichen Raum
 SpielRaum Grünau - Bewegungsförderung im öffentlichen Raum 1 Projekt SpielRaum Grünau die Idee Bewegungsförderung im einem sozial benachteiligten Stadtgebiet ( Grünau bewegt sich ) Belebung des öffentlichen
SpielRaum Grünau - Bewegungsförderung im öffentlichen Raum 1 Projekt SpielRaum Grünau die Idee Bewegungsförderung im einem sozial benachteiligten Stadtgebiet ( Grünau bewegt sich ) Belebung des öffentlichen
Wissenschaftstheorie für Pädagogen
 2*120 Friedrich W. Krön Wissenschaftstheorie für Pädagogen Mit 25 Abbildungen und 9 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Inhalt Vorwort 9 1.0 Erkenntnis als Grundlegung 11 1.4.3 1.4.4 Handlungskonzepte
2*120 Friedrich W. Krön Wissenschaftstheorie für Pädagogen Mit 25 Abbildungen und 9 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Inhalt Vorwort 9 1.0 Erkenntnis als Grundlegung 11 1.4.3 1.4.4 Handlungskonzepte
Bildung und informelles Lernen
 Institut für Sport und Sportwissenschaften Bildung und informelles Lernen Erin Gerlach Input zum Workshop beim idée sport-kongress Sport kann alles!? 20. September 2012 Warum Hintergrund 12. Kinder-
Institut für Sport und Sportwissenschaften Bildung und informelles Lernen Erin Gerlach Input zum Workshop beim idée sport-kongress Sport kann alles!? 20. September 2012 Warum Hintergrund 12. Kinder-
Univ.-Prof. Dr. Georg Wydra. Vorlesung Allgemeine Sportdidaktik Modul Didaktik/Methodik. Baustein 2: Didaktische Entscheidungen
 Univ.-Prof. Dr. Georg Wydra Vorlesung Allgemeine Sportdidaktik Modul Didaktik/Methodik Baustein 2: Didaktische Entscheidungen Sportwissenschaftliches Institut der Universität des Saarlandes WS 2015/2016
Univ.-Prof. Dr. Georg Wydra Vorlesung Allgemeine Sportdidaktik Modul Didaktik/Methodik Baustein 2: Didaktische Entscheidungen Sportwissenschaftliches Institut der Universität des Saarlandes WS 2015/2016
Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Dietrich Kurz Universität Bielefeld Abteilung Sportwissenschaft
 Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Lektion 3: Die pädagogische Frage nach dem Sinn des Sports Die pädagogische Frage nach dem Sinn des Sports 1. Was ist
Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Lektion 3: Die pädagogische Frage nach dem Sinn des Sports Die pädagogische Frage nach dem Sinn des Sports 1. Was ist
Grundlagen der Sportpädagogik
 Grundlagen der Sportpädagogik Vorlesung zum Themenbereich Grundlagen des Schulsports (Modul 1.1 für RPO und GHPO) Do 9.30-11 Uhr im Seminarraum des Sportzentrums Sportzentrum der Pädagogischen Hochschule
Grundlagen der Sportpädagogik Vorlesung zum Themenbereich Grundlagen des Schulsports (Modul 1.1 für RPO und GHPO) Do 9.30-11 Uhr im Seminarraum des Sportzentrums Sportzentrum der Pädagogischen Hochschule
Vorwort der Herausgeber der Edition Schulsport Einleitung 12. Forschungsfeld Unterricht Unterrichtsforschung
 Inhalt Vorwort der Herausgeber der Edition Schulsport 10 1 Einleitung 12 Forschungsfeld Unterricht 18 2 Unterrichtsforschung 19 Petra Wolters 2.1 Einführung 19 2.2 Erkenntnisinteressen und Forschungsthemen
Inhalt Vorwort der Herausgeber der Edition Schulsport 10 1 Einleitung 12 Forschungsfeld Unterricht 18 2 Unterrichtsforschung 19 Petra Wolters 2.1 Einführung 19 2.2 Erkenntnisinteressen und Forschungsthemen
Tutorium. Organisation und Struktur der Vorlesung. Vorlesung. Einführung in die. Block A: Themenliste der Vorlesung
 Dr. Jörg Bietz/Prof. Dr. Ralf Laging (Universität Marburg WS 05/06) Sport im Kontext von Bewegungstheorie und Pädagogik Vorlesung 1: Einführung in die Struktur und Thematik der Vorlesung Organisation und
Dr. Jörg Bietz/Prof. Dr. Ralf Laging (Universität Marburg WS 05/06) Sport im Kontext von Bewegungstheorie und Pädagogik Vorlesung 1: Einführung in die Struktur und Thematik der Vorlesung Organisation und
I. Einleitung, Zielsetzung und Vorgehen... 11
 Inhaltsverzeichnis I. Einleitung, Zielsetzung und Vorgehen... 11 II. Historische Entwicklung der Rhythmus- und Tanzbewegung im 20. Jahrhundert pädagogisch-anthropologische Implikationen... 17 1. Die Entstehung
Inhaltsverzeichnis I. Einleitung, Zielsetzung und Vorgehen... 11 II. Historische Entwicklung der Rhythmus- und Tanzbewegung im 20. Jahrhundert pädagogisch-anthropologische Implikationen... 17 1. Die Entstehung
Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Dietrich Kurz Universität Bielefeld Abteilung Sportwissenschaft
 Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Lektion 12: Sport pädagogisch vermitteln Lektion 12: Sport pädagogisch vermitteln 1. Sport vermitteln nicht nur eine
Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Lektion 12: Sport pädagogisch vermitteln Lektion 12: Sport pädagogisch vermitteln 1. Sport vermitteln nicht nur eine
Fachtag Praxisbausteine Dresden
 Anerkannte beru liche Bildung für Menschen mit Behinderung Eine Frage der Haltung? Fachtag Praxisbausteine Dresden 2018.03.20 Dr. Stefan Thesing Überblick 1 Berufliche Bildung 2 Bedeutung für WfbM und
Anerkannte beru liche Bildung für Menschen mit Behinderung Eine Frage der Haltung? Fachtag Praxisbausteine Dresden 2018.03.20 Dr. Stefan Thesing Überblick 1 Berufliche Bildung 2 Bedeutung für WfbM und
Didaktik / Methodik Sozialer Arbeit
 Johannes Schilling Didaktik / Methodik Sozialer Arbeit Grundlagen und Konzepte 7., vollständig überarbeitete Auflage Mit 40 Abbildungen, 5 Tabellen und 177 Lernfragen Mit Online-Material Ernst Reinhardt
Johannes Schilling Didaktik / Methodik Sozialer Arbeit Grundlagen und Konzepte 7., vollständig überarbeitete Auflage Mit 40 Abbildungen, 5 Tabellen und 177 Lernfragen Mit Online-Material Ernst Reinhardt
Didaktik und Methodik des Sportunterrichts
 Didaktik und Methodik des Sportunterrichts Vorlesung zum Themenbereich Sport und Erziehung (Modul 4.1 für RPO und GHPO) Mi 16.15 17.45 Uhr im Seminarraum des Sportzentrums Ziele der Veranstaltung Vertiefte
Didaktik und Methodik des Sportunterrichts Vorlesung zum Themenbereich Sport und Erziehung (Modul 4.1 für RPO und GHPO) Mi 16.15 17.45 Uhr im Seminarraum des Sportzentrums Ziele der Veranstaltung Vertiefte
Einführung in die Sportpsychologie
 H. Gabler / J. R. Nitsch / R. Singer Einführung in die Sportpsychologie Teil 2: Anwendungsfelder unter Mitarbeit von Dorothee Alfermann, Achim Conzelmann, Dieter Hackfort, Jörg Knobloch, Peter Schwenkmezger,
H. Gabler / J. R. Nitsch / R. Singer Einführung in die Sportpsychologie Teil 2: Anwendungsfelder unter Mitarbeit von Dorothee Alfermann, Achim Conzelmann, Dieter Hackfort, Jörg Knobloch, Peter Schwenkmezger,
Monographien. Zimmer, R. (2018): Wilde Spiele zum Austoben. Durch Bewegung zur Ruhe kommen. Freiburg: Herder Verlag.
 Monographien Zimmer, R. (2018): Wilde Spiele zum Austoben. Durch Bewegung zur Ruhe kommen. Freiburg: Herder Zimmer, R. & Hunger, I. (Hrsg.) (2017): Gut starten. Bewegung Entwicklung Diversität. (Bericht
Monographien Zimmer, R. (2018): Wilde Spiele zum Austoben. Durch Bewegung zur Ruhe kommen. Freiburg: Herder Zimmer, R. & Hunger, I. (Hrsg.) (2017): Gut starten. Bewegung Entwicklung Diversität. (Bericht
Ernst Reinhardt Verlag München Basel
 Friedrich W. Krön Eiko Jürgens Jutta Standop Grundwissen Pädagogik 8., aktualisierte Auflage Mit 29 Abbildungen und 12 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Inhalt Vorworte 11 Hinweise zur Arbeit
Friedrich W. Krön Eiko Jürgens Jutta Standop Grundwissen Pädagogik 8., aktualisierte Auflage Mit 29 Abbildungen und 12 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Inhalt Vorworte 11 Hinweise zur Arbeit
Qualität im Schulsport
 Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft Herausgeber: Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft ISSN 1430-2225 Band 148 Andre Gogoll & Andrea Menze-Sonneck (Hrsg.) Qualität im Schulsport
Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft Herausgeber: Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft ISSN 1430-2225 Band 148 Andre Gogoll & Andrea Menze-Sonneck (Hrsg.) Qualität im Schulsport
Sportengagement und Entwicklung im Kindesalter
 Zu den Autoren Prof. Dr. Wolf-Dietrich Brettschneider lehrt und forscht an der Universität Paderborn im Department Sport und Gesundheit, Arbeitsbereich Sport und Erziehung. Zuvor war er Professor an der
Zu den Autoren Prof. Dr. Wolf-Dietrich Brettschneider lehrt und forscht an der Universität Paderborn im Department Sport und Gesundheit, Arbeitsbereich Sport und Erziehung. Zuvor war er Professor an der
Angewandte Statistik
 Institut für Sportwissenschaften Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M. Vorlesung + Übung Einführung 2 Gliederung Forschungsprozess Forschungsmethoden Einige Inhalte der Vorlesung Literatur 3
Institut für Sportwissenschaften Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M. Vorlesung + Übung Einführung 2 Gliederung Forschungsprozess Forschungsmethoden Einige Inhalte der Vorlesung Literatur 3
Beobachtung von Säuglingen und Kleinkindern - Ausgewählte Methoden der Kindheits- und Jugendforschung
 Pädagogik Aurelie Kuhn-Kapohl Beobachtung von Säuglingen und Kleinkindern - Ausgewählte Methoden der Kindheits- und Jugendforschung Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Warum Säuglingsforschung?... 2 2.
Pädagogik Aurelie Kuhn-Kapohl Beobachtung von Säuglingen und Kleinkindern - Ausgewählte Methoden der Kindheits- und Jugendforschung Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Warum Säuglingsforschung?... 2 2.
Die tägliche Sportstunde an Grundschulen in NRW
 Die tägliche Sportstunde an Grundschulen in NRW Prof. Dr. Miriam Seyda Juniorprofessorin für das Fach Bewegung, Spiel und Sport im Kindesalter Vortrag auf dem ÖISS-Kongress 2014: Schule-Sport-Sportstätte,
Die tägliche Sportstunde an Grundschulen in NRW Prof. Dr. Miriam Seyda Juniorprofessorin für das Fach Bewegung, Spiel und Sport im Kindesalter Vortrag auf dem ÖISS-Kongress 2014: Schule-Sport-Sportstätte,
Religionsunterricht wozu?
 Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
zwei Sichtweisen von Bewegungshandlungen:
 zwei Sichtweisen von Bewegungshandlungen: funktionaler Zugang vs. ästhetisch-expressiver Zugang funktionaler Zugang: mit der Bewegung soll ein Bewegungsproblem gelöst werden (z.b. den Ball im Basketballkorb
zwei Sichtweisen von Bewegungshandlungen: funktionaler Zugang vs. ästhetisch-expressiver Zugang funktionaler Zugang: mit der Bewegung soll ein Bewegungsproblem gelöst werden (z.b. den Ball im Basketballkorb
Allgemeine Pädagogik
 Margit Stein Allgemeine Pädagogik 2., überarbeitete Auflage Mit 14 Abbildungen und 25 Tabellen Mit 56 Übungsaufgaben Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. phil. habil. Margit Stein, Dipl-Psych.,
Margit Stein Allgemeine Pädagogik 2., überarbeitete Auflage Mit 14 Abbildungen und 25 Tabellen Mit 56 Übungsaufgaben Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. phil. habil. Margit Stein, Dipl-Psych.,
Jugend und Sport - Zwischen Transition und Moratorium
 Sport Ruben Loest Jugend und Sport - Zwischen Transition und Moratorium Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 1. Einleitung 2 2. Jugend als Moratorium 3 2.1 Moratoriumskonzepte 5 2.1.1
Sport Ruben Loest Jugend und Sport - Zwischen Transition und Moratorium Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 1. Einleitung 2 2. Jugend als Moratorium 3 2.1 Moratoriumskonzepte 5 2.1.1
Kompetenzmodelle als Grundlage von schulischen Bildungsstandards - Modellierungsprobleme im Fach Sport
 1 Institut für Sportwissenschaft Prof. Dr. André Gogoll Kompetenzmodelle als Grundlage von schulischen Bildungsstandards - Modellierungsprobleme im Fach Sport 2 I. Der Kompetenzbegriff und seine Bedeutungen
1 Institut für Sportwissenschaft Prof. Dr. André Gogoll Kompetenzmodelle als Grundlage von schulischen Bildungsstandards - Modellierungsprobleme im Fach Sport 2 I. Der Kompetenzbegriff und seine Bedeutungen
Einführung in die Erziehungs- und Bildungswissenschaft
 Cathleen Grunert Einführung in die Erziehungs- und Bildungswissenschaft Vorwort zum Modul Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten
Cathleen Grunert Einführung in die Erziehungs- und Bildungswissenschaft Vorwort zum Modul Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten
Teil A: Zentrale Ziele des Pragmatischen Pädagogikunterrichts
 III Vorwort der Reihenherausgeber IX Vorwort 1 Einleitung Bezeichnung, Form und Anliegen der Didaktik 5 1. Die Bezeichnung Pragmatische Fachdidaktik Pädagogik" 5 2. Die Präsentation der Fachdidaktik in
III Vorwort der Reihenherausgeber IX Vorwort 1 Einleitung Bezeichnung, Form und Anliegen der Didaktik 5 1. Die Bezeichnung Pragmatische Fachdidaktik Pädagogik" 5 2. Die Präsentation der Fachdidaktik in
Schulsport als Motor für Gesundheitsförderung Probleme und Potenziale
 Impulsreferat auf der Landeskonferenz Sport und Gesundheit am 19. April 2018 im Bürgerhaus Güstrow Schulsport als Motor für Gesundheitsförderung Probleme und Potenziale Eckart Balz / Bergische Universität
Impulsreferat auf der Landeskonferenz Sport und Gesundheit am 19. April 2018 im Bürgerhaus Güstrow Schulsport als Motor für Gesundheitsförderung Probleme und Potenziale Eckart Balz / Bergische Universität
Pädagogik/Psychologie Lehrplan für das Ergänzungsfach
 Kantonsschule Zug l Gymnasium Pädagogik/Psychologie Ergänzungsfach Pädagogik/Psychologie Lehrplan für das Ergänzungsfach A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 0 0 0 0 0 5 B. Didaktische
Kantonsschule Zug l Gymnasium Pädagogik/Psychologie Ergänzungsfach Pädagogik/Psychologie Lehrplan für das Ergänzungsfach A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 0 0 0 0 0 5 B. Didaktische
Das Konzept der individuellen Förderung: vom theoretischen Rahmen zur praxisnahen Lehrerfortbildung
 Das Konzept der individuellen Förderung: vom theoretischen Rahmen zur praxisnahen Lehrerfortbildung Dr. Christiane Bohn WWU Münster Institut für Sportwissenschaft Individuelle Förderung bedeutet, dass
Das Konzept der individuellen Förderung: vom theoretischen Rahmen zur praxisnahen Lehrerfortbildung Dr. Christiane Bohn WWU Münster Institut für Sportwissenschaft Individuelle Förderung bedeutet, dass
Dr. Bettina Kleiner BILDUNG UND SELBSTBESTIMMUNGSFÄHIGKEIT IN POSTMODERNEN GESELLSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSEN. Vortrag am 6.
 Dr. Bettina Kleiner BILDUNG UND SELBSTBESTIMMUNGSFÄHIGKEIT IN POSTMODERNEN GESELLSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSEN Vortrag am 6. Dezember 2017 Universitäts-Gesellschaft Hamburg Verortung meines Beitrags Qualitative
Dr. Bettina Kleiner BILDUNG UND SELBSTBESTIMMUNGSFÄHIGKEIT IN POSTMODERNEN GESELLSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSEN Vortrag am 6. Dezember 2017 Universitäts-Gesellschaft Hamburg Verortung meines Beitrags Qualitative
Selbst- oder Mitbestimmung im Sportunterricht: Qualitative Aussagen von Schülerinnen und Schülern - quantitativ validiert
 A. Bund, J. Hönmann, B. Berner, N. Kälberer & N. Bandow (Technische Universität Darmstadt) Selbst- oder Mitbestimmung im Sportunterricht: Qualitative Aussagen von Schülerinnen und Schülern - quantitativ
A. Bund, J. Hönmann, B. Berner, N. Kälberer & N. Bandow (Technische Universität Darmstadt) Selbst- oder Mitbestimmung im Sportunterricht: Qualitative Aussagen von Schülerinnen und Schülern - quantitativ
Studien zur Didaktik und Schultheorie
 Dietrich Benner Studien zur Didaktik und Schultheorie Pädagogik als Wissenschaft, Handlungstheorie und Reformpraxis Band 3 L Juventa Verlag Weinheim und München 1995 Inhalt A Theoretische Studien I. Hauptströmungen
Dietrich Benner Studien zur Didaktik und Schultheorie Pädagogik als Wissenschaft, Handlungstheorie und Reformpraxis Band 3 L Juventa Verlag Weinheim und München 1995 Inhalt A Theoretische Studien I. Hauptströmungen
Sicher und kompetent den eigenen Mut ausloten!
 1 Sicher und kompetent den eigenen Mut ausloten! Im Modul «Wagnis» stehen Aufgaben und Problemlösungen im Vordergrund, die Mut erfordern. Dabei wird durch den Umgang mit Angst das emotionale Selbstkonzept
1 Sicher und kompetent den eigenen Mut ausloten! Im Modul «Wagnis» stehen Aufgaben und Problemlösungen im Vordergrund, die Mut erfordern. Dabei wird durch den Umgang mit Angst das emotionale Selbstkonzept
Profilstudium Bildungstheorie und Bildungsforschung
 Profilstudium Bildungstheorie und Bildungsforschung Master of Arts Erziehungswissenschaft Prof. Dr. Ruprecht Mattig Systematische Erziehungswissenschaft Prof. Dr. Ulrike Mietzner Historische Bildungsforschung
Profilstudium Bildungstheorie und Bildungsforschung Master of Arts Erziehungswissenschaft Prof. Dr. Ruprecht Mattig Systematische Erziehungswissenschaft Prof. Dr. Ulrike Mietzner Historische Bildungsforschung
Schule als Bildungsinstitution und Rolle der Lehrperson Termin 3, WS 16/17
 Schule als Bildungsinstitution und Rolle der Lehrperson Termin 3, WS 16/17 Christian Kraler Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung School of Education, Universität Innsbruck Christian.Kraler@uibk.ac.at
Schule als Bildungsinstitution und Rolle der Lehrperson Termin 3, WS 16/17 Christian Kraler Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung School of Education, Universität Innsbruck Christian.Kraler@uibk.ac.at
Vorlesung: BA, Kulturwissenschaften-Einführung // GS, Typ C Montag, 11:15-12:45 Uhr, Ort: GD Hs
 Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Kulturwissenschaft - Methoden II - Vorlesung: BA, Kulturwissenschaften-Einführung // GS, Typ C Montag, 11:15-12:45 Uhr, Ort: GD Hs8 19.11.2007 Verstehend-historiographische
Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Kulturwissenschaft - Methoden II - Vorlesung: BA, Kulturwissenschaften-Einführung // GS, Typ C Montag, 11:15-12:45 Uhr, Ort: GD Hs8 19.11.2007 Verstehend-historiographische
Prüfungsliteratur Modul Fachdidaktik
 Prüfungsliteratur Modul Fachdidaktik Stand: Januar 2009 A Überblicksliteratur Allgemeine Didaktik Arnold, K.-H., Sandfuchs, U. & Wiechmann, J. (Hrsg.). (2006). Handbuch Unterricht. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Prüfungsliteratur Modul Fachdidaktik Stand: Januar 2009 A Überblicksliteratur Allgemeine Didaktik Arnold, K.-H., Sandfuchs, U. & Wiechmann, J. (Hrsg.). (2006). Handbuch Unterricht. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Die Implementation einer Intervention zur Veränderung des Selbstkonzepts im Sportunterricht
 Sektion Sportpädagogik Die Implementation einer Intervention zur Veränderung des Selbstkonzepts im Sportunterricht Esther Oswald, Stefan Valkanover & Achim Conzelmann Institut für Sportwissenschaft, Universität
Sektion Sportpädagogik Die Implementation einer Intervention zur Veränderung des Selbstkonzepts im Sportunterricht Esther Oswald, Stefan Valkanover & Achim Conzelmann Institut für Sportwissenschaft, Universität
Pädagogische Ordnung von Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans
 1 Pädagogische Ordnung von Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans > Angebote in den PP-Heften Pädagogische Ordnung von Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans 2 anthropologische Voraussetzungen Erziehung
1 Pädagogische Ordnung von Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans > Angebote in den PP-Heften Pädagogische Ordnung von Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans 2 anthropologische Voraussetzungen Erziehung
Klausurrelevante Zusammenfassung WS Kurs Teil 2 Modul 1A B A 1 von
 Klausurrelevante Zusammenfassung WS 2010 2011 Kurs 33042 Teil 2 Modul 1A B A 1 von 12-21.02.11 Lernzusammenfassung Dilthey und der hermeneutische Zirkel - 33042 - T2...3 Lebensphilosophie Dilthey - (3)...3
Klausurrelevante Zusammenfassung WS 2010 2011 Kurs 33042 Teil 2 Modul 1A B A 1 von 12-21.02.11 Lernzusammenfassung Dilthey und der hermeneutische Zirkel - 33042 - T2...3 Lebensphilosophie Dilthey - (3)...3
Pädagogik als Nebenfach im Diplomstudiengang Informatik. Man könnte kurz auch sagen: Pädagogik befasst sich damit, wie man Menschen etwas beibringt.
 Universität Stuttgart Abteilung für Pädagogik Prof. Dr. Martin Fromm Dillmannstr. 15, D-70193 Stuttgart Pädagogik als Nebenfach im Diplomstudiengang Informatik Was ist Pädagogik? Pädagogen befassen sich
Universität Stuttgart Abteilung für Pädagogik Prof. Dr. Martin Fromm Dillmannstr. 15, D-70193 Stuttgart Pädagogik als Nebenfach im Diplomstudiengang Informatik Was ist Pädagogik? Pädagogen befassen sich
Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Dietrich Kurz Universität Bielefeld Abteilung Sportwissenschaft
 Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Lektion I: Worum geht es in der Sportpädagogik? Worum geht es in der Sportpädagogik? 1.Sportwissenschaft als angewandte
Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Lektion I: Worum geht es in der Sportpädagogik? Worum geht es in der Sportpädagogik? 1.Sportwissenschaft als angewandte
Prof. Dr. Jürgen Neyer. Einführung in die Politikwissenschaft. - Was ist Wissenschaft? Di
 Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Politikwissenschaft - 25.4.2008 Di 11-15-12.45 Wissenschaft ist die Tätigkeit des Erwerbs von Wissen durch Forschung, seine Weitergabe durch Lehre, der gesellschaftliche,
Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Politikwissenschaft - 25.4.2008 Di 11-15-12.45 Wissenschaft ist die Tätigkeit des Erwerbs von Wissen durch Forschung, seine Weitergabe durch Lehre, der gesellschaftliche,
Spezielle wissenschaftliche Arbeitsmethoden
 Prof. Dr. Ralf Laging Einführung in die speziellen wissenschaftlichen Arbeitsmethoden Vorlesungsteil 2 Spezielle wissenschaftliche Arbeitsmethoden Methodologische Grundlagen qualitativer Forschung (Teil
Prof. Dr. Ralf Laging Einführung in die speziellen wissenschaftlichen Arbeitsmethoden Vorlesungsteil 2 Spezielle wissenschaftliche Arbeitsmethoden Methodologische Grundlagen qualitativer Forschung (Teil
Forschungsmethoden VORLESUNG WS 2017/2018
 Forschungsmethoden VORLESUNG WS 2017/2018 SOPHIE LUKES Überblick Letzte Woche: Messen Heute: Hypothesen Warum Hypothesen? Menschliches Erleben und Verhalten? Alltag vs. Wissenschaft Alltagsvermutung Wissenschaftliche
Forschungsmethoden VORLESUNG WS 2017/2018 SOPHIE LUKES Überblick Letzte Woche: Messen Heute: Hypothesen Warum Hypothesen? Menschliches Erleben und Verhalten? Alltag vs. Wissenschaft Alltagsvermutung Wissenschaftliche
Einführung in die Allgemeine Bildungswissenschaft
 Cathleen Grunert Einführung in die Allgemeine Bildungswissenschaft Vorwort zum Modul Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
Cathleen Grunert Einführung in die Allgemeine Bildungswissenschaft Vorwort zum Modul Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
Grundwissen Pädagogik
 Friedrich W. Kron Grundwissen Pädagogik 7., vollst. überarbeitete und erweiterte Auflage Mit 29 Abbildungen und 12 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. phil. Friedrich W. Kron, Universitätsprofessor
Friedrich W. Kron Grundwissen Pädagogik 7., vollst. überarbeitete und erweiterte Auflage Mit 29 Abbildungen und 12 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. phil. Friedrich W. Kron, Universitätsprofessor
Examensthemen in Allgemeiner Pädagogik: Realschule
 Examensthemen in Allgemeiner Pädagogik: Realschule Herbst 2018 Stellen Sie die Erziehungstheorie Deweys in ihren wesentlichen Zügen vor! Arbeiten Sie den Zusammenhang von Erziehung und Demokratie an Deweys
Examensthemen in Allgemeiner Pädagogik: Realschule Herbst 2018 Stellen Sie die Erziehungstheorie Deweys in ihren wesentlichen Zügen vor! Arbeiten Sie den Zusammenhang von Erziehung und Demokratie an Deweys
Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft
 Einführungskurs Erziehungswissenschaft Herausgegeben von Heinz-Hermann Krüger Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft Die weiteren Bände Band I Heinz-Hermann
Einführungskurs Erziehungswissenschaft Herausgegeben von Heinz-Hermann Krüger Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft Die weiteren Bände Band I Heinz-Hermann
Kindheits- und Jugendforschung
 Cathleen Grunert Kindheits- und Jugendforschung Einführung zum Modul Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung
Cathleen Grunert Kindheits- und Jugendforschung Einführung zum Modul Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung
Theorien der Erziehungswissenschaft
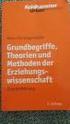 Eckard König / Peter Zedler Theorien der Erziehungswissenschaft Einführung in Grundlagen, Methoden und praktische Konsequenzen 2. Auflage Beltz Verlag Weinheim und Basel Inhaltsverzeichnis Vorwort zur
Eckard König / Peter Zedler Theorien der Erziehungswissenschaft Einführung in Grundlagen, Methoden und praktische Konsequenzen 2. Auflage Beltz Verlag Weinheim und Basel Inhaltsverzeichnis Vorwort zur
Wir/Ich und die anderen
 In der vorliegenden qualitativen Forschungsarbeit werden die Schülersichtweisen auf bedeutsame Gruppenidentifikationen und -beziehungen im Alltag des Sportunterrichts rekonstruiert. Es zeigt sich dabei,
In der vorliegenden qualitativen Forschungsarbeit werden die Schülersichtweisen auf bedeutsame Gruppenidentifikationen und -beziehungen im Alltag des Sportunterrichts rekonstruiert. Es zeigt sich dabei,
Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften neue LPO I. Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik
 Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften neue LPO I Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik Inhaltliche Teilgebiete der Allgemeinen Pädagogik gemäß 32 LPO I a) theoretische
Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften neue LPO I Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik Inhaltliche Teilgebiete der Allgemeinen Pädagogik gemäß 32 LPO I a) theoretische
Fahrplan für die Vorlesung
 Fahrplan für die Vorlesung Einführung in die Grundfragen der VE Kurze Zusammenfassung 1. Gegenstandsbereiche der VE und Definitionsversuch (Was ist das Spezifische der VE?) 2. Vergleiche in der VE 3. Funktionen
Fahrplan für die Vorlesung Einführung in die Grundfragen der VE Kurze Zusammenfassung 1. Gegenstandsbereiche der VE und Definitionsversuch (Was ist das Spezifische der VE?) 2. Vergleiche in der VE 3. Funktionen
Geisteswissenschaftliche Pädagogik
 Geisteswissenschaftliche Pädagogik Ein Lehrbuch von Dr. Eva Universität Augsburg Oldenbourg Verlag München Vorwort V Erster Teil: Biographische Zugänge 1 Vorbemerkung 3 1 Herman Nohl 3 2 Theodor Litt 8
Geisteswissenschaftliche Pädagogik Ein Lehrbuch von Dr. Eva Universität Augsburg Oldenbourg Verlag München Vorwort V Erster Teil: Biographische Zugänge 1 Vorbemerkung 3 1 Herman Nohl 3 2 Theodor Litt 8
Bildung und Erziehung: Historisch-systematische Zugänge. Semesterlage Dauer Status Zugangsvoraussetzung LP / Workload
 1. Anlage: Übersicht der Module und sleistungen 1.1. Pädagogik (2-Fächer Bachelor 70 LP) Pflichtmodule (40 LP) PHF-paed-Ba-P1 Bildung und Erziehung: Historisch-systematische Zugänge 1. Semester 1 Semester
1. Anlage: Übersicht der Module und sleistungen 1.1. Pädagogik (2-Fächer Bachelor 70 LP) Pflichtmodule (40 LP) PHF-paed-Ba-P1 Bildung und Erziehung: Historisch-systematische Zugänge 1. Semester 1 Semester
Teilstudiengang Pädagogik im Master Education Themen und Anforderungen von Masterarbeiten sowie Anforderungen der mündlichen Abschlussprüfung
 Teilstudiengang Pädagogik im Master Education Themen und Anforderungen von Masterarbeiten sowie Anforderungen der mündlichen Abschlussprüfung Informationsveranstaltung im Rahmen des Mastertags des Centrums
Teilstudiengang Pädagogik im Master Education Themen und Anforderungen von Masterarbeiten sowie Anforderungen der mündlichen Abschlussprüfung Informationsveranstaltung im Rahmen des Mastertags des Centrums
Mögliche Themen für Abschlussarbeiten (Zulassungs-, Bachelor- oder Masterarbeiten) bei der Professur für Sport- und Gesundheitspädagogik
 Mögliche Themen für Abschlussarbeiten (Zulassungs-, Bachelor- oder Masterarbeiten) bei der Professur für Sport- und Gesundheitspädagogik Am Lehrstuhl Sport- und Gesundheitspädagogik sind folgende Abschlussarbeiten
Mögliche Themen für Abschlussarbeiten (Zulassungs-, Bachelor- oder Masterarbeiten) bei der Professur für Sport- und Gesundheitspädagogik Am Lehrstuhl Sport- und Gesundheitspädagogik sind folgende Abschlussarbeiten
Inhaltsverzeichnis 3. Einleitung in den Forschungszusammenhang Themenkonstitution 9
 3 Einleitung in den Forschungszusammenhang Themenkonstitution 9 Themenkonstitution im Spiegel der Fachdidaktiken 9 Fragen zur Annäherung 10 Zu den Themen und deren Konstitution 11 Bärbel Völkel Themengewinnung
3 Einleitung in den Forschungszusammenhang Themenkonstitution 9 Themenkonstitution im Spiegel der Fachdidaktiken 9 Fragen zur Annäherung 10 Zu den Themen und deren Konstitution 11 Bärbel Völkel Themengewinnung
1.1 Gesellschaftspolitische Hintergründe interreligiösen Lernens und pädagogische Verantwortung Kindertheologie und Problemlagen 6
 Inhaltsverzeichnis 1. EINLEITUNG 1 1.1 Gesellschaftspolitische Hintergründe interreligiösen Lernens und pädagogische Verantwortung 3 1.2 Kindertheologie und Problemlagen 6 1.3 Religionsdidaktik - Selbstverständnis
Inhaltsverzeichnis 1. EINLEITUNG 1 1.1 Gesellschaftspolitische Hintergründe interreligiösen Lernens und pädagogische Verantwortung 3 1.2 Kindertheologie und Problemlagen 6 1.3 Religionsdidaktik - Selbstverständnis
Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften LPO I. Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik
 Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften LPO I Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik Inhaltliche Teilgebiete der Allgemeinen Pädagogik gemäß 32 LPO I a) Theoretische Grundlagen
Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften LPO I Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik Inhaltliche Teilgebiete der Allgemeinen Pädagogik gemäß 32 LPO I a) Theoretische Grundlagen
Univ.-Prof. Dr. Helmut Altenberger Institut für Sportwissenschaft Allgemeine Didaktik Stufenbezogene Didaktik: Sportdidaktik = Fachdidaktik
 Univ.-Prof. Dr. Helmut Altenberger Institut für Sportwissenschaft der Philosophisch Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg Sportdidaktik I 2004 Univ.-Prof. Dr. Helmut Altenberger Allgemeine
Univ.-Prof. Dr. Helmut Altenberger Institut für Sportwissenschaft der Philosophisch Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg Sportdidaktik I 2004 Univ.-Prof. Dr. Helmut Altenberger Allgemeine
Fach Pädagogik: Schulinternes Curriculum am Gymnasium Lohmar für Grund- und Leistungskurse der Jahrgangsstufen Q1 und Q2.
 Unterrichtsvorhaben I: Hilf mir, es selbst zu tun - Überprüfung pädagogischer Interaktionsmöglichkeiten im Kindesalter anhand der Montessoripädagogik als ein reformpädagogisches Konzept (+ Rückblick/Erweiterung
Unterrichtsvorhaben I: Hilf mir, es selbst zu tun - Überprüfung pädagogischer Interaktionsmöglichkeiten im Kindesalter anhand der Montessoripädagogik als ein reformpädagogisches Konzept (+ Rückblick/Erweiterung
Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis 1. Einführung-Was ist Schulpädagogik? 10 1.1 Gegenstands- und Theoriefelder der Schulpädagogik 10 1.2 Die Schulpädagogik als akademische Disziplin heute 11 1.3 Theorie-Praxis-Verhältnis
Inhaltsverzeichnis 1. Einführung-Was ist Schulpädagogik? 10 1.1 Gegenstands- und Theoriefelder der Schulpädagogik 10 1.2 Die Schulpädagogik als akademische Disziplin heute 11 1.3 Theorie-Praxis-Verhältnis
WISSENSCHAFTSTHEORIE
 WISSENSCHAFTSTHEORIE Eine Einführung für Pädagogen, von Herbert Tschamler 3., erweiterte und überarbeitete Auflage KLINKHARDT 1996 VERLAG JULIUS KLINKHARDT BAD HEILBRUNN Inhalt Vorwort zur 1. Auflage.
WISSENSCHAFTSTHEORIE Eine Einführung für Pädagogen, von Herbert Tschamler 3., erweiterte und überarbeitete Auflage KLINKHARDT 1996 VERLAG JULIUS KLINKHARDT BAD HEILBRUNN Inhalt Vorwort zur 1. Auflage.
Selbstkompetenz. der Schülerinnen und Schüler fördern. Ansätze und Vermittlungskonzepte im Berufsschulsport
 Fred Brauweiler Peter Elflein Paul Klingen (Hrsg.) Landesinstitut für Schule Bremen Selbstkompetenz der Schülerinnen und Schüler fördern Ansätze und Vermittlungskonzepte im Berufsschulsport Dokumentation
Fred Brauweiler Peter Elflein Paul Klingen (Hrsg.) Landesinstitut für Schule Bremen Selbstkompetenz der Schülerinnen und Schüler fördern Ansätze und Vermittlungskonzepte im Berufsschulsport Dokumentation
Das Fach Praktische Philosophie wird im Umfang von zwei Unterrichtsstunden in der 8./9. Klasse unterrichtet. 1
 Werrestraße 10 32049 Herford Tel.: 05221-1893690 Fax: 05221-1893694 Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie in der Sekundarstufe I (G8) (in Anlehnung an den Kernlehrplan Praktische
Werrestraße 10 32049 Herford Tel.: 05221-1893690 Fax: 05221-1893694 Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie in der Sekundarstufe I (G8) (in Anlehnung an den Kernlehrplan Praktische
Univ.-Prof. Dr. Georg Wydra Universität des Saarlandes Sportwissenschaftliches Institut Arbeitsbereich Gesundheits- und Sportpädagogik
 Klausur zur Vorlesung Sportpädagogik (SS 2005) 1. Grenzen Sie die Begriffe Sportpädagogik, Didaktik und Methodik voneinander ab! (3 Punkte) 2. Wieso hat sich das Sportartenkonzept so gegenüber anderen
Klausur zur Vorlesung Sportpädagogik (SS 2005) 1. Grenzen Sie die Begriffe Sportpädagogik, Didaktik und Methodik voneinander ab! (3 Punkte) 2. Wieso hat sich das Sportartenkonzept so gegenüber anderen
10 Leitbilder des Studiums in Gerontologie
 10 Leitbilder des Studiums in Gerontologie des Instituts für Psychogerontologie der Universität Erlangen-Nürnberg F. R. Lang, S. Engel, H.-J. Kaiser, K. Schüssel & R. Rupprecht Präambel In den vergangenen
10 Leitbilder des Studiums in Gerontologie des Instituts für Psychogerontologie der Universität Erlangen-Nürnberg F. R. Lang, S. Engel, H.-J. Kaiser, K. Schüssel & R. Rupprecht Präambel In den vergangenen
Einleitung Teil 1 Didaktik-Theoretische G rundlagen Didaktik als W issenschaft... 19
 Inhalt Einleitung... 11 Teil 1 Didaktik-Theoretische G rundlagen... 17 1 Didaktik als W issenschaft... 19 1.1 Was versteht man unter Sozialer A rbeit?... 19 1.2 Was versteht man unter Didaktik?... 20 1.2.1
Inhalt Einleitung... 11 Teil 1 Didaktik-Theoretische G rundlagen... 17 1 Didaktik als W issenschaft... 19 1.1 Was versteht man unter Sozialer A rbeit?... 19 1.2 Was versteht man unter Didaktik?... 20 1.2.1
Allgemeiner Überblick zum Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft
 Allgemeiner Überblick zum Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft Der auf sechs Semester angelegte Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft an der Universität Augsburg ist theoriegeleitet und zielt
Allgemeiner Überblick zum Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft Der auf sechs Semester angelegte Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft an der Universität Augsburg ist theoriegeleitet und zielt
Hans-Jürgen Schindele. Oskar Vogelhuber (1878 bis 1971) Leben und Werk eines bayerischen Volksschulpädagogen und Lehrerbildners
 Hans-Jürgen Schindele Oskar Vogelhuber (1878 bis 1971) Leben und Werk eines bayerischen Volksschulpädagogen und Lehrerbildners Herbert Utz Verlag München Pädagogik Zugl.: Diss., Erlangen-Nürnberg, Univ.,
Hans-Jürgen Schindele Oskar Vogelhuber (1878 bis 1971) Leben und Werk eines bayerischen Volksschulpädagogen und Lehrerbildners Herbert Utz Verlag München Pädagogik Zugl.: Diss., Erlangen-Nürnberg, Univ.,
Forschungsmethoden VORLESUNG SS 2017
 Forschungsmethoden VORLESUNG SS 2017 SOPHIE LUKES Überblick Letzte Woche: Messen Heute: Hypothesen Warum Hypothesen? Menschliches Erleben und Verhalten? Alltag vs. Wissenschaft Alltagsvermutung Wissenschaftliche
Forschungsmethoden VORLESUNG SS 2017 SOPHIE LUKES Überblick Letzte Woche: Messen Heute: Hypothesen Warum Hypothesen? Menschliches Erleben und Verhalten? Alltag vs. Wissenschaft Alltagsvermutung Wissenschaftliche
Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz
 Kolloquium Fremdsprachenunterricht 56 Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz Ein Beitrag zur Theoriebildung Bearbeitet von Nadine Stahlberg 1. Auflage 2016. Buch. 434 S. Hardcover ISBN 978 3 631 67479
Kolloquium Fremdsprachenunterricht 56 Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz Ein Beitrag zur Theoriebildung Bearbeitet von Nadine Stahlberg 1. Auflage 2016. Buch. 434 S. Hardcover ISBN 978 3 631 67479
Prüfungsliteratur Modul Sportdidaktik
 Prüfungsliteratur Modul Sportdidaktik Stand: 22.04.2016 A Überblicksliteratur Allgemeine Didaktik Arnold, K.-H., Sandfuchs, U. & Wiechmann, J. (Hrsg.). (2009). Handbuch Unterricht (2., aktualisierte Aufl.).
Prüfungsliteratur Modul Sportdidaktik Stand: 22.04.2016 A Überblicksliteratur Allgemeine Didaktik Arnold, K.-H., Sandfuchs, U. & Wiechmann, J. (Hrsg.). (2009). Handbuch Unterricht (2., aktualisierte Aufl.).
Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung
 Geisteswissenschaft Sarah Nolte Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Studienarbeit Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Sarah Nolte Universität zu Köln 1. Einleitung...1
Geisteswissenschaft Sarah Nolte Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Studienarbeit Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Sarah Nolte Universität zu Köln 1. Einleitung...1
dvs Hochschultag Kreativität Innovation Leistung September 2011 Martin Luther Universität Halle Wittenberg
 Dialogforum zwischen Sportwissenschaft und Sportorganisation: Herausforderung Ganztagsschule Fragen zu Auswirkungen und Gestaltungsoptionen der dritten Säule des Kinder und Jugendsports dvs Hochschultag
Dialogforum zwischen Sportwissenschaft und Sportorganisation: Herausforderung Ganztagsschule Fragen zu Auswirkungen und Gestaltungsoptionen der dritten Säule des Kinder und Jugendsports dvs Hochschultag
Wirkungen Kultureller Bildung
 Wirkungen Kultureller Bildung Tagung Kultur.Bildung Bamberg, 17.03.2012 München 1 Zur Unterscheidung (Natur-)Wissenschaftliches Wirkungsverständnis Kontrolle aller Wirkfaktoren im Ursache-Wirkungs- Zusammenhang
Wirkungen Kultureller Bildung Tagung Kultur.Bildung Bamberg, 17.03.2012 München 1 Zur Unterscheidung (Natur-)Wissenschaftliches Wirkungsverständnis Kontrolle aller Wirkfaktoren im Ursache-Wirkungs- Zusammenhang
Modulhandbuch Erziehungswissenschaft
 Fächerübergreifender Bachelor (für M.Ed. LG) Grundwissen Erziehungswissenschaft/Psychologie FüBA A.2.1 ; Institut für Psychologie Prof. Dr. Andreas Wernet 2. und 3. Semester (nach Studienplan) Vorlesungen
Fächerübergreifender Bachelor (für M.Ed. LG) Grundwissen Erziehungswissenschaft/Psychologie FüBA A.2.1 ; Institut für Psychologie Prof. Dr. Andreas Wernet 2. und 3. Semester (nach Studienplan) Vorlesungen
Kritische Theorie und Pädagogik der Gegenwart
 Kritische Theorie und Pädagogik der Gegenwart Aspekte und Perspektiven der Auseinandersetzung Herausgegeben von F. Hartmut Paffrath Mit Beiträgen von Stefan Blankertz, Bernhard Claußen, Hans-Hermann Groothoff,
Kritische Theorie und Pädagogik der Gegenwart Aspekte und Perspektiven der Auseinandersetzung Herausgegeben von F. Hartmut Paffrath Mit Beiträgen von Stefan Blankertz, Bernhard Claußen, Hans-Hermann Groothoff,
1 Einleitung 1 Einleitung
 1 Einleitung 1 Einleitung Sind Grundschüler/-innen zu klein für große Politik? Wenige Aspekte der politischen Bildung werden von gesellschaftlicher Seite heute noch so kritisch betrachtet wie das politische
1 Einleitung 1 Einleitung Sind Grundschüler/-innen zu klein für große Politik? Wenige Aspekte der politischen Bildung werden von gesellschaftlicher Seite heute noch so kritisch betrachtet wie das politische
Prof. Dr. Tobias Schlömer
 Workshop zur Gestaltungsorientierten Forschung/Panel 2 Fast beste Freunde wie Praxis und Wissenschaft zueinander finden Prof. Dr. Tobias Schlömer Wissenschaftszentrum in Bonn 22. Juni 2017 Agenda (1) Prolog
Workshop zur Gestaltungsorientierten Forschung/Panel 2 Fast beste Freunde wie Praxis und Wissenschaft zueinander finden Prof. Dr. Tobias Schlömer Wissenschaftszentrum in Bonn 22. Juni 2017 Agenda (1) Prolog
Forschungsmethoden VORLESUNG WS 2016/17
 Forschungsmethoden VORLESUNG WS 2016/17 FLORIAN KOBYLKA, SOPHIE LUKES Organisatorisches Termine Raum 231 1 28.10.16 10:15 Sophie Lukes / Florian Einführung Kobylka 2 04.11.16 10:10 Florian Kobylka Psychologie
Forschungsmethoden VORLESUNG WS 2016/17 FLORIAN KOBYLKA, SOPHIE LUKES Organisatorisches Termine Raum 231 1 28.10.16 10:15 Sophie Lukes / Florian Einführung Kobylka 2 04.11.16 10:10 Florian Kobylka Psychologie
Fach Pädagogik: Schulinternes Curriculum am Gymnasium Lohmar für Grund- und Leistungskurse der Jahrgangsstufen Q1 und Q2.
 Unterrichtsvorhaben I: Hilf mir, es selbst zu tun - Überprüfung pädagogischer Interaktionsmöglichkeiten im Kindesalter anhand der Montessoripädagogik als ein reformpädagogisches Konzept (+ Rückblick/Erweiterung
Unterrichtsvorhaben I: Hilf mir, es selbst zu tun - Überprüfung pädagogischer Interaktionsmöglichkeiten im Kindesalter anhand der Montessoripädagogik als ein reformpädagogisches Konzept (+ Rückblick/Erweiterung
Wirkungsforschung zu ästhetisch-kulturellen Bildungsangeboten in den Feldern Bewegung, Tanz, Musik und Theater
 Wirkungsforschung zu ästhetisch-kulturellen Bildungsangeboten in den Feldern Bewegung, Tanz, Musik und Theater Dr. Claudia Steinberg Institut für Sportwissenschaft/ Abteilung Sportpädagogik/ ethik Johannes
Wirkungsforschung zu ästhetisch-kulturellen Bildungsangeboten in den Feldern Bewegung, Tanz, Musik und Theater Dr. Claudia Steinberg Institut für Sportwissenschaft/ Abteilung Sportpädagogik/ ethik Johannes
4 SWS Arbeitsaufwand insgesamt Arbeitsstunden: 180 Anrechnungspunkte: 6 AP Arbeitsaufwand (Std.) Präsenzzeit: bereitung: 60. Vor- u.
 Modul (Modulnr.) SU-1: Didaktik des Sachunterrichts (18010) SU-1.1: Einführung in die Didaktik des Sachunterrichts (18011), Vorlesung, 2 SWS, 2 AP SU-1.2: Entwicklung und Probleme der Didaktik des Sachunterrichts
Modul (Modulnr.) SU-1: Didaktik des Sachunterrichts (18010) SU-1.1: Einführung in die Didaktik des Sachunterrichts (18011), Vorlesung, 2 SWS, 2 AP SU-1.2: Entwicklung und Probleme der Didaktik des Sachunterrichts
Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.
 16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
Grundlagen der Sportpädagogik
 Grundlagen der Sportpädagogik Vorlesung zum Themenbereich Grundlagen des Schulsports (Modul 1.1 für f r RPO und GHPO) Do 9.30-11 Uhr im Seminarraum des Sportzentrums Sportzentrum der Pädagogischen Hochschule
Grundlagen der Sportpädagogik Vorlesung zum Themenbereich Grundlagen des Schulsports (Modul 1.1 für f r RPO und GHPO) Do 9.30-11 Uhr im Seminarraum des Sportzentrums Sportzentrum der Pädagogischen Hochschule
Das Fach»Soziologie«THEMEN SCHWERPUNKTE - PROFESSUREN D. BISCHUR INTEGRIERTE EINFÜHRUNG WS 2016/17: EINFÜHRUNGSWOCHE - FACH SOZIOLOGIE 1
 Das Fach»Soziologie«THEMEN SCHWERPUNKTE - PROFESSUREN D. BISCHUR INTEGRIERTE EINFÜHRUNG WS 2016/17: EINFÜHRUNGSWOCHE - FACH SOZIOLOGIE 1 Was ist Gegenstand der Soziologie? MENSCHEN? Obwohl es die Soziologie
Das Fach»Soziologie«THEMEN SCHWERPUNKTE - PROFESSUREN D. BISCHUR INTEGRIERTE EINFÜHRUNG WS 2016/17: EINFÜHRUNGSWOCHE - FACH SOZIOLOGIE 1 Was ist Gegenstand der Soziologie? MENSCHEN? Obwohl es die Soziologie
Medienkompetenz Was ist das?
 Medienkompetenz Was ist das? Eine einheitliche Definition des Begriffs der Medienkompetenz gestaltet sich schwierig. Denn Medienkompetenz ist ein sehr umfassender Begriff, für den es dutzende von Definitionen
Medienkompetenz Was ist das? Eine einheitliche Definition des Begriffs der Medienkompetenz gestaltet sich schwierig. Denn Medienkompetenz ist ein sehr umfassender Begriff, für den es dutzende von Definitionen
Interkulturelle Bewegungs- und Sporterziehung
 Interkulturelle Bewegungs- und Sporterziehung Problemstellungen, Grundlagen, Vermittlungsperspektiven von Yoon-Sun Huh 1. Auflage Interkulturelle Bewegungs- und Sporterziehung Huh schnell und portofrei
Interkulturelle Bewegungs- und Sporterziehung Problemstellungen, Grundlagen, Vermittlungsperspektiven von Yoon-Sun Huh 1. Auflage Interkulturelle Bewegungs- und Sporterziehung Huh schnell und portofrei
