Falk Gastro-Kolleg Darm
|
|
|
- Waltraud Berg
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Falk Gastro-Kolleg Darm Divertikelkrankheit Zusammenfassung Kolondivertikel gehören zu den häufigsten gastroenterologischen Befunden. Von einer Divertikelkrankheit spricht man erst, wenn es zu Symptomen kommt. Die deutsche Leit linie zur Divertikelkrankheit schlägt eine neue Klassifikation vor, die sämtliche Manifestationen abbilden kann. Nur etwa 4% der Personen mit Kolondivertikeln entwickeln innerhalb von 10 Jahren eine Divertikulitis. Die akute unkomplizierte Divertikulitis kann unter gewissen Voraussetzungen ambulant behandelt werden, Antibiotika sind nicht immer erforderlich. Es gibt derzeit keine etablierte Therapie zur Remissionserhaltung bei rezidivierender Divertikulitis. Bei der chronischen Divertikelkrankheit wird die Operationsindikation nicht mehr von der Zahl der Schübe abhängig gemacht. Operationsindikationen liegen vor, wenn eine Divertikulitis mit Makroabszess erfolgreich konservativ behandelt wurde oder wenn es zu Komplikationen wie Stenosen oder Fisteln gekommen ist. Prof. Dr. Dr. Manfred Gross Internistische Klinik Dr. Müller Am Isarkanal München Schlüsselwörter Kolondivertikel Divertikelkrankheit Divertikulitis Divertikulose Fragebeantwortung unter Falk Gastro-Kolleg Titelbild: Kolonpräparat mit Divertikel (Quelle: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Stolte, Bayreuth) 1
2 Divertikelkrankheit Epidemiologie Kolondivertikel gehören zu den häufigsten Befunden im Gastrointestinaltrakt. Die Prävalenz steigt mit dem Lebensalter. Für die westlichen Industrienationen werden Prävalenzen um 10 15% für Personen bis zum 50. Lebensjahr berichtet, etwa 30% zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr und rund 50% ab dem 70. Lebensjahr [1]. Es besteht kein relevanter Unterschied in der Prävalenz der Divertikulose zwischen Männern und Frauen. P Die Prävalenz der Divertikulose ist altersabhängig und liegt bei über 50% bei Personen ab dem 70. Lebensjahr. Kolondivertikel sind anatomisch betrachtet Pseudodivertikel, bei der nicht alle Wandschichten in die Divertikelbildung einbezogen sind, sondern bei der es zu einer Hernierung der Mukosa mit Submukosa-Anteilen durch präformierte Schwachstellen der Kolonwand entlang der intramuralen Blutgefäße kommt. In den westlichen Ländern finden sich Kolondivertikel vorwiegend im linksseitigen Kolon, im asiatischen Raum hingegen häufig im proximalen Kolon. Ätiologie und Pathogenese Bei Patienten mit einer Divertikelkrankheit finden sich Zeichen einer enterischen Neuropathie mit strukturellen Veränderungen des Nervensystems und Störungen im Neurotransmittersystem. So sind die intramuralen Ganglien verkleinert und es finden sich weniger Nervenzellen in der Darmwand (oligoneuronale Hypoganglionose). Eine Reihe von Veränderungen in der Expression von Rezeptoren und in der Signaltransduktion sind beschrieben worden. Diese Veränderungen führen wahrscheinlich zu Störungen der intestinalen Motilität und Sensitivität des Kolons. Morphologisch findet sich zudem eine Verdickung der Ring- und Längsmuskulatur des Kolons ( Myochosis coli ). Es ist noch nicht klar, welche dieser strukturellen und funktionellen Veränderungen Ursache und welche Folge der Divertikulose sind. P Die Divertikulose geht mit einer enterischen Neuropathie einher. Ballaststoffmangel, Obstipation und wenig körperliche Aktivität sind keine gesicherten Risikofaktoren für die Entstehung von Divertikeln. Ein Ballaststoffmangel als Ursache der Divertikelentstehung wird in der Literatur oft angegeben, ist jedoch wissenschaftlich nicht gut belegt. Die Hypothese des Ballaststoffmangels geht vorwiegend auf Korrelationen der geografischen Verteilung der Divertikulose mit den Ernährungsgewohnheiten zurück. Mehrere Fallkontrollstudien und Querschnittsstudien fanden jedoch keine Hinweise darauf, dass ein Ballaststoffmangel ein relevanter Risikofaktor für die Ausbildung von Divertikeln ist [2]. Ebenso sind Bewegungsmangel, ein hoher Fett- oder Fleischanteil in der Nahrung, Rauchen, Übergewicht oder Obstipation keine gesicherten Risikofaktoren für die Entstehung von Kolondivertikeln [3]. Lediglich eine ausgeprägte Adipositas scheint mit Kolondivertikeln assoziiert zu sein. Genetische Faktoren haben hingegen eine erhebliche Bedeutung für die Ausbildung von Kolondivertikeln. Das relative Risiko für eineiige Zwillinge beträgt 14,5, wenn der Ko-Zwilling eine Divertikelkrankheit hat, bei zweieiigen Zwillingen hingegen 5,5 [4]. Aufgrund dieser und ähnlicher Befunde wurde berechnet, dass genetische Faktoren zu 40 50% für die Entstehung einer Divertikelkrankheit verantwortlich sind. Risikofaktoren oder -indikatoren für die Entwicklung einer Divertikelkrankheit Das Risiko einer Person mit Kolondivertikeln, Beschwerden und damit eine Divertikelkrankheit zu entwickeln, wird von mehreren Faktoren beeinflusst. In 2 großen Kohortenstudien hatten die Personen mit dem höchsten Ballaststoffanteil in der Nahrung das geringste Risiko für eine Divertikulitis [5, 6]. Der Konsum von Nüssen, Mais, Körnern oder Popcorn führte zu keiner Risikoerhöhung für eine Divertikulitis oder Divertikelblutung. Fallkontrollstudien und große prospektive Kohortenstudien zeigten einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von rotem Fleisch und dem Auftreten einer Divertikel- P Ein niedriger Ballaststoff- und hoher Fleischanteil in der Nahrung gehen mit einem erhöhten Risiko für das Auftreten von Beschwerden (Divertikelkrankheit) bei Patienten mit Kolondivertikeln einher. NSAR, Steroide und Opiate erhöhen das Risiko für Komplikationen. 2
3 krankheit. Rauchen ist ebenfalls ein gesicherter Risikofaktor, Alkoholkonsum hingegen nicht. Intensive und regelmäßige körperliche Aktivität kann das Risiko, dass Personen mit Divertikeln eine Divertikulitis oder Divertikelblutungen erleiden, senken [7]. Der ungünstige Effekt einer Therapie mit nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR) bei Divertikulose ist gut belegt. In einer Reihe von Studien wurde ein bis zu 5-fach erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer schweren symptomatischen Divertikelkrankheit ermittelt, das Risiko für eine Perforation ist um 1,8 3,6-fach erhöht. Die Einnahme von NSAR erhöht zudem das Risiko für die Entwicklung einer Divertikulitis. Sowohl unter NSAR als auch unter Acetylsalicylsäure (ASS) ist das Risiko für eine Divertikelblutung erhöht. Unter Einnahme von Steroiden und in geringerem Maße auch von Opiaten ist das Risiko für eine Divertikelperforation erhöht. Der Einsatz von Kalziumantagonisten hingegen zeigte in Fallkontrollstudien ein reduziertes Risiko für Perforationen. Verlauf Das Risiko für das Auftreten einer Divertikulitis wurde in der Vergangenheit wahrscheinlich deutlich überschätzt. In einer prospektiven Beobachtungsstudie mit mehr als 2000 Personen, bei denen im Rahmen einer Koloskopie Divertikel festgestellt wurden, erkrankten während einer 11-jährigen Beobachtungszeit nur 4,3% an einer klinisch diagnostizierten akuten Divertikulitis (6/1000 Personenjahre). Nur bei 1% der Patienten (1,5/1000 Personenjahre) wurde eine mittels Computertomografie (CT) oder Operation gesicherte Divertikulitis diagnostiziert [8]. Mit zunehmendem Lebensalter wurde die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person eine Divertikulitis entwickelt, geringer: Pro Dekade des Alters zum Zeitpunkt der Diagnose ging das Risiko um 24% zurück. 2 prospektive Kohortenstudien aus den USA und England mit Beobachtungszeiträumen von 18 Jahren bzw. knapp 12 Jahren sprechen ebenfalls für eine Inzidenz um 1 2% [6, 9]. P Innerhalb von 10 Jahren liegt das Risiko für Personen mit Kolondivertikeln, nach klinischen Kriterien eine akute Divertikulitis zu entwickeln, bei etwa 4%. Wenn es zu einer akuten Divertikulitis kommt, verläuft diese in etwa 75% der Fälle ohne Komplikationen. Diese Patienten mit unkomplizierter Divertikulitis können in mindestens 90% der Fälle erfolgreich konservativ behandelt werden. Nur etwa ein Drittel der Patienten erleidet ein Rezidiv, zu 90% in den ersten 5 Jahren. Neue Untersuchungen [10] geben das Rezidivrisiko noch niedriger an (17% Rezidive innerhalb von mehr als 10 Jahren). Bei jüngeren Patienten scheint das Rezidivrisiko etwas erhöht zu sein [10]. Stadieneinteilung In der Literatur ist die Klassifikation von Hinchey in der Modifikation von Wasvary [11] zwar gängig, sie klassifiziert jedoch primär die komplizierte Divertikulitis mit einer Stratifizierung für das operative Vorgehen. Sie reicht vom lokalisierten Abszess (Hinchey I) über den ausgedehnten mesenterialen Abszess (Hinchey II) und die freie Perforation (Hinchey III) bis zur Peritonitis (Hinchey IV). Weit verbreitet ist die Klassifikation von Hansen und Stock [12]. Sie erfasst sowohl akute unkomplizierte als auch chronische Verläufe. Ein großer Nachteil ist die Unschärfe der Abgrenzung der akuten Divertikulitis ohne Umgebungsreaktion (Stadium I) von der akuten Divertikulitis mit Peridivertikulitis (Stadium IIa). Bei der Sonografie der akuten unkomplizierten Divertikulitis wird jedoch regelhaft eine echoreiche Umgebungsreaktion gesehen, die nach Hansen und Stock zur Klassifikation als Stadium IIa und damit als Divertikulitis mit Komplikationen zu werten wäre, was jedoch der klinischen Situation meist nicht gerecht wird. Zudem differenziert die Klassifikation nicht die perforierten Verläufe (Mikroperforation, Makroperforation, Abszessgröße). Die deutsche Leitlinie zur Divertikelkrankheit [13] schlägt deshalb eine neue Klassifikation vor (Tab. 1). Die asymptomatische Divertikulose hat keinen Krankheitswert (Typ 0). Von einer Divertikelkrankheit des Kolons spricht man nur dann, wenn eine Divertikulose des Kolons zu Symptomen und/oder Komplikationen führt. 3
4 Klassifikation der Divertikelkrankheit entsprechend der Leitlinienkomission der DGVS/DGAV 2014 ( Typ 0 Asymptomatische Divertikulose Zufallsbefund; asymptomatisch Keine Krankheit Typ 1 Typ 1a Typ 1b Akute unkomplizierte Divertikelkrankheit/Divertikulitis Divertikulitis/Divertikelkrankheit ohne Umgebungsreaktion Divertikulitis mit phlegmonöser Umgebungsreaktion Auf die Divertikel beziehbare Symptome Entzündungszeichen (Labor): optional Typische Schnittbildgebung Entzündungszeichen (Labor): obligat Schnittbildgebung: phlegmonöse Divertikulitis Tab. 1 P Die deutsche Leitlinie zur Divertikelkrankheit schlägt eine neue Klassifikation vor, die eine Erfassung von asymptomatischen Personen mit Divertikeln, von akuten unkomplizierten und komplizierten Divertikulitiden, chronischen Verläufen und Divertikelblutungen ermöglicht. Typ 2 Akute komplizierte Divertikulitis wie 1b, zusätzlich: Typ 2a Mikroabszess Gedeckte Perforation, kleiner Abszess ( 1 cm); minimale parakolische Luft Typ 2b Makroabszess Para- oder mesokolischer Abszess (> 1 cm) Typ 2c Freie Perforation Freie Perforation, freie Luft/Flüssigkeit Generalisierte Peritonitis Typ 2c1 Typ 2c2 Typ 3 Eitrige Peritonitis Fäkale Peritonitis Chronische Divertikelkrankheit Rezidivierende oder anhaltende symptomatische Divertikelkrankheit Typ 3a Typ 3b Typ 3c Symptomatische unkomplizierte Divertikelkrankheit (SUDD) Rezidivierende Divertikulitis ohne Komplikationen Rezidivierende Divertikulitis mit Komplikationen Typische Klinik Entzündungszeichen (Labor): optional Entzündungszeichen (Labor): vorhanden Typische Schnittbildgebung Nachweis von Stenosen, Fisteln, Konglomerat Typ 4 Divertikelblutung Nachweis der Blutungsquelle Die akute unkomplizierte Divertikelkrankheit (Typ 1) kann in 2 Varianten auftreten. Beim Typ 1a beklagt der Patient Symptome, meist Bauchschmerzen, die auf Divertikel bezogen werden. Die klinische Untersuchung zeigt meist einen lokalisierten Druckschmerz, die Entzündungszeichen im Blut können erhöht sein und die Bildgebung (Sonografie) zeigt Divertikel. Beim Typ 1b besteht eine Divertikulitis mit erhöhten Entzündungszeichen, häufig ist der Patient febril und die Bildgebung zeigt eine phlegmonöse Umgebungsreaktion (s. Diagnostik). Beim Auftreten von Komplikationen im Rahmen einer akuten Divertikulitis spricht man vom Typ 2: Typ 2a mit gedeckter Perforation mit minimaler parakolischer Luft oder kleinen Abszessen bis 1 cm, Typ 2b mit Makroabszess ab 1 cm, Typ 2c mit freier Perforation mit freier Luft und generalisierter Peritonitis. Bei chronischen Krankheitsverläufen wird ein Typ 3 diagnostiziert: Typ 3a ist die symptomatische chronische unkomplizierte Divertikelkrankheit (im angloamerikanischen Sprachraum als SUDD bezeichnet: symptomatic uncomplicated diverticular disease). Eine andere chronische Verlaufsform liegt bei rezidivierenden Divertikulitiden vor, die jeweils ohne Komplikationen verlaufen (Typ 3b). Im Schub finden sich die gleichen Befunde wie bei einer akuten Divertikulitis. Rezidivierende Divertikulitiden können zu Komplikationen wie Stenosen oder Fisteln führen (Typ 3c). 4
5 Klinik und Diagnostik Akute Divertikelkrankheit Bei der akuten Divertikelkrankheit klagt der Patient über Bauchschmerzen, die klinische Untersuchung zeigt typischerweise einen lokalisierten Druckschmerz. Aufgrund der klinischen Symptomatik wird die typische Divertikulitis auch als linksseitige Appendizitis bezeichnet. Übelkeit, Obstipation, aber auch eine Diarrhö können auftreten. Schmerzen im Genitalbereich können auf eine Irritation des Plexus sacralis hinweisen, eine Pollakisurie oder Dysurie auf ein Übergreifen des Entzündungsprozesses auf die Harnblase. P Bei der akuten Divertikelkrankheit ist neben Anamnese, körperlicher Untersuchung und Laborwerten die Sonografie unverzichtbarer Bestandteil der Diagnostik. Gemäß der Leitlinie [13] sollte die Untersuchung eines Patienten mit Verdacht auf eine Divertikulitis die Palpation, Perkussion und Auskultation des Abdomens, eine rektale Untersuchung und die Temperaturmessung umfassen. Zudem sollte eine Laboruntersuchung mit mindestens Bestimmung von Leukozyten und C-reaktivem Protein (CRP) erfolgen, zusätzlich wird eine Urinanalyse empfohlen. Beim Typ 1a können die Entzündungswerte erhöht sein, beim Typ 2a sind Entzündungszeichen obligat. CRP ist der am besten validierte Laborparameter für die Diagnosestellung und die Verlaufskontrolle. Die Diagnose wird gestützt durch eine Bildgebung, in der Regel durch die Sonografie. Sonografisch zeigt sich an der Stelle der höchsten Druckschmerzhaftigkeit in fast allen Fällen das entzündete Divertikel mit der Umgebungsreaktion. Die Darmwand ist im Bereich des entzündeten Divertikels meist echoarm verdickt. Das Divertikel selbst ist oft als echoarme Struktur mit echoreichen Strukturen im Zentrum (Luft) sichtbar, gelegentlich sieht man den Fäkolithen mit Schallschatten. Die entzündliche umgebende Fettgewebsreaktion zeigt sich als echoreiche Netzkappe um das Divertikel herum. Abb. 1 Divertikel Sigma Koprolith Netzkappe Ultraschallbefund einer akuten Divertikulitis mit Nachweis des Koprolithen (Quelle: PD Dr. K. Seitz, Sigmaringen) Die Sonografie eignet sich hervorragend zur Verlaufskontrolle. Die echoreiche Netzkappe bildet sich bei erfolgreicher Therapie sehr rasch, meist binnen weniger Tage, zurück. Komplikationen wie ein Abszess lassen sich ebenfalls mit hoher Sensitivität nachweisen. Die Sonografie bei Divertikulitis erfordert keine jahrelange sonografische Erfahrung. In einer Studie mit 11 chirurgischen Ärzten, die nach einem Grundkurs eine mindestens 3-monatige Sonografiepraxis hatten, wurde die hohe Genauigkeit der Methode (Sensitivität 84%, Spezifität 93%, positiver Vorhersagewert 93%, negativer Vorhersagewert 84%, Treffsicherheit 88%) bestätigt [14]. 5
6 Eine CT ist dann notwendig, wenn die sonografisch erhobenen Befunde nicht zu der klinischen Diagnose passen oder der Verdacht auf eine Komplikation wie Abszess oder Fistel besteht und die Sonografie diese Befunde nicht abbilden kann. Der Sonografie überlegen ist die CT bei Distanzabszessen weit mesenterial oder bei Lokalisation im unteren Sigma, das häufig durch davorliegende Darmschlingen verdeckt ist. Abb. 2 Ausgeprägte Divertikulitis in Sigma und Colon descendens mit umgebender Fettgewebsinfiltration und zirkulärer Wandverdickung, koronare Rekonstruktion (Quelle: Prof. Dr. S. Feuerbach, Regensburg) Nach einer konservativ behandelten Divertikulitis sollte die Indikation zur Koloskopie großzügig gestellt werden, wenn nicht vor kurzer Zeit eine Koloskopie durchgeführt wurde. In der Regel sollte man 4 6 Wochen warten, damit die akute Entzündung sicher ausgeheilt ist. Obwohl die Divertikulitis meist eine Erkrankung des älteren Menschen ist, muss sie auch bei Personen vor dem 40. Lebensjahr bei Bauchschmerzen differenzialdiagnostisch berücksichtigt werden. Zudem muss auch bei rechtsseitigen oder suprapubischen Schmerzen an eine Divertikulitis gedacht werden (rechtsseitige Schmerzlokalisation nicht nur bei rechtsseitiger Divertikulitis, sondern auch bei nach rechts verlaufender Sigmaschlinge). Eine Koloskopie ist in dieser Phase nicht notwendig und wahrscheinlich mit einem erhöhten Perforationsrisiko behaftet. Wird eine Koloskopie in der Akutphase durchgeführt (z. B. bei diagnostischer Unklarheit), sollte zuvor mittels CT eine gedeckte Perforation oder Abszedierung ausgeschlossen werden. Der Kolonkontrasteinlauf sollte bei Verdacht auf Divertikulitis nicht mehr eingesetzt werden. Der Verdacht auf eine Komplikation einer akuten Divertikulitis (Abszess, Perforation, Peritonitis) ergibt sich aus dem Beschwerdebild (Verschlechterung des Zustands des Patienten trotz Antibiose, Zunahme der Entzündungszeichen, Entwicklung eines peritonealen Reizzustands). Die weiterführende Diagnostik besteht in der Bildgebung (initial Sonografie, CT-Abdomen ohne rektale Füllung bei nicht eindeutigem sonografischem Befund), die Kernspinuntersuchung ist meist entbehrlich. Chronische Divertikelkrankheit Patienten mit chronischer symptomatischer unkomplizierter Divertikelkrankheit (Typ 3a) leiden unter chronischen Beschwerden mit rezidivierenden oder persistierenden Bauchschmerzen, häufig auch Blähungen, die klinisch nicht von einem Reizdarm zu differenzieren sind. Die Entzündungszeichen im Labor können zeitweise erhöht sein. Die P Bei der chronischen Divertikelkrankheit müssen mittels Koloskopie Differenzialdiagnosen wie Entzündungen oder Karzinome ausgeschlossen werden. 6
7 Diagnostik besteht hier in erster Linie in der Koloskopie, zum einem zum Nachweis der Divertikulose (was auch sonografisch möglich wäre), aber insbesondere zum Ausschluss von Differenzialdiagnosen (Tumor, Entzündung, Stenose). Abb. 3 Reizlose Divertikelöffnung Koloskopie mit Nachweis von Sigmadivertikeln (Quelle: Autor) Bei Patienten mit rezidivierender Divertikulitis ohne Komplikationen (Typ 3b) entspricht die Diagnostik im Schub der bei der akuten Divertikulitis. Bei chronischen Verläufen mit Komplikationen ergibt sich die Diagnostik aus der Art der Komplikationen: Bei Hinweisen auf eine narbige Stenose stehen die Bildgebung (Sonografie oder CT-Abdomen) und die Koloskopie (zur Entnahme von Biopsien zur Abgrenzung gegen floride Entzündungen oder Tumoren) im Vordergrund, bei Fisteln die Bildgebung (bei dieser Fragestellung kann das Kernspin weiterhelfen). Bei Fisteln zur Blase oder Vagina kann der Mohnsamentest helfen: Nachweis von Mohnsamen im Urin oder in einem Tampon bei oraler Einnahme von Mohnsamen. Divertikelblutung Ursache einer Divertikelblutung ist eine Ruptur der Vasa recta im Divertikelhals, die meist nicht im Zusammenhang mit einer akuten Divertikulitis eintritt. Die Blutung ist in der Regel heftig, aber in den meisten Fällen selbstlimitierend. Bei der Divertikelblutung steht die möglichst rasch durchgeführte Koloskopie mit den Möglichkeiten der endoskopischen Blutstillung im Vordergrund. Notfallmäßig ist eine Rektoskopie sinnvoll, um eine Hämorrhoidalblutung auszuschließen. Die Koloskopie erfolgt sinnvollerweise erst nach antegrader Koloskopievorbereitung. Nur bei sehr heftigen Blutungen kommt eine CT-Angiografie in Betracht. Das Rezidivblutungsrisiko nach einer Divertikelblutung liegt bei etwa 10% nach 1 Jahr und 30% nach 5 Jahren. Eine Therapie mit Antikoagulanzien oder Plättchenhemmern erhöht das Risiko für Rezidivblutungen nicht. Eine Divertikelblutung ist somit kein Grund, eine indizierte Antikoagulation oder Thrombozytenaggregationshemmung zu beenden. P Eine Divertikelblutung hat ein Rezidivblutungsrisiko von etwa 30% in 5 Jahren und ist kein Grund, eine indizierte Antikoagulation oder Thrombozytenaggregationshemmung dauerhaft abzusetzen. 7
8 Abb. 4 spritzende Divertikelblutung Injektionsnadel (Blutstillung durch Unterspritzen mit verdünnter Suprarenin-Lösung Akute Divertikelblutung: endoskopische Blutstillung (Quelle: Autor) Therapie Konservative Therapie Prävention und Prophylaxe Es gibt keine Therapiestudien, die belegen, dass bei Patienten mit asymptomatischen Kolondivertikeln eine Primärprophylaxe zur Verhinderung von Symptomen oder Divertikulitiden möglich ist. Allerdings können aufgrund der zuvor dargestellten epidemiologischen Zusammenhänge eine Gewichtsnormalisierung bzw. der Erhalt des Normalgewichts, eine ballaststoffreiche Kost sowie regelmäßige körperliche Aktivität empfohlen werden, zumal diese Lebensstilmaßnahmen auch aus kardiovaskulären Überlegungen heraus sinnvoll sind. Die Empfehlung, Nüsse, Körner, Mais oder Popkorn zu meiden, da unverdaute Rückstände in den Divertikeln retiniert und dies zu einer Divertikulitis führen könnte, sind wissenschaftlich nicht belegt [9]. Therapie der akuten unkomplizierten Divertikulitis Es ist gängige Praxis, bei einer akuten unkomplizierten Divertikulitis eine antibiotische Therapie durchzuführen, wobei häufig Gyrasehemmer (Ciprofloxacin) sowie Metronidazol zum Einsatz kommen. Allerdings ist die antibiotische Therapie der akuten Divertikulitis nicht evidenzbasiert. 3 randomisierte kontrollierte Studien sowie retrospektive Fallkontrollstudien fanden keine Unterschiede in der Häufigkeit von Komplikationen oder in der Rezidivrate bei Patienten mit unkomplizierter leichtgradiger Divertikulitis in Abhängigkeit davon, ob Antibiotika eingesetzt worden waren oder nicht [15]. Dementsprechend findet sich in der deutschen Leitlinie die Aussage, dass bei akuter unkomplizierter linksseitiger Divertikulitis ohne Risikoindikatoren für einen komplizierten Verlauf unter engmaschiger klinischer Kontrolle auf eine Antibiotikatherapie verzichtet werden kann [13]. P Die akute unkomplizierte Divertikulitis muss nicht antibiotisch behandelt werden. Unter gewissen Voraussetzungen ist eine ambulante Therapie möglich. Das Problem besteht in der Auswahl der Patienten: Nur bei unkompliziertem Verlauf kann auf eine Antibiotikagabe verzichtet werden. Allerdings ist der Verlauf nicht von vorneherein absehbar und es können sich im Verlauf Komplikationen wie Abszesse herausbilden. Vor diesem Hintergrund wird im Zweifelsfall die Entscheidung zuguns- 8
9 ten einer antibiotischen Therapie fallen. Bei Risikoindikatoren für einen komplizierten Verlauf (arterielle Hypertonie, chronische Nierenerkrankung, Immunsuppression sowie eine allergische Disposition) sollten auf jeden Fall bei der akuten unkomplizierten Divertikulitis Antibiotika gegeben werden [13]. Die akute Divertikulitis muss nicht grundsätzlich stationär behandelt werden. Bei geringer klinischer Symptomatik ohne Fieber, ohne Stuhlverhalt und ohne Abwehrspannung kann bei nur gering erhöhtem CRP und fehlender Leukozytose bei sichergestellter ambulanter Überwachung und Compliance des Patienten eine orale Therapie durchgeführt werden [13, 16]. Voraussetzungen sind eine ausreichende orale Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme und die Möglichkeit, den Patienten engmaschig klinisch kontrollieren zu können. Bei Hinweisen auf eine Verschlechterung ist die umgehende stationäre Einweisung dringend anzuraten. Mesalazin (5-ASA) wurde in einer doppelblinden Therapiestudie bei Patienten mit akuten Beschwerden einer unkomplizierten Divertikelkrankheit eingesetzt [17], wobei es sich nach der neuen Klassifikation um eine heterogene Patientengruppe handelte (z. T. Typ 1a mit Entzündungszeichen, z. T. chronische Divertikelkrankheit Typ 3). Der primäre Endpunkt war die Intensität der Schmerzen im Unterbauch während der ersten 4 Wochen der Therapie gemäß Patiententagebuch. Die Mesalazingabe (3 x 1 g als Granulat über 6 Wochen) zeigt nur in der Per-Protocol- Analyse, aber nicht in der Intention-to-Treat-Analyse, eine signifikante Abnahme des Symptomscores, eine signifikant kürzere Zeit bis zur Schmerzfreiheit sowie einen höheren Anteil schmerzfreier Personen. Allerdings lag der Anteil der Patienten, die zusätzlich Analgetika oder Spasmolytika einnehmen mussten, in der Placebogruppe rund 50% höher als in der Mesalazingruppe. Mesalazin ist in Deutschland in dieser Indikation nicht zugelassen. Therapie der akuten komplizierten Divertikulitis Von einer komplizierten Divertikulitis (Typ 2) spricht man beim Vorliegen eines Mikroabszesses, eines Makroabszesses oder einer Perforation. Diese Patienten müssen stationär behandelt werden, eine antibiotische Therapie ist erforderlich. Die Frage der oralen Nahrungsaufnahme kann vom klinischen Schweregrad abhängig gemacht werden, eine Nulldiät oder Ballaststoff-freie Kost ist nicht generell notwendig. Eine parenterale Flüssigkeitssubstitution ist nur bei unzureichender Trinkmenge notwendig. Die Wahl des Antibiotikums ist nicht durch Studien belegt. Ebenso gibt es für die Frage einer oralen oder intravenösen Gabe keine wissenschaftlichen Evidenzen. Gängige Antibiotika sind Cefuroxim oder Ciprofloxacin in Kombination mit Metronidazol oder Ampicillin/Sulbactam, Piperacillin/Tazobactam sowie Moxifloxacin. Eine Therapiedauer von 5 7 Tagen ist meist ausreichend. Bei Abszessen ist, wenn technisch möglich, eine perkutane Drainage sinnvoll. Bei unzureichendem oder fehlendem Ansprechen auf eine konservative Therapie inkl. Antibiose ist bei der komplizierten Divertikulitis die Operation erforderlich. Notfallmäßig muss bei freier Perforation und Peritonitis operiert werden. P Patienten mit einer komplizierten akuten Divertikulitis sollten stationär behandelt werden, bei Abszessen ist, wenn möglich, eine perkutane Drainage anzustreben. 9
10 Abb. 5 Resektionspräparat bei akuter Divertikulitis mit Makroabszess (Typ 2b) (Quelle: Prof. Dr. A. Tannapfel, Bochum) Therapie der chronischen Divertikelkrankheit Zu den chronischen Formen der Divertikelkrankheit zählen die symptomatische unkomplizierte Divertikelkrankheit (Typ 3a) sowie die unkomplizierte rezidivierende Divertikulitis (Typ 3b). In den meisten Therapiestudien zur chronischen Divertikelkrankheit wurden diese beiden Formen nicht ausreichend differenziert und es gibt wenig prospektive Daten. Aufgrund dieser eingeschränkten Datenlage gibt es keine generelle Empfehlung zur konservativen Therapie der chronischen symptomatischen Divertikelkrankheit. Die Empfehlungen zum Lebensstil und zur Ernährung, wie sie zuvor zur Primärprophylaxe formuliert wurden, können ausgesprochen werden, ohne dass jedoch ein sicherer Therapieeffekt erwartet werden darf. P Bei der chronischen Divertikelkrankheit sind die Effekte einer Diät oder einer Lebensstilmodifikation nicht gut untersucht. Bei rezidivierender Divertikulitis ist eine Rezidivprophylaxe mit Mesalazin nicht möglich. Bei der Darstellung der Therapieoptionen bei Typ 1 wurde die placebokontrollierte Studie mit Mesalazingabe (3 x 1 g als Granulat über 6 Wochen) bei Patienten mit akuten Beschwerden einer Divertikelkrankheit erwähnt [17]. In dieser Studie wurden sowohl Patienten mit akuter unkomplizierter Divertikulitis als auch mit symptomatischer chronischer Divertikelkrankheit behandelt eine Subgruppenanalyse für beide Gruppen wurde nicht durchgeführt. Da die Studie in der Per-Protocol-Analyse (allerdings nicht in der Intention-to-Treat-Analyse) eine signifikante Symptomverbesserung sowie einen höheren Anteil schmerzfreier Personen zeigte, wird in der Leitlinie die Aussage getroffen, dass die symptomatische unkomplizierte Divertikelkrankheit mit Mesalazin (oral) behandelt werden kann. Allerdings ist Mesalazin in Deutschland in dieser Indikation nicht zugelassen. In 2 großen randomisierten Studien wurde versucht, durch eine Mesalazintherapie nach einer Divertikulitis das Auftreten von Rezidiven zu verhindern. In beiden Studien war kein remissionserhaltender Effekt von Mesalazin nachweisbar, die Rate an Rezidiven wurde nicht gesenkt. Deshalb sollte keine Therapie mit Mesalazin zur Rezidivprophylaxe durchgeführt werden [18, 19]. Die Wirksamkeit einer Rifaximintherapie bei Patienten mit chronischer Divertikelkrankheit wurde in 4 randomisierten Studien an 1660 Patienten untersucht [20]. Es wurde in allen Studien eine Intervalltherapie mit Rifaximin 2 x 400 mg an 7 Tagen pro Monat durchgeführt, alle Patienten erhielten zusätzlich Ballaststoffe. Die Studien liefen über 12 bzw. 24 Monate. In einer Meta-Analyse über diese Studien wurde eine signifikante Besserung der Symptome berichtet (signifikant mehr vollständig beschwerdefreie Patienten am Ende der Studie). In den Rifaximinstudienarmen erlitten signifikant weniger Patienten eine akute Divertikulitis allerdings war in der einzigen placebokon- 10
11 trollierten Studie dieser Unterschied nicht signifikant. Rifaximin ist in Deutschland in dieser Indikation nicht zugelassen. Mehrere kleine randomisierte kontrollierte Studien und einige unkontrollierte Therapiestudien untersuchten, ob eine ballaststoffreiche Ernährung einen positiven Effekt auf die Beschwerden bei symptomatischer unkomplizierter Divertikelkrankheit hat. Die überwiegende Mehrzahl der Studien fand positive Effekte auf die Symptome oder Surrogatmarker wie das Stuhlgewicht, die Qualität der meisten Studien ist jedoch gering. Indikation zur Operation Die früher ausgesprochene Empfehlung, spätestens nach dem zweiten Schub einer Divertikulitis die Operation zu empfehlen, kann heute nicht mehr aufrechterhalten werden. Für die Frage einer Operationsindikation ist die Zahl der Divertikulitisschübe kein Kriterium mehr. Eine erfolgreich behandelte akute unkomplizierte Divertikulitis ist keine generelle Operationsindikation. Finden sich jedoch Risikoindikatoren für Rezidive oder Komplikationen (z. B. Immunsuppression, chronische Glukokortikoidtherapie), kann eine Operation diskutiert werden. Nach erfolgreicher konservativer Therapie einer komplizierten Divertikulitis Typ 2b (Makroabszess) sollte wegen des hohen Rezidivrisikos die Operation im entzündungsfreien Intervall durchgeführt werden. P Die Zahl der Schübe ist kein Kriterium mehr für die Empfehlung einer Operation. Von diesen Überlegungen ausgenommen sind selbstverständlich die Operationsindikationen bei Patienten, die auf eine adäquate konservative Therapie der komplizierten Divertikulitis (Typ 2a/b) nicht ausreichend ansprechen. Diese sollten mit aufgeschobener Dringlichkeit operiert werden. Ebenso gibt es klare Indikationen für Notfalloperationen (freie Perforation oder Peritonitis). Abszesse (retroperitoneal oder parakolisch) können sonografisch oder CT-gesteuert drainiert werden. Wenn sich der Befund danach innerhalb von 72 Stunden nicht deutlich bessert oder die Drainage des Abszesses nicht gelingt, sollten die Patienten rasch operiert werden. Bei kleinen Abszessen ist die alleinige konservative Therapie unter täglicher Kontrolle der Entzündungswerte und der klinischen Symptomatik möglich. Unter den chronischen komplizierten Verlaufsformen der Divertikulitis stellen Fisteln und Stenosen eindeutige Operationsindikationen dar. In den seltenen Fällen einer anhaltenden und endoskopisch nicht beherrschbaren Divertikelblutung ist eine dringliche Operation indiziert. Bei rezidivierender Divertikelblutung ist ebenfalls die Operation nach dem ersten Rezidiv sinnvoll. 11
12 Zu empfehlende Literatur Literatur 1 Delvaux M. Diverticular disease of the colon in Europe: epidemiology, impact on citizen health and prevention. Aliment Pharmacol Ther. 2003;18 Suppl 3: Peery AF, Sandler RS, Ahnen DJ, Galanko JA, Holm AN, Shaukat A, et al. Constipation and a low-fiber diet are not associated with diverticulosis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013;11(12): Peery AF, Barrett PR, Park D, Rogers AJ, Galanko JA, Martin CF, et al. A high-fiber diet does not protect against asymptomatic diverticulosis. Gastroenterology. 2012;142(2): Strate LL, Erichsen R, Baron JA, Mortensen J, Pedersen JK, Riis AH, et al. Heritability and familial aggregation of diverticular disease: a population-based study of twins and siblings. Gastroenterology. 2013;144(4): Aldoori WH, Giovannucci EL, Rimm EB, Wing AL, Trichopoulos DV, Willett WC. A prospective study of diet and the risk of symptomatic diverticular disease in men. Am J Clin Nutr. 1994;60(5): Crowe FL, Appleby PN, Allen NE, Key TJ. Diet and risk of diverticular disease in Oxford cohort of European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): prospective study of British vegetarians and non-vegetarians. BMJ. 2011;343:d Strate LL, Liu YL, Aldoori WH, Giovannucci EL. Physical activity decreases diverticular complications. Am J Gastroenterol. 2009;104(5): Shahedi K, Fuller G, Bolus R, Cohen E, Vu M, Shah R, et al. Long-term risk of acute diverticulitis among patients with incidental diverticulosis found during colonoscopy. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013;11(12): Strate LL, Liu YL, Syngal S, Aldoori WH, Giovannucci EL. Nut, corn, and popcorn consumption and the incidence of diverticular disease. JAMA. 2008;300(8): Binda GA, Arezzo A, Serventi A, Bonelli L; Italian Study Group on Complicated Diverticulosis (GISDIC), et al. Multicentre observational study of the natural history of left-sided acute diverticulitis. Br J Surg. 2012;99(2): Hinchey EJ, Schaal PG, Richards GK. Treatment of perforated diverticular disease of the colon. Adv Surg. 1978;12: Hansen O, Stock W. Prophylaktische Operation bei der Divertikelkrankheit des Kolons Stufenkonzept durch exakte Stadieneinteilung. Langenbecks Arch Surg 1999; Suppl II: Leifeld L, Germer CT, Böhm S, Dumoulin FL, Häuser W, Kreis M, et al. S2k Leitlinie Divertikelkrankheit/Diverticulitis. Z Gastroenterol. 2014;52(7):
13 14 Zielke A, Hasse C, Nies C, Kisker O, Voss M, Sitter H, et al. Prospective evaluation of ultrasonography in acute colonic diverticulitis. Br J Surg. 1997;84(3): Literatur 15 Shabanzadeh DM, Wille-Jørgensen P. Antibiotics for uncomplicated diverticulitis Cochrane Database Syst Rev. 2012;11:CD Biondo S, Golda T, Kreisler E, Espin E, Vallribera F, Oteiza F, et al. Outpatient versus hospitalization management for uncomplicated diverticulitis: a prospective, multicenter randomized clinical trial (DIVER Trial). Ann Surg. 2014;259(1): Kruis W, Meier E, Schumacher M, Mickisch O, Greinwald R, Mueller R; German SAG-20 Study Group. Randomised clinical trial: mesalazine (Salofalk granules) for uncomplicated diverticular disease of the colon a placebo-controlled study. Aliment Pharmacol Ther. 2013;37(7): Kruis W, Kardalinos V, Curtin A, Dorofeyev AE, Zakko SF, Wölkner J, et al. Daily Mesalamine Fails to Prevent Recurrent Diverticulitis in a Large Placebo Controlled Multicenter Trial. Gastroenterology. 2014;146(5):S Raskin JB, Kamm MA, Jamal MM, Márquez J, Melzer E, Schoen RE, et al. Mesalamine did not prevent recurrent diverticulitis in phase 3 controlled trials. Gastroenterology. 2014;147(4): Bianchi M, Festa V, Moretti A, Ciaco A, Mangone M, Tornatore V, et al. Meta-analysis: long-term therapy with rifaximin in the management of uncomplicated diverticular disease. Aliment Pharmacol Ther. 2011;33(8):
14 Fragen zur Divertikelkrankheit Frage 1: Wie hoch ist die altersabhängige Prävalenz an Kolondivertikeln? Etwa 2% im Alter zwischen 20 und 40 Jahren Etwa 25% im Alter zwischen 20 und 40 Jahren Etwa 25% ab dem 70. Lebensjahr Etwa 50% ab dem 70. Lebensjahr Etwa 80% ab dem 70. Lebensjahr Frage 2: Was sind gesicherte Risikofaktoren für die Entstehung von Kolondivertikeln? Alkoholkonsum Bewegungsmangel Obstipation Fleischreiche Kost Genetische Faktoren Frage 3: Was ist kein Risikofaktor für die Entwicklung von Beschwerden (Divertikelkrankheit) bei Personen mit Kolondivertikeln? Ballaststoffarme Kost Fleischreiche Kost Alkoholkonsum Bewegungsmangel Die Therapie mit nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR) Falk Gastro-Kolleg Darm Bitte beachten Sie: Bei der Beantwortung der Fragen ist immer nur 1 Antwort möglich. Die Beantwortung der Fragen und Erlangung des Fortbildungszertifikats ist nur online möglich. Bitte gehen Sie dazu auf unsere Homepage Unter dem Menüpunkt Falk Gastro Kolleg können Sie sich anmelden und die Fragen beantworten. Bitte diesen Fragebogen nicht per Post oder Fax schicken! Frage 4: Wie hoch ist das Risiko, nach einer unkomplizierten Divertikulitis innerhalb von 10 Jahren ein Rezidiv zu erleiden? Etwa 5 10% Etwa 15 35% Etwa 35 50% Etwa 50 60% Über 70% Frage 5: Wie hoch ist das Risiko für eine Rezidivblutung innerhalb von 5 Jahren nach einer Divertikelblutung, wenn der Patient nicht operiert wird? 5% 10% 30% 50% 75% Wichtig: Fragebeantwortung unter Falk Gastro-Kolleg 14
15 Frage 6: Welche diagnostische Maßnahme wird nicht routinemäßig bei Verdacht auf eine akute Divertikulitis empfohlen? Temperaturmessung CRP-Bestimmung Urinanalyse Rektale Untersuchung CT-Abdomen Falk Gastro-Kolleg Darm Frage 7: Welches bildgebende Verfahren ist die Methode der Wahl bei Patienten mit Verdacht auf eine akute Divertikulitis? Koloskopie Sonografie-Abdomen CT-Abdomen MRT-Abdomen Kolonkontrasteinlauf Frage 8: Welche Antwort ist richtig? Die Behandlung der akuten unkomplizierten Divertikulitis sollte grundsätzlich stationär erfolgen sollte grundsätzlich die Gabe von Antibiotika beinhalten erfordert eine konsequente Schmerztherapie mit Opiaten beinhaltet eine 24-stündige Nahrungskarenz kann unter Umständen ambulant durchgeführt werden Frage 9: Welche Aussage zur Remissionserhaltung bzw. Rezidivprophylaxe nach akuter Divertikulitis ist richtig? Derzeit existiert keine etablierte evidenzbasierte Therapie zur Verhinderung von Rezidiven Die Gabe von Mesalazin (5-ASA) ist hocheffektiv Rifaximin senkt in placebokontrollierten Studien die Rezidivrate Eine ballaststoffreiche Diät kann Rezidive effektiv verhindern Die Vermeidung einer Obstipation verhindert effektiv Rezidive Frage 10: Wann liegt bei der Divertikelkrankheit eine klare Operationsindikation vor? Nach dem ersten Rezidiv einer akuten Divertikulitis Nach dem zweiten Rezidiv einer akuten Divertikulitis Nach dem ersten Rezidiv einer akuten Divertikulitis, wenn der Patient jünger als 40 Jahre ist Nach erfolgreicher konservativer Therapie einer Divertikulitis mit Makroabszess Nach einer ersten Divertikelblutung 15
Therapie der rezidivierenden Divertikulitis
 Therapie der rezidivierenden Divertikulitis ao Univ.Prof. Dr. Christoph Högenauer Theodor Escherich Labor für Mikrobiomforschung Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie Universitätsklinik
Therapie der rezidivierenden Divertikulitis ao Univ.Prof. Dr. Christoph Högenauer Theodor Escherich Labor für Mikrobiomforschung Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie Universitätsklinik
Divertikulitis und Alter Ein Mythos neu aufgerollt. Prof. Ch. Kettelhack Allgemein- und Viszeralchirurgie Universitätsspital Basel
 Divertikulitis und Alter Ein Mythos neu aufgerollt Prof. Ch. Kettelhack Allgemein- und Viszeralchirurgie Universitätsspital Basel Divertikulitis und Alter Mythen? Divertikulitis und Alter Mythos? Fakten?
Divertikulitis und Alter Ein Mythos neu aufgerollt Prof. Ch. Kettelhack Allgemein- und Viszeralchirurgie Universitätsspital Basel Divertikulitis und Alter Mythen? Divertikulitis und Alter Mythos? Fakten?
Moderne Therapie der Sigmadivertikulitis
 KontaktKontakt-Tel.: 030 3264 1562 Stichwort: Divertikulitis Moderne Therapie der Sigmadivertikulitis T. Rost Vortrag für Interessierte u. Patienten Krummdarm = Colon Sigmoideum Aufsteigender Darm Querdarm
KontaktKontakt-Tel.: 030 3264 1562 Stichwort: Divertikulitis Moderne Therapie der Sigmadivertikulitis T. Rost Vortrag für Interessierte u. Patienten Krummdarm = Colon Sigmoideum Aufsteigender Darm Querdarm
Akutes Abdomen aus internistischer Sicht
 Akutes Abdomen aus internistischer Sicht G. Weitz (Lübeck) plötzlich einsetzende Bauchschmerzen kurzer Verlauf (bis eine Woche) (störend - potentiell bedrohlich) Dynamik? Leitsymptome: heftige Bauchschmerzen
Akutes Abdomen aus internistischer Sicht G. Weitz (Lübeck) plötzlich einsetzende Bauchschmerzen kurzer Verlauf (bis eine Woche) (störend - potentiell bedrohlich) Dynamik? Leitsymptome: heftige Bauchschmerzen
Bildgebende Abklärung des akuten Schmerzes im GI-Trakt. Hans-Jürgen Raatschen
 Bildgebende Abklärung des akuten Schmerzes im GI-Trakt Hans-Jürgen Raatschen 4 Hauptursachen für ein akutes Abdomen Ileus (mechanisch/paralytisch) Organentzündung (Appendizitis, Adnexitis, Cholecystitis,
Bildgebende Abklärung des akuten Schmerzes im GI-Trakt Hans-Jürgen Raatschen 4 Hauptursachen für ein akutes Abdomen Ileus (mechanisch/paralytisch) Organentzündung (Appendizitis, Adnexitis, Cholecystitis,
Divertikulose und Divertikulitis
 DFP - Literaturstudium Divertikulose und Divertikulitis In den westlichen Industrienationen zählen Divertikulose und Divertikulitis zu den häufigsten Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes. Traditionelle
DFP - Literaturstudium Divertikulose und Divertikulitis In den westlichen Industrienationen zählen Divertikulose und Divertikulitis zu den häufigsten Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes. Traditionelle
Seminar Darm Teil I: Akutes Abdomen
 Seminar Darm Teil I: Akutes Abdomen Prof. Dr. Matthias Bollow Institut für f r Radiologie, Nuklearmedizin und Radioonkologie Augusta-Kranken Kranken-Anstalt Bochum Akademisches Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universit
Seminar Darm Teil I: Akutes Abdomen Prof. Dr. Matthias Bollow Institut für f r Radiologie, Nuklearmedizin und Radioonkologie Augusta-Kranken Kranken-Anstalt Bochum Akademisches Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universit
Clostridium difficile Infektion
 Clostridium difficile Infektion Erstellt durch ao Univ. Prof. Dr. Christoph Högenauer und Assoc. Prof. PD Dr. Christoph Steininger am 22.10.2013 Arbeitsgruppenleiter: Assoc. Prof. PD Dr. Christoph Steininger
Clostridium difficile Infektion Erstellt durch ao Univ. Prof. Dr. Christoph Högenauer und Assoc. Prof. PD Dr. Christoph Steininger am 22.10.2013 Arbeitsgruppenleiter: Assoc. Prof. PD Dr. Christoph Steininger
Dickdarmerkrankungen. Ursula Seidler Medizinische Hochschule Hannover Abt. für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie
 Dickdarmerkrankungen Ursula Seidler Medizinische Hochschule Hannover Abt. für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie Häufigkeit von Dickdarmerkrankungen Divertikelperforationen M. Crohn C. ulcerosa
Dickdarmerkrankungen Ursula Seidler Medizinische Hochschule Hannover Abt. für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie Häufigkeit von Dickdarmerkrankungen Divertikelperforationen M. Crohn C. ulcerosa
TUT 3. Dr. Christoph Bichler
 TUT 3 Bauchschmerz Dr. Christoph Bichler Aktuelle Symptomatik Patient, männlich, 68 Jahre Seit drei Tagen zunehmender Bauchumfang und Völlegefühl Seit zwei Tagen auch zunehmende krampfartige Bauchschmerzen
TUT 3 Bauchschmerz Dr. Christoph Bichler Aktuelle Symptomatik Patient, männlich, 68 Jahre Seit drei Tagen zunehmender Bauchumfang und Völlegefühl Seit zwei Tagen auch zunehmende krampfartige Bauchschmerzen
Therapeutische Exitstrategien
 Therapeutische Exitstrategien Klaus Fellermann Campus Lübeck, Med. Klinik I Der Einstieg vom Ausstieg Differenzierte Betrachtung von MC vs. CU von Medikamenten diagnostischen Notwendigkeiten Verlaufsformen
Therapeutische Exitstrategien Klaus Fellermann Campus Lübeck, Med. Klinik I Der Einstieg vom Ausstieg Differenzierte Betrachtung von MC vs. CU von Medikamenten diagnostischen Notwendigkeiten Verlaufsformen
Neue Leitlinien zur Dissektion hirnversorgender Arterien: Was ändert sich im klinischen Alltag?
 Neue Leitlinien zur Dissektion hirnversorgender Arterien: Was ändert sich im klinischen Alltag? Ralf Dittrich Department für Neurologie Klinik für Allgemeine Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität
Neue Leitlinien zur Dissektion hirnversorgender Arterien: Was ändert sich im klinischen Alltag? Ralf Dittrich Department für Neurologie Klinik für Allgemeine Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität
PEG in der Geriatrie. Dr. S. K. Gölder III. Medizinische Klinik Klinikum Augsburg
 PEG in der Geriatrie Dr. S. K. Gölder III. Medizinische Klinik Klinikum Augsburg Perkutane Endoskopische Gastrostomie Gauderer MW, Ponsky JL, Izant RJ. Gastrostomy without laparotomy: a percutaneous endoscopic
PEG in der Geriatrie Dr. S. K. Gölder III. Medizinische Klinik Klinikum Augsburg Perkutane Endoskopische Gastrostomie Gauderer MW, Ponsky JL, Izant RJ. Gastrostomy without laparotomy: a percutaneous endoscopic
konservativ oder operativ Anamnese (Stuhl/Wind; Vorop.) Klinik Diagnostik Thorax /Abdomen leer Sonographie CT KM-Passage Mechanisch Paralytisch
 Dünndarmileus Dünndarmileus Klinik und Diagnostik Take Home message Ursachen/Häufigkeit konservativ oder operativ Algorithmus Prophylaxe Konservative Therapie Operative Therapie -Offen -laparoskopisch
Dünndarmileus Dünndarmileus Klinik und Diagnostik Take Home message Ursachen/Häufigkeit konservativ oder operativ Algorithmus Prophylaxe Konservative Therapie Operative Therapie -Offen -laparoskopisch
3 x Diät kurz und knackig
 Rheuma - Forum Eggenberg 3 x Diät kurz und knackig Peter Skrabl Interne Abteilung II BHB Graz Herbsttagung für Pflegekräfte mit Spezialausbildung 26. 9. 2015 Hotel Wiesler ABLAUF / SOLL Flussdiagramm FODMAP
Rheuma - Forum Eggenberg 3 x Diät kurz und knackig Peter Skrabl Interne Abteilung II BHB Graz Herbsttagung für Pflegekräfte mit Spezialausbildung 26. 9. 2015 Hotel Wiesler ABLAUF / SOLL Flussdiagramm FODMAP
Divertikulose. Ausstülpungen am Darm und Ihre Komplikationen
 Gastroenterologie Divertikulose Ausstülpungen am Darm und Ihre Komplikationen Patientenvortrag Tillman Deist Facharzt für Innere Medizin Gastroenterologie, Proktologie, Onkologie und Nephrologie, internist.
Gastroenterologie Divertikulose Ausstülpungen am Darm und Ihre Komplikationen Patientenvortrag Tillman Deist Facharzt für Innere Medizin Gastroenterologie, Proktologie, Onkologie und Nephrologie, internist.
Die aktuelle S3-Leitlinie zur Diagnsotik, Therapie und Nachsorge des Ovarialkarzinoms. Diagnostik
 Die aktuelle S3-Leitlinie zur Diagnsotik, Therapie und Nachsorge des Ovarialkarzinoms Diagnostik Diagnostik: Zielsetzung und Fragestellungen Diagnostik (siehe Kapitel 3.3) Welche Symptome weisen auf ein
Die aktuelle S3-Leitlinie zur Diagnsotik, Therapie und Nachsorge des Ovarialkarzinoms Diagnostik Diagnostik: Zielsetzung und Fragestellungen Diagnostik (siehe Kapitel 3.3) Welche Symptome weisen auf ein
Divertikulitis. wann operieren?
 Universitätsklinik für Visceral-, Transplanta6ons- und Thoraxchirurgie Daniel Swarovski Forschungslabor Tiroler Krebsforschungsins6tut Divertikulitis wann operieren? D. Öfner-Velano 07 St. Stättner conflict-of-interest
Universitätsklinik für Visceral-, Transplanta6ons- und Thoraxchirurgie Daniel Swarovski Forschungslabor Tiroler Krebsforschungsins6tut Divertikulitis wann operieren? D. Öfner-Velano 07 St. Stättner conflict-of-interest
Die komplizierte Sigmadivertikulitis:
 Die komplizierte Sigmadivertikulitis: Konzept der Notfallchirurgie A. Scheiwiller Einteilung Hansen und Stock 0 Divertikulose I akute unkomplizierte Divertikulitis II akute komplizierte Divertikulitis
Die komplizierte Sigmadivertikulitis: Konzept der Notfallchirurgie A. Scheiwiller Einteilung Hansen und Stock 0 Divertikulose I akute unkomplizierte Divertikulitis II akute komplizierte Divertikulitis
Diagnostisches Vorgehen bei Leberraumforderungen. H. Diepolder
 Diagnostisches Vorgehen bei Leberraumforderungen H. Diepolder Bei 20% aller Routinesonographien fällt eine Leberraumforderung auf Problem Problem Bei 20% aller Routinesonographien fällt eine Leberraumforderung
Diagnostisches Vorgehen bei Leberraumforderungen H. Diepolder Bei 20% aller Routinesonographien fällt eine Leberraumforderung auf Problem Problem Bei 20% aller Routinesonographien fällt eine Leberraumforderung
Operative Therapie CED. Ernst Klar Chirurgische Universitätsklinik Rostock Hauptvorlesung Chirurgie
 Operative Therapie CED Ernst Klar Hauptvorlesung Chirurgie 2 Indikation zur operativen Therapie des Morbus Crohn Gesamt n=133 2004-2008 Perforation Fistel Abszess Stenose 53% 28% Konglomerattumor Chirurgische
Operative Therapie CED Ernst Klar Hauptvorlesung Chirurgie 2 Indikation zur operativen Therapie des Morbus Crohn Gesamt n=133 2004-2008 Perforation Fistel Abszess Stenose 53% 28% Konglomerattumor Chirurgische
Aspirin auch bei Typ-2-Diabetikern nur gezielt zur Sekundärprävention einsetzen
 Neue Erkenntnisse zur Prävention von Gefäßerkrankungen: Aspirin auch bei Typ-2-Diabetikern nur gezielt zur Sekundärprävention einsetzen Bochum (3. August 2009) Herzinfarkt und Schlaganfall sind eine häufige
Neue Erkenntnisse zur Prävention von Gefäßerkrankungen: Aspirin auch bei Typ-2-Diabetikern nur gezielt zur Sekundärprävention einsetzen Bochum (3. August 2009) Herzinfarkt und Schlaganfall sind eine häufige
HERZINFARKTE BEI FRAUEN
 HERZINFARKTE BEI FRAUEN Dr. med. Walter Willgeroth Epidemiologische Aspekte Ca. 100.000 Frauen erleiden Herzinfarkt pro Jahr. Ca. die Hälfte stirbt an den Folgen einer Koronaren Herzkrankheit. Mortalität
HERZINFARKTE BEI FRAUEN Dr. med. Walter Willgeroth Epidemiologische Aspekte Ca. 100.000 Frauen erleiden Herzinfarkt pro Jahr. Ca. die Hälfte stirbt an den Folgen einer Koronaren Herzkrankheit. Mortalität
Empfehlungen zur Antibiotikaverschreibung bei häufigen ambulant erworbenen Infektionen. Kriterien für die Antibiotikaverschreibung
 Empfehlungen zur Antibiotikaverschreibung bei häufigen ambulant erworbenen Infektionen für Sentinella Ärzte und Ärztinnen Kriterien für die Antibiotikaverschreibung Sentinella, Pediatric Infectious Disease
Empfehlungen zur Antibiotikaverschreibung bei häufigen ambulant erworbenen Infektionen für Sentinella Ärzte und Ärztinnen Kriterien für die Antibiotikaverschreibung Sentinella, Pediatric Infectious Disease
Kolonkarzinomscreening
 Kolonkarzinomscreening PD Dr. med. Stephan Vavricka Stadtspital Triemli stephan.vavricka@triemli.stzh.ch VZI-Symposium 30.1.2014 Karzinom Häufigkeit 1 CRC - Karzinomrisiko CH Nationales Krebsprogram für
Kolonkarzinomscreening PD Dr. med. Stephan Vavricka Stadtspital Triemli stephan.vavricka@triemli.stzh.ch VZI-Symposium 30.1.2014 Karzinom Häufigkeit 1 CRC - Karzinomrisiko CH Nationales Krebsprogram für
Harnwegsinfekte nach Nierentransplantation Symposium 25 Jahre Transplantationszentrum Stuttgart
 Harnwegsinfekte nach Nierentransplantation Symposium 25 Jahre Transplantationszentrum Stuttgart Professor Dr. med. Andreas Kribben Klinik für Nephrologie Universitätsklinikum Essen 21. 5. 2011 Harnwegsinfektionen
Harnwegsinfekte nach Nierentransplantation Symposium 25 Jahre Transplantationszentrum Stuttgart Professor Dr. med. Andreas Kribben Klinik für Nephrologie Universitätsklinikum Essen 21. 5. 2011 Harnwegsinfektionen
Akuter Abdominalschmerz Differentialdiagnose
 Akuter Abdominalschmerz Differentialdiagnose Florian Obermeier Akuter Abdominalschmerz Häufigkeit und Ursachen - Ursache für etwa 5% der Vorstellungen in der Notaufnahme - davon leiden 10% an einer potentiell
Akuter Abdominalschmerz Differentialdiagnose Florian Obermeier Akuter Abdominalschmerz Häufigkeit und Ursachen - Ursache für etwa 5% der Vorstellungen in der Notaufnahme - davon leiden 10% an einer potentiell
Perikarditis - Was sagen die neuen Leitlinien?
 Perikarditis - Was sagen die neuen Leitlinien? M. Pauschinger Ärztlicher Leiter Universitätsklinik für Innere Medizin 8 Schwerpunkt Kardiologie Paracelsus Medizinische Privatuniversität Nürnberg EHJ 2015,
Perikarditis - Was sagen die neuen Leitlinien? M. Pauschinger Ärztlicher Leiter Universitätsklinik für Innere Medizin 8 Schwerpunkt Kardiologie Paracelsus Medizinische Privatuniversität Nürnberg EHJ 2015,
Komplikationen unter Antikoagulation und Thrombozytenaggregationshemmung: Diagnostik und Management
 Komplikationen unter Antikoagulation und Thrombozytenaggregationshemmung: Diagnostik und Management Dr. med. W. Pommerien Klinik für Innere Medizin II Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH Nutzen/Risiken
Komplikationen unter Antikoagulation und Thrombozytenaggregationshemmung: Diagnostik und Management Dr. med. W. Pommerien Klinik für Innere Medizin II Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH Nutzen/Risiken
Abstracts. Entzündungen des Dickdarms Appendizitis, Divertikulitis, Colitis. Schwerin. Samstag, 6. September Uhr
 Abstracts Entzündungen des Dickdarms Appendizitis, Divertikulitis, Colitis Schwerin Samstag, 6. September 2014 9.00 15.30 Uhr Veranstaltungsort: Industrie- und Handelskammer zu Schwerin Ludwig-Bölkow-Haus
Abstracts Entzündungen des Dickdarms Appendizitis, Divertikulitis, Colitis Schwerin Samstag, 6. September 2014 9.00 15.30 Uhr Veranstaltungsort: Industrie- und Handelskammer zu Schwerin Ludwig-Bölkow-Haus
Schlüsselloch-Operationen bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen
 Schlüsselloch-Operationen bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Robert Rosenberg Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäss- und Thoraxchirurgie Kantonsspital Baselland Liestal Verdacht auf chronisch-entzündliche
Schlüsselloch-Operationen bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Robert Rosenberg Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäss- und Thoraxchirurgie Kantonsspital Baselland Liestal Verdacht auf chronisch-entzündliche
Chirurgie des Dickdarms. Ltd. OA A. Péter Klinik für Transplantations-und Allgemeinchirurgie Med. Univ. Semmelweis, Budapest, 2016
 Chirurgie des Dickdarms Ltd. OA A. Péter Klinik für Transplantations-und Allgemeinchirurgie Med. Univ. Semmelweis, Budapest, 2016 Aufbau der Vorlesung 1. Grundlagen (Anatomie, Diagnostik) 2. Gutartige
Chirurgie des Dickdarms Ltd. OA A. Péter Klinik für Transplantations-und Allgemeinchirurgie Med. Univ. Semmelweis, Budapest, 2016 Aufbau der Vorlesung 1. Grundlagen (Anatomie, Diagnostik) 2. Gutartige
Universitätsklinikum Jena Zentrale Notfallaufnahme
 Seite 1 von 6 1. Fakten Zu Beginn: Sollte der Patient an die Urologie angebunden werden, bitte vor Antibiotikagabe wegen laufender Studien Kontakt mit der Urologie aufnehmen. Wenn dies medizinisch nicht
Seite 1 von 6 1. Fakten Zu Beginn: Sollte der Patient an die Urologie angebunden werden, bitte vor Antibiotikagabe wegen laufender Studien Kontakt mit der Urologie aufnehmen. Wenn dies medizinisch nicht
Voruntersuchungen. Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin
 Voruntersuchungen ASA Klassifikation Grundlagen für apparative, technische Untersuchungen entscheidende Grundlagen zur Indikation jeder präoperativen technischen Untersuchung: - Erhebung einer sorgfältigen
Voruntersuchungen ASA Klassifikation Grundlagen für apparative, technische Untersuchungen entscheidende Grundlagen zur Indikation jeder präoperativen technischen Untersuchung: - Erhebung einer sorgfältigen
Womit haben wir es eigentlich zu tun?
 Womit haben wir es eigentlich zu tun? Wie häufig sind Thrombosen und Embolien? One of the least understood aspects of venous thrombosis risk is advancing age. Incidence rates ofvte increasedramaticallyataboutage55
Womit haben wir es eigentlich zu tun? Wie häufig sind Thrombosen und Embolien? One of the least understood aspects of venous thrombosis risk is advancing age. Incidence rates ofvte increasedramaticallyataboutage55
handlungsfehler in der präklinischen Versorgung f. Dr. A. Ferbert.2008 10. Jahrestagung der ANB
 handlungsfehler in der präklinischen Versorgung f. Dr. A. Ferbert.2008 10. Jahrestagung der ANB Häufige Fehlerarten in der Prähospitalphase Schlaganfall bzw. TIA nicht diagnostiziert. SAB nicht diagnostiziert
handlungsfehler in der präklinischen Versorgung f. Dr. A. Ferbert.2008 10. Jahrestagung der ANB Häufige Fehlerarten in der Prähospitalphase Schlaganfall bzw. TIA nicht diagnostiziert. SAB nicht diagnostiziert
Was ist die beste Nachsorge? 2. Berliner Tag des Eierstock- und Bauchfellkrebses am 11. September 2010
 Was ist die beste Nachsorge? 2. Berliner Tag des Eierstock- und Bauchfellkrebses am 11. September 2010 Jochem Potenberg Ev. Waldkrankenhaus Berlin Einführung 8500 Neuerkrankungen in Deutschland pro Jahr
Was ist die beste Nachsorge? 2. Berliner Tag des Eierstock- und Bauchfellkrebses am 11. September 2010 Jochem Potenberg Ev. Waldkrankenhaus Berlin Einführung 8500 Neuerkrankungen in Deutschland pro Jahr
Nachsorge und adjuvante Chemotherapie des Dickdarmkarzinoms. Sankt Marien-Hospital Buer
 Nachsorge und adjuvante Chemotherapie des Dickdarmkarzinoms Grundlagen und Ziele Nachsorgemethoden Wertigkeit der Nachsorgetests Stadienadaptierte Nachsorgepläne Adjuvante Chemotherapie Leitliniengemässe
Nachsorge und adjuvante Chemotherapie des Dickdarmkarzinoms Grundlagen und Ziele Nachsorgemethoden Wertigkeit der Nachsorgetests Stadienadaptierte Nachsorgepläne Adjuvante Chemotherapie Leitliniengemässe
2 State of the art lectures
 ÜBERBLICK: OPERATIONSINDIKATIONEN Herzklappenfehler Prof. F. Eckstein Bonow RO, Carabello BA, et al., J Am Coll Cardiol 2008 Empfehlungen / Level of Evidence (LE) Strategie bei Vorliegen von Herzgeräuschen
ÜBERBLICK: OPERATIONSINDIKATIONEN Herzklappenfehler Prof. F. Eckstein Bonow RO, Carabello BA, et al., J Am Coll Cardiol 2008 Empfehlungen / Level of Evidence (LE) Strategie bei Vorliegen von Herzgeräuschen
Herzlich Willkommen zum
 Herzlich Willkommen zum 1 Chronisch entzündliche Darmerkrankungen Medikamentöse Therapie Dr. M. Geppert SHG MC-CU 17.05.2013 Die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) sind: Morbus Crohn Colitis
Herzlich Willkommen zum 1 Chronisch entzündliche Darmerkrankungen Medikamentöse Therapie Dr. M. Geppert SHG MC-CU 17.05.2013 Die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) sind: Morbus Crohn Colitis
- Kolorektalkarzinom -
 - Kolorektalkarzinom - - Darmkrebs, Lokalisation - Dickdarmkrebs (kolorektales Karzinom) ICD 0 C18-20 Tumor im Dickdarm (Colon)=Kolonkarzinom Lokalisationsspezifische Häufigkeiten kolorektaler Tumore Tumor
- Kolorektalkarzinom - - Darmkrebs, Lokalisation - Dickdarmkrebs (kolorektales Karzinom) ICD 0 C18-20 Tumor im Dickdarm (Colon)=Kolonkarzinom Lokalisationsspezifische Häufigkeiten kolorektaler Tumore Tumor
Notfall-ERCP Indikationen - Durchführung - Nachsorge
 Notfall-ERCP Indikationen - Durchführung - Nachsorge Frankfurt 02.05.2013 Jörg Bojunga Medizinische Klinik I Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Grundsätzliche Indikationen zur ERCP Diagnostisch
Notfall-ERCP Indikationen - Durchführung - Nachsorge Frankfurt 02.05.2013 Jörg Bojunga Medizinische Klinik I Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Grundsätzliche Indikationen zur ERCP Diagnostisch
Gute Überlebensqualität Trastuzumab beim metastasierten Magenkarzinom
 Gute Überlebensqualität Trastuzumab beim metastasierten Magenkarzinom München (24. April 2012) - Mit dem monoklonalen Antikörper Trastuzumab (Herceptin ) steht bislang die einzige zielgerichtete Substanz
Gute Überlebensqualität Trastuzumab beim metastasierten Magenkarzinom München (24. April 2012) - Mit dem monoklonalen Antikörper Trastuzumab (Herceptin ) steht bislang die einzige zielgerichtete Substanz
kontrolliert wurden. Es erfolgte zudem kein Ausschluss einer sekundären Genese der Eisenüberladung. Erhöhte Ferritinkonzentrationen wurden in dieser S
 5.8 Zusammenfassung Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse dieser Studie erscheint die laborchemische Bestimmung der Transferrinsättigung zur Abklärung einer unklaren Lebererkrankung und Verdacht
5.8 Zusammenfassung Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse dieser Studie erscheint die laborchemische Bestimmung der Transferrinsättigung zur Abklärung einer unklaren Lebererkrankung und Verdacht
Speiseröhre Erkrankungen II. Dr. Katalin Müllner
 Speiseröhre Erkrankungen II. Dr. Katalin Müllner Ösophaguserkrankungen beim dem Vortrag schon! a) Dysphagie (Schluckstörung) b) Achalasie (Schlucklähmung) c) Divertikel d) Ösophagusvarizen e) Refluxösophagitis
Speiseröhre Erkrankungen II. Dr. Katalin Müllner Ösophaguserkrankungen beim dem Vortrag schon! a) Dysphagie (Schluckstörung) b) Achalasie (Schlucklähmung) c) Divertikel d) Ösophagusvarizen e) Refluxösophagitis
Sonographie Was ist sinnvoll am Magen-Darm-Trakt?
 Sonographie Was ist sinnvoll am Magen-Darm-Trakt? PD Dr. Eckhart Fröhlich Appendizitis Divertikulitis Ileus freie intraabd. Luft Karl-Olga-Krankenhaus GmbH Hackstr. 61 70190 Stuttgart www.karl-olga-krankenhaus.de
Sonographie Was ist sinnvoll am Magen-Darm-Trakt? PD Dr. Eckhart Fröhlich Appendizitis Divertikulitis Ileus freie intraabd. Luft Karl-Olga-Krankenhaus GmbH Hackstr. 61 70190 Stuttgart www.karl-olga-krankenhaus.de
Dickdarmerkrankungen. Ursula Seidler Medizinische Hochschule Hannover Abt. für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie
 Dickdarmerkrankungen Ursula Seidler Medizinische Hochschule Hannover Abt. für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie Häufigkeit von Dickdarmerkrankungen Divertikelperforationen C. ulcerosa Dickdarmkrebs
Dickdarmerkrankungen Ursula Seidler Medizinische Hochschule Hannover Abt. für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie Häufigkeit von Dickdarmerkrankungen Divertikelperforationen C. ulcerosa Dickdarmkrebs
Venenthrombose. Daniel Staub Angiologie. Dimitrios Tsakiris Hämostasiologie
 Venenthrombose Daniel Staub Angiologie Dimitrios Tsakiris Hämostasiologie VTE Abklärung und Behandlung im Wandel der Zeit Früher Heute Diagnostik: Phlebographie Ultraschall Klinik unspezif. Wells + D-Dimere
Venenthrombose Daniel Staub Angiologie Dimitrios Tsakiris Hämostasiologie VTE Abklärung und Behandlung im Wandel der Zeit Früher Heute Diagnostik: Phlebographie Ultraschall Klinik unspezif. Wells + D-Dimere
U P D A T E. H.K. Schulthess 2. März 06 VZI: Update Gastroenterologie
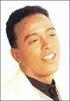 G A S T R O I N T E S T I N A L E E R K R A N K U N G E N U P D A T E Fallvorstellung Fallvorstellung: Symptome 36 jährige Frau Seit Jugend immer wieder starke Bauchschmerzen v.a. im rechten Unterbauch,
G A S T R O I N T E S T I N A L E E R K R A N K U N G E N U P D A T E Fallvorstellung Fallvorstellung: Symptome 36 jährige Frau Seit Jugend immer wieder starke Bauchschmerzen v.a. im rechten Unterbauch,
Ambulant erworbene Pneumonie
 Ambulant erworbene Pneumonie AWMF-Leitlinien-Register Nr. 82/001 Pneumologie. 2009 Oct;63(10):e1-68 Pneumologie. 2010 Mar;64(3):149-54 20, 21 Risikostratifizierung mit Hilfe des CRB- 65 Score C onfusion
Ambulant erworbene Pneumonie AWMF-Leitlinien-Register Nr. 82/001 Pneumologie. 2009 Oct;63(10):e1-68 Pneumologie. 2010 Mar;64(3):149-54 20, 21 Risikostratifizierung mit Hilfe des CRB- 65 Score C onfusion
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED)
 Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa Die 2 häufigsten Krankheitsbilder Inhaltsverzeichnis Epidemielogie Anatomie Ätiologie Symptome Diagnostik Therapie Prognose
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa Die 2 häufigsten Krankheitsbilder Inhaltsverzeichnis Epidemielogie Anatomie Ätiologie Symptome Diagnostik Therapie Prognose
Stellenwert von körperlicher Aktivität bei Krebserkrankungen
 Stellenwert von körperlicher Aktivität bei Krebserkrankungen München Verena Freiberger Präventive und Rehabilitative Sportmedizin www.sport.med.tum.de Verena Freiberger- Präventive und Rehabilitative Sportmedizin-Technische
Stellenwert von körperlicher Aktivität bei Krebserkrankungen München Verena Freiberger Präventive und Rehabilitative Sportmedizin www.sport.med.tum.de Verena Freiberger- Präventive und Rehabilitative Sportmedizin-Technische
Hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism in postmenopausal women: systematic review and meta-analysis
 Hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism in postmenopausal women: systematic review and meta-analysis Canonico M, Plu-Bureau G, Lowe G and Scarabin PY. BMJ May 2008;336:1227-1231
Hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism in postmenopausal women: systematic review and meta-analysis Canonico M, Plu-Bureau G, Lowe G and Scarabin PY. BMJ May 2008;336:1227-1231
Akutes Abdomen. B. Buerke Institut für Klinische Radiologie Universitätsklinikum Münster
 Akutes Abdomen B. Buerke Institut für Klinische Radiologie Universitätsklinikum Münster 1 Definition Akutes Abdomen Ätiologisch zunächst unklare Manifestation einer Erkrankung im Bauchraum, die einer sofortigen
Akutes Abdomen B. Buerke Institut für Klinische Radiologie Universitätsklinikum Münster 1 Definition Akutes Abdomen Ätiologisch zunächst unklare Manifestation einer Erkrankung im Bauchraum, die einer sofortigen
Aus der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. H.
 Aus der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. H. Dralle Gastric-banding als Operationsmethode bei morbider Adipositas
Aus der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. H. Dralle Gastric-banding als Operationsmethode bei morbider Adipositas
DIAGNOSTIK UND THERAPIE NICHTSEMINOMATÖSER HODENTUMOREN
 DIAGNOSTIK UND THERAPIE NICHTSEMINOMATÖSER HODENTUMOREN Allgemeines Wesentlich in der Therapie der Hodentumore sind: die exakte histologische Untersuchung die Bestimmung des Stadiums die Festlegung der
DIAGNOSTIK UND THERAPIE NICHTSEMINOMATÖSER HODENTUMOREN Allgemeines Wesentlich in der Therapie der Hodentumore sind: die exakte histologische Untersuchung die Bestimmung des Stadiums die Festlegung der
Diabetes mellitus Relevante Qualitätsdaten mit Blick auf Prävention und Therapie
 Diabetes mellitus Relevante Qualitätsdaten mit Blick auf Prävention und Therapie Qualitätsdaten im Gesundheitswesen allianzq- Stoos VIII 16. Juni, 2017 Prof. Dr. Michael Brändle, M.Sc. Chefarzt Allgemeine
Diabetes mellitus Relevante Qualitätsdaten mit Blick auf Prävention und Therapie Qualitätsdaten im Gesundheitswesen allianzq- Stoos VIII 16. Juni, 2017 Prof. Dr. Michael Brändle, M.Sc. Chefarzt Allgemeine
Dossierbewertung A14-28 Version 1.0 Apixaban (neues Anwendungsgebiet) Nutzenbewertung gemäß 35a SGB V
 2 Nutzenbewertung 2.1 Kurzfassung der Nutzenbewertung Hintergrund Der G-BA hat das IQWiG mit der Nutzenbewertung des Wirkstoffs Apixaban (neues Anwendungsgebiet) gemäß 35a SGB V beauftragt. Die Bewertung
2 Nutzenbewertung 2.1 Kurzfassung der Nutzenbewertung Hintergrund Der G-BA hat das IQWiG mit der Nutzenbewertung des Wirkstoffs Apixaban (neues Anwendungsgebiet) gemäß 35a SGB V beauftragt. Die Bewertung
Peri und postoperative Behandlungsempfehlungen. bei perforierender Keratoplastik. der Sektion Kornea der DOG
 Peri und postoperative Behandlungsempfehlungen bei perforierender Keratoplastik der Sektion Kornea der DOG Behandlungsempfehlungen bei perforierender Normalrisiko Keratoplastik Lokale Therapie OP Beginn
Peri und postoperative Behandlungsempfehlungen bei perforierender Keratoplastik der Sektion Kornea der DOG Behandlungsempfehlungen bei perforierender Normalrisiko Keratoplastik Lokale Therapie OP Beginn
Zustand nach Mammakarzinom: Wie geht es weiter? Dr. Franz Lang I. Interne Abteilung 26.2.2004
 Zustand nach Mammakarzinom: Wie geht es weiter? Dr. Franz Lang I. Interne Abteilung 26.2.2004 Epidemiologie des Mammakarzinoms Mammakarzinom in Österreich: Inzidenz: : 4350/ Jahr 105/ 100 000 Frauen Primär
Zustand nach Mammakarzinom: Wie geht es weiter? Dr. Franz Lang I. Interne Abteilung 26.2.2004 Epidemiologie des Mammakarzinoms Mammakarzinom in Österreich: Inzidenz: : 4350/ Jahr 105/ 100 000 Frauen Primär
Aktionstag Chronisch entzündliche Darmerkrankungen : Morbus Crohn-Patienten brauchen individuelle
 Aktionstag Chronisch entzündliche Darmerkrankungen Morbus Crohn-Patienten brauchen individuelle Therapie Berlin (19. Mai 2015) Deutet sich bei Morbus Crohn ein komplizierter Krankheitsverlauf an, sollten
Aktionstag Chronisch entzündliche Darmerkrankungen Morbus Crohn-Patienten brauchen individuelle Therapie Berlin (19. Mai 2015) Deutet sich bei Morbus Crohn ein komplizierter Krankheitsverlauf an, sollten
Kardio-CT im akuten Koronarsyndrom Gegenwart und Zukun. Hamburg Heart View,
 Kardio-CT im akuten Koronarsyndrom Gegenwart und Zukun. Hamburg Heart View, 05.11.2016 Prof. Dr. Gunnar Lund, Klinik und Poliklinik für diagnostische und interventionelle Radiologie, Universitätskrankenhaus
Kardio-CT im akuten Koronarsyndrom Gegenwart und Zukun. Hamburg Heart View, 05.11.2016 Prof. Dr. Gunnar Lund, Klinik und Poliklinik für diagnostische und interventionelle Radiologie, Universitätskrankenhaus
Erkrankungen des Kolon
 Erkrankungen des Kolon (Beispiele) Die wichtigsten Erkrankungen Tumore Hier unterscheiden wir zwischen gutartigen und bösartigen Tumoren. Zu den gutartigen Tumoren zählen wir: Polypen (falls ohne histologischem
Erkrankungen des Kolon (Beispiele) Die wichtigsten Erkrankungen Tumore Hier unterscheiden wir zwischen gutartigen und bösartigen Tumoren. Zu den gutartigen Tumoren zählen wir: Polypen (falls ohne histologischem
Neue Zielwerte in der Therapie der Hypertonie
 49. Bayerischer Internistenkongress Neue Zielwerte in der Therapie der Hypertonie 7. November 2010 Karl F. Hilgers Medizinische Klinik 4 (Nephrologie / Hypertensiologie) - Universitätsklinikum Erlangen
49. Bayerischer Internistenkongress Neue Zielwerte in der Therapie der Hypertonie 7. November 2010 Karl F. Hilgers Medizinische Klinik 4 (Nephrologie / Hypertensiologie) - Universitätsklinikum Erlangen
Antikoagulation und Plättchenaggregationshemmung beim flimmernden KHK-Patienten
 Antikoagulation und Plättchenaggregationshemmung beim flimmernden KHK-Patienten Dr. Ralph Kallmayer, Innere Abteilung Kardiologie HELIOS Klinik Lutherstadt Eisleben Das therapeutische Dilemma: Patient
Antikoagulation und Plättchenaggregationshemmung beim flimmernden KHK-Patienten Dr. Ralph Kallmayer, Innere Abteilung Kardiologie HELIOS Klinik Lutherstadt Eisleben Das therapeutische Dilemma: Patient
Der Mineralstoffhaushalt in der Pathogenese chronisch entzündlicher Darmerkrankungen
 Der Mineralstoffhaushalt in der Pathogenese chronisch entzündlicher Darmerkrankungen Dr. rer. nat. Katrin Huesker, IMD Berlin Postgrad Med J 1983 Morbus Crohn Colitis ulcerosa Zöliakie Reizdarm Postgrad
Der Mineralstoffhaushalt in der Pathogenese chronisch entzündlicher Darmerkrankungen Dr. rer. nat. Katrin Huesker, IMD Berlin Postgrad Med J 1983 Morbus Crohn Colitis ulcerosa Zöliakie Reizdarm Postgrad
Antibiotika bei Abdominalinfektionen: können Operationen vermieden werden?
 18. Symposium: Infektionskrankheiten in der Praxis Antibiotika bei Abdominalinfektionen: können Operationen vermieden werden? Appendizitis Pankreatitis Duodenitis Divertikulitis Gastritis Hepatitis Cholezystitis
18. Symposium: Infektionskrankheiten in der Praxis Antibiotika bei Abdominalinfektionen: können Operationen vermieden werden? Appendizitis Pankreatitis Duodenitis Divertikulitis Gastritis Hepatitis Cholezystitis
S3-LEITLINIE ZUR DIAGNOSTIK, THERAPIE UND NACHSORGE DER PERIPHEREN ARTERIELLEN VERSCHLUSSKRANKHEIT
 S3-LEITLINIE ZUR DIAGNOSTIK, THERAPIE UND NACHSORGE DER PERIPHEREN ARTERIELLEN VERSCHLUSSKRANKHEIT Stand: 30. September 2015 95% der Fälle durch Arteriosklerose Herzinfarkt, Schlaganfall und PAVK In ungefähr
S3-LEITLINIE ZUR DIAGNOSTIK, THERAPIE UND NACHSORGE DER PERIPHEREN ARTERIELLEN VERSCHLUSSKRANKHEIT Stand: 30. September 2015 95% der Fälle durch Arteriosklerose Herzinfarkt, Schlaganfall und PAVK In ungefähr
Clostridieninfektionen bei Nierenpatienten. Prof. Dr. Matthias Girndt Klinik für Innere Medizin II Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 Clostridieninfektionen bei Nierenpatienten Prof. Dr. Matthias Girndt Klinik für Innere Medizin II Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Epidemiologie in Deutschland Schwere Erkrankungen mit Cl. diff.
Clostridieninfektionen bei Nierenpatienten Prof. Dr. Matthias Girndt Klinik für Innere Medizin II Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Epidemiologie in Deutschland Schwere Erkrankungen mit Cl. diff.
Kopfschmerzen beim Patienten oder beim Arzt?
 Kopfschmerzen beim Patienten oder beim Arzt? - Wo sind die Grenzen für Abklärungen im Notfallzentrum? - Gibt es Guidelines? Dr. med. Hans Marty, Leiter Medizin Notfallzentrum Wo sind die Grenzen für Abklärungen
Kopfschmerzen beim Patienten oder beim Arzt? - Wo sind die Grenzen für Abklärungen im Notfallzentrum? - Gibt es Guidelines? Dr. med. Hans Marty, Leiter Medizin Notfallzentrum Wo sind die Grenzen für Abklärungen
Das Mammakarzinom: Diagnostik und Therapie
 Medizin Martin Smollich Das Mammakarzinom: Diagnostik und Therapie Wissenschaftlicher Aufsatz Martin Smollich Das Mammakarzinoms: Diagnostik und Therapie 1. Inzidenz, Risikofaktoren, Prävention, Früherkennung
Medizin Martin Smollich Das Mammakarzinom: Diagnostik und Therapie Wissenschaftlicher Aufsatz Martin Smollich Das Mammakarzinoms: Diagnostik und Therapie 1. Inzidenz, Risikofaktoren, Prävention, Früherkennung
Therapie der Wahl ist das operative Entfernen des entzündeten Wurmfortsatzes.
 Blinddarmentzündung (Appendizitis) Der Blinddarm ist Teil des menschlichen Dickdarms und endet als sogenannter Wurmfortsatz (Appendix) in der Bauchhöhle. Dieser Wurmfortsatz kann sich entzünden und eine
Blinddarmentzündung (Appendizitis) Der Blinddarm ist Teil des menschlichen Dickdarms und endet als sogenannter Wurmfortsatz (Appendix) in der Bauchhöhle. Dieser Wurmfortsatz kann sich entzünden und eine
Als Krebspatient an einer Studie teilnehmen was sollte man wissen?
 Als Krebspatient an einer Studie teilnehmen was sollte man wissen? Krebsinformationsdienst, Heidelberg Dr. Susanne Weg-Remers Seite 2 Grundlage für evidenzbasiertes medizinisches Wissen sind klinische
Als Krebspatient an einer Studie teilnehmen was sollte man wissen? Krebsinformationsdienst, Heidelberg Dr. Susanne Weg-Remers Seite 2 Grundlage für evidenzbasiertes medizinisches Wissen sind klinische
MaReCum Klausur in Biomathematik WS 2006 / 2007 Freitag, den 27. Oktober 2006
 MaReCum Klausur in Biomathematik WS 2006 / 2007 Freitag, den 27. Oktober 2006 Name: Matrikelnummer: Unterschrift: Aufgabe 1 In einer kleinen Gemeinde in Baden-Württemberg traten vermehrt Fälle von Q-Fieber
MaReCum Klausur in Biomathematik WS 2006 / 2007 Freitag, den 27. Oktober 2006 Name: Matrikelnummer: Unterschrift: Aufgabe 1 In einer kleinen Gemeinde in Baden-Württemberg traten vermehrt Fälle von Q-Fieber
Adipositas, Diabetes und Schlaganfall Prof. Dr. Joachim Spranger
 Adipositas, Diabetes und Schlaganfall Prof. Dr. Joachim Spranger Charité-Universitätsmedizin Berlin Adipositas- und Stoffwechselzentrum Campus Benjamin Franklin Hindenburgdamm 30 12200 Berlin The New Yorker
Adipositas, Diabetes und Schlaganfall Prof. Dr. Joachim Spranger Charité-Universitätsmedizin Berlin Adipositas- und Stoffwechselzentrum Campus Benjamin Franklin Hindenburgdamm 30 12200 Berlin The New Yorker
PD Dr. habil. Axel Schlitt et al., Halle
 Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Herz- und Kreislaufforschung e.v. (DGK) Achenbachstr. 43, 40237 Düsseldorf Geschäftsstelle: Tel: 0211 / 600 692-0 Fax: 0211 / 600 692-10 E-Mail: info@dgk.org Pressestelle:
Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Herz- und Kreislaufforschung e.v. (DGK) Achenbachstr. 43, 40237 Düsseldorf Geschäftsstelle: Tel: 0211 / 600 692-0 Fax: 0211 / 600 692-10 E-Mail: info@dgk.org Pressestelle:
Divertikel - Für immer beschwerdefrei
 Divertikel - Für immer beschwerdefrei Bearbeitet von Anne Iburg, Hans-Dieter Allescher 1. Auflage 2010. Taschenbuch. 128 S. Paperback ISBN 978 3 8304 3697 3 Format (B x L): 16 x 21,7 cm Weitere Fachgebiete
Divertikel - Für immer beschwerdefrei Bearbeitet von Anne Iburg, Hans-Dieter Allescher 1. Auflage 2010. Taschenbuch. 128 S. Paperback ISBN 978 3 8304 3697 3 Format (B x L): 16 x 21,7 cm Weitere Fachgebiete
Therapie und Nachsorge differenzierter Schilddrüsenkarzinome in Göttingen Abteilung Nuklearmedizin
 Therapie und Nachsorge differenzierter Schilddrüsenkarzinome in Göttingen 1990-2008 Abteilung Nuklearmedizin Hintergrund Therapie differenzierter SD-CAs: multimodal und interdisziplinär (Chirurgie und
Therapie und Nachsorge differenzierter Schilddrüsenkarzinome in Göttingen 1990-2008 Abteilung Nuklearmedizin Hintergrund Therapie differenzierter SD-CAs: multimodal und interdisziplinär (Chirurgie und
Wie können wir in Zukunft diese Fragen beantworten?
 Parkinson Krankheit: Diagnose kommt sie zu spät? Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder Mannheim (23. September 2010) - Die Frage, ob derzeit die Diagnosestellung einer Parkinson-Erkrankung zu spät kommt,
Parkinson Krankheit: Diagnose kommt sie zu spät? Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder Mannheim (23. September 2010) - Die Frage, ob derzeit die Diagnosestellung einer Parkinson-Erkrankung zu spät kommt,
Hämorriden und der kranke Enddarm
 Freya Reinhard Jens J. Kirsch Hämorriden und der kranke Enddarm Ein Ratgeber Verlag W. Kohlhammer Inhalt Vorwort 13 Einführung 15 Aufbau und Funktion des Dickdarms und des Enddarms 21 Aufbau 21 Funktion
Freya Reinhard Jens J. Kirsch Hämorriden und der kranke Enddarm Ein Ratgeber Verlag W. Kohlhammer Inhalt Vorwort 13 Einführung 15 Aufbau und Funktion des Dickdarms und des Enddarms 21 Aufbau 21 Funktion
Patient mit Husten: Klinische Unterscheidung von akuter Bronchitis und Pneumonie
 Alkoholmissbrauch Patient mit Husten: Klinische Unterscheidung von akuter Bronchitis und Pneumonie TGAM-Weiterbildung Bronchitis, 19. 11. 2014 Vortrag Herbert Bachler 1 Akute Bronchitis In den ersten Tagen
Alkoholmissbrauch Patient mit Husten: Klinische Unterscheidung von akuter Bronchitis und Pneumonie TGAM-Weiterbildung Bronchitis, 19. 11. 2014 Vortrag Herbert Bachler 1 Akute Bronchitis In den ersten Tagen
Chronisch entzündlicher Darmerkrankungen Klinische Daten aus der Phytoforschung
 19. Oktober 2011 Chronisch entzündlicher Darmerkrankungen Klinische Daten aus der Phytoforschung Prof. Dr. med. Jost Langhorst Universität Duisburg-Essen Hintergrund Fragestellung Patienten und Methoden
19. Oktober 2011 Chronisch entzündlicher Darmerkrankungen Klinische Daten aus der Phytoforschung Prof. Dr. med. Jost Langhorst Universität Duisburg-Essen Hintergrund Fragestellung Patienten und Methoden
Suisse ADPKD Zentrum Zürich. Dr. med. Diane Poster
 Suisse ADPKD Zentrum Zürich Dr. med. Diane Poster 28.09.2011 Suisse ADPKD Kohorte - seit 2006 - Aktuell 187 Patienten aus 4 Ländern Schweiz, Italien, Belgien, Deutschland - Alter zwischen 18-61 Jahre -
Suisse ADPKD Zentrum Zürich Dr. med. Diane Poster 28.09.2011 Suisse ADPKD Kohorte - seit 2006 - Aktuell 187 Patienten aus 4 Ländern Schweiz, Italien, Belgien, Deutschland - Alter zwischen 18-61 Jahre -
Studienzentrum der Deutschen Gesellschaft für f. SYNCHRONOUS Trial
 Studienzentrum der Deutschen Gesellschaft für f Chirurgie SYNCHRONOUS Trial Resection of the primary tumor vs. no resection prior to systemic therapy in patients with colon cancer and synchronous unresectable
Studienzentrum der Deutschen Gesellschaft für f Chirurgie SYNCHRONOUS Trial Resection of the primary tumor vs. no resection prior to systemic therapy in patients with colon cancer and synchronous unresectable
Der informierte Patient: Hilfe zur Selbsthilfe bei Verdauungskrankheiten
 Quelle: http://www.gastro-liga.de/index.php?id=75&fs=%22 Der informierte Patient: Hilfe zur Selbsthilfe bei Verdauungskrankheiten Präsentation erschienen zum Magen-Darm-Tag 2011, 05.11.2011 erstellt von:
Quelle: http://www.gastro-liga.de/index.php?id=75&fs=%22 Der informierte Patient: Hilfe zur Selbsthilfe bei Verdauungskrankheiten Präsentation erschienen zum Magen-Darm-Tag 2011, 05.11.2011 erstellt von:
Frage: Führt die antibiotische Behandlung der Helicobacter pylori Infektion bei Patienten mit funktioneller Dyspepsie zur Beschwerdefreiheit?
 Funktionelle Dyspepsie: Bei Patienten mit positivem Helicobacter pylori Nachweis hilft eine Eradikation, wenn überhaupt nur wenigen Patienten (Resultate von 2 Studien) Frage: Führt die antibiotische Behandlung
Funktionelle Dyspepsie: Bei Patienten mit positivem Helicobacter pylori Nachweis hilft eine Eradikation, wenn überhaupt nur wenigen Patienten (Resultate von 2 Studien) Frage: Führt die antibiotische Behandlung
Leitliniengerechte Gerinnungshemmung bei Vorhofflimmern und KHK
 Leitliniengerechte Gerinnungshemmung bei Vorhofflimmern und KHK Dr. med. Murat Nar Ambulantes Herz-Kreislaufzentrum Wolfsburg Vorhofflimmern - Inzidenz Vorhofflimmern ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung.
Leitliniengerechte Gerinnungshemmung bei Vorhofflimmern und KHK Dr. med. Murat Nar Ambulantes Herz-Kreislaufzentrum Wolfsburg Vorhofflimmern - Inzidenz Vorhofflimmern ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung.
Neue Wege zur Reduktion der Antibiotikaverordnung bei Atemwegsinfektionen.
 Neue Wege zur Reduktion der Antibiotikaverordnung bei Atemwegsinfektionen. Reduktion der Antibiotikaverordnungen bei akuten Atemwegserkrankungen 1. Basis für rationale Antibiotikaverordnungen: Leitlinien
Neue Wege zur Reduktion der Antibiotikaverordnung bei Atemwegsinfektionen. Reduktion der Antibiotikaverordnungen bei akuten Atemwegserkrankungen 1. Basis für rationale Antibiotikaverordnungen: Leitlinien
Abbildung 1: Aufgeschnittener Dickdarmabschnitt mit Divertikeln als Schleimhautausstülpungen
 4. Krankheitsbilder und Operationstechniken Divertikelkrankheit des Darmes Was ist eine Divertikulose? Als Divertikulose des Dickdarmes bezeichnet man sackförmige Ausstülpungen der Dickdarmschleimhaut
4. Krankheitsbilder und Operationstechniken Divertikelkrankheit des Darmes Was ist eine Divertikulose? Als Divertikulose des Dickdarmes bezeichnet man sackförmige Ausstülpungen der Dickdarmschleimhaut
Infektionsfokus in Thorax und Abdomen
 15. Kongress der DIVI; Leipzig, 04.12.15 Infektionsfokus in Thorax und Abdomen Bildgebung und interventionelle Therapie Peter Hunold Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
15. Kongress der DIVI; Leipzig, 04.12.15 Infektionsfokus in Thorax und Abdomen Bildgebung und interventionelle Therapie Peter Hunold Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Dossierbewertung A11-30 Version 1.0 Apixaban Nutzenbewertung gemäß 35a SGB V
 2 Nutzenbewertung 2.1 Kurzfassung der Nutzenbewertung Hintergrund Der G-BA hat mit Schreiben vom 14.12.2011 das IQWiG mit der Nutzenbewertung des Wirkstoffs Apixaban gemäß 35a SGB V beauftragt. Die Bewertung
2 Nutzenbewertung 2.1 Kurzfassung der Nutzenbewertung Hintergrund Der G-BA hat mit Schreiben vom 14.12.2011 das IQWiG mit der Nutzenbewertung des Wirkstoffs Apixaban gemäß 35a SGB V beauftragt. Die Bewertung
Mammakarzinom AGO State of the Art 2015
 Mammakarzinom AGO State of the Art 2015 S. Wojcinski Franziskus Hospital Bielefeld Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 1 2 3 Prävention 4 Rauchen HR BC-mortality HR All-cause-mortality Nichraucher
Mammakarzinom AGO State of the Art 2015 S. Wojcinski Franziskus Hospital Bielefeld Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 1 2 3 Prävention 4 Rauchen HR BC-mortality HR All-cause-mortality Nichraucher
C oli. di min. Divertikel- Erkrankungen. l o k a l e a n t i b i o t i s c h e T h e r a p i e. R i f a x i m i n
 neu Divertikel- Erkrankungen l o k a l e a n t i b i o t i s c h e T h e r a p i e C oli di min R i f a x i m i n Das ausschließlich im Magen-Darm-Trakt wirksame B r e i t b a n d a n t i b i o t i k u
neu Divertikel- Erkrankungen l o k a l e a n t i b i o t i s c h e T h e r a p i e C oli di min R i f a x i m i n Das ausschließlich im Magen-Darm-Trakt wirksame B r e i t b a n d a n t i b i o t i k u
