Eine Kognitive Typologie der Negation - Materialien - Teil 1
|
|
|
- Miriam Grosse
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Eine Kognitive Typologie der Negation - Materialien - Teil 1 Wolfgang Schulze 2008 Seite 1 1 These: Negation bedeutet die Konzeptualisierung von mismatch-ereignissen in der Kognition a Ausgangspunkt: Ein Umweltreiz [UR] (oder kognitionsinterner Reiz [KIR]) wird über sensorische Verfahren (KIR: kognitive Aktivitätsmuster [KAM]) in der Kognition durch den eingebrachten sensorischen Apparat verzerrt gespiegelt: Kognition UR /Sensor ur /Sensor Kognition KIR /KAM kir /KAM Verzerrt heißt, dass der Typ der aktiven sensorischen Einheit den Input seinem Typ gemäß spiegelt, vgl UR UR ur (= ur /Sensor1 ) ur (= ur /Sensor2 ) Sensor 1 Sensor 2 Jeder ur (oder kir ) ist also stets und immer sensorisch indiziert und entsprechend formatiert (verzerrt oder gebrochen)
2 ur : Die sensorisch verzerrte Abbildung eines kognitionsexternen Umweltreizes: UR ur (<KINDER SPIELEN FUSSBALL>) Seite 2 wwwkevins-webde/pic/kevin_fussball_1jpg kir : Die durch kognitive Aktivierungsmuster verzerrte Abbildung eines (aktivierten) Erinnerungssegments Segment KIR in /KAM kir Gedächtnis Nota: Das Erinnern eines Gedächtnissegments (Gedächtnis Erinnerung Erinnertes) bedeutet die Verzerrung des Gedächtnissegments Oder: Das Erinnerte ist eine aktuelle Verzerrung eines Gedächtnissegments b Wahrnehmung und Erfahrung: Der Prozess der Wahrnehmung eines UR (oder KIR) ist unmittelbar verbunden mit mehr oder minder spezifischen Gedächtniseinheiten Gedächtnis (memory, µ) ist das formale Substrat der Erfahrung SUBSTRAT FUNKTION GEHIRN GEDÄCHTNIS KOGNITION ERFAHRUNG Erfahrung ist die entsprechend der Architektur des formalen Substrats (memory) und der globalen Funktionaltät dieses Substrats schematisierte Festschreibung von als ähnlich konstruierten (kategorisierten) Wahrnehmungen von URs Glossen zu nachfolgender Graphik: t 0 t n : Wahrnehmung zu auf einander folgenden Zeitpunkten Gestaltvarianz der einzelnen UR entspricht der These, dass ein UR genau niemals wie anderer (vorangehender) sein kann Pfeilstärke (Wahrnehmung) = zunehmende Verstärkung der Wahrnehmung durch Erfahrung
3 t 0 t n UR 1 UR 2 UR 3 UR 3 UR n KOGNITION in ur 1 -Zustand Wahrnehmung,ur 1 -KOGNITION- in ur 2 -Zustand Wahrnehmung,ur 2 /ur 1 -KOGNITION- in ur 3 -Zustand Wahrnehmung,ur 2 /ur 1 -KOGNITION- in ur 3 -Zustand Wahrnehmung, ur 3 /ur 2 /ur 1 -KOGNITION- in ur n -Zustand Seite 3 Erfahrung (in Bezug auf UR (in t 0 -t n ) ur (in t 0 -t n )) = {ur n -Zustand} der Kognition NOTA: Kein Eingangsreiz kann als Wahrnehmung verarbeitet werden, wenn nicht ein Minimum an Erfahrung (memory appeal) aktiviert wird (Menōn-Paradoxon) Jeder neue Eingangsreiz bewirkt in seiner Wahrnehmung die minimale Aktivierung des Gedächtnissegments (Erfahrung) Da kein UR einem anderen UR vollständig entsprechen kann und jeder UR zudem von einer ihn wahrnehmenden Kognition in einem anderen Zustand dieser Kognition verarbeitet wird, erfolgt eine mehrfache Brechung der Wahrnehmung: 1 Brechung durch sensorische Einheit 2 Brechung durch den jeweils spezifischen, globalen Zustand der wahrnehmenden Kognition (kognitive Situierung) 3 Brechung durch Grad der Erfahrung in Bezug auf als analog erfahrene UR ur - Prozesse (Bahnung) 4 Brechung durch die Architektur des Erfahrungssubstrats (memory) 5 Brechung durch in der jeweiligen Erfahrung verankerte, UR ur -spezifische Wahrnehmungsstrategien und der konzeptuellen Fixierung der jeweiligen Erfahrung
4 Verkürzt (und stark vereinfacht) [α = aktuelle Reaktion auf eine UR, μ = Gedächtnissegment/Erfahrung] Kognition Seite 4 UR /Sensor /Sensor ur α ur μ/a ur μ! Jeder Umweltreiz wird in seiner Wahrnehmung dahingehend konstruiert (ur m/α ), dass ein Doppelbild entsteht: 1 eine erfahrungsbasierte Abbildung (ur μ ); 2 ein aktueller Schatten der Wahrnehmung (ur α ), der gegenüber ur μ notwendigerweise variant sein muss, da die Schattierung durch den aktuellen Zustand der wahrnehmenden Kognition mitbedingt ist ur μ/α ist eine Metapher von ur μ ur α ur μ 2 Negation als mismatch Die Voreinstellung der wahrnehmenden Kognition geht dahin, dass ein UR mittels eines aktivierten Gedächtnissegments ur μ hinreichend als ur α konstruiert werden kann KOG konstruiert jede aktuelle Abbildung von UR mittels eines memory check oder Gedächtnisabgleichs Da kein UR ohne Aktivierung eines μ-segments wahrgenommen und verarbeitet werden kann, ist damit eine grundsätzlich positive Kopplung gegeben Ist ein aktiviertes μ-segment in Teilen defizitär gegenüber den wahrgenommenen Eigenschaften von UR in ur α, entsteht ein mismatch in der Abbildung ur μ/α :
5 Kognition UR /Sensor /Sensor ur α ur μ/a Seite 5 ur μ Die Qualität von ur μ reicht nicht aus, um UR in ur α hinreichend abzubilden: ur α ur μ Hinreichend heißt, dass die active zones (Langacker) von ur α und ur μ keine Deckung finden, dh diejenigen Gestaltsegmente, die einen ur profilieren Vereinfacht: Negation ist der partielle mismatch von Wahrnehmung und Erfahrung Grundlage ist eventuell embodiment: Ein ur μ/α -match bedeutet die Sättigung von ur α in ur μ Bei einem mismatch liegt kognitiver Hunger vor, dh das mismatch-ereignis wird in Beziehung gesetzt zu einer Hypothese der Sättigung Basis eventuell: Bahnung von Hunger (= <nicht-satt>) / Sättigung-Zuständen des Embryos Kognitiv folgt daraus, dass jedes mismatch-ereignis mit einer matching-hypothese verbunden wird (Sättigung von ur μ/α ) Es gibt keine radikale Negation Jede Negation beinhaltet immer zumindest ein Segment, das die Konstatierung des mismatch überhaupt erst ermöglicht: Allein die Tatsache, dass ur μ aktiviert wird, bedeutet, dass zwischen UR ( ur α ) und ur μ eine Beziehung hergestellt wird, dh dass es mindestens eine matching-komponente gibt (zu den Folgen siehe su) Bahnung der Negation: Mismatch selbst ist eine globale kir -Erfahrung: Mismatch ist ein kognitionsinterner Reiz, der analog zu anderen Reizen über multiple (kognitionsinterne) Wahrnehmungen gebahnt!und in Erfahrung umgesetzt wird
6 Negation ist die konzeptuelle Repräsentation von mismatch-erfahrungen Die partielle Aktivierung von ur μ auch in mismatch-ereignissen bedingt, dass jede negationsmarkierte Verarbeitung eines UR kontrastiv markiert ist Kontrastiv heißt, dass parallel zum mismatch eine matching-hypothese zumindest in Bezug auf ein Segment von ur aktiviert wird (so) Seite 6 ur α UR ur μ/α -mismatch: < Der Ball ist nicht auf dem Stuhl > ur μ/α -match: < Der Ball ist neben dem Stuhl > ur μ M M M K [M = matching, K = Kontrast] Die negationsmarkierte Abbildung eines UR (mismatch) sei im Folgenden als bezeichnet ur -μ/α (kurz: -ur ) Jede negationsmarkierte Abbildung eines UR als ur -μ/α (-ur ) beinhaltet also eine positive Komponente (ur α und in Teilen ur μ ) Wenn ich wahrnehme, dass etwas NICHT ist, nehme ich zugleich wahr, DASS etwas ist Die Nichtigkeit eines ur α (über einen [partiellen] mismatch zu ur μ fixiert) ist also eine positive Eigenschaft von -ur Grob gesagt: Die Erfahrung des NICHT ist ETWAS ( Das NICHT ist ETWAS) Vgl Ich weiß, dass ich nicht weiß (οἴδα οὐκ εἰδώς, Sokrates in Platon, Apologie 21 St) 3 Typen der Konzeptualisierung des mismatch Ausgangspunkt (so): Die in -ur enthaltenen mismatch-ereignisse werden als kir - Erfahrungen konzeptualisiert: Mismatch ist ein kognitiver Reiz, keine Eigenschaft von UR!oder damit der objektiven Welt
7 Daraus folgt: NEGATION ist keine native (angeborene) Strategie der Kognition, sondern emergent und gekoppelt an den Grad der Bahnung von mismatch-ereignissen Negation ist Teil der Erfahrung, nicht der (UR-)Wahrnehmung In der objektiven Welt gibt es nicht nichts, alles ist etwas Da die Negation aus dem memory-segment heraus (kognitionsintern) wahrgenommen (kir ) und erfahren wird, ist die Negation als konzeptualisiertes Ereignis unmittelbar mit (grosso modo) Wissen verknüpft Wissen heißt hier derjenige Erfahrungskomplex, der in einer UR/KIR-Wahrnehmung aktiviert wird,damit ist Wissen quasi etymologisch gemeint = das, was man gesehen (= wahrgenommen > erfahren) hat} Wissen inkludiert also direkte Erfahrung ebenso wie Präsuppositionen [ich kann nur etwas präsupponieren, was ich schon erfahren habe] Da Negation ein emergentes Ereignis ist muss sie nicht autonomen konzeptualisiert werden Sie kann ebenso gut aus inhärent negationsmarkierten (dh also solche konstruierten) Konzepten abgeleitet und über diese repräsentiert werden Beispiel: Seite 7 Container-Metapher: Der Löffel im Glas Der Löffel außerhalb des Glases = nicht im Glas Negation kann sich emergent in explizit gemachten ur μ/α -matches nach Wahrnehmung eines ur -μ/α (mismatch) ausdrücken Eg: Wenn etwas in etwas ist, dann ist es nicht außerhalb von etwas ur μ/α innen ur -μ/α außen (= nicht innen) Aber: Konzeptuelle Repräsentationen mit inhärenter Negation können auch als negation conflation bezeichnet werden: Konzeptuelle Inkorporation: Eine Konzeptualisierung integriert eine andere Konzeptualisierung ( blending) Beispiel (Nota: Die Konzepte sind hier lexikalisch repräsentiert):
8 {nicht gut} ungut schlecht Nota: Gradierbare Konzepträume (eg Raum der Temperatur-Erfahrung) unterscheiden sich von nicht-gradierbaren Konzepträumen (eg der Raum von Container-Erfahrungen) dahingehend, dass hier der durch die inhärente Negation konzeptualisierte positive Raum (-ur ) schwächer bis kaum fixiert ist, vgl (lexikalisch repräsentiert): heiß ~ nicht-kalt/lau/warm ledig ~ nicht verheiratet innen ~ nicht außen Seite 8 /Temperatur-Erfahrung,nicht heiß -,heiß- /Container-Erfahrung {nicht-innen} {innen} Overte (offen) repräsentierte Konzeptualisierung des mismatch NOTA BENE: Der mismatch von ur μ und ur α in Bezug auf einen UR ist graduell / skalar De facto liegt eine Modalisierung der μ/α-abbildung vor Damit ist zugleich gesagt, dass NEGATION eine modale Strategie darstellt Assertiv μ/α match Schwach Epistemisch-Modal Interrogation Negation schwach μ/α-mismatch Dabei kann der jeweils stärkere Bereich (in der Regel ausgehend von μ/α-match) durch einen (naheliegenden) schwächeren Bereich repräsentiert werden, eg Assertion durch Epistemische Modalität Epistemische Modalität durch Interrogation Interrogation durch Negation
9 Die basale Form der Konzeptualisierung von Negation ist deiktisch (rejection-negation) Basis: Gestisch bzw motorisch repräsentierter mismatch Eg Dynamisch: (American Sign Language) [ Seite 9 Statisch: Cheyenne [ und 13jpg]: no yes Analog: Kopfschütteln [als Negationssignal extrem stark verbreitet; eher horizontale Bewegung favorisiert, stärker vertikale Bewegung ebenso möglich] Basis (vermutlich): Internalisierung der Kopfbewegung des Säuglings weg von der Brust beim Gefühl der Sättigung (= nicht mehr nuckeln ) Negationsgeste als Signal zur Herstellung eines UR-ur μ/α-matches ( praktische Negation ): Beispiel [Ausschnitt aus modifiziert] ur α : Essen ist da ur μ : Satt ur α : Kein Essen da ur μ : Satt Bewegung: Essen entfernen Sprachliche Repräsentation der rejection negation: Negative Deixis, eg nein! (Ostension) Die deiktische Negation ist häufig aus der epistemischen Satz-Negation oder Konstituenten-Negation entlehnt und verallgemeinert Vgl Deutsch nein < *ni ein, Latein nōn < *ne oinom usw Ebenso können gesten-analoge paralinguistische Artikulationen genutzt werden, eg [ɁmɁm], [ɁnɁn] (Deutsch), [ǃ] (click) [Arabisch] usw
10 Schwach bis nicht-deiktische Konzeptualisierungen von mismatch-erfahrungen können in unterschiedlich starker Varianz artikulatorisch repräsentiert werden Problem: Lexikalische Basis der Negation oft genug opak!! Globale, dh formal oder funktional nicht weiter ausdifferenzierte Negationsstrategien reflektieren einen relativ geringen Grad der Markierung spezifischer mismatch- Komponenten In der Regel aber interagieren mismatch-komponenten mit der Negationskonzeptualisierung und zeigen so emergente Spezifikationen der Negation, die sich auch substantiell in den jeweiligen Negationsverfahren äußern (können) Seite 10 Negationsstrategien sind unmittelbar verbunden mit der Architektur von ur oder kir, dh von der schematisierten Abbildung von UR (oder KIR) Jeder UR (in objektivistischer Lesart ein Ereignis ) wird als Ereignisvorstellung gespiegelt (EV), wobei die EV die Grundlage der weitergehenden kognitiven Aktivitäten (eg Spezifikation auf der Konzeptebene, sprachliche Artikulation etc) darstellt, nicht das Ereignis selbst Kognition UR(E) /Sensor /Sensor ur (EV) α ur (EV) μ/a ur (EV) μ Jede Spiegelung eines externen Ereignissen (Geschehen) in der Kognition als Ereignisvorstellung beinhaltet die Aktivierung von ähnlichen EV-Erfahrungen, die die Konstruktion der aktuellen Spiegelung überhaupt erst ermöglichen (so) Keine Wahrnehmung ohne Erfahrung [Zur Schematisierung von Ereignisvorstellungen vgl ua ] Wenn zwischen ur (EV) μ und ur (EV) α in Bezug auf einen UR ein mismatch auftritt (ur (EV) -μ/α, vereinfacht -ur(ev)), dann kann dieser mismatch ausgedrückt werden ua a In Bezug auf die gesamte Ereignisvorstellung; b In Bezug auf Teile der Ereignisvorstellung; c In Bezug auf die in ur μ enthaltene Präsupposition Basis-Architektur der Ereignisvorstellung [vgl
11 EV Seite 11 Da ur μ auch wissens- und damit Zeit-bezogen ist [vgl kann also weitere mismatch-ebene ur μ selbst gelten: ur μ EV Etwa (sprachlich ausgedrückt): Sie ist ins Kino gegangen ur α = kir α Ich weiß, dass kir α Erinnerung ur μ : EV: :sie /gehen :Kino Ereignisvorstellung kir μ : Aktiviert Konzeptualisierung der Erinnerung (PAST) Negiert: Sie ist nicht ins Kino gegangen ur α = kir α Ich weiß, dass kir α Erinnerung ur μ : EV: :sie /gehen :Kino Ereignisvorstellung kir - μ : Aktiviert, mismatch Konzeptualisierung der Erinnerung (PAST) Die Standard-Gestaltung von Ereignisvorstellungen erfolgt in Phrasen (kleinste unabhängige Ausdrucksformen) ur μ EV NP VP NP
12 Da kognitiven Relatoren ( ), sprachlich ausgedrückt in VP (Verbalphrasen) der meronyme Ausdruck von EVen sind, siedeln sich Negation-signalisierende Ausdrücke prototypisch innerhalb der VP an, sofern die Ereignisvorstellung selbst massiv vom mismatch betroffen ist: Beispiel (Deutsch) ur -μ Seite 12 Kognitiv EV Sprachlich NP VP NP Sein Hund spiel-t nicht mit Kindern Nota: In VP-Negationen wird nicht notwendigerweise der Referent ( ) negiert! Aber: Tendenzen, die gesamte Äußerung oder Phrasenkombinationen unter einen Negationston zu stellen, maximal etwa: Eine Frau lief über die Straße -> *Keine Frau lief nicht über keine Straße Besonders häufig: Integration der relationalen Primitive (RP, oder Grammatischen Relation) Objective in den Negationskomplex: Kognitiv RP A O Negation A /NEG O a A(>S) /NEG O /NEG b A O /NEG Beispiel für (a): Russisch: Я не ела мороженн-ого I:NOM NEG eat:past-sg:f ice-cream-gen:sg:nf I did not eat ice-cream Vgl aber: Я ел-а не мороженн-ое а сметан-у I:NOM eat:past-sg:f NEG ice=cream-acc:sg:n but sour=cream-acc:sg:f I did not eat ice-cream but sour cream Мороженное ел-а не я, а сестра ice=cream:acc:sg:n eat:past-sg:f NEG I:NOM but sister:nom:sg It wasn t I who ate ice-cream, but (my) sister Im ersten Satz spiegelt sich (= neg ) die VP-Negation (neg) in der Kasus-Wahl (Genitiv/Partitiv) für O Der für O kanonische Akkusativ bleibt in der Konstituenten-Negation erhalten
13 Beispiel für (b): Deutsch: Ich ess-e k-einen Fisch I:NOM eat:pres-1sg NEG-INDEF:ACC:SG:M fish I do not eat fish ~ Ich esse nicht einen Fisch Seite 13 Nota: *Ich esse nicht keinen Fisch zeigt, dass die Negation in der VP kognitiv erhalten bleibt! Indefinite NP in O-Funktion werden im Deutschen idr durch einen Negator- Transfer (aus der VP) markiert Vgl dagegen: Ich sah das Auto nicht (kein Trannsfer!] NEG-Affizierung der relationalen Primitive ist abhängig vom Rollenaspekt (vgl Schulze 2000, AEC): A O sem sem syn syn pra pra Präferierte Ebene der NEG-Affizierung: 1 Semantische Rolle (Agentivität) bei A 2 Pragmatische Funktion (Affiziertheit/Effiziertheit) bei (O) Wenn eine EV negiert wird, verliert der A-Referent massiv an Agentivität, da die EV selbst als nicht vonstatten gehend konstruiert wird Folge: A wird immer S-ähnlicher Wenn eine EV negiert wird, verliert der O-Referent massiv an Affiziertheit/Effiziertheit, da die EV als nicht Ziel-etablierend konstruiert wird Folge: O wird immer PER-ähnlicher (PER = (als periphär kodierter Referent) Im Ergebnis: Negation von EV bewirkt eine starke Reduktion der kognitiven Transitivität, was sich auch entsprechend sprachlich ausdrücken kann:! Ikonizität: Wenn eine EV als mismatch verarbeitet wird, verlieren (vom meronymen Relator ausgehend) die involvierten Referenten an Rollenqualität Der mismatch wirkt sich also nicht auf die Referenten an sich aus, sondern auf deren Rolleneigenschaften FOLGE: Verbale Negation hat bei transitiven Strukturen eine Intransitivierungswirkung:
14 PER A /NEG O S Seite 14 EV-Negation verstärkt die Asymmetrie zwischen A und O! Analog kann in schwächer transitiven Strukturen (Intransitiva) S (Subjective) in die Peripherie verschoben werden (mit einem neuen S-Dummy): Russisch: У меня не был-о денег at mine NEG be:past-3sg:n money:gen I did not have money Analyse (Topik-Stellung ist unberücksichtigt): денег не=было y=меня S>PER /S LOC Es war nicht bei mir des Geldes S /NEG/DS LOC PER *DS = Dummy S ( es )+ Ist das Verb (kognitiv: der Relator) eine stative Konstruktion (COP + ADJ), dann kann NEG auf ADJ transferiert werden (NEG-Inkorporation): Das Haus [ist nicht] schön > Das Haus ist un-schön Formal: NP:S VP[ /NEG ADV] NP:S VP[ NEG-ADV] Nota: Starke Lexikalisierung von mit alpha privativum markierten Adjektiven! Daher möglich: Das Haus ist nicht un-schön - Wird fortgesetzt - ( Konstituenten-Negation etc / NEG und TAM / NEG als Referenz)
Seminar Verbalflexion Wolfgang Schulze 2008 / WiSe 08/09
 Seminar Verbalflexion Wolfgang Schulze 2008 / WiSe 08/09 1 Kurze (!) Zusammenfassung der Sitzung vom 3.11.08 Ausgangsthese: Verben sind Teil der Artikulation (Versprachlichung) von (Teilen von) Ereignisvorstellungen.
Seminar Verbalflexion Wolfgang Schulze 2008 / WiSe 08/09 1 Kurze (!) Zusammenfassung der Sitzung vom 3.11.08 Ausgangsthese: Verben sind Teil der Artikulation (Versprachlichung) von (Teilen von) Ereignisvorstellungen.
Kognitive Linguistik / / ( Wolfgang Schulze 2008) - Beispielanalyse (1) aus der Sicht des Radical Experientialism -
 Kognitive Linguistik / 10.12.08 / ( Wolfgang Schulze 2008) - Beispielanalyse (1) aus der Sicht des Radical Experientialism - 1 UR http://blog.rbb-online.de/roller/knut/entry/kinder_wie_die_zeit_vergeht
Kognitive Linguistik / 10.12.08 / ( Wolfgang Schulze 2008) - Beispielanalyse (1) aus der Sicht des Radical Experientialism - 1 UR http://blog.rbb-online.de/roller/knut/entry/kinder_wie_die_zeit_vergeht
Wolfgang Schulze. Seminar: Kategorien II Kategorienverwandtschaft W. Schulze Sprachl. Zeichen des Präteritums
 Wolfgang Schulze Seminar: Kategorien II Kategorienverwandtschaft W. Schulze 2013 a. Ausgangspunkt: Der kategorielle Wert sprachlicher Zeichen: Signifié Signifiant KATEGORIE Sprachl. Zeichen einer ling.
Wolfgang Schulze Seminar: Kategorien II Kategorienverwandtschaft W. Schulze 2013 a. Ausgangspunkt: Der kategorielle Wert sprachlicher Zeichen: Signifié Signifiant KATEGORIE Sprachl. Zeichen einer ling.
GK Sprachwissenschaft - Wolfgang Schulze Zusammenfassung der Sitzung vom Syntax - Eine Einführung in die Grundlagen (1)
 Seite1 GK Sprachwissenschaft - Wolfgang Schulze Zusammenfassung der Sitzung vom 16.1.08 Syntax - Eine Einführung in die Grundlagen (1) 1. Ausgangspunkt: Wozu dient Morphologie? Mono-polare (lokale) Morphologie:
Seite1 GK Sprachwissenschaft - Wolfgang Schulze Zusammenfassung der Sitzung vom 16.1.08 Syntax - Eine Einführung in die Grundlagen (1) 1. Ausgangspunkt: Wozu dient Morphologie? Mono-polare (lokale) Morphologie:
Kasus-Typologie ( W. Schulze 2012)
 Kasus-Typologie ( W. Schulze 2012) Definitorische Grundaspekte 1. Kasus sind sprachliche Zeichen, wie jede andere linguistische Struktur auch. Damit gilt grundsätzlich: Signifié = von X Signifiant = Kasus-Form
Kasus-Typologie ( W. Schulze 2012) Definitorische Grundaspekte 1. Kasus sind sprachliche Zeichen, wie jede andere linguistische Struktur auch. Damit gilt grundsätzlich: Signifié = von X Signifiant = Kasus-Form
PS Morphologie - SoSe 09
 PS Morphologie - SoSe 09 Wolfgang Schulze 6. Allomorphie, Polysemie, Homophonie Ausgangspunkt: Ein (Fleions-)Morphem wird über Funktion und bestimmt: Funktion: Abbildung von bzw. Bezug auf Ko(n)tet-Eigenschaften
PS Morphologie - SoSe 09 Wolfgang Schulze 6. Allomorphie, Polysemie, Homophonie Ausgangspunkt: Ein (Fleions-)Morphem wird über Funktion und bestimmt: Funktion: Abbildung von bzw. Bezug auf Ko(n)tet-Eigenschaften
Motorik und Vorstellung
 Motorik und Vorstellung 1. Innere Repräsentation 2. Interferenzen (Hemmungen) zwischen Bewegungssteuerung und räumlichen Vorstellungen 3. Funktionelle Äquivalenz von Bewegungen und Bewegungsvorstellungen
Motorik und Vorstellung 1. Innere Repräsentation 2. Interferenzen (Hemmungen) zwischen Bewegungssteuerung und räumlichen Vorstellungen 3. Funktionelle Äquivalenz von Bewegungen und Bewegungsvorstellungen
Zur Struktur der Verbalphrase
 Zur Struktur der Verbalphrase Ein formales Kriterium zur Verbklassifikation: V ist ein intransitives Verb (ohne Objekte) schlafen, arbeiten, tanzen,... (1) Klaus-Jürgen schläft. V ist ein transitives Verb
Zur Struktur der Verbalphrase Ein formales Kriterium zur Verbklassifikation: V ist ein intransitives Verb (ohne Objekte) schlafen, arbeiten, tanzen,... (1) Klaus-Jürgen schläft. V ist ein transitives Verb
Die Grammatikalisierungsparameter am Beispiel der Modalverben. Grammatikalisierung. Modalverben. Sprachhistorische Aspekte
 Grammatikalisierung Hauptseminar WS 2004/05 Prof. Karin Pittner Die Grammatikalisierungsparameter am Beispiel der Modalverben Modalverben dürfen können mögen müssen sollen Wollen 2 verschiedene Modalverbsysteme
Grammatikalisierung Hauptseminar WS 2004/05 Prof. Karin Pittner Die Grammatikalisierungsparameter am Beispiel der Modalverben Modalverben dürfen können mögen müssen sollen Wollen 2 verschiedene Modalverbsysteme
Wolfgang Wildgen. Kognitive Grammatik. Klassische Paradigmen und neue Perspektiven. Walter de Gruyter Berlin New York
 Wolfgang Wildgen Kognitive Grammatik Klassische Paradigmen und neue Perspektiven wde G Walter de Gruyter Berlin New York Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung und Danksagung 1 1. Sprache und Denken und die Stellung
Wolfgang Wildgen Kognitive Grammatik Klassische Paradigmen und neue Perspektiven wde G Walter de Gruyter Berlin New York Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung und Danksagung 1 1. Sprache und Denken und die Stellung
a) Erklären Sie, was eine SOV Sprache ist und was eine V2 Sprache ist. b) Welche Wortstellungsmuster sind eher selten in Sprachen der Welt?
 Syntax 1) Wortstellung a) Erklären Sie, was eine SOV Sprache ist und was eine V2 Sprache ist. Unter SOV Sprachen verstehen wir all jene Sprachen, die als Grundwortstellung die Reihenfolge Subjekt (S) Objekt
Syntax 1) Wortstellung a) Erklären Sie, was eine SOV Sprache ist und was eine V2 Sprache ist. Unter SOV Sprachen verstehen wir all jene Sprachen, die als Grundwortstellung die Reihenfolge Subjekt (S) Objekt
Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur
 Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur Übersicht: Grammatische Funktionen Kategorien Konstituenten & Strukturbäume Konstituententest Endozentrizität 1 Einfacher Satzbau Drei allgemeine Grundfragen der Syntax:
Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur Übersicht: Grammatische Funktionen Kategorien Konstituenten & Strukturbäume Konstituententest Endozentrizität 1 Einfacher Satzbau Drei allgemeine Grundfragen der Syntax:
Denken Gehörlose anders?
 Denken Gehörlose anders? Untersuchungen zum Einfluss der visuell-gestischen Gebärdensprache vs. der vokal-auditiven Lautsprache auf kognitive Strukturen. Klaudia Grote Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaft
Denken Gehörlose anders? Untersuchungen zum Einfluss der visuell-gestischen Gebärdensprache vs. der vokal-auditiven Lautsprache auf kognitive Strukturen. Klaudia Grote Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaft
Sprachliches Wissen: mentales Lexikon, grammatisches Wissen. Gedächtnis. Psycholinguistik (2/11; HS 2010/2011) Vilnius, den 14.
 Sprachliches Wissen: mentales Lexikon, grammatisches Wissen. Gedächtnis Psycholinguistik (2/11; HS 2010/2011) Vilnius, den 14. September 2010 Das Wissen Beim Sprechen, Hören, Schreiben und Verstehen finden
Sprachliches Wissen: mentales Lexikon, grammatisches Wissen. Gedächtnis Psycholinguistik (2/11; HS 2010/2011) Vilnius, den 14. September 2010 Das Wissen Beim Sprechen, Hören, Schreiben und Verstehen finden
Grammatikanalyse. Prof. Dr. John Peterson. Sprechstunde: Montags, 14:30-15:30h Raum LS10/Raum 425. Sommersemester 2015 Donnerstags, 14:15h-15:45h
 Grammatikanalyse Sommersemester 2015 Donnerstags, 14:15h-15:45h Prof. Dr. John Peterson Sprechstunde: Montags, 14:30-15:30h Raum LS10/Raum 425 1 Termin Thema 16.4. Einführung Zerlegung des Satzes in seine
Grammatikanalyse Sommersemester 2015 Donnerstags, 14:15h-15:45h Prof. Dr. John Peterson Sprechstunde: Montags, 14:30-15:30h Raum LS10/Raum 425 1 Termin Thema 16.4. Einführung Zerlegung des Satzes in seine
Die Partikeln. Adverbien Präpositionen Konjunktionen
 Die Partikeln Adverbien Präpositionen Konjunktionen Gebrauch als adv. Bestimmung Dort liegt ein Buch. Der Ausflug war gestern. Attribut beim Substantiv, Adjektiv oder Adverb Das Buch dort gefällt mir.
Die Partikeln Adverbien Präpositionen Konjunktionen Gebrauch als adv. Bestimmung Dort liegt ein Buch. Der Ausflug war gestern. Attribut beim Substantiv, Adjektiv oder Adverb Das Buch dort gefällt mir.
de Gruyter Studienbuch Kognitive Grammatik Klassische Paradigmen und neue Perspektiven Bearbeitet von Wolfgang Wildgen
 de Gruyter Studienbuch Kognitive Grammatik Klassische Paradigmen und neue Perspektiven Bearbeitet von Wolfgang Wildgen Reprint 2012 2008. Taschenbuch. VIII, 259 S. Paperback ISBN 978 3 11 019600 9 Format
de Gruyter Studienbuch Kognitive Grammatik Klassische Paradigmen und neue Perspektiven Bearbeitet von Wolfgang Wildgen Reprint 2012 2008. Taschenbuch. VIII, 259 S. Paperback ISBN 978 3 11 019600 9 Format
Syntax II. Gereon Müller Institut für Linguistik 4. November Typeset by FoilTEX
 Syntax II Gereon Müller Institut für Linguistik heck@uni-leipzig.de gereon.mueller@uni-leipzig.de 4. November 2014 Typeset by FoilTEX [A] Kasus, 4. Teil [1] Inhärente vs. strukturelle Kasus: Fanselow (1999)
Syntax II Gereon Müller Institut für Linguistik heck@uni-leipzig.de gereon.mueller@uni-leipzig.de 4. November 2014 Typeset by FoilTEX [A] Kasus, 4. Teil [1] Inhärente vs. strukturelle Kasus: Fanselow (1999)
Seminar Verbalflexion Wolfgang Schulze 2008 / WiSe 08/09
 Seminar Verbalflexion Wolfgang Schulze 2008 / WiSe 08/09 1 Kurze (!) Zusammenfassung der Sitzung vom 3.11.08 Ausgangsthese: Verben sind Teil der Artikulation (Versprachlichung) von (Teilen von) Ereignisvorstellungen.
Seminar Verbalflexion Wolfgang Schulze 2008 / WiSe 08/09 1 Kurze (!) Zusammenfassung der Sitzung vom 3.11.08 Ausgangsthese: Verben sind Teil der Artikulation (Versprachlichung) von (Teilen von) Ereignisvorstellungen.
Was leistet Sprache?
 Was leistet Sprache? Elisabeth Leiss Germanistische Linguistik Münchner Wissenschaftstage 20.-23.10.2007 1 Was tun wir, wenn wir Sprache verwenden? Verwenden wir Sprache nur zur Kommunikation? Überspielen
Was leistet Sprache? Elisabeth Leiss Germanistische Linguistik Münchner Wissenschaftstage 20.-23.10.2007 1 Was tun wir, wenn wir Sprache verwenden? Verwenden wir Sprache nur zur Kommunikation? Überspielen
VP vs.?p. N V P N? N P N V Peter kommt nach Hause...dass Peter nach Hause kommt. Syntax V 2
 Syntax V Rechts- vs. Links-Köpfigkeit VL-Sätze als grundlegende Muster funktionale Kategorien IP/CP zum Nachlesen: Grewendorf/Hamm/Sternefeld: Sprachliches Wissen, S. 213-223, Kap. 7.1., 7.2 Syntax V 1
Syntax V Rechts- vs. Links-Köpfigkeit VL-Sätze als grundlegende Muster funktionale Kategorien IP/CP zum Nachlesen: Grewendorf/Hamm/Sternefeld: Sprachliches Wissen, S. 213-223, Kap. 7.1., 7.2 Syntax V 1
Teil 111. Chart-Parsing
 Teil 111 Chart-Parsing 102 Die im ersten Teil des Buches behandelten einfachen Parsingalgorithmen sind, anders als die meisten vor allem im Compilerbau verwendeten Algorithmen (z.b. die LLoder LR-Parsingalgorithmen),
Teil 111 Chart-Parsing 102 Die im ersten Teil des Buches behandelten einfachen Parsingalgorithmen sind, anders als die meisten vor allem im Compilerbau verwendeten Algorithmen (z.b. die LLoder LR-Parsingalgorithmen),
Von Subjekten, Sätzen und Subjektsätzen
 Wilhelm Oppenrieder Von Subjekten, Sätzen und Subjektsätzen Untersuchungen zur Syntax des Deutschen Max Niemeyer Verlag Tübingen 1991 V 0. EINLEITUNG 1 1. SUBJEKTE 3 1.1 Generelle Oberlegungen zu grammatischen
Wilhelm Oppenrieder Von Subjekten, Sätzen und Subjektsätzen Untersuchungen zur Syntax des Deutschen Max Niemeyer Verlag Tübingen 1991 V 0. EINLEITUNG 1 1. SUBJEKTE 3 1.1 Generelle Oberlegungen zu grammatischen
3.4 Direkte vs. indirekte Interpretation
 3 Theorie der λ -Repräsentation 3.4 Direkte vs. indirekte Interpretation In unserer semantischen Analyse natürlichsprachlicher Ausdrücke haben wir bisher die Methode der indirekten Interpretation zugrunde
3 Theorie der λ -Repräsentation 3.4 Direkte vs. indirekte Interpretation In unserer semantischen Analyse natürlichsprachlicher Ausdrücke haben wir bisher die Methode der indirekten Interpretation zugrunde
Die Rolle des Kontextes
 Was ist Sprache? Ein Zeichensystem: Lautäußerungen sind mit Bedeutungen gepaart (gibt es auch schon im Tierreich). Ein kombinatorisches System: verknüpft minimale Zeichen (Lexikonelemente) in berechenbarer
Was ist Sprache? Ein Zeichensystem: Lautäußerungen sind mit Bedeutungen gepaart (gibt es auch schon im Tierreich). Ein kombinatorisches System: verknüpft minimale Zeichen (Lexikonelemente) in berechenbarer
LÖSUNGEN ZU AUFGABE (41)
 DGB 40 Universität Athen, WiSe 2012-13 Winfried Lechner Handout #3 LÖSUNGEN ZU AUFGABE (41) 1. WIEDERHOLUNG: PARAPHRASEN, SITUATIONEN UND AMBIGUITÄT Ein Satz Σ ist ambig, wenn Σ mehr als eine Bedeutung
DGB 40 Universität Athen, WiSe 2012-13 Winfried Lechner Handout #3 LÖSUNGEN ZU AUFGABE (41) 1. WIEDERHOLUNG: PARAPHRASEN, SITUATIONEN UND AMBIGUITÄT Ein Satz Σ ist ambig, wenn Σ mehr als eine Bedeutung
DGm 04 Semantik Universität Athen, SoSe 2010
 DGm 04 Semantik Universität Athen, SoSe 2010 Winfried Lechner wlechner@gs.uoa.gr Handout #1 WAS IST SEMANTIK? 1. BEDEUTUNG Die natürlichsprachliche Semantik untersucht A. die Bedeutung von sprachlichen
DGm 04 Semantik Universität Athen, SoSe 2010 Winfried Lechner wlechner@gs.uoa.gr Handout #1 WAS IST SEMANTIK? 1. BEDEUTUNG Die natürlichsprachliche Semantik untersucht A. die Bedeutung von sprachlichen
Syntax. Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI
 Syntax Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Traditionale Syntaxanalyse Was ist ein Satz? Syntax: ein System von Regeln, nach denen aus einem Grundinventar kleinerer Einheiten (Wörter und Wortgruppen)
Syntax Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Traditionale Syntaxanalyse Was ist ein Satz? Syntax: ein System von Regeln, nach denen aus einem Grundinventar kleinerer Einheiten (Wörter und Wortgruppen)
Musterlösung Übungsblatt 6 ( )
 Seminar: Formale Semantik Modul 04-006-1006: Grammatikorie Seminarleiter: Anke Assmann Musterlösung Übungsblatt 6 (05.06.2013) Abgabe bis 14.06.2013 Institut für Linguistik Universität Leipzig Hinweis:
Seminar: Formale Semantik Modul 04-006-1006: Grammatikorie Seminarleiter: Anke Assmann Musterlösung Übungsblatt 6 (05.06.2013) Abgabe bis 14.06.2013 Institut für Linguistik Universität Leipzig Hinweis:
HAWIK-IV für Fortgeschrittene O.Dichtler/K.Tharandt
 HAWIK-IV für Fortgeschrittene Grundkonzept Das Intelligenzkonzept von Wechsler eine zusammengesetzte oder globale Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner
HAWIK-IV für Fortgeschrittene Grundkonzept Das Intelligenzkonzept von Wechsler eine zusammengesetzte oder globale Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner
// Maximilian Arend, Florian Watterott
 01.06.2016 // Maximilian Arend, Florian Watterott Wohin ist der Genitiv verschwunden? AUSGANGSPUNKT verbabhängige Genitive (sich eines Vorfalls erinnern) sowie nomenabhängige Genitive (das Auto meines
01.06.2016 // Maximilian Arend, Florian Watterott Wohin ist der Genitiv verschwunden? AUSGANGSPUNKT verbabhängige Genitive (sich eines Vorfalls erinnern) sowie nomenabhängige Genitive (das Auto meines
Sprachproduktion. Psycholinguistik (7/11; HS 2010/2011 Vilnius, den 26. Oktober 2010
 Sprachproduktion Psycholinguistik (7/11; HS 2010/2011 Vilnius, den 26. Oktober 2010 Sprachliche Zentren im Gehirn SSSSensorische Funktionen Motorische Funktionen Sprachliche Zentren im Gehirn Generieren
Sprachproduktion Psycholinguistik (7/11; HS 2010/2011 Vilnius, den 26. Oktober 2010 Sprachliche Zentren im Gehirn SSSSensorische Funktionen Motorische Funktionen Sprachliche Zentren im Gehirn Generieren
Optimierung einer technischen Beschreibung. Martin Witzel und Peter Buck
 Optimierung einer technischen Beschreibung Martin Witzel und Peter Buck Was ist eine Bedienungsanleitung? Ein DIN A4 Zettel in 12 Sprachen für die Bedienung eines Mixers? Ein Buch mit mehr als 500 Seiten
Optimierung einer technischen Beschreibung Martin Witzel und Peter Buck Was ist eine Bedienungsanleitung? Ein DIN A4 Zettel in 12 Sprachen für die Bedienung eines Mixers? Ein Buch mit mehr als 500 Seiten
HPSG. Referat zu dem Thema Kongruenz im Englischen Von Anja Nerstheimer
 HPSG Referat zu dem Thema Kongruenz im Englischen Von Anja Nerstheimer Gliederung Einleitung Kongruenz Allgemein Zwei Theorien der Kongruenz Probleme bei ableitungsbasierenden Kongruenztheorien Wie syntaktisch
HPSG Referat zu dem Thema Kongruenz im Englischen Von Anja Nerstheimer Gliederung Einleitung Kongruenz Allgemein Zwei Theorien der Kongruenz Probleme bei ableitungsbasierenden Kongruenztheorien Wie syntaktisch
VL Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Wahrnehmung von Bewegung
 VL Wahrnehmung und Aufmerksamkeit Wahrnehmung von Bewegung Bewegung Bewegung = raum-zeitliche Veränderung Abbild bewegt sich über die Retina retinale Bewegung Objekt zu Zeitpunkt t 1 an Position A; Zeitpunkt
VL Wahrnehmung und Aufmerksamkeit Wahrnehmung von Bewegung Bewegung Bewegung = raum-zeitliche Veränderung Abbild bewegt sich über die Retina retinale Bewegung Objekt zu Zeitpunkt t 1 an Position A; Zeitpunkt
Kognition, Sprache und Gedächtnis. Katharina Fischer und Anja Thonemann
 Kognition, Sprache und Gedächtnis Katharina Fischer und Anja Thonemann 1 Gedächtnisfunktionen und mentales Lexikon 2 Kognitive Einheiten und Strukturen im LZG 2.1 Konzepte und Wortbedeutungen 2.2 Komplexe
Kognition, Sprache und Gedächtnis Katharina Fischer und Anja Thonemann 1 Gedächtnisfunktionen und mentales Lexikon 2 Kognitive Einheiten und Strukturen im LZG 2.1 Konzepte und Wortbedeutungen 2.2 Komplexe
Seminarmaterial zum Abschnitt 12.5 Version vom Deutsche Grammatik verstehen und unterrichten. erarbeitet von Matthias Granzow-Emden
 Seminarmaterial zum Abschnitt 12.5 Version vom 23.01.2014 Deutsche Grammatik verstehen und unterrichten erarbeitet von Matthias Granzow-Emden Die Seminarmaterialien werden sukzessive ergänzt. Kommentar
Seminarmaterial zum Abschnitt 12.5 Version vom 23.01.2014 Deutsche Grammatik verstehen und unterrichten erarbeitet von Matthias Granzow-Emden Die Seminarmaterialien werden sukzessive ergänzt. Kommentar
Dependenz. Ferdinand de Saussure (* )
 Dependenz Dependenz Ferdinand de Saussure (* 26.11.1857 22.2.1913) - Genfer Sprachwissenschaftler - Begründer des Strukturalismus - langue vs. parole - synchron vs. diachron - paradigmatisch vs. syntagmatisch
Dependenz Dependenz Ferdinand de Saussure (* 26.11.1857 22.2.1913) - Genfer Sprachwissenschaftler - Begründer des Strukturalismus - langue vs. parole - synchron vs. diachron - paradigmatisch vs. syntagmatisch
Hubert Haider Die Struktur der deutschen Nominalphrase
 Hubert Haider Die Struktur der deutschen Nominalphrase 1. Grundlegende Bemerkungen zur deutschen Nominalphrase 1.1 Rechtsverzweigung: Wie im Englischen ist die Struktur der deutschen Nominalphrase rechtsverzweigend
Hubert Haider Die Struktur der deutschen Nominalphrase 1. Grundlegende Bemerkungen zur deutschen Nominalphrase 1.1 Rechtsverzweigung: Wie im Englischen ist die Struktur der deutschen Nominalphrase rechtsverzweigend
Zum Kasus der Aktanten
 Prof. Dr. Peter Gallmann Jena, Winter 2017/18 Zum Kasus der Aktanten Grundlage Wunderlich, Dieter (2003): Optimal case patterns: German and Icelandic compared. In: Ellen Brandner & Heike Zinsmeister (eds.):
Prof. Dr. Peter Gallmann Jena, Winter 2017/18 Zum Kasus der Aktanten Grundlage Wunderlich, Dieter (2003): Optimal case patterns: German and Icelandic compared. In: Ellen Brandner & Heike Zinsmeister (eds.):
John R. Searle: Das syntaktische Argument und die Irreduzibilität des Bewusstseins. Institut für Physik und Astronomie Universität Potsdam
 John R. Searle: Das syntaktische Argument und die Irreduzibilität des Bewusstseins Jonathan F. Donges Harald R. Haakh Institut für Physik und Astronomie Universität Potsdam Übersicht Themen 1 Physik, Syntax,
John R. Searle: Das syntaktische Argument und die Irreduzibilität des Bewusstseins Jonathan F. Donges Harald R. Haakh Institut für Physik und Astronomie Universität Potsdam Übersicht Themen 1 Physik, Syntax,
Zwischenbilanz: Projektion und Akkommodation von Präsuppositionen
 Johannes Dölling WiSe 2012/13 Präsupposition, Fokus, Topik Zwischenbilanz: Projektion und Akkommodation von Präsuppositionen 1 Grundsätzliches Präsuppositionen sind Propositionen, die erfüllt sein müssen,
Johannes Dölling WiSe 2012/13 Präsupposition, Fokus, Topik Zwischenbilanz: Projektion und Akkommodation von Präsuppositionen 1 Grundsätzliches Präsuppositionen sind Propositionen, die erfüllt sein müssen,
Satzstruktur und Wortstellung im Deutschen
 Hauptstudium-Linguistik: Syntaxtheorie (DGA 32) WS 2016-17 / A. Tsokoglou Satzstruktur und Wortstellung im Deutschen 2. Satzstruktur und Wortstellung in den deskriptiven Grammatiken Relativ freie Wortstellung
Hauptstudium-Linguistik: Syntaxtheorie (DGA 32) WS 2016-17 / A. Tsokoglou Satzstruktur und Wortstellung im Deutschen 2. Satzstruktur und Wortstellung in den deskriptiven Grammatiken Relativ freie Wortstellung
Psychologie im Handball Trainer-Schiedsrichter-Kommunikation in kritischen Spielsituationen
 Psychologie im Handball Trainer-Schiedsrichter-Kommunikation in kritischen Spielsituationen Dr. Georg Froese DHTV Trainerfortbildung 2013 31.05.2013 Köln 2 Zielstellung Trainer Schiedsrichter Kommunikation
Psychologie im Handball Trainer-Schiedsrichter-Kommunikation in kritischen Spielsituationen Dr. Georg Froese DHTV Trainerfortbildung 2013 31.05.2013 Köln 2 Zielstellung Trainer Schiedsrichter Kommunikation
x : es gibt ein oder mehrere x, auf die zutrifft, dass...
 Björn Wiemer WS 2005/2005 Vorlesung: Einführung in die Linguistik Teil III: Semantik Pragmatik 3. Referenzsemantik: Quantoren, Skopus, Negation etc. Quantoren sind (meta- oder objektsprachliche) Ausdrücke,
Björn Wiemer WS 2005/2005 Vorlesung: Einführung in die Linguistik Teil III: Semantik Pragmatik 3. Referenzsemantik: Quantoren, Skopus, Negation etc. Quantoren sind (meta- oder objektsprachliche) Ausdrücke,
Grundkurs Linguistik Wintersemester 2014/15. Syntax. Anja Latrouite
 Grundkurs Linguistik Wintersemester 2014/15 Syntax Anja Latrouite Von der Morphologie zur Syntax Morpheme sind das Baumaterial für Wörter sind das Baumaterial für Phrasen sind das Baumaterial für Teilsätze
Grundkurs Linguistik Wintersemester 2014/15 Syntax Anja Latrouite Von der Morphologie zur Syntax Morpheme sind das Baumaterial für Wörter sind das Baumaterial für Phrasen sind das Baumaterial für Teilsätze
Semantik. Anke Himmelreich Formale Semantik. Universität Leipzig, Institut für Linguistik 1 / 47
 1 / 47 Semantik Formale Semantik Anke Himmelreich anke.assmann@uni-leipzig.de Universität Leipzig, Institut für Linguistik 09.06.2016 2 / 47 Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen 2 Wahrheitskonditionale
1 / 47 Semantik Formale Semantik Anke Himmelreich anke.assmann@uni-leipzig.de Universität Leipzig, Institut für Linguistik 09.06.2016 2 / 47 Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen 2 Wahrheitskonditionale
Kapitel DB:IV (Fortsetzung)
 Kapitel DB:IV (Fortsetzung) IV. Logischer Datenbankentwurf mit dem relationalen Modell Das relationale Modell Integritätsbedingungen Umsetzung ER-Schema in relationales Schema DB:IV-46 Relational Design
Kapitel DB:IV (Fortsetzung) IV. Logischer Datenbankentwurf mit dem relationalen Modell Das relationale Modell Integritätsbedingungen Umsetzung ER-Schema in relationales Schema DB:IV-46 Relational Design
Können Sie Grundstrukturen, die NLP als Kommunikationsmodell bietet, erklären? Seite 10
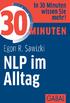 Können Sie Grundstrukturen, die NLP als Kommunikationsmodell bietet, erklären? Seite 10 Was wird bei NLP unter dem Begriff Modellieren verstanden? Seite 11 Kennen Sie die fünf wichtigsten Repräsentationssysteme?
Können Sie Grundstrukturen, die NLP als Kommunikationsmodell bietet, erklären? Seite 10 Was wird bei NLP unter dem Begriff Modellieren verstanden? Seite 11 Kennen Sie die fünf wichtigsten Repräsentationssysteme?
6 höhere Funktionen der Wahrnehmung - Teil 2. Referent: Philipp Schneider
 6 höhere Funktionen der Wahrnehmung - Teil 2 Referent: Philipp Schneider Überblick Agnosien Warringtons zweistufiges Objekterkennungsmodell Prosopagnosie Unterschiede zwischen Gesichts- und Objekterkennung
6 höhere Funktionen der Wahrnehmung - Teil 2 Referent: Philipp Schneider Überblick Agnosien Warringtons zweistufiges Objekterkennungsmodell Prosopagnosie Unterschiede zwischen Gesichts- und Objekterkennung
Syntaktische Kategorien: Phrasenkategorien
 Syntaktische Kategorien: Phrasenkategorien FLM0410 - Introdução à Linguística Alemã I Profa. Dra. Ma. Helena Voorsluys Battaglia Eugenio Braga 8974165 Márcio Ap. de Deus 7000382 Wörter Phrasen Satz Satz
Syntaktische Kategorien: Phrasenkategorien FLM0410 - Introdução à Linguística Alemã I Profa. Dra. Ma. Helena Voorsluys Battaglia Eugenio Braga 8974165 Márcio Ap. de Deus 7000382 Wörter Phrasen Satz Satz
1. Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung
 1. Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten Zufälliger Versuch: Vorgang, der (zumindest gedanklich) beliebig oft wiederholbar ist und dessen Ausgang innerhalb einer
1. Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten Zufälliger Versuch: Vorgang, der (zumindest gedanklich) beliebig oft wiederholbar ist und dessen Ausgang innerhalb einer
Einführung in die Bewegungswissenschaft SS 2007
 Einführung in die SS 2007 Fragen zum Mentalen Was ist? Lässt sich die behauptete Wirkung von Mentalem empirisch nachweisen? Wie lässt sich die Wirkung von Mentalem erklären? Definitionen von Mentalem I...
Einführung in die SS 2007 Fragen zum Mentalen Was ist? Lässt sich die behauptete Wirkung von Mentalem empirisch nachweisen? Wie lässt sich die Wirkung von Mentalem erklären? Definitionen von Mentalem I...
Optimalitätstheoretische Syntax
 Optimalitätstheoretische Syntax Gereon Müller Institut für Linguistik gereon.mueller@uni-leipzig.ch Vorlesung Sommersemester 2005 Kasustheorie [1] Kasustheorie Inhärente vs. strukturelle Kasus: Woolford
Optimalitätstheoretische Syntax Gereon Müller Institut für Linguistik gereon.mueller@uni-leipzig.ch Vorlesung Sommersemester 2005 Kasustheorie [1] Kasustheorie Inhärente vs. strukturelle Kasus: Woolford
Wissen und Repräsentation
 Pädagogik Eric Kolling Wissen und Repräsentation Studienarbeit Universität des Saarlandes Fachbereich 5.1 Erziehungswissenschaft 15. Januar 2002 Proseminar: Lernen, Denken, Gedächtnis WS 2001/02 Proseminararbeit:
Pädagogik Eric Kolling Wissen und Repräsentation Studienarbeit Universität des Saarlandes Fachbereich 5.1 Erziehungswissenschaft 15. Januar 2002 Proseminar: Lernen, Denken, Gedächtnis WS 2001/02 Proseminararbeit:
Linguistische Grundlagen 6. Semantik
 Linguistische Grundlagen 6. Semantik Gereon Müller Institut für Linguistik Universität Leipzig www.uni-leipzig.de/ muellerg Gereon Müller (Institut für Linguistik) 04-006-1001: Linguistische Grundlagen
Linguistische Grundlagen 6. Semantik Gereon Müller Institut für Linguistik Universität Leipzig www.uni-leipzig.de/ muellerg Gereon Müller (Institut für Linguistik) 04-006-1001: Linguistische Grundlagen
2.2.4 Logische Äquivalenz
 2.2.4 Logische Äquivalenz (I) Penélope raucht nicht und sie trinkt nicht. (II) Es ist nicht der Fall, dass Penélope raucht oder trinkt. Offenbar behaupten beide Aussagen denselben Sachverhalt, sie unterscheiden
2.2.4 Logische Äquivalenz (I) Penélope raucht nicht und sie trinkt nicht. (II) Es ist nicht der Fall, dass Penélope raucht oder trinkt. Offenbar behaupten beide Aussagen denselben Sachverhalt, sie unterscheiden
Prinzipien der Ereignisrepräsentation
 Prinzipien der Ereignisrepräsentation Die Kodierung von Ereignissen stellt ein bemerkenswertes Problem dar für die Abbildung von sprachlichen Bedeutungen auf syntaktische Strukturen (die sogenannte >Schnittstelle=
Prinzipien der Ereignisrepräsentation Die Kodierung von Ereignissen stellt ein bemerkenswertes Problem dar für die Abbildung von sprachlichen Bedeutungen auf syntaktische Strukturen (die sogenannte >Schnittstelle=
Syntax und Phonologie: Prosodische Phrasen
 Morphologie und Syntax (BA) Syntax und Phonologie: Prosodische Phrasen PD Dr. Ralf Vogel Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft Universität Bielefeld, SoSe 2007 Ralf.Vogel@Uni-Bielefeld.de 28.6.2007
Morphologie und Syntax (BA) Syntax und Phonologie: Prosodische Phrasen PD Dr. Ralf Vogel Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft Universität Bielefeld, SoSe 2007 Ralf.Vogel@Uni-Bielefeld.de 28.6.2007
2. Überlegen Sie, ob folgende Sprache vom gleichen Typ sind (m, n 1): Ordnen Sie die Sprachen jeweils auf der Chomsky-Hierarchie ein.
 Musterlösung Übung 1 Formale Grammatiken 1. Schreiben Sie eine Grammatik für die Sprache a m b c n d m (m, n 1). Ordnen Sie die Sprache auf der Chomsky-Hierarchie ein und begründen Sie, warum (a) eine
Musterlösung Übung 1 Formale Grammatiken 1. Schreiben Sie eine Grammatik für die Sprache a m b c n d m (m, n 1). Ordnen Sie die Sprache auf der Chomsky-Hierarchie ein und begründen Sie, warum (a) eine
WAS IST KOMMUNIKATION? Vorstellungen über die Sprache
 WAS IST KOMMUNIKATION? Vorstellungen über die Sprache Verständigung gelingt- manchmal Dr. Mario Fox, 2016 0 Grundsätzliches Menschliche Kommunikation dient dem Austausch von Information und entspringt
WAS IST KOMMUNIKATION? Vorstellungen über die Sprache Verständigung gelingt- manchmal Dr. Mario Fox, 2016 0 Grundsätzliches Menschliche Kommunikation dient dem Austausch von Information und entspringt
Seite 1 von Kognition 1 Gestalt und grafische Gestaltung für GUIs
 Seite 1 von 6 5. Kognition 1 Gestalt und grafische Gestaltung für GUIs Wahrnehmung in der Gestaltpsychologie - Entstehung Anfang 20. Jhdt. - Gestalt-Qualitäten beeinflussen das Wahrnehmungserleben - Vertreter:
Seite 1 von 6 5. Kognition 1 Gestalt und grafische Gestaltung für GUIs Wahrnehmung in der Gestaltpsychologie - Entstehung Anfang 20. Jhdt. - Gestalt-Qualitäten beeinflussen das Wahrnehmungserleben - Vertreter:
hypnonlp Notation Inhalt
 Notation hypnonlp Inhalt Idee 3 Repräsentationen 3 Folgen von Repräsentationen 3 Multiple Repräsentationen 5 Beziehungen zwischen Repräsentationen 7 NLP-Notation im Überblick 10 www.hypnonlp.de Seite 1
Notation hypnonlp Inhalt Idee 3 Repräsentationen 3 Folgen von Repräsentationen 3 Multiple Repräsentationen 5 Beziehungen zwischen Repräsentationen 7 NLP-Notation im Überblick 10 www.hypnonlp.de Seite 1
Lange Abhängigkeiten in Brosziewski-Derivationen
 Lange Abhängigkeiten in Brosziewski-Derivationen (UiL-OTS, Universiteit Utrecht) C.Unger@uu.nl GGS, Leipzig, 22. 24. Mai 2009 > Ziel Ziel W-Bewegung in einer derivationellen Syntax mit strikt lokalen Operationen,
Lange Abhängigkeiten in Brosziewski-Derivationen (UiL-OTS, Universiteit Utrecht) C.Unger@uu.nl GGS, Leipzig, 22. 24. Mai 2009 > Ziel Ziel W-Bewegung in einer derivationellen Syntax mit strikt lokalen Operationen,
Grundlagen der LFG. 2. Analysieren Sie jeweils einen der Sätze in (1) und (2), d.h., zeigen Sie, wie die C- und die F-Strukturen aussehen sollten.
 Einführung in die LFG Sommersemester 2010 Universität Konstanz Miriam Butt Lösung 1 Grundlagen der LFG 1 C-structure vs. F-structure 1. Die LFG bedient sich zweier Haupträpresentationsebenen: die C-Strukur
Einführung in die LFG Sommersemester 2010 Universität Konstanz Miriam Butt Lösung 1 Grundlagen der LFG 1 C-structure vs. F-structure 1. Die LFG bedient sich zweier Haupträpresentationsebenen: die C-Strukur
1. Einführung in Temporallogik CTL
 1. Einführung in Temporallogik CTL Temporallogik dient dazu, Aussagen über Abläufe über die Zeit auszudrücken und zu beweisen. Zeit wird in den hier zunächst behandelten Logiken als diskret angenommen
1. Einführung in Temporallogik CTL Temporallogik dient dazu, Aussagen über Abläufe über die Zeit auszudrücken und zu beweisen. Zeit wird in den hier zunächst behandelten Logiken als diskret angenommen
Ich bin mir Gruppe genug
 Ich bin mir Gruppe genug Leben mit Autismus Spektrum bzw. Asperger Syndrom Mag. Karin Moro, Diakoniewerk OÖ. Autismus Spektrum Störung Tiefgreifende Entwicklungsstörung (Beginn: frühe Kindheit) Kontakt-
Ich bin mir Gruppe genug Leben mit Autismus Spektrum bzw. Asperger Syndrom Mag. Karin Moro, Diakoniewerk OÖ. Autismus Spektrum Störung Tiefgreifende Entwicklungsstörung (Beginn: frühe Kindheit) Kontakt-
Einführung Syntaktische Funktionen
 Syntax I Einführung Syntaktische Funktionen Syntax I 1 Syntax allgemein Syntax befasst sich mit den Regeln, mit denen man Wörter zu grammatischen Sätzen kombinieren kann. Es gibt unterschiedliche Modelle
Syntax I Einführung Syntaktische Funktionen Syntax I 1 Syntax allgemein Syntax befasst sich mit den Regeln, mit denen man Wörter zu grammatischen Sätzen kombinieren kann. Es gibt unterschiedliche Modelle
2.2.2 Semantik von TL. Menge der Domänen. Zu jedem Typ gibt es eine Menge von möglichen Denotationen der Ausdrücke dieses Typs.
 2.2.2 Semantik von TL Menge der Domänen Zu jedem Typ gibt es eine Menge von möglichen Denotationen der Ausdrücke dieses Typs. Diese Menge wird Domäne des betreffenden Typs genannt. Johannes Dölling: Formale
2.2.2 Semantik von TL Menge der Domänen Zu jedem Typ gibt es eine Menge von möglichen Denotationen der Ausdrücke dieses Typs. Diese Menge wird Domäne des betreffenden Typs genannt. Johannes Dölling: Formale
IMPULehrerSchülerEltern IMPULeitbildSozialcurriculumErziehungspartnerschaft
 IMPULehrerSchülerEltern IMPULeitbildSozialcurriculumErziehungspartnerschaft Lernen lernen Tipps und Strategien WB 1 Ein thematischer Abend für Eltern und LehrerInnen der Klasse 5 Vorschau I. Begriff des
IMPULehrerSchülerEltern IMPULeitbildSozialcurriculumErziehungspartnerschaft Lernen lernen Tipps und Strategien WB 1 Ein thematischer Abend für Eltern und LehrerInnen der Klasse 5 Vorschau I. Begriff des
Nachhaltigkeit des Lernens aus neurobiologischer Sicht
 Studienseminar Koblenz Teildienststelle Altenkirchen Nachhaltigkeit des Lernens aus neurobiologischer Sicht Wie erreichen wir aus neurobiologischer Sicht ein nachhaltiges Lernen? Unterrichtsprinzipien
Studienseminar Koblenz Teildienststelle Altenkirchen Nachhaltigkeit des Lernens aus neurobiologischer Sicht Wie erreichen wir aus neurobiologischer Sicht ein nachhaltiges Lernen? Unterrichtsprinzipien
5 Benutzungsoberfläche
 5 Mit Ausnahme der in Kapitel 4.1 beschriebenen ÜNs wurde das Verfahren zur Transformation von Hauptansprüchen als JAVA-Anwendung implementiert. Die Anwendung, genannt ClaimTransformer, umfasst zusätzlich
5 Mit Ausnahme der in Kapitel 4.1 beschriebenen ÜNs wurde das Verfahren zur Transformation von Hauptansprüchen als JAVA-Anwendung implementiert. Die Anwendung, genannt ClaimTransformer, umfasst zusätzlich
Introduction to Data and Knowledge Engineering
 Introduction to Data and Knowledge Engineering Sommersemester 2015 Robert Rehner Tutorium 5: Syntheseverfahren Lösungsvorschlag Aufgabe 5.1: Verbundtreue Angenommen, Sie haben eine Relation R = ABCDEF
Introduction to Data and Knowledge Engineering Sommersemester 2015 Robert Rehner Tutorium 5: Syntheseverfahren Lösungsvorschlag Aufgabe 5.1: Verbundtreue Angenommen, Sie haben eine Relation R = ABCDEF
funktionale Abhängigkeiten: Semantik funktionale Abhängigkeiten: Syntax
 funktionale Abhängigkeiten: Syntax < R U F > ein Relationenschema mit R ein Relationensymbol, U eine Menge von Attributen, F eine Menge von funktionalen Abhängigkeiten (über R und U) Eine funktionale Abhängigkeit
funktionale Abhängigkeiten: Syntax < R U F > ein Relationenschema mit R ein Relationensymbol, U eine Menge von Attributen, F eine Menge von funktionalen Abhängigkeiten (über R und U) Eine funktionale Abhängigkeit
Einführung in die Semantik, 10. Sitzung Generalisierte Quanto
 Einführung in die Semantik, 10. Sitzung Generalisierte Quantoren, NPIs und Negation Göttingen 3. Januar 2007 Generalisierte Quantoren Prädikatenlogik Typentheorie Bedeutung von GQs Monotonizität GQs und
Einführung in die Semantik, 10. Sitzung Generalisierte Quantoren, NPIs und Negation Göttingen 3. Januar 2007 Generalisierte Quantoren Prädikatenlogik Typentheorie Bedeutung von GQs Monotonizität GQs und
Funktionale-Grammatik
 Lexikalisch-Funktionale Funktionale-Grammatik Generative Transformations-Grammatik Kompetenz vs. Performanz Was heißt generativ? Tiefenstruktur vs. Oberflächenstruktur Architektur der GTG Weiterentwicklungen
Lexikalisch-Funktionale Funktionale-Grammatik Generative Transformations-Grammatik Kompetenz vs. Performanz Was heißt generativ? Tiefenstruktur vs. Oberflächenstruktur Architektur der GTG Weiterentwicklungen
Seminar Ib Wort, Name, Begriff, Terminus Sommersemester Morphologie. Walther v.hahn. v.hahn Universität Hamburg
 Seminar Ib Wort, Name, Begriff, Terminus Sommersemester 2006 Morphologie Walther v.hahn v.hahn Universität Hamburg 2005 1 Morphologie: Definition Definitionen: Morphologie ist die Lehre von den Klassen
Seminar Ib Wort, Name, Begriff, Terminus Sommersemester 2006 Morphologie Walther v.hahn v.hahn Universität Hamburg 2005 1 Morphologie: Definition Definitionen: Morphologie ist die Lehre von den Klassen
Selective visual attention ensures constancy of sensory representations: Testing the influence of perceptual load and spatial competition
 Selective visual attention ensures constancy of sensory representations: Testing the influence of perceptual load and spatial competition Detlef Wegener, F. Orlando Galashan, Dominique N. Markowski, Andreas
Selective visual attention ensures constancy of sensory representations: Testing the influence of perceptual load and spatial competition Detlef Wegener, F. Orlando Galashan, Dominique N. Markowski, Andreas
Psychotherapeutische Praxis und Institut für Supervision und Weiterbildung. Trauma und Bindung
 Psychotherapeutische Praxis und Institut für Supervision und Weiterbildung Trauma und Bindung Auswirkungen erlebter Traumatisierung auf die Mutter-Kind-Beziehung Trauma Was kennzeichnet ein Trauma? Ausgangspunkt:
Psychotherapeutische Praxis und Institut für Supervision und Weiterbildung Trauma und Bindung Auswirkungen erlebter Traumatisierung auf die Mutter-Kind-Beziehung Trauma Was kennzeichnet ein Trauma? Ausgangspunkt:
Nervensystem Gliederung des Nervensystems der Wirbeltiere
 Nervensystem Gliederung des Nervensystems der Wirbeltiere Aufgaben Welche Aufgaben erfüllt das Nervensystem? - Welche Vorgänge laufen bei einer Reaktion ab? - Was ist das Ziel der Regulation? - Was ist
Nervensystem Gliederung des Nervensystems der Wirbeltiere Aufgaben Welche Aufgaben erfüllt das Nervensystem? - Welche Vorgänge laufen bei einer Reaktion ab? - Was ist das Ziel der Regulation? - Was ist
Überbestimmte lineare Gleichungssysteme
 Überbestimmte lineare Gleichungssysteme Fakultät Grundlagen September 2009 Fakultät Grundlagen Überbestimmte lineare Gleichungssysteme Übersicht 1 2 Fakultät Grundlagen Überbestimmte lineare Gleichungssysteme
Überbestimmte lineare Gleichungssysteme Fakultät Grundlagen September 2009 Fakultät Grundlagen Überbestimmte lineare Gleichungssysteme Übersicht 1 2 Fakultät Grundlagen Überbestimmte lineare Gleichungssysteme
5 Verteilte Algorithmen. vs5 1
 5 Verteilte Algorithmen vs5 1 Charakterisierung eines verteilten Systems? Prozesse als Systemkomponenten: Spezifikation eines Prozesses (Vgl. Spezifikation eines ADT) syntaktisch: z.b. Ports oder Parameter
5 Verteilte Algorithmen vs5 1 Charakterisierung eines verteilten Systems? Prozesse als Systemkomponenten: Spezifikation eines Prozesses (Vgl. Spezifikation eines ADT) syntaktisch: z.b. Ports oder Parameter
Logik und modelltheoretische Semantik. Grundlagen zum Bedeutung-Text-Modell (BTM)
 Logik und modelltheoretische Semantik Grundlagen zum Bedeutung-Text-Modell (BTM) Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 13.6.2017 Zangenfeind: BTM 1 / 26 Moskauer
Logik und modelltheoretische Semantik Grundlagen zum Bedeutung-Text-Modell (BTM) Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 13.6.2017 Zangenfeind: BTM 1 / 26 Moskauer
Die Neurobiologischen Bedingungen Menschlichen Handelns. Peter Walla
 Die Neurobiologischen Bedingungen Menschlichen Handelns 3 wichtige Sichtweisen der Neurobiologie 1. Das Gehirn produziert kontrolliertes Verhalten (somit auch jegliches Handeln) 2. Verhalten ist gleich
Die Neurobiologischen Bedingungen Menschlichen Handelns 3 wichtige Sichtweisen der Neurobiologie 1. Das Gehirn produziert kontrolliertes Verhalten (somit auch jegliches Handeln) 2. Verhalten ist gleich
4. Lernen von Entscheidungsbäumen
 4. Lernen von Entscheidungsbäumen Entscheidungsbäume 4. Lernen von Entscheidungsbäumen Gegeben sei eine Menge von Objekten, die durch Attribut/Wert- Paare beschrieben sind. Jedes Objekt kann einer Klasse
4. Lernen von Entscheidungsbäumen Entscheidungsbäume 4. Lernen von Entscheidungsbäumen Gegeben sei eine Menge von Objekten, die durch Attribut/Wert- Paare beschrieben sind. Jedes Objekt kann einer Klasse
SS 09: Klinische Linguistik
 SS 09: Klinische Linguistik Gebärdensprache und Gehirn Helen Leuninger Gebärdensprache und Gehirn Sprache und Raum Ikonizität Speicherung der Mimik im Gehirn 2 Klassen von Studien: Läsionsstudien Bildgebende
SS 09: Klinische Linguistik Gebärdensprache und Gehirn Helen Leuninger Gebärdensprache und Gehirn Sprache und Raum Ikonizität Speicherung der Mimik im Gehirn 2 Klassen von Studien: Läsionsstudien Bildgebende
Einführung in die mathematische Logik
 Prof. Dr. H. Brenner Osnabrück SS 2016 Einführung in die mathematische Logik Arbeitsblatt 3 Übungsaufgaben Aufgabe 3.1. Beweise mittels Wahrheitstabellen, dass die folgenden Aussagen Tautologien sind.
Prof. Dr. H. Brenner Osnabrück SS 2016 Einführung in die mathematische Logik Arbeitsblatt 3 Übungsaufgaben Aufgabe 3.1. Beweise mittels Wahrheitstabellen, dass die folgenden Aussagen Tautologien sind.
3. Kcmstrufftirismus. Der Mensch "konstruiert" sich seine Welt. Ist die Welt so, wie wir annehmen?
 Der Mensch "konstruiert" sich seine Welt. Ist die Welt so, wie wir annehmen? 3. Kcmstrufftirismus Können wir etwas von einer "wirklichen Wirklichkeit" - der Realität außerhalb von uns selbst - wissen?
Der Mensch "konstruiert" sich seine Welt. Ist die Welt so, wie wir annehmen? 3. Kcmstrufftirismus Können wir etwas von einer "wirklichen Wirklichkeit" - der Realität außerhalb von uns selbst - wissen?
Behaviorismus und Nativismus im Erstspracherwerb
 Behaviorismus und Nativismus im Erstspracherwerb 13-SQM-04 (Naturwissenschaft für Querdenker) 09.07.2015 Simeon Schüz Gliederung 1. Einleitung 2. Die Behavioristische Hypothese 2.1 Grundlegende Annahmen
Behaviorismus und Nativismus im Erstspracherwerb 13-SQM-04 (Naturwissenschaft für Querdenker) 09.07.2015 Simeon Schüz Gliederung 1. Einleitung 2. Die Behavioristische Hypothese 2.1 Grundlegende Annahmen
6 Pragmatik. Kerstin Schwabe (& Hubert Truckenbrodt) WS 2009/10 1
 Kerstin Schwabe (& Hubert Truckenbrodt) WS 2009/10 1 6.1 Gegenstand Gegenstand/Abgrenzung Semantik Pragmatik 3 Auffassungen, die sich überschneiden. Was Pragmatik genau zu untersuchen hat, ist umstritten.
Kerstin Schwabe (& Hubert Truckenbrodt) WS 2009/10 1 6.1 Gegenstand Gegenstand/Abgrenzung Semantik Pragmatik 3 Auffassungen, die sich überschneiden. Was Pragmatik genau zu untersuchen hat, ist umstritten.
Einführung in die portugiesische Sprachwissenschaft
 Annette Endruschat Jürgen Schmidt-Radefeldt Einführung in die portugiesische Sprachwissenschaft Gunter Narr Verlag Tübingen Inhalt Vorwort 9 Abkürzungen und Abbildungsverzeichnis 12 1 Weltsprache Portugiesisch
Annette Endruschat Jürgen Schmidt-Radefeldt Einführung in die portugiesische Sprachwissenschaft Gunter Narr Verlag Tübingen Inhalt Vorwort 9 Abkürzungen und Abbildungsverzeichnis 12 1 Weltsprache Portugiesisch
Argumentationstheorie 4. Sitzung
 Noch ein Beispiel Argumentationstheorie 4. Sitzung Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2004/5 empirische Hypothese (P1) echte Noch ein Beispiel Noch ein Beispiel empirische Hypothese (P1) Ein metaphysischer
Noch ein Beispiel Argumentationstheorie 4. Sitzung Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2004/5 empirische Hypothese (P1) echte Noch ein Beispiel Noch ein Beispiel empirische Hypothese (P1) Ein metaphysischer
Probeklausur: Einführung in die formale Grammatiktheorie
 Probeklausur: Einführung in die formale Grammatiktheorie Prof. Dr. Stefan Müller Deutsche Grammatik Freie Universität Berlin Stefan.Mueller@fu-berlin.de 16. Juli 2016 Name und Vorname: Matrikelnummer:
Probeklausur: Einführung in die formale Grammatiktheorie Prof. Dr. Stefan Müller Deutsche Grammatik Freie Universität Berlin Stefan.Mueller@fu-berlin.de 16. Juli 2016 Name und Vorname: Matrikelnummer:
4.3 NPn als Objekte oder als Prädikative [Chierchia , Lohnstein ]
![4.3 NPn als Objekte oder als Prädikative [Chierchia , Lohnstein ] 4.3 NPn als Objekte oder als Prädikative [Chierchia , Lohnstein ]](/thumbs/61/45932266.jpg) 4 Semantik von Nominalphrasen 4.3 NPn als Objekte oder als Prädikative [Chierchia 147-168, Lohnstein 185-196] 4.3.1 Quantifizierende NPn in Objektposition Steht eine quantifizierende NP nicht in Subjekt-,
4 Semantik von Nominalphrasen 4.3 NPn als Objekte oder als Prädikative [Chierchia 147-168, Lohnstein 185-196] 4.3.1 Quantifizierende NPn in Objektposition Steht eine quantifizierende NP nicht in Subjekt-,
Das visuelle System. Das Sehen von Kanten: Das Sehen von Kanten ist eine trivial klingende, aber äußerst wichtige Funktion des visuellen Systems!
 Das Sehen von Kanten: Das Sehen von Kanten ist eine trivial klingende, aber äußerst wichtige Funktion des visuellen Systems! Kanten definieren die Ausdehnung und die Position von Objekten! Eine visuelle
Das Sehen von Kanten: Das Sehen von Kanten ist eine trivial klingende, aber äußerst wichtige Funktion des visuellen Systems! Kanten definieren die Ausdehnung und die Position von Objekten! Eine visuelle
Stereotypes as Energy-Saving Devices
 Stereotypes as Energy-Saving Devices Stereotype 2012 Henrik Singmann Was sind die vermuteten Vorteile davon Stereotype zu benutzen und was wäre die Alternative zum Stereotyp Gebrauch? Welche bisherige
Stereotypes as Energy-Saving Devices Stereotype 2012 Henrik Singmann Was sind die vermuteten Vorteile davon Stereotype zu benutzen und was wäre die Alternative zum Stereotyp Gebrauch? Welche bisherige
Pragmatik in der Sprache und im Comic. Präsupposition und Inferenz; kommunikative Relevanz
 Pragmatik in der Sprache und im Comic Präsupposition und Inferenz; kommunikative Relevanz Gliederung 1. Definition Pragmatik 2. Fragestellungen in der Pragmatik 3. Sprechakte nach Searle 4. Konversationsmaxime
Pragmatik in der Sprache und im Comic Präsupposition und Inferenz; kommunikative Relevanz Gliederung 1. Definition Pragmatik 2. Fragestellungen in der Pragmatik 3. Sprechakte nach Searle 4. Konversationsmaxime
