2 Soziales Handeln in Rollen und Institutionen
|
|
|
- Hedwig Wagner
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 2.1 Rolle als Kategorie der Sozialstruktur 39 2 Soziales Handeln in Rollen und Institutionen Einleitung Der Begriff "soziale Rolle" wurde als Grundbegriff erst relativ spät in die Soziologie aufgenommen, hat dann allerdings eine ungewöhnliche Karriere durchlaufen. Am Rollenkonzept entzündete sich Anfang der 1960er Jahre ein grundlegender Streit zwischen "Funktionalisten" und "Interaktionisten", der auch für die heutige Diskussion der soziologischen Handlungstheorie bedeutsam ist. Anfang der 1970er Jahre wurden an den meisten Universitäten regelmäßige Lehrveranstaltungen zum Thema Rollentheorie angeboten. Mittlerweile hat der Rollenbegriff seine exponierte Stellung in der soziologischen Theoriediskussion an Begriffe wie Frame und Organisation abgetreten, wird aber weiterhin als Standardinstrument in konkreten soziologischen Studien verwendet. Diese Selbstverständlichkeit in der Anwendung ist ein Hinweis darauf, dass sich Rolle als Grundbegriff der Soziologie etabliert hat. Für die im Einleitungskapitel erwähnte Kontroverse zwischen dem normativen und dem interpretativen Paradigma hat die Rollentheorie eine doppelte Bedeutung. Einerseits entzündete sich - wissenschafts-historisch betrachtet - der Streit dieser beiden Paradigmen am Rollenbegriff und andererseits bildet die Rollentheorie ein konkretes Beispiel, an dem sich die unterschiedlichen Perspektiven aufzeigen lassen. Um in den nachfolgenden Kapiteln dem Leser die Übersicht zu erleichtern, werden wir zu jedem Ansatz die Grundidee, den Bezugsrahmen, explizite Modelle und Musterbeispiele darstellen. Der "Bezugsrahmen" besteht aus den Grundbegriffen sowie deren logischen Beziehungen zueinander. Kombiniert man Elemente des Bezugsrahmens, um bestimmte soziale Strukturen und Prozesse zu beschreiben und die zugrunde liegenden Mechanismen zu erklären, so ergeben sich explizite Modelle. Nach Kuhn (1978, 1979) gehören der begriffliche Rahmen und die Modelle zur ersten Bedeutung des Begriffs Paradigma. Zusätzlich umfasst der Begriff Paradigma die Kenntnis der konkreten Vorgehensweise einer wissenschaftlichen Disziplin, die sich an Musterbeispielen demonstrieren lässt. Daher werden die einzelnen Handlungstheorien auf Beispiele angewendet, um die Argumentationsweise exemplarisch vorzuführen Rolle als Kategorie der Sozialstruktur Der Rollenbegriff als soziologische Kategorie wurde von Linton eingeführt und dann von den Vertretern der "strukturell-funktionalen" Theorie, Parsons und Merton, in die soziolo10 Das zugrunde liegende Schema von Bezugsrahmen, expliziten Modellen und Musterbeispielen ist eine vereinfachte Version der "strukturalistischen" Wissenschaftstheorie, die der Philosoph W. Stegmüller (1973, 1979) entwickelt hat, um die Ideen Kuhns zu systematisieren. Eine Anwendung auf das Verhältnis von Theorie und Empirie bei Parsons findet sich in Miebach (1984: Kap. 2). B. Miebach, Soziologische Handlungstheorie, DOI / _2, Springer Fachmedien Wiesbaden 2014
2 40 2 Soziales Handeln in Rollen und Institutionen gische Theorie integriert. Neben der Definition grundlegender Begriffe wie Status, Position, Rolle und Rollenkonflikt entwickeln diese Autoren bereits explizite Modelle zur Rollenanalyse im Rahmen des normativen Paradigmas. Vor allem Mertons Studie zu den strukturellen Mechanismen der Verhinderung und Lösung von Intrarollenkonflikten stellt eine exemplarische Anwendung der strukturtheoretischen Denkweise auf eine soziologische Fragestellung dar. Durch den Vergleich des Mertonschen Rollen-Sets mit alternativen Arbeiten zum Rollenkonflikt, in denen die Strategien und Initiativen des Rollenhandelnden und nicht der strukturelle Rahmen betrachtet wird, lässt sich die unterschiedliche Argumentation der strukturellen und interaktionistischen Rollentheoretiker exemplarisch verdeutlichen. Im ersten Teil des nachfolgenden Abschnitts werden die klassischen Definitionen des Rollenbegriffs durch Linton und Parsons dargestellt, im zweiten Teil das Mertonsche Modell des Rollen-Sets vorgeführt und im dritten Teil die interaktionistische Erweiterung diskutiert Rolle und Position Ralph Linton ( ) führt in seinem Buch "The Study of Man" (1936) den soziologischen Rollenbegriff ein und entwickelt ihn in dem Werk "The Cultural Background of Personality" (1947) zu einer sozialstrukturellen Kategorie weiter, die dann von den Vertretern des normativen Paradigmas aufgegriffen wurde. 11 Mead, einer der Begründer des interpretativen Paradigmas, verwendet den Rollenbegriff bereits früher als Linton im Rahmen seiner Vorlesungen, 12 in denen er die Identitätsentwicklung des Individuums als Prozess der Rollenübernahme interpretiert (1978). Die Grundidee des Rollenkonzepts besteht darin, dass an die Mitglieder einer Gesellschaft in bestimmten sozialen Situationen Verhaltenserwartungen gerichtet werden, die jeder Rollenhandelnde auf etwa gleiche Weise erfüllt. Somit bezieht sich der Rollenbegriff auf ein regelmäßig ablaufendes Verhalten, das in bestimmten Situationen von den Mitgliedern einer Gesellschaft erwartet wird. Diese Definition reicht allerdings nicht aus, wie man sich am Beispiel des Händeschüttelns verdeutlichen kann. Obwohl das Händeschütteln in der Situation der Begrüßung allgemein erwartet wird, spricht man nicht von der Rolle des Händeschüttlers. Um solche Fälle auszuschließen, muss der Rollenbegriff weiter eingegrenzt werden, indem man zusätzlich voraussetzt, dass der Rollenträger einen bestimmten Platz in der gesellschaftlichen Ordnung einnimmt. Dieser Platz kann zum einen durch eine bestimmte Funktion der Rolle für die Gesellschaft definiert werden, wie bei Lehrern die Funktion der Erziehung von Schulkindern. Zum anderen kann sich der Platz des Rollenträgers aus der Mitgliedschaft in einer Gruppe ergeben. Dies trifft z.b. auf die Rolle des Kindes in der Familie zu. In beiden Fällen ist der Platz in der Gesellschaft mit Rechten und Pflichten ausgestattet, die das Rollenhandeln in bestimmte Bahnen lenkt. Es war Lintons Idee, den Platz eines Individuums zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten System als Status bzw. Position zu definieren (1973: 311). Während Linton beide Begriffe als gleichbedeutend auffasst, bevorzugt die neuere Rollentheorie den Begriff Position für den Platz des Rollenträgers in der Gesellschaft. Status wird dagegen mit Presti- 11 Zur Geschichte der Rollentheorie vgl. Wiswede (1977). Wir werden uns im nachfolgenden Text auf einen Auszug aus Lintons " The Cultural Background of Personality" (1973) beziehen. 12 Vorlesungsmitschriften von 1927 und 1930 wurden 1934 nach dem Tode Meads von dessen Schüler C.W. Morris publiziert: Mead (1978).
3 2.1 Rolle als Kategorie der Sozialstruktur 41 ge in Verbindung gebracht und als Ort eines Individuums auf einer Rangskala der Wertschätzung definiert (Dahrendorf 1974: 68). Nach Linton soll der Begriff Rolle "die Gesamtheit der kulturellen Muster bezeichnen, die mit einem bestimmten Status verbunden sind" (1973: 311). Diese kulturellen Muster umfassen Verhaltensweisen, Einstellungen und Wertvorstellungen des Statusinhabers (1973: 311). Den Kern der Rolle bilden allerdings die Verhaltensweisen, so dass sich die Rolle als dynamischer Aspekt eines Status ergibt (1973: 312). Linton geht von der Annahme aus, dass das Rollenhandeln eines Statusinhabers von allen Systemmitgliedern in gleicher Weise erwartet wird und dass ein Individuum mehr als einen Status innehat (1973: 312). Dadurch kann es - wie wir heute sagen - zu Interrollenkonflikten zwischen den unterschiedlichen Rollen eines Individuums kommen. Man denke etwa an den Konflikt eines parteipolitisch engagierten Lehrers, im Politikunterricht ein ausgewogenes Meinungsbild zu vermitteln. In modernen Gesellschaften werden häufig unterschiedliche Erwartungen an einen Positionsinhaber gerichtet. So steht ein Industriemeister im Spannungsfeld von Erwartungen der Unternehmensleitung und der ihm unterstellten Facharbeiter. Dieser Interrollenkonflikt wird in Lintons Rollendefinition nicht berücksichtigt, da alle Gesellschaftsmitglieder dieselben Verhaltensweisen erwarten. Rollen können nach Linton zugeschrieben oder erworben sein (1973: 310). So ist die Rolle des Kindes in der Familie nicht von bestimmten Vorleistungen abhängig, so dass die Kinderrolle als zugeschrieben bzw. askriptiv gilt, wogegen die Berufsrolle durch bestimmte Leistungen erworben wird. In traditionellen Gesellschaften, wie der mittelalterlichen Ständegesellschaft, wurden auch Berufsrollen durch Geburt zugeschrieben, während der Erwerb von Rollen durch individuelle Leistungen ein Merkmal moderner Industriegesellschaften ist. Wegen der Betonung des Leistungsaspekts spricht man von einer meritokratischen Gesellschaftsform. Allerdings hat der Erwerb der Berufsrolle in modernen Industriegesellschaften auch askriptive Züge, wenn z.b. beim Berufseintritt von Jugendlichen nicht die Qualifikation des Bewerbers, sondern die guten Beziehungen der Eltern den Ausschlag geben. Der französische Soziologe Raymond Boudon bezeichnet diesen Einfluss des elterlichen Sozialstatus auf den Berufsstatus der Jugendlichen als Dominanzeffekt (1979: 77) im Gegensatz zum meritokratischen Effekt. 13 Mit der Unterscheidung von zugeschriebenen und erworbenen Rollen führt Linton ein Merkmal zur Klassifikation von Rollen ein. Da dieses Merkmal zwei Ausprägungen hat, sprechen wir von einer dichotomen Variablen. Die Idee, dichotome Merkmale zur Beschreibung von Rollen zu verwenden, hat vor allem Parsons innerhalb der Soziologie weiterentwickelt. Die akademische Profession, für die besonders die Rollen des Wissenschaftlers und des Arztes typisch sind, beschreibt Parsons 1939 als "rational", "funktional spezifisch" und "universalistisch" (1973b). Damit klassifiziert Parsons eine bestimmte Rolle durch eine Kombination von Ausprägungen der drei dichotomen Variablen "rational versus nicht-rational", "spezifisch versus diffus" und "universalistisch versus partikularistisch" In seiner Auswertung von Daten zum französischen Bildungssystem zeigt Boudon folgenden "paradoxen Effekt" auf: Selbst unter der Annahme einer rein meritokratischen Gesellschaftsform führt die Zunahme von höheren Bildungsabschlüssen nicht dazu, dass mehr Kinder aus unteren sozialen Schichten in höhere Positionen aufsteigen (Boudon 1979: 85). Der Grund hierfür liegt in der Tatsache, dass die Zunahme von höheren Ausbildungsabschlüssen nicht mit einer Vermehrung höherer Berufspositionen einherging. 14 Diese Merkmale werden später von Parsons zu den "Pattern Variables" weiterentwickelt: "diffus versus spezifisch", "affektiv versus affektiv neutral", "partikularistisch versus universalistisch", "qualitativ versus performativ" und "selbstorientiert versus kollektivorientiert" (Miebach 1984: ).
4 42 2 Soziales Handeln in Rollen und Institutionen Während Linton in seiner Definition der Rolle den sozial-kulturellen Aspekt gleichförmiger Einstellungen, Wertvorstellungen und Verhaltensweisen betont, die mit einer Position verbunden sind, lenkt Parsons mit seiner Rollendefinition die Aufmerksamkeit auf die Wechselbeziehung zwischen der Sozialstruktur und der Persönlichkeit der Akteure. Individuen nehmen am gesellschaftlichen Leben teil, indem sie vorgegebene soziale Rollen spielen. Entscheidend ist dabei, dass Rollen jeweils nur einen bestimmten Ausschnitt (Parsons 1973c: 55) der Persönlichkeit aktivieren. So wird in den meisten Berufsrollen die Privatsphäre des Rollenträgers weitgehend ausgeblendet. Die Grenzen des Ausschnitts aus der Persönlichkeit in Berufsrollen können aber sehr unterschiedlich abgesteckt sein. Während in Professionen, wie z.b. Ärzte oder Juristen, die individuelle Gestaltung und das Einbringen der Gesamtpersönlichkeit als Maßstab für die Qualität der Ausfüllung der Rolle gelten kann, wird bei untergeordneten mechanischen Tätigkeiten ein eng umgrenztes Verhaltensrepertoire gefordert, das nur einen kleinen Ausschnitt der Persönlichkeit anspricht (vgl. Osterland 1975). Im Falle der Reduktion des persönlichen Engagements auf ein Minimum wird dem Rolleninhaber kaum Gelegenheit gegeben, sich mit seiner Tätigkeit zu identifizieren und sein Bedürfnis nach beruflicher Verwirklichung zu befriedigen. Die Folge ist mangelnde Arbeitsmotivation und das Gefühl der Entfremdung von der Berufsrolle. Nach Parsons haben Berufsrollen aber gerade die Funktion, dass Individuen sich mit Rollen identifizieren können und auf diese Weise in die soziale Struktur integriert werden. Neben der Identifikation mit der Rolle und der damit verbundenen Motivation des Positionsinhabers, die Rolle auszufüllen, wird die Einhaltung von Rollenpflichten durch Sanktionen abgesichert, die aus Belohnungen wie finanziellen Anreizen oder Bestrafungen wie Degradierung bestehen können. 15 Damit kann nach Parsons die soziale Rolle sowohl einen Zwang auf das Individuum ausüben als auch ihm Gelegenheit geben, sich persönlich zu engagieren und damit die soziale Ordnung zu gestalten. Falls Rollen diese Funktion in der Gesellschaft erfüllen, spricht Parsons von institutionalisierten Rollen oder von Institutionen (1973c: 56). Institutionalisierte Rollen sind Mechanismen (1973c: 56), durch die soziales Handeln auf eine bestimmte Weise abgestimmt wird. Kommen ein Dozent und eine Gruppe von Studenten zur ersten Sitzung eines Seminars am Anfang des Semesters zusammen, so sind durch die beiden Rollen Student und Dozent eine Reihe von Verhaltensregeln bereits definiert, ohne dass sie explizit ausgehandelt oder ausdiskutiert werden müssten. So ergreift der Dozent das Wort und erläutert den Semesterplan, auf den Studenten mit kommentarloser Zustimmung oder mit kritischen Einwänden und Gegenvorschlägen reagieren. Der Ablauf dieser Interaktionssequenz ist also durch die Rollenmuster in einem gewissen Umfang geregelt, ohne dass sich die Beteiligten auf diese Regelung vorher explizit geeinigt hätten. Ein solcher Regelmechanismus, der nicht auf einer konkreten Verständigungsleistung der beteiligten Akteure in Form verbaler oder nicht-verbaler Kommunikation beruht, nennen wir eine soziale Struktur. In diesem Sinne definieren Parsons und Linton den Rollenbegriff als Strukturkategorie. Nach Parsons haben Rollenstrukturen bestimmte Funktionen in der Gesellschaft zu erfüllen, indem sie einerseits die Auswahl eines bestimmten Verhaltens in einer Situation steuern und andererseits den Individuen Gelegenheit zum engagierten sozialen Handeln geben. Die erste Funktion wird Selektions- und die zweite Motivationsfunktion genannt (Parsons 1973c: 56). Diese Verbindung der Rollenstruktur mit bestimmten Funk- 15 Nach Dahrendorf beruht die Verbindlichkeit der Rollenerwartungen auf der Art der Sanktionen, die bei der Verletzung der Rollenerwartungen zu befürchten sind (1974: 35-42).
5 2.1 Rolle als Kategorie der Sozialstruktur 43 tionen im sozialen System bildet ein Musterbeispiel der strukturell-funktionalen Theorie, die Parsons zusammen mit Merton seit Mitte der 1940er Jahre entwickelt hat (1973c). Erinnern wir uns an das im Einführungskapitel zitierte Fundamentaltheorem der Handlungstheorie, nach dem soziales Handeln von institutionalisierten und internalisierten kulturellen Mustern bestimmt wird, dann lässt sich die Rollentheorie als eine Spezialisierung dieses Theorems auffassen. Im Hinblick auf die Persönlichkeit geht Parsons davon aus, dass das Individuum Verhaltensmaßstäbe von Gruppen sowie Werte und Normen in sich aufnimmt, also internalisiert. Auf diese Weise werden sie, unabhängig von äußeren Sanktionen, zu wirksamen Motivierungskräften für sein eigenes Verhalten. (Parsons 1973c: 55) Durch Verweis auf kulturelle Werte kann der Rollenhandelnde sich auch gegen die geltenden Rollenvorschriften stellen. So können Frauen am Arbeitsplatz gegen die ungleiche Bezahlung im Verhältnis zu männlichen Kollegen sich auf den Wert der Gleichheit berufen, um die Rechte und Pflichten ihrer Arbeitsrolle in Frage zu stellen. Institutionalisierte Rollen sind situationsspezifische Verhaltensvorschriften und somit Spezifikationen von Normen, die für einen weiteren Bereich von Verhaltensweisen gelten. So lernt - um das Beispiel des vorangehenden Kapitels nochmals aufzugreifen - der Lehrer auf der Rollenebene bestimmte Techniken der Belohnung und Bestrafung, die Normen, wie z.b. die individuelle Förderung von Schülern und gewaltfreie Motivation, konkretisieren. Diese Normen sind wiederum im Wertmuster der demokratischen Erziehung, also letztlich kulturell, verankert. In der Literatur hat sich der Ausdruck "funktionalistische" Rollentheorie eingebürgert, obwohl - wie wir gesehen haben - die Funktion der Rollen in dem Parsonsschen Modell nur eine untergeordnete Bedeutung einnimmt. Entscheidend sind dagegen institutionalisierte und internalisierte kulturelle Muster, die durch Rollen in der Sozial- und Persönlichkeitsstruktur verankert werden. Aus diesem Grunde sollte man dem Vorschlag Tenbrucks folgen und von Strukturtheorie (1961: 1) oder strukturtheoretischem Rollenkonzept sprechen. Die Anbindung an die allgemeine Theorie über das Fundamentaltheorem verleiht der Rollentheorie zwar einen hohen Abstraktionsgrad, entfernt sie nach Merton aber zu weit von der Analyse der sozialen Mechanismen, die das Rollenhandeln konkret steuern. Daher schlägt Merton in Abgrenzung zu Parsons die Entwicklung von "Theorien mittlerer Reichweite" (1973b: 319) vor Das Modell des Rollen-Sets Was unter einer solchen Theorie zu verstehen ist, zeigt Merton in seiner Studie von Intrarollenkonflikten auf, die - wie bereits erwähnt wurde - mit Lintons Rollenbegriff nicht erklärt werden können. Zunächst ist der Begriff der Rolle so zu definieren, dass unterschiedliche Verhaltenserwartungen auf einen Positionsinhaber gerichtet sind. Merton nennt diese unterschiedlichen Verhaltenserwartungen jeweils Rollen und die Menge der mit einer Position verbundenen Rollen das Rollen-Set (Merton 1973b: 322). Abweichend von Merton halten die nachfolgenden Rollentheoretiker daran fest, dass nur eine Rolle mit je einer Position verbunden ist. Diese Rolle zerfällt nach Dahrendorf (1974: 33) in die von unterschiedlichen Bezugsgruppen oder Bezugspersonen erwarteten Verhaltensweisen, die Rollensegmente genannt werden.
6 44 2 Soziales Handeln in Rollen und Institutionen Um nicht in den definitorischen Streit zu geraten, ob Rollen aus Erwartungen an das Verhalten oder aus erwartetem Verhalten bestehen, werden wir uns Popitz anschließen und von Verhaltensnormen sprechen: Als soziale Rolle bezeichnen wir Bündel von Verhaltensnormen, die eine bestimmte Kategorie von Gesellschafts- bzw. Gruppenmitgliedern im Unterschied zu anderen Kategorien zu erfüllen hat. (Popitz 1967: 21) Verhaltensnormen bestehen nach Popitz aus "tatsächlich ablaufendem Verhalten", das in einer gegebenen Gesellschaft regelmäßig stattfindet. Falls jemand von der Norm abweicht, so nimmt Popitz wie Parsons an, dass Sanktionen zur Korrektur des abweichenden Verhaltens eingesetzt werden (Popitz 1967: 22). Um das Rollen-Set zu einer gegebenen Position konkret zu untersuchen, sind demnach die Bezugspersonen und -gruppen sowie die Verhaltensnormen zu bestimmen. Falls man die unterschiedlichen Verhaltensnormen jeweils bestimmten Bezugsgruppen oder -personen zurechnet, lässt sich das Rollen-Set grafisch vereinfacht darstellen, wie Abbildung 7 für die Rolle des Studenten zeigt. Mitstudenten (b) (c) (c) Dozenten (b) Studentenvertreter (b) (c) Rolle 3 (a) Rolle 2 (a) Rolle 4 (a) Rolle 1 (a) Rolle 5 (a) (c) (c) Eltern/ Partner (b) Dekan/Rektor/ Minister (b) Abbildung 7: Beispiel Rollen-Set Neben Verhaltensnormen und Bezugsgruppen wäre für unser Beispiel auch die Position des Studenten im Universitätssystem zu bestimmen. Im Gegensatz zu den Dozenten, die lehren und forschen, soll der Student primär den Stoff der Wissenschaft lernen und einüben sowie ihn eigenständig auf kleinere wissenschaftliche Probleme anwenden. Damit wird der Position des Studenten eine bestimmte Aufgabe oder Funktion im Universitätssystem zugewiesen. Außerdem lassen sich Rechte und Pflichten angeben, die einen normativen Rahmen für die Rolle des Studenten festlegen. Studenten wird z.b. durch Prüfungsordnungen vorgegeben, welche Pflichtveranstaltungen sie erfolgreich besuchen müssen, um zu bestimmten Prüfungen zugelassen zu werden. Umgekehrt besitzen sie einen Anspruch darauf, dass Pflichtveranstaltungen in regelmäßigen Abständen im Lehrplan angeboten werden. Die allgemeinen Pflichten und Rechte stecken also einen Rahmen ab, der durch unterschiedli-
7 2.1 Rolle als Kategorie der Sozialstruktur 45 che Verhaltensweisen ausgefüllt werden muss. Diese Verhaltensweisen selbst ergeben sich aus Verhaltensnormen, die Bestandteil der Rolle des Studenten sind. Ein im Grundstudium häufig auftretender Intrarollenkonflikt ergibt sich, wenn ein Student sich einerseits der Erwartung der Dozenten gegenübersieht, eine besonders gute Leistung zu erbringen, und andererseits bei seinen Mitstudenten nicht als Streber gelten möchte. Merton vertritt in seinem Aufsatz zum Rollen-Set die These, dass bestimmte Beziehungsmuster innerhalb eines Rollen-Sets bestehen, die zu einer Konfliktlösung führen oder Konflikte bereits im Vorfeld verhindern. Wie Parsons spricht Merton von sozialen Mechanismen, durch die Handlungsprozesse innerhalb des Rollen-Sets koordiniert werden (Merton 1973b: 325). Im Einzelnen unterscheidet er sechs Mechanismen zur Verschränkung des Rollen-Sets, die sich am Beispiel der Studentenrolle illustrieren lassen: (1) Relative Bedeutsamkeit Die Bezugsgruppen haben unterschiedlich starkes Interesse an der Durchsetzung ihrer Rollenerwartungen. Während sowohl die Dozenten als auch die Mitstudenten ein relativ großes Interesse an dem Leistungsniveau in einem konkreten Seminar haben, werden die Eltern der Studenten oder die Vertreter des Wissenschaftsministeriums sich nicht besonders engagieren, um ihre Erwartungen durchzusetzen. (2) Machtunterschiede Beschwert sich ein Student über die Benotung seiner Prüfungsleistung bei dem zuständigen Dekan oder Fachbereichsleiter, so wird dessen Interesse an der betreffenden Prüfung zwangsläufig geweckt. In diesem Fall würde allerdings der Konflikt zwischen Professor und Dekan durch eine vorgegebene Machtstruktur geregelt, die dem Dekan die Möglichkeit gibt, nach einem genau vorgeschriebenen Verfahren die Berechtigung der Notenentscheidung zu überprüfen. (3) Abschirmung In der Regel sind die Prüfungen gegenüber dem Dekan abgeschirmt, der nur bei vorliegenden Beschwerden eingreift. Durch die Abschirmung des Rollenhandelns haben die einzelnen Bezugsgruppen unterschiedliche Chancen, ihre Rollenerwartungen durchzusetzen. Merton betont in diesem Zusammenhang, daß wir es hier mit strukturellen Anordnungen für solch eine Abschirmung zu tun haben, und nicht mit der Tatsache, daß dieser oder jener zufällig sein Rollen-Verhalten teilweise vor anderen verbirgt. (Merton 1973b: 327) Die Möglichkeit, das Rollenverhalten gegenüber dem Dekan oder Fachbereichsleiter abzuschirmen, hängt demnach nicht von persönlichen Merkmalen wie Neugier oder Machthunger des Positionsinhabers ab, sondern von den in der Universitätsverfassung festgelegten Rechten und Pflichten. Diese institutionelle Ordnung stellt für alle Beteiligten eine soziale Tatsache dar, die vom einzelnen Individuum nur bedingt zu beeinflussen ist. In seiner klassischen Definition betont Durkheim, der Begründer des strukturtheoretischen Paradigmas innerhalb der Soziologie, besonders den zwingenden Charakter dieser soziologischen Tatbestände:
8 46 2 Soziales Handeln in Rollen und Institutionen Hier liegt also eine Klasse von Tatbeständen von sehr speziellem Charakter vor: sie bestehen in besonderen Arten des Handelns, Denkens und Fühlens, die außerhalb der Einzelnen stehen und mit zwingender Gewalt ausgestattet sind, kraft deren sie sich ihnen aufdrängen. (Durkheim 1980: 107) (4) Übersehbarkeit Auch den vierten Mechanismus der Übersehbarkeit unterschiedlicher Rollenerwartungen durch die Bezugsgruppen definiert Merton auf der strukturellen Ebene. Dozenten müssen ihre Leistungsanforderungen in Seminaren allen beteiligten Studenten offen legen. Auf diese Weise sind für die Mitstudenten die Rollenerwartungen des Dozenten übersehbar, während der Dozent von den gegenseitigen Erwartungen der Studenten an ihre Mitstudenten häufig nichts erfährt. Es existiert keine Regelung, die Studenten zur Offenlegung ihrer Leistungserwartungen zwingen könnte. (5) Gegenseitige Unterstützung Studenten können sich zusammenschließen, um gegen den Dozenten ihre Erwartungen durchzusetzen. Dies kann z.b. durch Störung oder Boykott von Lehrveranstaltungen oder Einschaltung der gewählten Studentenvertreter geschehen. Merton würde in diesem Beispiel wiederum die strukturell bedingten Chancen der Studenten interessieren, ihre Vorstellungen durchzusetzen. Die möglichen negativen Folgen eines Boykotts für die beteiligten Studenten hängen z.b. von dem strukturellen Merkmal ab, ob der Besuch der Lehrveranstaltung den Studenten laut Studienordnung freisteht. (6) Abbruch von Rollenbeziehungen Der letzte von Merton aufgeführte Mechanismus bezieht sich auf die Möglichkeit, die Beziehung zu bestimmten Bezugspersonen oder -gruppen abzubrechen. Besteht in einem Fachbereich eine große Auswahl von Professoren, bei denen Studenten ihre Examen ablegen können, so wird es in der Regel für die Studenten relativ folgenlos sein, wenn sie die Rollenbeziehung zu einem Hochschullehrer abbrechen, während dies in einem sehr kleinen Fachbereich strukturell erschwert wird. Die Mertonschen Mechanismen steuern in gewissem Umfang das Entstehen und den Ablauf von Rollenkonflikten. Trotzdem müssen sie die Handlungsfreiheit des Rollenhandelnden nicht in jedem Falle einschränken, sondern können ihm auch Handlungsspielräume eröffnen. So gewinnt ein Student durch eine Machtkoalition mit seinen Mitstudenten einen Handlungsspielraum gegenüber den Dozenten, wogegen seine Handlungsfreiheit gegenüber den Mitstudenten durch das Gebot der Solidarität eingeschränkt wird. Die Möglichkeit der Abschirmung eröffnet dem Rollenhandelnden Handlungsfreiheit gegenüber den Gruppen, die sein Verhalten nicht einsehen können. Dieser Handlungsspielraum wird aber möglicherweise durch die verstärkte Kontrolle der nicht abgeschirmten Bezugsgruppen kompensiert. Somit liegen die Mechanismen des Rollen-Sets zwar nicht in der Hand des einzelnen Akteurs, sie eröffnen ihm aber bestimmte Handlungsmöglichkeiten zur Lösung von Intrarollenkonflikten. Holm hat diese Handlungsmöglichkeiten in Form von Strategien zur Bewältigung von Rollenkonflikten systematisiert und am Beispiel der Rolle des Werkmeisters demonstriert (zitiert nach Claessens 1974: 86-7). (1) Handlungsverzögerung (2) Handlungsverschleierung
9 2.1 Rolle als Kategorie der Sozialstruktur 47 (3) Alternierende Erwartungstreue (4) Handlung nach Legitimitätsgesichtspunkten (5) Handlung nach Sanktionskalkül Ein Student in einem Seminar für Studienanfänger kann z.b. auf die Anfertigung eines Referats verzichten, um nicht in einen möglichen Konflikt zwischen den Mitstudenten und dem Dozenten Stellung beziehen zu müssen. Die Strategie der Handlungsverschleierung würde ein Student dann wählen, wenn er seine Leistungsfähigkeit in den Einzelsprechstunden dem Dozenten vorführt, wo die Mitstudenten keine Einsicht haben. Eine alternierende Erwartungstreue liegt dann vor, wenn Studenten in Veranstaltungen, wo sie mehrere Hausaufgaben abgeben müssen, sich abwechselnd nach den Maßstäben der Mitstudenten und des Dozenten richten. Als Handlung nach Legitimitätsgesichtspunkten würde gelten, wenn ein Student gegenüber seinen Mitstudenten seine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft damit begründet, dass in der Universität höhere Leistungsanforderungen berechtigt sind, um das Niveau der akademischen Ausbildung nicht absinken zu lassen. Die Handlung nach dem Sanktionskalkül richtet sich dagegen nicht nach "guten Gründen", sondern nach dem "Recht des Stärkeren". Ein Student orientiert sich in seinem Handeln an der Bezugsgruppe, die über die größte Sanktionsmacht verfügt. Bei den meisten Studenten sind dies die Professoren, denen sie in Prüfungen gegenüberstehen werden. Allerdings ist es auch denkbar, dass Studenten den Verlust der Gruppensympathie mehr fürchten als eine schlechte Note in Prüfungen. Dies bedeutet, dass die Sanktionsmacht davon abhängt, wie wichtig dem Einzelnen das Erreichen der positiven Belohnung bzw. das Vermeiden negativer Sanktionen ist. Im Hinblick auf das vorangestellte Schema Bezugsrahmen, explizite Modelle und Musterbeispiele wird durch die Definition der Begriffe Position, Bezugsgruppe, Verhaltensnorm, Rolle und Rollen-Set ein Bezugsrahmen für die Analyse von Intrarollenkonflikten eingeführt. Die strukturellen Mechanismen Mertons, die Rollenkonflikte lösen oder mildern, ohne dass der Rollenhandelnde sich direkt mit den Konflikten auseinandersetzen muss, und die Strategien Holms zur Bewältigung der dann noch verbleibenden Rollenkonflikte bilden ein explizites Modell zur Erklärung von Handlungsprozessen in der sozialen Situation von Intrarollenkonflikten. Schließlich haben wir dieses Modell auf die Rolle von Studenten angewendet, die mit unterschiedlichen Verhaltenserwartungen der Mitstudenten und der Dozenten konfrontiert werden. Diese Anwendung des expliziten Modells auf eine konkrete soziale Situation bildet somit ein Musterbeispiel Struktur- und Handlungsaspekt von Rollen Die einflussreichste empirische Rollenstudie bildet die von N. Gross, W.S. Mason und A.W. McEachern 16 (1958) durchgeführte Untersuchung der Rolle des amerikanischen Schul-Superinterdanten, der mit dem deutschen Schulrat vergleichbar ist. Die Autoren untersuchen die Struktur des Rollen-Sets, indem sie erstens die institutionellen Rechte und Pflichten des Schulrats innerhalb des Schulsystems und zweitens die Sanktionsmacht der Bezugsgruppen untersuchen. Aufgrund der institutionellen Rechte und Pflichten kann der Schulrat die Berechtigung oder Legitimität von Erwartungen bewerten. Sein konkretes Verhalten wird der Schulrat dann an der Bezugsgruppe orientieren, deren Erwartung einen 16 Zusammenfassungen dieser Studie finden sich in Wiswede (1977) und Claessens (1974).
10 48 2 Soziales Handeln in Rollen und Institutionen höheren Grad an Legitimität aufweist oder mit größerer Sanktionsmacht verbunden ist. Je nach der Gewichtung dieser Kriterien ergeben sich zwei unterschiedliche Typen von Rollenhandelnden: der "Moralist" bewertet den Legitimitätsgesichtspunkt tendenziell höher, während sich der "Berechnende" eher der größeren Sanktionsmacht beugt. Gross, Mason und McEachern untersuchen somit Rollenkonflikte, indem sie primär die Beziehungsmuster und die institutionellen Regeln des Rollen-Sets erforschen und daraus das Rollenverhalten prognostizieren. Wie bei Merton liegt der Schwerpunkt ihres Interesses auf der strukturellen Ebene. Nach Merton wirken die Mechanismen des Rollen-Sets, ohne dass der Rollenhandelnde selbst Lösungsstrategien entwickelt. Diese Strategien werden lediglich auf die verbleibenden - Merton spricht von "residualen" - Rollenkonflikte angewendet, so dass in diesem expliziten Modell die strukturellen Mechanismen und die Handlungsstrategien hierarchisch angeordnet sind. Konkretes Rollenhandeln ist somit erstens auf die strukturellen Bedingungen und die sich daraus ergebenden Handlungsspielräume des Rollenhandelns und zweitens auf die Strategien und Ziele des Rollenhandelnden zu untersuchen. Beide Rollen-Komponenten bedingen sich gegenseitig, wobei die funktionalistische oder strukturtheoretische Rollenanalyse im Sinne Mertons dem strukturellen Aspekt Priorität einräumt und die interaktionistische Rollentheorie die Möglichkeiten der Rollengestaltung durch die Individuen stärker betont. Entsprechend untersuchen interaktionistische Rollentheoretiker, wie Rollenhandelnde die strukturellen Bedingungen beeinflussen, verändern und gestalten können. Eine empirische Arbeit in dieser Tradition bildet die von Hall durchgeführte Rollenanalyse berufstätiger Hausfrauen, die zur Bewältigung ihrer Rollenüberlastung bestimmte Strategien des "role-coping", also der Rollenbewältigung, entwickeln (1972). Neben den Handlungsstrategien der "persönlichen Rollendefinition" und des "reaktiven Rollenverhaltens" kann der Rollenhandelnde versuchen, die strukturellen Bedingungen zu verändern. Diese Strategie bezeichnet Hall als "strukturelle Rollen- Neudefinition" (1972: 474). Im Zentrum der Analyse steht der Rollenhandelnde, der zusammen mit den Bezugspersonen und -gruppen die Rolle in einem kommunikativen Prozess konstruiert. Dabei bilden die Strukturen des Rollen-Sets Bedingungen des Handelns, die einerseits als vorgegebener Rahmen und andererseits als veränderbar betrachtet werden. Ullrich und Claessens (1981: 23-9) unterscheiden zwischen Struktur- und Handlungsaspekt von Rollen und lehnen sich dabei an die Lintonsche Vorstellung der Position als Struktur- und der Rolle als Handlungsaspekt an. Mit Merton können wir den Strukturaspekt aufteilen in die institutionell verankerten Rechte und Pflichten des Positionsinhabers und die Mechanismen zur Vermeidung bzw. Verminderung von Intrarollenkonflikten. Zum Handlungsaspekt rechnen wir die Holmschen Strategien zur Lösung von Rollenkonflikten durch den Rolleninhaber und die "coping"-strategien zur Bewältigung von Rollenüberlastung nach Hall. Die Verteilung der Ansätze auf die beiden Aspekte vermittelt ein harmonisches Bild, nach dem die strukturtheoretische und die interaktionistische Rollenanalyse sich gegenseitig ergänzen. Betrachtet man die expliziten Modelle zur Untersuchung von Rollenhandeln in Konfliktsituationen, so verbinden die Vertreter beider Ansätze die strukturelle und interaktionistische Ebene auf genau umgekehrte Weise und kommen zu teilweise entgegen gesetzten Ergebnissen. Strukturtheoretiker beschäftigen sich häufig mit der Verbesserung der institutionellen Rahmenbedingungen wie Studien- und Prüfungsordnungen, während Interaktionstheoretiker sich eher auf Konflikte zwischen rivalisierenden Gruppen und die Beziehung der Individuen zu ihren Rollen konzentrieren. In der Universität wird dann z.b. untersucht, wie
11
GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE. Markus Paulus. Radboud University Nijmegen DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A.
 GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE Markus Paulus DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A. Radboud University Nijmegen IV, DER ROLLENBEGRIFF Die ganze Welt ist Bühne, Und alle Frau n und Männer bloße Spieler. Sie treten auf
GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE Markus Paulus DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A. Radboud University Nijmegen IV, DER ROLLENBEGRIFF Die ganze Welt ist Bühne, Und alle Frau n und Männer bloße Spieler. Sie treten auf
VORLESUNG SOZIOLOGISCHE GRUNDBEGRIFFE SoSe Veranstaltung SOZIALE ROLLE / SOZIALE KONTROLLE
 VORLESUNG SOZIOLOGISCHE GRUNDBEGRIFFE SoSe 09 5. Veranstaltung SOZIALE ROLLE / SOZIALE KONTROLLE ÜBERBLICK 1. Das allgemeine Rollen -Verständnis in der Schule des Strukturfunktionalismus 2. Talcott Parson
VORLESUNG SOZIOLOGISCHE GRUNDBEGRIFFE SoSe 09 5. Veranstaltung SOZIALE ROLLE / SOZIALE KONTROLLE ÜBERBLICK 1. Das allgemeine Rollen -Verständnis in der Schule des Strukturfunktionalismus 2. Talcott Parson
Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren?
 Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Homo sociologicus soziale Position
 soziale Position Homo sociologicus: Mensch als Träger vorgeformter Rollen Soziale Position: Bestimmte Stelle/Ort des Individuums im Koordinatensystem sozialer Beziehungen Jede Position impliziert ein Netz
soziale Position Homo sociologicus: Mensch als Träger vorgeformter Rollen Soziale Position: Bestimmte Stelle/Ort des Individuums im Koordinatensystem sozialer Beziehungen Jede Position impliziert ein Netz
Schlüsselbegriffe der Soziologie. Vorlesung: Einführung in die Soziologie, WS 2007/08 Dr. Guido Mehlkop
 Schlüsselbegriffe der Soziologie Vorlesung: Einführung in die Soziologie, WS 2007/08 Dr. Guido Mehlkop Methodologischer Individualismus Soziale Phänomene sind das (nichtintendierte) Ergebnis von individuellen
Schlüsselbegriffe der Soziologie Vorlesung: Einführung in die Soziologie, WS 2007/08 Dr. Guido Mehlkop Methodologischer Individualismus Soziale Phänomene sind das (nichtintendierte) Ergebnis von individuellen
Werte, Normen und Rollen
 Werte, Normen und Rollen Gliederung: 1. Werte 1.1 Was sind Werte? 1.2 Verschiedene Arten von Werten 2. Normen 2.1 Was sind Normen? 2.2 Kategorisierung nach Merkmalen (Kann-, Soll-, Mussnormen) 2.3 Zusammenhang
Werte, Normen und Rollen Gliederung: 1. Werte 1.1 Was sind Werte? 1.2 Verschiedene Arten von Werten 2. Normen 2.1 Was sind Normen? 2.2 Kategorisierung nach Merkmalen (Kann-, Soll-, Mussnormen) 2.3 Zusammenhang
Grundannahmen von Systemtheorien
 Grundannahmen von Systemtheorien Die Wechselbeziehungen zwischen den Elementen sind nicht zufällig, sondern sind in einer bestimmten Weise geordnet. Die Ordnung der Beziehungen = Struktur Systeme tendieren
Grundannahmen von Systemtheorien Die Wechselbeziehungen zwischen den Elementen sind nicht zufällig, sondern sind in einer bestimmten Weise geordnet. Die Ordnung der Beziehungen = Struktur Systeme tendieren
Mikrofundierung des soziologischen Neo-Institutionalismus und weiterführende Arbeiten
 Mikrofundierung des soziologischen Neo-Institutionalismus und weiterführende Arbeiten Themenbereich 5: Performance Measurement in Organisationen Perspektiven des soziologischen Neo-Institutionalismus Referent:
Mikrofundierung des soziologischen Neo-Institutionalismus und weiterführende Arbeiten Themenbereich 5: Performance Measurement in Organisationen Perspektiven des soziologischen Neo-Institutionalismus Referent:
Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann
 Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS
Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS
Sozialisation und Identität nach George Herbert Mead
 Sozialisation und Identität nach George Herbert Mead Universität Augsburg Lehrstuhl für Soziologie Seminar: Grundkurs Soziologie Dozent: Sasa Bosancic Referentinnen: Christine Steigberger und Catherine
Sozialisation und Identität nach George Herbert Mead Universität Augsburg Lehrstuhl für Soziologie Seminar: Grundkurs Soziologie Dozent: Sasa Bosancic Referentinnen: Christine Steigberger und Catherine
Forschungsstatistik I
 Prof. Dr. G. Meinhardt 6. Stock, TB II R. 06-206 (Persike) R. 06-321 (Meinhardt) Sprechstunde jederzeit nach Vereinbarung Forschungsstatistik I Dr. Malte Persike persike@uni-mainz.de http://psymet03.sowi.uni-mainz.de/
Prof. Dr. G. Meinhardt 6. Stock, TB II R. 06-206 (Persike) R. 06-321 (Meinhardt) Sprechstunde jederzeit nach Vereinbarung Forschungsstatistik I Dr. Malte Persike persike@uni-mainz.de http://psymet03.sowi.uni-mainz.de/
Neue Theorie der Schule
 Helmut Fend Neue Theorie der Schule Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen 2., durchgesehene Auflage III VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhalt Vorwort ll Einleitung: Geschichte der Theorie
Helmut Fend Neue Theorie der Schule Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen 2., durchgesehene Auflage III VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhalt Vorwort ll Einleitung: Geschichte der Theorie
Der Labeling Approach
 Geisteswissenschaft Feryal Kor Der Labeling Approach Studienarbeit 1. Einleitung In jeglichen Gesellschaftsformen leben die unterschiedlichsten Individuen, welche vielfältige und unterschiedliche Verhaltensweisen
Geisteswissenschaft Feryal Kor Der Labeling Approach Studienarbeit 1. Einleitung In jeglichen Gesellschaftsformen leben die unterschiedlichsten Individuen, welche vielfältige und unterschiedliche Verhaltensweisen
Grundlagen der soziologischen Theorie
 Wolfgang Ludwig Schneider Grundlagen der soziologischen Theorie Band 1: Weber - Parsons - Mead - Schutz 3. Auflage III VSVERLAG FOR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhalt Einleitung 15 1. Handlungsbegriff, Handlungsverstehen
Wolfgang Ludwig Schneider Grundlagen der soziologischen Theorie Band 1: Weber - Parsons - Mead - Schutz 3. Auflage III VSVERLAG FOR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhalt Einleitung 15 1. Handlungsbegriff, Handlungsverstehen
Schulinterner Lehrplan für das Fach Ethik, Klasse 1-4
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Ethik, Klasse 1-4 Lernziele/Inhalte Klasse 1 und 2 Hinweise Soziale Beziehungen Freundschaft - was gehört dazu und worauf kommt es an? o Formen von Freundschaft o Merkmale
Schulinterner Lehrplan für das Fach Ethik, Klasse 1-4 Lernziele/Inhalte Klasse 1 und 2 Hinweise Soziale Beziehungen Freundschaft - was gehört dazu und worauf kommt es an? o Formen von Freundschaft o Merkmale
Talcott Parsons Strukturfunktionalismus
 Systemtheorie I Talcott Parsons Talcott Parsons Handlungs- Martina Dellinger & Ordnungstheorie Katharina Systemtheorie Gesell Kathrin Weitere Hövekamp Theoriebausteine Anne Kübart Gliederung 1. Handlungs-
Systemtheorie I Talcott Parsons Talcott Parsons Handlungs- Martina Dellinger & Ordnungstheorie Katharina Systemtheorie Gesell Kathrin Weitere Hövekamp Theoriebausteine Anne Kübart Gliederung 1. Handlungs-
Aktives und gesundes Leben im Alter: Die Bedeutung des Wohnortes
 DZA Deutsches Zentrum für Altersfragen 5 Aktives und gesundes Leben im Alter: Die Bedeutung des Wohnortes Der Deutsche Alterssurvey (DEAS): Älterwerden und der Einfluss von Kontexten 1996 2002 2008 2011
DZA Deutsches Zentrum für Altersfragen 5 Aktives und gesundes Leben im Alter: Die Bedeutung des Wohnortes Der Deutsche Alterssurvey (DEAS): Älterwerden und der Einfluss von Kontexten 1996 2002 2008 2011
Soziologisches Institut, Lehrstuhl Prof. Dr. Jörg Rössel FS Proseminar zur soziologischen Forschung:
 Soziologisches Institut, Lehrstuhl Prof. Dr. Jörg Rössel FS 2010 Proseminar zur soziologischen Forschung: Empirische Sozialstrukturanalyse Soziologisches Institut, Lehrstuhl Prof. Dr. Jörg Rössel FS 2010
Soziologisches Institut, Lehrstuhl Prof. Dr. Jörg Rössel FS 2010 Proseminar zur soziologischen Forschung: Empirische Sozialstrukturanalyse Soziologisches Institut, Lehrstuhl Prof. Dr. Jörg Rössel FS 2010
Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier im Namen der Frankfurt School of Finance und Management begrüßen zu dürfen.
 Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier im Namen der Frankfurt School of Finance und Management begrüßen zu dürfen. Manch einer wird sich vielleicht fragen: Was hat eigentlich die Frankfurt
Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier im Namen der Frankfurt School of Finance und Management begrüßen zu dürfen. Manch einer wird sich vielleicht fragen: Was hat eigentlich die Frankfurt
Frage 1: Wie lässt sich der Gegenstandsbereich der Industriesoziologie charakterisieren?
 Frage 1: Wie lässt sich der Gegenstandsbereich der Industriesoziologie charakterisieren? Soziologie soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf
Frage 1: Wie lässt sich der Gegenstandsbereich der Industriesoziologie charakterisieren? Soziologie soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf
Edenred-Ipsos Barometer 2016 Wohlbefinden am Arbeitsplatz messen und fördern. Mai 2016
 Edenred-Ipsos Barometer 2016 Wohlbefinden am Arbeitsplatz messen und fördern Mai 2016 Fakten und Hintergrund Unternehmen, die mit unsicheren Märkten kämpfen, sind immer mehr auf die Bereitschaft ihrer
Edenred-Ipsos Barometer 2016 Wohlbefinden am Arbeitsplatz messen und fördern Mai 2016 Fakten und Hintergrund Unternehmen, die mit unsicheren Märkten kämpfen, sind immer mehr auf die Bereitschaft ihrer
befähigen, berufliche Handlungssituationen erfolgreich zu bewältigen.
 Das Ziel jeder Berufsausbildung ist es, die Lernenden zu befähigen, berufliche Handlungssituationen erfolgreich zu bewältigen. Die Ausbildung zur Assistentin / zum Assistenten Gesundheit und Soziales ist
Das Ziel jeder Berufsausbildung ist es, die Lernenden zu befähigen, berufliche Handlungssituationen erfolgreich zu bewältigen. Die Ausbildung zur Assistentin / zum Assistenten Gesundheit und Soziales ist
ERKLÄRUNGEN ZUM PRÄFERENZPROFIL
 Myers-Briggs Typenindikator (MBTI) Der MBTI ist ein Indikator er zeigt an wie Sie sich selbst einschätzen welche Neigungen Sie haben und wie diese Neigungen Ihr Verhalten beeinflussen können. Der MBTI
Myers-Briggs Typenindikator (MBTI) Der MBTI ist ein Indikator er zeigt an wie Sie sich selbst einschätzen welche Neigungen Sie haben und wie diese Neigungen Ihr Verhalten beeinflussen können. Der MBTI
Modul 1: Methoden der Politikwissenschaft A Qualifikationsziele vertiefte Kenntnisse der wissenschaftstheoretischen
 Modulbeschreibungen M.A. Politikwissenschaft Modul 1: Methoden der Politikwissenschaft A vertiefte Kenntnisse der wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Politikwissenschaft, der Forschungsmethoden der
Modulbeschreibungen M.A. Politikwissenschaft Modul 1: Methoden der Politikwissenschaft A vertiefte Kenntnisse der wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Politikwissenschaft, der Forschungsmethoden der
Begriffe der Friedens- und Konfliktforschung : Konflikt & Gewalt
 Begriffe der Friedens- und Konfliktforschung : Konflikt & Gewalt Vorlesung zur Einführung in die Friedensund Konfliktforschung Prof. Dr. Inhalt der Vorlesung Gewaltbegriff Bedeutungsgehalt Debatte um den
Begriffe der Friedens- und Konfliktforschung : Konflikt & Gewalt Vorlesung zur Einführung in die Friedensund Konfliktforschung Prof. Dr. Inhalt der Vorlesung Gewaltbegriff Bedeutungsgehalt Debatte um den
6. Geschlecht lernen in Familie und Schule 1: 7. Wie kommt Leistung in die Gesellschaft? TEXT: Parsons, S
 Datum Di., 8.10. Di., 8.10. Mi., 9.10. Mi., 9.10. Fr., 11.10 Mo., 21.10 Mo., 21.10. Do., 24.10. Vortragende/r Sertl 15:45-17:15 Grössing 17:30-19:00 Grössing 9:45-11:15 Sertl 11:30 13:00 Grössing 11:30-13:00
Datum Di., 8.10. Di., 8.10. Mi., 9.10. Mi., 9.10. Fr., 11.10 Mo., 21.10 Mo., 21.10. Do., 24.10. Vortragende/r Sertl 15:45-17:15 Grössing 17:30-19:00 Grössing 9:45-11:15 Sertl 11:30 13:00 Grössing 11:30-13:00
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse
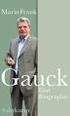 Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
Die gruppendynamischen Rollen innerhalb einer Gruppe
 Geisteswissenschaft Isabel Fallenstein Die gruppendynamischen Rollen innerhalb einer Gruppe Studienarbeit 1. Einleitung Der einzelne Mensch wird in der Gruppe Teil eines neuen Ganzen, dessen Charakter
Geisteswissenschaft Isabel Fallenstein Die gruppendynamischen Rollen innerhalb einer Gruppe Studienarbeit 1. Einleitung Der einzelne Mensch wird in der Gruppe Teil eines neuen Ganzen, dessen Charakter
Wissenschaftspropädeutik Gymnasium > Universität? Prof. Dr. A. Loprieno, 4. HSGYM-Herbsttagung, 12. November 2015
 Wissenschaftspropädeutik Gymnasium > Universität? Prof. Dr. A. Loprieno, 4. HSGYM-Herbsttagung, 12. November 2015 Gymnasium > Universität in historischer Perspektive Das frühneuzeitliche Modell (1500-1848):
Wissenschaftspropädeutik Gymnasium > Universität? Prof. Dr. A. Loprieno, 4. HSGYM-Herbsttagung, 12. November 2015 Gymnasium > Universität in historischer Perspektive Das frühneuzeitliche Modell (1500-1848):
Einführung in die Soziologie
 Heinz Abels Einführung in die Soziologie Band 1: Der Blick auf die Gesellschaft Westdeutscher Verlag Inhalt, Vorwort 9 1. Soziologisches Denken 15 1.1 Die Kunst des Misstrauens und die Lehre vom zweiten
Heinz Abels Einführung in die Soziologie Band 1: Der Blick auf die Gesellschaft Westdeutscher Verlag Inhalt, Vorwort 9 1. Soziologisches Denken 15 1.1 Die Kunst des Misstrauens und die Lehre vom zweiten
Spieltheorie mit. sozialwissenschaftlichen Anwendungen
 Friedel Bolle, Claudia Vogel Spieltheorie mit sozialwissenschaftlichen Anwendungen SS 2010 Strategische Züge 1. Einführung: Strategische Züge 2. Bedingungslose Züge 3. Bedingte Züge Drohung Versprechen
Friedel Bolle, Claudia Vogel Spieltheorie mit sozialwissenschaftlichen Anwendungen SS 2010 Strategische Züge 1. Einführung: Strategische Züge 2. Bedingungslose Züge 3. Bedingte Züge Drohung Versprechen
Soziale Beziehungen & Gesellschaft -Proseminar Sommersemester 2005 Bourdieu // Ökonomisches, kulturelles & soziales Kapital
 Soziale Beziehungen & Gesellschaft -Proseminar Sommersemester 2005 Bourdieu // Ökonomisches, kulturelles & soziales Kapital Die Kapitalsorten nach Bourdieu Kapital Ökonomisches Kapital (Geld, Besitz) Soziales
Soziale Beziehungen & Gesellschaft -Proseminar Sommersemester 2005 Bourdieu // Ökonomisches, kulturelles & soziales Kapital Die Kapitalsorten nach Bourdieu Kapital Ökonomisches Kapital (Geld, Besitz) Soziales
Theorien, Methoden und Begriffe oder Rezeptwissen?
 Theorien, Methoden und Begriffe oder Rezeptwissen? Zielperspektive Pädagogische Handlungskompetenz These: Diese (praktische) Handlungskompetenz ist nicht einfach ein Wissensvorrat, der sich in Verhaltensregeln
Theorien, Methoden und Begriffe oder Rezeptwissen? Zielperspektive Pädagogische Handlungskompetenz These: Diese (praktische) Handlungskompetenz ist nicht einfach ein Wissensvorrat, der sich in Verhaltensregeln
oder Klausur (60-90 Min.) Päd 4 Päd. Arbeitsfelder und Handlungsformen*) FS Vorlesung: Pädagogische Institutionen und Arbeitsfelder (2 SWS)
 Module im Bachelorstudium Pädagogik 1. Überblick 2. Modulbeschreibungen (ab S. 3) Modul ECTS Prüfungs- oder Studienleistung Päd 1 Modul Einführung in die Pädagogik *) 10 1. FS Vorlesung: Einführung in
Module im Bachelorstudium Pädagogik 1. Überblick 2. Modulbeschreibungen (ab S. 3) Modul ECTS Prüfungs- oder Studienleistung Päd 1 Modul Einführung in die Pädagogik *) 10 1. FS Vorlesung: Einführung in
Soziologie. Bildungsverlag EINS a Wolters Kluwer business. Sylvia Betscher-Ott, Wilfried Gotthardt, Hermann Hobmair, Wilhelm Ott, Rosemarie Pöll
 Sylvia Betscher-Ott, Wilfried Gotthardt, Hermann Hobmair, Wilhelm Ott, Rosemarie Pöll Herausgeber: Hermann Hobmair Soziologie 1. Auflage Bestellnummer 05006 Bildungsverlag EINS a Wolters Kluwer business
Sylvia Betscher-Ott, Wilfried Gotthardt, Hermann Hobmair, Wilhelm Ott, Rosemarie Pöll Herausgeber: Hermann Hobmair Soziologie 1. Auflage Bestellnummer 05006 Bildungsverlag EINS a Wolters Kluwer business
Thema / Inhalt allgemeine Leistungsziele spezifische Leistungsziele Lehrmittel: Kapitel Semester
 Schullehrplan Behindertenbetreuung FBD 2-jährige Grundbildung Bereich: Begleiten und Betreuen Thema / Inhalt allgemeine Leistungsziele spezifische Leistungsziele Lehrmittel: Kapitel Semester Alltagsgestaltung
Schullehrplan Behindertenbetreuung FBD 2-jährige Grundbildung Bereich: Begleiten und Betreuen Thema / Inhalt allgemeine Leistungsziele spezifische Leistungsziele Lehrmittel: Kapitel Semester Alltagsgestaltung
Beruf als institutionelle Grundlage des Arbeitsmarktes: Anmerkungen zu einer Neukonzipierung der Berufsforschung. Martin Abraham
 Beruf als institutionelle Grundlage des Arbeitsmarktes: Anmerkungen zu einer Neukonzipierung der Berufsforschung Workshop Perspektiven einer arbeitsmarktbezogenen Berufsforschung in Deutschland IAB 10.6.2008
Beruf als institutionelle Grundlage des Arbeitsmarktes: Anmerkungen zu einer Neukonzipierung der Berufsforschung Workshop Perspektiven einer arbeitsmarktbezogenen Berufsforschung in Deutschland IAB 10.6.2008
Zur Ausarbeitung einer Evaluationsordnung - Unter Berücksichtigung von Rechtslage und Hochschulmanagement
 Wirtschaft Boris Hoppen Zur Ausarbeitung einer Evaluationsordnung - Unter Berücksichtigung von Rechtslage und Hochschulmanagement Projektarbeit Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Diplomstudiengang
Wirtschaft Boris Hoppen Zur Ausarbeitung einer Evaluationsordnung - Unter Berücksichtigung von Rechtslage und Hochschulmanagement Projektarbeit Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Diplomstudiengang
Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien
 Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2006/07 Kernbereich der Friedens- und Konfliktforschung K o n f l i k t a n a l y s e & K o n f
Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2006/07 Kernbereich der Friedens- und Konfliktforschung K o n f l i k t a n a l y s e & K o n f
Kritische Theorie (u.a. Horkheimer, Marcuse, Adorno..., Habermas)
 Kritische Theorie (u.a. Horkheimer, Marcuse, Adorno..., Habermas) Anlehnung an Marxismus, insbesondere Geschichtsinterpretation. Theorie ist Form gesellschaftlicher Praxis. Historische Analyse Grundlage
Kritische Theorie (u.a. Horkheimer, Marcuse, Adorno..., Habermas) Anlehnung an Marxismus, insbesondere Geschichtsinterpretation. Theorie ist Form gesellschaftlicher Praxis. Historische Analyse Grundlage
Einführung in die Techniken des Rollenspiels: Erfolgreiche und gestörte Kommunikation im Sinne von Watzlawick
 Pädagogik Cornelia Leistner Einführung in die Techniken des Rollenspiels: Erfolgreiche und gestörte Kommunikation im Sinne von Watzlawick Unterrichtsentwurf UNTERRICHTSENTWURF Einführung in die Techniken
Pädagogik Cornelia Leistner Einführung in die Techniken des Rollenspiels: Erfolgreiche und gestörte Kommunikation im Sinne von Watzlawick Unterrichtsentwurf UNTERRICHTSENTWURF Einführung in die Techniken
Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung)
 Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung) Recht auf Bildung Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Bildung soll auf die volle Entfaltung der Persönlichkeit, der
Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung) Recht auf Bildung Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Bildung soll auf die volle Entfaltung der Persönlichkeit, der
Abschlussprüfung «Berufspraxis - mündlich» für Kaufleute der Ausbildungs- und Prüfungsbranche Dienstleistung und Administration (D&A)
 Abschlussprüfung «Berufspraxis - mündlich» für Kaufleute der Ausbildungs- und Prüfungsbranche Dienstleistung und Administration (D&A) Informationsblatt für Lernende Dieses Informationsblatt ergänzt und
Abschlussprüfung «Berufspraxis - mündlich» für Kaufleute der Ausbildungs- und Prüfungsbranche Dienstleistung und Administration (D&A) Informationsblatt für Lernende Dieses Informationsblatt ergänzt und
Einsatz und Rückzug an Schulen Engagement und Disengagement bei Lehrern, Schulleitern und Schülern
 Rezension erschienen in der Zeitschrift des Bundesverbandes der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen: Die berufsbildende Schule, Juni 2011, S. 209-210. von StD Ernst Rutzinger, Schulleiter Einsatz
Rezension erschienen in der Zeitschrift des Bundesverbandes der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen: Die berufsbildende Schule, Juni 2011, S. 209-210. von StD Ernst Rutzinger, Schulleiter Einsatz
Das Bachelorstudium der Politikwissenschaft als Kernfach
 Das Bachelorstudium der Politikwissenschaft als Kernfach Das Bachelorstudium kann in Jena jeweils nur zum Wintersemester aufgenommen werden. Voraussetzung ist neben dem Zeugnis der Hochschulreife der Nachweis
Das Bachelorstudium der Politikwissenschaft als Kernfach Das Bachelorstudium kann in Jena jeweils nur zum Wintersemester aufgenommen werden. Voraussetzung ist neben dem Zeugnis der Hochschulreife der Nachweis
Annahmen der Rollentheorie
 Erving Goffman Goffman interessiert sich für die vielfältigen Ausdrucksformen von Individuen in sozialen Interaktionen und für die sozialen Regeln, auf die Individuen zurückgreifen, wenn sie ihrer Identität
Erving Goffman Goffman interessiert sich für die vielfältigen Ausdrucksformen von Individuen in sozialen Interaktionen und für die sozialen Regeln, auf die Individuen zurückgreifen, wenn sie ihrer Identität
Mittwoch, 28. September 11. ProductMasterTeam
 ProductMasterTeam Die Scrum Rollen ScrumMaster Impedements und Probleme aufzeigen...und lösen Motiviert das Team Moderiert zwischen Scrum-Rollen und Stakeholdern Verantwortlich für die Fortschritte des
ProductMasterTeam Die Scrum Rollen ScrumMaster Impedements und Probleme aufzeigen...und lösen Motiviert das Team Moderiert zwischen Scrum-Rollen und Stakeholdern Verantwortlich für die Fortschritte des
Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft 10. Vorlesung 22. Dezember Policy-Analyse 1: Einführung
 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft Policy-Analyse 1: Einführung 1 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft Vgl. Böhret, Carl u.a.: Innenpolitik und politische Theorie. Ein Studienbuch.
Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft Policy-Analyse 1: Einführung 1 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft Vgl. Böhret, Carl u.a.: Innenpolitik und politische Theorie. Ein Studienbuch.
Kooperation in der Organisation Schule. Dr. Heinz Hinz
 Kooperation in der Organisation Schule Dr. Heinz Hinz Kooperation in der Organisation Schule Definition: Kooperation ist allgemein jedwede Form der Zusammenarbeit von mindestens zwei Interagierenden Personen
Kooperation in der Organisation Schule Dr. Heinz Hinz Kooperation in der Organisation Schule Definition: Kooperation ist allgemein jedwede Form der Zusammenarbeit von mindestens zwei Interagierenden Personen
1 Was ist die Aufgabe von Erziehung? Erziehung als Reaktion auf die Entwicklungstatsache Der Erziehungsbegriff Klaus Beyers...
 Inhalt Vorwort Die pädagogische Perspektive... 1 1 Was ist die Aufgabe von Erziehung?... 1 1.1 Erziehung als Reaktion auf die Entwicklungstatsache... 2 1.2 Der Erziehungsbegriff Klaus Beyers... 2 2 Mündigkeit,
Inhalt Vorwort Die pädagogische Perspektive... 1 1 Was ist die Aufgabe von Erziehung?... 1 1.1 Erziehung als Reaktion auf die Entwicklungstatsache... 2 1.2 Der Erziehungsbegriff Klaus Beyers... 2 2 Mündigkeit,
Universität Hamburg S TUDIENORDNUNG. für den Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (4. 10.
 Universität Hamburg Fachbereich Wirtschaftswissenschaften S TUDIENORDNUNG für den Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre (4. 10. 1996) 2 Die Studienordnung konkretisiert die Prüfungsordnung und regelt
Universität Hamburg Fachbereich Wirtschaftswissenschaften S TUDIENORDNUNG für den Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre (4. 10. 1996) 2 Die Studienordnung konkretisiert die Prüfungsordnung und regelt
Die Soziologie und das Soziale
 Geisteswissenschaft Holger Michaelis Die Soziologie und das Soziale Eine Erklärung der bislang vergeblichen Versuche einer adäquaten Bestimmung des Gegenstandes der Soziologie Dr. Holger Michaelis Die
Geisteswissenschaft Holger Michaelis Die Soziologie und das Soziale Eine Erklärung der bislang vergeblichen Versuche einer adäquaten Bestimmung des Gegenstandes der Soziologie Dr. Holger Michaelis Die
Prof. Dr. Bernhard Nauck
 Prof. Dr. Bernhard Nauck Vorlesung Erklärende Soziologie 6. Vorlesung Soziologische Modelle des Menschen 1 Do you remember? Das Grundmodell der soziologischen Erklärung Soziale Situation Soziologische
Prof. Dr. Bernhard Nauck Vorlesung Erklärende Soziologie 6. Vorlesung Soziologische Modelle des Menschen 1 Do you remember? Das Grundmodell der soziologischen Erklärung Soziale Situation Soziologische
Globalisierung und soziale Ungleichheit. Einführung in das Thema
 Globalisierung und soziale Ungleichheit Einführung in das Thema Gliederung 1. Was verbinden Soziologen mit dem Begriff Globalisierung? 2. Gliederung des Seminars 3. Teilnahmevoraussetzungen 4. Leistungsnachweise
Globalisierung und soziale Ungleichheit Einführung in das Thema Gliederung 1. Was verbinden Soziologen mit dem Begriff Globalisierung? 2. Gliederung des Seminars 3. Teilnahmevoraussetzungen 4. Leistungsnachweise
Entwicklung eines Erhebungsinstruments. Thema: Verteilung klinischer und subklinischer Essstörungen an der Universität Kassel
 Entwicklung eines Erhebungsinstruments Thema: Verteilung klinischer und subklinischer Essstörungen an der Universität Kassel Vorstellung des Themas In: Lehrforschungswerkstatt: Quantitative Untersuchungsverfahren
Entwicklung eines Erhebungsinstruments Thema: Verteilung klinischer und subklinischer Essstörungen an der Universität Kassel Vorstellung des Themas In: Lehrforschungswerkstatt: Quantitative Untersuchungsverfahren
Wenn das Team zur Wagenburg wird
 Weitere ausgewählte Ergebnisse der Goldpark-Datenbank Impressum: Herausgeber: Goldpark GmbH Unternehmensberatung Postanschrift: Johann-Klotz-Straße 12, 60528 Frankfurt am Main, Deutschland Kontakt: Telefon
Weitere ausgewählte Ergebnisse der Goldpark-Datenbank Impressum: Herausgeber: Goldpark GmbH Unternehmensberatung Postanschrift: Johann-Klotz-Straße 12, 60528 Frankfurt am Main, Deutschland Kontakt: Telefon
Führungsstile 1. Führungsstile Dr. Gerhard Friedrich Thesenpapier
 Führungsstile 1 Führungsaufgaben werden von verschiedenen Menschen verschieden gehandhabt. Der eine neigt zu militärischer Disziplin und Ordnung, ein Zweiter versucht, die Mitarbeiter so selbständig wie
Führungsstile 1 Führungsaufgaben werden von verschiedenen Menschen verschieden gehandhabt. Der eine neigt zu militärischer Disziplin und Ordnung, ein Zweiter versucht, die Mitarbeiter so selbständig wie
Hans-Werner Wahl Vera Heyl. Gerontologie - Einführung und Geschichte. Verlag W. Kohlhammer
 Hans-Werner Wahl Vera Heyl Gerontologie - Einführung und Geschichte Verlag W. Kohlhammer Vorwort 9 1 Alter und Alternsforschung: Das junge gesellschaftliche und wissenschaftliche Interesse am Alter 12
Hans-Werner Wahl Vera Heyl Gerontologie - Einführung und Geschichte Verlag W. Kohlhammer Vorwort 9 1 Alter und Alternsforschung: Das junge gesellschaftliche und wissenschaftliche Interesse am Alter 12
George Herbert Mead (US-amerikanischer Philosoph und Sozialpsychologe) Mensch bildet sich und erschließt sich seine Welt mittels Symbole
 George Herbert Mead (US-amerikanischer Philosoph und Sozialpsychologe) 1863-1931 Mensch bildet sich und erschließt sich seine Welt mittels Symbole Persönlichkeit und soziales Handeln sind durch Symbole
George Herbert Mead (US-amerikanischer Philosoph und Sozialpsychologe) 1863-1931 Mensch bildet sich und erschließt sich seine Welt mittels Symbole Persönlichkeit und soziales Handeln sind durch Symbole
Sicherheitswahrnehmungen im 21. Jahrhundert. Eine Einführung. Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht
 Sicherheitswahrnehmungen im 21. Jahrhundert Eine Einführung Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht 1 Sicherheit 2009 Einleitung Ausgangspunkt Stellung der Sicherheit in modernen Gesellschaften Risiko, Gefahr
Sicherheitswahrnehmungen im 21. Jahrhundert Eine Einführung Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht 1 Sicherheit 2009 Einleitung Ausgangspunkt Stellung der Sicherheit in modernen Gesellschaften Risiko, Gefahr
Freiwilligenarbeit in der Schweiz: Grundlagen, Trends und förderliche Rahmenbedingungen
 11. Nationale Fachtagung Departement Gesundheit und Integration SRK, Donnerstag, 19. September 2013, Hotel Ambassador Bern Freiwilligenarbeit in der Schweiz: Grundlagen, Trends und förderliche Rahmenbedingungen
11. Nationale Fachtagung Departement Gesundheit und Integration SRK, Donnerstag, 19. September 2013, Hotel Ambassador Bern Freiwilligenarbeit in der Schweiz: Grundlagen, Trends und förderliche Rahmenbedingungen
Textsorten. Folien zum Tutorium Internationalisierung Go West: Preparing for First Contacts with the Anglo- American Academic World
 Textsorten Folien zum Tutorium Internationalisierung Go West: Preparing for First Contacts with the Anglo- American Academic World Alexander Borrmann Historisches Institut Lehrstuhl für Spätmittelalter
Textsorten Folien zum Tutorium Internationalisierung Go West: Preparing for First Contacts with the Anglo- American Academic World Alexander Borrmann Historisches Institut Lehrstuhl für Spätmittelalter
Bjarne Reuter Außenseiterkonstruktion - en som hodder, buster-trilogi
 Sprachen Tim Christophersen Bjarne Reuter Außenseiterkonstruktion - en som hodder, buster-trilogi Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG... 3 2 WAS IST EIN AUßENSEITER?... 3 3 REUTERS AUßENSEITERKONSTRUKTION...
Sprachen Tim Christophersen Bjarne Reuter Außenseiterkonstruktion - en som hodder, buster-trilogi Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG... 3 2 WAS IST EIN AUßENSEITER?... 3 3 REUTERS AUßENSEITERKONSTRUKTION...
Abbildungsverzeichnis...VI Tabellenverzeichnis... VII Abkürzungsverzeichnis...VIII
 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis...VI Tabellenverzeichnis... VII Abkürzungsverzeichnis...VIII 1 Einführung... 1 1.1 Problemstellung und Zielsetzung... 1 1.2 Aufbau und Vorgehensweise der Untersuchung...
Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis...VI Tabellenverzeichnis... VII Abkürzungsverzeichnis...VIII 1 Einführung... 1 1.1 Problemstellung und Zielsetzung... 1 1.2 Aufbau und Vorgehensweise der Untersuchung...
SS 1990 - Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich
 Lehrveranstaltungen: An der Universität Bayreuth: SS 1990 - Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich WS 1990/91 - Einführung in die Empirische Sozialforschung - Zur Soziologie der Ehre
Lehrveranstaltungen: An der Universität Bayreuth: SS 1990 - Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich WS 1990/91 - Einführung in die Empirische Sozialforschung - Zur Soziologie der Ehre
Interkulturelle Kompetenz
 Seminar: Interkulturelle Kompetenz P. Buchwald WS 08 09 Seminar Interkulturelle Kompetenz WS 0809 Folie 1 Buchwald Ziel des Seminars Ihre interkulturelle Kompetenz im Umgang mit Schülern und Kollegen aus
Seminar: Interkulturelle Kompetenz P. Buchwald WS 08 09 Seminar Interkulturelle Kompetenz WS 0809 Folie 1 Buchwald Ziel des Seminars Ihre interkulturelle Kompetenz im Umgang mit Schülern und Kollegen aus
Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement
 Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Mitbestimmt geht s mir besser! Seite 1 Leitlinien für Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Beteiligung: Marginalisierten Gruppen eine Stimme geben!
Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Mitbestimmt geht s mir besser! Seite 1 Leitlinien für Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Beteiligung: Marginalisierten Gruppen eine Stimme geben!
R. Dahrendorf: Homo Sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle. Opladen 1977; S.
 R. Dahrendorf: Homo Sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle. Opladen 1977; S. 29 ff Nehmen wir an, wir seien auf einer Gesellschaft, auf der uns
R. Dahrendorf: Homo Sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle. Opladen 1977; S. 29 ff Nehmen wir an, wir seien auf einer Gesellschaft, auf der uns
11. Sozial-kognitive Persönlichkeitstheorien. Rotter und Bandura. Teil 11.b: Bandura
 10. Theorien der Persönlichkeit GHF im WiSe 2008 / 2009 an der HS MD- SDL(FH) im Studiengang Rehabilitationspsychologie, B.Sc., 1. Semester Persönlichkeitstheorien Rotter und Bandura Teil 11.b: Bandura
10. Theorien der Persönlichkeit GHF im WiSe 2008 / 2009 an der HS MD- SDL(FH) im Studiengang Rehabilitationspsychologie, B.Sc., 1. Semester Persönlichkeitstheorien Rotter und Bandura Teil 11.b: Bandura
Buch- Präsentation: Markus Lorber. Train the Trainer Seminar 2009/2010
 Buch- Präsentation: Markus Lorber Train the Trainer Seminar 2009/2010 Zum Autor: Hans-Christoph Koller 1956 Geboren in Ludwigsburg 1989 Promotion 1997 Habilitation: Bildung und Widerstreit. Zur sprachlichen
Buch- Präsentation: Markus Lorber Train the Trainer Seminar 2009/2010 Zum Autor: Hans-Christoph Koller 1956 Geboren in Ludwigsburg 1989 Promotion 1997 Habilitation: Bildung und Widerstreit. Zur sprachlichen
Fragestellungen. 2 Unternehmensführung und Management 2.1 Grundfunktionen der Unternehmensführung
 Fragestellungen 1 Unternehmen und Umwelt Als Stakeholder bezeichnet man die Kapitalgeber einer Unternehmung. (R/F) Bitte begründen! Nennen Sie beispielhaft 3 Stakeholder und ihre Beziehungen zum Unternehmen!
Fragestellungen 1 Unternehmen und Umwelt Als Stakeholder bezeichnet man die Kapitalgeber einer Unternehmung. (R/F) Bitte begründen! Nennen Sie beispielhaft 3 Stakeholder und ihre Beziehungen zum Unternehmen!
Pädagogisches Konzept. KiBiZ Tagesfamilien
 Pädagogisches Konzept KiBiZ Tagesfamilien Erweiterte Familien mit individuellem Spielraum Die grosse Stärke der Tagesfamilienbetreuung liegt in der Individualität. KiBiZ Tagesfamilien bieten Spielraum
Pädagogisches Konzept KiBiZ Tagesfamilien Erweiterte Familien mit individuellem Spielraum Die grosse Stärke der Tagesfamilienbetreuung liegt in der Individualität. KiBiZ Tagesfamilien bieten Spielraum
Soziale Beziehungen & Gesellschaft - Proseminar Sommersemester
 Soziale Beziehungen & Gesellschaft - Proseminar Sommersemester 2005 - I. Theoretische Einführung Zum Verhältnis von Gesellschaft und Individuum Gesellschaft Individuum >> 3 Gesellschaft als Aggregation
Soziale Beziehungen & Gesellschaft - Proseminar Sommersemester 2005 - I. Theoretische Einführung Zum Verhältnis von Gesellschaft und Individuum Gesellschaft Individuum >> 3 Gesellschaft als Aggregation
9. Sozialwissenschaften
 9. Sozialwissenschaften 9.1 Allgemeines Die Lektionendotation im Fach Sozialwissenschaft beträgt 200 Lektionen. Davon sind 10% für den interdisziplinären Unterricht freizuhalten. (Stand April 2005) 9.2
9. Sozialwissenschaften 9.1 Allgemeines Die Lektionendotation im Fach Sozialwissenschaft beträgt 200 Lektionen. Davon sind 10% für den interdisziplinären Unterricht freizuhalten. (Stand April 2005) 9.2
Alfred Schütz Konstitution sinnhaften Handelns
 Konstitution sinnhaften Handelns Erklären bedeutet also für eine mit Sinn des Handelns befasste Wissenschaft soviel wie: Erfassung des Sinnzusammenhangs, in den, seinem subjektiv gemeinten Sinn nach, ein
Konstitution sinnhaften Handelns Erklären bedeutet also für eine mit Sinn des Handelns befasste Wissenschaft soviel wie: Erfassung des Sinnzusammenhangs, in den, seinem subjektiv gemeinten Sinn nach, ein
Der Sozialisationsfaktor in der Erklärung der Autoritären Persönlichkeit
 Geisteswissenschaft Daniel Lois Der Sozialisationsfaktor in der Erklärung der Autoritären Persönlichkeit Studienarbeit Institut für Soziologie RWTH Aachen Der Sozialisationsfaktor in der Erklärung der
Geisteswissenschaft Daniel Lois Der Sozialisationsfaktor in der Erklärung der Autoritären Persönlichkeit Studienarbeit Institut für Soziologie RWTH Aachen Der Sozialisationsfaktor in der Erklärung der
Vorläufige Studienordnung zur SPO I 2003 Stufenschwerpunkt Hauptschule
 Vorläufige Studienordnung zur SPO I 2003 Stufenschwerpunkt Hauptschule Geschichte als Hauptfach (35 SWS) oder als (1) Anlage 1, 8 Aufbau und Inhalte Stand: 04.11.2005 Modul Beschreibung (lt. GHPO I) Veranstaltung
Vorläufige Studienordnung zur SPO I 2003 Stufenschwerpunkt Hauptschule Geschichte als Hauptfach (35 SWS) oder als (1) Anlage 1, 8 Aufbau und Inhalte Stand: 04.11.2005 Modul Beschreibung (lt. GHPO I) Veranstaltung
Gesellschaftstheorien und das Recht
 Vorlesung Rechtssoziologie HS 2012 Gesellschaftstheorien und das Recht Emile Durkheim Ass.-Prof. Dr. Michelle Cottier Juristische Fakultät Universität Basel Emile Durkheim (1858-1917) Rechtssoziologie
Vorlesung Rechtssoziologie HS 2012 Gesellschaftstheorien und das Recht Emile Durkheim Ass.-Prof. Dr. Michelle Cottier Juristische Fakultät Universität Basel Emile Durkheim (1858-1917) Rechtssoziologie
DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR.
 Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Männlichkeitsforschung Am Text Der gemachte Mann
Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Männlichkeitsforschung Am Text Der gemachte Mann
Engagierte Vaterschaft
 LBS-Initiative Junge Familie (Hrsg.) Engagierte Vaterschaft Die sanfte Revolution in der Familie Wassilios E. Fthenakis u.a. Leske + Budrich, Opladen 1999 Inhalt Vorwort 12 1. Vaterschaft - gestern und
LBS-Initiative Junge Familie (Hrsg.) Engagierte Vaterschaft Die sanfte Revolution in der Familie Wassilios E. Fthenakis u.a. Leske + Budrich, Opladen 1999 Inhalt Vorwort 12 1. Vaterschaft - gestern und
die Klärung philosophischer Sachfragen und Geschichte der Philosophie
 Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // christian.nimtz@phil.uni erlangen.de Theoretische Philosophie der Gegenwart 1 2 3 Unser Programm in diesem Semester Einführung Man unterscheidet in der Philosophie
Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // christian.nimtz@phil.uni erlangen.de Theoretische Philosophie der Gegenwart 1 2 3 Unser Programm in diesem Semester Einführung Man unterscheidet in der Philosophie
Wertewandel in Deutschland
 Geisteswissenschaft Miriam Fonfe Wertewandel in Deutschland Ein kurzer Überblick Studienarbeit EINLEITUNG UND DARSTELLUNG DER ARBEIT 3 WERTE UND WERTEWANDEL 4 Werte und Konsum 4 Phasen des Wertewandels
Geisteswissenschaft Miriam Fonfe Wertewandel in Deutschland Ein kurzer Überblick Studienarbeit EINLEITUNG UND DARSTELLUNG DER ARBEIT 3 WERTE UND WERTEWANDEL 4 Werte und Konsum 4 Phasen des Wertewandels
Freiwilliges Klausurkolloquium im WS 07/08
 Univ.-Prof. Dr. Sabine Fließ Freiwilliges Klausurkolloquium im WS 07/08 Kurs 41101: II - Management von Dienstleistungsprozessen - Autor Hagen, den 23. Januar 2008 Aufgabe 3 a) Die Interaktion zwischen
Univ.-Prof. Dr. Sabine Fließ Freiwilliges Klausurkolloquium im WS 07/08 Kurs 41101: II - Management von Dienstleistungsprozessen - Autor Hagen, den 23. Januar 2008 Aufgabe 3 a) Die Interaktion zwischen
Lawrence Kohlberg: Moralstufen und Moralerwerb. Der kognitiv-entwicklungstheortische Ansatz (1976)
 Lawrence Kohlberg: Moralstufen und Moralerwerb. Der kognitiv-entwicklungstheortische Ansatz (1976) 1. Der Stellenwert des moralischen Urteils in der Gesamtpersönlichkeit - Entwicklung der Ausbildung von
Lawrence Kohlberg: Moralstufen und Moralerwerb. Der kognitiv-entwicklungstheortische Ansatz (1976) 1. Der Stellenwert des moralischen Urteils in der Gesamtpersönlichkeit - Entwicklung der Ausbildung von
Forschungsmethoden: Definition
 Forschungsmethoden: Definition Unter Forschungsmethoden versteht man die generelle Vorgehensweise beim Aufstellen der Fragestellung, bei der Planung, der Durchführung und der Auswertung einer Untersuchung.
Forschungsmethoden: Definition Unter Forschungsmethoden versteht man die generelle Vorgehensweise beim Aufstellen der Fragestellung, bei der Planung, der Durchführung und der Auswertung einer Untersuchung.
Unterrichtsvorhaben I:
 Einführungsphase Lehrbuch Vorschläge für konkrete Unterrichtmaterialien Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie Menschen das Fremde, den Fremden und die Fremde wahrnahmen Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive
Einführungsphase Lehrbuch Vorschläge für konkrete Unterrichtmaterialien Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie Menschen das Fremde, den Fremden und die Fremde wahrnahmen Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive
Studienordnung für den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft an der Universität Augsburg vom 28. August 2006
 StO Bachelor Erziehungsw. 07 Studienordnung für den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft an der Universität Augsburg vom 28. August 200 Die Zeichen in den eckigen Klammern weisen auf die durch die
StO Bachelor Erziehungsw. 07 Studienordnung für den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft an der Universität Augsburg vom 28. August 200 Die Zeichen in den eckigen Klammern weisen auf die durch die
Analyse gesellschaftlicher Exklusions- und Inklusionsprozesse Systemtheorie
 Prof. Dr. Anton Schlittmaier Analyse gesellschaftlicher Exklusions- und Inklusionsprozesse Systemtheorie Nur für Weiße! Kapstadt 1985 Einstieg: Bezug zur Sozialen Arbeit Soziale Arbeit als Praxis und Soziale
Prof. Dr. Anton Schlittmaier Analyse gesellschaftlicher Exklusions- und Inklusionsprozesse Systemtheorie Nur für Weiße! Kapstadt 1985 Einstieg: Bezug zur Sozialen Arbeit Soziale Arbeit als Praxis und Soziale
5. Sitzung. Methoden der Politikwissenschaft: Wissenschaftstheorie
 5. Sitzung Methoden der Politikwissenschaft: Wissenschaftstheorie Inhalt der heutigen Veranstaltung 1. Was ist Wissenschaft? 2. Gütekriterien von Wissenschaft 3. Exkurs: Wissenschaftssprache 4. Hypothese,
5. Sitzung Methoden der Politikwissenschaft: Wissenschaftstheorie Inhalt der heutigen Veranstaltung 1. Was ist Wissenschaft? 2. Gütekriterien von Wissenschaft 3. Exkurs: Wissenschaftssprache 4. Hypothese,
Sozialer Einfluss in Gruppen 1
 Sozialer Einfluss in Gruppen 1 Vortrag von Stefanie Auberle Nina von Waldeyer-Hartz Gliederung 1. Begriffserklärung 2. Rollen und soziale Regeln 2.1 Stanford-Prison Experiment 3. Gehorsam und Autoritäten
Sozialer Einfluss in Gruppen 1 Vortrag von Stefanie Auberle Nina von Waldeyer-Hartz Gliederung 1. Begriffserklärung 2. Rollen und soziale Regeln 2.1 Stanford-Prison Experiment 3. Gehorsam und Autoritäten
Sozialwissenschaftliche Methoden und Methodologie. Begriffe, Ziele, Systematisierung, Ablauf. Was ist eine Methode?
 Sozialwissenschaftliche Methoden und Methodologie WiSe 2007/ 08 Prof. Dr. Walter Hussy Veranstaltung 1 Begriffe, Ziele, Systematisierung, Ablauf 24.01.2008 1 Was ist eine Methode? Eine Methode ist eine
Sozialwissenschaftliche Methoden und Methodologie WiSe 2007/ 08 Prof. Dr. Walter Hussy Veranstaltung 1 Begriffe, Ziele, Systematisierung, Ablauf 24.01.2008 1 Was ist eine Methode? Eine Methode ist eine
John Dewey (Art as Experience, 1935, S.50)
 Wenn der Künstler in seinem Schaffensprozess keine neue Vision ausbildet, so arbeitet er mechanisch und wiederholt irgendein altes Modell, das wie eine Blaupause in seinem Geist haftet John Dewey (Art
Wenn der Künstler in seinem Schaffensprozess keine neue Vision ausbildet, so arbeitet er mechanisch und wiederholt irgendein altes Modell, das wie eine Blaupause in seinem Geist haftet John Dewey (Art
Soziale Identität in Gruppen
 Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie Soziale Identität in Gruppen Tina Luckey Katja Menzel Michael Pielert Nina Strunk Nina Trebkewitz Si-Hee Won 1. Historische Entwicklung Lernziel: Historische
Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie Soziale Identität in Gruppen Tina Luckey Katja Menzel Michael Pielert Nina Strunk Nina Trebkewitz Si-Hee Won 1. Historische Entwicklung Lernziel: Historische
V. Aggression und Durchsetzung
 Ohne auf die einzelnen Aggressionstheorien einzugehen, kann man zwei Arten von Aggression (ad-gredi = an etwas oder jemanden zugehen, herantreten) unterscheiden: a) Destruktive Aggression, die durch ein
Ohne auf die einzelnen Aggressionstheorien einzugehen, kann man zwei Arten von Aggression (ad-gredi = an etwas oder jemanden zugehen, herantreten) unterscheiden: a) Destruktive Aggression, die durch ein
Praxismodul Soziologie
 Praxismodul Soziologie Berufspraktikum oder Forschungspraktikum Praxismodul 1 Zeitliche Einordnung und Stellenwert des Praxismoduls Theorien Methoden Gegenstände Berufspraktikum Praxismodul Forschungspraktikum
Praxismodul Soziologie Berufspraktikum oder Forschungspraktikum Praxismodul 1 Zeitliche Einordnung und Stellenwert des Praxismoduls Theorien Methoden Gegenstände Berufspraktikum Praxismodul Forschungspraktikum
Meine Rechte und die der Anderen
 Rechtekatalog für unsere Kinder und Jugendlichen Meine Rechte und die der Anderen Ev. Jugendhilfe Menden Dieser Rechtekatalog gehört: Seite 2 Wir danken allen Kindern und MitarbeiterInnen, die an der Entwicklung
Rechtekatalog für unsere Kinder und Jugendlichen Meine Rechte und die der Anderen Ev. Jugendhilfe Menden Dieser Rechtekatalog gehört: Seite 2 Wir danken allen Kindern und MitarbeiterInnen, die an der Entwicklung
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Einführung in die Politikwissenschaft. - Was ist Demokratie? Di 11-15-12.45
 Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Politikwissenschaft - Was ist Demokratie? Di 11-15-12.45 Anforderung I Rechtskonzept, das gleichzeitig der Positivität und dem freiheitsverbürgenden Charakter zwingenden
Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Politikwissenschaft - Was ist Demokratie? Di 11-15-12.45 Anforderung I Rechtskonzept, das gleichzeitig der Positivität und dem freiheitsverbürgenden Charakter zwingenden
Begriffsdefinitionen
 Begriffsdefinitionen Sozialisation: Unter Sozialisation versteht man die Entstehung und Bildung der Persönlichkeit aufgrund ihrer Interaktion mit einer spezifischen materiellen, kulturellen und sozialen
Begriffsdefinitionen Sozialisation: Unter Sozialisation versteht man die Entstehung und Bildung der Persönlichkeit aufgrund ihrer Interaktion mit einer spezifischen materiellen, kulturellen und sozialen
