Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
|
|
|
- Eleonora Ingeborg Sauer
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Chronisch entzündliche Darmerkrankungen Handbuch für Klinik und Praxis Bearbeitet von Anton J. Kroesen, Bodo Klump, Jörg Hoffmann, Robert Hoffmann, Frank Autschbach, Franz G. Bader, Marc F.A. Bode, Hans-Peter Bruch, Stephan Böhm, Axel Dignass, Rainer Duchmann, Jörg Emmrich, Klaus Fellermann, Florian Graepler, Michael N. Göke, Franz Hartmann, Hans Herfarth, Gundi Heuschen, Udo A. Heuschen, Martin H. Holtmann, Ekkehard Christoph Jehle, Harro Jenss, Bernd Jüngling, Klaus-Michael Keller, Christian F. Krieglstein, Wolfgang Kruis, Torsten Kucharzik, Harald Matthes, Markus Friedrich Neurath, Mathias Plauth, Jan Preiß, Armin Raible, Max Reinshagen, Emile Jan Marie Rijcken, Uwe Johannes Roblick, Gerhard Rogler, Guido Schürmann, Britta Siegmund, Andreas Stallmach, Jürgen- Michael Stein, Dirk O. Stichtenoth, Antje Timmer, Claus Peter Trimborn Neuausgabe Buch. 416 S. Hardcover ISBN Format (B x L): 19,5 x 27 cm Weitere Fachgebiete > Medizin > Klinische und Innere Medizin > Gastroenterologie, Proktologie Zu Inhaltsverzeichnis schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, ebooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.
2 Primäre sklerosierende Cholangitis 3.7 Primäre sklerosierende Cholangitis Jörg C. Hoffmann Einleitung Pathophysiologie Diagnostik der CED Die PSC ist eine chronische Erkrankung der Gallenwege, die durch eine diffuse Entzündung und Fibrose der Gallenwege gekennzeichnet ist. Sie befällt in der Regel die großen Gallenwege und führt hier zu typischen Strikturen und prästenotischen Dilatationen, sodass häufig von perlschnurartigen Veränderungen der Gallenwege gesprochen wird. Als Folge dieser Veränderungen kommt es gehäuft zu Cholangitiden und sekundären Gallenwegssteinen sowie im Verlauf zu einer biliären Zirrhose mit all ihren Folgen (portale Hypertension, Leberversagen). Neben dieser klassischen Form der PSC gibt es noch eine PSC der kleinen Gallenwege ( small duct PSC ), die in 22 % der Fälle in eine klassische PSC übergeht, aber sonst eine günstigere Prognose aufweist [1]. Eine Häufung von Lebererkrankungen bei Patienten mit CU wurde erstmals 1874 von Thomas und 1899 von Lister beschrieben [2, 3], Veränderungen der Gallenwege erstmals 1924 von Delbet in Frankreich [4]. Der Ausdruck PSC wurde von Holubitsky und McKenzie 1964 geprägt [5] Epidemiologie Die PSC ist eine seltene Erkrankung mit einer Inzidenz von 0,9 1,3 pro 10 5 Einwohner und Jahr in Nordamerika, England und Norwegen [6 8]. Deutlich seltener ist die PSC der kleinen Gallenwege mit 0,15 pro 10 5 Einwohnern und Jahr [7]. Die Prävalenz für die klassische PSC beträgt 8,5 14,2 pro 10 5 Einwohner in Nordamerika und Nordeuropa und scheint in Südeuropa geringer zu sein. Männer sind 2- bis 3-mal so oft von einer PSC betroffen wie Frauen; die Diagnose wird meist vor dem 40. Lebensjahr gestellt. Die PSC tritt gehäuft bei Nichtrauchern [9, 10] und bei Patienten mit CED auf [6, 7]. Insgesamt haben bis zu 80 % der PSC-Patienten eine CED; betrachtet man alle Patienten mit CU, so leiden 2,4 7,5 % unter einer PSC. Nachdem in den meisten früheren Studien von einer deutlichen Häufung bei Patienten mit CU, weniger bei MC, berichtet wurde, zeigte eine populationsbasierte Studie kürzlich eine ähnliche Häufung bei beiden CED [7]. Die Ursache für die Entstehung einer PSC ist unbekannt [11]. Da bei Verwandten 1. Grades eine über 80-fache Häufung der PSC gefunden wurde, steht heute außer Frage, dass genetische Faktoren eine Rolle spielen [8]. Da es kein einzelnes Gen gibt, das zu einer PSC führt, handelt es sich nicht um eine genetische, sondern vielmehr um eine polygene Erkrankung. Schon vor ca. 25 Jahren wurden Assoziationen mit bestimmten HLA-Genen auf Chromosom 6p21 beschrieben, z. B. DR3 und B8. Mehrere Studien berichteten über genetische Marker für einen ungünstigen Krankheitsverlauf, ohne dass diese reproduziert werden konnten. Daher kommt der Bestimmung von HLA-Typen bisher keine klinische Bedeutung zu. Neben der Genetik wurden bis heute 5 andere Hypothesen zur Pathogenese der PSC aufgestellt [12]: chronische portale Bakteriämie Toxizität von besonderen Gallesalzen Bakterientoxine Ischämie Virusinfektion Letztgenannte Hypothese entstand, da im Rahmen einer HIV-Infektion ein PSC-ähnliches Bild entstehen kann; weitere Hinweise auf eine Virusinfektion fanden sich jedoch nicht. Da die PSC insbesondere bei Patienten mit CED auftritt, wurde die Hypothese aufgestellt, dass Darmbakterien und/oder Toxine über die Pfortader einschwemmen und zu einer Entzündung der Gallenwege führen [11]. Dafür sprach, dass bakterielle Peptide in der Ratte eine portale Entzündung hervorrufen können. Allerdings konnten niemals Bakterien im Pfortaderkreislauf nachgewiesen werden. Vor allem aber spricht die klinische Beobachtung dagegen, dass Kolitisschübe nicht mit PSC-Schüben einhergehen. Vielmehr kann eine PSC einer Kolitis vorausgehen oder sogar erst auftreten, wenn bereits eine Proktokolektomie bei CU erfolgt ist. PSC-Patienten ohne Kolon zeigen keinen anderen Verlauf als Patienten mit Kolon [13]. Aufgrund der engen Assoziation der PSC mit CED und der Infiltration des Gallenepithels mit mononukleären Zellen geht man heute davon aus, dass es sich bei der PSC um eine immunologische Erkrankung handelt, die bei genetisch prädisponierten Patienten auftritt [11]. Neben der Verbindung zu den CED spricht für eine immunologische Genese, dass bei PSC gehäuft Hyper-γ-globulinämien (besonders IgM), erhöhte Autoantikörper (panca), Immunkomplexe und Komplementfragmente gefunden werden. 120
3 Diagnostik Außerdem werden bei der PSC für chronische Entzündungen typische zelluläre Veränderungen beschrieben, wie ein erhöhtes CD4/CD8-Verhältnis im Blut, höhere Zahlen an peripheren B-Zellen oder auch eine stärkere Expression von Adhäsionsmolekülen im entzündeten Gallengang. Ob diese immunologischen Veränderungen Folge oder Ursache der chronischen Entzündung mit Fibrose und Sklerose an den kleinen und großen Gallenwegen sind, bleibt unklar. Es erscheint aber wahrscheinlich, dass diese Veränderungen weiter durch die Besiedlung mit Streptokokken und enterischen Bakterien verstärkt werden. So haben 40,5 % aller PSC-Patienten mit dominanten Strikturen eine bakterielle Besiedlung; Patienten ohne dominante Strikturen zeigen dagegen keine Bakterienbesiedlung [14] Klinische Symptomatik Klinische Symptome können bei einer PSC im Rahmen von Komplikationen wie progredienter Leberzirrhose (z. B. Enzephalopathie), bakteriellen Infektionen oder auch sekundären Gallensteinbildungen der vorgeschädigten Gallenwege auftreten [12]. Der typische PSC-Patient ist jedoch bei Diagnosestellung asymptomatisch und fällt bei einer Routineblutentnahme durch erhöhte Cholestaseparameter oder Transaminasen auf. Wenn bereits ein Pruritus, Abgeschlagenheit, Ikterus, Gewichtsverlust und/oder Aszites auftreten, besteht in der Regel schon eine fortgeschrittene Erkrankung. Zeichen der Cholangitis können Fieber, Nachtschweiß, Ikterus oder Schüttelfrost sein. Diese Symptome können auch transient auftreten, müssen stets als Warnsignal wahrgenommen werden und an das mögliche Vorliegen einer PSC denken lassen Diagnostik Die typischen Veränderungen an den Gallenwegen kennzeichnen eine PSC, sodass deren Bildgebung durch ERCP oder MRCP entscheidend für die Diagnosestellung ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ähnliche Bilder andere Erkrankungen hervorrufen können, die ausgeschlossen werden sollten (s. S. 123), insbesondere: HIV-Infektion sepsisassoziierte sklerosierende Cholangitiden Folgezustände nach Gallengangsoperationen sekundäre sklerosierende Cholangitiden nach bakteriellen Cholangitiden Gallengangsneoplasien angeborene Gallenwegsveränderungen Zur Abgrenzung stehen neben einer sorgfältigen Ananmese und Untersuchung die Labordiagnostik, die Bildgebung und die Histologie zur Verfügung. Labor Erhöhte Cholestaseparameter stellen die typische Laborkonstellation bei PSC dar (γ-glutamyltransferase, alkalische Phosphatase und Bilirubin) [12]. Sonstige Transaminasen und Lebersyntheseparameter (z. B. das Albumin) sind im Frühstadium häufig normal, ändern sich jedoch meist im Verlauf. Selten sind alle Leberwerte normal. Das Bilirubin kann deutlich fluktuieren und steigt bei fortschreitendem Krankheitsprozess häufig an. Ein spezifischer Leberwert für die PSC existiert ebenso wenig wie ein spezifischer Antikörpertest. In der immunologischen Diagnostik fällt bei ca. 30 % eine Hyper-γ-globulinämie und bei % eine Erhöhung des IgM auf. Der Nachweis von panca gelingt bei 65 % der Patienten. Werden sonstige Antikörper, z. B. gegen glatte Muskulatur (SMA-Antikörper), erhöht gemessen, liegt gleichzeitig eine Autoimmunhepatitis vor und man spricht von einem Overlap-Syndrom [15]. Dies betrifft ca. 10 % aller PSC-Patienten und hat entsprechende therapeutische Konsequenzen. Wenn Cholestaseparameter bei Patienten, insbesondere CED-Patienten, erhöht gemessen werden, deutet dies auf das mögliche Vorliegen einer PSC hin. Daher sollten in diesem Fall ergänzend folgende Parameter bestimmt werden: Syntheseparameter (Albumin) sonstige Transaminasen Bilirubin (falls nicht erfolgt) Serumelektrophorese Ferritin In jedem Fall wird empfohlen, eine HIV-, HBV- und HCV-Serologie durchzuführen, um diese wichtigen Differenzialdiagnosen auszuschließen. Sofern eine Hyper-γ-globulinämie besteht, sollten ergänzend die Immungobulinen und die Leberautoantikörper (SMA, LKM, SLA, ANA) bestimmt werden. Die Bestimmung des panca hat keine therapeutische Konsequenz, sodass sie nicht erforderlich ist, außer wenn die Bestimmung in der differenzialdiagnostischen Abklärung gebraucht wird. Das Vorgehen ist in Abb schematisch dargestellt. Sonografie, ERCP, MRCP, PTC, Cholangio skopie, IDUS Auch bei CED-Patienten gehört eine hochauflösende perkutane Sonografie grundsätzlich zur Abklärung von erhöhten Leberwerten. Da nur fortgeschrittene Veränderungen an den Gallenwegen in der Sonografie nachweisbar sind, spielt sie für die definitive Diagnosestellung einer PSC in der Regel keine Rolle, sondern hilft bei der Differenzialdiagnostik. Als Goldstandard für die Diagnosestellung einer PSC galt bisher die ERCP. Entsprechend wird die Durchführung einer ERCP für die Primärdiagnostik in den deutschen Leitlinien für die CU empfohlen [16]. Eine ERCP ist jedoch 121 3
4 Primäre sklerosierende Cholangitis γ Abb Diagnostischer Algorithmus zur Abklärung von erhöhten Cholestaseparametern (MRC = Magnetresonanzcholangiografie, ERC = endoskopische retrograde Cholangiografie, Mo = Monate, KI = Kontraindikation, PE = Probeentnahme). Diagnostik der CED eine invasive Untersuchung mit einer Komplikationsrate von ca. 10 %, wobei insbesondere Pankreatitiden (ca. 5 %), Blutungen (ca. 2 %) und Cholangitiden (ca. 1 %) zu nennen sind [17]. Außerdem wird diskutiert, ob durch das potenzielle Einbringen von Erregern eine Besiedlung und damit ein Progress der Erkrankung auftreten kann [11]. Wenn dominante Stenosen vorliegen, finden sich bei 40,5 % der Patienten Besiedlungen mit enterischen Bakterien und bei immerhin 11,9 % Besiedlungen mit Candida [14, 18]. Bestanden keine dominanten Stenosen, wurden keine Keime gefunden. Auch wenn elektive ERCP bei PSC keine höhere Komplikationsrate aufweisen als bei sonstigen cholestatischen Lebererkrankungen [19], besteht im Rahmen einer ERCP ein Komplikationsrisiko, das eine MRCP nicht hat. Die Sensitivität und Spezifität der MRCP für die PSC liegt, verglichen mit der ERCP, bei % bzw % [20, 21] und stellt damit eine exzellente, nicht invasive Bildgebung dar. Im Falle einer negativen MRCP, einer Kontraindikation für eine MRCP oder beim Vorliegen von dominanten Stenosen, bei denen ein Cholangiokarzinom auch initial möglich ist, muss eine ERCP durchgeführt werden. Dieses sequenzielle Vorgehen (erst die MRCP und dann ggf. die ERCP) hat sich in Amerika weitgehend durchgesetzt, u. a. auch aus Kostengründen [22]. Die Cholangiografie mittels MRCP oder ERCP zeigt bei einer klassischen PSC perlschnurartige Veränderungen, die durch narbige Strikturen und prästenotische Dilatationen zustande kommen. In Abb sind diese Veränderungen mittels ERCP dargestellt. Die Auflösung insbesondere von intrahepatischen Veränderungen ist höher als bei der MRCP (Abb. 3.25). Sofern in der MRCP oder ERCP Strikturen nachgewiesen werden, spricht man von hochgradigen Stenosen. Diese werden folgendermaßen eingeteilt [23]: Einengung > 75 %: Grad 4 Eineingung %: Grad 3 Eineingung %: Grad 2 Einengung < 25 %: Grad 1 Als segmental wird eine Länge von 3 10 mm, als konfluierend eine Länge von > 10 mm bezeichnet. Der Befall wird schließlich in einen diffusen Befall bei über 25 % der Gallenwege und als lokalisiert bei unter 25 % eingestuft. Noch wichtiger als diese Einteilung ist jedoch die Definition von dominanten Strikturen, die durch einen Durchmesser von 1,5 mm des DHC bzw. 1 mm eines Hauptastes definiert werden [24, 25]. Sofern solche dominanten Strikturen nachgewiesen werden, muss das Vorliegen eines Cholangiokarzinomes angenommen werden, und es sollte eine Abb Endoskopische retrograde Cholangiografie einer typischen PSC. Unter Verwendung eines Ballonkatheters werden die intra- und extrahepatischen Gallenwege mit Kontrastmittel darstellt. Es zeigen sich zum Teil kurzstreckige, zum Teil langstreckige Stenosen mit einzelnen prästenotischen Dilatationen, sodass ein Perlschnurmuster entsteht (Das Bild wurde freundlicherweise von Dr. Heller, Berlin, zur Verfügung gestellt). 122
5 Differenzialdiagnosen lenstein, Infektion) und falsch negative PET-CT bei immer sehr kleinen Fallzahlen berichtet. In der Primärdiagnostik spielt das PET-CT keine Rolle. Abb Magnetresonanzcholangiografie einer PSC. Dargestellt sind die intra- und extrahepatischen Gallenwege sowie der Ductus Wirsungianus. Im rechten und linken Gallengang zeigen sich kurzstreckige Stenosen und angedeutete Dilatationen (Das Bild wurde freundlicherweise von PD Dr. Schreyer, Regensburg, zur Verfügung gestellt). Bürstenzytologie erfolgen. Da diese nur eine Sensitivität von im Durchschnitt 42 % hat [26], kann sie durch moderne molekulare Verfahren wie Fluoreszenz-in-Situ-Hybridisierung (FISH) oder digitale Bildanalyseverfahren (DIA) ergänzt werden [27]. Durch diese molekularen Verfahren kann die Sensitivität auf 70 % angehoben werden, bei einer sehr hohen Spezifität ( %). Alternativ kann bei dem Verdacht auf ein Cholangiokarzinom bei negativer Bürstenzytologie entweder erneut gebürstet werden oder ein intraduktaler Ultraschall (IDUS) oder auch eine Cholangioskopie im Rahmen der ERCP durchgeführt werden [28 30]. Bei letztgenannten Verfahren werden Sensitivitäten von um die 90 % bei einer Spezifität von über 90 % erreicht. Bisher sind beide Verfahren für den Routineeinsatz zur PSC-Überwachung nicht ausreichend etabliert. Schnittbildgebung: MRT, CT, PET-CT Angesichts einer Strahlenbelastung spielen CT-Untersuchungen in der Erstdiagnostik und der Karzinomüberwachung bisher eine untergeordnete Rolle, obwohl moderne CT-Geräte auch das Gallenwegssystem mehrdimensional mit guter Auflösung darstellen können. Zumeist wird jedoch das MRT eingesetzt und zur MRCP verrechnet, sodass man gleichzeitig eine 3-dimensionale Darstellung der Gallenwege und eine Schnittbilddiagnostik der übrigen Leber erhält. Ein neues Verfahren in der PSC-Diagnostik ist das PET-CT, über das bisher nur wenige Arbeiten veröffentlicht wurden [26]. Vom Prinzip her reichert sich 18 Fluorodeoxyglukose vermehrt im Tumor an und wird dann in diesem speziellen CT detektiert. Nach anfänglich sehr positiven Berichten wurde zuletzt auch über falsch positive (sekundärer Gal- Histologie Die klassische PSC ist durch makroskopische Veränderungen der Gallenwege gekennzeichnet. Gleichzeitig bestehen mikroskopische Veränderungen an den kleinen Gallenwegen, die bei manchen Patienten ohne gleichzeitige Veränderungen an den großen Gallenwegen auftreten. Dies ist die PSC der kleinen Gallengänge und geht bei 22 % der Betroffenen in eine klassische PSC über [1]. Somit findet sich bei diesen beiden PSC-Formen das gleiche histologische Bild. Als erste histologische Veränderungen finden sich Gallengangsproliferate und periportale Ödeme mit mononukleären Zellinfiltraten (Stadium I: portales Stadium) [31]. Im weiteren Verlauf kommt es zu einer Ausbreitung in das Leberparenchym, mit Periportalfibrose und vereinzelten Piecemeal-Nekrosen (Stadium II: periportales Stadium). Solange entweder ein Stadium I oder II besteht, ist die Prognose relativ gut, mit einer 5-Jahresüberlebensrate von ca. 90 % [31]. Im Stadium III tritt eine septale Fibrose mit Brückennekrosen auf, die schließlich in einer biliären Zirrhose (Stadium IV) münden. Die Prognose ist in diesen Stadien deutlich schlechter, mit 68 bzw. 40 % 5-Jahresüberlebensraten. Typische histologische Bilder einer PSC sind in Abb dargestellt Differenzialdiagnosen Die Differenzialdiagnosen (Tab. 3.22), die sich mit einer cholestatischen Laborkonstellation und Gallenuntergängen präsentieren, sind [31, 32]: primär biliäre Zirrhose Sarkoidose idiopathische Duktopenie des Erwachsenen Graft-versus-Host-Erkrankung medikamenteninduzierte Duktopenie Leberabstoßung sekundäre sklerosierende Cholangitiden Folgende Ursachen für sekundäre sklerosierende Cholangitiden wurden beschrieben [31, 32]: längere Intensivaufenthalte [33] AIDS-Cholangiopathie Autoimmunpankreatitis hepatische entzündliche Pseudotumoren eosinophile Cholangitis Mastzellencholangitis portale Biliopathie bei portaler Hypertension rezidivierende pyogene Cholangitis ischämische Cholangitis Mukoviszidose proliferative Cholangitis angeborene Cholangiopathien 123 3
6 Primäre sklerosierende Cholangitis Um diese Erkrankungen ausschließen zu können, ist die Anamnese (z. B. Lebertransplantation bei ischämischer Cholangitis oder Knochenmarkstransplantation bei GvHD), das Labor (Lipase, Differenzialblutbild, HIV-Serologie), eine sorgfältige Sonografie (portale Hypertension) und eine Bürstenzytologie im Rahmen einer ERCP hilfreich Assoziierte Erkrankungen und Komplikationen Assoziierte Erkrankungen Diagnostik der CED a b Neben dem oben beschriebenen Einhergehen der PSC mit CED besteht häufig eine Assoziation zur Autoimmunhepatitis (8 17% aller PSC-Patienten), insbesondere bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen [15]. Dabei werden insbesondere antinukleäre Antikörper und Antikörper gegen glatte Muskelzellen gehäuft gefunden. Unter einer Therapie mit Steroiden, niedrig dosiertem Aza und Ursodesoxycholsäure scheinen diese Patienten eine bessere Prognose zu haben als Patienten mit einer klassischen PSC. Weiterhin tritt bei PSC-Patienten oft eine verminderte Knochendichte auf. So zeigte sich bei 8,6 % ein T-Score von < 2,5, entsprechend einer Osteoporose [34]. Andere Gruppen berichten von einer verminderten Knochendichte bei bis zu 50 % der PSC-Patienten [31]. Diese Patienten waren älter, hatten eine CED und eine fortgeschrittene PSC. Es kann angenommen werden, dass 3 Faktoren für die Häufung der Osteopenie und Osteoporose verantwortlich sind: Resorptionsstörung für fettlösliche Vitamine (25-Hydroxyvitamin D) gleichzeitiges Bestehen einer CED PSC an sich Schließlich ist die PSC mit einer Reihe von Autoimmunerkrankungen assoziiert, darunter die Zöliakie, die retroperitoneale Fibrose und die rheumatoide Arthritis [31]. Bei Patienten nach Proktokolektomie mit ileoanaler Pouchanlage scheint eine Pouchitis gehäuft aufzutreten. Komplikationen c Abb. 3.26a c Histologische Veränderungen bei der PSC. a Portalfeld mit schütterem Rundzellinfiltrat und nur schemenhaft abgrenzbarem originärem Gallengang (*) mit degenerativen Epithelveränderungen (H&E, 200 x). b In der Cytokeratin-7-Immunhistologie zeigen sich degenerative Veränderungen des orginären Gallengangs sowie eine gerine duktuläre Reaktion und eine ausgeprägte duktuläre Metaplasie der periportalen Hepatozyten als Ausdruck der chronischen Cholestase (200 x). c Portalfeld mit einem schütteren Rundzellinfiltrat und einer konzentrischen, zwiebelschalenartigen periduktalen Fibrose mit komplettem Verlust des biliären Epithels (H&E, 100 x). (Die Bilder wurden freundlicherweise von Dr. Longerich, Heidelberg, zur Verfügung gestellt.) 124 Prinzipiell können bei der PSC 3 Gruppen von Komplikationen auftreten: 1. Komplikationen im Rahmen der Cholestase 2. Komplikationen im Rahmen der Leberzirrhose 3. PSC-spezifische Komplikationen Neben der o.g. Malabsorption fettlöslicher Vitamine kann es begleitend zu einer Steatorrhö und Fettmalabsorption kommen. Weiterhin führt die Cholestase zu typischen Symptomen der fortgeschrittenen cholestatischen Lebererkrankungen, insbesondere Pruritus, Ikterus und Müdigkeit. Gleichzeitig treten bei fortgeschrittener Fibrose bzw. Zirrhose typische Komplikationen auf, wie Ösophagusvarizenblutungen im Rahmen der portalen Hyperten-
7 Therapie Tabelle 3.22 Differenzialdiagnosen zur PSC (GG = Gallenweg, AMA = antimitochondrale Antikörper). Gruppe Krankheit Unterschied cholestatische Lebererkrankungen primär biliäre Zirrhose Sarkoidose ideopathische Duktopenie des Erwachsenen Graft vs. Host Disease medikamenteninduzierte Duktopenie Leberabstoßung AMA-positiv Histologie/Zytologie Z. n. Knochenmarkstranplantation Medikamentenanamnese Z. n. Lebertransplantation sekundäre sklerosierende Cholangitiden längerer Intensivaufenthalt AIDS-Cholangiopathie Autoimmunpankreatitis hepatischer Pseudotumor eosinophile Cholangitis Mastzellencholangitis portale Biliopathie rezidivierende pyogene Cholangitiden ischämische Cholangitis Mukoviszidose Verlauf HIV-Serologie, CD4-Zahlen IgG4, Sonografie, Histologie Sonografie GG-Zytologie, Differenzialblutbild GG-Zytologie Sonografie, Echokardiografie Anamnese, Verlauf Z. n. Lebertransplantation Anamnese, Verlauf 3 sion, Gerinnungsstörungen, Aszitesbildung und hepatische Enzephalopathie. Direkt mit der PSC einhergehende Komplikationen sind: bakterielle Cholangitiden sowie Candidainfektionen [14, 18] Gallenblasen- und Gallengangssteine [30, 35] Kolonkarzinome Pankreaskarzinome hepatozelluläre Karzinome v. a. Cholangiokarzinome [26, 36] Infektionen der Gallenwege treten praktisch ausschließlich bei Patienten mit dominanten Stenosen auf, sodass allgemein eine Antibiotikprophylaxe zur ERCP empfohlen wird. Sie vermag aber genauso wenig die Besiedlung zu verringern wie der Zusatz von Aminoglykosiden im Kontrastmittel während der ERCP. Vermutlich kommt es durch diese Infektionen gehäuft zu Steinbildungen in der Gallenblase und besonders im Gallengangsystem (bis zu 56 %). Im Rahmen der ERCP werden diese Steine bei ca. 30 % der Patienten nicht erkannt, wie eine Cholangioskopiestudie kürzlich zeigen konnte [30]. Malignome sind bei PSC-Patienten deutlich gehäuft. So starben innerhalb von im Durchschnitt 5,7 Jahren in einer großen schwedischen Kohorte 28 % aller Patienten, davon 44 % an Malignomen. Kolonkarzinome traten 10-mal, Pankreaskarzinome 14-mal und hepatobiliäre Karzinome 161-mal häufiger als in der Normalbevölkerung auf [36]. Bezogen auf kolorektale Karzinome ist entsprechend einer Metaanalyse das relative Risiko bei PSC und CU 4,3fach erhöht [37]. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, dass diese Karzinome häufig im rechtsseitigen Kolon liegen und oft erst im fortgeschrittenen Stadium festgestellt werden [38]. Das Cholangiokarzinom stellt ein Hauptproblem für Patienten mit PSC dar, weil ein kumulatives Risiko von bis zu 30 % besteht, der frühe Nachweis schwierig ist und weil die Prognose mit unter 10 % 2-Jahresüberleben nach Lebertransplantation ungünstig ist [31]. Multimodale neoadjuvante Therapieformen können evtl. einen Teil dieser Patienten doch einer Lebertransplantation zuführen, sodass dann bis zu 82 % der Betroffenen 5 Jahre überleben [31] Therapie Medikamentöse Therapie Die medikamentöse Therapie der PSC basiert in erster Linie auf der Gabe von Ursodesoxycholsäure (UDC) in einer Dosierung von mg/kg/tag. Diese Empfehlung basiert auf mehreren kleinen, zum Teil prospektiven Studien, die einen günstigen Effekt auf Laborwerte, Histologie und kürzlich Überlebenswahrscheinlichkeit unter 30 mg/kg/ Tag zeigten [39, 40]. Es muss aber auch erwähnt werden, dass es eine skandinavische Multizenterstudie gibt, in der unter mg/kg/tag kein positiver Effekt auf die Rate an Cholangiokarzinomen oder Überleben gesehen wurde [41]. Die Anreicherung von UDC in der Galle erreicht ein Plateau bei mg/kg /Tag [42]. Daher erscheint eine Dosis von mindestens 25 mg/kg/ Tag erforderlich, um relevant die Progression der PSC und evtl. sogar die Entwicklung eines Cholangiokarzinoms zu verhindern. Immerhin hatten in einer großen schwedischen Studie Patienten unter UDC signifikant weniger hepatobiliäre Karzinome [43]. Während der Effekt von UDC auf das Cholangiokarzinom noch kontrovers diskutiert wird, erscheint seine Wirksamkeit, bezogen auf die Prävention von kolitisassoziierten Kolonkarzinomen, gesichert [44, 45]. Unklar ist, ob UDC auch bei der PSC der kleinen Gallenwege eingesetzt werden sollte, da diese Untergruppe eine sehr gute Prognose hat und bei diesen Patienten bisher nur eine Verbesserung der Laborparameter gezeigt werden konnte [46]. 125
Magen-Darm-Trakt und Sjögren-Syndrom 7. Deutscher Sjögren Tag,
 Magen-Darm-Trakt und Sjögren-Syndrom 7. Deutscher Sjögren Tag, 08.03.2008 Dr. med. J. Rosendahl Department für Innere Medizin Medizinische Klinik & Poliklinik II Übersicht I -Speiseröhre - Schluckstörungen
Magen-Darm-Trakt und Sjögren-Syndrom 7. Deutscher Sjögren Tag, 08.03.2008 Dr. med. J. Rosendahl Department für Innere Medizin Medizinische Klinik & Poliklinik II Übersicht I -Speiseröhre - Schluckstörungen
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
 Chronisch entzündliche Darmerkrankungen Das CED-Handbuch für Klinik und Praxis von Jörg Hoffmann, Anton Kroesen, Bodo Klump 1. Auflage Chronisch entzündliche Darmerkrankungen Hoffmann / Kroesen / Klump
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen Das CED-Handbuch für Klinik und Praxis von Jörg Hoffmann, Anton Kroesen, Bodo Klump 1. Auflage Chronisch entzündliche Darmerkrankungen Hoffmann / Kroesen / Klump
Inhaltsverzeichnis. 1 Geschichte der CED Grundlagen der CED Diagnostik der CED Geschichte der chronisch entzündlichen
 Vorwort zur 2. Auflage Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte der CED.......................................................... 1 1 Geschichte der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED)............................
Vorwort zur 2. Auflage Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte der CED.......................................................... 1 1 Geschichte der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED)............................
LEBERERKRANKUNGEN BEI CED. Wolfgang Plieschnegger
 LEBERERKRANKUNGEN BEI CED Wolfgang Plieschnegger LEBERERKRANKUNGEN Infektiöse Erkrankungen Toxische Schädigungen Autoimmunerkrankungen Stoffwechselstörungen Speichererkrankungen Extrahepatische Ursachen
LEBERERKRANKUNGEN BEI CED Wolfgang Plieschnegger LEBERERKRANKUNGEN Infektiöse Erkrankungen Toxische Schädigungen Autoimmunerkrankungen Stoffwechselstörungen Speichererkrankungen Extrahepatische Ursachen
Medizinische Klinik III, UKA, RWTH-Aachen. Gallenblasen und Gallenwegserkrankungen
 Gallenblasen und Gallenwegserkrankungen Anatomie Spektrum der Gallenerkrankungen Steinbildung Entzündungen Abflussstörungen Malignome Cholangitis Cholezystolithiasis Cholezystitis Intrahepatisch Gallenblase
Gallenblasen und Gallenwegserkrankungen Anatomie Spektrum der Gallenerkrankungen Steinbildung Entzündungen Abflussstörungen Malignome Cholangitis Cholezystolithiasis Cholezystitis Intrahepatisch Gallenblase
Autoimmune Lebererkrankungen
 Autoimmune Lebererkrankungen Arzt-Patienten-Seminar der YAEL-Stiftung 27. Juni 2009 Dr. med. Christina Weiler-Normann I. Medizinische Klinik und Poliklinik Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Autoimmune
Autoimmune Lebererkrankungen Arzt-Patienten-Seminar der YAEL-Stiftung 27. Juni 2009 Dr. med. Christina Weiler-Normann I. Medizinische Klinik und Poliklinik Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Autoimmune
Was Sie über Gelbsucht wissen sollten!
 Was Sie über Gelbsucht wissen sollten! Frankfurter Gesundheitstage B. Kronenberger Samstag, 15. Juni 2013 von 15:00 bis 15:15 Uhr Sonntag, 16. Juni 2013 von 11:30 bis 11:45 Uhr Was ist eine Gelbsucht?
Was Sie über Gelbsucht wissen sollten! Frankfurter Gesundheitstage B. Kronenberger Samstag, 15. Juni 2013 von 15:00 bis 15:15 Uhr Sonntag, 16. Juni 2013 von 11:30 bis 11:45 Uhr Was ist eine Gelbsucht?
Die Unternehmergesellschaft
 Die Unternehmergesellschaft Recht, Besteuerung, Gestaltungspraxis Bearbeitet von Prof. Dr. Dr. hc. Michael Preißer, Gültan Acar 1. Auflage 2016. Buch. 300 S. Hardcover ISBN 978 3 7910 3445 4 Format (B
Die Unternehmergesellschaft Recht, Besteuerung, Gestaltungspraxis Bearbeitet von Prof. Dr. Dr. hc. Michael Preißer, Gültan Acar 1. Auflage 2016. Buch. 300 S. Hardcover ISBN 978 3 7910 3445 4 Format (B
Erhöhte Leberwerte: sinnvolle Abklärung. Klaus H.W.Böker Hannover. Deutscher Lebertag 2011 Hannover 1.12.
 Erhöhte Leberwerte: sinnvolle Abklärung Klaus H.W.Böker Hannover www.leberpraxis-hannover.de Wer ist überhaupt leberkrank; wie Leberkrankheiten erkennen? Symptome Ikterus, Inappetenz, Erschöpfung Schmerzen,
Erhöhte Leberwerte: sinnvolle Abklärung Klaus H.W.Böker Hannover www.leberpraxis-hannover.de Wer ist überhaupt leberkrank; wie Leberkrankheiten erkennen? Symptome Ikterus, Inappetenz, Erschöpfung Schmerzen,
Klinik für Hepatologie. Christoph Malenke
 Dense genotyping of immune-related disease regions identifies nine new risk loci for primary sclerosing cholangitis Nat Genet. 2013 June; 45(6): 670 675 Christoph Malenke Klinik für Hepatologie 2 Gliederung
Dense genotyping of immune-related disease regions identifies nine new risk loci for primary sclerosing cholangitis Nat Genet. 2013 June; 45(6): 670 675 Christoph Malenke Klinik für Hepatologie 2 Gliederung
Diagnostisches Vorgehen bei Leberraumforderungen. H. Diepolder
 Diagnostisches Vorgehen bei Leberraumforderungen H. Diepolder Bei 20% aller Routinesonographien fällt eine Leberraumforderung auf Problem Problem Bei 20% aller Routinesonographien fällt eine Leberraumforderung
Diagnostisches Vorgehen bei Leberraumforderungen H. Diepolder Bei 20% aller Routinesonographien fällt eine Leberraumforderung auf Problem Problem Bei 20% aller Routinesonographien fällt eine Leberraumforderung
Kognitive Verhaltenstherapie
 Kognitive Verhaltenstherapie Behandlung psychischer Störungen im Erwachsenenalter. Mit Online-Materialien Bearbeitet von Martin Hautzinger 1. Auflage 2011. Buch. 388 S. Hardcover ISBN 978 3 621 27771 6
Kognitive Verhaltenstherapie Behandlung psychischer Störungen im Erwachsenenalter. Mit Online-Materialien Bearbeitet von Martin Hautzinger 1. Auflage 2011. Buch. 388 S. Hardcover ISBN 978 3 621 27771 6
Klinische Psychologie: Körperliche Erkrankungen kompakt
 Klinische Psychologie: Körperliche Erkrankungen kompakt Mit Online-Materialien Bearbeitet von Claus Vögele 1. Auflage 2012. Taschenbuch. 170 S. Paperback ISBN 978 3 621 27754 9 Format (B x L): 19,4 x 25
Klinische Psychologie: Körperliche Erkrankungen kompakt Mit Online-Materialien Bearbeitet von Claus Vögele 1. Auflage 2012. Taschenbuch. 170 S. Paperback ISBN 978 3 621 27754 9 Format (B x L): 19,4 x 25
Gallenwegserkrankungen
 Leipzig, 28. November 2014 Gallenwegserkrankungen Johannes Wiegand Department für Innere Medizin, Neurologie und Dermatologie Medizinische Klinik und Poliklinik für Gastroenterologie und Rheumatologie
Leipzig, 28. November 2014 Gallenwegserkrankungen Johannes Wiegand Department für Innere Medizin, Neurologie und Dermatologie Medizinische Klinik und Poliklinik für Gastroenterologie und Rheumatologie
Fortgeschrittene Lebererkrankung bei CF und Indikation zur Lebertransplantation. Patrick Gerner Universitätskinderklinik Essen
 Fortgeschrittene Lebererkrankung bei CF und Indikation zur Lebertransplantation Patrick Gerner Universitätskinderklinik Essen Portale Hypertension, Oesophagusvarizen S.A. 21 J. Oesophagusvarizen Grad 3,
Fortgeschrittene Lebererkrankung bei CF und Indikation zur Lebertransplantation Patrick Gerner Universitätskinderklinik Essen Portale Hypertension, Oesophagusvarizen S.A. 21 J. Oesophagusvarizen Grad 3,
Autoimmune Hepatitiden
 Autoimmune Hepatitiden H. Klinker Medizinische Poliklinik der Universität Würzburg Direktor: Prof. Dr. K. Wilms Schwerpunkt Hepatologie/Infektiologie Leiter: Prof. Dr. H. Klinker Chronische Hepatitis -
Autoimmune Hepatitiden H. Klinker Medizinische Poliklinik der Universität Würzburg Direktor: Prof. Dr. K. Wilms Schwerpunkt Hepatologie/Infektiologie Leiter: Prof. Dr. H. Klinker Chronische Hepatitis -
Filme der Kindheit Kindheit im Film
 Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien 66 Filme der Kindheit Kindheit im Film Beispiele aus Skandinavien, Mittel- und Osteuropa Bearbeitet von Christine Gölz, Anja Tippner, Karin Hoff 1. Auflage
Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien 66 Filme der Kindheit Kindheit im Film Beispiele aus Skandinavien, Mittel- und Osteuropa Bearbeitet von Christine Gölz, Anja Tippner, Karin Hoff 1. Auflage
Soziale Phobie bei Jugendlichen
 Soziale Phobie bei Jugendlichen Kognitives Behandlungsmanual. Mit Online-Materialien Bearbeitet von Regina Steil, Simone Matulis, Franziska Schreiber, Ulrich Stangier 1. Auflage 2011. Buch. 194 S. Hardcover
Soziale Phobie bei Jugendlichen Kognitives Behandlungsmanual. Mit Online-Materialien Bearbeitet von Regina Steil, Simone Matulis, Franziska Schreiber, Ulrich Stangier 1. Auflage 2011. Buch. 194 S. Hardcover
Hepatitis C im Dialog
 Hepatitis C im Dialog 100 Fragen - 100 Antworten Herausgegeben von Stefan Zeuzem 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com
Hepatitis C im Dialog 100 Fragen - 100 Antworten Herausgegeben von Stefan Zeuzem 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com
Dr. med. Ioannis Pilavas, Patientenuniversität Essen, 7. April Chronische Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse Stent oder Operation?
 Dr. med. Ioannis Pilavas, Patientenuniversität Essen, 7. April 2015 Chronische Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse Stent oder Operation? Häufigkeit der chronischen Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung)
Dr. med. Ioannis Pilavas, Patientenuniversität Essen, 7. April 2015 Chronische Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse Stent oder Operation? Häufigkeit der chronischen Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung)
Was gibt es Neues in der Therapie? YAEL Arzt-Patientenseminar, Hamburg Christoph Schramm I. Medizinische Klinik und Poliklinik, UKE
 Was gibt es Neues in der Therapie? YAEL Arzt-Patientenseminar, Hamburg 2011 Christoph Schramm I. Medizinische Klinik und Poliklinik, UKE Autoimmune Lebererkrankungen Autoimmune Lebererkrankungen Autoimmune
Was gibt es Neues in der Therapie? YAEL Arzt-Patientenseminar, Hamburg 2011 Christoph Schramm I. Medizinische Klinik und Poliklinik, UKE Autoimmune Lebererkrankungen Autoimmune Lebererkrankungen Autoimmune
Lebererkrankungen. Oliver Schröder Medizinische Klinik I Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
 Lebererkrankungen Oliver Schröder Medizinische Klinik I Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Symptome bei Lebererkrankungen Fieber Müdigkeit Leistungsschwäche Abgeschlagenheit
Lebererkrankungen Oliver Schröder Medizinische Klinik I Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Symptome bei Lebererkrankungen Fieber Müdigkeit Leistungsschwäche Abgeschlagenheit
Mikrobiologische Diagnostik- wann ist was sinnvoll?
 Mikrobiologische Diagnostik- wann ist was sinnvoll? Radiologisch-internistisches Forum 09.07.2008 C. Ott Enge Assoziation von Infektionen mit CED fragliche pathogenetische Bedeutung von M. paratuberculosis
Mikrobiologische Diagnostik- wann ist was sinnvoll? Radiologisch-internistisches Forum 09.07.2008 C. Ott Enge Assoziation von Infektionen mit CED fragliche pathogenetische Bedeutung von M. paratuberculosis
Borderline-Therapie. Psychodynamik, Behandlungstechnik und therapeutische Settings. Bearbeitet von Dr. Mathias Lohmer, Otto F.
 Borderline-Therapie Psychodynamik, Behandlungstechnik und therapeutische Settings Bearbeitet von Dr. Mathias Lohmer, Otto F. Kernberg überarbeitet 2013. Taschenbuch. 244 S. Paperback ISBN 978 3 7945 2917
Borderline-Therapie Psychodynamik, Behandlungstechnik und therapeutische Settings Bearbeitet von Dr. Mathias Lohmer, Otto F. Kernberg überarbeitet 2013. Taschenbuch. 244 S. Paperback ISBN 978 3 7945 2917
Leitfaden Herztransplantation
 Leitfaden Herztransplantation Interdisziplinäre Betreuung vor, während und nach Herztransplantation Bearbeitet von Christof Schmid, Stephan Hirt, Hans Heinrich Scheld 3. Aufl. 2009. Taschenbuch. xi, 208
Leitfaden Herztransplantation Interdisziplinäre Betreuung vor, während und nach Herztransplantation Bearbeitet von Christof Schmid, Stephan Hirt, Hans Heinrich Scheld 3. Aufl. 2009. Taschenbuch. xi, 208
Primär Sklerosierende Cholangitis und Autoimmunhepatitis
 Primär Sklerosierende Cholangitis und Autoimmunhepatitis Patrick Gerner GPGE Jahrestagung 2013, Heidelberg Folie 2 Gerner Pädiatrische Endoskopie Interessenkonflikt: - Novartis: Unterstützung eines Familientages
Primär Sklerosierende Cholangitis und Autoimmunhepatitis Patrick Gerner GPGE Jahrestagung 2013, Heidelberg Folie 2 Gerner Pädiatrische Endoskopie Interessenkonflikt: - Novartis: Unterstützung eines Familientages
4.1 Hepatozelluläres Karzinom (HCC)
 4.1 Hepatozelluläres Karzinom (HCC) Hepatozelluläre Karzinome (HCC) sind die häufigsten primären Lebertumoren und machen etwa 85 % der primären Lebermalignome aus. In Europa tritt das HCC zumeist bei Patienten
4.1 Hepatozelluläres Karzinom (HCC) Hepatozelluläre Karzinome (HCC) sind die häufigsten primären Lebertumoren und machen etwa 85 % der primären Lebermalignome aus. In Europa tritt das HCC zumeist bei Patienten
Autoimmune Lebererkrankungen Welche Therapiemöglichkeiten bieten sich? Christiane Wiegard I. Medizinische Klinik und Poliklinik, UKE 27.
 Autoimmune Lebererkrankungen Autoimmune Lebererkrankungen Welche Therapiemöglichkeiten bieten sich? Christiane Wiegard I. Medizinische Klinik und Poliklinik, UKE 27. Juni 2009 Richtige und Falsche Immunantwort
Autoimmune Lebererkrankungen Autoimmune Lebererkrankungen Welche Therapiemöglichkeiten bieten sich? Christiane Wiegard I. Medizinische Klinik und Poliklinik, UKE 27. Juni 2009 Richtige und Falsche Immunantwort
Erste klinische Erfahrungen mit der Lumivision MRCP
 MR 2015 Garmisch - 16th International MRI Symposium Lunchsymposium Bender Gruppe 30.01.2015 Garmisch-Partenkirchen MRT des Abdomens und MRCP Wie geht es weiter? Erste klinische Erfahrungen mit der Lumivision
MR 2015 Garmisch - 16th International MRI Symposium Lunchsymposium Bender Gruppe 30.01.2015 Garmisch-Partenkirchen MRT des Abdomens und MRCP Wie geht es weiter? Erste klinische Erfahrungen mit der Lumivision
Hauptvorlesung Innere Medizin - Gastroenterologie. Lebererkrankungen II
 Hauptvorlesung Innere Medizin - Gastroenterologie Lebererkrankungen II Akuter versus chronischer Leberschaden Akuter Leberschaden: Akute Hepatitis A, B, E Paracetamol-/ Amanitin-Intox. Idiosynkratische
Hauptvorlesung Innere Medizin - Gastroenterologie Lebererkrankungen II Akuter versus chronischer Leberschaden Akuter Leberschaden: Akute Hepatitis A, B, E Paracetamol-/ Amanitin-Intox. Idiosynkratische
Lese-Rechtschreib-Störung
 Lese-Rechtschreib-Störung Ein Leben mit LRS - Wege und Chancen Bearbeitet von 1. Auflage 2014. Taschenbuch. 146 S. Paperback ISBN 978 3 7945 2998 8 Format (B x L): 16,5 x 24 cm Weitere Fachgebiete > Pädagogik,
Lese-Rechtschreib-Störung Ein Leben mit LRS - Wege und Chancen Bearbeitet von 1. Auflage 2014. Taschenbuch. 146 S. Paperback ISBN 978 3 7945 2998 8 Format (B x L): 16,5 x 24 cm Weitere Fachgebiete > Pädagogik,
Virale Hepatitis. Dienstag, Fortbildung Kinderärzte -Vereinigung Zentralschweiz Virale Hepatitis - Hepatitis A - B- C
 Fortbildung Kinderärzte -Vereinigung Zentralschweiz Fortbildung Kinderärzte Vereinigung Zentralschweiz Dienstag 26. Juni 2012 Beurteilung Leberfunktion Virale Hepatitis Virale Hepatitis Hepatitis A Hepatitis
Fortbildung Kinderärzte -Vereinigung Zentralschweiz Fortbildung Kinderärzte Vereinigung Zentralschweiz Dienstag 26. Juni 2012 Beurteilung Leberfunktion Virale Hepatitis Virale Hepatitis Hepatitis A Hepatitis
Definition. Entzündliche abakterielle Nierenerkrankungen mit Befall unterchiedlicher glomerulärer Strukturen
 Glomerulonephritis Definition Entzündliche abakterielle Nierenerkrankungen mit Befall unterchiedlicher glomerulärer Strukturen Ursachen Insgesamt eher seltene Erkrankung Zweithäufigste Ursache einer chronischen
Glomerulonephritis Definition Entzündliche abakterielle Nierenerkrankungen mit Befall unterchiedlicher glomerulärer Strukturen Ursachen Insgesamt eher seltene Erkrankung Zweithäufigste Ursache einer chronischen
kontrolliert wurden. Es erfolgte zudem kein Ausschluss einer sekundären Genese der Eisenüberladung. Erhöhte Ferritinkonzentrationen wurden in dieser S
 5.8 Zusammenfassung Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse dieser Studie erscheint die laborchemische Bestimmung der Transferrinsättigung zur Abklärung einer unklaren Lebererkrankung und Verdacht
5.8 Zusammenfassung Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse dieser Studie erscheint die laborchemische Bestimmung der Transferrinsättigung zur Abklärung einer unklaren Lebererkrankung und Verdacht
Medizin im Vortrag. Herausgeber: Prof. Dr. med. Christoph Frank Dietrich. Kolorektales Karzinom
 Medizin im Vortrag Herausgeber: Prof. Dr. med. Christoph Frank Dietrich Kolorektales Karzinom Autoren: Dr. med. Stefan Krüger Dr. med. Edgar Hartung Kerstin Siehr Prof. Dr. med. Christoph Frank Dietrich
Medizin im Vortrag Herausgeber: Prof. Dr. med. Christoph Frank Dietrich Kolorektales Karzinom Autoren: Dr. med. Stefan Krüger Dr. med. Edgar Hartung Kerstin Siehr Prof. Dr. med. Christoph Frank Dietrich
Erhöhte Leberwerte. Stephan Krähenbühl Klinische Pharmakologie & Toxikologie USB
 Erhöhte Leberwerte Stephan Krähenbühl Klinische Pharmakologie & Toxikologie USB Transaminasen was ist normal? Verteilung der Transaminasen bei 579 männlichen und 457 weiblichen Blutspendern Asymmetrische
Erhöhte Leberwerte Stephan Krähenbühl Klinische Pharmakologie & Toxikologie USB Transaminasen was ist normal? Verteilung der Transaminasen bei 579 männlichen und 457 weiblichen Blutspendern Asymmetrische
Notfall-ERCP Indikationen - Durchführung - Nachsorge
 Notfall-ERCP Indikationen - Durchführung - Nachsorge Frankfurt 02.05.2013 Jörg Bojunga Medizinische Klinik I Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Grundsätzliche Indikationen zur ERCP Diagnostisch
Notfall-ERCP Indikationen - Durchführung - Nachsorge Frankfurt 02.05.2013 Jörg Bojunga Medizinische Klinik I Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Grundsätzliche Indikationen zur ERCP Diagnostisch
Der Impfkurs. Eine Anleitung zum richtigen Impfen. Bearbeitet von Prof. Dr. Wolfgang Jilg
 Der Impfkurs Eine Anleitung zum richtigen Impfen Bearbeitet von Prof. Dr. Wolfgang Jilg 3. Auflage 2015 2015. Taschenbuch. 232 S. Paperback ISBN 978 3 609 51075 0 Format (B x L): 14,8 x 21 cm Gewicht:
Der Impfkurs Eine Anleitung zum richtigen Impfen Bearbeitet von Prof. Dr. Wolfgang Jilg 3. Auflage 2015 2015. Taschenbuch. 232 S. Paperback ISBN 978 3 609 51075 0 Format (B x L): 14,8 x 21 cm Gewicht:
Gibt es ein Osteoporose-Risiko bei Patienten mit Autoimmunen Lebererkrankungen?
 Autoimmune Lebererkrankungen Gibt es ein Osteoporose-Risiko bei Patienten mit Autoimmunen Lebererkrankungen? Christiane Wiegard Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf I. Medizinische Klinik und Poliklinik
Autoimmune Lebererkrankungen Gibt es ein Osteoporose-Risiko bei Patienten mit Autoimmunen Lebererkrankungen? Christiane Wiegard Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf I. Medizinische Klinik und Poliklinik
Zwänge verstehen und hinter sich lassen
 Zwänge verstehen und hinter sich lassen Was Betroffene und Angehörige selbst tun können Bearbeitet von Katarina Stengler 1. Auflage 2007. Taschenbuch. 152 S. Paperback ISBN 978 3 8304 3389 7 Format (B
Zwänge verstehen und hinter sich lassen Was Betroffene und Angehörige selbst tun können Bearbeitet von Katarina Stengler 1. Auflage 2007. Taschenbuch. 152 S. Paperback ISBN 978 3 8304 3389 7 Format (B
Fachhandbuch für F11 - Innere Medizin (8. FS) Inhaltsverzeichnis. 1. Übersicht über die Unterrichtsveranstaltungen... 2
 Fachhandbuch für F11 - Innere Medizin (8. FS) Inhaltsverzeichnis 1. Übersicht über die Unterrichtsveranstaltungen... 2 1.1. Vorlesung... 2 1.2. Unterricht am Krankenbett... 3 2. Beschreibung der Unterrichtsveranstaltungen...
Fachhandbuch für F11 - Innere Medizin (8. FS) Inhaltsverzeichnis 1. Übersicht über die Unterrichtsveranstaltungen... 2 1.1. Vorlesung... 2 1.2. Unterricht am Krankenbett... 3 2. Beschreibung der Unterrichtsveranstaltungen...
Leitliniengerechte Therapie bei metastasiertem kolorektalem Karzinom
 Leitliniengerechte Therapie bei metastasiertem kolorektalem Karzinom Case Report NZW Dresden 2010 Stefan Schalbaba stefan.schalbaba@klinikum-memmingen.de Patientenidentität und Subjektive Daten Patient
Leitliniengerechte Therapie bei metastasiertem kolorektalem Karzinom Case Report NZW Dresden 2010 Stefan Schalbaba stefan.schalbaba@klinikum-memmingen.de Patientenidentität und Subjektive Daten Patient
Rationale Diagnostik bei Transaminasenerhöhung
 Rationale Diagnostik bei Transaminasenerhöhung Intensivkurs Pädiatrische Hepatologie 12.-14. Juni 2013 in Mülheim an der Ruhr Simone.Kathemann@uk-essen.de Transaminasenerhöhung -GOT und GPT sind erhöht
Rationale Diagnostik bei Transaminasenerhöhung Intensivkurs Pädiatrische Hepatologie 12.-14. Juni 2013 in Mülheim an der Ruhr Simone.Kathemann@uk-essen.de Transaminasenerhöhung -GOT und GPT sind erhöht
Kasuistiken aus der Rheumatologie
 Fortbildung der SLÄK zur Lyme-Borreliose Dresden, 20.02.2013 Kasuistiken aus der Rheumatologie Dr. Christoph Lübbert Fachbereich Infektions- und Tropenmedizin Prof. Dr. Christoph Baerwald Sektion Rheumatologie
Fortbildung der SLÄK zur Lyme-Borreliose Dresden, 20.02.2013 Kasuistiken aus der Rheumatologie Dr. Christoph Lübbert Fachbereich Infektions- und Tropenmedizin Prof. Dr. Christoph Baerwald Sektion Rheumatologie
1 Leber. 3 Pankreas. Inhaltsverzeichnis
 X 1 Leber Fokale Leberläsionen... 1 M. Taupitz und B. Hamm Einleitung... 1 Indikationen... 1 Untersuchungstechnik... 1 Bildgebung der normalen Anatomie... 11 Bildgebung pathologischer Befunde... 12 Anwendung
X 1 Leber Fokale Leberläsionen... 1 M. Taupitz und B. Hamm Einleitung... 1 Indikationen... 1 Untersuchungstechnik... 1 Bildgebung der normalen Anatomie... 11 Bildgebung pathologischer Befunde... 12 Anwendung
Sonographie bei portaler Hypertonie
 Sonographie bei portaler Hypertonie Gian-Marco Semadeni 2 Klinik Hepatische Encephalopathie Spontane bakterielle Peritonitis Hepatorenale Syndrom 3 Posthepatisch Intrahepatisch Prähepatisch HVPG norm
Sonographie bei portaler Hypertonie Gian-Marco Semadeni 2 Klinik Hepatische Encephalopathie Spontane bakterielle Peritonitis Hepatorenale Syndrom 3 Posthepatisch Intrahepatisch Prähepatisch HVPG norm
Referat Blut Teil 3: Leukämien
 n 1. Definition Bei einer handelt es sich um eine bösartige (maligne) Erkrankung der weißen Blutkörperchen, bei der es zu einer qualitativen und meist auch quantitativen Veränderung der Leukozyten kommt.
n 1. Definition Bei einer handelt es sich um eine bösartige (maligne) Erkrankung der weißen Blutkörperchen, bei der es zu einer qualitativen und meist auch quantitativen Veränderung der Leukozyten kommt.
schnell und portofrei erhältlich bei
 Der große TRIAS-Ratgeber für Nierenkranke Erkrankungen, Untersuchungen, Therapien - Aktiver Schutz Bearbeitet von Johannes Mann, Ulrich Dendorfer, Jörg Franke 1. Auflage 2008. Taschenbuch. 191 S. Paperback
Der große TRIAS-Ratgeber für Nierenkranke Erkrankungen, Untersuchungen, Therapien - Aktiver Schutz Bearbeitet von Johannes Mann, Ulrich Dendorfer, Jörg Franke 1. Auflage 2008. Taschenbuch. 191 S. Paperback
11. Radiologisch Internistisches Forum. Pankreas/Gallenwege: ERCP zur Diagnostik und zum Staging
 KLINIK UND POLIKLINIK FÜR INNERE MEDIZIN I 11. Radiologisch Internistisches Forum DIAGNOSE UND STAGING GASTROINTESTINALER TUMOREN WAS HAT SICH GEÄNDERT? Pankreas/Gallenwege: ERCP zur Diagnostik und zum
KLINIK UND POLIKLINIK FÜR INNERE MEDIZIN I 11. Radiologisch Internistisches Forum DIAGNOSE UND STAGING GASTROINTESTINALER TUMOREN WAS HAT SICH GEÄNDERT? Pankreas/Gallenwege: ERCP zur Diagnostik und zum
Vorwort zur 2. Auflage
 Vorwort zur 2. Auflage Seit Erscheinen der ersten Auflage 2004 hat sich unser Verständnis der Pathogenese vertieft und die Diagnostik verfeinert. So wissen wir heute, dass die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
Vorwort zur 2. Auflage Seit Erscheinen der ersten Auflage 2004 hat sich unser Verständnis der Pathogenese vertieft und die Diagnostik verfeinert. So wissen wir heute, dass die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
Autoimmune Lebererkrankungen. 22. Oktober 2013, 19:00 Uhr
 Autoimmune Lebererkrankungen 22. Oktober 2013, 19:00 Uhr Dr. rer. nat. Brit Kieselbach Institut für Medizinische Diagnostik Berlin, Nicolaistraße 22, 12247 Berlin +49 3077001-220, info@inflammatio.de Autoimmune
Autoimmune Lebererkrankungen 22. Oktober 2013, 19:00 Uhr Dr. rer. nat. Brit Kieselbach Institut für Medizinische Diagnostik Berlin, Nicolaistraße 22, 12247 Berlin +49 3077001-220, info@inflammatio.de Autoimmune
Stammzelltransplantation
 Cornelie Haag Medizinische Klinik und Poliklinik 1 Universitätsklinikum Carl-Gustav-Carus Dresden 1 Klinische Einteilung - Begriffsbestimmung Autologe Quelle: Patient selbst KM oder peripheres Blut (Apherese)
Cornelie Haag Medizinische Klinik und Poliklinik 1 Universitätsklinikum Carl-Gustav-Carus Dresden 1 Klinische Einteilung - Begriffsbestimmung Autologe Quelle: Patient selbst KM oder peripheres Blut (Apherese)
Therapeutische Endoskopie
 Therapeutische Endoskopie Priv-Doz. Dr. med. Jonas Mudter Endoskopische Untersuchungen sind nicht nur bei der Diagnostik und Therapiekontrolle der CED von Bedeutung. Sie bieten neben chirurgischen Eingriffen
Therapeutische Endoskopie Priv-Doz. Dr. med. Jonas Mudter Endoskopische Untersuchungen sind nicht nur bei der Diagnostik und Therapiekontrolle der CED von Bedeutung. Sie bieten neben chirurgischen Eingriffen
Psychotherapie in Psychiatrie und Psychosomatik. Narzissmus. Theorie, Diagnostik, Therapie
 Psychotherapie in Psychiatrie und Psychosomatik Narzissmus Theorie, Diagnostik, Therapie Bearbeitet von Gerhard Dammann, Isa Sammet, Bernhard Grimmer 1. Auflage 2012. Taschenbuch. 200 S. Paperback ISBN
Psychotherapie in Psychiatrie und Psychosomatik Narzissmus Theorie, Diagnostik, Therapie Bearbeitet von Gerhard Dammann, Isa Sammet, Bernhard Grimmer 1. Auflage 2012. Taschenbuch. 200 S. Paperback ISBN
Epilepsie und Psyche
 Epilepsie und Psyche Psychische Störungen bei Epilepsie - epileptische Phänomene in der Psychiatrie Bearbeitet von Prof. Dr. Ludger Tebartz van Elst, Dr. Evgeniy Perlov 1. Auflage 2013. Taschenbuch. 230
Epilepsie und Psyche Psychische Störungen bei Epilepsie - epileptische Phänomene in der Psychiatrie Bearbeitet von Prof. Dr. Ludger Tebartz van Elst, Dr. Evgeniy Perlov 1. Auflage 2013. Taschenbuch. 230
Pankreas / Gallenwege
 INSTITUT FÜR ROENTGENDIAGNOSTIK Pankreas / Gallenwege MRT und MRCP N. Zorger 2 Aufgaben der Bildgebung Aufgaben der Bildgebung Pankreas- Gallengangs- Gallenblasen- Tumordetektion Differentialdiagnostik
INSTITUT FÜR ROENTGENDIAGNOSTIK Pankreas / Gallenwege MRT und MRCP N. Zorger 2 Aufgaben der Bildgebung Aufgaben der Bildgebung Pankreas- Gallengangs- Gallenblasen- Tumordetektion Differentialdiagnostik
Serum- und Stuhlmarker hilfreich für Diagnose und Prognose?
 KLINIK UND POLIKLINIK FÜR INNERE MEDIZIN I Serum- und Stuhlmarker hilfreich für Diagnose und Prognose? F. Klebl Stuhlmarker Produkte neutrophiler Granulozyten Calprotectin Lactoferrin S100A12 PMN-Elastase
KLINIK UND POLIKLINIK FÜR INNERE MEDIZIN I Serum- und Stuhlmarker hilfreich für Diagnose und Prognose? F. Klebl Stuhlmarker Produkte neutrophiler Granulozyten Calprotectin Lactoferrin S100A12 PMN-Elastase
Rationale Diagnostik ik von Autoimmunthyreopathien
 2. Mühldo orfer Schild ddrüs sensym mposium Rationale Diagnostik ik von Autoimmunthyreopathien Dr. Christos Koutsampelas Facharzt für Nuklearmedizin dia.log Diagnostische Radiologie Altötting Nuklearmedizinische
2. Mühldo orfer Schild ddrüs sensym mposium Rationale Diagnostik ik von Autoimmunthyreopathien Dr. Christos Koutsampelas Facharzt für Nuklearmedizin dia.log Diagnostische Radiologie Altötting Nuklearmedizinische
KOLOREKTALES KARZINOM: SCREENING UND SURVEILLANCE BEI CHRONISCH ENTZÜNDLICHEN DARMERKRANKUNGEN
 KOLOREKTALES KARZINOM: SCREENING UND SURVEILLANCE BEI CHRONISCH ENTZÜNDLICHEN DARMERKRANKUNGEN Sieglinde Angelberger, Reingard Platzer, Gottfried Novacek Juli 2013 Risiko für Kolorektales Karzinom Statement:
KOLOREKTALES KARZINOM: SCREENING UND SURVEILLANCE BEI CHRONISCH ENTZÜNDLICHEN DARMERKRANKUNGEN Sieglinde Angelberger, Reingard Platzer, Gottfried Novacek Juli 2013 Risiko für Kolorektales Karzinom Statement:
Fall einer hereditären Hämochromatose (HH) Dr. med. Carl M. Oneta Schaffhauserstrasse Winterthur
 Fall einer hereditären Hämochromatose (HH) Dr. med. Carl M. Oneta Schaffhauserstrasse 7 8400 Winterthur Fall (Klinik) 48 jähriger Patient, Wirtschaftsmanager, Vater von 3 Kindern, bisher immer bei guter
Fall einer hereditären Hämochromatose (HH) Dr. med. Carl M. Oneta Schaffhauserstrasse 7 8400 Winterthur Fall (Klinik) 48 jähriger Patient, Wirtschaftsmanager, Vater von 3 Kindern, bisher immer bei guter
Leistung und Auswahl. TRUEtome. Optimierte Führungsdraht-Sondierung zur Behandlung pankreatikobiliärer Erkrankungen. Sondierungspapillotom
 Leistung und Auswahl Optimierte Führungsdraht-Sondierung zur Behandlung pankreatikobiliärer Erkrankungen TRUEtome Mit dem TRUEtome können endoskopische retrograde Cholangiopankreatographieverfahren (ERCP)
Leistung und Auswahl Optimierte Führungsdraht-Sondierung zur Behandlung pankreatikobiliärer Erkrankungen TRUEtome Mit dem TRUEtome können endoskopische retrograde Cholangiopankreatographieverfahren (ERCP)
Indirekte Sterbehilfe
 Neuere Medizin- und Wissenschaftsgeschichte 27 Indirekte Sterbehilfe Medizinische, rechtliche und ethische Perspektiven Bearbeitet von Sophie Roggendorf 1. Auflage 2011. Taschenbuch. 204 S. Paperback ISBN
Neuere Medizin- und Wissenschaftsgeschichte 27 Indirekte Sterbehilfe Medizinische, rechtliche und ethische Perspektiven Bearbeitet von Sophie Roggendorf 1. Auflage 2011. Taschenbuch. 204 S. Paperback ISBN
Freya Banning
 Heilpraktiker Multiple Choice Prüfungsfragen mit Lösungen Es gibt 3 Antwortvarianten: Nur eine Antwort ist richtig 2 Antworten sind richtig Antwortkombination (eine der vorgeschlagen Antworten ist richtig)
Heilpraktiker Multiple Choice Prüfungsfragen mit Lösungen Es gibt 3 Antwortvarianten: Nur eine Antwort ist richtig 2 Antworten sind richtig Antwortkombination (eine der vorgeschlagen Antworten ist richtig)
Klebsiella oxytoca als Ursache der hämorrhagischen
 Klebsiella oxytoca als Ursache der hämorrhagischen Antibiotikacolitis a.o. Univ. Prof. Dr. Christoph Högenauer, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin Graz.
Klebsiella oxytoca als Ursache der hämorrhagischen Antibiotikacolitis a.o. Univ. Prof. Dr. Christoph Högenauer, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin Graz.
Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom
 Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom Mit ausführlicher Darstellung des GuK-Systems Bearbeitet von Prof. Dr. Etta Wilken 12., überarbeitete und erweiterte Auflage 2014 2014. Taschenbuch. 235 S.
Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom Mit ausführlicher Darstellung des GuK-Systems Bearbeitet von Prof. Dr. Etta Wilken 12., überarbeitete und erweiterte Auflage 2014 2014. Taschenbuch. 235 S.
Bandscheiben-Aktiv-Programm
 Bandscheiben-Aktiv-Programm Endlich wieder schmerzfrei - dauerhaft belastbar bleiben Bearbeitet von Doris Brötz, Michael Weller 2. vollst. überarb. erw. Aufl. 2010. Taschenbuch. 140 S. Paperback ISBN 978
Bandscheiben-Aktiv-Programm Endlich wieder schmerzfrei - dauerhaft belastbar bleiben Bearbeitet von Doris Brötz, Michael Weller 2. vollst. überarb. erw. Aufl. 2010. Taschenbuch. 140 S. Paperback ISBN 978
Wenn Alkohol zum Problem wird
 Wenn Alkohol zum Problem wird Suchtgefahren erkennen - den Weg aus der Abhängigkeit finden Bearbeitet von Michael Soyka 1. Auflage 2009. Taschenbuch. 168 S. Paperback ISBN 978 3 8304 3415 3 Format (B x
Wenn Alkohol zum Problem wird Suchtgefahren erkennen - den Weg aus der Abhängigkeit finden Bearbeitet von Michael Soyka 1. Auflage 2009. Taschenbuch. 168 S. Paperback ISBN 978 3 8304 3415 3 Format (B x
Definition des akuten Leberversagens
 Definition des akuten Leberversagens Plötzlicher Beginn eines Leberversagens bei einem Patienten ohne Hinweis für eine chronische Lebererkrankung Ursachen des akuten Leberversagens virale Hepatitis A,
Definition des akuten Leberversagens Plötzlicher Beginn eines Leberversagens bei einem Patienten ohne Hinweis für eine chronische Lebererkrankung Ursachen des akuten Leberversagens virale Hepatitis A,
was ist das? Reizdarmsyndrom
 1 was ist das? 2 Was ist das? Der Begriff bezeichnet im weitesten Sinne das Zusammentreffen einer Vielzahl von unterschiedlichen Symptomen, die bei den Betroffenen auftreten. Ihr Arzt fasst diese Symptome
1 was ist das? 2 Was ist das? Der Begriff bezeichnet im weitesten Sinne das Zusammentreffen einer Vielzahl von unterschiedlichen Symptomen, die bei den Betroffenen auftreten. Ihr Arzt fasst diese Symptome
Epstein-Barr-Virus-Infektion: Möglichkeiten und Grenzen der serologischen Diagnostik von Reaktivierungen und chronischen Verläufen
 Epstein-Barr-Virus-Infektion: Möglichkeiten und Grenzen der serologischen Diagnostik von Reaktivierungen und chronischen Verläufen Dr. Claudia Wolff Viramed Biotech AG 1 Akute EBV-Primärinfektion Erster
Epstein-Barr-Virus-Infektion: Möglichkeiten und Grenzen der serologischen Diagnostik von Reaktivierungen und chronischen Verläufen Dr. Claudia Wolff Viramed Biotech AG 1 Akute EBV-Primärinfektion Erster
Erkrankungen des Kolon
 Erkrankungen des Kolon (Beispiele) Die wichtigsten Erkrankungen Tumore Hier unterscheiden wir zwischen gutartigen und bösartigen Tumoren. Zu den gutartigen Tumoren zählen wir: Polypen (falls ohne histologischem
Erkrankungen des Kolon (Beispiele) Die wichtigsten Erkrankungen Tumore Hier unterscheiden wir zwischen gutartigen und bösartigen Tumoren. Zu den gutartigen Tumoren zählen wir: Polypen (falls ohne histologischem
Psychosoziale Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik
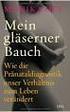 Psychosoziale Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik Evaluation der Modellprojekte in Bonn, Düsseldorf und Essen Bearbeitet von A. Rohde, G. Woopen 1. Auflage 2007. Taschenbuch. 153 S. Paperback ISBN
Psychosoziale Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik Evaluation der Modellprojekte in Bonn, Düsseldorf und Essen Bearbeitet von A. Rohde, G. Woopen 1. Auflage 2007. Taschenbuch. 153 S. Paperback ISBN
Autoimmunhepatitis und PSC
 Autoimmunhepatitis und PSC Patrick Gerner Intensivkurs Pädiatrische Hepatologie, 12.-14.06.2013 Folie 2 Gerner Pädiatrische Endoskopie CRP neg., SGOT/SGPT: 1028/1307U/l, gamma- GT 661U/l, Bilirubin, 3,5
Autoimmunhepatitis und PSC Patrick Gerner Intensivkurs Pädiatrische Hepatologie, 12.-14.06.2013 Folie 2 Gerner Pädiatrische Endoskopie CRP neg., SGOT/SGPT: 1028/1307U/l, gamma- GT 661U/l, Bilirubin, 3,5
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Prof. Dr. Tamás Decsi Kinderklinik, UNI Pécs
 Chronisch entzündliche Darmerkrankungen Prof. Dr. Tamás Decsi Kinderklinik, UNI Pécs Häufigkeit: Morbus Crohn In den letzten Jahren haben die Inzidenz und die Prävalenz (verbesserte Lebenserwartung) stetig
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen Prof. Dr. Tamás Decsi Kinderklinik, UNI Pécs Häufigkeit: Morbus Crohn In den letzten Jahren haben die Inzidenz und die Prävalenz (verbesserte Lebenserwartung) stetig
Sklerosierende Cholangitis: primär sklerosierende Cholangitis (PSC) und sekundär sklerosierende Cholangitis (SSC)
 Falk Gastro-Kolleg Leber und Gallenwege Sklerosierende Cholangitis: primär sklerosierende Cholangitis (PSC) und sekundär sklerosierende Cholangitis (SSC) Prof. Dr. U. Leuschner Interdisziplinäres Facharztzentrum
Falk Gastro-Kolleg Leber und Gallenwege Sklerosierende Cholangitis: primär sklerosierende Cholangitis (PSC) und sekundär sklerosierende Cholangitis (SSC) Prof. Dr. U. Leuschner Interdisziplinäres Facharztzentrum
Figur und Handlung im Märchen
 Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien 82 Figur und Handlung im Märchen Die «Kinder- und Hausmärchen» der Brüder Grimm im Licht der daoistischen Philosophie Bearbeitet von Liping Wang /??? 1.
Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien 82 Figur und Handlung im Märchen Die «Kinder- und Hausmärchen» der Brüder Grimm im Licht der daoistischen Philosophie Bearbeitet von Liping Wang /??? 1.
Handbuch Röntgen mit Strahlenschutz
 ecomed Medizin Handbuch Röntgen mit Strahlenschutz Verfahren, Strahlenschutzvorschriften Bearbeitet von Hartmut Reichow, Max Heymann, Wolfgang Menke, Dirk Höwekenmeier Grundwerk mit 17. Ergänzungslieferung
ecomed Medizin Handbuch Röntgen mit Strahlenschutz Verfahren, Strahlenschutzvorschriften Bearbeitet von Hartmut Reichow, Max Heymann, Wolfgang Menke, Dirk Höwekenmeier Grundwerk mit 17. Ergänzungslieferung
Herzlich Willkommen zum
 Herzlich Willkommen zum 1 Chronisch entzündliche Darmerkrankungen Medikamentöse Therapie Dr. M. Geppert SHG MC-CU 17.05.2013 Die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) sind: Morbus Crohn Colitis
Herzlich Willkommen zum 1 Chronisch entzündliche Darmerkrankungen Medikamentöse Therapie Dr. M. Geppert SHG MC-CU 17.05.2013 Die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) sind: Morbus Crohn Colitis
Inhaltsverzeichnis. Magendarmtrakt. Endoskopie und Funktionsdiagnostik
 Inhaltsverzeichnis Magendarmtrakt Ösophagus 1.1 Dysphagie... 17 1.2 Achalasie... 20 1.3 Ösophagusspasmus... 21 1.4 Hyperkontraktiler Ösophagus... 21 1.5 Schatzki-Ring und Webs... 22 1.6 Divertikel... 22
Inhaltsverzeichnis Magendarmtrakt Ösophagus 1.1 Dysphagie... 17 1.2 Achalasie... 20 1.3 Ösophagusspasmus... 21 1.4 Hyperkontraktiler Ösophagus... 21 1.5 Schatzki-Ring und Webs... 22 1.6 Divertikel... 22
NON-HODGKIN-LYMPHOME (C82-C85)
 EPIDEMIOLOGISCHE KREBSREGISTRIERUNG // EINZELNE KREBSARTEN NON-HODGKIN-LYMPHOME (C82-C85) SITUATION IN DEUTSCHLAND INZIDENZ UND MORTALITÄT MÄNNER FRAUEN Altersstandardisierte Rate (/1.) Europastandard
EPIDEMIOLOGISCHE KREBSREGISTRIERUNG // EINZELNE KREBSARTEN NON-HODGKIN-LYMPHOME (C82-C85) SITUATION IN DEUTSCHLAND INZIDENZ UND MORTALITÄT MÄNNER FRAUEN Altersstandardisierte Rate (/1.) Europastandard
Die Erwartungen der Eltern an die weiterführende Schule beim Schulübertritt ihres Kindes von der Grundschule in die Sekundarstufe I
 Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes 1035 Die Erwartungen der Eltern an die weiterführende Schule beim Schulübertritt ihres Kindes von
Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes 1035 Die Erwartungen der Eltern an die weiterführende Schule beim Schulübertritt ihres Kindes von
Informationsbroschüre Risiko Hepatitis C
 Dres. med. Fenner & Kollegen Gemeinschaftspraxis für Labormedizin und Humangenetik Informationsbroschüre Risiko Hepatitis C Das Hepatitis-C-Virus ein Silent Killer Dr. med. Claus Fenner FA Laboratoriumsmedizin,
Dres. med. Fenner & Kollegen Gemeinschaftspraxis für Labormedizin und Humangenetik Informationsbroschüre Risiko Hepatitis C Das Hepatitis-C-Virus ein Silent Killer Dr. med. Claus Fenner FA Laboratoriumsmedizin,
Krafttraining bei Kindern und Jugendlichen
 Krafttraining bei Kindern und Jugendlichen Hintergründe, Trainingspläne, Übungen Bearbeitet von Michael Fröhlich, Jürgen Gießing, Andreas Strack überarbeitet 2011. Taschenbuch. 224 S. Paperback ISBN 978
Krafttraining bei Kindern und Jugendlichen Hintergründe, Trainingspläne, Übungen Bearbeitet von Michael Fröhlich, Jürgen Gießing, Andreas Strack überarbeitet 2011. Taschenbuch. 224 S. Paperback ISBN 978
Mathe: sehr gut, 6. Klasse - Buch mit Download für phase-6
 mentor sehr gut: Deutsch, Mathe, Englisch für die 5. - 8. Klasse Mathe: sehr gut,. Klasse - Buch mit Download für phase- Mit Download für phase- Bearbeitet von Uwe Fricke 1. Auflage 2009. Taschenbuch.
mentor sehr gut: Deutsch, Mathe, Englisch für die 5. - 8. Klasse Mathe: sehr gut,. Klasse - Buch mit Download für phase- Mit Download für phase- Bearbeitet von Uwe Fricke 1. Auflage 2009. Taschenbuch.
Vorlesung Leber / Ikterus. Universitätsklinikum Düsseldorf Institut für Laboratoriumsdiagnostik / Zentrallabor
 Vorlesung Leber / Ikterus Universitätsklinikum Düsseldorf Institut für Laboratoriumsdiagnostik / Zentrallabor Das Organ Leber die Leber ist mit 1500g-2000g unser größtes inneres Organ Funktionen Elimination
Vorlesung Leber / Ikterus Universitätsklinikum Düsseldorf Institut für Laboratoriumsdiagnostik / Zentrallabor Das Organ Leber die Leber ist mit 1500g-2000g unser größtes inneres Organ Funktionen Elimination
Leben mit chronischer Erschöpfung - CFS
 Leben mit chronischer Erschöpfung - CFS Ein Ratgeber für Patienten von J. Strienz überarbeitet Leben mit chronischer Erschöpfung - CFS Strienz schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG
Leben mit chronischer Erschöpfung - CFS Ein Ratgeber für Patienten von J. Strienz überarbeitet Leben mit chronischer Erschöpfung - CFS Strienz schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG
Wenn Alkohol zum Problem wird
 Wenn Alkohol zum Problem wird Suchtgefahren erkennen - den Weg aus der Abhängigkeit finden Bearbeitet von Michael Soyka 1. Auflage 2009. Taschenbuch. 168 S. Paperback ISBN 978 3 8304 3415 3 Format (B x
Wenn Alkohol zum Problem wird Suchtgefahren erkennen - den Weg aus der Abhängigkeit finden Bearbeitet von Michael Soyka 1. Auflage 2009. Taschenbuch. 168 S. Paperback ISBN 978 3 8304 3415 3 Format (B x
50 Strategien, die falschen Mitarbeiter zu finden... und wie Sie es besser machen können
 50 Strategien, die falschen Mitarbeiter zu finden... und wie Sie es besser machen können Bearbeitet von Uwe Peter Kanning 1. Auflage 2017. Buch. 264 S. Hardcover ISBN 978 3 407 36622 1 Format (B x L):
50 Strategien, die falschen Mitarbeiter zu finden... und wie Sie es besser machen können Bearbeitet von Uwe Peter Kanning 1. Auflage 2017. Buch. 264 S. Hardcover ISBN 978 3 407 36622 1 Format (B x L):
Zeitung als Zeichen. Identität und Mediennutzung nationaler Minderheiten in Deutschland. Bearbeitet von Swea Starke
 Zeitung als Zeichen Identität und Mediennutzung nationaler Minderheiten in Deutschland Bearbeitet von Swea Starke 1. Auflage 2014. Taschenbuch. XIII, 286 S. Paperback ISBN 978 3 631 65738 6 Format (B x
Zeitung als Zeichen Identität und Mediennutzung nationaler Minderheiten in Deutschland Bearbeitet von Swea Starke 1. Auflage 2014. Taschenbuch. XIII, 286 S. Paperback ISBN 978 3 631 65738 6 Format (B x
Reihe, PARETO. Mamma. Bearbeitet von Uwe Fischer, Friedemann Baum. 1. Auflage Buch. 256 S. ISBN Format (B x L): 12,5 x 19 cm
 Reihe, PARETO Mamma Bearbeitet von Uwe Fischer, Friedemann Baum 1. Auflage 2006. Buch. 256 S. ISBN 978 3 13 137231 4 Format (B x L): 12,5 x 19 cm Weitere Fachgebiete > Medizin > Sonstige Medizinische Fachgebiete
Reihe, PARETO Mamma Bearbeitet von Uwe Fischer, Friedemann Baum 1. Auflage 2006. Buch. 256 S. ISBN 978 3 13 137231 4 Format (B x L): 12,5 x 19 cm Weitere Fachgebiete > Medizin > Sonstige Medizinische Fachgebiete
Der große Patientenratgeber Morbus Crohn und Colitis ulcerosa
 Der große Patientenratgeber Morbus Crohn und Colitis ulcerosa von Prof. Dr. Julia Seiderer-Nack 1. Auflage Der große Patientenratgeber Morbus Crohn und Colitis ulcerosa Seiderer-Nack schnell und portofrei
Der große Patientenratgeber Morbus Crohn und Colitis ulcerosa von Prof. Dr. Julia Seiderer-Nack 1. Auflage Der große Patientenratgeber Morbus Crohn und Colitis ulcerosa Seiderer-Nack schnell und portofrei
3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome
 3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome Untersucht wurden insgesamt 26 Melanome, die zwischen 1991 und 1997 in der Universitätsklinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie
3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome Untersucht wurden insgesamt 26 Melanome, die zwischen 1991 und 1997 in der Universitätsklinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie
Extraintestinale Manifestationen! bei! Morbus Crohn / Colitis Ulcerosa! "
 Extraintestinale Manifestationen! bei! Morbus Crohn / Colitis Ulcerosa! R. Grüner Arzt - Patienten Seminar Morbus Crohn / Colitis ulcerosa 25. September 2010 Extraintestinale Manifestationenbei Morbus
Extraintestinale Manifestationen! bei! Morbus Crohn / Colitis Ulcerosa! R. Grüner Arzt - Patienten Seminar Morbus Crohn / Colitis ulcerosa 25. September 2010 Extraintestinale Manifestationenbei Morbus
Brandschutz im Detail - Türen, Tore, Fenster
 Brandschutz im Detail - Türen, Tore, Fenster Planung Montage Abnahme Wartung Bearbeitet von Hans P Mink 1. Auflage 2010. Buch. 253 S. Hardcover ISBN 978 3 939138 77 8 Format (B x L): 17 x 24 cm Weitere
Brandschutz im Detail - Türen, Tore, Fenster Planung Montage Abnahme Wartung Bearbeitet von Hans P Mink 1. Auflage 2010. Buch. 253 S. Hardcover ISBN 978 3 939138 77 8 Format (B x L): 17 x 24 cm Weitere
Verlässlicher Grammatik-Transfer
 Transferwissenschaften 8 Verlässlicher Grammatik-Transfer Am Beispiel von subordinierenden Konjunktionen Bearbeitet von Alaa Mohamed Moustafa 1. Auflage 2011. Buch. XIV, 294 S. Hardcover ISBN 978 3 631
Transferwissenschaften 8 Verlässlicher Grammatik-Transfer Am Beispiel von subordinierenden Konjunktionen Bearbeitet von Alaa Mohamed Moustafa 1. Auflage 2011. Buch. XIV, 294 S. Hardcover ISBN 978 3 631
ISO 9001: vom Praktiker für Praktiker. Bearbeitet von Norbert Waldy
 ISO 9001: 2015 vom Praktiker für Praktiker Bearbeitet von Norbert Waldy 1. Auflage 2015. Buch. 168 S. Hardcover ISBN 978 3 7323 3353 0 Format (B x L): 14 x 21 cm Gewicht: 385 g Wirtschaft > Management
ISO 9001: 2015 vom Praktiker für Praktiker Bearbeitet von Norbert Waldy 1. Auflage 2015. Buch. 168 S. Hardcover ISBN 978 3 7323 3353 0 Format (B x L): 14 x 21 cm Gewicht: 385 g Wirtschaft > Management
Depression. Helfen und sich nicht verlieren
 Depression. Helfen und sich nicht verlieren Ein Ratgeber für Freunde und Familie Bearbeitet von Huub Buijssen, Eva Grambow Deutsche Erstausgabe 2016. Buch. 187 S. Hardcover ISBN 978 3 407 85919 8 Format
Depression. Helfen und sich nicht verlieren Ein Ratgeber für Freunde und Familie Bearbeitet von Huub Buijssen, Eva Grambow Deutsche Erstausgabe 2016. Buch. 187 S. Hardcover ISBN 978 3 407 85919 8 Format
Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen Diagnose
 Morbus Fabry - Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen - Vom unklaren Sympto Morbus Fabry Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen
Morbus Fabry - Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen - Vom unklaren Sympto Morbus Fabry Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen
Depression und Manie
 Depression und Manie Erkennen und erfolgreich behandeln Bearbeitet von Christian Simhandl, Klaudia Mitterwachauer 1. Auflage 2007. Taschenbuch. xiv, 150 S. Paperback ISBN 978 3 211 48642 9 Format (B x
Depression und Manie Erkennen und erfolgreich behandeln Bearbeitet von Christian Simhandl, Klaudia Mitterwachauer 1. Auflage 2007. Taschenbuch. xiv, 150 S. Paperback ISBN 978 3 211 48642 9 Format (B x
ZUKUNFT. Die Gallenblase aus internistischer und chirurgischer Sicht
 Die Gallenblase aus internistischer und chirurgischer Sicht KRANKENHAUS MIT ZUKUNFT Bronzeleber aus Piacenza Zentrum für Hepato-Pankreatiko-Biliäre Erkrankungen des Sana Klinikums Hameln Pyrmont PD Dr.
Die Gallenblase aus internistischer und chirurgischer Sicht KRANKENHAUS MIT ZUKUNFT Bronzeleber aus Piacenza Zentrum für Hepato-Pankreatiko-Biliäre Erkrankungen des Sana Klinikums Hameln Pyrmont PD Dr.
