r z T z b e n m SprachSenSibler Fachunterricht Sprachbildung und leseförderung in berlin
|
|
|
- Judith Dressler
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 SprachSenSibler Fachunterricht A C W o r t sc h T z r b e i t a i g f n m p u r z g h j d v u ä s s k h d l h Sprachbildung und leseförderung in berlin Handreichung zur Wortschatzarbeit in den Jahrgangsstufen 5 10 unter besonderer Berücksichtigung der Fachsprache
2 impressum herausgeber Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Bernhard-Weiß-Str. 6 D Berlin-Mitte Tel.: erarbeitung Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) Ludwigsfelde-Struveshof Tel.: autorinnen und autoren Dr. Dorothea Bolte, Sabine Both, Nadine Düppe, Dr. Christoph Hamann, Birgit Kölle, Thomas Krehan, Astrid Lehmann, Oliver Pechstein, Dr. Anett Pilz, Mike Reblin, Katrin Reinisch, Thea Sarich, Dr. Ilona Siehr, Prof. Dr. Winfried Ulrich Redaktion Birgit Kölle, Dr. Ilona Siehr Grafiken Nadine Düppe, Erna Hattendorf, Christa Penserot, Thea Sarich, Dr. Ilona Siehr, Horst Zeitler Druck isbn Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM); August 2013 Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte einschließlich Übersetzung, Nachdruck und Vervielfältigung des Werkes sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des LISUM in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine Vervielfältigung für schulische Zwecke ist erwünscht. Das LISUM ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder Berlin und Brandenburg im Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (MBJS).
3 Vorwort Der Wortschatz ist eine zentrale Voraussetzung sowohl für das Verstehen und Verfassen von Texten als auch für die mündliche Kommunikation. Er prägt und formt die Vorstellungen von der Welt. Konzepte wie Kindheit, Nahrung, Wachstum werden durch Begriffe gestützt, die ihnen eine Bedeutung geben, sie abgrenzen und in Zusammenhänge einordnen lassen. In der Sekundarstufe I ist der Grundwortschatz in der Regel gefestigt. Für die Lernenden kommt es nun darauf an, ihren Wortschatz auszubauen und zu differenzieren. Dabei geht es einerseits um den bildungssprachlichen Wortschatz, der eine abstraktere und begriffich ausgerichtete Ausdrucksweise fördert. Andererseits geht es um den Fachwortschatz, mit dem spezifische Sachverhalte etwa aus den Natur oder Gesellschaftswissenschaften erschlossen werden. Eine Grundorientierung liefert der Fremdsprachenunterricht. In ihm lernen Schülerinnen und Schüler wichtige Strategien der Wortschatzaneignung wie z. B. den aktiven Umgang mit Wortbildungsregeln. Besonders im Fach Mathematik wird die Fähigkeit gefördert, eine präzise Terminologie in kurzen Sätzen und Anweisungen zu verstehen und anzuwenden: Schnell erkennen, was gemeint ist, und klar die eigenen Intentionen ausdrücken, führt zu erfolgreicher Arbeit sowohl gemeinsam mit anderen als auch individuell. Hierbei geht es nicht nur um die Verwendung treffender Wörter, sondern immer auch um die Nutzung geeigneter Formulierungen. Da die Wortschatzarbeit im Rahmen von Sprachbildung und Leseförderung einen zentralen Stellenwert einnimmt, möchten wir Ihnen mit dieser Handreichung Ideen und Materialien für Ihren Unterricht und darüber hinaus für die Arbeit im Fachteam und am schulinternen Curriculum bieten. Wir hoffen, dass wir Ihnen reichhaltige Anregungen geben können, und wünschen Ihnen viel Erfolg! Birgit Kölle Fachaufsicht Deutsch und Koordination künstlerische Fächer Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Dr. Gisela Beste Abteilungsleiterin Unterrichtsentwicklung Sek. I/II/GOST und E learning LISUM 3
4
5 Inhalt Einführung Dorothea Bolte Einführung 9 1 Schulischer Alltag zwei Beispiele 10 2 Möglichkeiten der Umsetzung 12 3 Mögliche Schwerpunkte eines Sprachbildungsprogramms 12 Literatur 15 Wortschatzarbeit im Deutschunterricht Astrid Lehmann, Anett Pilz, Thea Sarich 1 Wortschatzarbeit heißt Arbeiten mit Wörtern 19 2 Aufgabenformen und Methoden zur Arbeit am Fach und Allgemeinwortschatz 23 3 Methodenkoffer Assoziatives Netz Fragekarten Lernkarten Lerntagebuch Tabu Wörter finden/formulieren Lernplakat Mind Map Partnerinterview Sag es anders Advance Organizer Klangnetz Domino Kugellagerübung Über den Rand Schreiben Textlupe Vier Ecken Methode Wörterkette Wörterparty Wörterpuzzle Wortkasten Stichwortkarten Wörterhexagon 49 5
6 4 Aufgabenbeispiele zur Arbeit am Fach und Allgemeinwortschatz Wortschatzarbeit am Beispiel der Gattung Ballade Wortschatzarbeit am Thema Werbung 77 5 Wortschatzarbeit und Aufgabenstellungen 83 6 Anhang 87 Literatur 91 Wortschatzarbeit im Englischunterricht Katrin Reinisch 1 Bedeutung der Wortschatzarbeit im Fach Englisch 95 2 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von Wortschatz im Fach Englisch Einführung von Wortschatz/neue Lexik Phase der Übung und Festigung; Behaltenstechniken Phonetik/Betonung/Aussprache Schreibung Erste Vernetzung Mnemotechniken Übergang ins Mentale Lexikon : Nutzen der Wörter für die Kommunikation und den Kompetenzerwerb Überprüfung des Wortschatzes (mündlich/schriftlich) Strategien für die Formulierung und Beispiele gelungener Aufgabenstellungen 109 Literatur 119 Wortschatzarbeit im Geografieunterricht Nadine Düppe Wortschatzarbeit im Geografieunterricht Notwendigkeit von sprachlicher Arbeit im Geografieunterricht Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von (Fach )wörtern und Formulierungen Aufgabenformulierung im Geografieunterricht Die Arbeit mit Operatoren Satzstrukturen 163 Literatur 165 Wortschatzarbeit im Geschichtsunterricht Christoph Hamann, Thomas Krehan 1 Fachdidaktische Überlegungen Königsherrschaft im Mittelalter Die fünf Schritte der Wortschatzarbeit Aufgabenformulierungen im Geschichtsunterricht Die Arbeit mit Operatoren Aufgabenkonstruktion: vorher nachher 205 Literatur 207 6
7 Wortschatzarbeit im Mathematikunterricht Mike Reblin 1 Bedeutung der Wortschatzarbeit im Mathematikunterricht Einbindung von Texten und Kontexten in den Unterricht Fachbegriffe im Mathematikunterricht Allgemeinwortschatz im Mathematikunterricht Möglichkeiten des Aufbaus eines Fachwortschatzes Bewusste Arbeit am Fachwortschatz Sprache als Bestandteil des Mathematikunterrichts Aufgabenstellungen zur besseren Einbindung von Sprache in den Mathematikunterricht Beispiele aus der Schulpraxis Aufgabenformulierungen ändern und dabei verbessern Operatoren 230 Literatur 233 Wortschatzarbeit im naturwissenschaftlichen Unterricht Biologie, Chemie, Physik Sabine Both, Oliver Pechstein, Ilona Siehr 1 Warum ist Wortschatzarbeit im Fachunterricht wichtig? Didaktischer Rahmen der Wortschatzarbeit Alltagssprache und Fachsprache Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz Wortbedeutungen im Kontext vernetzen Begriffe aus dem Kontext erschließen und ordnen Arbeit mit Ober und Unterbegriffen Den Wortschatz über den Rhythmus üben und festigen (Kindergarten 5. Schuljahr) Den Wortschatz mit semantischen Wortlisten erweitern Den Wortschatz mit Textpräsentationen festigen Den Wortschatz mit Wortfamilien und Wortfeldern systematisch festigen Mit Antonymen und Synonymen bewusst umgehen Texte mit Schlüsselwörtern entschlüsseln Zusammensetzungen und Ableitungen entschlüsseln Umgang mit Fachwortschatz und Fachtexten Den Wortschatz mit Mindmap und Cluster strukturieren und erweitern Wortbeziehungen mit Begriffsnetz und Advance Organizer visualisieren Wortzusammenhänge mit Strukturlegetechnik erklären Feine Unterschiede der Vieldeutigkeit von Wörtern erkennen Redewendungen bewusst aufnehmen und Metaphern bewusst anwenden Strategien für die Formulierung und Beispiele gelungener Aufgabenstellungen 295 Literatur 301 7
8 Wissenschaftliche Grundlagen der Wortschatzarbeit im Fachunterricht Winfried Ulrich Wissenschaftliche Grundlagen der Wortschatzarbeit im Fachunterricht Welche Bedeutung hat der erworbene Wortschatz für die allgemeine Sprachkompetenz eines Menschen? Auf welchen Wortschatz greift man beim Sprachhandeln zu? Wie erfolgt der Wortschatzerwerb? Wie ist der innere Wortspeicher, das mentale Lexikon aufgebaut? Wie werden die Einheiten des mentalen Lexikons erlernt? Wie unterscheiden sich Grob und Feinstruktur des mentalen Lexikons? Wie fördert man im Unterricht eine Wortschatzerweiterung? Wie fördert man im Unterricht eine Wortschatzvertiefung? Wie unterscheidet sich der Fachwortschatz vom Allgemeinwortschatz? Wie erfolgt die Begriffsbildung/Begriffskonstruktion? Objekt/Sachverhalt (Fach )Begriff Sprachzeichen/(Fach )Wort Wie können Operatoren helfen, Arbeitsanweisungen besser zu verstehen? Welche Operatoren können für die Wortschatzarbeit genutzt werden? Welche fachübergreifenden Verabredungen der Lehrkräfte zu Wortschatzarbeit, Arbeitsaufträgen und Operatoren erscheinen sinnvoll? 322 Literatur 327 8
9 Einführung Dorothea Bolte
10
11 Einführung Durch die Vermittlung von Fachwissen in der Sekundarstufe I gewinnt die Wortschatzarbeit für jede Schülerin und jeden Schüler eine zusätzliche Bedeutung. Immer mehr wird die Fähigkeit benötigt, komplexe Texte zu verstehen, d. h. den Grundschulwortschatz im Gespräch, lesend und schreibend erheblich zu erweitern. Um im Fachunterricht erfolgreich lernen zu können, müssen sich die Schülerinnen und Schüler die sogenannte Bildungssprache aneignen. Darunter versteht man 1 dasjenige sprachliche Register, in dem man sich mit den Mitteln der Schulbildung ein grundlegendes Orientierungswissen verschaffen kann. Gemeint ist damit die Beherrschung sprachlicher Formen, die für das Lernen und das Erfassen komplexer Sachverhalte unerlässlich sind. Bildungssprache orientiert sich stark an den Regeln des Schriftsprachgebrauchs und muss von den Schülerinnen und Schülern beherrscht werden, wenn sie z. B. Lernaufgaben verstehen wollen. Gleichzeitig wird dadurch ein Fundament für eine erfolgreiche Schul- und Berufskarriere der Lernenden geschaffen. Dieser Prozess stellt jedoch hohe Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler:» Sprachliche Formen werden aus dem ihnen bekannten situativen Kontext herausgelöst und weiter ausgebaut. Somit wird die bisher beherrschte Alltagsbedeutung bekannter Wörter durch weitere und damit irritierende Bedeutungen in Frage gestellt. Diese Wörter müssen in ihrer Komplexität und Bedeutungsvielfalt im fachwissenschaftlichen und fächerübergreifenden Kontext des Schulunterrichts neu gelernt werden.» Texte im Unterricht werden in der Sek I abstrakter und präsentieren ihre Informationen anders als in der Grundschule, nämlich enorm verdichtet und komplex durch neu zu erlernende grammatische Verbindungen sowie durch eine Häufung von schwierigen Wörtern und grammatikalischen Strukturen. Für Kinder, die Deutsch als zweite oder dritte Sprache lernen und zudem außerhalb der Schule dem im Unterricht geforderten Sprachgebrauch nie oder nur selten begegnen, bedeutet dieser Schritt in den Erwerb von Bildungssprache in den Fächern eine zusätzliche Hürde, die die Lehrperson durch bewusste Entscheidungen über das Lehrarrangement sowie Hilfen durch einen gezielt sprachbildend gestalteten Unterricht niedrig halten muss. Aber auch muttersprachliche deutsche Lernende stehen zum Teil in diesem Bereich vor großen Problemen, je nach sozialer Herkunft und familiärem Rückhalt beim Spracherwerb. 1 Vgl. Habermas 1981 und Gogolin/Lange
12 Sprachsensibler Fachunterricht Einführung 1 Schulischer Alltag zwei Beispiele Im Biologieunterricht einer 7. Klasse wird nach der Unterrichtseinheit Photosynthese ein Test geschrieben, in dem die Schülerinnen und Schüler vielfach nicht ihr Wissen zeigen können. Hier zwei der Aufgaben: 1. Zimmerpflanzen nehmen verschiedene Stoffe aus ihrer Umwelt auf. In der Abbildung sind die Stoffe dargestellt. Streiche die Stoffe durch, die nicht von der Pflanze aufgenommen werden. Sauerstoff Zucker Erde Stickstoff Kohlenstoffdioxid Mineralstoffe Wasser 2. Unterstreiche die Stoffe, die über die Blätter aufgenommen werden. (Hervorhebungen in Fettdruck DB) Viele Schülerinnen und Schüler unterstrichen alle Begriffe und bekamen dafür null Punkte. Sie scheiterten aufgrund einer Lese-Fehlleistung. Ihr aus dem Unterricht gelerntes Wissen wurde also nicht honoriert. Wie kann diese Fehlleistung erklärt werden? Die Operatoren Streiche durch sowie Unterstreiche wurden nicht in ihrer unterschiedlichen Bedeutung erkannt; die Schülerinnen und Schüler machten keinen Unterschied zwischen durchstreichen und unterstreichen. Dies könnte daran liegen, dass etwa im Imperativ die Vorsilbe getrennt wird (vgl.: Unterstreiche! Streiche durch!) und der zweite Teil des Imperativs Streiche (die Stoffe) durch nicht wahrgenommen wurde. Eine weitere Fehlerquelle liegt vermutlich in dem Umstand, dass die Präposition über als Angabe des Mittels den Schülerinnen und Schülern nicht bekannt war. Das Pons-Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache gibt für die Präposition über 20 Bedeutungen an. Von diesen tragen die meisten mit einer rein grammatischen, zeitlichen oder örtlichen Bestimmung die Hauptbedeutung der Präposition und sind den Schülerinnen und Schülern vertraut: Ich freue mich über eine gute Note, Ich ziehe die Jacke über den Pullover, vielleicht auch: Der Zug nach Hannover fährt über Wolfsburg oder Übers Wochenende fahre ich zu meiner Freundin. 12 Die Angabe des Mittels mit der Präposition über ist den Schülerinnen und Schülern allerdings nicht geläufig, da sie vorwiegend in der exakten fachwissenschaftlichen Sphäre zu finden ist. Von daher führt der Satz Der Nährstoff wird über die Blätter aufgenommen sie direkt in eine Irritation oder ein Missverständnis. Spontan würden Schülerinnen und Schüler wohl, aus ihrer Sicht durchaus korrekt, formulieren: wird von den Blättern aufgenommen, was jedoch fachlich
13 Einführung unpräzise ist, da die Formulierung über die Blätter auf die im Unterricht relevanten Fakten der Leitungsbahnen in der Pflanze verweisen. Die Exaktheit der Aufgabenformulierung verwirrt also in diesem Fall die Schülerinnen und Schüler, die sich ja erst auf dem Weg in das Gebiet der exakten Wissenschaften befinden. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie fachliche Unterrichtssprache, Aufgabenblätter und Lehrbuchtexte im Unterricht der Mathematik, Natur- und Gesellschaftswissenschaften von Stolperstellen geprägt sind, die den Schülerinnen und Schülern das Verständnis und das nachhaltige Lernen erschweren. Scheinbar bekannte Begriffe erweisen sich im fachwissenschaftlichen Kontext als nicht mehr sicher gewusst und damit mehrdeutig, was sich z. B. ebenfalls am Begriff der Stoff zeigen lässt. Weitere Beispiele: Das aus dem Grammatikunterricht bekannte Objekt etwa verliert seine mühsam erworbene Bedeutung im Kontext des Biologieunterrichts bzw. muss als mehrdeutig erkannt werden. Wendungen wie Bedeutung tragen oder eine Kraft erfahren verwirren einen Lerner im ersten Kontakt, denn in die vertraute Bedeutungsebene der Alltagssprache mischen sich fachsprachliche Sonderbedeutungen. Vertraute Begründungen und Erläuterungen docken durch diese in den Augen der Schülerinnen und Schüler verfremdete Sprachverwendung nicht mehr an die gewohnte Alltagswelt an. Diese Fachsprache ist verdichtet und u. a. geprägt von komplexen Nominalkonstruktionen, d. h. anstelle von Nebensätzen werden den Nomen viele bedeutungstragende Elemente hinzugefügt, wie z. B. in der hochinformativen, aber außerordentlich schwer lesbaren Satzkonstruktion Ökologische Bedeutung haben die Spinnentiere vorwiegend durch Humus bildende, Insekten vertilgende und als Parasiten lebende Arten. 2 Zusätzlich haben die Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl von Proformen 3 sowie verkürzte oder ungewöhnliche Nebensatzkonstruktionen, Formeln und Abkürzungen zu dekodieren. In Untersuchungen ist festgestellt worden, dass von den Schülerinnen und Schülern vor allem Kenntnisse in den folgenden grammatischen Bereichen gefordert werden 4 :» Passivkonstruktionen (z. B. Die Summe wird multipliziert mit )» Partizipialattribute ( die resultierende Differenz )» weitere Attribute unterschiedlicher Komplexität» Komposita ( Schnittmenge )» unpersönliche Ausdrücke z. B. mit man oder es wird» Verwendung des Konjunktivs» Konstruktionen mit lassen» Nominalisierungen 2 Biologie plus 2006, S Unter Proformen versteht man alle Stellvertreter für bereits genannte Elemente im Text wie Personalpronomen (er, sie, es etc.), Pronominaladverbien (z. B. daher, deshalb, dagegen etc.) sowie Frage-, Possessiv- und Demonstrativpronomen. Die Zuordnung von Proformen zu ihren Bezugswörtern ist eine entscheidende Voraussetzung zur Fähigkeit, Texten Sinn zu entnehmen. Infos nach: Rösch 2005, S. 137f. 4 Vgl. Feilke 2012, S. 5 und S. 9 13
14 Sprachsensibler Fachunterricht Einführung 2 Möglichkeiten der Umsetzung Um einen nachhaltigen Erfolg des sprachsensiblen Fachunterrichts zu erreichen, ist eine Kooperation und Vernetzung auf Schulebene und in den Fachbereichen unverzichtbar. Das Prinzip der durchgängigen Sprachbildung sollte das übergeordnete Ziel sein, d. h. alle Lehrer werden zu Sprachlehrern. Konkret heißt dies, dass das schulinterne Sprachbildungskonzept in fachübergreifenden Gremien weiter konkretisiert werden muss, und zwar möglichst durch eine von der Sprachbildungskoordinatorin bzw. vom Sprachbildungskoordinator geleitete Sprachbildungs-AG. Die Fortschreibung und Konkretisierung bedeutet eine Schwerpunktsetzung von Maßnahmen für das betreffende Schuljahr sowie für die jeweiligen Jahrgangsstufen. Aus dem Schwerpunkt sich ergebende Aufträge hinsichtlich der Vermittlung von Bildungssprache sind für jede Lehrkraft verbindlich. Somit werden fächerübergreifend sprachliche Lerngegenstände festgelegt, die jeder Fachbereich für seine Ziele der Kompetenzentwicklung und die Vermittlung von fachwissenschaftlichen Inhalten zu konkretisieren hat. Die Wahl der sprachlichen Schwerpunktsetzung sollte dabei auf einen Bereich fallen, der nach der Analyse typischer Fehler und Schwierigkeiten für das Gros der Schülerschaft sinnvoll ist. Von zentraler Bedeutung für jeden methodischen Schwerpunkt ist die Berücksichtigung der Muttersprachen im Unterricht. Der Lehrperson wird es in der Regel nicht möglich sein, Vergleiche zu den Herkunftssprachen ihrer Schülerinnen und Schüler zu ziehen. Hier sind die Kinder und Jugendlichen selbst, und zwar in ihrer zweisprachigen Kompetenz, gefragt und können sich untereinander durch Sprachmittlung 5 fachliche Kenntnisse näherbringen. Auch die Einbeziehung der Elternhäuser oder außerschulischer Initiativen und Vereine, in denen mittlerweile eine Vielzahl mehrsprachiger Personen Schülerinnen und Schülern zur Seite stehen, kann in die Sprachmittlung im Bereich der Vermittlung von Fachwissen integriert werden. In der Analyse der o. g. Beispiele etwa wird bereits das Wissen, dass es im Türkischen keine Präpositionen gibt, Lehrende und Lernende sensibilisieren, d. h. türkische Schülerinnen und Schüler müssen die Funktionen und das gesamte System der konkreten bis hin zu abstrakten Bedeutungen der Präpositionen vollständig neu erlernen. 3 Mögliche Schwerpunkte eines Sprachbildungsprogramms Wie die o. g. Beispiele zeigen, scheitern Schülerinnen und Schüler in Übungs- und Testphasen des Unterrichts häufig schon an der Aufgabenstellung bzw. an den Operatoren. Eine Vereinheitlichung und klare Definition derjenigen Verben, die die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, Aufgaben zu erledigen, gehört unbedingt und vorrangig in den Aufgabenkanon der Sprachbildungs-AG. Dieses Thema bietet sich für einen ersten Schwerpunkt an und es sollte im Unterricht der Sek I möglich sein, eine begrenzte Anzahl von Basis-Operatoren für alle Fächer festzulegen und diese klar und verbindlich zu definieren. Die Lehrperson kann ihre konsequente Verwendung einfordern. Zusätzlich wird jeder Fachbereich seine spezifischen Anforderungen in spezifischen Operatoren festlegen 6. Auch diese sollte jede Lehrperson des Fachbereichs einheitlich verwenden und die fachspezifischen Definitionen den Lernenden vermitteln. Dazu gehört, dass eine von den Basis-Operatoren abweichende Bedeutung sorgfältig thematisiert wird. Auf 14 5 Unter Sprachmittlung versteht man die sinngerechte Übertragung von Sachverhalten und Sinnzusammenhängen von einer Sprache in die andere. Dabei geht es nicht wie bei einer Übersetzung um ein möglichst eng am Wortlaut der Ausgangssprache orientiertes Übersetzen, sondern um die Übermittlung wesentlicher Inhalte. 6 Vgl. die Ausführungen von Winfried Ulrich in diesen Materialien, S. 320f. und S. 321.
15 Einführung diese Weise kommt im Laufe der vier Jahre in der Sek I ein progressiv voranschreitendes, sich erweiterndes Inventar von Operatoren zur Anwendung. Dieses Instrumentarium soll im Kern für alle Fächer identisch, fachlich aber jeweils ausdifferenziert sein. Einen weiteren sinnvollen Schwerpunkt bietet die Erstellung eines individuellen Portfolios in Form einer Mappe, in die die Lernenden ihre besten, möglichst frei formulierten Arbeiten im Laufe einer oder mehrerer Unterrichtsreihen einlegen und gleichzeitig Reflexionen über ihren Lernerfolg formulieren. Auf diese Weise wird ihre Lernentwicklung dokumentiert. Die Schülerinnen und Schüler werden mit dieser Methode in die Lage versetzt, ihre Fortschritte in der Zunahme ihres Sprach- aber gleichzeitig auch Fachwissens als solche wahrzunehmen und zu reflektieren. Sie werden darüber hinaus angeregt, Lernprozesse und -inhalte als Möglichkeit zu sehen, ihren eigenen Fortschritt, d. h. eigene Ziele des Lernens zu formulieren und den Weg zu diesen Zielen bewusst mitzugestalten und mitzuverfolgen. Die Fachkonferenzen sollten zur Entlastung der Lehrkräfte für Standardreihen des Unterrichts Portfolio-Raster erarbeiten, die den Schülerinnen und Schülern einen Rahmen vorgeben. In einem solchen Raster sind mögliche sprachliche Besonderheiten, die der jeweiligen Reihe angemessen sind, schon aufgeführt. Außerdem sollte die Fachkonferenz den Fachlehrerinnen und Fachlehrern entsprechende fachsprachliche Übungssequenzen vorschlagen. Das Portfolio bietet zu den genannten Vorzügen auch den Rahmen, im Fachunterricht die Schreibkompetenz der Lernenden zu trainieren, da die Einträge vorwiegend aus selbstständig formulierten Texten bestehen. Dieser Weg ist weit: Er geht vom Verstehen eines fachlich korrekten und relevanten Satzes im Kontext des naturwissenschaftlichen Themas bis zur Fähigkeit, selbst nicht nur einen solchen Satz, sondern einen fachlich und sprachlich korrekten Text zu formulieren. Die einzelnen Etappen auf diesem Weg müssen im Unterricht trainiert werden. Vorgaben und Richtlinien dazu sollten in der Fachkonferenz diskutiert und im schulinternen Curriculum festgelegt werden. Die Sprachbildungskoordinatorin bzw. der Sprachbildungskoordinator wird bei diesem Prozess als Berater/-in hinzugezogen. In den Vorgaben werden die Anforderungen an die Vermittlung des Fachwissens mit denen an eine qualifizierte Verschriftlichung der Lernergebnisse verbunden. Ein wichtiges Thema sind dabei die Textvernetzungsmöglichkeiten etwa durch Proformen 7 und Konnektoren 8, die nicht nur im Deutschunterricht, sondern in allen Fachsprachen eine hohe Bedeutung haben und eigens trainiert werden müssen. Das A und O der Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Bildungssprache liegt in der täglichen Wortschatzarbeit 9. Hier sollten alle Fachbereiche einer Schule zusammenarbeiten und sich über Methoden der Visualisierung und Mnemotechniken austauschen. Außerdem sollten sie gemeinsam ausgewählte geeignete didaktische Standards der Wortschatzvermittlung als verbindlich erklären. Auch diese Festlegung wäre ein geeigneter Schwerpunkt des schulinternen Sprachbildungsprogramms. Ebenso sind die Elemente des sprachsensiblen Unterrichts 10 nicht sehr schwer zu berücksichtigen und helfen den Lernenden, die Verbindlichkeit des Sprachlernens im Fachunterricht als selbstverständlich anzuerkennen. Eine weitere mögliche Hilfe zur bewussten Sprachaneignung liegt in Selbsteinschätzungs- und Rückmeldebogen: Alle Ziele des sprachbildenden Fachunterrichts können insofern den Schüle 7 Vgl. Anm. 2 8 Wörter zur Verbindung von Teilsätzen 9 Vgl. die Ausführungen von Winfried Ulrich in diesen Materialien, S. 321f. und S. 322f. 10 Vgl. QM_1_10.pdf 15
16 Sprachsensibler Fachunterricht Einführung rinnen und Schülern bewusst gemacht werden, als sie sich selbst ein Lernziel setzen und seine Erreichung zusammen mit der Lehrkraft oder in einem klasseninternen Lernteam festlegen. In einen solchen Bogen werden Standards der Reihe gemäß Rahmenplan, damit verbundene Sprachhandlungen und ihre genau definierten sprachlichen Mittel sowie sprachliche Lernziele eingetragen. Die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern erhalten nach Ablauf der Einheit den von der Lehrkraft gegengezeichneten Bogen. Folgendes Raster 11 könnte dafür eine Grundlage sein: Name, Klasse: Fach, Thema: erreichte Leistung: Tipps zum Üben und Wiederholen: Dies wollen wir lernen: (konkret ausfüllen, schülerorientiert formulieren) Dies sind deine persönlichen Ziele: Dies ist deine Leistung: Standard aus dem Lehrplan Sprachhandlungen ausformulierter Erwartungshorizont Sprachliche Mittel (konkret aufgelistet) Und zum Schluss Alle Hinweise und methodischen Grundsätze verlieren ihre Wirkung, wenn die Lehrperson nicht kontinuierlich und konsequent als Sprachvorbild den Unterricht gestaltet. Bewusstes Sprechen und Artikulieren, klare, differenzierte Formulierungen etwa von Begründungen und rituell verankerte Ausspracheübungen sollten fester Bestandteil des Unterrichts sein Anregung durch Tanja Tajmel (Oktober 2011): Sprachliche Lernziele des naturwissenschaftlichen Unterrichts
17 Literatur Biologie plus (2006), Klassen 7/8. Berlin: Cornelsen Feilke, Helmuth (2012): Bildungssprachliche Kompetenzen fördern und entwickeln. In: Praxis Deutsch, 39 (2012) 233, S Gogolin, Ingrid/Lange, Imke (2010): Durchgängige Sprachbildung. Eine Handreichung. Unter Mitarbeit von Dorothea Grießbach (= FörMig Material Band 2). Münster/New York/ München/Berlin: Waxmann Habermas, Jürgen (1981): Umgangssprache, Bildungssprache, Wissenschaftssprache. In: Habermas, Jürgen: Kleine politische Schriften (I IV). Frankfurt/M.: Suhrkamp, S Rösch, Heidi (2005) (Hrsg.): Mitsprache: Deutsch als Zweitsprache in der Sekundarstufe I. Grundlagen, Übungsideen, Kopiervorlagen. Braunschweig: Schroedel 17
18
19 Wortschatzarbeit im Deutschunterricht Astrid Lehmann, Anett Pilz, Thea Sarich
20
21 1 Wortschatzarbeit heißt Arbeiten mit Wörtern Wofür ich keine Sprache habe, darüber kann ich nicht reden. Ingeborg Bachmann Die erfolgreiche Arbeit von Schülerinnen und Schülern im Unterricht hängt entscheidend von ihren sprachlichen Fähigkeiten ab. Dabei ist nicht nur ihr Wissen über die Alltagssprache wichtig, sondern auch ihr Zugang zur Bildungssprache. Im tatsächlichen Sinne des Begriffes Wortschatz ist die Erweiterung des sprachlichen Könnens Schatzgräberei. Schülerinnen und Schüler können täglich neue Wörter entdecken, Beziehungen zwischen vorhandenem Weltwissen und zu erlernendem Fachwissen finden und damit ihren Wortschatz/Sprachschatz erweitern. Die Welt der Wörter und ihrer Beziehungen eröffnet ihnen Erkenntnisse und Einsichten, wenn ihnen der Zugang zu den entsprechenden Wissensnetzen gelingt. Wortschatzarbeit kann dies in entscheidender Weise unterstützen. Kognitive Psychologie und konstruktivistische Lernpsychologie beschäftigen sich seit langem damit, wie man Wörter lernen, behalten und abrufen kann und wie sie im Gedächtnis gespeichert sind. Lernen eines Wortschatzes heißt, Wörter in ihren vielen Facetten (z. B. Schreibung, Lautung) wahrzunehmen, zu verstehen, zu memorieren, anzuwenden. Jedes neue Wort/jedes Redemittel ist ein Beitrag zu mehr Weltwissen und stärkt damit die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler. Die Bedeutung der neuen Wörter, ihre Struktur, ihre Ordnung und ihre Beziehung zum bereits vorhandenen Wortsystem werden im mentalen Lexikon gespeichert, in welchem der Wortschatz netzartig strukturiert ist. Dabei kann jedes Wort gleichzeitig unterschiedlichen Ordnungen (sogenannten Netzen) angehören. Mit steigender Quantität nehmen auch die Verknüpfungsmöglichkeiten innerhalb des Netzes und zwischen den Netzen zu, es wird immer einfacher, Neues 21
22 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch dazuzulernen. Damit leistet Wortschatzarbeit auch einen Beitrag zur qualitativen Entwicklung von Lernprozessen. Mögliche Netze, in denen Wörter gespeichert werden, sind:» Begriffsnetze: Vernetzung nach begriffichen Merkmalen (vor allem Nomen, die hierarchisch geordnet werden, Ober- und Unterbegriffe)» Wortfelder: Vernetzung nach sprachspezifischen Bedeutungsmerkmalen, u. a. Synonyme, Antonyme (sinnverwandte und inhaltlich verwandte Wörter zu einem Thema, z. B. Ballade)» syntagmatische Netze: lexikalische Verbindungen, Kollokationen, d. h. Wörter, die oft zusammen gebraucht werden, z. B. Hunde und bellen oder himmelhoch und jauchzend» Sachnetze: Vernetzung unter enzyklopädischen und soziokulturellen Aspekten (thematische Beziehungen, räumlich-zeitliche Beziehungen)» Wortfamilien: Vernetzung nach morphologischen Aspekten (Wörter, die durch Ableitung und Komposition zueinander in Beziehung stehen, dabei Vermischung von Sach-, Wortund Begriffsnetzen)» Klangnetze: Ordnungsfaktoren sind Wortlänge, Phonemstruktur, Silbigkeit, Graphemstruktur, z. B. Reime» affektive Netze, auch Assoziationsnetze: Wörter werden aufgrund von eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen auch mit ihren Nebenbedeutungen, Konnotationen, gespeichert, z. B. Ferien Sonne, Feuer Gefahr Das lexikalische Lernen sollte folglich qualitativ bestimmt sein, d. h., es gilt, die Vernetzung von Wörtern und Formulierungen im mentalen Lexikon zu aktivieren und zu optimieren. Peter Kühn formuliert pointiert: Den Lernern sollte in Bezug auf den Wortschatz die Einsicht vermittelt werden, dass dieser geordnet ist und dass es gilt, in der unübersichtlichen Fülle und dem scheinbaren Durcheinander der Wörter Ordnungen zu erkennen und zu schaffen. Es gilt die Maxime: Wörternetze statt Grundwortschätze. 1 Fach- und Allgemeinwortschatz im Deutschunterricht Die Sichtung der KMK-Bildungsstandards im Fach Deutsch für den mittleren Schulabschluss sowie des Rahmenlehrplans für die Sekundarstufe I des Fachs bestätigt, dass fachspezifische Lexeme und Wortgruppenlexeme wie beispielsweise Aktiv, äußere Handlung, Erzählperspektive, lyrisches Ich, sprachliches Bild, wörtliche Rede etc. zum lexikalisch-semantischen Soll-Zustand am Ende einer Klassenstufe oder der Sekundarstufe I gezählt werden. [ ] Eine Auswertung der Sprachbuchreihe P.A.U.L.D. für das Fach Deutsch auf den Klassenstufen 5 9 des Gymnasiums 2 führt zu dem Ergebnis, dass allein in der Sekundarstufe I über 500 verschiedene fachspezifische Lexeme und Wortgruppenlexeme zwischen Abenteuerroman und Zustandspassiv zum auf- und auszubauenden Lerner-Wortschatz von Schülerinnen und Schülern zu zählen sind. 3 Bedenkt man, in wie vielen Fächern die Schülerinnen und Schüler mit ähnlich großen Fachwortschätzen 22 1 Kühn 2007, S Vgl. Dieckhans/Fuchs 2004ff. 3 Kilian 2010, S. 60
23 Wortschatzarbeit heißt Arbeiten mit Wörtern umgehen (ein Oberstufenlehrwerk Biologie weist ca. 700 Termini aus), wird die besondere Rolle des Faches Deutsch deutlich: Der Deutschunterricht muss dazu beitragen, dass Strategien des Wortschatzlernens und des Wortschatzerwerbs aufgebaut werden, indem ein Wort/Terminus sowie bildungssprachlich relevante Wendungen und Formulierungen in das mentale Lexikon so integriert werden, dass sie in der Folge (wieder) produktiv gebraucht werden können, d. h. Wortschatzkompetenz entwickelt wird. Wortschatzarbeit im Deutschunterricht ist also ein Kerngeschäft, möchte man meinen. Dennoch kennen die Lehrerinnen und Lehrer aus ihrem Fachunterricht unzählige Beispiele dafür, dass erwartete Begriffe und Formulierungen im kommunikativen Zusammenhang des Unterrichtes nicht verwendet werden oder dass scheinbar gängige Wörter und Wendungen des Allgemeinwortschatzes nicht verstanden und somit nicht selbstständig angewendet werden können. In literarischen Texten kann ein Dichter beispielsweise seine Frauenfigur durchaus als wenig affektiert bezeichnen oder beschreiben, wie einer seiner Protagonisten bei einem Handel der List des Verkäufers aufgesessen ist. Beide Worte sind dabei zentral für das Verstehen dieser poetischen Äußerungen und deren Unkenntnis kann zu massiven Verständnisproblemen führen. Helmuth Feilke betont im Zusammenhang mit der Entwicklung der lexikalischen Kompetenz das Zusammenspiel von Wortschatz und Grammatik einerseits und Wortschatz und Textkompetenzen andererseits: Die Entwicklung von Sprachkompetenz in der Schule erfolgt als Zusammenspiel von textorientierten, wortschatzorientierten und funktional-grammatischen Zugängen 4. Allein die Kenntnis der Semantik eines Wortes, wie sie beispielsweise aus einer am Text angeführten Worterklärungsliste zu entnehmen ist, garantiert noch nicht den Erwerb der Fähigkeit zur korrekten Anwendung dieses Wortes und dessen Aufnahme in den aktiven Wortschatz der Schülerin/des Schülers. Grammatische Konstruktionen und Modellwörter LEXIKALISCHE KOMPETENZ Textsortenkenntnis Textsemantische Wissensrahmen Vgl. Feilke 2009, S. 6 Dies gilt es, bei der Wortschatzarbeit im Unterricht zu beachten. Dass Wortschatzarbeit Textarbeit ist, gilt als anerkannte wortschatzdidaktische Maxime. Die Wortschatzarbeit sollte folglich nicht isoliert, sondern auf Aufgaben zum Lesen und Textverste- 4 Feilke 2012, S. 8 23
24 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch hen (rezeptive Wortschatzarbeit) oder zum Schreiben (produktive Wortschatzarbeit) bezogen sein 5. Anders ausgedrückt: Wortschatzarbeit gelingt, wenn sie in sprachliche Handlungen des Hörens, Sprechens, Lesens und Schreibens eingebettet wird. In diesem Zusammenhang soll betont werden, dass es einerseits keiner separaten Unterrichtseinheiten bedarf, um lexikalische Kompetenz im Deutschunterricht zu fördern. Die Wortschatzarbeit lässt sich in ganz unterschiedliche Kontexte und Lernbereiche einbinden, wie die Beispiele aus dieser Handreichung zeigen sollen. Andererseits wird der Wortschatzarbeit in Form der Beschäftigung mit Wörtern und Formulierungen in vereinzelten Unterrichtseinheiten nicht Genüge getan. Wortschatzarbeit muss nicht zwingend eine lange Zeit in Anspruch nehmen und gelingt, wenn im Unterricht ganz selbstverständlich stetig Raum für das Nachdenken über Wörter und Formulierungen gewährt wird. Oft genügen schon kleine Übungen (z. B. 5-Finger), um Wörter zu memorieren, einzusetzen, zu reflektieren und damit immer besser im mentalen Lexikon zu verankern. In Anlehnung an Claudio Nodari und Cornelia Steinmann (2008) orientieren wir uns dabei an folgendem Modell: Wortschatzarbeit in Modulen 1. Wörter und Formulierungen kontextbezogen einführen, so dass das Verstehen der neuen Begriffe ermöglicht wird 2. Wörter und Formulierungen üben Bedeutungen zunehmend genauer erfassen und formulieren 3. Wörter und Formulierungen nutzen Fachsprache verwenden Lernende zum selbstständigen Gebrauch der neuen Begriffe und Formulierungen führen 4. Über Wörter und Formulierungen reflektieren Aufbau einer Wortschatzanalysekompetenz, die beim Verstehen und Lernen neuer Wörter und Formulierungen hilft 5. Testen Ergebnissicherung, Arbeit am Fachwortschatz verbindlich machen 24 5 Kühn 2007, S. 163
25 2 Aufgabenformen und Methoden zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz Wortschatzarbeit in Modulen 6 mögliche Aufgabenformen/Methoden 7 Modul Ziel Mögliche Aufgabenschwerpunkte Mögliche Aufgabenformen Die mit * gekennzeichneten Methoden werden im Methodenkoffer erklärt. 1. Wörter und Formulierungen kontextbezogen einführen, so dass das Verstehen der neuen Begriff e und Formulierungen/ Redemitt el ermöglicht wird verschiedene Ebenen des Wortes berücksichtigen und unterschiedliche Lernkanäle ansprechen, Wörter in das mentale Netz integrieren einzelne Bedeutungen kontextbezogen präsentieren und erproben und Wortbedeutungen sowie Bedeutungen von Formulierungen eingrenzen Wortbedeutungen durch Assoziationen zusammentragen, notieren und austauschen, dazu z. B. Brainstorming, Vier-Ecken-Methode*, Platzdeckchen-Methode (Placemat) verwenden Wortbedeutungen in Texten durch Lesen erschließen nach der Textrezeption aus verschiedenen Bedeutungen auswählen veraltete Bedeutungen in die Gegenwartssprache übertragen Mini-Lexika erstellen Wörterlisten erstellen, ergänzen oder aus Wörterlisten Wörter zum Einsetzen auswählen, unpassende Wörter herausstreichen Lernplakat* zu Begriffen erstellen Lernkarten* anlegen sich über Wortbedeutungen im Gespräch verständigen Wortnetze ergänzen Fachwörter in einem Text identifizieren 6 In Anlehnung an: Nodari/Steinmann An dieser Stelle wird nicht zwischen der Arbeit am Allgemein- oder Fachwortschatz unterschieden. 25
26 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch mögliche Aufgabenformen/Methoden 7 Wortschatzarbeit in Modulen 6 Modul Ziel Mögliche Aufgabenschwerpunkte Mögliche Aufgabenformen Die mit * gekennzeichneten Methoden werden im Methodenkoffer erklärt. Aussprache des Wortes kennen lernen und üben (gesprochene) Wörter im Text finden (z. B. unter- streichen) Wörter, z. B. Komposita, im Wörtersalat ordnen Kreuzworträtsel lösen Buchstaben im Text ergänzen Wörter aus dem Text in eine Liste übertragen Wörter in einem Fehlertext korrigieren Schreibung erfassen und bewusstmachen Register erfassen und erproben Anwendungsbereiche erschließen (Welche Konnotation passt zu welchem Kontext? Welches Wort erfüllt die Aussageabsicht am besten?) Definitionstexte zum Fachwortschatz mit Hilfe verschiedener Lesestrategien erschließen Bild-Text-Zuordnungen vornehmen Textlupe* einsetzen, Wortbedeutungen recherchieren, dabei auch verbundene Begriffe finden Fachwortschatz in Texten identifizieren und entschlüsseln, Begriffe nachschlagen, z. B. in (digitalen) Wörterbüchern, Begriffsinhalte überprüfen, falsche oder ungenaue Formulierungen ausschließen, z. B. durch das Herausstreichen aus einer Liste, Worterklärungen für Texte formulieren Hören: Rezeption von Hörtexten, Aufnehmen aus Lehrervortrag Sprechen: Nachsprechen der Wörter, Gebrauch im Gespräch, bei Beschreibungen, Nennungen etc. Auswahl von Wörtern oder Wortgruppen aus einem Set treffen und Auswahl begründen unterschiedliche Verwendungen benennen, aus einem vorhandenen Wortschatz auf verschiedenen Registerebenen auswählen und in einen Lückentext einsetzen sowie im Text unterstreichen, Wörter unter vorgegebenen Aspekten sortieren Einsetzübungen (Lückentext, Synonyme finden, Gegenteil finden) Wörter und Begriffe auf einen nahen Kontext anwenden, z. B. in einer ähnlichen Satzkonstruktion Visualisierungen finden (z. B. Symbole auswählen) Metaphern und Redewendungen erschließen und verwenden (z. B. zum Bildimpuls eine Formulierung finden, die Metapher oder Redewendung aus dem Textzusammenhang erschließen und eigene Formulierungen finden, verschiedene Textversionen mit und ohne Metaphern/Redewendungen gegenüberstellen, Lernplakate* gestalten) 26
27 Aufgabenformen und Methoden zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz Wortschatzarbeit in Modulen 6 mögliche Aufgabenformen/Methoden 7 Modul Ziel Mögliche Aufgabenschwerpunkte Wortnetze konstruieren, ergänzen, nutzen, z. B. semantische Netze, affrmative Netze, assoziative Netze Mögliche Aufgabenformen Die mit * gekennzeichneten Methoden werden im Methodenkoffer erklärt. Wortspinnen und Begriffsnetze konstruieren Brainstorming, Symbole/Visualisierungen/Bilder versprachlichen, Visualisierungen erstellen, aus Texten verwandte Wörter herausfinden und unter vorgegebenen Aspekten ordnen, z. B. Ober- und Unterbegriff finden, Advance Organizer*, mit Hilfe von Bildimpulsen Sprechsituationen schaffen, Fragen an ein Bild formulieren lassen 2. Wörter und Formulierungen üben Bedeutungen zunehmend genauer erfassen und formulieren, Wörter (nach)sprechen und (ab) schreiben, Wortbild (Schreibung) und Klangbild zur Routine werden lassen, Wörter in ihrer Vielfalt verwenden Wörter und Wendungen im Text auffnden und Bedeutungen bewusst verwenden Wörter schreiben Wörter/Textteile/ Texte sprechen Bedeutungen markieren/beziehungen im Text durch Markierungen, z. B. farbliche Markierungen oder Pfeile, herstellen Randbemerkungen anfertigen oder vorgefertigte Randbemerkungen zuordnen oder aus einer Liste passende Randbemerkungen auswählen und dem richtigen Textabschnitt zuordnen Texte mit Schlüsselwörtern erschließen Wörter/Wortgruppen ersetzen Wörter memorieren (z. B. mit Hilfe von Symbolkarten, Bildern oder anderen Visualisierungen sowie Lernkarten*, Fragekarten*, Stichwortkarten*) Wörter aus Texten in Tabellen oder Mindmaps* übertragen fehlende Anfangsbuchstaben, Silben, Wortteile oder Wörter ergänzen Lernplakate* zu Begriffen zusammenstellen und Texte dazu verfassen Zusammenfassungen schreiben Definitionstexte ergänzen Kreuzworträtsel lösen Zuordnung von Wörtern zu Bildelementen Rollenspiel Variation von Lautstärke, Tonhöhe und Sprechgeschwindigkeit einsetzen (ausdrucksvolles Lesen, Dramatisierung von Texten, Ausprobieren von Vortragsweisen, Rhythmisierungen einsetzen) Erzählwettbewerb (z. B. einen spannenden Schluss für eine Geschichte finden), Verbalisierung von Gesehenem (parallel zu einer Pantomime das Gesehene in Worte fassen), zu einer Filmszene oder Bildstrecke Dialoge und Erzählteile finden 27
28 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Wortschatzarbeit in Modulen 6 mögliche Aufgabenformen/Methoden 7 Modul Ziel Mögliche Aufgabenschwerpunkte Hören der Wörter durch Vorsprechen, Gebrauch in der Gruppen- und Partnerarbeit, Einsatz audiovisueller Unterrichtsmittel Mögliche Aufgabenformen Die mit * gekennzeichneten Methoden werden im Methodenkoffer erklärt. Arbeit mit einem Hörbuch oder audiovisuellen Mitteln Präsentation von Arbeitsergebnissen in einer Kleingruppe Partnerinterview* Kugellagerübung* 3. Wörter und Formulierungen nutzen Fachsprache verwenden, Lernende zum selbstständigen Gebrauch der neuen Begriff e und Formulierungen führen Wörter in einem begrenzten Rahmen selbstständig verwenden Wörter in größeren Kontexten verwenden Lückentexte ergänzen Wörterpuzzle* (auch auf Phrasen anwendbar) Textpuzzle Wörter umschreiben (z. B. Sag-es-anders-Spiel/ Tabu*, Pantomime, Wörterparty*, Wortkasten*) Ergänzungsübungen (z. B. Präpositionen oder Verben ergänzen, Zeitformen verändern, Präsentationsform verändern) mündliches und schriftliches Formulieren von informativen Texten und Textpassagen (z. B. Bilder und andere Darstellungen beschreiben, Lexikoneinträge formulieren, Rahmentexte zur Information schreiben, Auswahl beschreiben, Lieblingstext nach vorgegebenen Kriterien beschreiben, Textzusammenfassungen formulieren, Wörterlisten erstellen für Vorträge und die Erläuterung visualisieren) Formulieren von analytisch-deskriptiven Texten (z. B. Textuntersuchungen formulieren) sowie erörternden Texten (z. B. freie Erörterung) Auswahl von Wörtern/Formulierungen in Texten prüfen und korrigieren (Über-den-Rand-Schreiben*, Schreibkonferenz) Debatten führen Präsentation von Arbeitsergebnissen in Vorträgen 28
29 Aufgabenformen und Methoden zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz mögliche Aufgabenformen/Methoden 7 Wortschatzarbeit in Modulen 6 Modul Ziel Mögliche Aufgabenschwerpunkte Mögliche Aufgabenformen Die mit * gekennzeichneten Methoden werden im Methodenkoffer erklärt. 4. Über Wörter und Formulierungen reflektieren Aufbau einer Wortschatzanalysekompetenz grammatisches und lexikalisch-semantisches Umfeld erschließen, Wortbildungsmöglichkeiten erkennen und ausprobieren Klassifizierungen vornehmen (z. B. in einer Mind map*, Ober-und Unterbegriffe finden, Cluster bilden, Strukturlegetechnik anwenden) Reihenbildung: weitere Wörter mit ähnlicher Bedeutung aus einer Liste auswählen, im Wörterbuch finden, aus einem Wörternetz auswählen und einfügen, selbstständig finden, Wortreihen fortsetzen, Begriffsketten bilden, Bedeutungsumschreibungen auswählen, zuordnen, selbstständig formulieren, aus Texte herausfiltern, Wörterhexagon*, Zusammensetzungen und Ableitungen entschlüsseln und selbst bilden verbundene Wörter finden (Synonyme/Antonyme- Listen erstellen, Sätze bilden), aus einem vorhandenen Angebot die passenden Wörter auswählen und die Auswahl begründen Klangnetze* finden und ergänzen (z. B. Reimpaare, Alliterationen, gleiche Suffxe, dabei z. B. auf die Funktion zur Wortartbestimmung eingehen und mit diesem Wissen neue Wörter bilden) Was stimmt hier nicht Was ändert sich? Variationen im Text untersuchen Wörter mit Hilfe verschiedener netzartiger Verknüpfungen in das mentale Lexikon integrieren, z. B mit Hilfe von Begriffsnetzen Wortigel oder andere Formen von Assoziogram men verwenden, Spiel: Koffer packen Situationen beschreiben Geschichten weitererzählen, Bildimpulse verwenden Regieanweisungen formulieren Situationen/Texte gestaltend interpretieren Assoziatives Netz bilden und ergänzen Satzwerkstatt Auswahlübungen und Ergänzungsübungen Verwendung im Satz bewusstmachen (z. B. den Artikel unterstreichen, Artikel einsetzen, Verhältniswörter korrekt verwenden) Zusammensetzungen und Ableitungen bilden und deren Integration im Satz deutlich machen (Vorsilben oder Nachsilben einsetzen, die Änderung der Wortart thematisieren, Komposita bilden) 29
30 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Wortschatzarbeit in Modulen 6 mögliche Aufgabenformen/Methoden 7 Modul Ziel Mögliche Aufgabenschwerpunkte Affektive Netze formen und ergänzen Mögliche Aufgabenformen Die mit * gekennzeichneten Methoden werden im Methodenkoffer erklärt. Nebenbedeutungen finden Situationen beschreiben, Bilder ergänzen Mini-Bücher herstellen Bedeutungen mit einem Partner diskutieren (z. B. Überschriften in Gedichten, einzelne Phrasen, Metaphern, Sprichwörter etc.) Lerntagebücher* erstellen Wortbildung und Wortverwendung korrigieren (im Textzusammenhang) Lernplakate* herstellen und präsentieren, ihre Gestaltung reflektieren 5. Testen Ergebnissicherung, Arbeit am Fachwortschatz verbindlich machen Schreibung Klassifizierung Reihenbildung Verwendung im Kontext Lückendiktat, Auswahl aus einer Liste möglicher Schreibungen treffen, zuordnen, Schreibungen begründen Ergänzung Mindmap*, Zuordnung von Begriff und Oberbegriff (oder umgekehrt), fehlende Begriffe ergänzen, Wort und Wortbedeutung einander zuordnen Wörter ergänzen, Anfangsbuchstaben ergänzen, Silben ergänzen, Zwillings- oder Drillingsformeln ergänzen, aus einer Liste unpassende Wörter eliminieren, Synonyme finden eigenständig Texte formulieren (z. B. Bildbeschreibungen, Textuntersuchungen, Definitionstexte, Erläuterungen) 30
31 3 Methodenkoffer 3.1 Assoziatives Netz Wörter und Begriffe stehen für Lerner in einem semantischen Zusammenhang. Die Psychologie geht davon aus, dass das Nennen eines Wortes das Erinnern eines weiteren beeinflusst, auch hinsichtlich der Konnotation. So können z. B. folgende Wörter in einem Netzwerk stehen: 31
32 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch 3.2 Fragekarten» zur Erschließung von Themen, Texten, Wörtern» zur Wiederholung und Übung von Lerninhalten» Einsatz: z. B. im Partnerinterview oder in der Kugellagerübung Aufbau/Gestaltung Vorderseite Was ist eine Ballade? Rückseite Mischform: Elemente von Lyrik, Epik, Dramatik 3.3 Lernkarten» Hilfsmittel zum Memorieren von Lerninhalten (z. B. Begriffsdefinitionen) Beispiel Vorderseite Anapher Rückseite Ein Wort oder mehrere Wörter werden am Anfang einer Verszeile, Strophe oder eines Satzes wiederholt. 32
33 Methodenkoffer 3.4 Lerntagebuch» Hilfsmittel zum Memorieren von Lerninhalten Beispiel Wort Wo ist mir das Wort begegnet? Was bedeutet es? Wie wirkt dieses Wort? Welche weiteren Wörter/Wendungen passen dazu? das Mitleid (Nomen) Aufgabe aus Sprachbuch S. dass man sich in die Situation eines anderen hineinversetzen kann neutral, eher positiv mitleidig, Mitleid fühlen, Mitleid zeigen, in Mitleid zerfließen, Mitleid heucheln 3.5 Tabu-Wörter finden/formulieren» Schülerinnen und Schüler erstellen auf diese Weise Sachnetze: Vernetzung unter enzyklopädischen und soziokulturellen Aspekten (thematische Beziehung, räumlichzeitliche Beziehungen) Vorgehen» Schülerinnen und Schüler notieren fünf Wörter, die beim Um-/Beschreiben des gesuchten Wortes nicht verwendet werden dürfen, zunächst in Einzel- oder Partnerarbeit» Indem die Lehrkraft die von den Schülerinnen und Schülern notierten Wörter sammelt und visualisiert, entsteht ein Sachnetz zum (alltagssprachlichen und/oder fachspezifischen) Wort. Gedicht Ritter Slogan sparsam 33
34 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch 3.6 Lernplakat» Visualisierung von Lerninhalten durch die Schülerinnen und Schüler» Kombination aus Kurztexten, bildlichen Darstellungen, Symbolen, Farben» Verwendung: zur Reflexion von Lerninhalten, zur Vorbereitung und Begleitung von Präsentationen an Wand, Türe, Schrank etc. auffällig zeitlich begrenzter Aushang das Wesentliche Kästchen Lernplakat ansprechend auch auf Distanz gut lesbar Umrahmungen leicht erfassbar nach teachsam Bilder Text Grafiken übersichtlich Quelle: 34
35 Methodenkoffer 3.7 Mind Map» entwickelt von Tony Buzan» Ziel: Reduktion von Lerninhalten auf wesentliche Elemente» Verwendung, z. B. zur Vorbereitung von Kurzvorträgen, zum Bereitstellen von Vorwissen und Aufschlüsseln einer Thematik, als Strukturierungshilfe und Übersicht beim Lernen, bei der Vorbereitung von Schreibaufgaben zur Stoffsammlung und Strukturierung» Gestaltung: Papier im Querformat Thema in die Mitte schreiben (z. B. Ballade) Notizen in Form von Schlüsselwörtern Gestaltung durch Farben, Symbole, Bilder, Nummern, Pfeile und Linien Beispiel 35
36 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch 3.8 Partnerinterview» zur Erarbeitung von neuen Inhalten» zur Wiederholung und Vertiefung von bereits Erlerntem» Basis: Aufgaben von ähnlichem Lösungsanspruch (zeitlich und inhaltlich) Vorgehen Phase Schülertätigkeiten Erläuterung 1 Aneignung Die Schülerinnen und Schüler werden zu Experten auf ihrem Arbeitsgebiet, dabei teilt sich die Gesamtklasse in zwei Gruppen (A und B), die jeweils einem Gebiet zugeordnet sind. Das Themengebiet wird durch Lesen, Nachschlagen usw. erschlossen (Einzelarbeit oder Partnerarbeit, aber auch Mini-Gruppe) 2 Vermittlung Die Schülerinnen und Schüler stellen einem Partner ihre Aufgabe vor und unterstützen durch Erläuterungen die Lösung, ggf. ergänzen sie die Lösung. 3 Wiederholung und Vertiefung Die Paare werden immer wieder neu zusammengestellt (z. B. durch das Bewegen im Raum) und die Aufgaben werden immer wieder gelöst. Hinweis» Regeln für die Austauschsituation (z. B. Lautstärke) vereinbaren 36
37 Methodenkoffer 3.9 Sag-es-anders» Wortschatzarbeit: Erweiterung des Wortschatzes, Bewusstheit bei der Überprüfung von Texten Beispiel Hier stimmt doch etwas nicht! Ich habe es doch schon immer gesagt: Misskraut übergeht nicht. Tim hatte einen Verfall, weil er sich beim Fahren total überschätzt hatte. Aber dass er dann einmal darüber andenkt, was er getan hat, keine Spur. Erst durchfährt er auf der Landstrasse beinahe ein Huhn, dann zerbricht er die Aufsperrung einer Baustelle, und zum Schluss will er für den überstandenen Schaden nicht unterkommen. Nun verkommt er die bediente Quittung dafür. Für sein rücksichtsloses Anhalten muss er eine saftige Strafe zahlen. Auftrag: 1) Einige Vorsilben im Text vertragen sich nicht mit dem Wortstamm. Verändere diese Vorsilben so, dass der Text gut zu lesen und zu verstehen ist. Quelle: Selimi 2010, S. 164 Varianten Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Set Karten mit Wortpaaren (z. B. Synonyme) und müssen daraus die passenden zusammenlegen (als Einzel- oder Partnerarbeit). oder Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Set Karten mit Wörtern und befragen jeweils einen Partner nach dem dazu passenden Begriff (z. B. Synonyme-Antonyme). oder In einem Text wird für eine bestimmte Gruppe von Wörtern nur ein Wort gesetzt (z. B. sagen). Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Aufgabe, das Wort mit passenden Entsprechungen zu ersetzen (z. B. schreien, wispern, erklären). 37
38 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch 3.10 Advance Organizer» entwickelt von David Ausubel 8» zentrale Idee: kontextuell vernetzte Informationen werden besser gemerkt und memoriert» verbale und/oder visuelle Lernhilfen, die vor dem Lern-/Leseprozess als Orientierungshilfe dienen während des Lernens als Leitfaden dienen zum Abschluss des Lernprozesses als Reflexionsinstrument fungieren.» Zweck: Strukturierung und Organisation des kognitiven Denkens durch Visualisierung von Wissen und Lernwegen» Formen: Kurztexte zur Orientierung über einen Text Plakate zur Übersicht über die zu bearbeitenden Stoffe und Themen Präsentationen (z. B. PPP) zur Verknüpfung des zu erwerbenden Lerninhaltes mit anderen Lernbereichen (max. 15 Min.) Entwicklung 1. Stichworte sammeln (Bsp. AIDA-Konzept, Sprache, Farben) 2. Anordnung der Begriffe (z. B. Über- und Unterordnung) 3. Visualisierung (Ergänzung durch Farben, Symbole, Pfeile etc.) Beispiel Werbung 38 8 Ausubel 1960
39 Methodenkoffer 3.11 Klangnetz» In einem Klangnetz werde Wörter zusammengestellt, die durch Gleichklang miteinander verbunden sind (z. B. gleiche Endsilbe: Asylant, Emigrant, Immigrant). Gleichklang hilft bei der Einordnung in das mentale Lexikon. Beispiel Aufgabe: Finde Reimwörter. Haare finden zünden oder Ergänze mit Reimwörtern. steht Verbinde sich reimende Wörter mit Linien. Wind der biegen gehen wer klagen fragen Kasse nass Degen stehen schwer Tasse Masse sehr Kind regen Fisch Klasse liegen wiegen siegen Tisch Bass seht Finde acht Wörter, die mit der Silbe keit enden. Notiere Sie an den Seitenrändern. (z.b. Heiterkeit) steht geht fleht 39
40 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch 3.12 Domino Start Aus einem Set von beschrifteten Karten fügen die Schülerinnen und Schüler ein Domino zusammen. Dabei werden passende Begriffe aneinandergefügt. Lyrik Strophe Vers 40
41 Methodenkoffer Ende Quelle: 41
42 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch 3.13 Kugellagerübung Vorgehen» Bildung von zwei Stuhlkreisen, je zwei Schülerinnen und Schüler sitzen sich gegenüber» Schülerinnen und Schüler berichten/erzählen/fragen sich gegenseitig ab» Zuhörender: Zusammenfassung des Gehörten, Ergänzung» Weiterrücken der Schülerinnen und Schüler um je ein oder zwei Plätze (nur einer der Kreise)» Wechsel der Rolle: Außenkreis hört zu und ergänzt Einsatz» Vertiefung umfangreicher Lerninhalte/Informationen Vorteil» zahlreiche Sprechakte zur gleichen Zeit Hinweis» Es ist genügend Platz erforderlich, um die besondere Anordnung der Sitzplätze zu ermöglichen; zudem erfordert die Methode ausreichend Zeit. Quelle: Mattes 2002, S
43 Methodenkoffer 3.14 Über-den-Rand-Schreiben Das Über-den-Rand-Schreiben ist (wie die Textlupe) ein Verfahren des kooperativen Schreibens. Nach dem Verfassen eines Textes arbeiten bis zu vier Schülerinnen und Schüler gemeinsam an der Überarbeitung des Textes. Dabei wird der jeweilige Text zunächst vorgestellt (z. B. durch Lesen oder Vorlesen), dann werden durch jedes Gruppenmitglied konkrete Verbesserungsvorschläge erarbeitet, die entweder direkt am Rand notiert werden oder zunächst auf Zetteln notiert werden und dann an der passenden Stelle am Rand festgeklebt. Dabei kann die Überarbeitung frei (Überarbeite den Text. Schlage deinem Mitschüler Änderungen vor.) oder gelenkt, d. h. entweder mit einer spezifischen Aufgabe für jeden Gruppenteilnehmer (A: Überprüfe die Einleitung. Sie soll interessant sein und auf persönlicher Erfahrung beruhen. Unterbreite Vorschläge, wenn du Verbesserungsmöglichkeiten siehst.) oder durch Kriterien gelenkt (Untersuche die Auswahl der Verben. Sind diese treffend gewählt? Unterbreite Verbesserungsvorschläge erfolgen, falls nötig). Die Verfasserin/der Verfasser überarbeitet abschließend den Text und entscheidet selbstständig, welche Verbesserungsvorschläge eingearbeitet werden. Text Raum für Anmerkungen Hinweis Ein Aufgabenbeispiel finden Sie unter: 43
44 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch 3.15 Textlupe» Strategie zur genaueren Beschäftigung mit einem Text» Schülerinnen und Schüler prüfen die eigenen und fremden Texte mit Hilfe von Kriterien» Bearbeitung der Texte in Lesegruppen von max. fünf Schülern, auf einem Rückmeldezettel werden kurze Kommentare notiert und weitergereicht, abschließend erhält die Verfasserin/der Verfasser alle Zettel zusammen mit dem Text zur Überarbeitung zurück Beispiel für Textlupen- Formulare Schülerin/Schüler Was mir gefällt Was mich stört Änderungsvorschläge oder Schülerin/Schüler Das ist dir besonders gut gelungen: Das ist noch nicht so gut gelungen: So könntest du ändern: oder Kriterium erfüllt nicht erfüllt Änderungshinweis Einleitungssatz geschrieben, der Information enthält zu(m) Informationen Entstehungsjahr Textsorte drei Teile gestaltet (Einleitung, Hauptteil, Schluss)... 44
45 Methodenkoffer 3.16 Vier-Ecken-Methode» Methode zur Erfassung von Vorwissen und Ideen» Material: Große Bögen Packpapier, Wegwerftischdecken oder Flipchart-Blöcke sowie dicke Stifte» Möglichkeiten der Umsetzung: Variante 1 In den vier Ecken eines Raumes werden Flipchartblätter mit einer Frage/einem Thema angebracht. Die Blätter können natürlich auch auf Tischen ausliegen. Die in Kleingruppen eingeteilte Klasse beantwortet die Frage, bearbeitet das Thema, die Problemstellung in einer vorgegebenen Zeit und geht dann (nach Aufforderung) zum nächsten Chart. Die Ergebnisse werden später vorgestellt, ggf. sortiert, bewertet und in anderen Kontexten verwendet. Vorteil:» Verschiedene Aspekte können gleichzeitig abgerufen werden.» Unterschiedliche Wissensstände spielen für das Bearbeiten eines Problems keine Rolle.» Die Lehrkraft gewinnt eine genaue Vorstellung von der Einsicht der Schülerinnen und Schüler in die Problemstellung und kann dies im weiteren Unterrichtsverlauf berücksichtigen. Nachteil:» Die Tiefgründigkeit der Bearbeitung kann nicht vorgeplant werden, ggf. sind weitere Zwischenschritte (z. B. Lesen von Texten) notwendig. Variante 2 Die Arbeit erfolgt in der Vierergruppe am Tisch. Die Gruppe erhält einen Papierbogen, der in Arbeitsfelder eingeteilt wird. Jede Schülerin/jeder Schüler bearbeitet zunächst das vor ihr/ihm liegende Arbeitsfeld, dann wird das Blatt gedreht und jeder bearbeitet dann wiederum das vor ihr oder ihm liegende, über dem bereits ausgefüllten Bereich liegende Feld. Dabei kann es jeweils für die Felder oder für jede Runde unterschiedliche Fragen geben. Hinweis: Abzuraten ist von der Variante, dass die Schülerinnen und Schüler das Blatt nur nacheinander bearbeiten. Auf diese Weise entsteht zu viel Wartezeit für einzelne Schülerinnen und Schüler bzw. jeweils arbeitende Schüler werden gedrängt und in ihrer Konzentration gestört. Vorteil:» viele Ideen werden sichtbar» die bei Variante 1 entstehende Bewegungsunruhe wird vermieden Hinweis: Die Lehrkraft sollte konsequent Nebengespräche unterbinden. Unterschiedliche Arbeitstempi werden nicht ausgeglichen. 45
46 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch 3.17 Wörterkette Die Schülerinnen und Schüler finden Wörter, die durch einen Buchstaben (leicht) oder eine Silbe (schwierig) miteinander verbunden sind. Dabei bildet der letzte Buchstabe/die letzte Silbe jeweils den Anfangsbuchstaben/die Anfangssilbe des nächsten Wortes. Es können dabei noch Einschränkungen vorgegeben werden, wie z. B. nur Substantive auszuwählen oder das Thema nicht zu verlassen. Beispiel Titel Leitmotiv Vaterfigur Replik Kontrast Thema Antagonist geben nehmen nennen nerven necken 46
47 Methodenkoffer 3.18 Wörterparty (auch bekannt als Wörtertausch oder Geb-ich-dir-gibst-du-mir) Methode» zur Wiederholung von Wörtern» zum Erfassen von Vorwissen» zum Sammeln von Ideen Material» Blätter/Karteikarten (o. Ä.) mit einer entsprechenden Feldeinteilung, z. B. 5 5» leer oder schon mit Voreintrag Beispiel Anapher Ablauf Nach der Einführung in das Thema werden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, in Einzelarbeit (am Platz) einige Begriffe (z. B. fünf Begriffe, die ihnen zum Thema sprachliche Mittel einfallen) in die Tabelle einzutragen. Die Reihenfolge oder Position sind egal. Beispiel Anapher Symbol Klimax Alliteration Metapher Danach stehen die Schülerinnen und Schüler auf, gehen im Raum umher und tauschen die Begriffe. Es soll ein Begriff für einen anderen getauscht (ggf. die Bedeutung nachgefragt werden) und dann zum nächsten Partner gegangen werden, bis die gesamte Tabelle gefüllt ist. Die einzelnen Felder können abschließend voneinander getrennt werden. 47
48 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Verwendung, z. B.» zur Vorbereitung von Lernkarten» als Vorbereitung für die Strukturlegetechnik 3.19 Wörterpuzzle» Wortschatzarbeit mit dem Schwerpunkt Schreibung/Lautung» Wörter werden in ihre Buchstaben zerlegt und sollen von den Schülerinnen und Schülern geordnet werden» Möglichkeit der Differenzierung: Anfangsbuchstaben vorgeben oder in der Reihe unterstreichen, Hilfsmittel zur Verfügung stellen, z. B. Duden Beispiel Ordne die Buchstaben so, dass sich zum Oberbegriff passende Wörter ergeben. Ballade PTOSEHR KRLYI ESRV HHTRYSMU TMRUEM 48
49 Methodenkoffer 3.20 Wortkasten» Wortschatzarbeit mit dem Schwerpunkt Wiederholung von Begriffen Beispiel-Aufgaben Im Wortkasten sind neun Fachwörter versteckt, die zum Begriff Ballade gehören. 1. Markiere die Wörter. Sie können waagerecht, senkrecht, aber auch diagonal verlaufen. 2. Notiere die Wörter dann auf den Lernkarten. 3. Notiere auf der Rückseite der Karten die Bedeutung des jeweiligen Fachwortes. P E S X M E T R U M T X P V D S S D S K J L H E A E H D H W B S W X P R C R S T R O P H E I J Z H S B D G T C V K J Z Ä Z D E D A L L A B C H H I S X C S Ä Y S V S R L O C Y M I E R R Ö U F E P V Z S J G I D C B C R S B E S C V K D G M D H J D R A M A T I K A M V G H E E B N M K D J A E 49
50 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch 3.21 Stichwortkarten Funktionen» Merkhilfe beim Lernen» Orientierungshilfe in Vorträgen» Formulierungshilfe Material» z. B. Karteikarten liniert Beispiel Ballade Mischform aus Lyrik, Epik, Dramatik Mittel Lyrik: Vers, Reim, Rhythmus Stichwortkarten können auch Raster für die Strukturierung (z. B. von Präsentationen) enthalten. Beispiel: Raster für Kurzpräsentation eines Textes/Buches Titel Autor Thema Textzusammenfassung interessante/wichtige Textstellen und Begründung Wörter (wichtig, neu, besonders schön, besonders schwierig) Sonstiges 50
51 Methodenkoffer 3.22 Wörterhexagon Mit Hilfe eines Sechsecks werden Verbindungen zwischen Wörtern und Wortteilen deutlich gemacht. Die Teile des Hexagons (Dreiecke) können dabei verwendet werden, aber auch mehrere Sechsecke zusammengelegt werden. Das Hexagon kann dazu dienen, aus Wortteilen Wörter zu bilden, aber auch dazu, Verbindungen zwischen Begriffen zu verdeutlichen. Variante 1 Die Schülerinnen und Schüler fügen die Dreiecke passend zusammen und notieren dann die Wörter. Es können dann mit diesen Wörtern Sätze gebildet werden. ab holen weg geben holen über geben über über winden über nehmen Variante 2 Die Schülerinnen und Schüler legen die Sechsecke passend zusammen. Als Variante können die Schülerinnen und Schüler zunächst selbstständig Sets entwerfen und sie dann von Mitschülern zusammenfügen lassen. Epik Lyrik Strophe 51
52 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Variante 3 Die Schülerinnen und Schüler finden die passende Silbe. Sie notieren die Wörter und achten dabei auf die veränderte Schreibung. übel vollständig wichtig großzügig nichtig künstlich Aus den Adjektiven können Substantive entstehen. Finde die passende Nachsilbe und schreibe sie in die Mitte. Notiere alle Substantive. 52
53 4 Aufgabenbeispiele zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz 4.1 Wortschatzarbeit am Beispiel der Gattung Ballade Die folgenden Übungen verstehen sich nicht als Unterrichtseinheit zum Thema Ballade, sondern sollen Möglichkeiten aufzeigen, wie a. der Fachwortschatz bei der Arbeit an der Gattung Ballade erarbeitet, geübt und gefestigt werden kann und b. während der Arbeit an dieser Textform Wortschatzwissen (Allgemeinwortschatz) erweitert werden kann. Mögliche Begriffe aus dem Kontext Gattung Gattung Epik Lyrik Dramatik Erzählgedicht Erzähler Erzählperspektive Erzählbericht Präsentationsform Zeit Präsens Präteritum zeitdeckendes Erzählen zeitdehnendes Erzählen zeitraffendes Erzählen Raum innerer Raum äußerer Raum Situation Atmosphäre Vers Sprecher Strophe Reim/Reimarten/ Reimschema, z. B. Anfangsreim Binnenreim Endreim Kreuzreim Paarreim umarmender Reim Schweifreim Haufenreim Waise Metrum, z. B. Jambus Trochäus Daktylus Anapäst Rhythmus Spannung dramatische Kurve/ Spannungskurve/ Spannungsbogen Konflikt Dialog 53
54 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Begriffe des Fachwortschatzes: mögliche Liste sprachliche Mittel z. B. Metapher Symbol Alliteration Klimax Enjambement Antithese Ellipse Vergleich Begriffe des Allgemeinwortschatzes, die durch die Verwendung als Operatoren in die Bildungssprache eingegangen sind: z. B. erzählen wiedergeben zusammenfassen nennen auflisten einsetzen ersetzen ergänzen umschreiben beschreiben erklären erläutern vergleichen interpretieren untersuchen gestalten Aufgabenbeispiele Modul: Wörter und Formulierungen kontextbezogen einführen Ziel: Die Schülerinnen und Schüler aktivieren Vorwissen zum Begriff Lyrik. Material: Karten oder Papierstreifen (ca. 5 bis 6 pro Schülerin/Schüler) Aufgabe: Was macht einen Text zum Gedicht? Notiere Merkmale von Gedichten. Benutze pro Merkmal einen Papierstreifen. (danach werden die Wörter in der Vierergruppe oder im Plenum z. B. an der Tafel zusammengetragen) oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten die Begriffsinhalte zu den Wörtern Reim und Rhythmus sowie damit verbundene Unterbegriffe. Material: Text Reime Aufgabe: siehe Arbeitsblatt 1. Lies den Text. Schlage die unterstrichenen Wörter nach. 2. Erstelle Anmerkungen zur Bedeutung der Wörter und notiere sie rechts neben dem Text. Text Reime geben Gedichten Rhythmus 1. Sie bewirken, dass wir beim Lesen und Hören von Gedichten auf einige Stellen des Textes besonders achten. Wir unterscheiden dabei z. B. den Paarreim 2, den Kreuzreim 3 oder den umarmenden Reim 4. Mit dem Paarreim werden zwei Zeilen verknüpft, besondere Aufmerksamkeit liegt dabei auf den Wörtern am Zeilenende, verursacht durch die Betonung der Reimwörter, z. B. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Worterklärung Vergleiche deine Lösung mit der deines Partners. 54
55 Aufgabenbeispiele zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler lernen Unterbegriffe zum Begriffskonzept Ballade kennen. Material: verschiedene kurze Texte zu den Begriffen Methode: Info-Ecken Ablauf: Die Lehrkraft bereitet verschiedene Materialien zum Thema Ballade vor (Bilder mit Untertext, Texte) und verteilt sie auf verschiedenen Tischen. Die Schülerinnen und Schüler sichten zunächst die Materialien und nehmen dabei schon durch die Überschriften die verschiedenen Begriffe wahr. Sie wählen anhand einer Pflichtund Kürliste aus und im nächsten Arbeitsschritt werden die Materialien dann bearbeitet, um die Bedeutung der Begriffe und ihren Zusammenhang zu erschließen. oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler reaktivieren Vorwissen zum Begriff Epik. Aufgabe: siehe Arbeitsblatt Arbeitsblatt zur Begriffsliste Epik Elemente der Epik 1. Hier findest du eine Liste von Wörtern, die man zur Beschreibung erzählender Texte benutzen kann. Erzähler, Erzählerbericht, Zeit, Ort, Handlung, Dialog, Protagonist, Atmosphäre, Figur Notiere hier eine Kurzerklärung der Begriffe: Begriff Erklärung Begriff Erklärung Erzähler Dialog Erzählerbericht Protagonist Zeit Atmosphäre Ort Figur Handlung 2. Überprüfe deine Definitionen mit Hilfe des Lehrbuches. Ergänze deine Notizen, wenn du einen Begriff nicht kennst oder du deine Definition ungenau findest. Notiere auch Fragen, falls du nicht alles verstehst. 55
56 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler vergleichen ihr alltagssprachliches Konzept des Wortes Drama mit dem Fachbegriff Drama im Deutschunterricht vom Alltagssprachlichen zum Fachsprachlichen. Material: Arbeitsblatt, Nachschlagewerke Aufgabe: siehe Arbeitsblatt Arbeitsblatt zum Wort Drama 1. Notiere, was du unter dem Wort Drama verstehst und welche anderen Wörter dir in diesem Zusammenhang einfallen. Nutze dazu das Arbeitsblatt. 2. Vergleiche mit deinem Partner. Welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede stellt ihr fest? 3. Schlagt nun das Wort nach. Ihr könnt dazu alle zur Verfügung stehenden Hilfsmittel nutzen (Buch, PC, Materialsammlung). 4. Tragt euer Ergebnis im Arbeitsblatt ein. 5. Vergleicht nun, ob es Unterschiede zu eurer ersten Überlegung gibt. Drama Wörter, die mir zu dem Begriff einfallen: Was für ein Drama! Diese Definition habe ich in der Quelle gefunden: 56
57 Aufgabenbeispiele zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler erkunden den Begriff Bänkelsänger. Material: Bildimpulse: Bänkelsänger auf dem Markt Aufgabe: siehe Arbeitsblatt Moderationstext des Lehrers/der Lehrerin (Einführung in die Unterrichtssituation) Im Laufe der Jahrhunderte gab es immer wieder Berufe, die inzwischen gar nicht oder nur von einigen Menschen ausgeübt werden. Kennt ihr einen solchen Beruf? Auf dem Bild seht ihr die Darstellung eines alten Berufes, den wir uns genauer anschauen wollen, denn er hat etwas mit einem sehr modernen Beruf zu tun, den ich euch später verrate. Aber vielleicht erratet ihr selbst, welcher Beruf das ist. 1. Aufgabe für die Einzelarbeit (Tafelanschrieb): Notiere Ideen und Assoziationen zu dem Bild. (B 1) 2. Aufgabe für das Paar: Vergleicht eure Überlegungen. 3. Aufgabe im Plenum (Gespräch): Stellt eure Überlegungen und Beobachtungen vor. Habt ihr Fragen zu dem Bild? (Sammeln der Fragen an der Tafel mit Hilfe von Protokollanten) 4. Lesen Einzelarbeit: Lest den Text M 1. Markiert interessante Textstellen. Möglichkeiten der Differenzierung: Worterklärungen, unterschiedliche Textlängen 5. Aufgabe am Vierertisch oder für Arbeitspaare: Vergleicht, welche Informationen ihr interessant findet. 6. Aufgabe im Plenum: Gibt es schon Antworten auf unsere Fragen? 7. Aufgabe für die Einzelarbeit (Tafelanschrieb): Lest den Text noch einmal und wählt fünf Informationen aus, die man unbedingt über den Beruf des Bänkelsängers wissen sollte. 8. Aufgabe für das Paar: Vergleicht miteinander. Ergänzt dann gemeinsam das Arbeitsblatt A 1 Der Bänkelsänger. 9. Ausstellung der Arbeitsblätter. Vergleich. Lehrertext Ich zeige euch jetzt einen modernen Bänkelsänger, denn ganz ausgestorben ist der Beruf noch nicht. Er wird nur nicht mehr so genannt. Bild zeigen von Peter Fox oder Xavier Naidoo (o. a. in der Gruppe vermutlich bekannte Sänger). Ausblick auf die nächste Stunde Wir befassen uns mit dem, was X (Name des modernen Sängers) mit einem Bänkelsänger gemeinsam hat: die Geschichten, die sie in Versen und Liedern erzählen. 57
58 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Bildimpulse B 1 Bänkelsänger Quelle: 58
59 Aufgabenbeispiele zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz Text M 1 Untergegangene Berufe Der Bänkelsänger Von Michaela Vieser, Irmela Schautz (Illustration) Eine Kiste, eine Schautafel und ein lautes Organ: Das war das Handwerkszeug der Geschichtenerzähler vom Marktplatz. In ihren Liedern ging es um Schlachten, Morde und Katastrophen. Schon damals ließ Mitleid die Kasse klingeln Während auf dem Marktplatz das Treiben in vollem Gange ist, stellt sich ein seltsam gekleideter Mann auf eine kleine Bank und zeigt [...] auf ein Schaubild, das er hinter sich aufgestellt hat. Darauf sind fünf traurig blickende, in Lumpen gekleidete Menschen zu sehen. [...] Wer jetzt nicht stehenblieb, um die ungeheuerliche Geschichte in aller Ausführlichkeit zu hören, dem konnte auch nicht geholfen werden. Furchtbares hatte sich da zugetragen, ein schreckliches Ereignis, man stelle sich das vor! Der Bänkelsänger erhebt wiederum die Stimme und trägt das ganze Lied in mehreren Versen vor. Dabei greift er zu einer Drehorgel und begleitet seinen Sing-Sang mit einer eintönigen Melodie. Trauer, Schmerz, Furcht, Grausen: Der Bänkelsänger weiß, wie er dem Volk die Gefühle zu entlocken hat. [...] Ist die Geschichte vorgetragen, so läuft der Spielmann mit einem Hut herum und sammelt Geld ein. Er bietet auch kleine Heftchen zum Kauf an, meist mit drei Liedtexten, zum Teil mit Illustrationen. Die erste schriftliche Erwähnung eines Bänkelsängers stammt aus dem Jahr 1709, aber es wird ihn in dieser Form schon vorher gegeben haben, als Nachfolger der Spielmänner und Reimsprecher des Mittelalters. Zunächst waren die Bänkelsänger invalide Soldaten und Landstreicher, die herumgekommen waren und von Ereignissen aus anderen Gegenden in Liedform berichteten. Später war der Bänkelsänger ein richtiger Beruf, oft als Paar Mann und Frau oder häufig sogar als Familie ausgeübt. [...] Ein Affe gehörte häufig mit zur Ausstattung, die Kleidung war meist ausgefallen und hob sich optisch immer von der des Volkes ab. Entweder trug der Bänkelsänger einen Frack, Handschuhe und einen Dreispitz, um autoritär zu wirken, oder aber er wählte lumpige Kleidung, um Mitleid zu erregen. Als Fahrender, am Rande der Gesellschaft Lebender konnte er so bezeugen, dass das Lied vom Leid, das er besang, auch zum Teil sein eigenes sei. Inspiriert wurden die Bänkelsänger von Zeitungsblättern, die seit Ende des 15. Jahrhunderts zirkulierten, religiösen Gesängen und moralischen Geschichten, die sie auf ihren Reisen aufschnappten und weiterdichteten. Sie verwendeten dabei eine schwülstige Sprache, in die immer wieder Ausdrücke wie Ach, oh weh eingeflochten wurden, sowie die üblichen verdächtigen Adjektive: schauerlich, fürchterlich, tragisch. Die Lieder handelten oft von Verbrechen, Morden und Räuberbanden. Es konnten aber auch politische Ereignisse wie die Hinrichtung König Ludwig XVI. in Frankreich besungen werden oder eine Seeschlacht vor Helgoland. Es gab Texte von Katastrophen, von schrecklichen Bränden oder Überschwemmungen, in denen die Zuhörer vom Leid anderer erfuhren und aufatmen konnten, dass sie verschont geblieben waren, sei es aus Gottesfurcht oder aus Tugendhaftigkeit. [...] Aus den Bänkelgesängen entwickelten sich später die Moritatenlieder und Balladen, [...] Bis um 1920 fand man innerhalb Deutschlands die Bänkelsänger. Die letzten ihrer Art benutzten nicht mehr Schautafeln mit gemalten Bildern, sondern ausgeschnittene Zeitungsfotos, die weitaus realistischer waren. Dann traten die bunten Illustrierten ihren Siegeszug an und der Beruf starb aus. Quelle: 59
60 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Arbeitsblatt A 1 Der Bänkelsänger Quelle: Was man über den Bänkelsänger wissen sollte: 60
61 Aufgabenbeispiele zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler lernen den Begriff Ballade kennen. Sie nehmen durch Lesen die Verwendung der fachsprachlichen Begriffe wahr. Aufgabe: siehe Arbeitsblatt Arbeitsblatt zum Begriff Ballade Die Ballade 1. Lies den Text. Die Ballade Die Bezeichnung Ballade kommt ursprünglich von dem italienischen Wort ballata oder auch von dem provenzalischen Begriff balada. Beide Wörter bedeuten Tanzlied. Später wurde diese Liedform von Minnesängern zum Erzähllied weiterentwickelt. Das bedeutet, dass die Ballade in gedichteter Form Geschichten erzählte, die zum Beispiel von Rittern, unglücklichen Liebenden und magischen oder sagenhaften Ereignissen handelten. Man kann sagen, dass die Ballade sowohl epische beziehungsweise erzählende, lyrische und dramatische Elemente enthält. Deshalb erklärte Goethe die Ballade zum Urei aller drei Grundarten der Poesie. Lange Zeit waren die Verfasser der Balladen unbekannt. Die Balladen wurden als Volksballaden mündlich weitergetragen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden die Balladen dann gesammelt und in Büchern zusammengestellt. Zu der Zeit entstanden auch viele Nachdichtungen alter Stoffe und neue Dichtungen. Aus der Volksballade wurde die Kunstballade. Goethe und Schiller gefiel die Ballade so gut, dass sie 1797 ein Balladenjahr ausriefen. Auch das 19. Jahrhundert und die Zeit der Romantik und des literarischen Realismus sind in Deutschland fruchtbare Epochen für die Ballade. Beliebte Arten der Kunstballade sind die so genannte naturmagische Ballade, die von den unerklärlichen, zauberhaften Kräften der Natur handelt, sowie die historische (Helden-)Ballade mit vorwiegend aus dem Mittelalter entnommenen Themen. Seitdem ist die Ballade eine bis heute weithin beliebte Form. Sie wurde in verschiedenen Ländern und Sprachen auf unterschiedlichste Art und Weise gestaltet und weiterentwickelt. (nach 2. Unterstreiche im Text die Antworten auf die folgenden Fragen. Woher stammt das Wort Ballade? Was bedeuten die Wörter ballata und balada? Wovon handelten Balladen? Warum erklärte Goethe die Ballade zum Urei? Wann wurde aus der Volksballade die Kunstballade? Wie bezeichneten Goethe und Schiller das Jahr 1797? Welches sind beliebte Arten der Ballade? 61
62 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Variante zum Arbeitsblatt (erhöhtes Niveau) Die Ballade 1. Lies den Text. Die Ballade Die Bezeichnung Ballade kommt ursprünglich von dem italienischen Wort ballata oder auch von dem provenzalischen Begriff balada. Beide Wörter bedeuten Tanzlied. Später wurde diese Liedform von Minnesängern zum Erzähllied weiterentwickelt. Das bedeutet, dass die Ballade in gedichteter Form Geschichten erzählte, die zum Beispiel von Rittern, unglücklichen Liebenden und magischen oder sagenhaften Ereignissen handelten. Man kann sagen, dass die Ballade sowohl epische beziehungsweise erzählende, lyrische und dramatische Elemente enthält. Deshalb erklärte Goethe die Ballade zum Urei aller drei Grundarten der Poesie. Lange Zeit waren die Verfasser der Balladen unbekannt. Die Balladen wurden als Volksballaden mündlich weitergetragen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden die Balladen dann gesammelt und in Büchern zusammengestellt. Zu der Zeit entstanden auch viele Nachdichtungen alter Stoffe und neue Dichtungen. Aus der Volksballade wurde die Kunstballade. Goethe und Schiller gefiel die Ballade so gut, dass sie 1797 ein Balladenjahr ausriefen. Auch das 19. Jahrhundert und die Zeit der Romantik und des literarischen Realismus sind in Deutschland fruchtbare Epochen für die Ballade. Beliebte Arten der Kunstballade sind die so genannte naturmagische Ballade, die von den unerklärlichen, zauberhaften Kräften der Natur handelt, sowie die historische (Helden-)Ballade mit vorwiegend aus dem Mittelalter entnommenen Themen. Seitdem ist die Ballade eine bis heute weithin beliebte Form. Sie wurde in verschiedenen Ländern und Sprachen auf unterschiedlichste Art und Weise gestaltet und weiterentwickelt. (nach 2. Unterstreiche alle wichtigen Informationen über die Herkunft des Begriffes die Geschichte der Ballade. 62
63 Aufgabenbeispiele zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler lernen den Begriff Archaismus sowie einzelne Wörter als Teil des veralteten Wortschatzes kennen. Material: Text Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland von Theodor Fontane Aufgabe: siehe Arbeitsblatt Differenzierungsmöglichkeiten Dem Schüler/der Schülerin wird ein bestimmtes Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, das eine begrenzte Auswahl enthält wird ein bestimmtes Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, aus dem der Schüler/die Schülerin selbst auswählen muss, z. B. Internet, ohne eine Quelleninformation oder Suchhilfe zu geben wird eine Auswahl von Hilfsmitteln zur Verfügung gestellt, z. B. verschiedene Medien. Möglichkeit der Metakommunikation (Modul 4): Austausch über das Vorgehen, die Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten, die sich aus der Arbeit mit den einzelnen Hilfsmitteln ergeben. Arbeitsblatt Archaismen In der Ballade Herr von Ribbeck zu Ribbeck werden einige Wörter verwendet, die uns heute ungewöhnlich erscheinen. Man nennt sie Archaismen (Einzahl: Archaismus). 1. Finde heraus, was sie bedeuten. Notiere die Erklärung. 2. Vergleiche deine Erklärung mit dem Partner. Archaismus (= veraltete Bezeichnung) Pantinen lobesam abscheiden Büdner knausern Erklärung 3. Kennst du andere Wörter, die heute selten gebraucht werden? Notiere die Wörter. 63
64 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler lernen den Begriff Dialekt kennen. Sie vergleichen ihre Sprache mit der der Handelnden in der Ballade. Aufgabe: siehe Arbeitsblatt 1. Fontane lässt Herrn von Ribbeck und die Kinder anders sprechen als den Erzähler. Sie sprechen im Dialekt. Was sagen sie? Notiere eine eigene Formulierung für die Sätze der Sprechenden. Es ist ganz leicht, wenn du die Sätze laut sprichst. 2. Finde heraus, wo das Havelland liegt und ob es den Ort wirklich gibt. 3. Finde auf der Karte der Dialekte heraus, welchen Dialekt Herr von Ribbeck und die Kinder sprechen. Welcher Dialekt wird in deiner Region gesprochen? Aufgabenvariante: Visualisierung, Sprechblasen einfügen Möglichkeit zur Reflexion (Funktionalität der unterschiedlichen Sprachvarianten im Gedicht): Aufgabe: Diese Art zu sprechen nennt man Dialekt. Stelle Vermutungen an, warum Fontane für Herrn von Ribbeck und die Kinder eine andere Sprachform als für den Erzähler wählt. (Karten z. B. auf: runde_1/f20/ oder interaktiv, auch mit Ratespiel auf Material zu Aufgabe 1 Was Herr von Ribbeck und die Kinder sagen/was im Baum zu hören ist: Junge, wiste ne Birn? Lütt Dirn, kumm man röwer, ick hebb ne Birn He is dod nu. Wer giwt und nu ne Beer? Wiste ne Beer? Lütt Dirn, kumm man röwer, ick gew di ne Birn. eigene Formulierung Junge, möchtest du eine Birne haben? 64
65 Aufgabenbeispiele zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz Modul: Wörter und Formulierungen üben Ziel: Die Schülerinnen und Schüler üben Fachbegriffe, die man benötigt, um epische Texte zu beschreiben. Aufgabe: siehe Arbeitsblatt Arbeitsblatt Begriffe finden 1. Lies den Text. 2. Ergänze die unten stehende Tabelle. Suche den Begriff zur Erläuterung aus dem Text heraus, unterstreiche ihn und schreibe ihn dann in die linke Tabellenspalte. Begriffe der Epik Mit dem Begriff Epik wird die Gattung der erzählenden Texte bezeichnet. Erzählende Texte sind Texte, die von einer Erzählerinstanz präsentiert werden. Der Erzähler ist niemals identisch mit dem Autor. Man kann die Erzählerfigur aber trotzdem genauer beschreiben. So kann der Erzähler als Ich-Erzähler oder Er/Sie-Erzähler in Erscheinung treten. Der Ich-Erzähler präsentiert die Handlung in der Ich-Form. Er ist eine erlebende und erzählende Figur. Er kann seine Geschichte z. B. aus der Retrospektive (das ist die Rückschau auf vergangene Ereignisse), d. h. im Präteritum oder aus der Gegenwartssicht als gerade erlebendes Ich (d. h. im Präsens) darbieten. Der Er/Sie-Erzähler vermittelt das Geschehen aus der Sicht einer oder mehrerer Figuren. Dabei verwendet er die Er- oder Sie-Form. Der auktoriale Erzähler ist eine besondere Form der Er/Sie-Perspektive. Der Er/Sie-Erzähler weiß alles (auktoriale = allwissende, überschauende Position) über die Figuren, die Ereignisse. Er kennt die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Manchmal werden die Gedanken und Gefühle der Figuren als innerer Monolog oder Bewusstseinsstrom wiedergegeben. Wenn eine Figur mit sich selbst spricht, also in Gedanken (z. B. Was soll ich tun? Was soll ich nur tun?), dann wird dies als innerer Monolog bezeichnet. Werden Gedanken, Gefühle, Eindrücke in loser Folge, ungeordnet, quasi wie das Hin- und Hergrübeln wiedergegeben, dann nennt man dies Bewusstseinsstrom (z. B. Grün. Der Mann, das Haus. Die Angst kehrt zurück. Wahnsinn. Ich kann nicht mehr atmen! Hilfe!) Der Raum in einer Geschichte kann ein äußerer Raum, z. B. eine Landschaft oder ein Haus sein, aber auch der innere Raum, das Bewusstsein und die sozialen Beziehungen von Figuren, z. B. die Familie. Zeit spielt nicht nur im Hinblick auf den Erzählvorgang eine Rolle, ob z. B. im Präsens oder Präteritum erzählt wird, sondern auch, wie das Verhältnis von erzählter Zeit (Zeit, die die Handlung braucht) und Erzählzeit (Zeit, die das Erzählen braucht) ist. So kann z. B. zeitdeckend erzählt werden, d. h. der Erzählvorgang dauert so lange, wie die Handlung selbst. Das ist z. B. der Fall, wenn Dialoge wiedergegeben werden. Zeitraffend wird erzählt, wenn viel mehr Zeit in der Handlung vergeht, als das Erzählen braucht. Typische Formulierung sind hier Nach vielen Jahren oder Als fünf Jahre vergangen waren. Das zeitdehnende Erzählen ist ein Mittel, um die Eindrücke der Figuren und Vorgänge in der Geschichte detailliert auszumalen. Der Erzählvorgang nimmt viel mehr Zeit in Anspruch als die erzählte Handlung. 65
66 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Begriff Erläuterung. bezeichnet erzählende Texte. werden von einem Erzähler präsentiert. bietet die Geschichte aus der Ich-Perspektive dar. bietet die Geschichte aus der Er/Sie-Perspektive dar, d. h. die Ich-Form wird verwendet und die Figur ist erlebendes und erzählendes Ich. oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler ordnen Wörter in Kategorien und schreiben sie richtig. Aufgabe: siehe Arbeitsblatt Arbeitsblatt Das Wortfeld sich äußern 1. Ordne die folgenden Wörter den in der Tabelle genannten Arten, sich zu äußern, zu und schreibe sie in die rechte Tabellenspalte. zischen, reden, schluchzen, sich erkundigen, befehlen, hauchen, schreien, plaudern, murmeln, plärren, erwidern, sich beschweren, wispern, kreischen, vorschlagen, stammeln, lallen, reklamieren, tuscheln, krakeelen, erwähnen, widersprechen, näseln, zurechtweisen, seufzen, krächzen, versprechen, jammern, schildern, zustimmen, verkünden, petzen, flunkern sich leise äußern sich laut äußern sich traurig äußern sich wütend äußern oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler ordnen bekannte Wörter neu und nehmen dabei die Schreibung wahr. Aufgabe: siehe Arbeitsblatt Arbeitsblatt Das Wortfeld sagen 1. Ergänzt die folgende Wörterliste zum Wortfeld sagen um mindestens 10 weitere Wörter und notiert alle Wörter einzeln auf Papierstreifen. aussagen, einwerfen, bemerken, weinen, stottern, lispeln, rufen, schreien, fordern, stöhnen, berichten, sagen, reden, rufen, behaupten, brummen, plappern, stottern, kreischen, brüllen, anschreien, protestieren 2. Legt gemeinsam ein Scrabble aus möglichst vielen der Wörter. 66
67 Aufgabenbeispiele zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler finden Wortreihen und verwenden Wörter kontextgebunden im Satz. Material: Text Die Brück am Tay von Theodor Fontane Aufgabe: siehe Arbeitsblatt Arbeitsblatt Wortreihe 1. Notiere Wörter, die eine Bewegung mit starkem Tempo bezeichnen. rasen 2. Bilde je einen Satz mit den Verben, die die Bewegung des Zuges in der Ballade Die Brück am Tay beschreiben. Beispiel: Während die Hexen sich verabreden, rast der Zug heran. oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler memorieren zusammenhängende Begriffe. Ablauf: Erste Möglichkeit Die Schülerinnen und Schüler sollen nach Ansage durch die Lehrkraft spontan einen weiteren Begriff zu dem, der genannt wurde, notieren. Danach wird verglichen und geordnet. Die Lehrerin/der Lehrer sagt z. B. Ballade und der Schüler/die Schülerin schreibt Tanzlied. Die gefundenen Wörter lassen sich dann auch zu Sätzen oder kurzen Texten verarbeiten. Zweite Möglichkeit Material: Kartenset mit Begriffen Arbeit im Paar oder Kugellagerübung*: Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Set Karten mit Begriffen. Im Wechsel nennen sie dem Partner ein Wort und der/die muss ein Wort nennen oder notieren, das ihm/ihr spontan dazu einfällt. Dritte Möglichkeit (Kombination aus Einzel- und Paararbeit): Material: Papierstreifen Die Schülerinnen und Schüler notieren zunächst in Einzelarbeit eine begrenzte Anzahl von Wörtern zu einem Sachgebiet, z. B. Ballade, auf Papierstreifen. Dann tauschen sie mit dem Partner und dieser/diese notiert auf der Rückseite passende Begriffe/spontan einfallende Begriffe (z. B. Ballade/Bänkelsänger). 67
68 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler bilden (a und b)/finden (c) zu einem bekannten Wort neue Wörter. Methode: Fünf-Finger Ablauf: Es wird ein Wort gegeben und der Schüler/die Schülerin findet (je nach Übungsschwerpunkt) a) vier neue Zusammensetzungen oder b) vier Ableitungen oder c) vier sinn-/themenverwandte Wörter. Dabei werden die Wörter mit Hilfe der Finger heruntergezählt. z. B. rasen, vorbeirasen, heranrasen, vorüberrasen, wegrasen Tempo, Bewegung, Schnelligkeit, Beschleunigung, Antrieb Beispiel 5-Finger-Bild Rhythmus Reim Strophe änkelsänger B Ballade 68
69 Aufgabenbeispiele zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz oder Ziel: Material: Logbuch Ablauf: Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine Übersicht über neu erlernte Begriffe und ihre Bedeutung sowie ggf. ihre Ordnung und Verwendung. Die Schülerinnen und Schüler führen während der Arbeit an den Balladen ein Logbuch zu Begriffen. Das Logbuch enthält auf jeder Seite Anweisungen für das Notieren, wird aber im Laufe der Bearbeitung des Themas selbstständig geführt. Beispiel für ein Logbuch zum Thema: Rund um Balladen Deckblatt Rund um Balladen Wörter und Begriffe Seite 1 Welche Fachbegriffe habe ich gelernt? Seite 2 Wörter, die Bewegung ausdrücken: Seite 3 Das Wortfeld Gefühle Seite 4 Synonyme/Antonyme Seite 5 Welche Arbeitsanweisungen (Operatoren) habe ich ausgeführt? 69
70 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Modul: Wörter und Formulierungen nutzen Fachsprache verwenden Lernende zum selbstständigen Gebrauch der neuen Begriffe und Formulierungen führen Ziel: Die Schülerinnen und Schüler setzen ihnen bereits bekannte Wörter und Begriffe in einen vorhandenen Text ein. Sie wählen dazu aus einem Set von Begriffen aus. Textgrundlage: Text zum Begriff Ballade Aufgabe: siehe Arbeitsblatt Differenzierungsmöglichkeit: Begriffe werden nicht vorgegeben oder Begriffe werden durch den Erstbuchstaben angedeutet Arbeitsblatt Begriff Ballade 1. Wähle aus der Liste der Wörter die passenden zur Ergänzung des Lückentextes aus. Tanzlied, Minnesängern, Geschichten, epische, lyrische, dramatische, Poesie, mündlich, Kunstballade, Balladenjahr, Romantik, naturmagische Die Ballade Die Bezeichnung Ballade kommt ursprünglich von dem italienischen Wort ballata oder auch von dem provenzalischen Begriff balada. Beide Wörter bedeuten. Später wurde diese Liedform von zum Erzähllied weiterentwickelt. Das bedeutet, dass die Ballade in gedichteter Form erzählte, die zum Beispiel von Rittern, unglücklichen Liebenden und magischen oder sagenhaften Ereignissen handelten. Man kann sagen, dass die Ballade sowohl beziehungsweise erzählende, und Elemente enthält. Deshalb erklärte Goethe die Ballade zum Urei aller drei Grundarten der. Lange Zeit waren die Verfasser der Balladen unbekannt. Die Balladen wurden als Volksballaden weitergetragen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden die Balladen dann gesammelt und in Büchern zusammengestellt. Zu der Zeit entstanden auch viele Nachdichtungen alter Stoffe und neue Dichtungen. Aus der Volksballade wurde die. Goethe und Schiller gefiel die Ballade so gut, dass sie 1797 ein ausriefen. Auch das 19. Jahrhundert und die Zeit der und des literarischen Realismus sind in Deutschland fruchtbare Epochen für die Ballade. Beliebte Arten der Kunstballade sind die so genannte Ballade, die von den unerklärlichen, zauberhaften Kräften der Natur handelt, sowie die historische (Helden-)Ballade mit vorwiegend aus dem Mittelalter entnommenen Themen. Seitdem ist die Ballade eine bis heute weithin beliebte Form. Sie wurde in verschiedenen Ländern und Sprachen auf unterschiedlichste Art und Weise gestaltet und weiterentwickelt. (nach 70
71 Aufgabenbeispiele zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz Lösung Die Ballade Die Bezeichnung Ballade kommt ursprünglich von dem italienischen Wort ballata oder auch von dem provenzalischen Begriff balada. Beide Wörter bedeuten Tanzlied. Später wurde diese Liedform von Minnesängern zum Erzähllied weiterentwickelt. Das bedeutet, dass die Ballade in gedichteter Form Geschichten erzählte, die zum Beispiel von Rittern, unglücklichen Liebenden und magischen oder sagenhaften Ereignissen handelten. Man kann sagen, dass die Ballade sowohl epische beziehungsweise erzählende, lyrische und dramatische Elemente enthält. Deshalb erklärte Goethe die Ballade zum Urei aller drei Grundarten der Poesie. Lange Zeit waren die Verfasser der Balladen unbekannt. Die Balladen wurden als Volksballaden mündlich weitergetragen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden die Balladen dann gesammelt und in Büchern zusammengestellt. Zu der Zeit entstanden auch viele Nachdichtungen alter Stoffe und neue Dichtungen. Aus der Volksballade wurde die Kunstballade. Goethe und Schiller gefiel die Ballade so gut, dass sie 1797 ein Balladenjahr ausriefen. Auch das 19. Jahrhundert und die Zeit der Romantik und des literarischen Realismus sind in Deutschland fruchtbare Epochen für die Ballade. Beliebte Arten der Kunstballade sind die so genannte naturmagische Ballade, die von den unerklärlichen, zauberhaften Kräften der Natur handelt, sowie die historische (Helden-)Ballade mit vorwiegend aus dem Mittelalter entnommenen Themen. Seitdem ist die Ballade eine bis heute weithin beliebte Form. Sie wurde in verschiedenen Ländern und Sprachen auf unterschiedlichste Art und Weise gestaltet und weiterentwickelt. (nach 71
72 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler ordnen Fachbegriffe Textbefunden zu. Material: Die Brück am Tay von Theodor Fontane, Arbeitsblatt Gestaltungsmittel Aufgabe: siehe Arbeitsblatt Arbeitsblatt Gestaltungsmittel Unterstreiche im Text Beispiele für die am Rand genannten Gestaltungselemente. Theodor Fontane: Die Brück am Tay Wann treffen wir drei wieder zusamm? Paarreim Um die siebente Stund, am Brückendamm. wörtliche Rede Am Mittelpfeiler. Ich lösch die Flamm. Kreuzreim 05 Ich mit. Ich komme vom Norden her. Ellipse Und ich vom Süden. Anapher Und ich vom Meer. Hei, das gibt ein Ringelreihn, und die Brücke muß in den Grund hinein. 10 Und der Zug, der in die Brücke tritt Enjambement um die siebente Stund? Ei, der muß mit. Wechselrede/Dialog Muß mit. Wiederholung Tand, Tand Archaismus 15 ist das Gebild von Menschenhand. Auf der Norderseite, das Brückenhaus alle Fenster sehen nach Süden aus, Personifizierung und die Brücknersleut, ohne Rast und Ruh Zwillingsformel/Alliteration und in Bangen sehen nach Süden zu, 20 sehen und warten, ob nicht ein Licht Paarreim übers Wasser hin ich komme spricht, ich komme, trotz Nacht und Sturmesflug, ich, der Edinburger Zug. [ ] 72
73 Aufgabenbeispiele zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler setzen ihr Vokabular zur Beschreibung einer visuell präsentierten Szenerie ein, die sich dem Wortfeld Gefahr zuordnen lässt. Material: Text John Maynard von Theodor Fontane Aufgabe: siehe Arbeitsblatt 1. Sammelt möglichst viele Begriffe, die mit dem Wort Gefahr verbunden sind. (Erstellen eines Assoziogramms* am Vierertisch, z. B. auf Flipchart) danach Bildimpuls: Brennendes Schiff (z. B Notiere deine Assoziationen zum Bild (Brainstorming*, Einzelarbeit) auf Papierstreifen oder auf Teilen des Flipcharts. Tausche dich mit einer Mitschülerin/einem Mitschüler dazu aus. weitere Möglichkeit: Das Bild wird aus zwei Perspektiven angeboten (z. B. aus der Perspektive eines im Rettungsboot Sitzenden und eines an Bord Befindlichen) und beschrieben. oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler gewinnen eine Überblick über das gelernte Vokabular und verwenden es in einem Handlungskontext. Material: Lernlandkarte Voraussetzung: Die Schülerinnen und Schüler kennen den Aufbau von Lexika und Artikeln in Lexika. Aufgabe: siehe Arbeitsblatt Du benötigst den Begriff Ballade und Wörter, die damit im Zusammenhang stehen, auch in den anderen Schuljahren. Stelle mit Hilfe unserer Lernlandkarte ein Mini-Lexikon zum Begriff Ballade zusammen. Dein Lexikon sollte mindestens folgende Begriffe enthalten: Ballade, Erzähler, Ort, Zeit, Dialog, Sprecher, Handlung, Atmosphäre, Spannungsbogen, Balladenurteil, Reim, Vers, Strophe Außerdem wären Beispiele für sprachliche Mittel (Metapher, Anapher, Enjambement, Alliteration, Wiederholung, Ausruf), ein Textbeispiel sowie Informationen zu Goethes und Schillers Arbeit an Balladen im Balladenjahr hilfreich. 1. Überprüfe zunächst, welche weiteren Begriffe zum Thema Ballade gehören. 2. Sammle die notwendigen Informationen z. B. auf Karteikarten. 3. Plane dein Lexikon. Denke auch an die Gestaltung (Schrift, Schriftgröße, Bilder, Zusatzinformationen). 4. Gestalte dein Lexikon. Nach jedem Arbeitsschritt kannst du dir Unterstützung holen oder deine Ideen überprüfen lassen. Voraussetzung ist, dass du zunächst eine Lösung versucht hast. 73
74 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Beispiel einer Lernlandkarte zur Ballade 74
75 Aufgabenbeispiele zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler verwenden selbstständig Wörter und Formulierungen (Fachwortschatz sowie Alltagssprache) in komplexen Darstellungen. Material: Dinge, Bilder, die etwas mit dem Thema zu tun haben (z. B. zur Ballade Erlkönig eine Illustration) Vorgehen: Methode Ein Glas Tee Die Schülerinnen und Schüler sitzen im Stuhlkreis. Der Gegenstand/die Gegenstände liegen in der Mitte. Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, einen Gegenstand zu wählen und ihre Assoziationen zu beschreiben (z. B. wenn es um das Thema Mensch und Technik geht und im weiteren Verlauf dann um die Ballade Die Brück am Tay eine Computermaus). Wenn nur ein Gegenstand liegt, bezieht sich jeder Teilnehmer auf diesen Gegenstand. Die Ideen können protokolliert werden. Es ist auch möglich, diese Übung an Vierertischen auszuführen und dann im Plenum zu vergleichen. oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler verwenden ein vorher erarbeitetes Vokabular zur Beschreibung von Illustrationen. Material: Illustrationen zu einer Ballade (selbst gestaltet oder aus anderen Quellen) Vorgehen: Methode Fotostrecke Die Illustrationen liegen in der Mitte. Jeder Schüler/jede Schülerin wählt eine, hebt sie aber noch nicht auf. Die Schüler und Schülerinnen gruppieren sich zu den Illustrationen (nach Möglichkeit sollen alle verwendet werden) und besprechen, was darauf zu sehen ist und in welcher Beziehung sie zum Balladentext stehen. Dabei sollen sie entsprechende Fachbegriffe (Vordergrund, Hintergrund, Farbkomposition, Atmosphäre, Situation, Strophe, Höhepunkt etc.) verwenden. Abschließend werden die Illustrationen präsentiert. Diese Übung gibt auch die Möglichkeit einer Kontrolle durch die Schülerinnen und Schüler, indem z. B. zwei Schüler notieren, welche Fachbegriffe verwendet wurden (entweder selbstständige Notiz oder Herausstreichen aus einer Liste). 75
76 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Modul: Über Wörter und Formulierungen reflektieren Aufbau einer Wortschatzanalysekompetenz, die beim Verstehen und Lernen neuer Wörter und Formulierungen hilft Ziel: Die Schülerinnen und Schüler strukturieren Begriffe. Material: Begriffskarten Methode: Strukturlegetechnik* Aufgabe: siehe Arbeitsblatt 1. Sieh dir alle Begriffe an und überlege kurz, ob du sie erklären kannst. Lege die Begriffe, die du nicht erklären kannst, auf einen separaten Stapel. (für den Einzelnen) 2. Erklärt euch gegenseitig die Begriffe, insbesondere die, bei denen ihr Schwierigkeiten hattet. Ihr könnt auch ein Nachschlagewerk zu Rate ziehen. (für das Paar) 3. Lege die Karten so zusammen, dass verwandte Begriffe einander zugeordnet werden und dass man Ober- und Unterbegriffe erkennt. (für den Einzelnen) 4. Erklärt euch gegenseitig die Struktur, die ihr gelegt habt und begründet die Anordnung. Gibt es Gemeinsamkeiten? (für das Paar oder die Vierergruppe) Begriffsliste: 20 bis 30 Wörter aus einem Themenfeld, z. B. Ballade, Erzählgedicht, Sprecher, Erzähler, Schweifreim, Strophe, Erzählperspektive, Dialog, Erzählbericht, zeitdeckendes Erzählen, zeitdehnendes Erzählen, Binnenreim, Trochäus, Rhythmus, Spannung, Jambus, Konflikt, Waise, zeitraffendes Erzählen, innerer Raum, Paarreim, Haufenreim, Metrum, äußerer Raum, Atmosphäre, Vers, Kreuzreim, umarmender Reim oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler wählen vorgegebene Wörter kontextbezogen aus und begründen die Auswahl. Aufgabe: siehe Arbeitsblatt Es ist nicht immer leicht, das passende Wort zu finden, wenn man einen Aufsatz schreibt. Hier findest du einige Beispiele, die dir helfen sollen, dich darauf vorzubereiten. 1. Wähle aus den vorgegebenen Formulierungen eine passende aus und ergänze die Sätze. 2. Vergleiche und diskutiere deine Lösung mit einer Partnerin/einem Partner. Die Ballade Titel Die Brück am Tay. hat den trägt den wird bezeichnet mit dem In der Ballade wird das Verhältnis von Mensch und Technik Der Erzähler von einem Eisenbahnunglück an einer Brücke über den Fluss Tay. angesprochen thematisiert dargestellt erzählt berichtet redet Die Verse unterschiedliche Reime. schließen mit enden auf haben 76
77 Aufgabenbeispiele zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz oder Ziel: Die Schülerinnen und Schüler denken über die Verwandtschaft von Wörtern nach und erweitern ihren Wortschatz. Material: Arbeitsblatt mit grafischer Darstellung, z. B. Kreis oder Spielfeld Aufgabe: Arbeit am Fachwortschatz: Finde möglichst viele Wörter, die zum Thema Gedichte, Lyrik und Ballade gehören. oder Arbeit am Allgemeinwortschatz: siehe Arbeitsblatt Arbeitsblatt zur Erstellung eines Wortfeldes Nacht 1. Erstelle eine Liste von Wörtern, die zum Wortfeld Nacht gehören. Beispiel: Angst, Schatten, Dunkelheit Quelle: 77
78 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Modul: Testen Ergebnissicherung, Arbeit am Fachwortschatz verbindlich machen Aufgabe: siehe Arbeitsblatt 1. Hier findest du eine Liste von Fachbegriffen. Wähle fünf aus und erkläre sie. Lyrik, Epik, Dramatik, Erzähler, Atmosphäre, Dialog, Reim Begriff Erklärung oder Aufgabe: siehe Arbeitsblatt Hier siehst du eine Illustration zur Ballade Der Erlkönig. 1. Erläutere, welche Stimmung im Bild dargestellt wird und mit welchen Mitteln dies geschieht. 2. Erkläre, welche Beziehung zwischen der Atmosphäre in der Ballade und der Stimmung im Bild besteht. Begründe. Stelle dazu Beziehungen zwischen den Bildmitteln und den Gestaltungsmitteln des Textes her. Quelle: oder Aufgabe: Die Ballade Die Brück am Tay enthält viele Gestaltungsmittel, die das Balladengeschehen dramatisch erscheinen lassen. Benenne fünf und erläutere, wie sie im Einzelnen zu der dramatischen Atmosphäre beitragen. 78
79 Aufgabenbeispiele zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz 4.2 Wortschatzarbeit am Thema Werbung Die folgenden Übungen verstehen sich nicht als Unterrichtseinheit zum Thema Werbung, sondern sollen Möglichkeiten aufzeigen, wie a. Fachwortschatz bei der Arbeit am Thema Werbung erarbeitet, geübt und gefestigt werden kann und b. während der Arbeit Wortschatzwissen (Allgemeinwortschatz) erweitert werden kann. Modul: Wörter und Formulierungen kontextbezogen einführen, so dass das Verstehen der neuen Begriffe und Formulierungen ermöglicht wird Ziel: Die Schülerinnen und Schüler lernen Begriffe aus dem Bereich der Werbung kennen und vertiefen deren Bedeutungen. Material: Einführungstext (der an die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler anknüpft und dabei die einzuführenden Fachbegriffe verwendet) und Arbeitsblatt Aufgabe: siehe Arbeitsblatt Einführungstext des Lehrers, der an die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler anknüpft und dabei die einzuführenden Fachbegriffe verwendet: In unserem täglichen Leben sind wir von Werbung umgeben. Sie begegnet uns auf der Straße, im Internet, im Radio, Fernsehen oder in den Illustrierten, sie wird dort platziert, wo wir sie nicht übersehen können, als Product Placement. Mit großen Kampagnen wird für ein neues Parfüm geworben, Slogans wie McDonalds ist einfach gut und die passende Headline Stars of Amerika, Teil 2 dazu sollen uns davon überzeugen, dass man nirgends so gut isst wie bei dieser Fastfood-Kette. Die PR-Leute des Fernsehens schrecken nicht einmal vor Schleichwerbung zurück, wenn sie dem Anrufer bei der Fernsehsendung einen Preis von Media Markt versprechen. 1. Bei den nachfolgenden Begriffen sind die Erklärungen durcheinander geraten. Ordne den Begriffen ihre korrekten Erklärungen zu und vergleiche deine Zuordnungen mit denen deines Banknachbarn. Schleichwerbung Product Placement Headline PR Slogan Kampagne Aktionen von Unternehmen zum Zwecke der Bekanntmachung von Produkten insbesondere bei der Markteinführung. Sie zielen auf Aufmerksamkeit, Glaubwürdigkeit, Merkfähigkeit und Kontinuität Schlagzeile als Aufhänger einer Werbeanzeige variiert innerhalb einer Kampagne public relations = Öffentlichkeitsarbeit Werbeart, die darauf abzielt, die zu bewerbenden Produkte dort zu platzieren, dass sie möglichst von vielen Menschen wahrgenommen werden Werbeform, die nicht direkt als solche wahrgenommen wird, aber eine ähnliche hohe Wirkung bei den Konsumenten erzielt Werbespruch oder Schlagwort Merksatz/Kernsatz/Zwecksatz; stetiges Element einer Kampagne 79
80 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Modul: Wörter und Formulierungen üben Bedeutungen zunehmend erfassen und formulieren Ziel: Die Schülerinnen und Schüler erfassen die Bedeutung der Begriffe aus der Werbung durch Zuordnung von Beispielen und üben diese in entsprechenden Wendungen. Material: Internet, Illustrierte u. a. Aufgabe: Finde mit Hilfe des Internets oder anderer Medien Beispiele für Schleichwerbung, Product Placement, Headlines, PR-Kampagnen und Slogans. Erläutere deine Beispiele in einem kurzen Vortrag. Modul: Wörter und Formulierungen nutzen Fachsprache verwenden Lernende zum selbstständigen Gebrauch der neuen Begriffe und Formulierungen führen Ziel: Die Schülerinnen und Schüler verwenden die Fachbegriffe und Wendungen und vertiefen an einem Beispiel die Gebrauchsmöglichkeiten des Wortes Slogan Material: Lückentext, Wortliste Aufgabe: siehe Arbeitsblatt 1. Ergänze den Lückentext mit folgenden Fachwörtern (Mehrfachnennungen sind möglich): Schleichwerbung, Product Placement, Headline, PR, Slogan, Kampagne Australien lockt mit genialer PR-Kampagne Es gibt Marketing- bzw. (PR)-Ideen, da fasst man sich an den Kopf und fragt sich, warum man nicht selbst auf die geniale Idee gekommen ist. Oft sind es relativ einfache Ideen, die eine riesige Wirkung entfalten. Eine solche (PR) Aktion ist gerade erfolgreich zu Ende gegangen mit dem (Slogan) Willkommen beim besten Job der Welt! Dabei handelt es sich bei der (Kampagne) der Tourismus-Behörde von Queensland in Australien um eine weltweite Erfolgsstory. Irgendwann saßen die Verantwortlichen von Queensland zusammen und haben wahrscheinlich ein Brainstorming veranstaltet. Die Aufgabe bestand darin, mehr Touristen in die Region zu locken. Dabei vertraute man nicht auf die übliche (Schleichwerbung), wie sie indirekt von den Bildbänden oder Naturfilmen über die Region ausgeht, denn man wollte vor allem eine weltweit wirksame Werbung. Dazu kam man auf eine hervorragende Idee. Anstatt klassische Werbung zu machen, nutzte man auf geniale Weise das Web 2.0 als (Product Placement), schuf einen neuen Job und schrieb einen Wettbewerb aus mit der (Headline): Insel-Ranger gesucht auf Hamilton Island. Bei Hamilton-Island handelt es sich um eine Trauminsel vor der Küste Queenslands. Ein wahrer Postkarten-Traum direkt am Great Barrier Reef. Dieser Job sollte verlost werden und der Gewinner konnte dann für sechs Monate auf der Insel leben und musste nur ein wenig die Insel im Auge behalten und bloggen. Zudem erhielt er Dollar Gehalt für diese 6 Monate und konnte kostenlos in einer Traumvilla wohnen. Und die Idee ging auf. Weltweit berichteten Blogger über die (Kampagne) und auch die großen Zeitungen und Online-Medien brachten dazu Berichte. So z. B. die BBC News oder AsiaOne. 80
81 Aufgabenbeispiele zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz Auf Youtube gab es einige Videos und durch all diese Dinge verbreitete sich die Nachricht weltweit. Am Ende gab es Bewerber. (vgl Untersuche die nachfolgende Liste von Slogans auf die darin vorkommenden satzbezogenen rhetorischen Mittel und trage die entsprechenden Beispiele in die Tabelle ein. oder Suche im Internet unter entsprechende Slogans, die die oben dargestellten satzbezogenen rhetorischen Mittel enthalten, und trage sie in die Tabelle ein. IKK classic: Unser Handwerk. Ihre Gesundheit. ABS Ruefer (CH): Automation Innovation Präzision 1 to 1 Energy (CH): Energie mit Intelligenz Agentur für Erneuerbare Energien: Deutschland hat unendlich viel Energie. Anais Anais: Das zärtlichste aller Parfüms. Chloé: Lange bevor es ein Parfüm war, war es eine Legende der Liebe Kölnisch Eis: Kühlt. Erfrischt. Belebt. Audi V8: Eine Luxuslimousine sollte vor allem Sie selbst beeindrucken. Berking: Drucksache ist Chefsache. Rei: Frühlingszeit Hausputzzeit! Alles strahlt so frisch gereit. AEG: Erhaltʼ das Glück in deiner Ehʼ durch ein Gerät von AEG! 1. FC Saarbrücken: Liebe kennt keine Liga. Alegria (AT): Einfach glückliche Schuhe. 8 x 4: Mehr Sicherheit kann keiner bieten Aquilana (CH): Eine gesunde Krankenversicherung. Alcatel: Haben Sie schpn mal verszucht, auf einr zu kleinen Tasztatur eine Telrfonnummer einzutippen? Paulaner: Gut, besser, Paulaner. 81
82 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Doppelung (Gemination) Verdoppelung; unmittelbare Wiederholung eines Satzteiles (Wort oder Wortgruppe) Rhetorische Frage Scheinfrage, bei der jeder schon die Antwort kennt Steigerung (Klimax) steigernde Aneinanderreihung von Begriffen Übertreibung (Hyperbel) starke Übertreibung Antithese Entgegenstellung von Begriffen oder Gedanken; Imperativ Befehlsform Personifizierung (Personifikation) Vermenschlichung von einem Begriff oder Gegenstand 82
83 Aufgabenbeispiele zur Arbeit am Fach- und Allgemeinwortschatz Modul: Über Wörter und Formulierungen reflektieren Aufbau einer Wortschatzanalysekompetenz, die beim Verstehen und lernen neuer Wörter und Formulierungen hilft Ziel: Die Schülerinnen und Schüler vertiefen ihre Wortschatzanalysekompetenz am Beispiel des Begriffes Headline. Material: Arbeitsblatt Aufgabe: In den drei der unten genannten Headlines wird ein produktspezifischer Zusatznutzen propagiert. Erläutere, worin dieser Zusatznutzen besteht. Worin besteht die Funktion bzw. die Werbebotschaft der Headline, die keinen solchen Zusatznutzen beschreibt? Anzeige für den Renault Kangoo, der über Schiebetüren hinten verfügt:»die Tür muss man schieben. Das Auto fährt selbst.«anzeige für Herrenslips von Moonday, schwarz-weiß gedruckt, Bild oben: Kopf und Oberkörper eines Mannes, sehr dunkel gehalten; Bild unten: Abbildung des grau-weißen Slips vor weißem Hintergrund:»die nacht erfindet sich jeden abend neu. und der tag jeden morgen.«anzeige für die Investment-Vorsorge von Switch/Adig:»Alter du hast mehr verdient.«anzeige für ein Handy von Alcatel:»Haben Sie schpn mal verszucht, auf einr zu kleinen Tasztatur eine Telrfonnummer einzutippen?«(vgl. Modul: Testen Ergebnissicherung, Arbeit am Fachwortschatz verbindlich machen Ziel: Die Schülerinnen und Schüler verwenden die erlernten Fachbegriffe eigenständig und in einem neuen Kontext Material: Aufgabe: Entwirf unter Verwendung der dir bekannten Fachbegriffe aus dem Bereich der Werbung ein Konzept für eine Produktwerbung, das du der Schülervertretung vorstellen kannst. Du kannst unter folgenden Produkten wählen: eure Schülerzeitung euer Schulessen einen Fachunterricht deiner Wahl den Tag der offenen Tür eurer Schule eine Arbeitsgemeinschaft deiner Schule 83
84
85 5 Wortschatzarbeit und Aufgabenstellungen Die erfolgreiche Arbeit am Wortschatz hängt wesentlich auch von der Art der Aufgabenstellung ab, denn diese initiiert die Arbeit mit dem Wort bzw. den bildungssprachlich relevanten Wendungen. Lernen ist stets auch mündliches oder schriftliches Sprachhandeln. Daraus ergeben sich verschiedene Ansprüche an die Schülerinnen und Schüler. Sie müssen nicht nur über den Allgemein- und Fachwortschatz, der zur Lösung der Aufgabe notwendig ist, verfügen, sondern auch über den bildungssprachlichen Wortschatz, der in der Aufgabenstellung verwendet wird. Versteht eine Schülerin/ein Schüler z. B. einen Operator nicht, kann die Lösung kaum gelingen. Bei der Aufgabenformulierung sollte neben der Eindeutigkeit der Anweisung auch der Aspekt der Überschaubarkeit berücksichtigt werden. Übermäßig komplexe Arbeitsanweisungen verbergen Forderungen eher als sie zu benennen. So ist es besser, für jede Anweisung einen Satz zu reservieren oder nicht mehr als zwei Teilaspekte in einem Satz zu verbinden, um die Aufgabenrekonstruktion durch die Schülerin/den Schüler zu stützen. Aufgabenstellungen in der Wortschatzarbeit können bezüglich der kognitiven Prozesse im Bereich der Reproduktion und des nahen Transfers (z. B. das Wiederholen und Wiedererkennen von Fachbegriffen) oder des weiten Transfers und der Problemlösung (z. B. Verwendung von Fachvokabular zur Verschriftlichung von Arbeitsergebnissen bei einer Textuntersuchung) angesiedelt sein. Die in den Arbeitsanweisungen verwendeten Operatoren bzw. Fragen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie lenken und unterstützen den Denk- und Lernprozess in unterschiedlicher Weise. So sind z. B. W-Fragen (Wer, Wie, Was) ebenso wie die Operatoren Liste auf, Benenne, Füge zusammen auf die Wiedergabe von Erlerntem ausgerichtet. Komplexere Leistungen verlangen andere Operatoren, z. B. Vergleiche, Interpretiere. Operatoren repräsentieren dabei bezüglich der geforderten Wissensart beispielsweise Prozeduren (Nenne) oder Konzepte (Analysiere den Text Textanalyse). Die Eindeutigkeit der Anweisung ist für die Entwicklung eines erfolgreichen Lösungskonzeptes von entscheidender Bedeutung. Eindeutigkeit entsteht für die Schülerin/den Schüler aber nur, wenn die geforderte Umsetzung im Vorfeld vermittelt/ verabredet wurde, z. B. welche Lösungsschritte und Lösungsansprüche eine Aufgabe mit dem Operator Interpretiere enthält. Auch das ist Wortschatzarbeit. Das Klären des Aufgabenverständnisses gehört somit zu einem der wichtigsten Faktoren für die Entlastung von Lernsituationen. Das Verstehen des fachsprachlichen Wortschatzes in den Arbeitsanweisungen unterstützt die erfolgreiche Entwicklung von Lösungskonzepten. 85
86 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Arbeit am Wortschatz gelingt besonders gut, wenn die Schülerin/der Schüler mehrkanalig angesprochen wird, d. h. wenn ein Arbeitsblatt z. B. auch grafische Elemente enthält, wenn verschiedene Sinne angesprochen werden (Hören, Sehen, Fühlen). Aktive, variantenreiche und erfolgreiche Wortschatzarbeit ist nicht nur ein Beitrag zur intellektuellen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler, sondern auch ein Beitrag zur Entlastung von Unterricht, indem der Störfaktor Nichtverstehen minimiert wird. Operatoren Operatoren präzisieren das Ziel von Arbeitsaufträgen, sorgen dabei für Orientierung und erleichtern die Bearbeitung von Aufgaben. Manche Lehrwerke enthalten daher Listen von Operatoren und erklären in einer für Schülerinnen und Schüler verständlichen Alltagssprache, welche geforderte Handlung mit dem jeweiligen Operator verbunden ist. Auch die Konferenz der Kultusminister (KMK) hat für einige Fächer Operatoren insbesondere für die Verwendung in der Sekundarstufe II bzw. bei der Erstellung von Klausuraufgaben zusammengestellt. Diese Listen bleiben jedoch stets fachspezifisch und sind daher als Orientierung für Schülerinnen und Schüler gerade der Sekundarstufe I nur bedingt geeignet. So gibt es z. B. für den Operator Analysieren in unterschiedlichen Fächern verschiedene Definitionen. Für Schülerinnen und Schüler ist dies sehr irritierend, und das erst recht, wenn verschiedene Lehrkräfte eines Faches überdies unterschiedliche Aspekte der geforderten Tätigkeit für wichtig halten. Es wäre daher gut, wenn in einem Kollegium eine Einigung darüber hergestellt würde, welche Operatoren fachübergreifend verwendet werden können. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich nämlich, dass viele Operatoren einen gemeinsamen Bedeutungskern haben. Die vorliegende Liste von Operatoren aus den Bereichen Natur- und Gesellschaftswissenschaften sowie Deutsch, Englisch und Mathematik stellt den exemplarischen Versuch dar,» aus den in den einzelnen Fächern genutzten Operatoren diejenigen herauszufiltern, die in allen Fächern verwendet werden. Es wurde also eine Schnittmenge gebildet;» aus den in den Fächern genannten Definitionen den ihnen allen gemeinsamen Kern herauszufiltern;» die so gefundenen Operatoren in einer für Schülerinnen und Schüler verständlichen Sprache zu formulieren. Der Gewinn liegt in der Möglichkeit einer breiten Anwendung dieser Operatoren in vielen Fächern. 86
87 Wortschatzarbeit und Aufgabenstellungen Operator nennen, angeben beschreiben vergleichen erklären erläutern begründen analysieren, untersuchen diskutieren, erörtern beurteilen Handlung Informationen aufzählen, zusammentragen, wiedergeben Sachverhalte, Objekte oder Verfahren mit eigenen Worten darstellen Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln und darstellen Sachverhalte verständlich und nachvollziehbar machen und in Zusammenhängen darstellen Einen Sachverhalt darstellen und unter Verwendung zusätzlicher Informationen veranschaulichen Sachverhalte, Entscheidungen bzw. Thesen durch nachvollziehbare Argumente stützen und sachlich (beispielhaft) belegen Unter einer Fragestellung wesentliche Bestandteile, Ursachen oder Eigenschaften herausarbeiten bzw. nachweisen Sich argumentativ mit verschiedenen Positionen auseinandersetzen und ggf. zu einer begründeten Schlussfolgerung gelangen Zu Sachverhalten eine selbstständige Einschätzung formulieren und begründen 87
88
89 6 Anhang Die schnelle Wörterhilfe. Kurze Übungen für den Schulalltag 5-Finger-Übung Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, je fünf Begriffe zu einem Themengebiet oder aus einem Wortfeld etc. zu nennen. Die Begriffe werden mithilfe der Finger heruntergezählt. Hinweis: Diese Übung kann auch zum Brainstorming verwendet werden, die Wörter können dann z. B. auf einer Folie oder im Tafelbild festgehalten werden. Schwarz-Weiß Die Gruppe wird in zwei gleich große Teilgruppen eingeteilt. Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, Wörter, zu denen es Antonyme gibt, zu notieren. Wettstreit: Es wird jeweils ein Wort genannt und die andere Gruppe soll das Antonym möglichst schnell nennen. Für jedes gefundene Wort gibt es einen Punkt. Es wird eine maximale Bedenkzeit vereinbart (z. B. 5 Sekunden). oder Die Notiz wird auf Kartenstreifen vorgenommen. Dann werden die Streifen getauscht und auf die Rückseite schreiben die Schülerinnen und Schüler das Antonym. Es kann auch ein zweiter Streifen beschriftet werden, die Streifen werden dann ausgestellt. Gemeinsam kann noch überprüft werden, ob die Wortpaare stimmen. Ich-bin Es werden Begriffe zu einem Themenbereich entweder auf Karten vorbereitet (z. B. Begriffe zu sprachlichen Mitteln) oder a. in kleinen Gruppen in der Anzahl der Schülerinnen und Schüler b. in großen Gruppen für die Arbeit am Vierertisch. Die Schülerinnen und Schüler erklären den Begriff in einer kurzen Einzelarbeit (Zeitkontrolle!) auf der Rückseite der Karte in Sätzen oder Stichwörtern in Fortsetzung der Formulierung: Ich bin... (z. B. Ich bin die Metapher. Ich bin ein sprachliches Bild und vereine in mir zwei Vorstellungen zu einem neuen Bild...). 89
90 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Dann wird in der Vierergruppe oder der Gesamtgruppe vorgetragen. Die Mitschüler überprüfen, ob die Erklärung stimmig ist. Hinweis: In großen Gruppen ist die Überprüfung in Paaren eine zeitsparende Variante. Es sollte ein Lösungsblatt vorhanden sein, um die Korrektheit der Lösung abzusichern. Dieses hängt entweder aus oder wird zum Abschluss in Kopie auf den Vierertisch gelegt. Achrostikon Ein Thema wird als Ausgangswort gegeben, die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, passende Wörter aus dem Themenbereich mit entsprechenden Anfangsbuchstaben zu finden, z. B. B A L L A D E änkelsänger tmosphäre yrik Kartenschatz Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, möglichst viele Wörter/Begriffe zu einem Thema, Wortfeld etc. einzeln auf Karten zu notieren. Die Karten werden gesammelt (z. B. an der Tafel) und können für weitere Übungen (z. B. Sortierübung) verwendet werden. Minitext Die Schülerinnen und Schüler ergänzen einen Mini-Lückentext, z. B. mit Begriffen, die in der vorherigen Stunde besprochen wurden. Diese Übung ist besonders gut für das Erlernen von Definitionen geeignet, wenn man die vorher eingeführten Definitionstexte immer wieder (z. B. in der Eröffnungsphase) verwendet. Auf diese Weise prägen sich auch verknüpfende Formulierungen gut ein. Fortsetzen Auf einem Arbeitsblatt werden Wortgruppen, Sätze oder Texte (z. B. Definitionstexte) unvollständig gegeben. Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, die Formulierungen sinnvoll zu ergänzen. 90
91 Anhang Beschriften Bildliche Darstellungen (z. B. das Bild einer Bühne) werden den Schülerinnen und Schülern mit der Aufforderung ausgehändigt, diese zu beschriften. Als Unterstützung können Beschriftungspfeile oder Beschriftungsfelder die zu benennenden Aspekte markieren. Zur Differenzierung bieten sich Wortlisten an. Wörterkasten Wörter und Begriffe aus einem Themenfeld werden in einem Wörterkasten versteckt. Die Schülerinnen und Schüler sollen die entsprechenden Wörter (Anzahl angeben!) herausfinden und oder oder oder oder a. markieren b. markieren und herausschreiben c. markieren, herausschreiben und sortieren d. markieren, herausschreiben und in einen Text/eine Liste einfügen e. markieren, herausschreiben und damit selbstständig Sätze/Texte bilden. 91
92 Sprachsensibler Fachunterricht Deutsch Beispiel Wörterkasten: sprachliche Mittel Lösung (Zum Herstellen der Schülerfassung Tabelle markieren und bei Rahmen und Schatterung den Füllbereich auf kein Füllbereich setzen) S D F H B C U I K R E I N K U M E T A P H E R W E S E N M U S E U P A R T N E Y R I S U S A N A P H E R X M K E A A F K L R E R E R E B E K I K L I M A X S D F G O S E H S D F G P G T J G R L V H C E R K R H C I E L G R E V E D D F D R A N A P H E R R D C F G C A Ü B E R A L L A D V G E J S I E S O S E H U C W I E D E R H O L U N G S Was ist korrekt? Den Schülerinnen und Schülern werden je zwei Kurztexte (z. B. zu Definitionen) gegeben. Sie müssen entscheiden, welcher Text korrekt ist. Sie vergleichen ihre Ergebnisse und begründen ihre Wahl. Diese Übung lässt sich auf die Verwendung von Wörtern und Strukturen anwenden (z. B. korrekte Satzstruktur). Wichtig ist, dass die Zahl der abgefragten Aspekte klein gehalten wird, um den Zeiteinsatz überschaubar zu halten und die Aufmerksamkeit angemessen lenken zu können. 92
93 Literatur Ausubel, David P. (1960): The use of advance organizers in the learning and retention of meaningful verbal material. In: Journal of Educational Psychology, 51 (1960) 5, S Diekhans, Johannes/Fuchs, Michael (2004ff.) (Hrsg.): P.A.U.L.D. Persönliches Arbeits- und Lesebuch Deutsch. Paderborn Feilke, Helmuth (2009): Wörter und Wendungen: kennen, lernen, können. In: Praxis Deutsch, 36 (2009) 218, S Feilke, Helmuth (2012): Bildungssprachliche Kompetenzen fördern und entwickeln. In: Praxis Deutsch, 39 (2012) 233, S Kilian, Jörg (2010): Zur Förderung lexikalisch-semantischen Wissens und Könnens am Beispiel des Fachwortschatzes der Unterrichtsfächer. In: Der Deutschunterricht, 62 (2010) 6, S Kühn, Peter (2007): Rezeptive und produktive Wortschatzkompetenzen. In: Willenberg, Heiner (Hrsg.): Kompetenzhandbuch für den Deutschunterricht. Auf der empirischen Basis des DESI-Projekts. Baltmannsweiler: Schneider, S Mattes, Wolfgang (2002): Methoden für den Unterricht. 75 kompakte Übersichten für Lehrende und Lernende. Paderborn: Schöningh Nodari, Claudio/Steinmann Cornelia (2008): Fachdingsda Fächerorientierter Grundwortschatz für das Schuljahr. Lehrmittelverlag des Kantons Aargau Selimi, Naxhi (2010): Wortschatzarbeit konkret. Balmannsweiler/Hohengehren: Schneider 93
94
95 Wortschatzarbeit im Englischunterricht Katrin Reinisch
96
97 1 Bedeutung der Wortschatzarbeit im Fach Englisch In der Didaktik der Fremdsprachen nimmt die Wortschatzarbeit einen hohen Stellenwert ein, da die semantische Komponente von Sprache die wichtigste für die Verwirklichung aller Äußerungsabsichten ist. 1 Aus diesem Grund bedarf es einer ständigen Motivation zur Wortschatzarbeit. Es ist nicht immer leicht, im Unterricht genügend Zeit für das Üben und Vertiefen von Wortschatz zu finden, zumal das Vokabellernen von den Lehrkräften und den Lernenden oftmals als trockene Paukerei empfunden wird. Schülerinnen und Schüler wissen oft nicht, wie sie sich den Wortschatz eigenständig aneignen können, sodass er möglichst langfristig und anwendungsbereit zur Verfügung steht. So wird das Vokabellernen häufig zur ungeliebten Pflicht, der mehr oder weniger gewissenhaft nachgekommen wird. Die Einführung von Vokabeln und die Vermittlung von Lernstrategien sollten daher zum unverzichtbaren Bestandteil des Unterrichts werden. Nur so wird es Schülerinnen und Schülern zur Gewohnheit, sich Vokabeln (auch zu Hause) so anzueignen, dass sie sie wirklich verwenden können. In der Praxis ist es jedoch nicht immer leicht, für die Wortschatzarbeit innerhalb des kompetenzorientierten Fremdsprachenunterrichts den geeigneten Platz zu finden. So möchten Lehrkräfte auf jeden Fall langweilige Drillübungen vermeiden und viel Raum für Kommunikation und Interaktion geben. Wie passt da das Vokabellernen hinein? Grundsätzliches über Wortschatz in den Fremdsprachen Man unterscheidet zwischen passivem (auditiv-passivem und visuell-passivem) Wortschatz und aktivem (mündlich-aktivem und schriftlich-aktivem) Wortschatz. In der Fremdsprache ist der Unterschied zwischen den beiden Komponenten größer als in der Erstsprache, denn ein deutscher Muttersprachler hat im Durchschnitt etwa Wörter in seinem aktiven Wortschatzspeicher, wobei der rezeptive Wortschatz sogar bis zu Wörter umfassen kann. In der Fremdsprache geht man in der Grundstufe von etwa Wörtern, in der Mittelstufe von etwa 1 Quetz 1995, S
98 Sprachsensibler Fachunterricht Englisch bis Wörtern und in der Oberstufe von ungefähr Wörtern im aktiven Wortschatz aus. 2 Der passive Wortschatz umfasst die Gesamtheit aller Wörter, die Schülerinnen und Schüler verstehen, wenn sie sie hören oder lesen. Hingegen umfasst der aktive Wortschatz alle Wörter, die Schülerinnen und Schüler beim Schreiben oder Sprechen benutzen. Die Aneignung und auch der Umfang sind unterschiedlich. Bei Auswahl und Menge von zu erwerbendem Wortschatz gilt es zu entscheiden, welche Wörter möglichst aktiv zur Verfügung stehen sollten und bei welchen eine Übernahme in den passiven Wortschatz genügt. Insbesondere bei langen Listen zu Lehrbuchlektionen ist eine sinnvolle Auswahl zu treffen. Hierfür werden am Ende dieses Kapitels verschiedene Überprüfungsformen vorgestellt.... und für die Vermittlung von Wortschatz im Fremdsprachenunterricht Der Erfolg der Wortschatzarbeit und damit auch des Fremdsprachenlernens hängen wesentlich davon ab, ob der Unterricht durchgängig in der Fremdsprache durchgeführt wird, ob methodische Vielfalt in den unterschiedlichen Phasen des Wortschatzerwerbs angewandt wird und in welcher affektive/emotionale und kognitive Tiefe. 3 Ein abwechslungsreicher, methodisch vielfältiger und emotional ansprechender Unterricht trägt zu einer besseren Fremdsprachenaneignung bei. Studien 4 haben gezeigt, dass ein bewegungsorientierter Unterricht auf die Einstellung und Lern-/Behaltensleistung der Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Schulstufen und Schularten einen fördernden Einfluss hat. Es wurde nachgewiesen, dass die Verknüpfung von Sprache mit Bewegung hohe positive Effekte auf die Behaltensleistung, die Aussprache sowie die Leseleistung der Schüler hat. Des Weiteren ist ein Wechsel verschiedener Lernstrategien und Verfahren wie z. B. zwischen Einzel- und Partnerarbeit oder zwischen Einzel- und Gruppenarbeit oder Frontal- und Partnerarbeit anzustreben, um den Schülerinnen und Schülern vielfältige Angebote des Lernens zu machen. Neuere Forschungen haben ergeben, dass mehr als 70 % unseres sprachlichen Vokabulars in so genannten Chunks gespeichert ist. 5 Daraus ergibt sich auch, dass ein Wort nie als einzelne Vokabel vermittelt, sondern im Kontext, situativ eingebettet und in Wortnetzen abgespeichert, in Gruppen kategorisiert und mit bereits vorhandenen Informationen verbunden werden muss, um die Wörter möglichst vielfältig und sicher im Gehirn zu vernetzen. Die Aneignung einer Fremdsprache ist auch der bewusste Aufbau von Wissen. Kennt man z. B. die wichtigsten Wortbildungsregeln, erhöht sich der potenzielle Wortschatz. 6 Kennt man Regeln der Aussprache, Betonung und Lautschrift, erhöht sich das Bewusstsein für Sprache Tettenhammer ( ) 3 Neudecker ( ) 4 Schiffer 2012, S Huber 2001, S Haß 2006, S. 118
99 Bedeutung der Wortschatzarbeit im Fach Englisch Grundsätzlich stellt fremdsprachig durchgeführter Unterricht eine entscheidende Voraussetzung für erfolgreiches Lernen von Wortschatz dar, denn er liefert den Lernenden ein sprachliches Vorbild und vielfältigen Input an Strukturen und Vokabular ( Sprachbad ). Darüber hinaus bietet er Schülerinnen und Schülern mit nichtdeutschen Herkunftssprachen bessere Möglichkeiten zum Erlernen der Fremdsprache. In einem fremdsprachig erteilten Unterricht wird ihnen die Zusatzanforderung erspart, über den Erwerb der neuen Fremdsprache hinaus auch noch ständig zwischen dieser und ihrer ersten Fremdsprache Deutsch vermitteln zu müssen. Durchgängig in der Fremdsprache erteilter Unterricht hat außerdem den Vorteil, dass er im Sinne einer Förderung der Mehrsprachigkeit den Blick auf andere Sprachen fördert. Während zweisprachiger Unterricht auf den Vergleich mit der deutschen Sprache fixiert ist, erleichtert der fremdsprachige Unterricht den Bezug auf alle Sprachen, die den Schülerinnen und Schülern mehr oder weniger ansatzweise bekannt sind. So bietet es sich an, bei der Einführung neuer Wörter Bezüge zu ähnlichen Vokabeln aus anderen Sprachen zunehmend selbstständig herzustellen. Der Erwerb von Lernstrategien beinhaltet somit nicht nur Techniken des Verstehens und Behaltens, sondern auch die ständige Vernetzung mit aktiv oder passiv vorhandenem Sprachmaterial aus anderen Sprachen. Dies ist unverzichtbar, um die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler zum Erwerb mehrerer Fremdsprachen (wie vom Europarat 2008 gefordert) zu entwickeln. Außer dem Verweis auf Ähnlichkeiten zwischen z. B. romanischen Sprachen mit dem Englischen, dem Deutschen und anderen indogermanischen Sprachen sollten hier die Sprachen der Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutschen Herkunftssprachen einen festen und geachteten Platz erhalten. Fragen wie What is this in your language? unterstützen die Vernetzungsfähigkeit und damit die Behaltensleistung der auf diese Weise aktivierten Lernenden, die Sprachbewusstheit bei allen Beteiligten (einschließlich der Lehrkräfte), und sie vermitteln und entwickeln Interesse und Wertschätzung für die in der Lerngruppe vertretenen Kulturkreise. Als Teil der angestrebten interkulturellen Kompetenz wird so die im Rahmenlehrplan und in den KMK-Standards für die Fremdsprachen geforderte interkulturelle fremdsprachige Handlungsfähigkeit entscheidend unterstützt. 99
100
101 2 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von Wortschatz im Fach Englisch Die Phasen der Einführung, des Übens, der Festigung, der Anwendung und der endgültigen Ergebnissicherung durch Testen sind miteinander verbunden. Ohne Anwendung erfolgt kein automatisches Behalten des Wortes. Ohne das Lernen in geordneten Gruppen oder Feldern erfolgt kein Abspeichern. Ohne ständiges Wiederholen und Einbetten in neue Kontexte erfolgt kein Manifestieren. Es besteht ein dialektisches Verhältnis zwischen dem Erinnern und Vergessen. Da das Vergessen ein aktiver Prozess ist, ist ein ständiges nachhaltiges Üben und Anwenden notwendig, um Informationen auch vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zu transferieren und dort zu bewahren. 7 Je nach Schulart, Klassenstufe, Klassenraum, Klassenstärke, unterschiedlichen Lerntypen (auditiv, visuell, kommunikative, motorisch) kann man unter vielfältigen Möglichkeiten wählen. Es gibt keine Patentlösungen, aber viele sinnvolle Hilfen, die man entsprechend dem Leistungsgefüge einsetzen kann und die für die Wortschatzarbeit einen festen Platz im Fremdsprachenunterricht schaffen sollten. Wenn man bestimmte Einprägetechniken (siehe 2.2.3), Übungen oder kleine Spiele zur Routine macht, spart das Zeit, erleichtert die Arbeit und wirkt motivierend. Solche routinemäßigen Phasen könnten zu Beginn oder Ende einer Stunde eingesetzt werden und den Schülerinnen und Schülern eine Stütze für die selbstständige Arbeit sein.» Word of the Day: Zur Erweiterung des Wortschatzes kann man sich die Methode des Einführens des word of the day zueigen machen. In der Klasse kann man eine Reihenfolge bestimmen, und jeder Schüler und jede Schülerin darf einmal ein spezielles Wort, welches er/sie aus Liedern, Texten oder Büchern etc. kennt oder welches thematisch 7 Stangls ( ) 101
102 Sprachsensibler Fachunterricht Englisch zur Lektion passt, zu Beginn der Stunde an die Tafel schreiben. Dieses Wort wird dann von allen in die eigene oder class wordlist übernommen und an geeigneter Stelle mit den anderen Wörtern wiederholt. Es ist auch möglich, diese Methode zu nutzen, um zur individuellen Erweiterung des Wortschatzes anzuregen und, wie in Online-Portalen dargeboten, sich selbständig wordlists zu erstellen, was allerdings nach geraumer Zeit im Unterricht Verwendung finden und überprüft werden muss.» Arbeit mit dem Lernkasten: festgelegter Wortschatz & individueller Wortschatz. Das individuelle Lernen und das Lernen mit dem Partner oder der Partnerin sind durch Abfragen, Korrigieren und Austauschen möglich.» Guess the word. Gegenseitiges Abfragen mithilfe vorgefertigter laminierter Karten, die wieder verwendbar sind (siehe Kap. 3).» Wortschatzspiele: wie Stadt, Land, Fluss oder Activity Draw, Mime, Explain the word ; machen den Schülerinnen und Schülern nicht nur Spaß, sondern regen auch zur Erweiterung des Wortschatzes an.» Auswendiglernen Das Auswendiglernen hilft den Lernenden, auf bestimmte Muster zurückzugreifen. Lassen Sie ihre Schülerinnen und Schüler Lieder, Raps, Gedichte oder Reime auswendig lernen, die sie zu Beginn oder in entsprechenden Phasen des Unterrichts verwenden. Oftmals erinnern sich die Schülerinnen und Schüler noch Jahre später daran, können das Gelernte fehlerlos wiedergeben oder beziehen sich auf Strukturen aus dem Gelernten. Das schult sowohl die Gedächtnisleistung als auch die Technik des Lernens. 2.1 Einführung von Wortschatz/neue Lexik Die Lehrerinnen und Lehrer wählen anhand der Lerngruppe, des Lernniveaus und des Leistungsfortschritts der einzelnen Lernenden den zu erlernenden Wortschatz entsprechend dem Thema. Ein reines Auswendiglernen der in den Büchern nach Units abgedruckten, thematisch und semantisch meist völlig ungeordneten Wörter ist nicht empfehlenswert. Die kontextbezogene Einführung von Wörtern ist Basis für den Wortschatzerwerb. In einer Stunde sollten nur 12 bis maximal 20 Wörter eingeführt werden. Je nach Leistungsvermögen der einzelnen Schülerinnen und Schüler kann die Zahl der Wörter erheblich darunter liegen. In den Klassen 5 und 6 müssen neue Wörter noch semantisiert werden; ab Klasse 7 hingegen beginnt der Übergang von der Semantisierung zur Präsentation des neuen Wortschatzes und ab Klasse 8 wird der Wortschatz entweder präsentiert oder von den Schülerinnen und Schülern bei der Bearbeitung von Texten nachgefragt oder selbstständig mithilfe des Wörterbuchs herausgefunden. 8 Hierbei gibt es verschiedene Semantisierungstechniken 9 : a. Mit Hilfe realer Gegenstände, Bildern, Fotos: Show and tell. b. Vormachen c. Ganzheitliche Darstellung (Mimik, Gestik, Körperhaltung) d. Im Kontext durch das Weltwissen der Schüler Neudecker ( ) 9 Haß 2006, S
103 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von Wortschatz im Fach Englisch e. Durch Definition oder Erläuterungen f. Aus dem Tool durch Unter- und Oberbegriffe g. Durch Paraphrasen, Analogien, Synonyme, Antonyme, Ableitungen h. Ähnlichkeiten mit dem Deutschen (Phonetik, Orthografie) i. Internationalismen j. Übersetzen Arbeit mit Wörterbüchern Ab Klasse 5 ist es möglich, ab Klasse 7 aber unbedingt empfehlenswert, den Umgang mit dem zweisprachigen Wörterbuch und spätestens ab Klasse 10 mit dem einsprachigen Wörterbuch zu trainieren. Das Wörterbuch spielt nicht nur bei der Wortschatzerfassung sondern auch bei der Wortschatzarbeit eine wichtige Rolle. Die Schülerinnen und Schüler lernen, die jeweils richtige Bedeutung des Wortes, Redewendungen und die grammatikalische Verwendung herauszufinden, und werden angehalten, Wendungen in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Perspektivisch werden die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt, selbstständig zu arbeiten und auch die Angebote des einsprachigen Wörterbuchs für sich zu nutzen. Eine sehr hilfreiche Quelle für die Lehrerinnen und Lehrer sind die Angebote einzelner Verlage, darunter kostenlose Arbeitsblätter für die Arbeit mit dem Wörterbuch, die aus dem Internet heruntergeladen oder von den Verlagen als Zusatzmaterial angefordert werden können. Auf systematische und spielerische Weise wird den Schülerinnen und Schülern der Zugang zum Wörterbuch erleichtert, auch als Wörterbuchrallye. Sie können nach Niveaustufen und/oder Themen verschiedene Übungen zu Aussprache, Wortfamilien, Wortfeldern, Synonymen und Antonymen, Redewendungen u. ä. auswählen. Individuelle und differenzierte Arbeit ist hier möglich, da die Übungen als elementary und advanced gekennzeichnet sind. 103
104 Sprachsensibler Fachunterricht Englisch 2.2 Phase der Übung und Festigung; Behaltenstechniken Die Übungsphase sollte phonetische, grammatikalische, morphologische Aspekte und die Schreibung des Wortschatzes beinhalten Phonetik/Betonung/Aussprache Um die Aussprache der Wörter zu trainieren, sind Drill, Chor- und Individualsprechen von Vorteil. Man kann Wörter auch theatralisch einüben, indem man sie schreien, jammern, flüstern oder in die Luft oder auf den Rücken schreiben lässt. Des Weiteren sollte auf die Lautschrift hinsichtlich Betonung und Aussprache eingegangen und Übungen zum Erkennen des Wortes anhand der Lautschrift angeboten werden. Dies hilft den Schülern auch im weiteren Fremdsprachenlernen beim eigenständigen Benutzen von Wörtern aus Wörterbüchern, zum Beispiel für Vorträge.» Find the correct word. [pə sweɪd] (persuade)» Match the transcription with the word. persuade [pə sweɪd] convince participate check [kən vɪns] [pɑ: tɪsɪ,peɪt] [tʃɛk]» Transcription Guess. Choose three words from our unit and write down the transcrip guess. Change partners as tion. (Use your book / vocabulary list). Make your classmates often as possible.» Sound and spelling. You say the same pair of letters differently in one of the words. Underline that word. [e]: leap seat scream dead» Word pairs that sound the same. Use the word pairs to finish the sentences. 1. Did it on the first day of Queen Victoria s? 2. Everyone about Watt s invention. 3. One, a Norman lost his helmet in the dark. 4. After just one everyone knew Elizabeth was not a queen. Choose from: knew/new; week/weak; rain/reign; night/knight» Elektronische Wörterbücher, Online-Wörterbücher sind vor allem für die häusliche Arbeit empfehlenswert, da man sich die Aussprache des Wortes anhören kann. Sie eignen sich somit besonders gut für das selbstständige Arbeiten. 104
105 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von Wortschatz im Fach Englisch Schreibung Jedes Wort des aktiven Wortschatzes muss irgendwann in irgendeiner Weise von der Schülerin oder dem Schüler geschrieben werden, da dies nicht nur für die Schreibkompetenz notwendig ist, sondern auch die Behaltensleistung fördert. Dies kann während der Einführungs- oder Erarbeitungsphase, im Zusammenhang mit semantischen Wortfeldern oder während der Übungsphasen erfolgen. Die Arbeit mit dem konservativen Vokabelheft, einer Lernkartei, dem Lernkasten oder Wordmaster ist abhängig von vielen Komponenten und obliegt einer situativen Entscheidung. Zurzeit ist die Arbeit mit dem Lernkasten auf dem Vormarsch, da er eine systematische und wiederholende Form des Lernens ermöglicht, allerdings ständig kontrolliert und fest in den Unterricht integriert werden muss Erste Vernetzung Mnemotechniken Mnemotechnik steht für jede Form der Gedächtniskunst. Transferiert auf den Fremdsprachenunterricht hieße das, um Wortschatz fest im Gedächtnis zu verankern und abrufbar zu machen, bedarf es verschiedener Verfahren, die manchmal auch als Technik der Eselsbrücken oder Assoziationen definiert werden. 10 Das Angebot an Übungsformen, Wortschatzspielen und möglichen Workbook-Übungen ist riesig. Als Lehrerin und Lehrer steht man vor der Qual der Wahl. Aber nicht alle Übungen sind immer hilfreich oder führen zum Erfolg. Manche sind auch recht zeitintensiv. Allerdings erfolgt das Behalten des Wortschatzes nicht ohne Anwendung. Im Folgenden werden einige Techniken aufgelistet, die die Arbeit am Wortschatz unterstützen. 11 a. kreative Wortbildgestaltung picture words: headmaster; hot dog b. Reime, Sprüche, Lernen anhand eines Raps oder Songs c. Alliteration: Ten tough teachers teach technology. d. Visualisierung e. Übersetzungskuriosa (operating theatre operierendes Theater OP-Saal) f. false friends (gift Gift Geschenk) g. skurrile Vorstellungsbilder (brainwashing) h. Lernen durch Bewegung 10 Voigt ( ), auch 11 Haß 2006, S
106 Sprachsensibler Fachunterricht Englisch 2.3 Übergang ins Mentale Lexikon : Nutzen der Wörter für die Kommunikation und den Kompetenzerwerb Zur Entwicklung von Kompetenzen wird Wissen gezielt aufgebaut und vernetzt und geht durch vielfältiges Anwenden in kompetentes, durch Interesse und Motivation geleitetes Handeln über. Deshalb werden im Verlauf der Schulzeit zunehmend fachliche Grenzen überschritten und vernetztes Denken und Handeln gefördert. 12 Um die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, den Wortschatz selbständig zu gebrauchen, muss er in die Ganzheit des Sprachschatzes übergehen. Diese Integration kann durch spielerische Wiederholung in allen Phasen des Unterrichts zu Stundenbeginn oder Stundenende oder auch am Ende einer Unit erfolgen. Einige Beispiele verdeutlichen die spielerische Wortschatzarbeit. 13 a. Buchstabensalat, wordsnake, hangman, Scrabble, Taboo, Puzzle Maker b. Wortschatzumwälzung: Domino, Memory, Tast-und Suchspiele, Quick Bingo c. Einsatz von flash cards, lipreading; d. Pantomime, Draw and guess (Montagsmaler) e. Spiele mit dem Wörterbuch (siehe Kap. 3) Neben der spielerischen Wortschatzarbeit können kooperative Übungsmethoden diese Phase bereichern. Einige Beispiele sind hier aufgeführt.» Placemat activity: Wörter sammeln, sortieren und strukturieren» Cooperative Storytelling: Schüler erfinden zu vorgegebenen Vokabeln eine gemeinsame Geschichte» Communicative hand: Schüler malen den Umriss ihrer Hand und sammeln zu fünf Oberbegriffen (Fingern) passende Wörter» Give and Take: Im Austausch Vokabeln geben und erhalten» Vokabeln lernen und visualisieren im Lerntempoduett: unterricht/sol/03_grundlagen/lernformen/tempo/ Die folgenden Übungen sind eine Zusammenstellung aus dem Buch From Vocabulary Activities (2012) 14, die wissenschaftlich aufgearbeitet den Grundsätzen des modernen Fremdsprachenlernens entsprechen.» Words without a vowel Wörter, die wiederholt werden sollen, werden ohne Vokale an die Tafel geschrieben. Die Schüler schreiben sie in ihr Heft und zur Kontrolle setzt ein Schüler die richtigen Vokale ein. Man kann diese Worte auch im Satz verwenden. My / s_st_r / g s / sh_pp_ng / _v_ry / d_y. (My sister goes shopping every day.) RLP Englisch 2006, S Dreyer 2011, S Ur 2012
107 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von Wortschatz im Fach Englisch Eine bei den Schülern recht beliebte Übung ist die Abwandlung des Spiels: Stadt, Land, Fluss, welches in jeder Klassenstufe einsetzbar ist.» Words beginning with Beginner Find a word that begins with the given letter, for different kinds of categories. A thing A food An animal A name L lamp lemon lion Liza T N Intermediate Find a word that begins with the given letter, for different kinds of categories. Noun Verb Ajective Adverb L letter like long likely T N Find a word that begins with the given letter, for different kinds of categories. Sport & Games School & Study House & Home Travel & Movement L lacrosse literature lunch leap T N Das Gedächtnistraining ist in dieser Phase von enormer Bedeutung, um die Wörter später in der Kommunikation nutzen zu können. Im Folgenden werden einige Methoden beschrieben. Die Übung Koffer packen eignet sich für viele Themen und Klassenstufen. Die Lehrkraft schreibt den Beginn des Satzes an die Tafel, die Schülerinnen und Schüler fügen Wörter hinzu, wobei nur der erste Buchstabe der neu gefundenen Wörter angeschrieben wird. Am Ende müssen die Schülerinnen und Schüler im Chor oder auch in Einzel/Partnerarbeit versuchen, den gesamten Satz zu wiederholen.» In London we can visit many sights such as (names of sights or buildings, cathedrals, churches, monuments, parks )» Every day I (activities: get up, brush my teeth, have breakfast )» In school we do not only write, but (activities: learn words, sing songs, read )» When we go to a zoo, we can see animals such as 107
108 Sprachsensibler Fachunterricht Englisch Die Methode des Recall & Share richtet sich nach den Wörtern oder Wortgruppen, die wiederholt werden sollen. Schreiben Sie 10 bis 12 Wörter an die Tafel, die sich die Schülerinnen und Schüler einprägen sollen. Nach 30 Sekunden werden die Wörter versteckt oder abgewischt und die Schülerinnen und Schüler beauftragt, so viele Wörter wie möglich individuell aufzuschreiben. Danach treffen sich die Schülerinnen und Schüler in Zweier- oder Dreiergruppen, um die Schreibung zu überprüfen und gegebenenfalls das Repertoire zu erweitern. Am Ende präsentiert die Lehrkraft die Wörter zum Vergleich und gratuliert denjenigen, die alle Wörter erfolgreich rekapituliert haben. Die Methode Erase kann anhand eines bereits behandelten Textauszugs von ungefähr 50 Wörtern eingesetzt werden. Die Lehrkraft schreibt den Text an die Tafel oder das Whiteboard. Danach lässt man entweder die Schülerinnen und Schüler die Augen schließen und diese erraten dann, welches Wort weggewischt wurde, oder es werden phasenweise Wörter ausgestrichen und am Ende sollen die Schülerinnen und Schüler aus ihrem Gedächtnis den gesamten Text aufschreiben. Eine Mnemotechnik zum dauerhaften und nachhaltigen Lernen ist die Lernkartei. Eine Lernkartei mithilfe eines Lernkastens, der selbst gebastelt oder als Vorlage von vielen Verlagen oder Internetportalen teilweise kostenlos erworben werden kann, kann in jeder Schulform, in jeder Klasse und in jedem Fach angelegt werden. Das lernpsychologische Prinzip dahinter ist neben dem assoziativen Lernen vor allem das verteilte und regelmäßige Lernen und das Gedächtnisprinzip des Vergessens. Worauf sollte im Fach Englisch geachtet werden? Vorderseite deutsches Wort, Rückseite Übersetzung. Bei Vokabeln ist es ratsam, nicht nur die einzelne Vokabel aufzuschreiben, sondern einen zusammenhängenden Satz, aus dem der genaue Sinn des Wortes ersichtlich ist. Auch sind oft Zeichnungen, Skizzen oder Chiffren hilfreich, wenn man etwa Beziehungen oder Gegensätze verdeutlichen will. Bei einer besseren Beherrschung der Sprache sollte man sie unbedingt in einsprachiger Form führen, um das Denken innerhalb der Sprache zu schulen Stangl ( )
109 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von Wortschatz im Fach Englisch 2.4 Überprüfung des Wortschatzes (mündlich/schriftlich) Wie im Rahmenlehrplan angemerkt, bilden eine kontinuierliche Rückmeldung und Lernberatung die Grundlage für eine individuelle Lernentwicklung und stärken die Lernbereitschaft. 16 Deshalb bedarf ein nachhaltiges Wortschatzlernen einer Ergebnissicherung durch Testen einerseits, aber auch eines Feedbacks und einer Auswertung der Ergebnisse mit dem Angebot und praktischen Tipps zur Verbesserung andererseits. Man kann immer nur das testen, was man auch wirklich geübt hat. Mündliche Überprüfung a. Guess the word. b. How do I ask somebody? c. What can you say in that situation? d. Explain. What is? e. Wortfelder zu einem vorgegebenen Impuls: house and garden f. Wortverknüpfungen Wörter sollten immer in sinnvollen Sätzen benutzt werden. Schriftliche Überprüfung a. Lückendiktat b. Definition: Guess the word or explain the word. Beispiel: The text under a photo or cartoon is called.. (caption) What do we call the text under a photo or cartoon? c. Zuordnung von Begriff und Definition d. Abbildungen beschriften e. phonetische Umschrift f. Kreuzworträtsel oder Rätsel Hilfe für die Lehrkraft: g. Überprüfung von Wortfamilien: Beispiel: Complete the sentences with a noun from the same word family. He invited me to the party although I hadn t expected to get an. If he had decided not tell me I would have had to accept his. h. Überprüfung von Wörtern auf einer Textgrundlage Beispiel: 1. Put the German words into English. When I first saw Alex in school and 1 verliebte mich with him, he didn t even know who I was. When I saw him again I 2 fühlte mich really nervous and excited. 16 RLP Englisch 2006, S
110 Sprachsensibler Fachunterricht Englisch 2. Find the missing words and use them in the text. Differenzierungsmöglichkeiten: a. Vorgabe der englischen Wörter organized; homecoming; b. Vorgabe der deutschen Wörter prize; started c. ohne Wortvorgabe The year (1) well with a great (2) dance. It was (3) by teachers and pupils. The couple with the best costumes got a (4). i. Testen online ein Angebot des Klett-Verlages ist ein hervorragendes, zeitsparendes und effektives Testverfahren mit individueller Auswertung und weiteren Fördermaterialien für jeden Schüler. ( 110
111 3 Strategien für die Formulierung und Beispiele gelungener Aufgabenstellungen Übung zum Abfragen, Erklären und Erraten von neuen Wörtern Step 1: Pick three words you want to ask a partner. Write them into the spaces. Don t forget the solutions. Step 2: Walk around and ask your questions. Change partners as often as possible. a. What s in English/German? b. What does mean in English/German? c. What s English/German for? Solutions: a. b. c. Grieser-Kindel, Henseler, Möller 2009, S. 109 A vocab card Eine sehr sinnvolle Methode zur Verbesserung der Vokabelkenntnisse und des Lernens in Chunks stellt die Arbeit mit der Vokabelkarte dar, die vielfältig einsetzbar ist. Die Vorbereitung erfolgt entweder individuell und/oder in kleinen Teams mithilfe des Lehrwerks und/oder Wörterbuchs. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine vocab card und tragen das zu lernende Wort (welches sie selbst bestimmen), eine Definition in englischer Sprache, ein Wort der Wortfamilie, einen Satz (deutsch/englisch) sowie Synonyme oder Antonyme ein. In dieser Phase sollte die Lehrkraft helfend zur Seite stehen. Danach wechseln die Partnerinnen und Partner und fragen sich gegenseitig ab, indem sie das Wort für ihre Definition finden, den Satz übersetzen und ggf. Synonyme und Antonyme erraten lassen. Die Partnerin und der Partner schreiben das zu lernende Wort und ggf. weiter Wendungen auf. Durch ständiges Wechseln der Partner erreicht man eine sehr abwechslungsreiche Auffrischung und intensive Arbeit am Wortschatz. 111
112 Sprachsensibler Fachunterricht Englisch Step 1: Pick three words you want your partner to guess. Write the explanations of those words into the spaces. Don t forget the solutions. Step 2: Walk around and ask your questions. Change partners a soften as possible. a. b. c. Solutions: a. b. c. Grieser-Kindel, Henseler, Möller 2009, S. 109 a definition in your own words words from the same word family word or phrase to be learnt a sentence showing the meaning synonyms (=words that mean the same) or antonyms (= words that mean the opposite) Tandembögen zur Wortschatzarbeit Eine sehr effektive Methode zur thematischen und kontextuellen Einbindung von Wortschatz ist die Arbeit mit den Tandembögen. In Partnerarbeit werden Schülerinnen und Schüler befähigt, sich gegenseitig abzufragen, zuzuhören und zu korrigieren. Sie können dialogisch miteinander üben, übernehmen einmal die aktive Rolle des Übersetzers und ein anderes Mal die korrigierende oder überprüfende Rolle der Lehrerin bzw. des Lehrers. Dem Schülerpaar stehen zwei vorbereitete auf einander abgestimmte Bögen zur Verfügung, wobei der erste Teil in deutscher Sprache die Anweisung zur Übersetzung für den einen Schüler oder die eine Schülerin enthält und der zweite Teil dann die Antwort des Partners. Folgendes Beispiel verdeutlicht diese Methode. Partner A Frage deinen Partner, ob London eine Reise Wert ist. I have never been to London, but I have already heard lots of interesting things. Sage, dass dein Vater bereits London besucht hat. Which sights did he look at? Partner B Do you think London is worth a visit? Sage, dass du noch nie in London warst, aber schon viele interessante Dinge gehört hast. My father has already visited London. Frage, welche Sehenswürdigkeiten er sich dort angeschaut hat. 112
113 Strategien für die Formulierung und Beispiele gelungener Aufgabenstellungen Gelungenes Beispiel des Erarbeiten, Üben, Festigen und Anwenden von Wortschatz zum Thema: Warming up instructions, Klasse 7, und eine Idee zum Lernen im Entspannungszustand mit abwechslungsreichen Methoden. Die Schülerinnen und Schüler werden zu Beginn der Stunde gebeten aufzustehen, um einige Aufwärmübungen für Körper und Geist zur Sauerstoffaufnahme zu praktizieren. Die Lehrerin bzw. der Lehrer spielt eine CD mit Übungen und musikalischer Untermalung ab und unterstützt durch eigenes Mitmachen den Verstehens- und Mitmacheffekt. Das Vormachen der Lehrerin bzw. des Lehrers hat auch einen sehr anspornenden und unterhaltsamen Charakter. Danach werden die Instruktionen mit Unterstützung einer PPT und bildlicher Veranschaulichung zusammengefasst, besprochen, nachgesprochen und geschrieben. Eine Wiederholung der Körperteile in einem semantischen Wortfeld ist empfehlenswert. Der Beginn der folgenden Stunden erfolgt immer mit kleinen Übungen, entweder von der CD oder durch die Lehrerin bzw. dem Lehrer initiiert. In Übungsphasen ordnen die Schülerinnen und Schüler mithilfe eines Arbeitsblatts entsprechende Instruktionen den Bildern zu und entwickeln eigene Übungsteile und eine sportliche Übungsphase für den Sportunterricht. Des Weiteren kann man in dieser Phase auf Bewegungslieder aus der Grundschule zurückgreifen: Head & Shoulder; If you are happy oder The warm-up song video from Melody Treehouse ( com/watch?v=dcw5p_idrby). Eine Englischstunde wird dann zu einer bilingualen Sportstunde umfunktioniert, in der je nach Klassenstärke in Einzel- oder Partnerarbeit die Warming-up-Instruktionen, die vorher erarbeitet und auswendig gelernt wurden, vorgetragen und natürlich von den Mitschülerinnen und Mitschülern ausgeführt werden. In Absprache mit der Sportlehrerin bzw. dem Sportlehrer können auch mal ganz spontan im Sportunterricht ein oder zwei dieser Übungen in englischer Sprache genutzt werden. Die Warming-up-Aktivitäten können immer wieder eingesetzt werden. Die Themen Sports, Dealing with stress, Preparing for an exam, History bieten direkte Möglichkeiten, um zu einem späteren Zeitpunkt auf diese Art der Aktivität zurückgreifen, die den Schülerinnen und Schülern besonderen Spaß gemacht hat, da sie aktiv ihren Wortschatz anwenden und auch Spaß am Lernen entwickeln. Zur Auflockerung oder Einführung anderer Vokabeln sind diese Aktivitäten ebenfalls einsetzbar. Learning by doing ist eine effektive und motivierende Methode, die auch beim Vorspielen von Schlachtszenen (Battle of Hastings, King Arthur), Vorspielen von Rollenspielen (At the doctor s, In the restaurant) genutzt werden kann. 113
114 Sprachsensibler Fachunterricht Englisch Eine sehr komplexe, aber überaus nützliche, lustige und wertvolle Übung zum Einüben und Anwenden lexikalischer und grammatischer Strukturen stellt folgendes Beispiel dar. The colloquial use of the verb get 17» Step 1: Das Einhämmern (drill) bestimmter Wendungen anhand einer Bildergeschichte. It was a sunny day. It got cloudy. It got dark. It started to rain. He didn t have an umbrella. So he got wet. He got sick. He called in sick and his boss got angry. He got fired.» Step 2: Festlegen einer Reihenfolge zu einem Thema, z. B. Scott s terrible life, mithilfe von 30 verschiedenen Wendungen in Gruppenarbeit. Got worse Got divorced Got angry Got depressed Got fired Got into trouble Got into an accident Got fat Got involved in crime Got stessed out Got killed Got sleepy Got arrested Got nervous Got shot Got drunk Got desperate Got away with Got too confident Got behind at work Got careless Got old Got sick Got pregnant Got into debt Got lonely Got bored Got caught Got evicted Got addicted to drugs» Step 3: Story writing. In Gruppenarbeit schreiben die Schülerinnen und Schüler auf der Basis ihrer Festlegung der Reihenfolge der Redewendungen eine Geschichte zum Leben ihres Hauptcharakters auf. Nach der Kontrolle auf Hauptfehler durch die Lehrerin bzw. den Lehrer können die Schülerinnen und Schüler ihre Geschichten gegenseitig vorlesen (wieder in Gruppen möglich, um jedem Sprechmöglichkeit anzubieten).» Step 4: Final Game. Alle Wendungen stehen an der Tafel. In Gruppen versuchen die Schülerinnen und Schüler die richtige Wendung zu erraten, indem sie Hinweise geben, die sich entweder auf die Geschichten beziehen oder allgemeiner Art sind. a. He was in the rain so he b. He never had a wife so he didn t c. The police found him after stealing something so he» Diese Methode mit allen Schritten eignet sich auch mit dem Verb have, um später eine Geschichte mit einem Happy-end zu verfassen Lewis 1997, S
115 Strategien für die Formulierung und Beispiele gelungener Aufgabenstellungen» The colloquial use of the verb have. Had a holiday in Had a good time Had nothing/a lot to do Had a good job Had a chance to Had no diffculties ing Had a nasty shock when Had a meal/a few drinks Had no way of avoiding Had a bit of good/ bad luck Had a friend who Had an accident Had no doubt that Had a talk to Had a feeling that (S)he had no idea! Had no hesitation in ing Had a think and decided to Had no alternative but to Had no way of avoiding Für Übungen zur Wortschatzarbeit in Verbindung mit der Arbeit am Wörterbuch sind Arbeitsblätter abrufbar unter Diese Arbeitsblätter sind auch für Wörterbücher anderer Verlage geeignet und können individuell und differenziert eingesetzt werden. Operatoren Operatoren präzisieren das Ziel von Arbeitsaufträgen, sorgen dabei für Orientierung und erleichtern die Bearbeitung von Aufgaben. Manche Lehrwerke enthalten daher Listen von Operatoren und erklären in einer für Schülerinnen und Schüler verständlichen Alltagssprache, welche geforderte Handlung mit dem jeweiligen Operator verbunden ist. Auch die Konferenz der Kultusminister (KMK) hat für einige Fächer Operatoren insbesondere für die Verwendung in der Sekundarstufe II bzw. bei der Erstellung von Klausuraufgaben zusammengestellt. Diese Listen bleiben jedoch stets fachspezifisch und sind daher als Orientierung für Schülerinnen und Schüler gerade der Sekundarstufe I nur bedingt geeignet. So gibt es z. B. für den Operator analysieren in unterschiedlichen Fächern verschiedene Definitionen. Für Schülerinnen und Schüler ist dies sehr irritierend, und das erst recht, wenn verschiedene Lehrkräfte eines Faches überdies unterschiedliche Aspekte der geforderten Tätigkeit für wichtig halten. Es wäre daher gut, wenn in einem Kollegium eine Einigung darüber hergestellt würde, welche Operatoren fachübergreifend verwendet werden können. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich nämlich, dass viele Operatoren einen gemeinsamen Bedeutungskern haben. Die vorliegende Liste von Operatoren aus den Bereichen Natur- und Gesellschaftswissenschaften sowie Deutsch, Englisch und Mathematik stellt den exemplarischen Versuch dar,» aus den in den einzelnen Fächern genutzten Operatoren diejenigen herauszufiltern, die in allen Fächern verwendet werden. Es wurde also eine Schnittmenge gebildet;» aus den in den Fächern genannten Definitionen den ihnen allen gemeinsamen Kern herauszufiltern;» die so gefundenen Operatoren in einer für Schülerinnen und Schüler verständlichen Sprache zu formulieren. Der Gewinn liegt in der Möglichkeit einer breiten Anwendung dieser Operatoren in vielen Fächern. 115
116 Sprachsensibler Fachunterricht Englisch Operator nennen, angeben (name) beschreiben (describe) vergleichen (compare) erklären/erläutern (explain) begründen (give reasons) analysieren, untersuchen (analyse, examine) diskutieren, erörtern (discuss) beurteilen (evaluate, form an opinion) Handlung Informationen aufzählen, zusammentragen, wiedergeben Sachverhalte, Objekte oder Verfahren mit eigenen Worten wiedergeben Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln und darstellen Sachverhalte verständlich und nachvollziehbar machen und in Zusammenhänge darstellen Sachverhalte, Entscheidungen bzw. Thesen durch nachvollziehbare Argumente stützen und sachlich (beispielhaft) belegen Unter einer Fragestellung wesentliche Bestandteile oder Eigenschaften herausarbeiten bzw. nachweisen Sich argumentativ mit verschiedenen Positionen auseinandersetzen und ggf. zu einer begründeten Schlussfolgerung gelangen Zu Sachverhalten eine selbstständige Einschätzung formulieren und begründen In der Fremdsprache entsprechen die hier aufgeführten Operatoren weitgehend nur den Anforderungen für die Sekundarstufe II. 116
117 Strategien für die Formulierung und Beispiele gelungener Aufgabenstellungen Checkliste für Lehrerinnen und Lehrer» Ist meine Unterrichtssprache durchgängig/vorwiegend Englisch?» Plane ich bewusst Zeit ein, um am Wortschatz und an der Technik des Vokabellernens zu arbeiten?» Investiere ich auch einmal eine separate Stunde zur Wortschatzarbeit?» Erarbeite ich Wordlists, die nur diejenigen Wörter umfassen, die von den Schülerinnen und Schülern aktiv beherrscht werden sollen und die thematisch geordnet sind?» Ist die Einführung des Wortschatzes kontextgebunden?» Verwende ich abwechslungsreiche motivierende Methoden, um den Wortschatz einzuführen, zu festigen und zu üben?» Achte ich darauf, dass die neuen Wörter von allen Schülerinnen und Schülern gesprochen und geschrieben werden?» Kennen meine Schülerinnen und Schüler verschiedene Lerntechniken?» Berücksichtige ich bei den Übungen die verschiedenen Wahrnehmungskanäle?» Binde ich die Arbeit mit dem Vokabelheft oder Lernkasten in den Unterricht ein?» Biete ich den Schülerinnen und Schülern kooperative Übungsmethoden an?» Lasse ich die Schülerinnen und Schüler an der Erstellung von Wortfeldern teilhaben?» Trainiere ich das Gedächtnis der Schülerinnen und Schüler durch Auswendiglernen, durch ständiges Wiederholen, durch Merkübungen?» Verwende ich den zu lernenden Wortschatz in verschiedenen Situationen?» Überprüfe ich Vokabeln in mündlicher Form?» Entspricht die schriftliche Überprüfung, dem was geübt wurde?» Rege ich die Schülerinnen und Schüler zur Reflektion ihrer eigenen Arbeit und Ergebnisse an?» Lasse ich Tests berichtigen, damit Schülerinnen und Schüler aus ihren Fehlern lernen? 117
118 Sprachsensibler Fachunterricht Englisch Checkliste für Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche einmal pro Woche manchmal nie Ich beschäftige mich mit der englischen Sprache, indem ich einen englischen Text im Internet / einen englischen Comic / ein englisches Buch lese / einen englischen Song mitsinge und versuche, ihn zu übersetzen oder einen englischen Film mit englischen Untertiteln ansehe. Ich lese selbstständig Texte aus unserem Schulbuch, um meine Leistungen zu verbessern. Ich wiederhole Wörter und Grammatik aus dem Unterricht. Ich wiederhole regelmäßig Vokabeln der Lektion. Ich präge mir die Wörter ein mithilfe eines Vokabelkastens eines Vokabelhefts oder -hefters eines Computerprogramms eines Freundes Ich lerne die Wörter indem ich sie in beide Sprachen übersetze. indem ich sie noch einmal schreibe und dann die Schreibweise überprüfe. indem ich mich abfragen lasse. Ich lerne die Wörter in der Schule, im Unterricht. in der Pause. am Nachmittag zuhause. am Abend im Bett. Wörter, die mir schwer fallen, notiere ich mir, um sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu wiederholen. Nach dem Lernen gehe ich schlafen. gehe ich ins Freie. mache ich Sport. male/zeichne ich. unterhalte ich mich mit Freunden/meiner Familie. sehe ich fern. sitze ich am Computer. 118
119 Strategien für die Formulierung und Beispiele gelungener Aufgabenstellungen Im Unterricht übe ich Wörter am Besten/ am intensivsten in Gruppen/Partnerarbeit. bei LB/WB Übungen. beim Spielen. Ich lerne nur, wenn ein Vokabeltest angekündigt wurde. zweimal pro Woche einmal pro Woche manchmal Ja Nein nie Lerntipps» Um die englische Sprache zu beherrschen, muss man sich auch außerhalb des Unterrichts mit Englisch beschäftigen. Du kannst englische Filme anschauen oder deinen aktuellen Lieblingshit mitsingen und genauer unter die Lupe nehmen oder einfach einen englischen Text lesen. Das kann auch in Verbindung mit Computerspielen oder Internet-Aktivitäten geschehen.» Vokabeln zu lernen, zu üben und regelmäßig zu wiederholen, bedeutet natürlich viel Arbeit, aber wenn man sich einen Plan macht und strukturiert lernt, dann wird man in naher Zukunft auch Erfolge verspüren.» Eine positive Einstellung zum Lernen und ein eigener Wille sind die erste Voraussetzung.» Du musst herausfinden, wann und wie du am Besten lernen kannst. Aber denke daran, dass du dafür Zeit einplanst, dass du langfristig lernst und dass du die Wörter ständig wiederholst, um sie im Langzeitgedächtnis abspeichern zu können.» Manchmal ist es sogar vorteilhaft, sich die Wörter vor dem Schlafengehen noch einmal anzuschauen, um sie dann im Schlaf zu lernen und zu behalten. Wenn du am Tag nur 10 Vokabeln wiederholst, sind es in einer Woche bereits 50 Wörter, die du gefestigt oder geübt hast.» Aber denke daran, dass du dir genügend Zeit nimmst, um dich nach getaner Arbeit auch entsprechend zu entspannen. Du kannst Sport treiben oder dich an der frischen Luft bewegen. Vermeide die permanente Nutzung des Computers oder Fernsehers, um Gelerntes nicht gleich wieder zu verdrängen.» Trainiere dein Gedächtnis, lerne auswendig und formuliere lange Wort- oder Satzketten, baue dir Eselsbrücken, präge dir Wörter mithilfe von Bildern oder Ereignissen oder kleinen Geschichten ein.» Du kannst auch verschiedene Formen des Lernens ausprobieren, wie z. B. im Auf- und Abgehen zu lernen, sich Wörter durch Bilder oder Geschichten oder Lieder einzuprägen. Beim Lernen von Zeitwörtern kann man auch versuchen, die Tätigkeiten selbst auszuführen oder sie sich vorzustellen. Du kannst auch Vokabel-Poster oder Sticker in deinem Zimmer oder an bestimmten Stellen in der Wohnung aufhängen, sodass du dir beim Vorübergehen die Vokabeln einprägst. Bilder oder Bewegung ersetzen zwar nicht das schriftliche oder akustische Lernen, aber sie ergänzen und unterstützen es. 119
120 Sprachsensibler Fachunterricht Englisch» Auch Online-Portale bieten dir zahlreiche Hilfen an, um englische Vokabeln und englische Grammatik zu üben, aber auch thematisch zu wiederholen und z. B. durch Spiele Spaß beim Anwenden der englischen Sprache zu finden. Probier doch mal:
121 Literatur Bücher/Zeitschriften Berliner Rahmenlehrplan für Englisch für die Grundschule und Sekundarstufe 1. Berlin, 2006/7 Dreyer, Elke (2011): Wortschatzarbeit. In: Praxis Englisch, Heft 1/2011, Berlin: Westermann, S. 45f. Grieser-Kindel, Christin; Henseler, Roswitha; Möller, Stefan (2009): Method Guide. Methoden für einen kooperativen und individualisierenden Englischunterricht in den den Klassen Paderborn: Schöningh, S Haß, Frank (2006): Fachdidaktik Englisch. Stuttgart: Klett Nodari, Claudio/Steinmann Cornelia (2008): Fachdingsda Fächerorientierter Grundwortschatz für das Schuljahr. Lehrmittelverlag des Kantons Aargau Lewis, Michael (1997): Implementing the Lexical Approach Puttng Theory into Practice. London: Commercial Colour Press Quetz, Jürgen (1995): Wortschatzlernen Viele Fragen an die Forschung. In: Bausch, Karl- Richard (Hrsg.): Erwerb und Vermittlung von Wortschatz im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr, S Schiffer, Ludger (2003): Wie helfe ich mir beim Fremdsprachenlernen? Berlin: Urania Schiffer, Ludgar (2012): Effektiver Fremdsprachenunterricht: Bewegung-Visualisierung- Entspannung. Tübingen: Narr Ur, Penny (2012): Vocabulary Activities. Cambridge: University Press 121
122 Sprachsensibler Fachunterricht Englisch Internetquellen Bortoli, Ricarda (2007) Bildungsklick ( ) Huber, Konrad (2001) Methodenvorschläge und Hinweise für den Englischunterricht in der 5. und 6. Jahrgangsstufe, Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung, München ( ) Neudecker, Wolfgang (2011) Einführung neuer Lexik, Fachdidaktik Englisch ( ) Siepmann, Dirk Wortschatzlernen im Fremdsprachenunterricht, Universität Osnabrück ( ) Stangls, Werner Arbeitsblätter (Vergessen) ( ) Stangls, Werner Arbeitsblätter (Lernkartei) ( ) Tettenhammer, Christine (2013) Wie viele Wörter sollte ich können? ( ) Voigt, Ulrich (2005) Mnemotechnik-Patchwork aus Internetbeiträgen ( ) 122
123 Wortschatzarbeit im Geografieunterricht Nadine Düppe
124
125 Wortschatzarbeit im Geografieunterricht Wortschatzarbeit? Dafür habe ich keine Zeit, ich schaffe ja kaum die curricularen Vorgaben. Das kann ich nicht. Ich bin ja keine Sprachlehrerin. Dafür ist das Fach Deutsch zuständig. Das mache ich doch schon Fachwörter werden immer erklärt und an die Tafel geschrieben. Werden Kolleginnen und -kollegen auf die Wortschatzarbeit im Geografieunterricht angesprochen, kommen nicht selten Vorbehalte. Diese Gedanken lassen sich sicherlich noch weiter ausführen. Im Prinzip geht es um nachvollziehbare Vorbehalte wie den Mangel an Zeit, didaktische und/oder methodische Unsicherheiten sowie um Gedankenlosigkeit über die Bedeutung der Spracharbeit im Geografieunterricht. Im weiteren Gespräch wird aber auch schnell deutlich, dass fast allen Lehrkräften die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in den Kompetenzbereichen Lesen, Schreiben, Sprechen und Zuhören auffällt. Insbesondere bei Hausaufgaben, Tests und anderen schriftlichen Aufgaben wird die Qualität sprachlicher Darstellungen bemängelt. Auffallend ist aber auch, dass in Fachgesprächen die Beschäftigung mit sprachlichen Aspekten im Unterricht didaktisch nicht mehr sofort bzw. allein dem Fach Deutsch zugeschrieben wird, wie es Czapek im Jahr 2000 noch in seinem Aufsatz beklagte. 1 Unterricht in sprachlich heterogenen Klassen gehört zum Alltag von Lehrkräften jedweden Fachs. Das Verständnis, dass jeder Unterricht auch Sprachunterricht ist, setzt sich inzwischen durch. Allerdings fehlt meist ein Repertoire von Handlungsstrategien im Umgang mit sprachlicher Heterogenität zur Förderung der Sprachkompetenz. Der folgende Beitrag befasst sich zunächst mit der Bedeutung der Sprach- und Wortschatzarbeit im Geografieunterricht. Neben diesen grundsätzlichen Überlegungen zur Umsetzung werden außerdem Beispiele für den Unterricht aufgezeigt. 1 Czapek 2000, S
126
127 1 Notwendigkeit von sprachlicher Arbeit im Geografieunterricht Der Sachunterricht mit seiner fachlichen Spezifizierung legt klare Zuordnungen in Bezug auf Inhalte und Kompetenzen fest. Aus dieser Tatsache heraus ist vordergründig die Auffassung nachvollziehbar, Spracharbeit sei die Aufgabe des Deutschunterrichts. Die Verantwortung für die Spracharbeit wird nicht in dem Maße anzunehmen, wie es die Situation in der Lerngruppe vielleicht erfordert. 2 Schon die Tatsache, dass der geografische Fachwortschatz nicht einfach vom Deutschkollegen übernommen werden kann, zeigt jedoch die Verantwortung der Lehrkräfte im Unterrichtsfach Geografie auch für die Wortschatzarbeit. Die Sprache als zentrales Mittel zur Überlieferung und Erhaltung des gewonnenen Wissens zeigt den prinzipiellen Stellenwert einer Wissensgesellschaft. Czapek verweist in diesem Zusammenhang auf die zahlreichen Bildungsstudien, die die Notwendigkeit einer Sprachbildung an vorderste Stelle stellen. 3 Durch den Paradigmenwechsel hin zum kompetenzorientierten Unterricht kommt dem Sprachvermögen als Grundlage für die soziale und kommunikative Kompetenz eine besondere Bedeutung sowohl fachübergreifend als auch fachintern zu. Die Bildungsstandards der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG) weisen Kommunikation als Kompetenzbereich explizit aus und umreißen diesen Kompetenzbereich mit der Fähigkeit, geographische/geowissenschaftliche Sachverhalte zu verstehen, sich angemessen unter der Verwendung der Fachsprache auszudrücken und damit anderen verständlich zu machen 4. Auch der Berliner Rahmenlehrplan Geografie in der Sekundarstufe I weist die sachgerechte Nutzung der Fachsprache in mündlichen und schriftlichen Darstellungen aus Standard aus. 5 Diese Fähigkeiten werden als Teil einer geografischen Gesamtkompetenz angesehen, die zielstrebig entwickelt und langfristig eingeübt werden müssen. Vergleicht man den hohen sprachlichen Anteil der Schüleraktivitäten mit der stattindenden Sprachkompetenzförderung, wird die Aufgabe deutlich. Czapek weist in nur zwei Bezügen 2 Czapek 2000, S Ebenda 4 Deutsche Gesellschaft für Geographie 2012, S Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin 2006, S. 12 und S
128 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie auf, worin die Möglichkeiten, aber auch Notwendigkeiten sprachlicher Bildung im Geografieunterricht liegen. 6 Im Konkreten ist es der Umgang mit den vielfältigen Materialien, der eine große fachsprachliche Darstellungsleistung benötigt. Das zweite Beispiel ist etwas allgemeiner und greift die Tatsache auf, dass Geographie als vielschichtiges Integrationsfach Bezüge und Betrachtungsweisen aus der Natur- und Gesellschaftswissenschaft integriert und vernetzt, was eine entsprechend komplexe und differenzierte Ausdrucksweise erfordert. Nodari und Steinemann betonen, dass gerade das Fach Geografie neben Geschichte zu einer Fächergruppe gehört, dessen Unterricht stark an die geschriebene Sprache gebunden ist. Dies begründen sie mit der Textlastigkeit des Faches. Gemeint ist damit, dass neue Sachinhalte häufig über Sachtexte eingeführt werden, also Texte, die den Lernenden komplexe und zum Teil abstrakte Sachverhalte mit präzisen Begriffen und zum Teil komplexen Satzstrukturen präsentieren. 7 Bei dieser Textsorte wird von den Lernenden erwartet, dass sie selbst Zusammenhänge mündlich oder schriftlich differenziert darlegen können. Dabei müssen die entsprechenden (Fach-)Begriffe und die zum Teil komplexe Syntax genau verstanden werden. In Qualifizierungen wird von Lehrkräften darauf hingewiesen, dass Aufgabenstellungen von den Lernenden oft nicht oder nur unzureichend verstanden würden, was eine weitere sprachliche Hürde für den Lernenden sein könne und somit über ihren oder seinen Erfolg maßgeblich mitentscheide. Im Folgenden wird ein Beispiel dafür gegeben, worin weitere Schwierigkeiten auf der Wortschatzebene liegen können. Dieses Beispiel stammt aus einer schriftlichen Leistungskontrolle einer 10. Klasse am Gymnasium. Das Beispiel mit der Ölpalme Unter der Problemfrage Perspektiven für Nigeria durch Erdöl? forderte einer der Arbeitshinweise auf, die wirtschaftliche Nutzung des Nigerdeltas zu beschreiben. Dazu gab es eine Wirtschaftskarte aus dem Atlas. Der Schüler baute seinen Text so auf, dass er den Wirtschaftsraum differenziert mit Ausrichtung auf Ölfelder bearbeitete. Er brachte das große Vorkommen der Ölpalme in einen Zusammenhang mit den Erdölvorkommen. Hier hat der sprachliche Aspekt ihm eine Falle gestellt. Im späteren Gespräch und nach Erarbeitung des Begriffs war ihm die Zuordnung völlig klar. Er erwähnte aber auch, dass er während der Bearbeitung der Aufgabe und auch in der Selbstreflektion im Nachgang keinen Moment daran gezweifelt hatte, dass die Ölpalme etwas mit Erdöl zu tun hat. Spracharbeit und im Speziellen auch die Wortschatzarbeit ist also gut investierte Unterrichtszeit. Damit ist die Sprachbildung ein grundsätzlicher und ganz und gar nicht zusätzlicher Auftrag des Geografieunterrichts und reiht sich in andere Kompetenzbereiche, die stärker die inhaltliche Seite der Geografiedidaktik betreffen. Sprachbildung als Prinzip des GU In den meisten Berliner Schulen ist Geografie mit einer Stunde in der Stundentafel ausgewiesen. Auch wenn dies in der schulischen Planung teilweise in Form des epochalen Unterrichts mit zwei Stunden umgesetzt wird, bleibt die Rechnung dieselbe. Der oben erwähnte Zeitaspekt als Vorbehalt für die Integration der Spracharbeit im Geografieunterricht ist so gesehen nachvollziehbar. Allerdings sollte Spracharbeit im Geografieunterricht nicht als eine Ausweitung des Deutschunterrichts und somit on top gesehen werden. Hauptziel ist und bleibt die Vermittlung Czapek 2000, S Nodari/Steinemann 2008, S. 44
129 Notwendigkeit von sprachlicher Arbeit im Geografieunterricht von Fachinhalten und die Entwicklung von Fachkompetenzen. Sprachförderung trägt der Tatsache Rechnung, dass die Fachsprache das Werkzeug der Lernenden ist, mit dessen Hilfe sich die neuen Inhalte erschließen und verstehen. Sprachförderung im Fachunterricht geht demnach nicht einfach auf Kosten der Fachinhalte, sondern schaff die Grundlagen für die vertiefte Auseinandersetzung mit ihnen. 8 Dabei wird der Aufbau fach- und bildungssprachlicher Kompetenzen über Klassen- und Schulstufen sowie Schularten hinweg verfolgt. Ziel ist es, das Sprachbewusstsein der Schülerinnen und Schüler so zu erweitern, dass sie die sprachlichen Anforderungen im Fach Geografie bewältigen können. Die Betonung der Sprach- und Wortschatzarbeit im Geografieunterricht als Prinzip bedeutet letztendlich, all die Aspekte deutlicher zu beachten, die ohnehin schon Gegenstand im Fachunterricht sind: 9 Bei schriftlichen Leistungsüberprüfungen wird neben inhaltlichen und methodischen Kompetenzen auch die sprachliche Qualität bewertet. Dies erfordert folglich auch eine Hinführung und Vorbereitung sowie die mündliche Leistung ebenfalls nicht nur nach inhaltlicher Kenntnis, sondern auch nach der Qualität der Vermittlung und Darstellung eingeschätzt werden muss. Letztendlich bedeutet dies, die Sprach- und Wortschatzarbeit grundsätzlich in die jeweiligen Phasen zu integrieren und stärker die sprachliche Qualität zu beachten: 10 Neben dem Eingehen auf inhaltliche und methodische Aspekte gilt es auch» die sprachliche Qualität (z. B. bei Hausaufgaben und schriftliche Aufgabenlösungen) zu beachten,» Rückmeldungen zur sprachlichen Qualität bei mündlichen Schüleraktivitäten zu geben,» komplexe sprachliche Darstellungen einzufordern,» auf fragmentarische Lösungen (Stichwörter) zu verzichten,» sprachliche Anforderungen an die Vorgaben anderer Fächer anzugleichen (z. B. Textproduktion und Stilistik des Deutschunterrichts),» das Lernen von (Fach-)Begriffen und Formulierungen zu betonen. Demnach unterscheidet sich der herkömmliche Geografieunterricht nicht grundsätzlich vom Geografieunterricht, in den gezielte Wortschatzförderung integriert ist. Selbstverständlich stehen auch hier die curricularen Vorgaben im Vordergrund. Neu ist einzig ein bewusster Umgang mit der (Fach-) Sprache und den (Fach-)Begriffen. Ansätze für eine Umsetzung in der Praxis Die Rolle der Lehrkraft Voraussetzung für einen gelungenen Geografieunterricht, in dem die Sprachbildung zum Prinzip gemacht wird, ist natürlich eine Lehrkraft, die sich der Bedeutung der Sprache für den Lernprozess bewusst ist und die der Integration der Spracharbeit gegenüber aufgeschlossen ist. Unabhängig davon, ob die Lehrkraft bewusst die Sprachbildung in ihrem Unterricht fördert und steuert, gilt der eigene Sprachgebrauch als Vorlage. Die Lehrkraft ist also dauerhaft in der Rolle 8 Nodari/Steinemann 2008, S. 7 9 Vgl. Czapek 2000, S Ebenda 129
130 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie des sprachlichen Vorbildes, was durch das Maß ihrer Formulierungsfähigkeit mehr oder weniger beispielgebenden Charakter hat. Eine Lehrkraft, die selbst keine Fachwörter benutzt, stets in Halbsätzen die Schülerinnen und Schüler auffordert, kann keinen Gebrauch der Fachbegriffe und komplexe Darstellungen von den Schülerinnen und Schülern erwarten. Hierbei geht es nicht um ein übertriebenes und künstliches Sprachhandeln, sondern um den Gebrauch einer sachlichen Fachsprache, so dass die Schülerinnen und Schüler lernen, zwischen Alltags- und Fachsprache zu unterscheiden. Weitergehend besteht ihre Aufgabe darin, bei sprachlichen Unzulänglichkeiten seitens der Schülerinnen und Schüler korrigierend einzugreifen und zum Beispiel bei richtig gemeinten, aber sprachlich unpräzisen Beiträgen zur Verbesserung aufzufordern. Dieser Vorbehalt, bei wenig Zeit sich dies nicht erlauben zu können, kann entkräftet werden: Nur was sprachlich exakt gefasst werden kann, ist inhaltlich gesichert. Andersfalls verbleibt der Unterricht in Aspekthaftigkeit und Vordergründigkeit. 11 Umgang mit Sachtexten Vor dem Einsatz von Sachtexten ist es wichtig, diese vorab nicht nur durch eine fachdidaktische, sondern durch eine didaktische Brille in Hinsicht auf das sprachliche Lernen zu betrachten. Die Eignung für eine textuelle Weiterarbeit wird geprüft, so dass die Sachtexte auch zum sprachlichen Umgang anregen und somit zur Sprachbildung beitragen. Texte, die bereits eine Zusammenfassung eines komplexen Sachverhalts beinhalten, eignen sich wenig zur Zusammenfassung mit eigenen Worten, dazu bedarf es Texte mit Redundanzen. Neue Fachbegriffe können nur aus dem Kontext erschlossen werden, wenn der Text auch tatsächlich Erklärungen dazu anbietet. Umgang mit Karten, Diagrammen und Statistiken Im Unterschied zu Texten bieten diese Darstellungsformen geografischer Inhalte von sich aus nur eine sehr begrenzte Sprachvorlage, die übernommen werden kann. Stattdessen erfordert ihre Auswertung einen gut ausgebildeten produktiven Wortschatz. Hierzu sind neben den methodischen Anleitungen demnach auch sprachliche Unterstützungen angebracht, die den Lernenden zeigen, wie ein Material sachlogisch ausgewertet werden kann. Die Bereitstellung eines Wortschatzes sowie die Verdeutlichung einer sachlogischen Gliederung bei der Darstellung können dies sein. Begriffsbildung Der Umgang mit (Fach-)Begriffen spielt eine zentrale Rolle in der Sprachbildung. Begriffe sind nach Haubrich Bausteine unseres Wissens und Denkens. Sie sind Beschreibungen und Erklärungen für beobachtbare Sachverhalte. Das Erlernen und Anwendenkönnen ist für das Lösen von Problemen von zentraler Bedeutung. Die Grenzen zwischen Begriffsbildung und Wissenserwerb sind fließend. 12 Birkenhauer 13 stellt dar, auf welche unterschiedliche Weise Lernende mit Begriffen vertraut gemacht werden, und bewertet sie. Das Einüben in Form von bloßem Auflisten und späterem Abfragen ist wenig ertragreich. Untersuchungen zeigten, dass Lernende zwar mit dem Sachverhalt vertraut sind, dennoch nutzen sie trotz Vermittlung die Fachbegriffe (z. B. Pendler, CBD, Wirtschaftssektor) nicht. Anders sieht es nach einer sorgfältigen Einführung neuer Begriffe aus. Methodisch sollte von den konkreten Begriffen der Erfahrungswelt der Lernenden ausgegangen werden und daran anknüpfend sollte die Funktion neuer Begriffe erarbeitet wer Czapek 2000, S Haubrich 2006, S Birkenhauer 2005, S. 42f.
131 Notwendigkeit von sprachlicher Arbeit im Geografieunterricht den. Die Lernenden erfahren dabei, warum es sinnvoll ist, z. B. statt der beschreibenden allgemeinen Begriffe Straßen, Eisenbahn, Stromleitungen den neuen Fachbegriff Infrastruktur zu verwenden, indem ihnen gezeigt wird, wie schnell man sich mit ihm präzise verständigen kann und verdeutlicht so die Funktion von Fachbegriffen. Schlussendlich lässt sich ableiten, dass im Unterricht Angebote zum Sprachgebrauch gemacht werden sollten, die zur sprachlich konkreten und präzisen Auseinandersetzung mit den geografischen Inhalten anregen. Dies ist ein Schritt, allen Lernenden den Zugang zur Fachsprache zu eröffnen und sie zu unterstützen. Dabei geht es stets um den Umgang mit Begriffen und Formulierungen sowie dem eigenständigen Formulieren im sachlichen Kontext. 131
132
133 2 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von (Fach-)wörtern und Formulierungen Im Folgenden werden anhand einer exemplarischen Zusammenstellung Vorschläge aufgezeigt, wie Wortschatzarbeit als Förderung der Fachsprache im Geografieunterricht betrieben werden kann. Die vorliegenden Angebote verschiedener Aufgabentypen können und sollten jederzeit verändert und auf die konkrete Lerngruppe zugeschnitten werden. Grundlage dabei ist die Fünf- Schritt-Methode, wobei für jede Stufe einige Vorschläge gemacht werden. Vorrangig geht es um das Vorstellen geeigneter Aufgabentypen, die auch auf andere Fachinhalte mit relativ wenig Vorbereitungszeit übertragen werden können und dabei helfen, Routinen aufzubauen. Hinweis: Zur besseren Orientierung werden Aufgabentypen, die für Einzelarbeit geeignet sind, mit (EA) gekennzeichnet. Selbstverständlich können sie in Abwandlung auch in andere Sozialformen überführt werden. Interaktive Methoden werden mit (IA) gekennzeichnet. Darüber hinaus wird gezeigt, ob dies ein Beispiel auf Wort- oder Satzebene darstellt. Die fünf Schritte der Wortschatzarbeit Fünf-Schritt-Methode der Wortschatzarbeit (Synopse) Schritte 1. Fachwörter und Formulierungen kontextbezogen einführen 2. Fachwörter und Formulierungen üben Aufgabentypen/Übungen Buchstabensalat; Zuordnung von Fachwörtern/Formulierungen zu grafischen Darstellungen; Beschreibung von Diagrammen mit vorgegebenen Kommunikationsmitteln; selbständiges Erschließen von Fachwörtern aus einem Text und einer grafischen Darstellung; Überschriftenformulierung; Blockbildbeschriftung Schreiben und Zuordnen von Wörtern zu Abbildungen; fehlende Vokale/Konsonanten finden; Definitionen schreiben und raten; Kreuzworträtsel; Lückentext; 133
134 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie Schritte 3. Fachwörter und Formulierungen anwenden 4. Über Wörter und Formulierungen reflektieren Aufgabentypen/Übungen Laufdiktat; Schreiben eines Textes mit Wortgerüst; Auswertung eines Klimadiagrammes mit vorgegebenen Kommunikationsmitteln; Wortbildung durch Zusammensetzung von Wörtern (Komposita); Begriffsnetze zum Speichern und Systematisieren des Fachwortschatzes z. B. Wortfamilie, Wortfeld; Wortbildung durch Ableitungen: Beispiel Adjektivendungen; Textvergleich; 5. Testen Multiple-Choice; Transferaufgabe. Schritt 1: Kontextbezogene Einführung von Fachwörtern und Formulierungen Wörter und Formulierungen werden kontextbezogen eingeführt. Die Fachinhalte stehen im Vordergrund, aber zugleich wird Wert auf das genaue Verstehen der Begriffe gelegt bzw. auf das Anbieten von Formulierungen. Aufgabentyp: Buchstabensalat EA; Wortebene Aufgabe: Finde Wörter, die jeweils die beiden höchsten und niedrigsten Punkte der Kurve bezeichnen. Stelle dazu die Buchstaben um. xumiamm das munmimi das eummambnexin das binnmneumeim das M Alle mit M gekennzeichneten Diagramme und Tabellen basieren auf Entwürfen der Autorin (N. Düppe).
135 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von (Fach-)wörtern und Formulierungen Aufgabentyp: Zuordnung von (Fach-)Wörtern und Formulierungen zu grafischen Darstellungen EA; Satzebene Aufgabe: Ordne die Formulierungen, die zur Beschreibung der gestrichelten Grafen passen, den Abbildungen zu. Nutze dazu die Nummern. M2a 1. Der Graf steigt mäßig an. / Man erkennt einen mäßig ansteigenden Grafen. 2. Der Graf steigt leicht an. / Man erkennt eine leicht ansteigenden Grafen. 3. Der Graf steigt stark an. / Man erkennt einen stark ansteigenden Grafen. 4. Der Graf steigt extrem stark an. / Man erkennt einen extrem ansteigenden Grafen. M2b 1. Der Graf fällt stark. / Man erkennt einen stark fallenden Grafen. 2. Der Graf fällt mäßig. / Man erkennt einen leicht fallenden Grafen. 3. Der Graf fällt leicht. / Man erkennt einen leicht fallenden Grafen. 4. Der Graf fällt extrem stark. / Man erkennt einen extrem fallenden Grafen. Lösung: 135
136 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie Aufgabentyp: Beschreibung von Diagrammen mit vorgegebenen Kommunikationsmitteln EA; Wort- und Satzebene Aufgabe: Beschreibe das Diagramm. Benutze dazu unterschiedliche Kommunikationsmittel. Der Aralsee: Entwicklung des Volumens und der Fläche Fläche in km² Volumen in km³ Fläche in km² ,4 47,9 44,5 43,3 42,5 41,5 39,5 38,2 35,4 33,6 M3 15 Kommunikationsmittel: sein : betragen entsprechen liegen bei (Zahl) sich belaufen auf Rangfolge: einnehmen (Platz) liegen an (Stelle) / auf (Platz) belegen (Platz / Stelle) kommen an (Stelle) / auf (Platz) größer werden : (an)steigen zunehmen wachsen sich erhöhen sich vergrößern sich verdoppeln/verdreifachen eine steigende Tendenz aufweisen gleich bleiben : stagnieren kleiner werden : sinken abnehmen zurückgehen sich verringern sich verkleinern sich halbieren eine sinkende Tendenz aufweisen von auf um (Differenz) Die Daten nach: Giese/Bahro/Betke 1998, S ( )
137 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von (Fach-)wörtern und Formulierungen Aufgabentyp: Selbstständiges Erschließen von Fachwörtern aus einem Text und einer grafischen Darstellung EA; Wortebene Aufgabe: Ordne mit Hilfe des Textes die Begriffe neben die Zahlen im Klimadiagramm ein: Temperaturkurve +++ Monate eines Jahres +++ Jahresdurchschnittstemperatur in C +++ Niederschlagssäulen +++ Jahresniederschlagsmenge in Millimeter (mm) +++ Niederschlagsskala in Millimeter (mm) +++ Ortsname +++ Temperaturskala in C +++ Höhenlage in Meter (m) +++ Lage im Gradnetz 1 3 C Ksyl-Orda (Kasachstan) 129 m ü.m. 44 N, 65 O mm ,1 C 114 mm J F M A M J J A S O N D 6 10 erzeugt nach Diercke Klimagraph unter M4 16 Das Klimadiagramm (M5) Ein Klimadiagramm gibt Informationen über die klimatischen Verhältnisse (Temperatur, Niederschlag) an einem bestimmten Ort im Jahresverlauf. Diese Informationen stehen in grafischer Darstellung zur Verfügung und nicht in Textform. Voraussetzung ist aber, dass man die Zeichen des Klimadiagramms versteht, es also lesen kann. Zuerst gibt das Klimadiagramm allgemeine Informationen. Genannt wird natürlich immer der Name des Ortes, an dem die Klimadaten entnommen wurden. Damit du einordnen kannst, wo der Ort liegt, werden auch seine Lage im Gradnetz anhand der geografischen Koordinaten angegeben sowie die Höhenlage des Ortes, also wie viele Meter der Ort über dem Meeresspiegel (ü. M.) liegt. An der Temperaturskala kannst du die Temperaturwerte der einzelnen Monate ablesen. An der Temperaturskala steht natürlich auch, in welcher Einheit die Werte angegeben sind. In der Regel wirst du es mit der Celsius-Einheit zu tun haben, denn das ist die in Deutschland gebräuchlichste. Aber es gibt noch andere, wie z. B. Fahrenheit und Kelvin. Die Temperaturwerte entnimmst du der Temperaturkurve, die die Durchschnittswerte der einzelnen Monate miteinander verbin 16 Die Daten nach: und ( ) 137
138 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie det. Die Jahresdurchschnittstemperatur, auch Jahresmitteltemperatur bezeichnet, wird aus dem Durchschnitt der zwölf Monatsmitteltemperaturen errechnet. Diese musst du meist nicht selbst errechnen, denn in der Regel wird sie im Klimadiagramm aufgeführt. An der Niederschlagsskala kannst du die Niederschlagsmenge in Millimeter (mm) für die einzelnen Monate ablesen. Die Niederschlagmenge der einzelnen Monate wird in Niederschlagssäulen dargestellt. Für die Jahresniederschlagsmenge werden die Werte der einzelnen Monate zusammengerechnet (addiert). Lösung: 1. Ortsname, 2. Lage im Gradnetz, 3. Höhenlage in Meter (m), 4. Jahresdurchschnittstemperatur in C, 5. Temperaturkurve, 6. Jahresniederschlagsmenge in Millimeter (mm), 7. Niederschlagssäulen, 8. Temperaturskala in C, 9. Niederschlagsskala in Millimeter (mm), 10. Monate eines Jahres 138
139 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von (Fach-)wörtern und Formulierungen Aufgabentyp: Selbstständiges Erschließen eines Textes; Überschriftenformulierung; Blockbildbeschriftung EA; Satz- bzw. Textebene Aufgaben zu Text 1: 1. Lies den Text. 2. Ordne den beiden Blockbildern anschließend die Überschriften Europa nach dem Eis und Europa unter dem Eis zu und schreibe sie jeweils auf die Linien neben den Bilden. 3. Finde eine Überschrift zu Text 1 und schreibe sie über den Text. Eis Europa Sandersande Kiessande in Endmoränen und glazialen Erosionsrinnen Geschiebemergel = Grundmoräne älteres Pleistozän oder älterer Untergrund Pleistozän (Eiszeitalter) N Europa S M Vgl. Koppe 2012, siehe auch 139
140 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie Lösung: Eis Sandersande Kiessande in Endmoränen und glazialen Erosionsrinnen Geschiebemergel = Grundmoräne älteres Pleistozän oder älterer Untergrund Pleistozän (Eiszeitalter) N S Urstromtal Hauptendmoräne kuppige Grundmoränenlandschaft ebene Grundmoränenlandschaft M Ebenda
141 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von (Fach-)wörtern und Formulierungen Text 1 (M8 19 ) Bis vor ca Jahren lagen weite Teile Europas unter einer mächtigen Eisdecke begraben, danach erwärmte sich das Klima wieder und zwang die Eismassen zum Rückzug. Während der größten Eisausdehnung in Mitteleuropa, vor ca Jahren, schoben sich die Gletscher aus Skandinavien über die Ostsee und Großbritannien bis weit hinter Berlin an die deutsche und polnische Mittelgebirgsschwelle heran. Im Süden dehnten sich die Gletscher der Alpen weitläufig in das Vorland aus. Diese großräumige Vereisung, währenddessen ca. ein Drittel der weltweiten Landmassen unter Eis begraben waren, ist keine Ausnahmeerscheinung. In den letzten 1,6 Millionen Jahren der Erdgeschichte gab es eine Vielzahl von Kaltphasen, die eine global weitreichende Vereisung verursachten. Momentan befinden wir uns in einer Interglazialphase, d. h. in einer Warmphase zwischen zwei Eiszeiten. Mittlere Warmphasen dauerten in der Erdgeschichte ca Jahre an, die derzeitige nun schon seit Jahren. Eiszeiten haben in der Natur unverwechselbare Landschaften hinterlassen, die heute beliebte Naherholungsziele darstellen, wie beispielsweise die Mecklenburger Seenplatte oder die Oberbayrischen Seen. Als erste beschrieben Albrecht Penck (1858 bis 1945) und Eduard Brückner (1862 bis 1927) die typische Abfolge eiszeitlicher Formungen, zu denen Grundmoräne, Endmoräne, Sander und Urstromtal gehören. Sie prägten daraufhin die Bezeichnung Glaziale Serie. Die regelhafte Anordnung glazialer Formen können unterschiedlich ausgeprägt und durch darauffolgende Eiszeiten überformt sein. Am besten sind die Ablagerungen der letzten Eiszeit, die für Norddeutschland die Bezeichnung Weichsel-Kaltzeit trägt, in der Landschaft erhalten. 19 Ebenda 141
142 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie Aufgabentyp: Selbstständiges Erschließen von Fachwörtern aus einem Text mit Blockbildbeschriftung EA; Wortebene Aufgaben zu Text 2: 1. Lies den Text. 2. Ordne dem unteren Blockbild die Hauptelemente der glazialen Serie zu: ebene Grundmoränenlandschaft +++ kuppige Grundmoränenlandschaft +++ Endmoräne +++ Sander +++ Urstromtal. 3. Finde Beispiele zu den Wörtern der Wortliste und schreibe deine eigenen Erklärungen. Ergänze die Liste durch weitere Wörter, die dir neu sind Text 2: Hauptformen der glazialen Serie (M9 20 ) Die glaziale Serie gliedert sich schematisch in eine Grundmoränenlandschaft, die sich unter dem Eis befand; in eine hügelige Endmoränenkette; eine durch Schmelzwässer aufgeschüttete Sanderfläche und dem Urstromtal als abschließendes Element. Grundmoräne Die Grundmoränenlandschaft zeichnet sich durch eine flache, leicht wellige bis kuppige Oberfläche aus, die auch eine Vielzahl von Seen beinhaltet. Material, das der Gletscher im Eis mitführt, wird durch Ausschmelzen unter ihm abgelagert. Das Korngrößenspektrum reicht von feinem Sediment wie Ton und Sand über Kies bis zu großen Gesteinsblöcken, die auch als Findlinge bezeichnet werden. Endmoräne An die Grundmoräne schließt sich die Endmoräne an, die sich bogenförmig um den weitesten Vorstoß des Eises anordnet. Sie markiert eine über längere Zeit stationäre Randlage des Gletschers, so dass sich mächtige Wälle aus mitgeführtem Material anhäufen konnten. Die Endmoränen können dabei eine Länge von mehreren hundert Kilometern und eine Höhe von bis zu hundert Metern erreichen. Ihre Entstehung kann durch Ausschmelzen von Material aus dem Eis am Ende des Gletschers sowie durch Aufschieben von Sediment durch die Bewegung des Eises erklärt werden. Meist sind nur die Endmoränenwälle der letzten Vereisung erhalten geblieben. Sander Sander sind im Gegensatz zu den Moränen nicht durch die direkte Einwirkung des Gletschers entstanden. Durch den enormen Auflagerungsdruck des Gletschers und die Erdwärme schmilzt das Eis an der Unterseite des Gletschers und fließt in einer Vielzahl von Schmelzwasserströmen aus dem Gletscher aus. Sie führen große Mengen an Material wie Ton, Sand und Geröll mit sich, welches hinter der Endmoräne im Gletschervorland wieder abgelagert wird. Mit wachsender Entfernung zur Endmoräne wird das Material, aus dem der Sander aufgebaut ist, immer feiner. Kiese werden sofort hinter der Endmoräne abgelagert, Sand und Ton werden noch weiter transportiert. Urstromtal Das abfließende Wasser sammelte sich in einem Urstromtal, welches mehr oder weniger parallel zum Eisrand verlief. Da die Flüsse aufgrund des Eisschildes über Norddeutschland während der Kaltphasen nicht mehr nach Norden abfließen konnten, mussten sie westwärts umschwenken Ebenda
143 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von (Fach-)wörtern und Formulierungen Die Schmelzwässer aus dem Eis kamen hinzu und formten die heute bekannten Urstromtäler, die meist von Südost nach Nordwest fließen. Von heutigen Flüssen genutzte Urstromtäler sind u. a. das nördlich der Alpen verlaufende Tal der Donau sowie Urstromtäler in Norddeutschland, in denen heute der Oder-Havel-Kanal und die Elbe fließen. Verfolgt man die Elbe auf einer Landkarte, so kann man das westliche Abknicken in ein Urstromtal zum einem östlich von Wittenberg, zum anderen südöstlich von Perleberg erkennen. Kleinformen Neben den Hauptformen der glazialen Serie bilden sich unter sowie im Umland des Gletschers diverse kleinere Formen. Sie entstehen zum einen direkt durch die Arbeit des Gletschers, zum anderem indirekt durch dessen Schmelzwässer. Steigen die Temperaturen im Vereisungsgebiet wieder an, so wird der Gletscher zum Rückzug gezwungen. Dabei können sich kleinere Eisblöcke vom Gletscher abtrennen und als Toteiskörper unter dem Ablagerungsschutt des Gletschers noch einige Zeit bestehen. Taut schließlich auch das Toteis aus, so entstehen verschiedene Hohlformen, welche Sölle genannt werden. Wortliste Artikel Wort/ Formulierung Beispielsatz/Wendung Übersetzung oder eigene Erklärung wellig kuppig bogenförmig das Korngrößenspektrum das Sediment die Kaltphase stationär der Wall, die Wälle (Pl.) der Auflagerungsdruck der Ton der Kies das Geröll der Schmelzwasserstrom abfließend mehr oder weniger entwässern westwärts der Rückzug das Toteis die Sölle (Plural) 143
144 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie Schritt 2: Üben der Fachwörter und Formulierungen Die Bedeutungen der Wörter und Formulierungen werden zunehmend genauer in ihren Bedeutungen erfasst und formuliert. Dazu werden Lernsituationen geschaffen, die das Wiedererkennen der eingeführten Begriffe fördern. Aufgabentyp: Schreiben und Zuordnen von Wörtern zu einer Abbildung EA; Wortebene Ziel: Wortbedeutung wiederholen, Wiedererkennung von Wörtern, konkrete Schreibweise Aufgabe: Schreibe die neuen Begriffe (Minimum, Maximum, Nebenminimum, Nebenmaximum) an die richtige Stelle der Kurve. Lösung: Maximum Nebenmaximum Nebenminimum Minimum M10 144
145 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von (Fach-)wörtern und Formulierungen Aufgabentyp: Fehlende Vokale finden EA; Wortebene Ziel: Aufgabe: Lösung: Wiedererkennung von Wörtern, konkrete Schreibweisung In diesen Wörtern fehlen die Vokale. Finde sie und schreibe das Wort neu. Grndmrn; Sndr; Gltschr; strmtl; Tts Grundmoräne, Sander, Gletscher, Urstromtal, Toteis Aufgabentyp: Fehlende Konsonanten finden EA; Wortebene Ziel: Aufgabe: Lösung: Wiedererkennung von Wörtern, konkrete Schreibweise benutzen In diesen Wörtern fehlen die Konsonanten. Finde sie und schreibe das Wort neu. uoäe; ae; ee; Uoa; oei Grundmoräne, Sander, Gletscher, Urstromtal, Toteis Aufgabentyp: Definitionen schreiben und erraten EA; Wortebene, Satzebene Ziel: Definieren (Oberbegriff, charakteristische Merkmale), Wortbedeutung Vorbereitung: vorbereitete Karten je nach Gruppenzahl, auf denen jeweils ein neu eingeführtes Fachwort steht. Kommunikationsmittel zur Formulierung von Definitionen können zur Verfügung gestellt werden: Begriff Oberbegriff spezielle Merkmale / Eigenschaften / Funktionen Ein Klimadiagramm Unter emigrieren versteht man ist eine Diagrammform, das Wanderungsverhalten von Personen die das Klima eines Ortes darstellt von einem Staat in einen anderen. Aufgabe: Jede Gruppe (4 6 Personen) zieht ein Kärtchen mit einem der neuen Fachwörter. Die Gruppe schreibt eine Definition zu dem Begriff, ohne diesen zu verwenden. Beratet euch leise, denn anschließend sollen die anderen Gruppen euren Begriff erraten. 145
146 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie Aufgabentyp: Kreuzworträtsel EA; Wortebene Ziel: Hinweis: Wiedererkennung von Wörtern; konkrete Schreibweise benutzen; definieren Ein einfaches Tool zum Erstellen von Kreuzworträtseln ist Teacher s Pet, kostenlos herunterzuladen unter Aufgabe: 1. Partner A: Entwickle die Hinweise 1 4 auf deinem Bogen A für deinen Partner B zu den Lösungen deines Kreuzworträtsels. Partner B: Entwickle die Hinweise auf deinem Bogen B für deinen Partner A zu den Lösungen deines Kreuzworträtsels. Aber passt auf, dass euer Partner die Lösungen nicht sieht. 2. Partner A und Partner B: Tauscht die Rätsel aus und löst sie vollständig, auch wenn ihr bereits das Lösungswort wisst. Kreuzworträtsel Partner A O N M E Hinweise: Lösung A: N I O J A H R E S D U R C H S C H N I T T S T E M P E R A T U R T E M P E R A T U R S K A L A E D E R S C H L A G S S Ä U L E N K L I M A D I A G R A M M M E 146
147 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von (Fach-)wörtern und Formulierungen Kreuzworträtsel Partner B Ö N L G E Hinweise: Lösung B: N I J A H R E S M I T T E L T E M P E R A T U R Ö E D E R S C H L A G S S K A L A J A H R E S N I E D E R S C H L A G S M E N G E N L T E M P E R A T U R K U R V E G E M Erstellt mit Teacher s Pet 147
148 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie Aufgabentyp: Lückentext EA; Wortebene Ziel: Einüben/Wiederholen des Fachwortschatzes Variante: Lückentext mit oder ohne Wortvorgaben auf dem Textblatt bzw. Lehrertisch. Aufgabe: Ergänze die Lücken im Text mit den entsprechenden Fachbegriffen. Hinweis: Auf dem Lehrertisch liegt ein Zettel. Darauf sind die notwendigen Fachwörter aufgeführt. Du kannst selbst entscheiden, ob du diesen Zettel verwenden möchtest oder ob du (erst einmal) ohne Hilfe des Zettels die Lücken vervollständigen möchtest. Am 11. März 2011 wurde der Norden Honshus von einem schweren Erdbeben erschüttert. Wie kam es dazu? Östlich von Japan treffen zwei aufeinander, die Platte, die aus schwererem Gesteinsmaterial aufgebaut ist und die Eurasische Platte, die aus besteht. Die Platten können sich auf der Fließzone (= die Asthenosphäre), die sich unter den Platten befinden, bewegen. Bei dem Zusammentreffen der beiden Platten taucht die unter der ab. Diesen Vorgang bezeichnen die Geologen als. In großer Tiefe wird das feste Gestein der abtauchenden Platte aufgrund der hohen Temperaturen, die im Erdinneren herrschen, aufgeschmolzen. In dem Gebiet, wo die Pazifische Platte unter der Eurasischen abtaucht, entsteht ein : der Japangraben. Bei der Subduktion üben die Platten einen großen aufeinander aus. Die Grenzflächen sind spröde und rau. Dies führt dazu, dass die Grenzflächen sich beim Abtauchen der Pazifischen Platte ineinander verhaken. Die Bewegung der abtauchenden Platte wird gebremst. Dabei wird eine Druckspannung aufgebaut. Durch eine werden die verhakten Platten wieder gelöst. Dieser Vorgang führt zu einer. Der Ort, von dem die Erschütterung ausgeht und am größten ist, wird als bezeichnet. Da er sich im Fall des betrachteten Erdbebens am 11. März unterhalb des Meeresbodens östlich vor der Küste Honshus befunden hat, sprechen die Geologen von einem. Vom Erdbebenherd ausgehend breiteten sich die Erschütterungen aus. Am 11. März war die Erschütterung so stark, dass die Erdstöße das japanische Festland erreichten. Es kam im Norden von zu einem starken mit großen Schäden. Ein folgte und brachte weitere Schäden. M12 Lösungswörter (in unsortierter Reihenfolge): Druck + Erdbeben + Erdbebenherd + Erschütterung + Eurasische Platte + Honshu + leichterem Gesteinsmaterial + pazifische Platte + Platten + ruckartige Bewegung + Seebeben + Tsunami + Subduktion + Tiefseegraben 148
149 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von (Fach-)wörtern und Formulierungen Schritt 3: Anwenden der neuen Wörter und Formulierungen Die Fachsprache soll verwendet und die Lernenden zum selbständigen Gebrauch der neuen Begriffe und Formulierungen geführt werden. Die neuen, bereits bekannten Fachwörter sollen dazu in den Mitteilungswortschatz der Lernenden gelangen. Dazu sollten neue Begriffe möglichst oft und in verschiedenen Kontexten verwendet werden und Gelegenheiten geschaffen werden, den neuen Fachwortschatz und die Fachsprache zunehmend freier zu verwenden. Aufgabentyp: Laufdiktat EA; Satzebene Ziel: Konkrete Schreibweise benutzen, Hörverstehen, Gebrauch der Wörter und Formulierungen im textuellen Zusammenhang, Wiederholungen von Formulierungen, Einschleifen von Formulierungen Vorbereitung: Den Diktiertext mehrfach kopieren und so im Raum platzieren (z. B. an den Wänden), dass einerseits die Gruppen den Text nicht von ihrem Tisch aus sehen können, andererseits aber alle Gruppen einen etwa gleich großen Abstand zum Text haben. Beispiel einer Textvorlage: Beschreibung der Temperatur- und Niederschlagskurve für El Fasher (Sudan) Das Klimadiagramm von El Fasher im Sudan zeigt eine relativ konstante Temperaturkurve mit wenigen Schwankungen. Der Januar ist der Monat mit der niedrigsten Temperatur, nämlich 20 Grad. Diese steigt konstant bis zum Maximum im Juli, was bei 30 Grad liegt. Danach fällt die Temperaturkurve wieder leicht ab. Die Niederschlagskurve zeigt eine ausgeprägte aride Zeit von Oktober bis März. Im Juni steigt die Niederschlagskurve steil an, bis auf fast 140 mm im August. M13 22 Aufgabe: Bestimmt in der Zweiergruppe, wer schreibt und welche Person diktiert. Der Läufer diktiert dem Schreiber nach einem Signal den Inhalt der Textvorlage. Der Text darf dabei nicht von der Wand genommen werden. Anschließend geht die Gruppe den Text nochmals gemeinsam durch und korrigiert eventuell. Diejenige Gruppe hat gewonnen, welche am schnellsten fertig ist und am wenigsten Fehler hat. 22 Die Daten nach: ( ) 149
150 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie Aufgabentyp: Schreiben eines Textes mit Wortgerüst EA; Wort-, Satz-, Textebene Ziel: Sachlogische Darstellung von Zusammenhängen unter Verwendung der Fachwörter Aufgabe: Stelle dir folgende Situation vor: Die Schülerzeitung deiner Schule möchte in der nächsten Ausgabe das Thema Japan herausbringen. Das Team der Schülerzeitung bittet dich mitzumachen und einen Artikel über Naturkatastrophen in Japan zu schreiben. In diesem Artikel sollst du begründen, warum Japan immer wieder mit schweren Erdbeben rechnen muss. Benutze dazu alle der folgenden Fachwörter: Eurasische Platte +++ pazifische Platte leichteres Gesteinsmaterial +++ Subduktion +++ Druck +++ ruckartige Bewegung ++ + Erschütterung +++ Erdbeben +++ Erdbebenherd +++ Seebeben +++ Tsunami Aufgabentyp: Auswertung eines Klimadiagramms mit Kommunikationsmitteln EA; Satz-, Textebene Aufgabe: Schreibe einen Bericht über das Klima in Ksyl-Orda für ein Reisemagazin. Werte dazu das Klimadiagramm von Ksyl-Orda aus. Arbeitsschritte: 1. Beantworte zunächst die Fragen zum Klimadiagramm der Reihenfolge nach auf einem Extrablatt. Die folgenden Formulierungshilfen kannst du benutzen. 2. Schreibe nun für das Reisemagazin den Bericht. Darin informierst du den Leser sachlich und genau. Benutze deine Lösungssätze aus der ersten Aufgabe, die noch zusammenhanglos untereinander stehen. Verbinde aber die Sätze mit geeigneten Elementen zur logischen Satzverknüpfung (Pronomen, Konnektoren ). Du kannst auch die Sätze umstellen. C Ksyl-Orda (Kasachstan) mm 129 m ü.m. 44 N, 65 O ,1 C 114 mm J F M A M J J A S O N D M14 23 erzeugt nach Diercke Klimagraph unter Die Daten nach: und fortbildung/pages/ksyl-orda.html ( )
151 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von (Fach-)wörtern und Formulierungen Fragen an den Text Formulierungshilfe Lösungen 1. Über welchen Ort informiert das Klimadiagramm? 2. Wo liegt der Ort? In dem Klimadiagramm ist das Klima von dargestellt Das Diagramm zeigt das Klima von. Der Ort liegt auf Die geografischen Koordinaten sind Ksyl-Orda? Nordhalbkugel Folgerung: Wie kann die Lage eingeordnet werden? 3. In welcher Höhenlage liegt der Ort? 4. Wie hoch ist die Jahresdurchschnittstemperatur? 5. Wie ist der Jahresverlauf der Temperatur? z. B.: Der Ort liegt auf der Nordhalbkugel/Südhalbkugel. Er liegt Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei. Die (a) höchste / (b) niedrigste Temperatur liegt im bei 129 Meter über dem Meeresspiegel.? Juli 26 C? Folgerung: Wie groß ist die Schwankung? 6. Wie hoch ist der Jahresniederschlag? 7. Beschreibe den Jahresverlauf des Niederschlags? Folgerung: Wie viele aride (trockene) und humide (feuchte) Monate gibt es? M15 Das entspricht einer Amplitude/? Temperaturschwankung im Jahresverlauf von Der Jahresniederschlag beträgt? Der meiste Niederschlag fällt im Monat/in den Monaten mit Die höchste/niedrigste Menge fällt im /von bis mit Im fällt (besonders) viel/wenig Niederschlag, nämlich Im gibt es ein Minimum/ Maximum mit Insgesamt sind es? 151
152 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie Lösung 1: 1. Das Diagramm zeigt das Klima von Ksyl-Orda. 2. Der Ort liegt auf 44 nördlicher Breite und 65 östlicher Länge. Der Ort liegt auf der Nordhalbkugel. 3. Der Ort liegt 129 Meter über dem Meeresspiegel. 4. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 8,1 Celsius. 5. Die höchste Temperatur liegt im Juli bei 26 C. (b) Die niedrigste Temperatur liegt im Januar bei 10 C. Das entspricht einer Temperaturschwankung im Jahresverlauf von 36 Kelvin (veraltet: 36 C). 6. Der Jahresniederschlag beträgt 114 mm. 7. Der meiste Niederschlag fällt in den Monaten November bis Mai mit etwa mm im Monat. Die niedrigste Menge fällt in den Monaten Mai bis August mit maximal 5 mm. Insgesamt sind es 7 aride Monate. Lösung 2: individuell Variante: Ksyl-Orda liegt auf 44 nördlicher Breite und 65 östlicher Länge und somit auf der Nordhalbkugel. Der Ort liegt 129 Meter über dem Meeresspiegel. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt in Ksyl-Orda bei 8,1 Celsius, jedoch mit einer relativ großen Temperaturschwankung im Jahresverlauf, die bei 16 C liegt. Dabei liegt die höchste Temperatur im Juli bei 26 C und die niedrigste im Januar bei 10 C, mit einer Jahresamplitude von 36 Kelvin. Der Jahresniederschlag beträgt 114 mm und ist auch relativ ungleich über das Jahr verteilt. Der meiste Niederschlag fällt in den Monaten November bis Mai mit etwa mm im Monat. Die trockensten Monate sind die Monate Mai bis September mit maximal 5 mm Niederschlag. Insgesamt sind es 7 aride Monate. 152
153 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von (Fach-)wörtern und Formulierungen Schritt 4: Reflektion über Wörter und Formulierungen In diesem Schritt soll der Aufbau einer Wortschatzanalysekompetenz, die beim Verstehen und Lernen neuer Fachwörter und Formulierungen hilft, gefördert werden. Dazu werden die Wörter und deren Bedeutung/en in einen größeren sprachlichen Zusammenhang gebracht und ein bewusster Umgang mit Wortbildungen wird gefördert. Unter der Annahme, dass die Kenntnis von regelmäßigen Wortbildungsmustern das Verstehen von unbekannten Wörtern erleichtert und auch das Abspeichern unterstützt, wird sich schließlich auch der Mitteilungswortschatz vergrößern. 24 Beispiele und Übungen zum (Fach-)wortschatzlernen Der wesentliche Teil einer Fachsprache sind Fachwörter. Viele Wörter und damit auch Fachwörter der deutschen Sprache entstehen durch Zusammensetzung verschiedener lexikalischer Elemente oder durch Ableitungen von Wörtern. 25 Ziel der Übungen ist, dass die Schüler lernen, zur Bedeutung von Wörtern Hypothesen zu bilden, diese zu überprüfen, Hilfsmittel wie Wörterbücher zu benutzen und die Bedeutungshypothese gegebenenfalls anzupassen. Die Übungen dazu sollten nicht aus dem Kontext gegriffen werden, sondern an Texten oder Materialien anknüpfen, die zur Vermittlung oder Förderung der Fachinhalte und -methoden eingesetzt wurden. Dementsprechend beziehen sich die vorgestellten exemplarischen Übungen auf die bereits in Schritt 1 3 eingesetzten Materialen. Im Rahmen dieser Vorstellung werden verschiedene Übungen an einem Material gezeigt. Für die Unterrichtspraxis bedeutet es nicht, dass ein Text immer hinsichtlich aller sprachlichen Phänomene ausgequetscht werden soll. Das kann der Fachunterricht gar nicht leisten. Vielmehr soll exemplarisch gezeigt werden, was aus Erfahrung für sprachliche Schwierigkeiten (auch mit Blick auf die besondere Situation von Schülerinnen und Schülern nicht deutscher Muttersprache) sorgen könnte und wie diese im Geografieunterricht aufgegriffen werden können. Hierin ist natürlich auch eine Möglichkeit der fachübergreifenden Kooperation zu sehen. Die folgenden Beispiele mit ihren dazugehörigen Übungen stellen Hinweise für die Lehrkräfte dar, wie bestimmte Phänomene bewusst gemacht und erklärt werden können. 24 Nodari/Steinemann 2008, S Ebenda 153
154 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie Beispiel 1: Wortbildung durch Zusammensetzungen von Wörtern (Komposita) Ziel: Vertiefung von Strategien zur Entschlüsselung unbekannter Komposita. Info: Bei der Wortzusammensetzung werden selbständige Wörter unterschiedlicher Wortart und mit jeweils eigener Bedeutung zu einem neuen Wort kombiniert (Kompositum). In der Fachsprache kommen Komposita häufig vor, da mit ihnen Gegenständige und Sachzusammenhänge präzise und zugleich eindeutiger benannt werden können. 26 Im Prinzip kann jedes Inhaltswort mit einem anderen zusammengesetzt werden, sodass die Vielfalt weit über das Angebot von Wörterbüchern hinausgeht. Das Kompositum entsteht durch die Zusammensetzung des Grundwortes, welches auch die Wortart und den Artikel bestimmt, mit einem Bestimmungswort, das das Grundwort spezifiziert. Manchmal sind Bestimmungs- und Grundwort durch ein Fugenelement miteinander verbunden. das Klima (Nomen) lesen (Verb) bruttonational (2 Adjektive) die Bevölkerung (Nomen) gegen (Präposition) Grundwort das Diagramm (Nomen) der Text (Nomen) das Produkt (Nomen das Wachstum (Nomen) das Argument Bestimmungswort Zusammensetzung (Kompositum) das Klimadiagramm (Nomen) der Lesetext (Nomen) das Bruttonationalprodukt (Nomen) das Bevölkerungswachstum das Gegenargument (Nomen) Nodari/Steinemann 2008, S. 13
155 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von (Fach-)wörtern und Formulierungen Übung 1: Wortbildung durch Zusammensetzungen von Wörtern (Komposita) Aufgabe: Lies das Infokästchen. Ergänze dann die Tabelle mit Begriffen aus M12. Unterstreiche dabei im zusammengesetzten Wort den Artikel und das Artikelmerkmal. Kennzeichne das Fugenelement, falls eins vorhanden ist. Info: In der deutschen Sprache kann man neue Wörter bilden, indem mindestens zwei eigenständige Wörter zusammengesetzt werden. Im Prinzip kann jedes Inhaltswort mit einem anderen zusammengesetzt werden. So entsteht eine Menge an Wörtern, die nicht alle im Wörterbuch stehen können. Daher ist es wichtig zu wissen, wie Wörter zusammengesetzt werden können. Das erleichtert das Verstehen des neuen Wortes: Bei dem Wort Erdbeben passiert z. B. Folgenden: die Erde + das Beben = das Erdbeben Bestimmungs- Grundwort wort Beben ist dabei das Grundwort. Es zeigt den Artikel und auch die Wortart der neuen Zusammensetzung und natürlich auch, wovon der neue Begriff handelt, nämlich von einem Beben. Erde ist das Bestimmungswort, das das Grundwort spezifiziert, also ein Beben, das unter der Erde passiert. Das zweite e in Erde wird gestrichen. Manchmal sind Bestimmungs- und Grundwort aber durch ein Fugenelement (z. B. -s oder -n) miteinander verbunden. das Gestein (Nomen) Grundwort das Material (Nomen) Bestimmungswort Zusammensetzung (Kompositum) das Gesteinsmaterial (Nomen) M16 155
156 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie Lösung: Bestimmungswort/-wörter Grundwort Zusammensetzung (Kompositum) das Gestein (Nomen) das Material (Nomen) das Gesteinsmaterial fließen (Verb) die Zone (Nomen) die Fließzone zusammen (Adjektiv) treffen (Verb) das Zusammentreffen (Nomen) die Erde (Nomen) das Innere das Erdinnere (Nomen) tief (Adjektiv); die See (Nomen) der Graben (Nomen) der Tiefseegraben (Nomen) die Grenze (Nomen) die Fläche (Nomen) die Grenzfläche (Nomen) der Druck (Nomen) die Spannung (Nomen) die Druckspannung (Nomen) die See (Nomen) das Beben (Nomen) das Seebeben (Nomen) die Erde (Nomen), das Beben (Nomen) der Herd (Nomen) der Erdbebenherd die Erde (Nomen) die Stöße (Plural, Nomen) die Erdstöße fest (Adjektiv) das Land (Nomen) das Festland (Nomen) 156
157 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von (Fach-)wörtern und Formulierungen Beispiel 2: Begriffsnetze zum Speichern und Systematisieren des Fachwortschatzes: Wortfamilie Ziel: Info: Systematischer Aufbau des Fachwortschatzes durch Kategorisierung und Systematisierung Alle Begriffe, die den gleichen Wortstamm und ein gemeinsames lexikalisches Morphem (= kleinste Spracheinheit, der eine Bedeutung oder grammatische Funktion zugeordnet ist) haben, gehören zu einer Wortfamilie. Dies beinhaltet auch Begriffe, die unterschiedliche Wortarten umfassen. Ihnen ist also dasselbe Stammwort gemeinsam. Übung 2: Begriffsnetze zum Speichern und Systematisieren des Fachwortschatzes: Beispiel Wortfamilie Aufgabe: Vervollständige die Karteikarte mithilfe eines Wörterbuchs. Zusammensetzungen mit dem Ausgangswort als Bestimmungswort das Siedlungsverhalten?... Wortbildung durch Ableitung von anderen Wörtern, z. B. Endungen? die Siedlung der Siedler/die Siedlerin siedeln, sich ansiedeln,? Zusammensetzungen mit dem Ausgangswort als Grundwort die Großsiedlung?... Die Siedlung Lindenhof ist eine Wohnsiedlung im äußersten Süden des Berliner Ortsteils Schöneberg.?... Sätze und Definitionen, in denen Ausgangswort oder Zusammensetzungen vorkommen 157
158 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie Beispiel einer Karteikarte: Zusammensetzungen mit dem Ausgangswort als Bestimmungswort das Siedlungsverhalten die Siedlungsgeografie die Siedlungsform Wortbildung durch Ableitung von anderen Wörtern, z. B. Endungen besiedelbar die Siedlung der Siedler/die Siedlerin siedeln, sich ansiedeln, umsiedeln Zusammensetzungen mit dem Ausgangswort als Grundwort die Großsiedlung die Wohnsiedlung die Kleingartensiedlung Die Siedlung Lindenhof ist eine Wohnsiedlung im äußersten Süden des Berliner Ortsteils Schöneberg. Städtische Siedlungen wachsen stark. Viele internationale Unternehmen haben sich angesiedelt. Sätze und Definitionen, in denen Ausgangswort oder Zusammensetzungen vorkommen Beispiel 3: Wortbildung durch Ableitungen Ziel: Vertiefung der Wortbildungskompetenz durch Reflexion über die Funktion von Adjektivendungen Info: Mit Hilfe von bestimmten Silben können in der deutschen Sprache neue Wörter gebildet (in diesem Fall abgeleitet) werden. Abhängig davon, ob die Ableitungssilbe vor oder hinter dem Grundwort steht, handelt es sich um Prä- bzw. Suffxe. Die Prä- und Suffxe transportieren oft Bedeutungen und Wortartenmerkmale. Präfix Grundwort Suffx Ableitung siedeln -ung die Siedlung be wohnen bewohnen erklären -bar erklärbar ein das Heim -isch einheimisch 158
159 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von (Fach-)wörtern und Formulierungen Übung 3: Wortbildung durch Ableitungen: Beispiel Adjektivendungen (zu M8/9) Hinweis: Weitere Übungen zur Wortbildung durch Ableitung könnten folgende sprachliche Phänomene aufgreifen: Ableitungsendungen (Suffxe), die Nomen erzeugen (z. B. -ung (die Überschwemmung); Ableitungsvorsilben (Präfixe), die die Bedeutung von Verben konkretisieren oder verändern, z. B. ver- (vergleichen), ab- (abnehmen) Aufgaben: 1.1 Suche in den Texten M8 und M9 Adjektive mit den Endungen -ig, -lich und -isch im Text (Beispiel wellig). Erkläre die Bedeutung jeweils eines Beispiels mit diesen Endungen. 1.2 Welche Funktion haben die Endungen -ig, -lich und -isch gemeinsam. 2.1 Nenne weitere Endungen, die Adjektive erzeugen? Suche Beispiele für diese Endungen. 2.2 Erkläre die Adjektive mit deinen eigenen Worten: zählbar: feststellbar: funktionslos: arbeitslos: 2.3 Leite die Bedeutung der Endungen -bar und -los ab. 3 Erkläre den Unterschied: lösbar löslich (Hilfe: Bilde zuerst mit jeweils beiden Adjektiven einen Satz.) Lösung: Zu 1.1: individuelle Erklärungen z. B. von bogenförmig, kuppig, hügelig, schematisch, polnisch, westlich, nördlich Zu 1.2: Mithilfe dieser drei Ableitungsendungen (Suffxe) werden aus Substantiven Adjektive abgeleitet. Alle drei sind Endungen zur Adjektivierung mit der Bedeutung, dass das vom Wortstamm Bezeichnete vorhanden ist. Zum Beispiel: hügelig = Hügel sind vorhanden; bogenförmig = geformt wie ein Bogen. Zu 2.1: z. B. für weitere Ableitungsendungen, die Adjektive erzeugen, sind: -bar (trinkbar), -isch (geografisch), -los (mittellos), Zu 2.2: zählbar: wenn man es zählen kann / etwas, das man zählen kann; feststellbar: wenn man es feststellen kann / etwas, das man feststellen kann; funktionslos: wenn etwas ohne Funktion ist / etwas, das nicht funktioniert; arbeitslos: wenn jemand ohne Arbeit ist bzw. keine Arbeit hat / jemand, der keine Arbeit hat bzw. ohne Arbeit ist Zu 2.3: Die Endung beschreibt, dass das vom Wortstamm Bezeichnete fehlt (-los = ohne). Zu 3: Beispiel: Löslich bedeutet, dass sich etwas auflösen kann (z. B. ist Salz löslich) und beschreibt den Zustand. Lösbar bedeutet, dass man etwas lösen kann, es also zu lösen ist (Probleme sind lösbar). 159
160 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie Übung 4: Textvergleich EA; Satz- bzw. Textebene Ziel: Aufgabe: Sensibilisierung für die Verwendung der Fachbegriffe zur präzisen Darstellung von Vernetzungswissen Die Schülerinnen und Schüler einer 7. Klasse haben sich ebenfalls mit der Auswertung von Klimadiagrammen beschäftigt und dabei Begriffe wie arid und humid gelernt. Nun bekommen sie die Aufgabe, das Klimadiagramm von Rom auszuwerten. Lies dir die beiden Schülerantworten durch. Begründe, welche du für die bessere Antwort hältst. Werte das Klimadiagramm von Rom aus! Antwort Schüler a): Das Diagramm zeigt Rom und man erkennt, dass die Temperaturkurve allmählich ansteigt, im Juni die Niederschlagskurve teilt und ab September wieder unter die Niederschlagskurve fällt. Die Niederschlagskurve fängt im Januar bei über 80 mm an, sinkt im Juli auf unter 20 mm und steigt dann wieder an mit einem Höchststand von über 120 mm im Oktober. Die Temperatur steigt von 9 Grad Celsius im Januar auf 25 Grad im Sommer und fällt dann wieder bis September. Antwort Schülerin b): Das Klimadiagramm für Rom zeigt eine ausgeprägte aride Zeit im Juli und August bei Temperaturen von deutlich über 20 Grad Celsius und Niederschlagswerten von unter 20 mm. Die übrige Jahreszeit ist durchweg humid bei einem Niederschlagsmaximum von über 120 mm im Oktober und monatlichen Durchschnittstemperaturen, die auch in der kalten Jahreszeit nicht unter 9 Grad Celsius fallen. M17 27 Lösung: individuell Es sollte dabei herausgearbeitet werden, dass die Antwort von Schülerin b) deutlich sachgerechter ist, da hier die Fachbegriffe richtig eingebunden sind. Mit der Verwendung der Fachbegriffe ist ihre Aussage deutlich präziser. Schüler a) beschreibt dagegen zwar den Verlauf der Kurven richtig und auch ihr Verhältnis zueinander, von dem man auf eine aride und humide Zeit schließen kann. Jedoch benennt er dies nicht schlussfolgernd Die Texte wurden erstellt in Anlehnung an die Schülerbeispiele vgl. auch Czapek 2000, S. 30.
161 Möglichkeiten des Aufbaus/Trainings von (Fach-)wörtern und Formulierungen Schritt 5: Testen Das Testen als letzter Schritt der (Fach-)wortschatzarbeit ist eine logische Folgerung, wenn Wortschatzarbeit als Prinzip im Unterricht umgesetzt wird. Wenn, wie bereits in Kapitel 1 darauf hingewiesen wurde, die sprachliche Qualität in die Note miteinfließt, stellt sich eigentlich gar nicht die Frage, ob und warum die Fachwortschatzarbeit nicht auch in Leistungsüberprüfungen verbindlich gemacht werden soll. Es trägt im selben Maß zum nachhaltigen Lernen und zur Ergebnissicherung bei wie inhaltliche und methodische Kompetenzüberprüfungen. Die Überprüfung bezieht sich hier auf den Fachwortschatz, der im vorangegangenen Unterricht erarbeitet wurde. Hierzu eignen sich Aufgabenformate, die zum Teil bereits in Schritt 1 4 dargestellt wurden: Zum Testen von Fachwörtern eigenen sich z. B. Lückentexte, Beschriftungen von Abbildungen, Kreuzworträtsel. Ein weiteres Beispiel sind Multiple-Choice-Aufgaben, die konkret die eingeführten Fachwörter oder sprachliche Phänomene testen. Aufgabentyp: Multiple-Choice Aufgabe: Kreuze die richtigen Aussagen zum Diagramm M3 an. 1. Das Wasservolumen des Aralsees betrug 1960 etwas über km³. ist 1960 etwas über km³. belief sich 1960 etwas über km³. 2. Das Wasservolumen des Aralsees sank von 1960 bis 1984 stark. verringert sich stark von 1960 bis wies von 1960 bis 1984 eine leicht sinkende Tendenz auf. 3. Das Wasservolumen des Aralsees halbierte sich von 1960 bis 1984 von ungefähr km³ bis etwa 500 km³. von ungefähr km³ auf etwa 500 km³. von ungefähr km³ nach etwa 500 km³. 4. Insgesamt nahm die Fläche des Aralsees von 1985 bis 1992 auf ungefähr ein Viertel ab. um ungefähr ein Viertel ab. 161
162 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie Lösung: 1. betrug 1960 etwas über km³; 2. sank stark; 3. halbierte sich von 1960 bis 1984 von ungefähr km³ auf etwa 500 km³; 4. um ungefähr ein Viertel. Freiere Aufgabenformate bedienen ein höheres Anforderungsniveau. Beispielsweise müssen die Lernenden den Fachwortschatz in sachlogischen Zusammenhängen eigenständig darstellen. Sie erbringen somit eine Transferleistung (AFB 2 und 3). Beispiel 1: Transferaufgabe Aufgabe: Beurteile die Aussage im Kasten aus der Sicht der Geografie. Wende dabei deine Kenntnisse aus dem Unterricht zu den Ursachen für Erdbeben in Japan an. Dem japanischen Volksglauben nach bestraft der riesenhafte Katzenfisch Namazu, der tief in der Erde lebt, die Menschen für ihr lasterhaftes Leben. Dies tut er, indem er durch seine Bewegungen die Erde erschüttern lässt. Benutze dazu alle der folgenden Fachwörter: Eurasische Platte +++ Pazifische Platte +++ leichteres Gesteinsmaterial +++ Subduktion +++ Druck +++ ruckartige Bewegung ++ + Erschütterung +++ Erdbeben +++ Erdbebenherd +++ Seebeben +++ Tsunami 162
163 3 Aufgabenformulierung im Geografieunterricht Aufgabenstellungen werden oftmals von Schülerinnen und Schülern (sprachlich begründet) nicht richtig oder nur unzureichend verstanden. In schriftlichen Leistungsüberprüfungen führt dies zu Punktabzügen, obwohl gegebenenfalls der Lernende den sachlichen Inhalt oder die überprüfte methodische Kompetenz aufzeigen könnte. Oftmals erfährt die Lehrkraft die Ursache für das Scheitern an der Aufgabe jedoch nicht. Auch im Unterrichtsgeschehen werden Antworten, die sich nicht konkret auf die Aufgabe oder Fragestellung beziehen, mit der Aufforderung abgetan, bitte doch die Aufgabenstellung richtig zu lesen. Erst später wird manchmal klar, dass der Lernende Schwierigkeiten hatte, die Aufgabe sprachlich zu verstehen und dass ihr oder ihm Strategien zur sprachlichen Entfaltung der Aufgabe fehlen. Dass allein schon die sprachliche Formulierung den Erfolg eines Lernschritts behindern kann, stellte sich auch bei einem langwierigen Testprozess heraus Die Arbeit mit Operatoren Genaue Handlungsanleitungen für die Schülerinnen und Schüler sind im Unterricht unabdingbar. Eine wichtige Rolle spielen dabei Operatoren. Dies sind Verben gleichsam Schlüsselwörter, die den Schülerinnen und Schülern signalisieren, was sie bei einer Frage oder einer Aufgabe konkret tun sollen, und zwar sowohl im Unterrichtsgespräch als auch in schriftlichen Arbeitsaufträgen. Wird eine Aufgabe unklar formuliert, führt dies zu Verunsicherung oder gar zu Missverständnissen, da das Ziel des Auftrags unklar bleibt. Eine Frage wie zum Beispiel: Welche Ursachen hatte die Französische Revolution? lässt offen, ob die Schülerinnen und Schüler diese Ursachen einfach aufzählen sollen oder ob sie einen Text durchlesen, nach den dort erwähnten Ursachen suchen und diese dann beschreiben sollen. Möglich wäre auch, dass sie die Ursachen erklären, begründen oder diskutieren sollen. Nur leistungsstarke Schülerinnen und Schüler werden einen solchen Arbeitsauftrag so ausführen, dass möglichst viele der zu vermutenden Absichten der Lehrkraft dabei erfüllt werden. Operatoren präzisieren das Ziel von Arbeitsaufträgen, sorgen dabei für Orientierung und erleichtern die Bearbeitung von Aufgaben. Manche Lehrwerke enthalten daher Listen von Operatoren 28 Birkenhauer 2005, S
164 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie und erklären in einer für Schülerinnen und Schüler verständlichen Alltagssprache, welche geforderte Handlung mit dem jeweiligen Operator verbunden ist. Auch die Konferenz der Kultusminister (KMK) hat für einige Fächer Operatoren insbesondere für die Verwendung in der Sekundarstufe II bzw. bei der Erstellung von Klausuraufgaben zusammengestellt. Diese Listen bleiben jedoch stets fachspezifisch und sind daher als Orientierung für Schülerinnen und Schüler gerade der Sekundarstufe I nur bedingt geeignet. So gibt es z. B. für den Operator analysieren in unterschiedlichen Fächern verschiedene Definitionen. Für Schülerinnen und Schüler ist dies sehr irritierend, und das erst recht, wenn verschiedene Lehrkräfte eines Faches überdies unterschiedliche Aspekte der geforderten Tätigkeit für wichtig halten. Es wäre daher gut, wenn in einem Kollegium eine Einigung darüber hergestellt würde, welche Operatoren fachübergreifend verwendet werden können. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich nämlich, dass viele Operatoren einen gemeinsamen Bedeutungskern haben. Die vorliegende Liste von Operatoren aus den Bereichen Natur- und Gesellschaftswissenschaften sowie Deutsch, Englisch und Mathematik stellt den exemplarischen Versuch dar,» aus den in den einzelnen Fächern genutzten Operatoren diejenigen herauszufiltern, die in allen Fächern verwendet werden. Es wurde also eine Schnittmenge gebildet;» aus den in den Fächern genannten Definitionen den ihnen allen gemeinsamen Kern herauszufiltern;» die so gefundenen Operatoren in einer für Schülerinnen und Schüler verständlichen Sprache zu formulieren. Der Gewinn liegt in der Möglichkeit einer breiten Anwendung dieser Operatoren in vielen Fächern. Operator nennen, angeben beschreiben vergleichen erklären erläutern begründen analysieren, untersuchen diskutieren, erörtern beurteilen Handlung Informationen aufzählen, zusammentragen, wiedergeben Sachverhalte, Objekte oder Verfahren mit eigenen Worten darstellen Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln und darstellen Sachverhalte verständlich und nachvollziehbar machen und in Zusammenhängen darstellen Einen Sachverhalt darstellen und unter Verwendung zusätzlicher Informationen veranschaulichen Sachverhalte, Entscheidungen bzw. Thesen durch nachvollziehbare Argumente stützen und sachlich (beispielhaft) belegen Unter einer Fragestellung wesentliche Bestandteile, Ursachen oder Eigenschaften herausarbeiten bzw. nachweisen Sich argumentativ mit verschiedenen Positionen auseinandersetzen und ggf. zu einer begründeten Schlussfolgerung gelangen Zu Sachverhalten eine selbstständige Einschätzung formulieren und begründen 164
165 Aufgabenformulierung im Geografieunterricht 3.2 Satzstrukturen Auch das sprachliche Verstehen auf der Satzebene bereitet Probleme. Es fällt auf, dass viele der exemplarischen Operatoren aus trennbaren Verben bestehen. Auf syntaktischer Ebene sollte den Lernenden diese Verbklammer verdeutlich werden. Schwierigkeiten ergeben sich u. a. durch einen hypotaktischen Satzbau, die Verwendung Partizipial- und Präpositionalgruppen. Hier gilt für die Aufgabengestaltung die Maxime Je schlichter ein Satz sprachlich formuliert wird, umso besser sind die Schüler in der Lage, den Satz zu verstehen. 29 Folgende Gegenüberstellung soll die Unterschiede zwischen gelungenen und weniger gelungenen Aufgabenkonstruktionen verdeutlichen: Aufgaben vorher nachher Operatoren statt Welche Hauptelemente der glazia- Ordne dem Blockbild die Haupt- W-Fragen len Serie findest du im Blockbild? elemente der glazialen Serie zu. Schülerinnen und Schüler erhalten durch den Operator eine klare Handlungsanweisung. Sprachliche Kon- Beurteile, ob es richtig ist, dass 1. Lies den Infokasten über den zentration statt dem japanischen Volksglauben japanischen Volksglauben. Schachtelsatz nach der riesenhafte Katzenfisch Namazu, der tief in der Erde lebt, die Menschen für ihr lasterhaftes Leben bestraft, indem er durch seine Bewegungen die Erde erschüttern lässt. Schülerinnen und Schüler müssten erst die hypotaktische Struktur der Aufgabenstellung verstehen und auflösen, um die Aufgabe zu beantworten. Komplexe grammatikalische Strukturen bereiten allerdings oft Schwierigkeiten. 2. Beurteile die Aussage im Kasten aus der Sicht der Geografie. 3. Wende dabei deine Kenntnisse aus dem Unterricht zu den Ursachen für Erdbeben in Japan an. Schülerinnen und Schüler können die einzelnen Arbeitsschritte auf Grund der Ein-Satz-Konstruktion schneller und einfacher erfassen. Eindeutigkeit Wo liegt Ksyl-Orda? Bestimme die Lage von Ksyl-Orda statt Schülerinnen und Schüler könn im Gradnetz. Vieldeutigkeit ten als Antwort u. a. in Europa, in Kasachstan, auf der Nordhalbkugel, auf der Welt auch die geografischen Koordinaten nennen. Schülerinnen und Schüler wissen, dass konkrete Angaben zu geografischen Koordinatoren verlangt werden. Offene Hat Ksyl-Orda ein extrem kontinen- Begründe, ob Ksyl-Orda ein extrem Fragestellungen tales Klima? Schülerinnen und Schüler können auf diese Entscheidungsfrage nur mit ja oder nein antworten. kontinentales Klima hat. Schülerinnen und Schüler müssen Pro- und Kontra-Argumente anführen und daraus eine Entscheidung ableiten. 29 Ebenda 165
166 Sprachsensibler Fachunterricht Geografie Aufgaben vorher nachher Transfer statt Beschreibe das Klima in Ksyl-Orda. Stell dir vor, dein Freund deine Reproduktion Freundin hat eine Einladung zu Schülerinnen und Schüler geben die wesentlichen klimatischen Merkmale wieder. (AFB 1) einem Geografie-Wettbewerb nach Ksyl-Orda bekommen. Er fragt dich in einer , mit welchem Wetter er rechnen muss. Dementsprechend möchte er seinen Koffer packen. Du weißt nicht, ob er im Sommer oder Winter fährt. Schreibe eine an deinen Freund/deine Freundin und beschreibe ihm das Klima im Jahresverlauf. Gib Ratschläge, was er an Garderobe einpacken muss. Schülerinnen und Schüler übernehmen die Perspektive einer fiktiven Person, müssen deren Gedanken übernehmen, geben erläuternd die klimatischen Gegebenheiten wieder und leiten perspektivisch die Folgen für die Reisegarderobe ab. (AFB 1 3) 166
167 Literatur Birkenhauer, Josef (2005): Sprache und Begriffichkeit im Geographieunterricht. In: Praxis Geographie, 35 (2005)1, S Czapek, Frank-Michael (2000): Begriffs- und Sprachbildung als Prinzip des Geographie- Unterrichts. Gedanken zum lernstrukturellen Profil des Fach-Unterrichts. In: Geographie und Schule, 22 (2000) 124, S Deutsche Gesellschaft für Geographie (2012) (Hrsg.): Bildungsstandards im Fach Geographie für den Mittleren Schulabschluss. 7. Aufl., Bonn Giese, Ernst/Bahro, Gundula/Betke, Dirk (1998): Umweltzerstörungen in Trockengebieten Zentralasiens (West- und Ost-Turkestan). Ursachen, Auswirkungen, Maßnahmen. Stuttgart: Franz Steiner Haubrich, Hartwig (2006) (Hrsg): Geographie unterrichten lernen. Die neue Didaktik der Geographie konkret. München: Oldenbourg Koppe, Wolfgang (2012): Geographie Infothek, Leipzig: Klett Nodari, Claudio/Steinmann Cornelia (2008): Fachdingsda Fächerorientierter Grundwortschatz für das Schuljahr. Lehrmittelverlag des Kantons Aargau Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin (2006) (Hrsg.): Rahmenlehrplan Geografie für die Sekundarstufe I. Berlin 167
168
169 Wortschatzarbeit im Geschichtsunterricht Christoph Hamann, Thomas Krehan
170
171 1 Fachdidaktische Überlegungen Man muss so viel lesen. Es gibt Unklarheiten. Der Gegenstand des Unterrichts im Fach Geschichte existiert nicht mehr die Vergangenheit. Die Geschichte als Darstellung einer sinnvollen Erzählung vom Wandel in der Zeit ist deshalb notwendig sprachlich vermittelt. Geschichte ist Text. Schülerinnen und Schüler bleibt also nur eines: Geschichtsunterricht heißt Texte lesen gleichviel ob dies Quellen oder Darstellungen sind. Aus den Quellen sind Informationen zu ermitteln, sie sind zu interpretieren, in historische Zusammenhänge zu stellen und zu beurteilen. Denn nur in der Form von Geschichte(n) kann Vergangenheit vergegenwärtigt werden. Unzweifelhaft also ist: Lesekompetenz ist Voraussetzung und Teil historischer Kompetenz. 1 Unzweifelhaft ist ebenso: Das Verfügen über einen Wortschatz ist Voraussetzung und Teil der Lesekompetenz. Die Lernenden: die Kompetenz der Schülerinnen und Schüler Man muss soviel lesen. Es gibt Unklarheiten. (Man weiß nicht, was gemeint ist.) 2 urteilt der 11-jährige Ole über seinen Geschichtsunterricht. Diese subjektive Einschätzung bringt eine persönliche Erfahrung zum Ausdruck, mit denen Lehrkräfte alltäglich konfrontiert sind. Sie spiegelt sich auch in den Ergebnissen von internationalen wie nationalen Evaluationsstudien zur Lesekompetenz. Bei den 15-Jährigen in Deutschland liegen die mittleren Leistungen deutlich unter dem OECD-Durchschnitt. Die Ergebnisse der Evaluationsstudien lassen begründet vermuten, dass die wie ebenfalls immer wieder durch empirische Studien festgestellt wird gleichermaßen wenig befriedigenden Leistungen der Lernenden im Unterrichtsfach Geschichte auch in der durchschnittlich gering entwickelten Lesekompetenz ihre Ursache haben können. Die Förderung der Wortschatzarbeit ist also auch im Fach Geschichte notwendiger Bestandteil des Unterrichts, die Schwierigkeit des Lesens und des schlichten Verstehens der Schulbuchtexte (muss) endlich ganz ernst genommen werden 3. Dies betriff die syntaktische Ebene, jedoch aber auch das lexikalische Lernen: die Alltagssprache einerseits wie auch die Fachsprache andererseits. 1 Günther-Arndt 2003, S. 256; vgl. auch Borries 2005, S Meyer-Hamme 2006, S. 93; vgl. Langer-Plän 2003, S Borries 2005, S
172 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte Das Lernmedium: die Komplexität der Texte Die Kompetenz der Lernenden sind die eine Seite, der Schwierigkeitsgrad des Lernmediums eine andere. Die Forderung nach mehr Lesetraining, das lexikalische Lernen sowie das Einführen wie Üben bildungssprachlicher Wendungen im Geschichtsunterricht wird zwar folgerichtig gestellt. All dies steht aber dann vor großen Hürden, wenn das Niveau der Texte in den Lehrbüchern für Geschichte die Lernenden objektiv überfordert. Und empirische Untersuchungen zu dem Medium, welches nach wie vor im Geschichtsunterricht dominant ist, legen auch dies nahe. Befragungen haben ergeben, dass ein großer Anteil der Kinder und Jugendlichen durch ihre jeweiligen Geschichts-Schulbücher kognitiv krass überfordert wird (und zwar bereits auf einer ganz elementaren Ebene des oberflächlichen Verstehens im Sinne zuverlässiger Informationsentnahme) 4. In einem zufällig gewählten Lehrbuch Geschichte (Gymnasium) der Jahrgangsstufen 9/10 finden sich in dessen Register rund 500 Fachbegriffe, von denen rund 90 in einem Begriffslexikon erklärt werden. Dies spricht für eine Vereinfachung der Darstellungstexte einerseits und einen gezielten Einsatz von Arbeitsanregungen zur Aneignung des Fachwortschatzes in den Lehrwerken andererseits. Gleichwohl stößt dieser Anspruch bei Quellentexten an Grenzen. Diese lassen sich schwer vereinfachen, ohne dass diese dabei zum bloß bestätigenden historischen Beleg für die Interpretation des Darstellungstextes werden. Ist ein solcher Grad der Vereinfachung erreicht, dann ist auch der Anspruch auf die Arbeit mit Quellen und damit in einem Teilbereich des historischen Lernens auch die Kompetenzorientierung hinfällig. Der Lerngegenstand: die Geschichte als schwach strukturierte Domäne Begriffe fügen sich in vielen Domänen in ein System von Klassifizierungen, Hierarchisierungen und Abstraktionsgraden ein: Die Unterscheidung zwischen Baum Laubbaum Eiche folgt zum Beispiel dem Prinzip zunehmender Konkretisierung und abnehmender Abstraktion. Die Begriffe Angebot und Nachfrage aus der Ökonomie sind Unterbegriffe des Oberbegriffs Markt. Sie ordnen und strukturieren damit einerseits die (in unseren Beispielen natur- oder wirtschaftswissenschaftliche) Domäne und erleichtern damit aus kognitionspsychologischer Sicht das Lernen. Historische Fachbegriffe dagegen lassen sich nur schwer klassifizieren, in Systeme einordnen, in denen sie dann ähnliche Seinsbereiche oder bestimmte Ebenen verschiedener Abstraktionsniveaus repräsentieren 5. Im Feld des Historischen dominieren die singulären Ereignisse und Sachverhalte, das Individuelle, das Einmalige und Besondere. Und die Fachwörter zu der Benennung des Singulären beziehen sich eben häufig nur auf dies und sind von daher selten übertragbar. Und wenn sie übertragen werden, dann bezeichnen sie in dem veränderten historischen Kontext ebenfalls etwas Verändertes. Die Eigenart historischer Begriffe lässt sich auf verschiedenen Ebenen beschreiben: Historische Begriffe a. bezeichnen häufig das eben nicht mehr Beobachtbare, das Vergangene (z. B. Zunft, Patrizier), und sind als solche kognitive Konstruktionen und Oberbegriffe, die z. B. durch die Beschreibung von deren Einzelmerkmalen (in unserem Beispiel: Tätigkeiten, Rechte und Status) konkretisiert und fassbar gemacht werden müssen; Borries 2005, S. 17; vgl. auch Meyer-Hamme 2006, S. 95; Länger-Plan 2003, S Länger-Plan/Beilner 2006, S. 223
173 Fachdidaktische Überlegungen b. unterliegen in ihrer Semantik selbst einem zeitlichen Wandel und sind von daher ebenso historisch wie dasjenige, was sie benennen wollen. Die Begriffe König, Adel oder Bürger bezeichnen in unterschiedlichen Epochen Unterschiedliches: Das Amt Königs Otto I. ( ) unterscheidet sich in seiner Stellung und seinen Funktionen grundlegend von dem den Königs Juan Carlos I. (*1938) von Spanien; c. unterliegen in ihrer Semantik auch kulturellen Unterschieden: Sind zum Beispiel die Königsherrschaften in Japan, Afrika und Europa dasselbe? d. werden je nach Perspektive und (persönlichem, zeitlichem, sozialem ) Standort unterschiedlich definiert, weil sie nicht konkrete Sachverhalte einfach abbilden, sondern selbst schon Deutungen sind (z. B. Nationalsozialismus, Faschismus, Sozialismus, Imperialismus); e. haben als Oberbegriffe mitunter eine große Reichweite, sind aber in der Abstraktion und Aggregation vieler Einzelmerkmale schwer umfassend mit historisch Konkretem zu untersetzen (z. B. Arbeiterklasse, Dritter Stand, Veto-Politik); f. entstammen nicht selten der Alltagssprache und sind auch von daher einerseits vieldeutig oder werden deswegen andererseits nicht als erklärungsbedürftige Begriffe erkannt (z. B. Herrschaft, Prozess ); g. werden in der Alltagssprache, in der Fachsprache wie auch in der Sprache der Quellen genutzt und können je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen haben (z. B. Revolution); h. können historisch Einmaliges benennen, zugleich aber auch symbolhaft auf größere Zusammenhänge verweisen (z. B. der Kreml, Nine Eleven ). Konkretion und Abstraktion Das Lernen von historischen Fachwörtern muss aufgrund dieser semantischen Herausforderungen immer kontextbezogen erfolgen: König Otto I. ( ) hatte diese und jene Rechte und Pflichten. Von König Otto I. kann dann auf die Königsherrschaft im Hochmittelalter geschlossen werden. Im 10. Jahrhundert ist ein König ein Mann, der diese und jene Rechte und Pflichten hatte. Für das historische Lernen ist aber von Bedeutung, dass die Definition des Begriffs zwar einerseits konkret und eindeutig sein muss, zugleich aber auch so offen sein sollte, dass ein Transfer auf andere historische Kontexte möglich bleibt. Wenn denn der Begriff König zum Beispiel auch auf Juan Carlos I. von Spanien (*1938) angewendet werden soll, dann muss er für Lernende so definiert werden, dass er die im Vergleich zu Otto I. unterschiedlichen Merkmale seines Amtes unter dem Oberbegriff integrieren kann. Der Weg des Lernens historischer Fachwörter geht also, wie das Lernen schlechthin, einen Dreischritt: von der Anschauung zum Begriff und dann wieder zur Anschauung, vom historisch Konkreten zum Abstrakten und dann wieder zum historisch Konkreten. Kontextbezogenes lexikalisches Lernen meint auch, den Gebrauch der Wörter im Zusammenhang mit den sprachlichen Wendungen zu sehen, in denen diese genutzt werden. So wird dem König gehuldigt. Der König trägt eine Krone. Der König herrscht in seinem Reich. Der König verteidigt mit seinem Schwert und den Vasallen sein Reich. Der König reist von Pfalz zu Pfalz. Das Anwenden des Wortes in sprachlichen Wendungen festigt die Wahrnehmung und das Behalten des semantischen Kerns des Wortes, übt bildungssprachliche Formulierungen und verbindet Fachsprache mit Standardsprache. Aus dem rezeptiven wird der produktive Wortschatz. 173
174
175 2 Königsherrschaft im Mittelalter Die Krönung Ottos I. eine Sequenz zur Einführung, Festigung und Anwendung des Fachwortschatzes Die Arbeit am Wortschatz der Lernenden ist eine Aufgabe, die den Unterricht kontinuierlich bei jedem Thema begleiten muss. Denn die Fachbegriffe sind wie auch die sprachlichen Wendungen, in denen diese gebraucht werden, jeweils neu. Die vorliegende sprachsensible Sequenz über die mittelalterliche Königsherrschaft ist in diesem Sinne ein Beispiel für die Anwendung von Aufgabentypen zur Wortschatzarbeit und auch für andere thematische Zusammenhänge. Schülerinnen und Schüler eines 7. Jahrgangs erfassen den Vorgang der mittelalterlichen Königswahl Otto I. anhand einer längeren Quelle, können diese verstehen, analysieren und ihre Ergebnisse sowie erste Interpretationen in einem zusammenhängenden Text darstellen. Da die Quelle auch Wortmaterial enthält, das den Lernenden nicht geläufig ist, helfen ihnen verschiedenen Aufgabentypen (z. B. Heraussuchen und Zuordnen, Umformulieren, Rollenspiel, Brief schreiben, Fragen zu einem Film beantworten), sich ein genaueres Verständnis des Inhaltes der Quelle zu erarbeiten. Gleichzeitig lernen die Schülerinnen und Schüler einen Fachwortschatz kennen, üben ihn und wenden ihn vielfältig an. Dabei werden zunächst komplexe eigene Sprachleistungen vermieden. Deshalb stehen vor allem die eigene Sprachrezeption sowie die Anwendung von Operatoren im Mittelpunkt. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie in fünf Schritten Wortschatzarbeit im Geschichtsunterricht in Verbindung mit der Analyse einer umfangreichen Quelle betrieben werden kann. 175
176 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte Fünf-Schritt-Methode der Wortschatzarbeit (Synopse) Schritte Wortschatzaktivierung als Voraussetzung, Formulierungen Fachwörter zu einem Thema einführen Fachwörter und Formulierungen üben Fachwörter in Sprachwendungen benutzen lassen Über Wörter reflektieren Testen Aufgabentypen Fachwörter im Kontext von Formulierungen, Fachwörter in Buchstabengitter finden, Wortfelder erstellen bekannte Fachwörter in Texten markieren, neue Begriffe zu bekannten Wortfeldern markieren, Bild beschriften Bild beschriften, Begriffe in ein Schaubild einordnen, Buchstabensalat entwirren (Fachbegriffe rekonstruieren), zu vorgegebenen Erklärungen Fachwörter und Wortverbindungen suchen, Lückentext ausfüllen Rollenspiel, einfache Quellenanalyse unter Zuhilfenahme von Satzmustern anfertigen, Fachwörter in eigenen Formulierungen verwenden, einen kurzen Vortrag halten, einen Brief schreiben Karteikarten zu Wortfamilien anfertigen Bilder beschriften, logische Reihenfolge von Abläufen herstellen, Lückentext ausfüllen Fachwortschatzliste Die Fachwortschatzliste wird erst im Verlauf der Unterrichtseinheit präsentiert, am besten am Ende von Schritt zwei der Wortschatzarbeit. Sie enthält den von der Lehrkraft festgelegten Pflichtwortschatz (Fettdruck) und zusätzliches Wortmaterial für sehr gute Schülerinnen und Schüler. Aber auch Schülerinnen und Schüler mit Kompetenzdefiziten erhalten mit der vollständigen Liste die Chance, sich mehr Fachwissen anzueignen, als sie unbedingt müssten. Zu jedem Fachwort der Liste muss ein Beispielsatz gebildet werden, der mit dem behandelten Thema zusammenhängen kann, aber nicht muss. Der Beispielsatz erleichtert den Schülerinnen und Schülern das Abspeichern und Abrufen des jeweiligen Fachbegriffs. Zusätzlich fertigen sich die Schülerinnen und Schüler eine eigene Merkhilfe (z. B. Zeichnung, Symbol, Übersetzung in Muttersprache) für das jeweilige Fachwort an. Artikel Fachwort Beispielsatz Merkhilfe der/die Erzbischof, -e Der Erzbischof leitet den Gottesdienst in der Kirche. der/die Heide, n Christen bezeichnen im Mittelalter alle Nichtchristen als Heiden. der/die Herzog, -e Der Herzog unterstützt den König. das/die Insigne, -ien Der König trägt als Insigne der Macht die Krone. 176
177 Königsherrschaft im Mittelalter Artikel Fachwort Beispielsatz Merkhilfe die Krönung, en Während der Krönung erhält der König seine Krone. das/die Schwert, -er Der König erhält das Schwert. das/die Volk, -er Das Volk stimmt der Wahl des Königs zu. das/die Zepter, Der König hält in seiner Hand das Zepter. das/die Diadem, e Dem König wird das Diadem auf den Kopf gesetzt. das/die Wehrgehänge, Im Wehrgehänge trägt der König sein Schwert. die Basilika, -ken In der Basilika beten die Menschen zu Gott. designieren huldigen präsentieren verteidigen Der Sohn ist als Nachfolger seines Vaters designiert. Der Adel huldigt seinem neuen Herrscher. Der Erzbischof präsentiert dem Volk den neuen König. Otto I. verteidigt mit dem Schwert sein Reich. 177
178 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte Wortschatzarbeit: Wortschatzaktivierung/Vorentlastung Bevor mit der eigentlichen Wortschatzarbeit begonnen wird, sollte immer Bekanntes reaktiviert und wiederholt werden. Dazu wäre beispielsweise ein Buchstabengitter geeignet, in dem die Fachbegriffe der letzten Stunden aufzufinden sind. Das Ganze kann leichter gestaltet werden, indem man die Wörter als Liste oder die jeweiligen Begriffsdefinitionen vorgibt. Damit wäre auch der Binnendifferenzierung Rechnung getragen. Eine zweite Möglichkeit zum Reaktivieren des Wortschatzes bildet die Wortfeld-Aufgabe. Aufgabe: Suche und markiere in dem Buchstabengitter 17 Begriffe zum Thema Leben und Herrschaft im Mittelalter. Hinweis: Die Begriffe sind waagerecht, senkrecht und diagonal angeordnet. (Ö = OE) M U T N E T S I R H C E O N U R B I S C H O F M E T K I R C H E X N R G N E O R S K L O S T E R C R E L O T Q W A B T A H T N A T N G E B E T F M A I O A D E L P Z I H F N G R U N D H E R R Y S C H W E R T P F A L Z Lösungen: Kloster; Mönch; Abt; Bischof; Gott; Christentum; Gebet; Kirche; König; Krone; Pfalz; Ritter; Grundherr; Graf; Adel; Schwert; Untertan Aufgabe: Finde weitere Wörter (Nomen, Verben, Adjektive) für das Wortfeld König KÖNIG Königin Thron regieren reich Lösung: Schloss, Krone, Schätze, Landbesitz, Königreich, Diener, herrschen, kämpfen, schützen, mächtig 178
179 3 Die fünf Schritte der Wortschatzarbeit Schritt 1: Fachwörter zu einem Thema einführen Bekannte Fachbegriffe finden Anwendung und neuer Fachwortschatz wird kontextbezogen eingeführt. Dies erleichtert den Schülerinnen und Schülern das Verstehen und Behalten der neuen Wörter. Die Königswahl Ottos I. Kaisersiegel Otto I. Unter König Heinrich I. entsteht im Jahre 919 das deutsche Königtum der sächsischen Ottonen. Heinrich einte die Herzogtümer Franken, Bayern, Schwaben, Lothringen und Sachsen zu einem Deutschen Königreich. Sein Sohn Otto I. gilt bereits zu Lebzeiten Heinrichs als dessen designierter Nachfolger. 936 wird er in Aachen vom Adel (Herzöge, Grafen, Ritter) zum König gewählt und von den Erzbischöfen von Köln und Mainz gekrönt. Während der Krönung werden Otto I. die Insignien, also die Zeichen seiner Macht, überreicht. Als König bleibt Otto I. auf die Zusammenarbeit mit den Herzögen, die mächtige Grundherren sind, angewiesen. Des Weiteren findet er besonders bei den Vertretern der Kirche (Erzbischöfe, Äbte, Äbtissinnen) Unterstützung. Nach Jahren des Kämpfens gegen seine Feinde wird Otto I. im Jahre 962 in Rom vom Papst zum Kaiser gekrönt. Damit herrscht er sowohl über das Deutsche Königreich als auch über Italien. 179
180 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte Aufgaben: 1. Markiere die bekannten Begriffe des Wortfeldes König farbig (rot) im Text. 2. Nutze eine weitere Farbe (grün) und markiere neue Begriffe des Wortfeldes. Ergänze anschließend dein bisheriges Wortfeld im Hefter. 3. Suche im Text die Personengruppen, die den König bei seiner Arbeit unterstützen. Markiere sie mit einer dritten Farbe (blau). Lösungen: 1. König, Königreich, gekrönt, Krönung, Macht, des Kämpfens 2. Deutsche Königtum, sächsischen Ottonen, designierter Nachfolger, zum König gewählt, Insignien überreicht 3. Adel (Herzöge, Grafen, Ritter), Herzögen, Vertretern der Kirche (Erzbischöfe, Äbte, Äbtissinnen) 180
181 Die fünf Schritte der Wortschatzarbeit Ein Krönungsbericht In seiner Sachsengeschichte berichtete der Mönch Widukind aus dem Kloster Corvey an der Weser, der den Ottonen nahe stand, über wichtige Ereignisse im 10. Jahrhundert. Da er die Krönung Ottos I. nicht persönlich miterlebte, beruht sein Bericht vermutlich auf der Beobachtung einer späteren Königserhebung: Nachdem also der Vater des Vaterlandes und der größte wie beste König Heinrich gestorben war, wählte sich das gesamte Volk der Franken und Sachsen seinen Sohn Otto, der bereits vorher vom Vater zum König designiert worden war, als Herrscher aus. Als Ort der allgemeinen Wahl nannte und bestimmte man die Pfalz Aachen. [ ] 5 Und als man dorthin gekommen war, versammelten sich die Herzöge und obersten Grafen mit der übrigen Schar vornehmster Ritter in dem Säulenhof, der mit der Basilika Karls des Großen [Pfalzkapelle] verbunden ist, setzten den neuen Herrscher auf einen dort aufgestellten Thron, huldigten ihm, gelobten ihm Treue, versprachen ihm Unterstützung gegen alle seine Feinde und machten ihn nach ihrem Brauch zum König. Während dies die Herzö 10 ge und die übrige Beamtenschaft vollführten, erwartete der Erzbischof mit der gesamten Priesterschaft und dem ganzen Volk im Innern der Basilika den Auftritt des neuen Königs. Als dieser erschien, ging ihm der Erzbischof entgegen, berührte mit seiner Linken die Rechte des Königs, während er selbst in der Rechten den Krummstab trug, bekleidet mit der Albe, geschmückt mit Stola und Messgewand, schritt vor bis in die Mitte des Heiligtums 15 und blieb stehen. Er wandte sich zum Volk um, das ringsumher stand es waren nämlich in jener Basilika unten und oben umlaufende Säulengänge, sodass er vom ganzen Volk gesehen werden konnte, und sagte: Seht, ich bringe euch den von Gott erwählten und von dem mächtigen Herrn Heinrich einst designierten, jetzt aber von allen Fürsten zum König gemachten Otto: wenn euch diese Wahl gefällt, zeigt dies an, indem ihr die rechte 20 Hand zum Himmel emporhebt. Da streckte das ganze Volk die Rechte in die Höhe und wünschte unter lautem Rufen dem neuen Herrscher viel Glück. Dann schritt der Erzbischof [Hildebert von Mainz] mit dem König, der nach fränkischer Sitte mit einem eng anliegenden Gewand bekleidet war, hinter den Altar, auf dem die königlichen Insignien lagen: das Schwert mit dem Wehrgehänge, der Mantel mit den Span 25 gen, der Stab mit dem Zepter und das Diadem. [ ] Derselbe [Erzbischof von Mainz] aber ging zum Altar, nahm von dort das Schwert mit dem Wehrgehänge auf, wandte sich an den König und sprach: Nimm dieses Schwert, auf dass du alle Feinde Christi verjagst, die Heiden und schlechten Christen, da durch Gottes Willen dir alle Macht im Frankenreich übertragen ist, zum unerschütterlichen Frieden für alle Christen. Dann nahm er die Span 30 gen, legte ihm den Mantel um und sagte: Durch die bis auf den Boden herabreichenden Zipfel [deines Gewandes] seist du daran erinnert, mit welchem Eifer du im Glauben entbrennen und bis zum Tod für die Sicherung des Friedens eintreten sollst. Darauf nahm er Zepter und Stab und sprach: Durch diese Abzeichen bist du aufgefordert, mit väterlicher Zucht deine Untertanen zu leiten und in erster Linie den Dienern Gottes, den Witwen und 35 Waisen die Hand des Erbarmens zu reichen; und niemals möge dein Haupt ohne das Öl der Barmherzigkeit sein, auf dass du jetzt und in Zukunft mit ewigem Lohn gekrönt werdest. Auf der Stelle wurde er mit dem heiligen Öl gesalbt und mit dem goldenen Diadem gekrönt von eben den Bischöfen Hildebert und Wigfried [von Köln], und nachdem die rechtmäßige Weihe vollzogen war, wurde er von denselben Bischöfen zum Thron geführt, 40 zu dem man über eine Wendeltreppe hinaufstieg, und er war zwischen zwei Marmorsäulen von wunderbarer Schönheit so aufgestellt, dass er von da aus alle sehen und selbst von allen gesehen werden konnte. 181
182 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte Nachdem man dann das Lob Gottes gesungen und das Messopfer feierlich begangen hatte, ging der König hinunter zur Pfalz, trat an die marmorne, mit königlicher Pracht 45 geschmückte Tafel und nahm mit den Bischöfen und dem ganzen Adel Platz; die Herzöge aber taten Dienst. Der Herzog der Lothringer, Giselbert, zu dessen Machtbereich dieser Ort gehörte, organisierte alles; Eberhard kümmerte sich um den Tisch, der Franke Hermann um die Mundschenken; Arnulf [von Bayern] sorgte für die Ritterschaft sowie für die Wahl und Errichtung des Lagers [ ]. 50 Der König aber ehrte danach einen jeden Fürsten freigebig, wie es sich für einen König gehört, mit einem passenden Geschenk und verabschiedete die vielen Leute mit aller Fröhlichkeit. Widukind von Corvey, Sachsengeschichte, hrsg. von Ekkehart Rotter und Bernd Schneidmüller, Stuttgart 1981, S , zitiert nach: Ulrich Baumgärtner (Hrsg.): Anno 7, Westermann Verlag, Braunschweig 2006, S. 88f. Aufgabe: Lies den Krönungsbericht. Verbinde anschließend die angegebenen Teile der Kleidung eines Bischofs mit einer geraden Linie mit dem Bild. Krummstab (Symbol des hohen Amtes in der Kirche) Messgewand (mit christlichen Symbolen besticktes Obergewand) Albe (langes weißes Untergewand) Kleidung eines Bischofs Lösung: Krummstab (Symbol des hohen Amtes in der Kirche) Messgewand (mit christlichen Symbolen besticktes Obergewand) Albe (langes weißes Untergewand) 182
183 Die fünf Schritte der Wortschatzarbeit Schritt 2: Fachwörter üben Bekannte Fachbegriffe müssen geübt werden, damit der Wortklang und das Schriftbild den Schülerinnen und Schülern geläufig wird und sie die Begriffe in ihren Mitteilungswortschatz übernehmen. Hierzu müssen vielfältige Übungsaufgaben angeboten werden, z. B. Bilder und Schaubilder beschriften, Fachbegriffe rekonstruieren oder Fachbegriffe zu vorgegebenen Erklärungen in der Quelle suchen. Das Aufsuchen der Begriffe und Wortgruppen im Text schult zugleich das Leseverständnis. Um dabei den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, kann die Zeilenvorgabe weggelassen werden. In einer sich anschließenden Hausaufgabe sollten dann die gefundenen Fachbegriffe durch die einfachen Erklärungen im Quellentext ersetzt werden, um dadurch dessen Verständlichkeit zu erhöhen. Vor allem müssen die Schülerinnen und Schüler die Quelle erneut lesen und dann die Fachbegriffe anwenden. Um den Ehrgeiz der Schülerinnen und Schüler zu wecken, sollte es ihnen überlassen sein, welche der Begriffe sie ersetzen wollen. Die Schülerinnen und Schüler rekonstruieren im weiteren Unterrichtsgeschehen den genauen Ablauf der mittelalterlichen Königswahl. Dazu bilden sie Überschriften zu vorgegebenen Textabschnitten. Diese Überschriften sollten dann den Schritten der Königswahl entsprechen. Als vereinfachte Alternative wäre denkbar, dass die Teilüberschriften ungeordnet vorgegeben werden, um sie dann den entsprechenden Textabschnitten zuzuordnen. Außerdem suchen die Schülerinnen und Schüler erneut nach Fachbegriffen und Aussagen in der Textquelle. Letztere müssen sie unter Verwendung aussagekräftiger Verben in eine moderne Sprache übertragen. Die Ergebnisse werden etwas später für ein Rollenspiel benötigt. Aufgabe: Suche nun aus der Quelle die königlichen Insignien heraus und beschrifte das Bild. Welches königliche Symbol fehlt auf dem Bild? Königliche Insignien Lösung: Schwert mit Wehrgehänge 1. Diadem/Krone 2. Mantel mit den Spangen 3. Stab mit dem Zepter 183
184 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte Aufgabe: Lies den Krönungsbericht. Ordne dann die Personengruppen aus dem Kasten den jeweiligen Erklärungen im Schaubild zu. Personen: Ritter Herzöge Volk Erzbischöfe König Grafen Herrscher 1 2 Personen der obersten Schicht des Adels und der Kirche 3 Personen der mittleren Schicht des Adels 4 5 Personen der unteren Schicht des Adels Mehrheit der Bevölkerung 6 Lösung: 1. König 4. Grafen 2. Herzöge 5. Ritter 3. Erzbischöfe 6. Volk 184
185 Die fünf Schritte der Wortschatzarbeit Aufgabe: Bei den folgenden Fachwörtern aus der Quelle ist etwas durcheinander geraten. Bilde aus den Buchstaben das richtige Wort (Nomen oder Verb). Beachte dabei, dass der erste Buchstabe bereits an der richtigen Stelle steht. a. H G R E O Z b. Z P T E E R c. H I N E L U D G d. D E M A I D e. I S G N N N I I E f. H D E E I N Lösung: a. H G R E O Z Herzog b. Z P T E E R Zepter c. H I N E L U D G huldigen d. D E M A I D Diadem e. I S G N N N I I E Insignien f. H D E E I N Heiden 185
186 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte Aufgabe: Suche in der Quelle die Begriffe/Wortgruppen zu den vorgegebenen Erklärungen und notiere sie anschließend. Die Zeilenangaben dienen dir dabei als Hilfe. als König ausgewählt: (Z. 3) Gruppe adliger Schwertkämpfer: (Z. 6) zeigten ihm ihre Verehrung: (Z. 8) die königlichen Symbole: (Z. 23/24) Gegner des Christentums: (Z. 27) Nichtchristen: (Z. 28) starkes Bemühen: (Z. 31) mit strenger Disziplin: (Z. 33/34) die feierliche Handlung: (Z. 39) ein Lied zu Ehren Gottes singen: (Z. 43) den Gottesdienst durchführen: (Z. 43) Lösung: als König ausgewählt: zum König designiert (Z. 3) Gruppe adliger Schwertkämpfer: Schar vornehmster Ritter (Z. 6) zeigten ihm ihre Verehrung: huldigten ihm (Z. 8) die königlichen Symbole: die königlichen Insignien (Z. 23/24) Gegner des Christentums: Feinde Christi (Z. 27) Nichtchristen: Heiden (Z. 28) starkes Bemühen: Eifer (Z. 31) mit strenger Disziplin: mit väterlicher Zucht (Z. 33/34) die feierliche Handlung: die rechtmäßige Weihe (Z. 39) ein Lied zu Ehren Gottes singen: das Lob Gottes gesungen (Z. 43) 186 den Gottesdienst durchführen: das Messopfer feierlich begangen (Z. 43)
187 Die fünf Schritte der Wortschatzarbeit Hausaufgabe: In der Quelle wurden schwer verständliche Wörter/Wortgruppen weggelassen. Ersetzt sie durch die einfacheren Erklärungen. Achte dabei auf die Wortendungen und die passenden Zeitformen der Verben. Hinweis: Falls ihr das Originalwort versteht, setzt dieses ein. Ein Krönungsbericht In seiner Sachsengeschichte berichtete der Mönch Widukind aus dem Kloster Corvey an der Weser, der den Ottonen nahe stand, über wichtige Ereignisse im 10. Jahrhundert. Da er die Krönung Ottos I. nicht persönlich miterlebte, beruht sein Bericht vermutlich auf der Beobachtung einer späteren Königserhebung: Nachdem also der Vater des Vaterlandes und der größte wie beste König Heinrich gestorben war, wählte sich das gesamte Volk der Franken und Sachsen seinen Sohn Otto, der bereits vorher vom Vater zum König 1 worden war, als Herrscher aus. Als Ort der allgemeinen Wahl nannte und bestimmte man die Pfalz Aachen. [ ] Und als man dorthin gekommen war, versammelten sich die Herzöge und obersten Grafen mit der übrigen 2 in dem Säulenhof, der mit der Basilika Karls des Großen [Pfalzkapelle] verbunden ist, setzten den neuen Herrscher auf einen dort aufgestellten Thron, 3, gelobten ihm Treue, versprachen ihm Unterstützung gegen alle seine Feinde und machten ihn nach ihrem Brauch zum König. Während dies die Herzöge und die übrige Beamtenschaft vollführten, erwartete der Erzbischof mit der gesamten Priesterschaft und dem ganzen Volk im Innern der Basilika den Auftritt des neuen Königs. Als dieser erschien, ging ihm der Erzbischof entgegen, berührte mit seiner Linken die Rechte des Königs, während er selbst in der Rechten den Krummstab trug, bekleidet mit der Albe, geschmückt mit Stola und Messgewand, schritt vor bis in die Mitte des Heiligtums und blieb stehen. Er wandte sich zum Volk um, das ringsumher stand es waren nämlich in jener Basilika unten und oben umlaufende Säulengänge, sodass er vom ganzen Volk gesehen werden konnte, und sagte: Seht, ich bringe euch den von Gott erwählten und von dem mächtigen Herrn Heinrich einst designierten, jetzt aber von allen Fürsten zum König gemachten Otto: wenn euch diese Wahl gefällt, zeigt dies an, indem ihr die rechte Hand zum Himmel emporhebt. Da streckte das ganze Volk die Rechte in die Höhe und wünschte unter lautem Rufen dem neuen Herrscher viel Glück. Dann schritt der Erzbischof [Hildebert von Mainz] mit dem König, der nach fränkischer Sitte mit einem eng anliegenden Gewand bekleidet war, hinter den Altar, auf dem die königlichen 4 lagen: das Schwert mit dem Wehrgehänge, der Mantel mit den Spangen, der Stab mit dem Zepter und das Diadem. [ ] Derselbe [Erzbischof von Mainz] aber ging zum Altar, nahm von dort das Schwert mit dem Wehrgehänge auf, wandte sich an den König und sprach: Nimm dieses Schwert, auf dass du alle 5 verjagst, die 6 und schlechten Christen, da durch Gottes Willen dir alle Macht im Frankenreich übertragen ist, zum unerschütterlichen Frieden für alle Christen. Dann nahm er die Spangen, legte ihm den Mantel um und sagte: Durch die bis auf den Boden herabreichenden Zipfel [deines Gewandes] seist du daran erinnert, mit welchem 7 du im Glauben entbrennen und bis zum Tod für die Sicherung des Friedens eintreten sollst. Darauf nahm er Zepter und Stab und sprach: Durch diese Abzeichen bist du aufgefordert, mit 8 deine Untertanen zu leiten und in erster Linie den Dienern Gottes, den Witwen und Waisen die Hand des Erbarmens zu reichen; und niemals möge dein Haupt ohne das Öl der Barmherzigkeit sein, auf 187
188 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte dass du jetzt und in Zukunft mit ewigem Lohn gekrönt werdest. Auf der Stelle wurde er mit dem heiligen Öl gesalbt und mit dem goldenen Diadem gekrönt von eben den Bischöfen Hildebert und Wigfried [von Köln], und nachdem die 9 vollzogen war, wurde er von denselben Bischöfen zum Thron geführt, zu dem man über eine Wendeltreppe hinaufstieg, und er war zwischen zwei Marmorsäulen von wunderbarer Schönheit so aufgestellt, dass er von da aus alle sehen und selbst von allen gesehen werden konnte. Nachdem man dann 10 und 11 hatte, ging der König hinunter zur Pfalz, trat an die marmorne, mit königlicher Pracht geschmückte Tafel und nahm mit den Bischöfen und dem ganzen Adel Platz; die Herzöge aber taten Dienst. Der Herzog der Lothringer, Giselbert, zu dessen Machtbereich dieser Ort gehörte, organisierte alles; Eberhard kümmerte sich um den Tisch, der Franke Hermann um die Mundschenken; Arnulf [von Bayern] sorgte für die Ritterschaft sowie für die Wahl und Errichtung des Lagers [ ]. Der König aber ehrte danach einen jeden Fürsten freigebig, wie es sich für einen König gehört, mit einem passenden Geschenk und verabschiedete die vielen Leute mit aller Fröhlichkeit. Widukind von Corvey, Sachsengeschichte, hrsg. von Ekkehart Rotter und Bernd Schneidmüller, Stuttgart 1981, S , zitiert nach: Ulrich Baumgärtner (Hrsg.): Anno 7, Westermann Verlag, Braunschweig 2006, S. 88f. Lösung: 1. ausgewählt 7. starken Bemühen 2. Gruppe adliger Schwertkämpfer 8. mit strenger Disziplin 3. zeigten ihm ihre Verehrung 9. feierliche Handlung 4. Symbole 10. ein Lied zu Ehren Gottes gesungen 5. Gegner des Christentums 11. den Gottesdienst durchgeführt 6. Nichtchristen 188
189 Die fünf Schritte der Wortschatzarbeit Aufgabe: Lies die Quelle noch einmal abschnittsweise. Gib den angegebenen Abschnitten eine passende Überschrift: a. Z. 1 4: b. Z. 5 11: c. Z : d. Z : e. Z : Lösung: a. Der neue König Otto b. Die Huldigung und das Treuegelöbnis des Adels c. Die Wahl durch das Volk d. Die Übergabe der Insignien e. Das Krönungsmahl Aufgabe: In Abschnitt d) übergibt der Erzbischof die Insignien königlicher Macht an Otto. Gib die Symbole, die überreicht werden, der Reihe nach an Lösung: 1. Schwert mit dem Wehrgehänge 2. Mantel mit Spangen 3. Stab mit dem Zepter 4. Diadem 189
190 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte Aufgabe: Im Folgenden sind in der Tabelle entweder Personen/Gegenstände benannt oder Eigenschaften von Personen/Gegenständen angegeben. Vervollständige die Tabelle, indem du die fehlenden Personen/Gegenstände bzw. Eigenschaften aus der Quelle heraussuchst. Personen/Gegenstände König Heinrich Tafel Adjektive vornehm freigebig, fröhlich heilig Aufgabe: Schaue dir die Adjektive an. Fällt dir etwas auf? Gib an, was das alles für Eigenschaften sind? Lösung: Personen/Gegenstände König Heinrich Ritter König [Otto I.] Tafel Öl Adjektive größte, beste vornehm freigebig, fröhlich marmorn, königlich, prachtvoll heilig positive Eigenschaften, drücken etwas Besonderes aus 190
191 Die fünf Schritte der Wortschatzarbeit Aufgabe: Markiere in der Quelle die direkte [wörtliche] Rede des Erzbischofs von Mainz farbig. Du kannst die direkte Rede an den voran- und nachgestellten Anführungszeichen erkennen. Aufgabe: Trage die Zeilenangaben der gefundenen vier Aussagen in die Klammern ein. Gib dann die Worte des Erzbischofs in deinen Worten wieder. Nutze dazu folgende Verben: präsentieren, zustimmen, kämpfen, verteidigen, helfen, schützen. Aussage 1 (Z. ): Aussage 2 (Z. ): Aussage 3 (Z. ): Aussage 4 (Z. ): 191
192 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte Lösung: Aussage 1 (Z ): Der Erzbischof präsentiert dem Volk den neuen König, das der Wahl zustimmt. Aussage 2 (Z ): Der König soll gegen alle Feinde der Christen und die Heiden kämpfen. Aussage 3 (Z ): Otto I. muss den Glauben und Frieden verteidigen. Aussage 4 (Z ): Der Könige möge alle Untertanen, besonders Witwen und Waisen, und die Kirche schützen. Zusatz: Denkbar wäre hier auch, dass die vier Aussagen vorgegeben werden, dabei aber mehrere Verben zur Auswahl stehen, und die Schülerinnen und Schüler entweder ein treffendes Verb heraussuchen (Variante A) oder ein unzutreffendes wegstreichen (Variante B). Beispiel: a. Wähle in der Aussage aus den vorgegebenen Verben ein passendes aus. Der Erzbischof führt vor / präsentiert / stellt vor dem Volk den neuen König, das der Wahl zustimmt. b. Streiche alle Verben durch, die nicht passen. Der Erzbischof lobt gegenüber / beschimpft gegenüber / präsentiert dem Volk den neuen König, das der Wahl zustimmt. 192
193 Die fünf Schritte der Wortschatzarbeit Schritt 3: Fachwörter benutzen lassen Um den Fachwortschatz dauerhaft bei den Lernenden zu verankern, müssen sie ihn oft und zunehmend freier benutzen. Dazu können die folgenden Aufgaben dienen. Beim Rollenspiel halten sich die Schülerinnen und Schüler eng an den Originaltext. Etwas freier, aber noch stark gelenkt, äußern sich die Schülerinnen und Schüler bei der Verschriftlichung der Ergebnisse einer einfachen Quellenanalyse. Die vorhandenen Satzbausteine dienen den Schülerinnen und Schülern als Hilfe, um die Ergebnisse einer Quellenanalyse als zusammenhängenden Text darzustellen. Für sehr gute Schülerinnen und Schüler können auch die Lösungen der Aufgaben 1 bis 4 entfallen bzw. gibt man mehrere Lösungsmöglichkeiten vor, aus denen die Schülerinnen und Schüler die richtigen auswählen müssen. Die Antworten auf die Fragen 5 bis 8 stellen eine Herausforderung dar. Denn die Schülerinnen und Schüler werden dazu angeregt, die Quelle zu interpretieren. Für Schülerinnen und Schüler mit sehr niedrigem Kompetenzniveau sollten die Antworten daher vorgegeben werden, damit sie sich auf das Verschriftlichen der Ergebnisse konzentrieren können. Während des Anschauens des Films wiederholen sie bekanntes Fachvokabular und wenden es anschließend in einem kurzen Vortrag an. Das Schreiben eines Briefes trainiert dann am nachhaltigsten den freien Gebrauch neuer Fachwörter. Aufgabe: Wählt aus der Klasse zwei Vorleser aus. Der eine liest den Krönungsbericht, der andere trägt dabei die Worte des Erzbischofs vor. Aufgabe: Spielt nun die Krönung Otto I. nach (Z. 5 42). Teilt euren Klassenraum dazu in zwei Hälften. Die eine Hälfte bildet den Säulenhof, die andere Hälfte stellt das Innere der Basilika dar. Stellt in jede Hälfte einen Stuhl als Thron auf. Legt vier Gegenstände auf einem Tisch [Altar] bereit, die die königlichen Symbole darstellen sollen (z. B. Mütze als Krone, Jacke als Mantel, Lineal als Zepter, Zeigestock als Schwert). Säulenhof Herzöge, Grafen, Ritter, Beamte Basilika Volk, Erzbischöfe von Mainz und Köln Thron 1 Thron 2 Altar mit: Schwert, Mantel, Zepter, Diadem/Krone Bestimmt, wer die folgenden Einzelrollen übernimmt: Otto I.: Erzbischof Hildebert von Mainz: Erzbischof Wigfried von Köln: Der Rest der Klasse teilt sich in a) Herzöge, Grafen, Ritter und Beamte und b) das Volk auf. Bestimmt einen Vorleser, der den Quellentext (Z. 5 42) etappenweise vorträgt. Probt das Ganze. 193
194 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte Ablauf: Vorleser (Z. 5 11) Spielszene Vorleser (Z ) Spielszene Vorleser (Z ) Spielszene (beides gleichzeitig) Vorleser (Z ) Spielszene Vorleser (Z ) Spielszene (beides gleichzeitig) Vorleser (Z ) Spielszene 194
195 Die fünf Schritte der Wortschatzarbeit Quellenanalyse: Die Krönung Otto I. Aufgabe: Analysiere den Bericht Widukinds. Arbeitsschritte: Beantworte die Fragen zu der Quelle der Reihenfolge nach auf einem Extra-Blatt. Du kannst dabei die folgenden Hilfen benutzen. Hinweis: Bei den Fragen 1 bis 4 sind die Lösungen schon vorgegeben. Fragen an den Text Satzmuster Lösungen 1. Welche Textsorte liegt vor? 2. Wer ist der Verfasser des Textes? 3. An wen richtet sich der Text? 4. Wann und in welcher Situation wurde er verfasst? Es handelt sich bei diesem Text um Er stammt von Er wurde von geschrieben. Er wurde von verfasst. Er richtet sich an Er wendet sich an Er spricht an. Er wurde im Jh. vor dem Hintergrund einen Bericht. dem Mönch Widukind. Ottos Untertanen. 10. der Auseinandersetzungen mit den Herzögen 5. Was ist die Kernaussage des Textes? 6. Was ist die Absicht des Verfassers? 7. Wie begründet der Verfasser seine Absicht? 8. Wie reagieren Leser Zuhörer wohl auf den Text? im Anschluss an verfasst. Der Verfasser/Berichtende beschreibt /hebt hervor/unterstreicht, dass Er versucht darzustellen, dass Sein Ziel ist zu bewirken, dass Seine Absicht ist die Zuhörer dazu zu bringen, dass Er hat vor zu überzeugen, dass die Krönung Otto I. Er verweist darauf, dass Er führt als Beweis an, dass? Die Leser/Zuhörer bekommen den Eindruck, dass??? 195
196 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte Lösung: 1. Es handelt sich bei diesem Text um einen Bericht. 2. Er stammt von dem Mönch Widukind. 3. Er wendet sich an Ottos Untertanen. 4. Der Text wurde im 10. Jh. vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen mit den Herzögen im Anschluss an die Krönung Otto I. verfasst. 5. Der Verfasser hebt hervor, dass Otto I. der rechtmäßige König ist. 6. Er hat vor zu überzeugen, dass Otto I. ein mächtiger/reicher/großzügiger König ist. 7. Er führt als Beweis an, dass Otto I. von Adel, Kirche und Volk unterstützt/gewählt wurde. 8. Die Zuhörer bekommen den Eindruck, dass Otto I. ein mächtiger König ist, und bewundern ihn. 196
197 Die fünf Schritte der Wortschatzarbeit Fragen zum Film Die Deutschen: Otto und das Reich Ihr seht jetzt eine Dokumentation mit Spielszenen, in denen euch das Leben Otto I. präsentiert wird. Aufgabe: Otto I.: Beantwortet stichpunktartig die folgenden Aufgaben. Haltet mit euren Aufzeichnungen einen kurzen Vortrag zum Leben Ottos I. geboren am , Geburtsort nicht gesichert gestorben am , Memleben (bei Nebra/Unstrut) Das Reich im 10. Jahrhundert AACHEN RHEIN MAGDEBURG QUEDLINBURG GRENZEN DES REICHES REGNUM TEUTONICORUM (DEUTSCHES HERRSCHAFTSGEBIET) AUGSBURG LECHFELD (955) SIEDLUNGSGEBIETE DER UNGARN REGNUM ITALICUM (ITALISCHES HERRSCHAFTSGEBIET) DONAU KIRCHENSTAAT ROM 1. Zähle die Herzogtümer auf, aus denen Ottos Reich bestand. 2. Gib das Jahr und die Stadt der Königskrönung Otto I. an. 3. Nenne zum einen Ottos Gegner bei der Schlacht auf dem Lechfeld 955 und zum anderen den Sieger der Schlacht. 4. Ergänze den Satz: Otto I. stammt aus dem Herzogtum 5. Schreibe die Unterstützer Otto I. beim Regieren im Reich auf. 6. Vervollständige: Otto I. wird 962 zum, damit herrscht er auch über. 197
198 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte 7. Womit erzielt Otto I. einen Ausgleich mit Byzanz (Oströmisches Reich)? Hinweis: Theophanu 8. Gib an, wer mit Teutonen und Tedeschi gemeint ist? Lösung: 1. Sachsen, Franken, Bayern, Schwaben, Lothringen in Aachen 3. gegen die Ungarn, Otto I. siegte 4. Sachsen 5. Herzöge, Kirche, Ehefrauen und Söhne 6. Kaiser gekrönt Italien. 7. Hochzeit seines Sohnes mit byzantinischer Prinzessin Theophanu 8. Teutonen = Germanen, Tedeschi = Deutsche 198
199 Die fünf Schritte der Wortschatzarbeit Aufgabe: Stell dir vor, du bist ein Graf und hast an der Krönung Ottos I. teilgenommen. Schreibe einen Brief an deine Frau/deine Tochter/deinen Sohn und berichte ihr/ihm davon. Du musst dabei sowohl auf die Gedanken und Gefühle des Grafen als auch den genauen Ablauf der Krönung eingehen. Lösung: individuell 199
200 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte Schritt 4: Über Wörter reflektieren Hier wird der bewusste Umgang mit der Wortfamilie aufgezeigt, der für den systematischen Aufbau des Fachwortschatzes unverzichtbar ist. Denn mittels der Wortbildungsregeln kann der Lernende neue, abgeleitete Begriffe leichter verstehen. Als bewährtes Mittel kann die Wort- Karteikarte empfohlen werden, die mit bestimmten festgelegten Inhalten (siehe Lösungsteil!) als Ausgangspunkt einer ganzen Sammlung dienen kann. Aufgabe: Vervollständige mit Hilfe eines Wörterbuches die folgende Karteikarte. die Königskrönung der Krönungsmantel krönen (er krönt, die Krönung er krönte, die Krone er hat gekrönt) = jemanden zum König machen Der Erzbischof krönt den künftigen König. Der Adel versammelt sich zur feierlichen Krönung in der großen Kirche. 200
201 Die fünf Schritte der Wortschatzarbeit Lösung: Alternative Beispiele für Zusammensetzungen und Sätze sind möglich. Zusammensetzungen Zusammensetzungen mit dem Ausgangsmit dem Ausgangswort wort als Bestimals Grundwort Adjektive mungswort die Königskrönung die Kaiserkrönung die Reichskrone krönen (er krönt, die Krönung er krönte, die Krone er hat gekrönt) = jemanden zum König machen der Krönungsmantel die Krönungsfeier die Krönungsrede Der Erzbischof krönt den künftigen König. Der Adel versammelt sich zur feierlichen Krönung in der großen Kirche. Der Nachfolger wird zum König gekrönt. Die Kaiserkrönung findet in Rom statt. Sätze und Definitionen, in denen Ausgangswort oder Zusammensetzungen vorkommen 201
202 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte Schritt 5: Testen Kommentar: Alle abgefragten Wörter müssen aus dem Kernwortschatz der Wortschatzliste stammen und im Unterricht besprochen worden sein. Hier geht es nicht um einen Rechtschreibtest, deshalb sollten Fehler korrigiert, aber nicht sanktioniert werden. 1. Aufgabe: Beschrifte im Bild die vier Symbole der königlichen Macht. 4/. Die Symbole der königlichen Macht 2. Aufgabe: Bringe die fünf Aussagen zum Ablauf der Königswahl in die richtige Reihenfolge, indem du in die Klammern die Zahlen 1 bis 5 einsetzt. 5/. ( ) Die Zeichen der Macht werden übergeben. ( ) Der Adel huldigt dem neuen König und gelobt Treue. ( ) Das Krönungsmahl findet statt. ( ) Das Volk wählt den König. ( ) Volk und Adel versammeln sich. 3. Aufgabe: Im folgenden Text fehlen vier Fachbegriffe. Ergänze sie. 4/. 936 wird Otto I. in Aachen vom Adel zum Nachfolger Heinrich I. gewählt und von den von Köln und Mainz zum König. Während der Krönung werden Otto I. die, also die Zeichen seiner Macht, überreicht. Als christlicher König muss er gegen alle Nichtchristen, also die, kämpfen. 4. Aufgabe: Versetze dich in die Rolle eines einfachen Bauern. Dir wird von einem Augenzeugen über den Krönungstag Otto I. berichtet. Schreibe danach deine Gedanken über den neuen König auf. Nutze ganze Sätze. 2/. 202 Punkte: 15/ Note:
203 Die fünf Schritte der Wortschatzarbeit Lösungen: 1. Krone/Diadem Stab mit Zepter Mantel mit Spangen Schwert (mit Wehrgehänge) Die Symbole der königlichen Macht 2. (4) Die Zeichen der Macht werden übergeben. (2) Der Adel huldigt dem neuen König und gelobt Treue. (5) Das Krönungsmahl findet statt. (3) Das Volk wählt den König. (1) Volk und Adel versammeln sich. 3. 1) Erzbischöfe 3) Insignien 2) gekrönt 4) Heiden 4. Der Bauer denkt vermutlich, dass Otto I. ein reicher, mächtiger und guter König sei. 203
204
205 4 Aufgaben formulierungen im Geschichtsunterricht 4.1 Die Arbeit mit Operatoren Genaue Handlungsanleitungen für die Schülerinnen und Schüler sind im Unterricht unabdingbar. Eine wichtige Rolle spielen dabei Operatoren. Dies sind Verben gleichsam Schlüsselwörter, die den Schülerinnen und Schülern signalisieren, was sie bei einer Frage oder einer Aufgabe konkret tun sollen, und zwar sowohl im Unterrichtsgespräch als auch in schriftlichen Arbeitsaufträgen. Wird eine Aufgabe unklar formuliert, führt dies zu Verunsicherung oder gar zu Missverständnissen, da das Ziel des Auftrags unklar bleibt. Eine Frage wie zum Beispiel: Welche Ursachen hatte die Französische Revolution? lässt offen, ob die Schülerinnen und Schüler diese Ursachen einfach aufzählen sollen oder ob sie einen Text durchlesen, nach den dort erwähnten Ursachen suchen und diese dann beschreiben sollen. Möglich wäre auch, dass sie die Ursachen erklären, begründen oder diskutieren sollen. Nur leistungsstarke Schülerinnen und Schüler werden einen solchen Arbeitsauftrag so ausführen, dass möglichst viele der zu vermutenden Absichten der Lehrkraft dabei erfüllt werden. Operatoren präzisieren das Ziel von Arbeitsaufträgen, sorgen dabei für Orientierung und erleichtern die Bearbeitung von Aufgaben. Manche Lehrwerke enthalten daher Listen von Operatoren und erklären in einer für Schülerinnen und Schüler verständlichen Alltagssprache, welche geforderte Handlung mit dem jeweiligen Operator verbunden ist. Auch die Konferenz der Kultusminister (KMK) hat für einige Fächer Operatoren insbesondere für die Verwendung in der Sekundarstufe II bzw. bei der Erstellung von Klausuraufgaben zusammengestellt. Diese Listen bleiben jedoch stets fachspezifisch und sind daher als Orientierung für Schülerinnen und Schüler gerade der Sekundarstufe I nur bedingt geeignet. So gibt es z. B. für den Operator analysieren in unterschiedlichen Fächern verschiedene Definitionen. Für Schülerinnen und Schüler ist dies sehr irritierend, und das erst recht, wenn verschiedene Lehrkräfte eines Faches überdies unterschiedliche Aspekte der geforderten Tätigkeit für wichtig halten. Es wäre daher gut, wenn in einem Kollegium eine Einigung darüber hergestellt würde, welche Operatoren fachübergreifend verwendet werden können. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich nämlich, dass viele Operatoren einen gemeinsamen Bedeutungskern haben. 205
206 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte Die vorliegende Liste von Operatoren aus den Bereichen Natur- und Gesellschaftswissenschaften sowie Deutsch, Englisch und Mathematik stellt den exemplarischen Versuch dar,» aus den in den einzelnen Fächern genutzten Operatoren diejenigen herauszufiltern, die in allen Fächern verwendet werden. Es wurde also eine Schnittmenge gebildet;» aus den in den Fächern genannten Definitionen den ihnen allen gemeinsamen Kern herauszufiltern;» die so gefundenen Operatoren in einer für Schülerinnen und Schüler verständlichen Sprache zu formulieren. Der Gewinn liegt in der Möglichkeit einer breiten Anwendung dieser Operatoren in vielen Fächern. Operator nennen, angeben beschreiben vergleichen erklären erläutern begründen analysieren, untersuchen diskutieren, erörtern beurteilen Handlung Informationen aufzählen, zusammentragen, wiedergeben Sachverhalte, Objekte oder Verfahren mit eigenen Worten darstellen Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln und darstellen Sachverhalte verständlich und nachvollziehbar machen und in Zusammenhängen darstellen Einen Sachverhalt darstellen und unter Verwendung zusätzlicher Informationen veranschaulichen Sachverhalte, Entscheidungen bzw. Thesen durch nachvollziehbare Argumente stützen und sachlich (beispielhaft) belegen Unter einer Fragestellung wesentliche Bestandteile, Ursachen oder Eigenschaften herausarbeiten bzw. nachweisen Sich argumentativ mit verschiedenen Positionen auseinandersetzen und ggf. zu einer begründeten Schlussfolgerung gelangen Zu Sachverhalten eine selbstständige Einschätzung formulieren und begründen 206
207 Aufgabenformulierungen im Geschichtsunterricht 4.2 Aufgabenkonstruktion: vorher nachher Für Lernende stellt mitunter schon die Formulierung der Arbeitsaufgabe eine erste Verständnishürde dar, welche sie davon abhält, zielorientiert zu arbeiten. Deshalb ist gerade bei der sprachlichen Gestaltung der Aufgaben eine besondere Sorgfalt notwendig. Die folgenden Ausführungen geben Hinweise auf Fallstricke und Lösungsmöglichkeiten bei der Formulierung. Aufgaben vorher nachher Operatoren statt W Fragen Welche Herzogtümer bilden Ottos Reich? Welche 17 Begriffe in dem Buchstabengitter zum Thema Leben und Herrschaft im Mittelalter kannst du entdecken? Zähle die Herzogtümer auf, aus denen Ottos Reich bestand. Suche und markiere in dem Buchstabengitter 17 Begriffe zum Thema Leben und Herrschaft im Mittelalter. Schülerinnen und Schüler erhalten jeweils eine klare Handlungsanweisung. Sprachliche Trage die Zeilenangaben der gefun 1. Trage die Zeilenangaben der Konzentra denen vier Aussagen in die Klam gefundenen vier Aussagen in die tion statt mern ein (1. HS) und gib in deinen Klammern ein. Schachtelsatz Worten (2. HS-1), indem du die folgenden Verben präsentieren, zustimmen, kämpfen, verteidigen, helfen, schützten nutzt (1. NS), wieder (2. HS-2), was der Erzbischof sagt (2. NS). 2. Gib die Worte des Erzbischofs dann in deinen Worten wieder. 3. Nutze dazu folgende Verben: präsentieren, zustimmen, kämpfen, verteidigen, helfen, schützen. Lies den Krönungsbericht (1. HS) und ordne dann die Personengruppen (2. HS-1), die du in dem unten stehenden Kasten findest (NS), den jeweiligen Erklärungen im Schaubild zu (2. HS-2). 1. Lies den Krönungsbericht. 2. Ordne dann die Personengruppen aus dem Kasten den jeweiligen Erklärungen im Schaubild zu. Schülerinnen und Schüler müssten erst die hypotaktische Struktur der Aufgabenstellung verstehen und auflösen, um die Aufgabe zu beantworten. Komplexe grammatikalische Strukturen bereiten allerdings oft Schwierigkeiten. Schülerinnen und Schüler erfassen die einzelnen Arbeitsschritte auf Grund der Ein-Satz-Konstruktion schnell. Eindeutigkeit Gib die Zeit und den Ort der Königs Gib das Jahr und die Stadt der statt Vielein- krönung Otto I. an. Königskrönung Otto I. an. deutigkeit Schülerinnen und Schüler könnten als Antwort neben 936 auch Mittelalter oder 10. Jh. sowie Deutsches Reich oder Basilika statt Aachen angeben. Schülerinnen und Schüler wissen, dass eine konkrete Jahreszahl und ein genauer Städtename verlangt werden. 207
208 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte Aufgaben vorher nachher Inhaltliche Ihr seht jetzt die 45-minütige Doku- Ihr seht jetzt eine Dokumentation Klarheit statt mentation Otto und das Reich aus über Otto I. Überfrach der TV-Reihe Die Deutschen über tung den mittelalterlichen König Otto I. (HS), den ihr bereits aus der im Unterricht erschlossenen Quelle Widukinds kennt (NS). Während des Anschauens beantwortet ihr die aufgeführten acht Aufgaben (HS), indem ihr knappe Stichworte notiert (NS). Beantwortet die Aufgaben stichpunktartig. Schülerinnen und Schüler sind beim Verstehen des Hinweises und Arbeitsauftrages vielfach überfordert und verwirrt. Zu viele überflüssige Nebensächlichkeiten sowie die hypotaktische Struktur erschweren das Verständnis. Schülerinnen und Schüler erhalten knappen präzisen Hinweis und Arbeitsauftrag. Offene Frage War Otto I. ein mächtiger König? Begründe, ob Otto I. ein mächtiger stellungen König war. Schülerinnen und Schüler können auf diese Entscheidungsfrage nur mit ja oder nein antworten. Schülerinnen und Schüler müssen Pro- und Kontra-Argumente anführen und daraus eine Entscheidung ableiten. Transfer statt Beschreibe den Ablauf der Krönung Stell dir vor, du bist ein Graf und hast Reproduktion Otto I. an der Krönung Ottos I. teilgenommen. Schreibe einen Brief an deine Frau/deine Tochter/deinen Sohn und berichte ihr/ihm davon. Du musst dabei sowohl auf die Gedanken und Gefühle des Grafen als auch den genauen Ablauf der Krönung eingehen. Schülerinnen und Schüler geben den wesentlichen Ablauf des historischen Ereignisses korrekt wieder, mehr aber auch nicht. (AFB 1) Schülerinnen und Schüler übernehmen die Perspektive einer fiktiven Person, müssen deren Gedanken und Gefühle nachvollziehen (Kommentar), geben den Ablauf des historischen Ereignisses als Bericht wieder und urteilen über das Gesehene. (AFB 1 3) 208
209 Literatur Borries, Bodo von (2005) (Hrsg.): Schulbuchverständnis, Richtlinienbenutzung und Reflexionsprozesse im Geschichtsunterricht. Eine qualitativ-quantitative Schüler- und Lehrerbefragung im deutschsprachigen Bildungswesen Neuried: Ars una Günther-Arndt, Hilke (2003): PISA und der Geschichtsunterricht, In: Günther-Arndt, Hilke (Hrsg.): Geschichtsdidaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin: Cornelsen Scriptor, S Langer-Plän, Martina (2003): Problem Quellenarbeit. Werkstattbericht aus einem Empirischen Projekt, In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 54 (2003) 5/6, S Langer-Plän, Martina/Beilner, Helmut (2006): Zum Problem historischer Begriffsbildung, In: Günther-Arndt, Hilke/Sauer, Michael (Hrsg.): Geschichtsdidaktik empirisch. Untersuchungen zum historischen Denken und Lernen. Berlin/Münster: Lit, S Mehr, Christian/Werner, Kerstin (2012): Geschichtstexte verstehen. Sinnerschließendes Lesen als historisches Lernen, In: Geschichte lernen, Nr. 148 (2012), S Meyer-Hamme, Johannes (2006): Man muss ja soviel lesen. [ ] Nimmt so viel Zeit in Anspruch und ist nicht so wichtig. Ergebnisse einer qualitativen und quantitativen Befragung zum Schulbuchverständnis, In: Handro, Saskia/Schönemann, Bernd (Hrsg.): Geschichtsdidaktische Schulbuchforschung. Berlin/Münster: Lit, S Nodari, Claudio/Steinmann Cornelia (2008): Fachdingsda Fächerorientierter Grundwortschatz für das Schuljahr. Lehrmittelverlag des Kantons Aargau 209
210 Sprachsensibler Fachunterricht Geschichte Bildnachweis Seite 179 Seite 182 Seite 183 Seite 202f. Kaisersiegel Otto I. Kaisersiegel_Otto_I_HW-Kunze_Ekta.jpg ( ) Kleidung eines Bischofs (Popo von Trier) mittelalter/lucys-wissensbox/kategorie/kirche-und-papst-von-paepsten-mitviel-und-wenig-macht-und-einer-stadt-namens-avignon/frage/warum-wardie-kirche-so-maechtig.html?ht=4&ut1=11 ( ) Königliche Insignien AAAAAAAAAkc/mBJ2q3fQKDE/s1600/nachgestellt.jpg ( ) Die Symbole der königlichen Macht blob/ /2/data.jpg ( ) 210
211 Wortschatzarbeit im Mathematikunterricht Mike Reblin
212
213 1 Bedeutung der Wortschatzarbeit im Mathematikunterricht 1.1 Einbindung von Texten und Kontexten in den Unterricht Das Schulfach Mathematik scheint prädestiniert dafür zu sein, mit besonders wenigen Worten oder gar vollständig ohne Texte auszukommen. Tatsächlich ist es durchaus möglich, dass sich Lernende eine ganze Unterrichtsstunde mit Mathematik auseinandersetzen und dazu weniger als zwanzig Worte lesen oder schreiben müssen. Mitunter sind selbst diese wenigen Worte nur Arbeitsaufforderungen wie: Löse die nachfolgenden Gleichungen. Wie groß der Anteil derartig spracharmer Unterrichtsabschnitte ist, unterliegt auch dem Einfluss der Lehrkraft. Zweifellos müssen im Mathematikunterricht Rechenverfahren und Algorithmen thematisiert und geübt werden, dabei tritt die Sprache zeitweilig in den Hintergrund. Problematisch wird es, wenn Spracharmut und Textvermeidung zum durchgehenden Unterrichtsprinzip werden. Dies geht mitunter auch einher mit einem bestimmten Lehrmuster: Präsentation eines Inhaltes durch die Lehrkraft, üben des Gelernten durch die Schülerinnen und Schüler, weitere Inhalte, weitere Übungen und am Ende, quasi als rückwirkende Legitimation der Inhalte, einige Textaufgaben. Dabei werden nicht nur fast alle prozessorientierten Kompetenzen vernachlässigt, sondern auch Möglichkeiten verschenkt, die Mathematik in die Erlebens- und Alltagswelt der Lernenden einzubinden. Die Frage: Wozu brauchen wir denn das?, hat wohl jede Lehrkraft schon mehr als einmal gehört. Von einer erfolgreichen Beantwortung kann die Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler abhängen. Deshalb ist es nötig, schon bei der Planung einer Unterrichtseinheit nach Kontexten zu suchen, in denen die vorgesehenen Inhalte von Bedeutung sind. Zur Darstellung dieser Kontexte werden Texte notwendig. Diese Texte sollten alters- und lerngruppengerecht sein. Dass darin auch Worte auftauchen, die den Kindern noch unbekannt sind, ist normal. Mögliche Verständnisprobleme sollten uns Lehrkräften bewusst sein, so dass wir darauf eingehen können. Ein guter Text, mit interessantem Kontext, verständlich und sprachlich korrekt, bringt oft auch eine gute Motivation auf Seiten der Lernenden mit sich und leistet wertvolle Beiträge zur Verbesserung des Allgemeinwortschatzes der Schülerinnen und Schüler. Ein Beispiel ist in Kapitel 3 dargestellt ( Rechnen mit direkter Proportionalität ). 213
214 Sprachsensibler Fachunterricht Mathematik Mit Texten können Probleme anschaulich gemacht und mathematische Inhalte motiviert werden. Sie sind aber auch nützlich, wenn Lernende aufgefordert werden, mittels eigener Texte Überlegungen darzustellen. Die Verschriftlichung von Ideen erzwingt eine Verlangsamung des Denkens, Gedanken werden tiefgründiger und Beziehungen deutlicher. Durch Aufforderungen wie Beschreibe dein Vorgehen oder Stelle deine Überlegungen dar werden Lernende in die Situation gebracht, ihre erste spontane Idee mit Argumenten belegen und sie dabei eventuell auch anzweifeln zu müssen. Solche Arbeitsaufträge heißen in der didaktischen Literatur Lernjournale, Reisebücher oder Lerntagebücher. 1 Um Texte im Mathematikunterricht erfolgreich nutzen zu können, ist die Entwicklung der Sprachkompetenz erforderlich sowohl auf Seiten der Lernenden als auch auf der der Lehrenden. Wobei mit Sprachkompetenz der Lehrenden nicht deren linguistische Fähigkeiten gemeint sind, sondern eine professionelle Sensibilität gegenüber sprachlichen Problemen. 1.2 Fachbegriffe im Mathematikunterricht Die Darstellung von mathematischen Problemen und die Beschreibung von Problemlöseprozessen gelingen nur dann mit ausreichender Präzision, wenn Lehrende und Lernende auf ein gemeinsames Repertoire an Fachbegriffen zurückgreifen können. Dieses Repertoire muss gezielt entwickelt werden. Eine Grunderfahrung des Mathematikunterrichtes ist, mathematische Gegenstände und Sachverhalte, repräsentiert in Sprache, Symbolen, Bildern und Formen, als geistige Schöpfungen, als eine deduktiv geordnete Welt eigener Art kennen zu lernen und zu begreifen (nach Heinrich Winter, drei Grunderfahrungen des Mathematikunterrichtes) 2. Um Zugang zur Welt der Mathematik zu erhalten, ist ein Bekanntmachen mit der Sprache der Mathematik unverzichtbar. Sicher können wir Lehrkräfte uns auch unter Umgehung von Fachbegriffen in einer Lerngruppe verständlich machen, statt Zähler und Nenner könnten wir oben und unten, statt Argument könnten wir x-wert sagen. Schülerinnen und Schüler würden dies sogar begrüßen und die Kommunikation wäre scheinbar erleichtert. Doch gilt dies nur für den Augenblick, denn auf lange Sicht wird mathematische Kommunikation dadurch erschwert. Fehlende Begriffskenntnis führt dazu, dass Lehrbücher nicht verstanden, die Kommunikation mit künftigen Lehrkräften und ein Weiterlernen nach der Schule erschwert werden. Selbst die Anfrage an eine Suchmaschine im Internet verlangt die Kenntnis notwendiger Fachbegriffe. Dem gegenüber ist aber mitunter ein Verzicht auf bestimmte Fachbegriffe in Lerngruppen notwendig. Beispiel: Die Gleichung 2 x + 6 = (x + 3) 2 ist eine Tautologie. In einer Schulklasse, deren Bildungsziel die Berufsbildungsreife ist, kann man auf diesen Begriff verzichten. In einer Schulklasse mit dem Ziel der Begabtenförderung kann man ihn jedoch problemlos verwenden. Bei der Nutzung von Fachbegriffen ist ein gezieltes Abwägen ratsam. Eine Überfrachtung des Unterrichtes mit Fachbegriffen kann auch zu einer Überforderung führen und dadurch Kommunikationserfolge verhindern. Das Abwägen der Sinnhaftigkeit bestimmter Fachbegriffe für eine Lerngruppe sollte Bestandteil der Überlegungen von Lehrkräften im Rahmen ihrer Unterrichtsvorbereitung sein. Weitere Beispiele für abzuwägende Fachbegriffe sind u. a. Diskriminante, äquivalent, Radikand, Numerus, Polygon Vgl. Gallin/Urs Vgl. Winter 1995
215 Bedeutung der Wortschatzarbeit im Mathematikunterricht Fällt die Entscheidung zugunsten des Fachbegriffes, dann müssen Überlegungen angestellt werden, wie Begriffssicherheit erreicht werden soll. Einzelne Begriffe lassen sich mitunter im Verlauf des Unterrichts ohne zusätzlichen Aufwand prägen. Der Begriff wird an der notwendigen Stelle genannt, seine Bedeutung im Unterrichtsgespräch geklärt, er wird ggf. notiert und ab diesem Zeitpunkt häufig verwendet. Erstrebenswert ist eine Anknüpfung des neuen Begriffes an schon bekannte Worte. Mitunter sind Begriffe jedoch schwieriger zu erfassen und zu merken oder es ist notwendig, eine Vielzahl von Fachbegriffen innerhalb kurzer Zeit neu einzuführen. Diese Situation tritt häufig am Anfang der Bearbeitung eines neuen Themengebiets auf. Dann muss in Betracht gezogen werden, Übungen zur Verwendung dieser neuen Begriffe durchzuführen. Mit dieser bewussten Arbeit am Fachwortschatz beschäftigt sich das Kapitel Allgemeinwortschatz im Mathematikunterricht Nicht nur unzureichend ausgeprägte Kompetenz in Bezug auf mathematische Fachbegriffe kann eine Lern- oder Leistungsbarriere darstellen. Auch Probleme mit der allgemeinen Sprache wirken sich aus. Mangelnde allgemeinsprachliche Kompetenz führt dazu, dass Verständigungsprobleme auftreten, sogar Verwirrung oder Unmut entstehen, Aufgabenstellungen nicht richtig erfasst werden und eine zielführende Bearbeitung damit zumindest erschwert wird. Natürlich ist es Aufgabe der Schule, allgemeinsprachliche Kompetenz zu entwickeln. Diese Entwicklung ist jedoch ein Prozess, der über mehrere Niveaustufen verläuft. Bei der Formulierung von Aufgabenstellungen im Mathematikunterricht muss das aktuelle Sprachniveau der Lerngruppe oder, im Sinne von Inklusion, sogar der einzelnen Lernenden berücksichtigt werden. Das gilt im besonderen Maße für schriftliche Lern- und Leistungsaufgaben, aber auch für mündliche Fragestellungen, Impulse, Erläuterungen etc. Aus Sicht des Aufgabenstellers, der nach erfolgreichem Abschluss von Schule und Studium über eine hohe Sprachkompetenz verfügt, sind seine Formulierungen in der Regel genau richtig sie enthalten alles Wesentliche, sind eindeutig und grammatisch korrekt. Für Schülerinnen und Schüler können sie dennoch problematisch sein. Verständnisprobleme entstehen u. a. durch:» Verwendung von Fremdwörtern (z. B. Reduzierung, Existenz, Design),» Verwendung von Begriffen, die nicht in Berührung mit der Lebensumwelt bzw. dem Alltag der Lernenden stehen (z. B. Giebel, Feldrain, Lore, Querlenker, Stollen),» lange, zusammengesetzte Wörter [Komposita] (z. B. Kredittlgungsrate)» Satzlängen (z. B. Zeichne ein Quadrat von 5 cm Seitenlänge, schneide es aus, zerlege es in zwei oder vier Dreiecke und setze sie zu einem großen Dreieck zusammen. ) Lange Sätze bestehen oft aus mehreren Haupt- und Nebensätzen, die anstatt des Objektes ein Pronomen enthalten, das sich auf ein vorheriges Objekt im Satz bezieht. Das ist für Schülerinnen und Schüler mit noch gering ausgeprägter Sprachkompetenz schwierig zu dechiffrieren, insbesondere bei Schachtelsätzen oder nachgeschobenen Erklärungen bzw. bei Umschreibungen.» häufige Genitivverwendung (z. B. Schnittpunkt der Mittelsenkrechten der Grundkanten des Tetraeders),» Verschleierung logischer Zusammenhänge durch Umstellung von Satzgliedern, z. B. bei Implikationen (am besten ist immer die klassische Wenn..., dann... -Satzstruktur), 215
216 Sprachsensibler Fachunterricht Mathematik» Verwendung von Synonymen, die Texte zwar sprachlich interessanter machen, aber häufig verwirren, weil nicht klar ist, ob mit dem Synonym dasselbe oder doch etwas anderes gemeint ist,» extrem knappe, redundanzfreie Formulierungen, bei denen es auf jedes einzelne Wort ankommt und man leicht etwas Wichtiges überliest bzw. überhört,» Verwendung des mathematischen Konjunktivs ( Sei eine Funktion mit... ),» nachgeschobene Zusatzinformationen oder Randbedingungen, die eigentlich zu den voranzustellenden Voraussetzungen einer Aufgabe gehören,» Mischungen aus Sprache und Symbolketten so, dass ein Teil der Symbole als Satzglied zu lesen ist (z. B. Eine Nullstelle liegt vor, wenn (x) = 0 ist. Sprachlich besser: Eine Nullstelle liegt dann vor, wenn gilt: (x) = 0.)» Partizipialkonstruktionen (z. B. die das Dreieck halbierende Gerade). Auch verwenden Fachlehrkräfte routinemäßig fachspezifische Kollokationen. Das sind häufig gemeinsam auftretende Worte, die in ihrem Zusammenwirken mitunter eine spezielle Bedeutung haben, z. B.: eine Höhe konstruieren, eine Gleichung auflösen. Die Problematik aus Sicht des unkundigen Lesers besteht darin, dass die einzelnen Worte eine andere Bedeutung haben als ihre Kollokation. Weitere Beispiele aus dem Artikel Wortschatzarbeit von Tanja Tajmel 3 : Kollokation einen Mittelwert bilden Geraden laufen zueinander parallel eine Gerade schneiden von der Zeit abhängen eine Zahl einsetzen eine Zahl herausheben eine Gleichung aufstellen eine Gleichung auflösen Umschreibung Ein Mittelwert wird ausgerechnet. Zwei Geraden sind parallel. Eine Gerade wird mit einer anderen Linie gekreuzt. Eine Größe verändert sich mit der Zeit. In einer Gleichung wird eine bestimmte Zahl anstelle einer Variablen verwendet. Eine Zahl wird als eigener Faktor mit einem mathematischen Ausdruck, der durch diese Zahl gebrochen wurde, multipliziert. Für einen mathematischen Zusammenhang wird eine Gleichung niedergeschrieben, die diesen Zusammenhang in eindeutiger Weise ausdrückt. (Neue Kollokation: Zusammenhang ausdrücken) Eine Gleichung wird so umgeformt, dass auf der einen Seite nur x steht. (Neue Kollokation: Gleichung umformen) Oder Eine Gleichung wird so ausgerechnet, dass auf der einen Seite nur x steht. (Verständlicher, aber mathematisch nicht exakt.) 3 Tajmel
217 Bedeutung der Wortschatzarbeit im Mathematikunterricht In einigen Situationen muss damit gerechnet werden, dass unterschiedliche Sprachniveaus zum Problem werden können. Dazu gehören Prüfungen und Vergleichsarbeiten sowie die Verwendung von Materialien und Aufgabenstellungen, die ursprünglich für andere Bildungsgänge oder Jahrgangsstufen konzipiert waren. Auch für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache muss die Sprachproblematik Bestandteil pädagogischer und methodischer Überlegungen sein. 217
218
219 2 Möglichkeiten des Aufbaus eines Fachwortschatzes 2.1 Bewusste Arbeit am Fachwortschatz Josef Leisen, der bereits vielfach zum Thema Sprachförderung in der Schule publizierte, charakterisiert Wortschatzarbeit durch folgende Leitlinien 4 :» führt neue Begriffe und Sprachstrukturen nicht isoliert ein,» semantisiert im fachlich relevanten Kontext,» verwendet und grenzt neue Begriffe und Sprachstrukturen in bekannten Wortfeldern ab,» führt neue Begriffe und Sprachstrukturen über mehrere Stufen sprachlicher Fassungen ein,» liegt knapp über dem jeweiligen Entwicklungsstand der Lernenden,» führt zu relevanten mündlichen und schriftlichen Äußerungen,» verbindet sprachliche Unterweisung und interaktives, kommunikatives Handeln,» vermeidet mechanischen Sprachgebrauch,» fördert das Sprachbewusstsein. Leisen 5 gibt zudem folgende methodische Anregungen zur Wortschatzarbeit:» Begriffe nicht fragend erarbeiten, sondern im Gebrauch einführen,» verschiedenste Darstellungsformen nutzen,» Wortschatzarbeit mit Methoden-Werkzeugen methodisch abwechslungsreich gestalten,» eine überformende Fehlerkorrektur bevorzugen,» Wortschatz im Verwendungszusammenhang üben. 4 Leiser Ebenda 219
220 Sprachsensibler Fachunterricht Mathematik Claudio Nodari und Cornelia Steinemann beschreiben fünf Phasen der Wortschatzarbeit 6, die sich durchaus auf die Erarbeitung eines Fachwortschatzes übertragen lassen, was die im Kapitel 3 angefügten Beispiele verdeutlichen sollen. Phasen Wörter und Formulierungen kontextbezogen einführen Wörter und Formulierungen üben Wörter und Formulierungen nutzen Über Wörter und Formulierungen reflektieren Überprüfen Beschreibung Damit neue Wörter und Formulierungen im Gedächtnis schnell abrufbar werden, müssen sie in möglichst verschiedenen Kontexten (z. B. Texte, Bilder, Zeichnungen, Grafiken, Simulationen) eingeführt und angewandt werden, denn die Bedeutung vieler Wörter erschließt sich erst aus dem Satz-, Situations- oder Handlungskontext. Es ist wichtig, Lernsituationen zu schaffen, in denen die Schülerinnen und Schüler die neuen Wörter und Formulierungen üben können. Man ermöglicht somit das wiederholte Abrufen der Wörter, dass diese reproduziert, deren Bedeutungen zunehmend genauer erfasst und formuliert werden können. Dabei werden die Vernetzungen im Gehirn aktiviert, verstärkt und Wissensnetze erweitert und gefestigt. Wörter, die bereits verstanden und mehrfach reproduziert worden sind, können durchaus wieder vergessen werden, wenn sie nicht regelmäßig gebraucht werden. Für den Aufbau eines differenzierten Wortschatzes ist es unabdingbar, Lernende zum selbstständigen Gebrauch der neuen Begriffe und Formulierungen zu führen. Dieses Prinzip der Wiederholung dient der Festigung eines Mitteilungswortschatzes. Aufgaben, die die Anwendung der Wörter und Formulierungen in verschiedenen Kontexten berücksichtigen, intendieren diesen Sachverhalt. Um eine Wortschatzanalysekompetenz bei Lernenden zu entwickeln, muss man ihnen ermöglichen, den Wortschatz bewusster wahrzunehmen und Strategien zu entwickeln, mit denen sie scheinbar unbekannte Wörter ohne weitere Hilfe verstehen können. Für das Nachdenken über Wortbedeutungen sollten im Fachunterricht bewusst Phasen geplant werden, die gleichzeitig zur Festigung, Systematisierung und Anwendung genutzt werden können. Die Wortschatzarbeit im Fachunterricht sollte verbindlich sein und den Lernenden bewusst gemacht werden. Voraussetzung dafür ist die gründliche Einführung und Reflexion der Wörter und Formulierungen. Im Zusammenhang mit der Überprüfung des entsprechenden Fachwissens sollte auch der fachsprachlich korrekte/angemessene Gebrauch der jeweiligen Wörter und Formulierungen Teil von Lernerfolgskontrollen in den Fächern sein. Die Bearbeitung einer Aufgabe sollte den Lernenden nach der schrittweisen Erarbeitung der Begriffsbedeutungen leichter fallen, weil Sach- und Sprachwissen miteinander verknüpft werden Nodari/Steinmann 2008
221 Möglichkeiten des Aufbaus eines Fachwortschatzes Die bewusste Arbeit am Fachwortschatz soll jedoch keine Ausweitung des Deutschunterrichtes darstellen und sie darf auch nicht zu Lasten der inhaltlichen Arbeit gehen. Dazu schreibt Leisen 7 : Wovon wir als Fachlehrer die Finger lassen sollten:» von grammatischer Nachhilfe, weil wir davon zu wenig verstehen,» von belehrenden Fehlerkorrekturen, weil sie für das Weiterlernen fatal sind,» von isolierten Übungen, weil sie nicht in kommunikativen Verwendungssituationen greifen,» von einseitigen Methoden, weil sie den vielfältigen Erwerbsprozessen nicht gerecht werden. Wortschatzarbeit sollte permanent Bestandteil des Unterrichtes sein. Mitunter ist es jedoch notwendig, sich dieser Arbeit besonders zuzuwenden. In diesem Fall kann man besondere Methoden verwenden, um die Begriffsbildung und die Einübung von Formulierungen zu unterstützen.» Eine Möglichkeit ist die Nutzung von Lernkarteikästen. Diese sind dann sinnvoll, wenn eine größere Menge neuer Begriffe und Formulierungen erforderlich ist.» Bei einer überschaubaren Menge von Begriffen, die in einem begrenzten Zeitraum besonders intensiv genutzt werden, bietet sich eine Wortschatzliste an. Diese wird, für alle gut lesbar, im Unterrichtsraum ausgestellt und ist für die gesamte Arbeitszeit einsehbar.» Arbeitstechniken zum Lesen und zur Systematisierung von Begriffen und Formulierungen und ihren Beziehungen zum Unterrichtsgegenstand machen.» Rätsel wirken anspornend und regen zum Umgang mit Begriffen an. Man kann Rätsel lösen (siehe Beispiele in Kapitel 3) oder auch von Schülerinnen und Schülern erstellen lassen. Soll besonders intensiv an notwendigen Begriffen und Formulierungen gearbeitet werden, kann man auch Methoden der Mnemotechnik verwenden. Eine Methode, die auf dem Prinzip der Loci-Methode aufbaut, ist die Schrift an der Wand 8. Dazu ist es günstig, aber nicht zwingend notwendig, wenn die Klasse immer im selben Raum den Fachunterricht hat oder sogar ein Klassenraum vorhanden ist. Die Begriffe oder Lernwörter werden auf Schilder geschrieben und diese an verschiedenen Stellen des Unterrichtsraumes aufgehängt. Falls notwendig, können kurze Erklärungen mit auf dem Schild untergebracht werden. Unterschiedliche Schildfarben oder -formen bieten zusätzliche visuelle Anker. Die Lehrerimpulse kennzeichnen die Lernschritte: 1. Merkt euch, wo welches Schild hängt. Ihr habt eine Minute Zeit. 2. Schließt jetzt eure Augen. Wenn ich nun einen Begriff nenne, zeigt ihr dahin, wo ihr das passende Schild in Erinnerung habt. Ihr macht dann die Augen auf und schaut ob ihr Recht habt. Dann kommt der nächste Begriff. 9 Dabei wird der Raum als Erinnerungsanker genutzt und die räumliche Intelligenz angesprochen. Die Schilder können einige Unterrichtstage hängen bleiben. Wenn die Begriffe im Unterricht auf 7 Leisen Vgl. Handke Ebenda 221
222 Sprachsensibler Fachunterricht Mathematik tauchen, wenden die Schülerinnen und Schüler sich den Schildern bei Bedarf zu. Nimmt man die Schilder nach einiger Zeit ab, so kann man beobachten, wie einige Schüler zu der Stelle blicken, wo einst das entsprechende Schild hing. Einige Schülerinnen und Schüler nutzen diese Technik dann auch zu Hause und tapezieren ihr Zimmer oder die Wohnung mit Klebezetteln durchaus mit beachtlichem Erfolg. Ein Beispiel für drei Schilder, die im Unterricht genutzt wurden, ist das folgende. Hier sollte eine 6. Klasse die Begriffe Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetz lernen, da sie Grundlage der späteren Termumformungen sind. Deshalb wurden folgende Schilder benutzt: Kommutativgesetz Assoziativgesetz = Distributivgesetz = = (20 + 4) = = = 7 (98 + 2) = = Sprache als Bestandteil des Mathematikunterrichts Die KMK-Bildungsstandards 10 für das Fach Mathematik beschreiben neben den inhaltsbezogenen Kompetenzen auch allgemeine mathematische Kompetenzen. Darin finden sich folgende Anforderungen, die in direktem Bezug zur Sprachkompetenz stehen: (K 1) Mathematisch argumentieren Dazu gehört:» Fragen stellen, die für die Mathematik charakteristisch sind ( Gibt es?, Wie verändert sich?, Ist das immer so? ) und Vermutungen begründet äußern,» mathematische Argumentationen entwickeln (wie Erläuterungen, Begründungen, Beweise),» Lösungswege beschreiben und begründen. (K 2) Probleme mathematisch lösen Dazu gehört:» vorgegebene und selbst formulierte Probleme bearbeiten,»,» die Plausibilität der Ergebnisse überprüfen sowie das Finden von Lösungsideen und die Lösungswege reflektieren Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2004
223 Möglichkeiten des Aufbaus eines Fachwortschatzes (K 3) Mathematisch modellieren Dazu gehört:» den Bereich oder die Situation, die modelliert werden soll, in mathematische Begriffe, Strukturen und Relationen übersetzen,» (K 5) Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen Dazu gehört:»,» symbolische und formale Sprache in natürliche Sprache übersetzen und umgekehrt, (K 6) Kommunizieren Dazu gehört:» Überlegungen, Lösungswege bzw. Ergebnisse dokumentieren, verständlich darstellen und präsentieren, auch unter Nutzung geeigneter Medien,» die Fachsprache adressatengerecht verwenden,» Äußerungen von anderen und Texte zu mathematischen Inhalten verstehen und überprüfen. Fachliche Inhalte können zwar durch Instruktion vermittelt werden, aber eine bloße Instruktion wird kaum ausreichen, um auf Seiten der Lernenden eine Kompetenz zu entwickeln. Allgemeine Kompetenzen sind gar nicht instruierbar. Sie werden durch Handeln erworben. Von den 19 allgemeinen Kompetenzen der KMK-Bildungsstandards sind die o. g. 10 Kompetenzen nur unter Einsatz sprachlicher Mittel zu erreichen. Damit wird offensichtlich, dass Sprachbildung im Fach Mathematik keine zusätzliche Aufgabe ist, sondern notwendiger Bestandteil des Unterrichts mit dem Ziel der Umsetzung der Bildungsstandards. Um diese Standards zu erreichen, müssen entsprechende Aufgabenstellungen, die die Sprache als Bestandteil des Mathematikunterrichts ausdrücklich berücksichtigen, Gegenstand des Mathematikunterrichts werden. Zwei Beispiele zum Argumentieren und zum Kommunizieren finden sich im nachfolgenden Kapitel
224
225 3 Aufgabenstellungen zur besseren Einbindung von Sprache in den Mathematikunterricht 3.1 Beispiele aus der Schulpraxis Die nachfolgenden Beispiele wurden von Kolleginnen und Kollegen bereits im Unterricht eingesetzt. [Die jedem Beispiel nachgestellte Klammer beschreibt den bisherigen Unterrichtseinsatz.] a) Kontext zum Einstieg in ein Fachthema Einstiege über einen Kontext verbinden Sprache und mathematische Strukturen von Anfang an und machen die Nützlichkeit von Mathematik deutlich. Nach der in Kapitel 2.1 beschriebenen Phaseneinteilung repräsentiert diese Aufgabe sowohl Phase 1, das kontextbezogene Einführen, als auch Phase 3, das Verwenden von Sprache. Dem erhöhten Leseaufwand von Kontextaufgaben muss Beachtung geschenkt werden. Nach einer angemessenen Einlesephase sollte es Gelegenheit zur Kommunikation geben. Dabei können unbekannte Formulierungen geklärt werden, wie z. B. Tagesumsatz im nächsten Beispiel. Man kann das Sich-hinein-denken auch fördern, indem man passende Anschauungsmaterialien (Operationsobjekte) präsentiert, hier z. B. eine Cornflakespackung oder ein Diätbuch. Nährwerte Oma hat über die Weihnachtsfeiertage etwas zugenommen. Um wieder in Form zu kommen, hat sie ihren alten Diätratgeber hervorgeholt. Neben vielen nützlichen Tipps enthält er Nährwerttabellen. Genau da liegt das Problem. Das Buch ist toll und Oma will es auf keinen Fall gegen ein neues eintauschen, aber alle Angaben sind in der alten Einheit 1 kcal beschrieben. Um ihre aufgenommene Energie zu berechnen und mit ihrem Tagesumsatz vergleichen zu können, wäre es wichtig, dass die Angaben in der aktuellen Einheit 1 kj angegeben sind. 225
226 Sprachsensibler Fachunterricht Mathematik»» Ihr Enkel soll helfen. Er hat auch schon eine Idee. Auf seiner Cornflakespackung findet er folgende Angabe: 100 g Cornflakes enthalten 410 kcal ( kj). Er nimmt sich die erste Seite des Diätbuches vor, rechnet um und schreibt die Angaben in die Tabelle. Beschreibe, wie DU vorgehen würdest.» Rechne dabei ein Beispiel vor. Ergänze die Tabelle entsprechend. [Jahrgangsstufe 6, Gymnasium] b) Aufgabe zum Kommunizieren Aufgaben zum Kommunizieren regen zu Sprachverwendung an. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit, bekannte Begriffe und Formulierungen zu nutzen. Doppelter Rabatt? 10% für alle auf unsere Gartenartikel Ein Bau- und Gartenmarkt gewährt Stammkunden mit Treukarte einen Rabatt*) von 3 % auf alle Einkäufe. Bei einem frühherbstlichen Ausverkauf von Saisonartikeln wird allen Kunden ein Rabatt von 10 % auf Gartenartikel gewährt. Ein Stammkunde möchte während des Ausverkaufs seine Gartenartikel bezahlen und natürlich seine Rabatte nutzen. Sollte er den ursprünglichen Preis erst um 10 % und dann um 3 % oder erst um 3 % und dann um 10 % reduzieren lassen? Befrage einen Erwachsenen zu diesem Problem und kommentiere dessen Aussagen. *) Rabatt bedeutet, dass sich der ursprüngliche Preis einer Ware um den angegebenen Prozentsatz verringert. [Jahrgangsstufe 7, Gymnasium und Jahrgangsstufe 8, Realschule Schweiz] 226
227 Aufgabenstellungen zur besseren Einbindung von Sprache in den Mathematikunterricht c) Aufgaben zum Argumentieren Aufgaben zum Argumentieren sind nicht nur zur Erfüllung der KMK-Bildungsstandards notwendig, sondern regen zuallererst zur Sprachverwendung im Mathematikunterricht an. Sie leisten damit einen Beitrag zur allgemeinen Sprachentwicklung. Die Bankräuber Vier Verdächtige Jack Knackauf, Karl Kerbholz, Gamaschen-Ede und Willi Klauer werden in der Bank, die gerade überfallen wurde, verhört. Alle Verdächtigen werden befragt und antworten wie folgt: Jack Knackauf: Karl Kerbholz hat die Bank überfallen. Karl Kerbholz: Willi Klauer ist der Dieb. Gamaschen-Ede: Ich habe den Überfall nicht begangen. Willi Klauer: Karl Kerbholz lügt. Nur einer hat die Bank überfallen und nur genau eine der Aussagen ist wahr. Wer ist der Bankräuber? Begründe. [Jahrgangsstufe 7, Gymnasium] Ein Dreieck bauen In der Schule sind Dreiecke das neue Thema. Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse sollen als Hausaufgabe jeweils drei Holzleisten mitbringen, aus denen ein Dreieck gebaut werden soll. Marek fand im Keller Leisten mit den Längen 35 cm, 20 cm und 10 cm. Seine Schwester meint: Na damit kann es ja nicht klappen.» Erkläre, warum die Leisten so nicht geeignet sind.» Welchen Ratschlag kannst du Marek geben, damit er sein Dreieck bauen kann? [Jahrgangsstufe 7, Gesamtschule] 227
228 Sprachsensibler Fachunterricht Mathematik d) Aufgaben zum Üben von Wörtern und Begriffen Gitterrätsel In dem Buchstabengitter befinden sich Begriffe zum Thema Funktionen. Sie sind waagerecht, senkrecht und diagonal, jeweils vorwärts oder rückwärts gelesen, versteckt. Ein Begriff ist bereits eingekreist. Finde mindestens 14 weitere Begriffe. S X A H C I E R E B E T R E W T C D A R S T E L L U N G Y E E O H Z U O R D N U N G G F Q I P Y E D A R E G E Z M R U R G G P L I T N E M U T R A N H E L E L N T X E Z H K R P K C N B R E T A E L U S N K H T S D U B B E Y I L W U U P E I I N G E A R E N E P C P H D O T E E L T V A O T A U D E S N A L I N E A R T S R R N M M S R L T D T L Q O L A T I K I W D A S S R L S N L B R E B T E A F N Q E F S O U E R B N X R U I A P W H F M N L R T E D T Q Weiterführend: Erkläre die Bedeutung deiner gefundenen Begriffe. Lösung: Folgende 22 Begriffe sind versteckt: Funktion in Funktionswert, Nullstelle, Scheitelpunkt, Anstieg, Wertebereich, Monotonie, Wertetabelle, Graph, Darstellung, Argument, steigend, fallend, Intervall, Gerade, Parabel, Hyperbel, eindeutig, Zuordnung, linear, quadratisch, Punkt. [Jahrgangsstufe 9, Gesamtschule] 228
229 Aufgabenstellungen zur besseren Einbindung von Sprache in den Mathematikunterricht Geometrisches Begriffsrätsel In den folgenden Dreiergruppen gehören zwei Begriffe zusammen, einer passt nicht dazu. Finde die Begriffe in jeder Gruppe, die nicht hineinpassen. Begründe deine Entscheidung. a. Mantelflächeninhalt Rauminhalt Oberflächeninhalt b. Quader Kreis Dreieck c. Kugel Kegel Kreis d. Sehne Kathete Tangente e. Quadratmeter Hektar Liter f. Kubikmeter Hektar Liter g. Kreiskegel Tetraeder Zylinder h. Kubikmeter Volumen Fläche i. Flächeninhalt Umfang Hektar j. Raute Quadrat Fünfeck k. rechtwinklig gleichseitig gleichschenklig l. Pythagoras Thales Sokrates Lösung: a) Rauminhalt; b) Quader; c) Kreis; d) Kathete weil keine Linie in Bezug zum Kreis oder d) Tangente weil Sehnen und Katheten sind Strecken, die Tangente eine Gerade; e) Liter; f) Hektar; g) Tetraeder da keine runde Grundfläche oder g) Zylinder da Deckfläche und keine Spitze; h) Fläche da Kubikmeter eine Volumeneinheit ist oder h) Kubikmeter da Fläche und Volumen Größen sind und der Kubikmeter eine Einheit; i) Umfang oder Hektar vgl. h); j) Fünfeck; k) rechtwinklig; l) Sokrates. [Jahrgangsstufe 8, Gesamtschule] Buchstabensalat zur Stochastik Hier ist einiges durcheinander geraten. Bilde die richtigen mathematischen Begriffe aus dem Themengebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. AFLLUZ EEGIINRS BEEGINRS EEGMN AACELLP AADGIMMR AIIKSSTTT ADEIMN AEIMNOPRTTU ADELMORTW EEILMRTTTW AAABDGIMMMRU AEELNRRTTWZ ACCEEHHHIIIKLNRSTW Lösung: Zufall Ereignis Ergebnis Menge Laplace Diagramm Statistik Median Permutation Modalwert Mittelwert Baumdiagramm Zentralwert Wahrscheinlichkeit [Jahrgangsstufe 8 und 9, Gesamtschule] 229
230 Sprachsensibler Fachunterricht Mathematik Zwei Dutzend Behauptungen über Vierecke Entscheide, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. Falls falsch bitte begründen! 1. Die Summe der Innenwinkel in einem Viereck beträgt Ein Trapez hat mindestens zwei parallele Seiten. 3. Ein Rhombus ist immer ein Trapez. 4. Ein Rhombus ist immer ein Drachenviereck. 5. Jedes Drachenviereck ist ein Trapez. 6. Bei jedem Parallelogramm stehen die Diagonalen senkrecht aufeinander. 7. Bei folgenden Vierecken halbieren sich die Diagonalen immer: Quadrate, Rhomben, Rechtecke, Parallelogramme. 8. In jedem Parallelogramm sind benachbarte Winkel gleich groß. 9. Alle Quadrate sind Trapeze. 10. Alle Trapeze sind Parallelogramme. 11. Jedes Quadrat ist zugleich auch Rechteck, Drachenviereck, Rhombus und Parallelogramm. 12. Es gibt Drachenvierecke, bei denen die Diagonalen nicht senkrecht aufeinander stehen. 13. Ein Drachenviereck kann kein Trapez sein. 14. In jedem Rechteck stehen die Diagonalen senkrecht aufeinander. 15. Im Trapez müssen sich die Diagonalen gegenseitig halbieren. 16. In einem Trapez können sich die Diagonalen gegenseitig halbieren. 17. Wenn ein Viereck einen Inkreis hat, dann kann es kein Trapez sein. 18. Kein Drachenviereck hat einen Umkreis. 19. Alle Drachenvierecke haben einen Umkreis. 20. Es gibt konkave Drachen. 21. Die Diagonalen einer Raute sind auch deren Symmetrieachsen. 22. Die Diagonalen eines Rechteckes sind auch dessen Symmetrieachsen. 23. Ein Drachenviereck hat keine Symmetrieachsen. 24. Quadrate sind Drachenvierecke. [Jahrgangsstufe 6 und 7, Gymnasium und Realschule Mecklenburg-Vorpommern] 230
231 Aufgabenstellungen zur besseren Einbindung von Sprache in den Mathematikunterricht 3.2 Aufgabenformulierungen ändern und dabei verbessern Ob eine Aufgabenstellung oder ein Fachtext leicht oder schwer verständlich ist, hängt von der Qualität der Aufgabenformulierung und vom Niveau der Sprachkompetenz der Schülerinnen und Schüler ab. Um diese zu entwickeln, müssen Über- und Unterforderung vermieden werden. Mathematikunterricht muss auch einen Beitrag zur Entwicklung von Sprachkompetenz leisten, aber seine vorrangige Aufgabe ist die Entwicklung mathematischer Kompetenzen. Um dabei keine zusätzlichen Verständnishürden aufzubauen, ist es notwendig, die Formulierung von Aufgabenstellungen und Arbeitsaufträgen dem Sprachniveau der Lernenden angemessen zu gestalten. Ein Kriterium für die Verständlichkeit eines Textes ist der Lesbarkeitsindex LIX. Dieser lässt sich folgendermaßen berechnen: LIX = durchschnittliche Satzlänge + relative Häufigkeit langer Wörter in Prozent Die durchschnittliche Satzlänge berechnet sich aus der Gesamtzahl der Wörter dividiert durch die Anzahl der Sätze. Der zweite Summand ergibt sich aus der Anzahl der Wörter mit mehr als sechs Buchstaben, dividiert durch die Gesamtzahl der Wörter, das Ergebnis multipliziert mit 100. Auch wenn die Berechnung des LIX mathematisch nicht sehr anspruchsvoll ist, gestaltet sich die Handhabung doch zeitaufwändig. Möchte man den LIX eines Textes bestimmen, so kann man sich einen LIX-Rechner aus dem Internet herunterladen. Man findet ihn über eine Suchmaschine oder direkt unter: Vorhandene digitalisierte Texte können einfach markiert, mit STRG+C kopiert und in das Eingabefeld mit STRG+V übertragen werden. Der berechnete LIX wird automatisch in Schwierigkeitsstufen klassifiziert, von sehr niedrig bis sehr hoch. Als Vergleich können folgende Richtwerte für Textgattungen dienen: LIX unter 40 Kinderund Jugendliteratur, LIX Belletristik, LIX Sachliteratur und LIX über 60 Fachliteratur. Der Lesbarkeitsindex LIX berücksichtigt jedoch nur Wort- und Satzlängen und damit nicht das komplette Spektrum von Sprachproblemen. Ablesbar ist, dass es im Sinne besserer Lesbarkeit mitunter ratsam ist, kürzere Sätze zu bilden. Als Beispiel soll die in Kapitel 1.3 schon zitierte Aufgabe Zeichne ein Quadrat von 5 cm Seitenlänge, schneide es aus, zerlege es in zwei oder vier Dreiecke und setze sie zu einem großen Dreieck zusammen. dienen. Der LIX beträgt hier 57. Diese Aufgabenstellung lässt sich anders gestalten: Zeichne ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 5 cm. Schneide das Quadrat aus und zerlege es in zwei oder vier Dreiecke. Lege diese Dreiecke zu einem großen Dreieck zusammen. Die bessere Lesbarkeit ist offensichtlich, der LIX beträgt nun 44. Zudem wurde der Text zusätzlich mit Spiegelstrichen strukturiert. Nicht immer bringt eine Verkürzung von Texten einen Verständnisvorteil, insbesondere dann, wenn mit der Verkürzung erklärende Informationen oder interessante Details wegfallen. Beispiel: Das gleichförmig fahrende Auto hat eine Geschwindigkeit von 50 km h -1., umzuformulieren in: Ein Auto fährt gleichförmig. Seine Geschwindigkeit beträgt 50 km h -1., verbessert die Lesbarkeit kaum. Es lohnt sich aber, über die Texte, mit denen man die Schülerinnen und Schüler konfrontiert, nachzudenken und ggf. angemessen zu reduzieren. 231
232 Sprachsensibler Fachunterricht Mathematik Aus dem Comenius-Fortbildungsprojekt BaCuLit 11 stammt die folgende Liste von Strategien zur Vereinfachung von Fachtexten: 1. Vereinfachung beim Schreibstil: konkrete, anschauliche Wörter, Verben im Aktiv sowie einfache Satzkonstruktionen nutzen. LIX < Lockerung der Informationsdichte: Bei längeren Texten sind Wiederholungen und Nutzung von Worten mit ähnlicher Bedeutung nützlich. Bei kürzeren Texten ist es nicht sinnvoll, möglichst viele Informationen in einem Satz unterzubringen. 3. Vereinfachung der Gliederung/Textstruktur: Ziel ist eine logische und für den Leser transparente Struktur. 4. Präsentationsform der Hauptideen: Inhalt strukturieren, Analogien nutzen, Hauptideen durch Fett- oder Kursivdruck hervorheben. 5. Motivationale Aspekte: Interessant dargebotene zusätzliche Details, die sich direkt auf das Thema beziehen, erhöhen das Behalten wichtiger Informationen. Details können auch durch passende Abbildungen dargestellt werden. Neben der sprachlichen Veränderung von Texten hat auch das Aussehen von Texten Einfluss auf die Lesbarkeit. Absätze strukturieren die Informationen. Eine Aufzählung von Fakten liest sich besser, wenn sie als Liste mit Aufzählungszeichen (Spiegelstrichen) präsentiert wird. Umfangreiches Zahlenmaterial bringt man besser in Tabellen oder Schaubildern unter. Illustrationen machen lange Texte deutlich attraktiver. 3.3 Operatoren Genaue Handlungsanleitungen für die Schülerinnen und Schüler sind im Unterricht unabdingbar. Eine wichtige Rolle spielen dabei Operatoren. Dies sind Verben gleichsam Schlüsselwörter, die den Schülerinnen und Schülern signalisieren, was sie bei einer Frage oder einer Aufgabe konkret tun sollen, sowohl im Unterrichtsgespräch als auch in schriftlichen Arbeitsaufträgen. Wird eine Aufgabe unklar formuliert, führt dies zu Verunsicherung oder gar zu Missverständnissen, da das Ziel des Auftrags unklar bleibt. Eine Frage wie zum Beispiel: Welche Ursachen hatte die Französische Revolution? lässt offen, ob die Schülerinnen und Schüler diese Ursachen einfach aufzählen sollen oder ob sie einen Text durchlesen, nach den dort erwähnten Ursachen suchen und diese dann beschreiben sollen. Möglich wäre auch, dass sie die Ursachen erklären, begründen oder diskutieren sollen. Nur leistungsstarke Schülerinnen und Schüler werden einen solchen Arbeitsauftrag so ausführen, dass möglichst viele der zu vermutenden Absichten des Lehrers bzw. der Lehrerin dabei erfüllt werden. Operatoren präzisieren das Ziel von Arbeitsaufträgen, sorgen dabei für Orientierung und erleichtern die Bearbeitung von Aufgaben. Manche Lehrwerke enthalten daher Listen von Operatoren und erklären in einer für Schülerinnen und Schüler verständlichen Alltagssprache, welche geforderte Handlung mit dem jeweiligen Operator verbunden ist. Auch die Konferenz der Kultusminister (KMK) hat für einige Fächer Operatoren insbesondere für die Verwendung in der Sekundarstufe II bzw. bei der Erstellung von Klausuraufgaben zusammengestellt Basic Curriculum for Teachers In-service Training in Content Area Literacy in Secondary Schools
233 Aufgabenstellungen zur besseren Einbindung von Sprache in den Mathematikunterricht Diese Listen bleiben jedoch stets fachspezifisch und sind daher als Orientierung für Schülerinnen und Schüler gerade der Sekundarstufe I nur bedingt geeignet. So gibt es z. B. für den Operator analysieren in unterschiedlichen Fächern verschiedene Definitionen. Für Schülerinnen und Schüler ist dies sehr irritierend, und das erst recht, wenn verschiedene Lehrkräfte eines Faches überdies unterschiedliche Aspekte der geforderten Tätigkeit für wichtig halten. Es wäre daher gut, wenn in einem Kollegium eine Einigung darüber hergestellt würde, welche Operatoren fachübergreifend verwendet werden können. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich nämlich, dass viele Operatoren einen gemeinsamen Bedeutungskern haben. Die vorliegende Liste von Operatoren aus den Bereichen Natur- und Gesellschaftswissenschaften sowie Deutsch, Englisch und Mathematik stellt den exemplarischen Versuch dar,» aus den in den einzelnen Fächern genutzten Operatoren diejenigen herauszufiltern, die in allen Fächern verwendet werden. Es wurde also eine Schnittmenge gebildet;» aus den in den Fächern genannten Definitionen den gemeinsamen Kern herauszufiltern;» die so gefundenen Operatoren in einer für Schülerinnen und Schüler verständlichen Sprache zu formulieren. Der Gewinn liegt in der Möglichkeit einer breiten Anwendung dieser Operatoren in vielen Fächern. Operator nennen, angeben beschreiben vergleichen erklären erläutern begründen analysieren, untersuchen diskutieren, erörtern beurteilen Handlung Informationen aufzählen, zusammentragen, wiedergeben Sachverhalte, Objekte oder Verfahren mit eigenen Worten darstellen Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln und darstellen Sachverhalte verständlich und nachvollziehbar machen und in Zusammenhängen darstellen Einen Sachverhalt darstellen und unter Verwendung zusätzlicher Informationen veranschaulichen Sachverhalte, Entscheidungen bzw. Thesen durch (logische) Argumente stützen und sachlich (beispielhaft) belegen Unter einer Fragestellung wesentliche Bestandteile Ursachen oder Eigenschaften herausarbeiten bzw. nachweisen Sich argumentativ mit verschiedenen Positionen auseinandersetzen und ggf. zu einer begründeten Schlussfolgerung gelangen Zu Sachverhalten eine selbstständige Einschätzung formulieren und begründen 233
234
235 Literatur Gallin, Peter/Ruf, Urs (1998): Sprache und Mathematik in der Schule. Seelze: Kallmeyer- Verlag Handke, Ulrike (2008): Mehr Erfolg im Unterricht Ausgewählte Methoden, die Schüler motivieren. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor Leisen, Josef (2007): Workshop: Methoden zur Wortschatzarbeit im Fachunterricht Zusammenfassung_-_Workshop_-_Wortschatzarbeit_01.pdf ( ) Nodari, Claudio/Steinmann Cornelia (2008): Fachdingsda Fächerorientierter Grundwortschatz für das Schuljahr. Lehrmittelverlag des Kantons Aargau Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2004) (Hrsg.): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss. München: Wolters Kluwer Tajmel, Tanja (2011): Wortschatzarbeit im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. In: ide. informationen zur deutschdidaktik, 35 (2011) 1, S Winter, Heinrich (1995): Mathematikunterricht und Allgemeinbildung. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, 61 (1995), S
236
237 Wortschatzarbeit im naturwissenschaftlichen Unterricht Biologie, Chemie, Physik Sabine Both, Oliver Pechstein, Ilona Siehr
238
239 1 Warum ist Wortschatzarbeit im Fachunterricht wichtig? Sprachförderung im Fachunterricht trägt der Tatsache Rechnung, dass die Fachsprache das Werkzeug der Lernenden ist, mit dessen Hilfe sie die neuen Inhalte erschließen und verstehen. Sprachförderung im Fachunterricht geht demnach nicht einfach auf Kosten der Fachinhalte, sondern schaff die Grundlagen für die vertiefte Auseinandersetzung mit ihnen. 1 Dieses Zitat macht dreierlei deutlich:» Es verweist auf die Tatsache, dass es kein Lernen, zumindest kein begriffiches, jenseits der Sprache gibt.» Die Sprache ist auch im Fachunterricht nicht einfach nur eine äußere Hülle des Inhalts, der Gedanken oder der Begriffe. Das Lernen und Entäußern von fachlichen Inhalten vollzieht sich stets in und mittels der Sprache, der Schüler- wie der Lehrersprache. Sprache ist der bildende Organ der Gedanken, mit Hilfe von Sprache werden Sachfachkonzepte an die Lernenden herangetragen, Sprache wird benötigt, um Beobachtungen an und Beschreibungen von Sachverhalten durchführen zu können, Sprache ermöglicht den Gedankenaustausch zwischen den Lernenden und die Diskussion über kontroverse Erkenntnisse.» Spracharbeit im Fachunterricht ist folglich kein ausblendbares Begleitphänomen, sondern als didaktische Ressource zu sehen, die dazu beiträgt, fachliches Lernen als kognitiven und kommunikativen Prozess zu unterstützen. Dass auch im Fachunterricht die Sprache der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen und zu fördern ist, ist ein keineswegs neues Postulat. Die Rede war und ist in diesem Zusammenhang oft vom Deutschunterricht als Unterrichtsprinzip, das für alle Fächer zu gelten habe. Deutschunterricht als Unterrichtsprinzip bedeutet, daß die Muttersprache grundsätzlich in allen Fächern und Teilen des Unterrichts gepflegt wird. 2 1 Nodari/Steinmann 2008, S. 7 2 Ossner 1994, S
240 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Dieser Gedanke, der im alltäglichen Unterricht oft wohl mehr Wunsch als gelebte Praxis war, wird sein einiger Zeit wieder verstärkt aufgegriffen, theoretisch ausgebaut und besonders aus der Sicht des Fachunterrichts mit didaktischen Konzepten und Ideen untersetzt. Was beim Deutschdidaktiker Ossner noch unbestimmt Pflege der Muttersprache heißt, ist z. B. von Leisen als Programm eines sprachsensiblen Fachunterrichts weitergedacht worden. Leisen beschreibt sprachsensiblen Unterricht folgendermaßen: Ein sprachsensibler Fachunterricht widmet sich der Aufgabe die Lernenden zu befähigen, sprachliche Standardsituationen zu bewältigen. Er ist grundsätzlich auf fachliche Kommunikation hin ausgerichtet. Sprachsensible Fachunterricht» verwendet in der Lernsituation die jeweils passende Sprache,» unterstützt das fachliche Verstehen durch eine Vielfalt von Darstellungsformen (Tabellen, Skizzen, Formeln, Graphen, Diagramme, Karten, Bilder ),» festigt, übt und trainiert fachtypische Sprachstrukturen,» ermutigt, unterstützt und hilft den Lernenden durch Sprechhilfen beim strukturierten und freien Sprechen,» trainiert das Hörverstehen,» gibt beim Lesen von Texten Hilfen und übt das Leseverstehen,» vermeidet möglichst sprachliche Misserfolge und stärkt so das sprachliche und fachliche Könnensbewusstsein. 3 Sprachsensibler Fachunterricht, das macht diese Bestimmung deutlich, ist umfassende Spracharbeit. Sie arbeitet mit einem weiten Sprach- und Repräsentationsbegriff und berücksichtigt die grundlegenden kommunikativen Tätigkeiten wie Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben, soweit sie für das fachliche Lernen erforderlich sind. Wortschatzarbeit ist ein besonders relevanter Teil des sprachsensiblen Fachunterrichts. Fachsprachliche Kommunikation ist zwar nicht auf den Gebrauch des Fachwortschatzes zu reduzieren, aber es ist unstrittg, dass die Arbeit an Fachbegriffen und der Herausbildung einen Fachwortschatzes einen westlichen Teil des Fachlernens ausmacht. Claudio Nodari und Cornelia Steinmann 4 beschreiben den Erwerb von Wörtern als einen Prozess der Wortschatzerweiterung und -vertiefung. Um ein Wort richtig zu lernen und korrekt zu benutzen, muss ein Kind viele Informationen aufnehmen und im mentalen Lexikon abspeichern. Ein Wort prägt sich nach einmaligem Lesen nur dann ein, wenn das Kind emotional stark beteiligt ist. In der Regel muss ein Wort bis zu 50 Mal in unterschiedlichen Situationen verwendet werden, bis es Bestandteil des Mitteilungswortschatzes wird. Ein sorgloser Umgang mit Sprache in den Naturwissenschaften kann zu erheblichen Irritationen führen. Obwohl die meisten Problemfälle bekannt sind, ist z. B. noch oft von Energieerzeugung in einem Kraftwerk oder vom Energieverbrauch eines elektrischen Gerätes die Rede. Diese Formulierungen tragen nicht dazu bei, dass der Energieerhaltungssatz von den Lernenden verstanden und richtig angewandt wird Leisen 2007a 4 In Anlehnung an Nodari/Steinmann 2008
241 Warum ist Wortschatzarbeit im Fachunterricht wichtig? Die Schule hat die Aufgabe, das vorhandene Sprachpotenzial, das Schülerinnen und Schüler mitbringen, systematisch zu erweitern und zu differenzieren, so dass Bildungsprozesse erfolgreich verlaufen können bzw. manchmal überhaupt erst ermöglicht werden. Solche wichtigen Fragen, wie:» Kennen die Fachkonferenzmitglieder die Sprachregelungen anderer Fachkonferenzen?» Wird das muttersprachliche Prinzip in allen Fächern ausreichend berücksichtigt?» Welche wortschatzspezifischen Methoden sind wann sinnvoll? sollten im schulinternen Curriculum einer Schule bei der Erarbeitung eines Sprachbildungsprogrammes 5 Berücksichtigung finden. 5 Siehe die Einführung von Dorothea Bolte in diesen Materialien, S. 14f. 241
242 242
243 2 Didaktischer Rahmen der Wortschatzarbeit Wortschatzarbeit wird von Leisen 6 durch folgende Leitlinien charakterisiert: Wortschatzarbeit» führt neue Begriffe und Sprachstrukturen nicht isoliert ein,» semantisiert im fachlich relevanten Kontext,» verwendet und grenzt neue Begriffe und Sprachstrukturen in bekannten Wortfeldern ab,» führt neue Begriffe und Sprachstrukturen über mehrere Stufen sprachlicher Fassungen ein,» liegt knapp über den jeweiligen Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler,» führt zu relevanten mündlichen und schriftlichen Äußerungen,» verbindet sprachliche Unterweisung und interaktives, kommunikatives Handeln,» vermeidet mechanischen Sprachgebrauch, also die Verwendung einförmiger Formulierungen, sondern unterstützt die Nutzung vielfältiger sprachlicher Äußerungen,» fördert das Sprachbewusstsein. Einige Leitlinien werden in dieser Handreichung anhand von Beispielen aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht veranschaulicht. Wichtig ist noch folgender Hinweis: Fachspezifische Wortschatzarbeit ist Arbeit an Wörtern und an einzelwortübergreifenden Wendungen bzw. Formulierungen. Damit soll berücksichtigt werden, dass allein der Fokus auf das Einzelwort (z. B. der Ausdruck Arbeit) zu kurz greift. In den Blick zu nehmen sind auch jene charakteristischen Wendungen, in die ein Ausdruck typischerweise eingebunden ist. Die Fachlichkeit eines Ausdrucks ist gebunden an derartige Formulierungsmuster. So bekommt der Ausdruck Arbeit in den Wendungen Arbeit leisten oder den Begriff Arbeit definieren seinen fachlichen Charakter auch durch die benachbarten Ausdrücke. In den Wendungen Arbeit haben, mir macht die Arbeit Spaß oder ich muss noch zur Arbeit gehen wird deutlich, dass hier die alltagssprachlichen Bedeutung des Ausdrucks gebraucht wird. Viele der im Fachunterricht verwendeten Fachwörter haben eine entsprechende alltagssprachliche Verwurzelung, die den Schüler zumeist bekannt und als Spracherfahrung zu nutzen ist. Erinnert sei nur an 6 Leisen 2007b 243
244 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften den Ausdruck Leben in charakteristischen Wendungen wie Entwicklungsgeschichte des Lebens, Merkmale des Lebens, Leben von 400,, ungeborenes Leben, wie im richtigen Leben. Claudio Nodari und Cornelia Steinemann unterschieden für die allgemeine Wortschatzarbeit fünf Phasen, die sich auch auf die Erarbeitung eines Fachwortschatzes übertragen lassen. Im Folgenden werden diese Phasen jeweils mit Beispielen (siehe Kap. 4) für den Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern verdeutlicht. Phasen Wörter und Formulierungen kontextbezogen einführen Es ist wichtig, Lernsituationen zu schaffen, in denen die Schülerin nen und Schüler die neuen Wörter und Formulierungen üben können. Man ermöglicht somit das wiederholte Abrufen der Wörter, dass diese reproduziert, deren Bedeutungen zunehmend genauer erfasst und formuliert werden können. Dabei werden die Vernetzungen im Gehirn aktiviert, verstärkt und Wissensnetze erweitert und gefestigt. Wörter und Formulierungen üben Wörter und Formulierungen nutzen Über Wörter und Formulierungen reflektieren Wörter und Formulierungen überprüfen Beschreibung Damit neue Wörter und Formulierungen im Gedächtnis schnell abrufbar werden, müssen sie in möglichst verschiedenen Kontexten (z. B. Texte, Bilder, Zeichnungen, Grafiken, Experimente, Demonstrationen) eingeführt und angewandt werden, denn die Bedeutung vieler Wörter erschließt sich erst aus dem Satz-, Situations- oder Handlungskontext. Wörter, die einmal verstanden und mehrfach reproduziert worden sind, können durchaus wieder vergessen werden, wenn sie nicht regelmäßig gebraucht werden. Für den Aufbau eines differenzierten Wortschatzes ist es unabdingbar, Lernende zum selbstständigen Gebrauch der neuen Begriffe und Formulierungen zu führen. Dieses Prinzip der Wiederholung dient der Festigung des Mitteilungswortschatzes. Aufgaben, die die Anwendung der Wörter und Formulierungen in verschiedenen Kontexten berücksichtigen, intendieren diesen Sachverhalt. Um eine Wortschatzanalysekompetenz bei Lernenden zu entwickeln, muss man ihnen ermöglichen, den Wortschatz bewuss ter wahrzunehmen und Strategien zu entwickeln, mit denen sie scheinbar unbekannte Wörter ohne weitere Hilfe verstehen können. Für das Nachdenken über Wortbedeutungen sollten im Fachunterricht bewusst Phasen geplant werden, die gleichzeitig zur Festigung, Systematisierung und Anwendung genutzt werden können. Die Wortschatzarbeit im Fachunterricht sollte verbindlich sein und den Lernenden bewusst gemacht werden. Voraussetzung dafür ist die gründliche Einführung und Reflexion der Wörter und Formulierungen. Im Zusammenhang mit der Überprüfung des entsprechenden Fachwissens sollte auch der fachsprachlich korrekte/angemessene Gebrauch der jeweiligen Wörter und Formulierungen Teil von Lernerfolgskontrollen in den Fächern sein. Die Bearbeitung einer Aufgabe sollte den Lernenden nach der schrittweisen Erarbeitung der Begriffsbedeutungen leichter fallen, weil Sach- und Sprachwissen miteinander verknüpft werden. 244
245 Didaktischer Rahmen der Wortschatzarbeit Im Folgenden werden Möglichkeiten der Einführung und des Trainings von Wörtern und Formulierungen im naturwissenschaftlichen Unterricht an einem Kontext aus der Physik vorgestellt. Im täglichen Leben werden die Begriffe Masse und Gewicht oft synonym verwendet. So gibt man z. B. ein Gewicht in Kilogramm an, der physikalischen Einheit für Masse. Mit Gewicht wird aber auch oft die Gewichtskraft gleichgesetzt. Außerdem werden diese Begriffe auch alltags- und umgangssprachlich angewandt, sodass deren exakte fachsprachliche Verwendung erschwert wird. Die Beispiele verdeutlichen, dass die Bedeutung der Wörter vom Kontext abhängt, in dem sie gebraucht werden:» Besim hat eine Masse Zeit.» Lea legt Gewicht auf gute Umgangsformen.» Im Backrezept steht: Man nehme eine Masse von 500 g Mehl.» Lukas hat in den letzten Monaten erheblich an Gewicht verloren.» Die Gewichtskraft eines Körpers ist abhängig von der Masse und vom Ort.» Deine Meinung hat Gewicht.» Ich habe eine Masse Arbeit.» Der Teig ist eine klebrige Masse. 245
246 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Beispiel: Wortschatzarbeit Gewichtskraft und Masse (Physik 7/8) 7 Wörter und Formulierungen kontextbezogen einführen Astronauten auf dem Mond Armstrong und Aldrin waren 1969 die ersten Menschen auf dem Mond. Bei ihrem Spaziergang auf dem Mond mussten sich die beiden mit Raumanzügen schützen. Der Raumanzug eines Astronauten wog 85 kg, ungefähr genau so viel Masse, wie der Astronaut selbst. Mit diesen Raumanzügen liefen die beiden Astronauten bei ihrem ersten Ausstieg über zwei Stunden auf der Mondoberfläche umher. Sie konnten sogar springen und hüpfen, da die Gewichtskraft der Anzüge auf dem Mond viel kleiner war als auf der Erde. Armstrong auf dem Mond 8 Astronaut auf dem Mond 9 Astronaut auf der Erde Aufgabe 1: Aufgabe 2: a. Nenne die im Text beschriebene ungewöhnliche Erscheinung. b. In dem Text werden die Begriffe Masse und Gewichtskraft benutzt. Markiere Aussagen zur Masse und zur Gewichtskraft mit jeweils unterschiedlichen Farben. a. Masse und Gewichtskraft werden oft verwechselt. Sie beschreiben jedoch verschiedene Erscheinungen. b. Lies die folgende Fachinformation. Markiere Aussagen zur Masse und zur Gewichtskraft mit jeweils unterschiedlichen Farben. c. Vergleiche Masse und Gewichtskraft. Ergänze dazu die Tabelle Aufgabe: Oliver Pechstein, Barnim-Gymnasium Berlin 8 Abbildung: 9 Zeichnungen: Horst Zeitler, OSZ Lise Meitner, Berlin
247 Didaktischer Rahmen der Wortschatzarbeit Fachinformation Was sind Masse und Gewichtskraft? Masse und Gewichtskraft haben nicht nur verschiedene Formelzeichen (m und FG), sondern auch verschiedene Einheiten (1 kg und 1 N). Je größer die Masse eines Körpers ist, desto schwieriger ist es, die Bewegung des Körpers zu ändern. Einen Medizinball zu werfen ist anstrengender als einen Handball. Man sagt: Der Medizinball ist träger als der Handball. Die Masse gibt an, wie träge ein Körper ist. Auf jeden Körper wirkt auch eine Gewichtskraft nach unten, da ein Körper aufgrund seiner Masse von der Erde oder einem anderen Himmelskörper mit einer Kraft angezogen wird. Hat ein Körper gegenüber einem anderen die doppelte Masse, so ist auch seine Gewichtskraft doppelt so groß. Welchen Einfluss hat der Ort auf Masse und Gewichtskraft? Die Erde ist nicht ganz genau eine Kugel. Dadurch ist die Gewichtskraft eines Körpers an verschiedenen Orten unterschiedlich, da z. B. der Nordpol etwas dichter am Erdmittelpunkt ist als der Äquator. Die Trägheit eines Körpers ist jedoch überall gleich. Gewichtskraft FG für einen Körper der Masse m = 1 kg Nordpol 9,83219 N rund 10 N Bremen 9,81341 N Berlin 9,81288 N München 9,80891 N Äquator 9,78033 N Mondoberfläche 1,62 N ca. ein Sechstel der Gewichtskraft an der Erdoberfläche Formelzeichen... gibt an, wie... Masse Gewichtskraft... ist an verschiedenen Orten... Einheit 247
248 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Wörter und Formulierungen üben Aufgabe 1: a. Definiere die Begriffe Masse und Gewichtskraft. b. Ergänze mit Hilfe des Textes Astronauten auf dem Mond und der Fachinformation (S. 247) die folgenden Aussagen. Die Masse des Raumanzuges eines Astronauten beträgt auf der Erde... auf dem Mond... Die Gewichtskraft des Raumanzuges eines Astronauten beträgt auf der Erde... auf dem Mond... Aufgabe 2: Für verschiedene Größen gibt es immer auch verschiedene Messgeräte. Wenn man weiß, wie Masse und Gewichtskraft gemessen werden, kann man sie besser unterscheiden. a. Lies den folgenden Text. Markiere in dem Text, wie Masse und Gewichtskraft gemessen werden. b. Ergänze die Tabelle. Wie werden Masse und Gewichtskraft gemessen? Die Masse des Fotoapparates wird bestimmt, in dem seine Masse mit der Masse von Wägestücken verglichen wird. Diese Wägestücke sind geeicht, d. h. ihre Masse ist sehr genau bekannt. Die Masse des Fotoapparates beträgt 282 g. Mit einem Federkraftmesser wird die Gewichtskraft gemessen. In dem Federkraftmesser ist eine Feder. Die Gewichtskraft des Fotoapparates dehnt diese Feder. Die Gewichtskraft beträgt etwa 2,77 N. Waage und Wägestücke Federkraftmesser Messgerät Skizze des Messgerätes Messwert für den Fotoapparat Messverfahren Masse Gewichtskraft 248
249 Didaktischer Rahmen der Wortschatzarbeit Wörter und Formulierungen nutzen Aufgabe 1: Begründe, warum der Astronaut den Raumanzug auf dem Mond problemlos tragen kann. Nutze möglichst viele der folgenden Begriffe und Angaben: Masse Gewichtskraft 85 kg 850 N 140 N Erde Mond. Aufgabe 2: Begründe, warum der Astronaut auf dem Mond hüpfen kann, obwohl er einen 85 kg schweren Raumanzug trägt. Über Wörter und Formulierungen reflektieren Aufgabe 1: In einem Fitnessstudio steht eine Waage. Über der Waage hängt ein Schild: Prüfe dein Gewicht! Diskutiere die Aussage auf dem Schild unter physikalischen Gesichtspunkten. Aufgabe 2: Die Wörter Masse und Gewicht kommen auch häufig in der Alltagssprache vor. Dabei werden die Begriffe oft physikalisch falsch benutzt. Entscheide, ob die markierten Begriffe physikalisch richtig oder falsch verwendet werden. Begründe kurz. Lea legt Gewicht auf gute Umgangsformen. Besim hat eine Masse Zeit. physikalisch richtig physikalisch falsch X Begründung Gewicht im Sinne von wichtig, nicht als Gewichtskraft. Im Backrezept steht: Man nehme eine Masse von 500 g Mehl. Lukas hat in den letzten Monaten erheblich an Gewicht verloren. 249
250 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Wörter und Formulierungen überprüfen Aufgabe 1: Ein Astronaut muss auf der Mondoberfläche ein Messgerät aufbauen. Das Messgerät hat auf der Erde eine Masse von 35 kg. Wie sind Masse und Gewichtskraft des Messgerätes auf der Mondoberfläche? Kreuze die richtigen Aussagen an. Masse und Gewichtskraft sind auf dem Mond genauso groß wie auf der Erde. Die Masse und die Gewichtskraft sind auf dem Mond kleiner als auf der Erde. Die Masse ist auf dem Mond kleiner, die Gewichtskraft bleibt gleich. Die Masse ist auf dem Mond genauso groß, die Gewichtskraft wird kleiner. Aufgabe 2: Welchen Begriff benötigt man, um die in der Tabelle dargestellten Vorgänge richtig zu beschreiben? Kreuze an. Ein Wanderer sinkt im Schnee ein. Masse Gewichtskraft keinen von beiden Ein vollbeladener Lastwagen fährt langsamer an einer Ampel an als ein baugleicher unbeladener Lastwagen. Ein Astronaut auf dem Mond tritt gegen einen Fußball, der Ball wird beschleunigt. Ein Astronaut lässt auf dem Mond einen Hammer fallen, der Hammer fällt langsamer als auf der Erde. Aufgabe 3: Antonia plant eine Reise nach Indonesien. Indonesien liegt am Äquator. Sie weiß, dass sie nicht zu viel Fluggepäck dabei haben darf, denn für Gepäck schwerer als 20 kg muss extra bezahlt werden. Ihr Koffer wiegt zu Hause in Potsdam genau 20 kg.» Erläutere, ob sich die Größen Masse und Gewichtskraft des Koffers während der Reise von Potsdam nach Indonesien ändern.» Müsste Antonia auf dem Rückflug für Übergepäck zahlen, wenn sich der Inhalt des Koffers nicht ändert? Begründe deine Entscheidung. 250
251 Didaktischer Rahmen der Wortschatzarbeit Lösungen: Gewichtskraft und Masse (Physik 7/8) Wörter und Formulierungen kontextbezogen einführen Aufgabe 1: a. Die Astronauten konnten auf dem Mond springen und hüpfen, obwohl ihr Raumanzug auf der Erde 85 kg wog. Astronauten auf dem Mond Armstrong und Aldrin waren 1969 die ersten Menschen auf dem Mond. Bei ihrem Spaziergang auf dem Mond mussten sich die beiden mit Raumanzügen schützen. Der Raumanzug eines Astronauten wog 85 kg, ungefähr genau so viel Masse, wie der Astronaut selbst. Mit diesen Raumanzügen liefen die beiden Astronauten bei ihrem ersten Ausstieg über zwei Stunden auf der Mondoberfläche umher. Sie konnten sogar springen und hüpfen, da die Gewichtskraft der Anzüge auf dem Mond viel kleiner war als auf der Erde. Aufgabe 2: Fachinformation Was sind Masse und Gewichtskraft? Masse und Gewichtskraft haben nicht nur verschiedene Formelzeichen (m und FG), sondern auch verschiedene Einheiten (1 kg und 1 N). Je größer die Masse eines Körpers ist, desto schwieriger ist es, die Bewegung des Körpers zu ändern. Einen Medizinball zu werfen ist anstrengender als einen Handball. Man sagt: Der Medizinball ist träger als der Handball. Die Masse gibt an, wie träge ein Körper ist. Auf jeden Körper wirkt auch eine Gewichtskraft nach unten, da ein Körper aufgrund seiner Masse von der Erde oder einem anderen Himmelskörper mit einer Kraft angezogen wird. Hat ein Körper gegenüber einem anderen die doppelte Masse, so ist auch seine Gewichtskraft doppelt so groß. Welchen Einfluss hat der Ort auf Masse und Gewichtskraft? Die Erde ist nicht ganz genau eine Kugel. Dadurch ist die Gewichtskraft eines Körpers an verschiedenen Orten unterschiedlich, da z. B. der Nordpol etwas dichter am Erdmittelpunkt ist als der Äquator. Die Trägheit eines Körpers ist jedoch überall gleich. Gewichtskraft FG für einen Körper der Masse m = 1 kg Nordpol 9,83219 N rund 10 N Bremen 9,81341 N Berlin 9,81288 N München 9,80891 N Äquator 9,78033 N Mondoberfläche 1,62 N ca. ein Sechstel der Gewichtskraft an der Erdoberfläche 251
252 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Masse Gewichtskraft Formelzeichen m F G... gibt an, wie... träge ein Körper ist wie stark ein Körper von der Erde angezogen wird... ist an verschiedenen Orten... gleich unterschiedlich Einheit 1 kg 1 N Wörter und Formulierungen üben Aufgabe 1: Aufgabe 2: a. Definition: Lösung siehe Tabelle b. Die Masse des Raumanzuges eines Astronauten beträgt auf der Erde 85 kg auf dem Mond 85 kg Die Gewichtskraft des Raumanzuges eines Astronauten beträgt auf der Erde rund 850 N auf dem Mond rund 140 N Wie werden Masse und Gewichtskraft gemessen? Die Masse des Fotoapparates wird bestimmt, in dem seine Masse mit der Masse von Wägestücken verglichen wird. Diese Wägestücke sind geeicht, d. h. ihre Masse ist sehr genau bekannt. Die Masse des Fotoapparates beträgt 282 g. Mit einem Federkraftmesser wird die Gewichtskraft gemessen. In dem Federkraftmesser ist eine Feder. Die Gewichtskraft des Fotoapparates dehnt diese Feder. Die Gewichtskraft beträgt etwa 2,77 N. Masse Gewichtskraft Messgerät Waage Federkraftmesser Skizze des Messgerätes Skizze Waage Skizze Federkraftmesser Messwert für den Fotoapparat 282 g 2,77 N Messverfahren Die Masse des Fotoapparates mit der Masse von Wägestücken vergleichen Die Gewichtskraft des Fotoapparates dehnt die Feder im Kraftmesser. 252
253 Didaktischer Rahmen der Wortschatzarbeit Wörter und Formulierungen nutzen Aufgabe 1: Auf dem Mond hat der Anzug immer noch eine Masse von 85 kg, jedoch ist er nicht mehr so schwer für den Astronauten, da sich seine Gewichtskraft gegenüber der Erde von 850 N auf 140 N verringert hat. Aufgabe 2: Der Astronaut kann auf dem Mond mühelos hüpfen, da sein Anzug und er selbst gegenüber der Erde nur noch ein Sechstel der Gewichtskraft hat. Über Wörter und Formulierungen reflektieren Aufgabe 1: Die Aussage: Prüfe dein Gewicht! ist alltagssprachlich üblich, aber physikalisch falsch, geprüft wird die Masse. Aufgabe 2: Lea legt Gewicht auf gute Umgangsformen. Besim hat eine Masse Zeit. Im Backrezept steht: Man nehme eine Masse von 500 g Mehl. Lukas hat in den letzten Monaten erheblich an Gewicht verloren. physikalisch richtig X physikalisch falsch X X X Begründung Gewicht im Sinne von wichtig, nicht als Gewichtskraft. Masse im Sinne von viel, nicht im Sinne von Trägheit Mit korrekter Angabe der Einheit Üblicherweise wird die Masse in Kilogramm mit einer Waage gemessen. 253
254 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Wörter und Formulierungen überprüfen Aufgabe 1: Masse und Gewichtskraft sind auf dem Mond genauso groß wie auf der Erde. Die Masse und die Gewichtskraft sind auf dem Mond kleiner als auf der Erde. Die Masse ist auf dem Mond kleiner, die Gewichtskraft bleibt gleich. X Die Masse ist auf dem Mond genauso groß, die Gewichtskraft wird kleiner. Aufgabe 2: Masse Gewichtskraft keinen von beiden Ein Wanderer sinkt im Schnee ein. X Ein vollbeladener Lastwagen fährt langsamer an einer Ampel an als ein baugleicher unbeladener Lastwagen. Ein Astronaut auf dem Mond tritt gegen einen Fußball, der Ball wird beschleunigt. X X Ein Astronaut lässt auf dem Mond einen Hammer fallen, der Hammer fällt langsamer als auf der Erde. X Aufgabe 3: Auf dem Weg nach Indonesien bleibt die Masse gleich, denn die Masse ist ortsunabhängig. Die Gewichtskraft wird minimal kleiner (für Experten: um 0,65 N), da der Äquator weiter vom Erdmittelpunkt entfernt ist als Berlin. Es tritt kein Übergepäck auf, wenn der Inhalt sich nicht ändert, da die Masse sich nicht ändert. Antonia darf aber auch nichts dazu packen, obwohl die Gewichtskraft etwas kleiner geworden ist. 254
255 3 Alltagssprache und Fachsprache Die Sprache der Schülerinnen und Schüler ist der am häufigsten benutzte Indikator zum Überprüfen des Verstehens. Man sollte sich aber nicht nur an der Syntax (Satzlehre), d. h. an der korrekten Verwendung der Fachsprache orientieren, sondern auch die Semantik (Bedeutungslehre) beachten. Fachsprache selbst ist nicht kommunikativ. Ihr Anspruch an hohe Exaktheit ist vor allem für die Schriftlichkeit gedacht. Für den Lernprozess können mitunter umschriebene Begriffe viel lernfördernder sein. Sie formulieren nicht minderwertig, sondern schülergemäß. Die folgenden Beispiele 10 sollen das verdeutlichen: Alltagssprache Solarzellen erzeugen elektrischen Strom. Helium ist leichter als Luft. Das Auto fährt mit hohem Tempo. Eine weiße Billardkugel prallt gegen eine schwarze, die weiße bleibt stehen und die schwarze rollt weiter. Das Wasser kocht. Fachsprache In Solarzellen wird Energie des Sonnenlichtes in elektrische Energie umgewandelt. Die Dichte von Helium ist geringer als die Dichte von Luft. Das Auto fährt mit großer Geschwindigkeit. Die weiße Kugel gibt Bewegungsenergie ab, die schwarze nimmt diese Energie auf. Das Wasser siedet. Alltagssprachliche Formulierungen enthalten jedoch häufig auch Fehlvorstellungen, die sich trotz eines intensiven Unterrichts hartnäckig halten. Im Umgang mit alltagssprachlichen Formulierungen ergibt sich hieraus die Notwendigkeit der Abwägung: Besteht durch eine Reflexion der sprachlichen Formulierung die große Gefahr, die Kommunikation und Lernfreude der Schülerinnen und Schüler zu bremsen, oder eröffnet sich hier die Chance, fachliche Konzepte zu entwickeln? 10 Zusammengestellt von Oliver Pechstein, Barnim-Gymnasium, Berlin 255
256 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Einige Beispiele für mit alltagssprachlichen Formulierungen verbundene tiefgreifende Fehlvorstellungen seien hier noch aufgeführt: Alltagssprache Der Pullover wärmt. Durch das Fenster kommt Kälte in das Zimmer. Die Batterie gibt Strom an die Lampe ab. Das Auto fährt mit voller Kraft gegen die Wand. Fehlvorstellung Der Pullover gibt Wärme ab. Kälte kann von einem Körper auf einen anderen übertragen werden. Elektrischer Strom wird verbraucht. Bewegte Körper enthalten Kraft, Kraft wird im Sinne von Energie oder Impuls verstanden. Für die Wortschatzarbeit mit Fachwörtern, die auch in der Alltagssprache in verschiedenen Bedeutungsvarianten verwendet werden, lohnt sich auch im Fachunterricht die Verwendung des Dudens. Das folgende Beispiel stellt eine Übungsmöglichkeit dar. Der Begriff Arbeit ist im Duden 11 für die Naturwissenschaft Physik wie in der Tabelle angegeben definiert. Arbeit (Physik) Produkt aus der an einem Körper angreifenden Kraft und dem unter ihrer Einwirkung von dem Körper zurückgelegten Weg (wenn Kraft und Weg in ihrer Richtung übereinstimmen) Aufgaben Unterstreiche in der Definition den Oberbegriff mit grüner Farbe und die charakteristischen Merkmale mit blauer Farbe. Übersetze diese Definition unter Verwendung der Symbole für die physikalischen Größen in eine mathematische Gleichung. Mit diesen beiden Aufgabenstellungen wird einerseits der richtiger Gebrauch des Operators Definieren und andererseits das Wechseln der Darstellungsebene (vom Text zu mathematischen Symbolen) geübt. Im Duden sind auch Synonyme zum Begriff Arbeit aufgeführt, die aber unterschiedliche Bedeutungen haben. Ordne die rechts in der Tabelle stehenden Wendungen, Redensarten, Sprichwörter den Synonymen zum Begriff Arbeit zu. Arbeite in Partnerarbeit Auswahl aus: ( )
257 Alltagssprache und Fachsprache Synonyme für Arbeit Lösung Wendungen, Redensarten, Sprichwörter Mühe, Anstrengung; Beschwerlichkeit, Plage 10., 11., nur halbe Arbeit machen (etwas nur unvollkommen ausführen) 2. die Arbeit am Sandsack, mit der Hantel 3. [bei jemandem] in Arbeit sein, stehen ([bei jemandem] beschäftigt, angestellt sein) Schaffen, Tätigsein; das 6., 4. von seiner Hände Arbeit leben (gehoben; sich Beschäftigtsein mit etwas, 7., seinen Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit mit jemandem 8., verdienen) jede Arbeit ist ihres Lohnes wert Berufsausübung, 3., 6. ganze, gründliche o. ä. Arbeit leisten/tun/ (um- Erwerbstätigkeit; 4., gangssprachlich:) machen (etwas so gründlich Arbeitsplatz 5. tun, dass nichts mehr zu tun übrig bleibt; oft im negativen Sinn) 7. das war eine ziemliche Arbeit Erzeugnis, Produkt viel Arbeit mit jemandem, etwas haben 9. du hast dir [damit, dadurch] unnötige Arbeit gemacht körperliche Vorbereitung 2. auf bestimmte Leistun 10. keine Mühe und Arbeit scheuen gen; Training 11. das macht viel Arbeit 12. in übertragener Bedeutung: das war ein hartes Stück Arbeit (eine große Mühe) 257
258 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Man findet in Duden-Online Wortfelder zum Begriff Arbeit. Bestimme die Wortarten der roten Wörter in Wortfeld A, B und C. Schreibe für jedes Wortfeld zwei Sätze (mehrere Sätze) unter Verwendung ausgewählter Begriffskombinationen. Überlege, welche Bedeutung Arbeit in deinen Sätzen hat. Nutze dazu die obere Tabelle. Wortfeld A hart gemeinnützig wissenschaftlich sozial Arbeit täglich künstlerisch gut ehrenamtlich Wortfeld B leisten verrichten aufnehmen erledigen niederlegen Arbeit beginnen machen Wortfeld C Technik Sozialordnung Wirtschaft Kapital Leben Gesundheit Arbeit Freizeit Arbeit 258
259 Alltagssprache und Fachsprache Die KAWA-Methode (Kreativ, Analografie, Wort, Assoziativ) stellt eine Möglichkeit dar, kreative Wortschatzarbeit bei der Ideenfindung, Wiederholungen, Anwendungen zu betreiben. Diese Kreative analoge Wortassoziation ist ein Wortbild, um Wissen zu verknüpfen und neue Ideen zu entwickeln. Es geht darum, zu einem Wort zum Thema zu assoziieren. Es soll zu jedem Buchstaben des Wortes ein neues Wort (möglichst zur Bedeutung des Stammwortes) gefunden werden, um dadurch neue Denkansätze zu gewinnen. Die Vorteile liegen darin, dass bei der Auseinandersetzung mit Wörtern die Fantasie angeregt wird. Die Methode ist leicht zu praktizieren und bringt unbewusste Lösungen und neue Ansätze hervor. Dabei kommt es nicht darauf an, nur fachsprachliche Assoziationen zu finden. Man sollte die Schülerinnen und Schüler sogar dazu ermutigen, alltags- und fachsprachliche Bezüge zu suchen, um das Wissensnetz im mentalen Lexikon zu festigen. Schreibe in der Mitte eines Blattes das gewünschte Thema (hier: Energie). Ergänze nun zu den Buchstaben deine Ideen und Gedanken passend zum Thema. Du kannst auch Wörter in anderen Sprachen oder kurze Sätze verwenden. Die Visualisierung der Wörter ist möglich. 259
260
261 4 Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz Nachhaltiges Wortschatzlernen wird erreicht durch die Berücksichtigung methodischer und lernpsychologischer Prinzipien wie Sinnstiftung, Vernetzung, Ordnung und Veranschaulichung sowie einer dem Kinde bzw. dem Lernenden angepassten Variation der Lehr- und Lernaktivitäten. 12 Die von N. Selemi vorgeschlagene Reihenfolge von Einzelmethoden für die Arbeit am Wortschatz vom Kindergartenalter an entspricht diesen Prinzipien. (Vgl. Kap. 4.1). Methoden für die Arbeit am Wortschatz zeitliche Einordnung 1 Wortbedeutungen im Kontext vernetzen Kindergarten 5. Schuljahr 2 Begriffe aus dem Kontext erschließen und ordnen Kindergarten 5. Schuljahr 3 Arbeit mit Ober- und Unterbegriffen Kindergarten 5. Schuljahr 4 Den Wortschatz über den Rhythmus üben und festigen Kindergarten 5. Schuljahr 5 Den Wortschatz mit semantischen Wortlisten erweitern Schuljahr 6 Den Wortschatz mit Textpräsentationen festigen ab 2. Schuljahr 7 Den Wortschatz mit Wortfamilien und Wortfeldern systematisch festigen Schuljahr 8 Mit Antonymen und Synonymen bewusst umgehen Schuljahr 9 Texte mit Schlüsselwörtern entschlüsseln Schuljahr 10 Zusammensetzungen und Ableitungen entschlüsseln Schuljahr 11 Umgang mit Fachwortschatz und Fachtexten Schuljahr Den Wortschatz mit Mindmap und Cluster strukturieren und erweitern Wortbeziehungen mit Begriffsnetz und Advance Organizer visualisieren Schuljahr Schuljahr 12 Selemi 2010, S
262 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Methoden für die Arbeit am Wortschatz zeitliche Einordnung 14 Wortzusammenhänge mit Strukturlegetechnik erklären Schuljahr 15 Feine Unterschiede der Vieldeutigkeit von Wörtern erkennen Schuljahr 16 Redewendungen bewusst aufnehmen Schuljahr 17 Metaphern bewusst anwenden Schuljahr Im Folgenden werden zu den wortschatzspezifischen Methoden Beispiele aus dem naturwissenschaftlichen Fachunterricht vorgestellt. Diese lassen sich den Phasen der Wortschatzarbeit von Claudio Nodari und Cornelia Steinemann sehr gut zuordnen. Phasen der Wortschatzarbeit Wörter und Formulierungen kontextbezogen einführen Beispiele für Methoden für die Arbeit am Wortschatz 1. Begriffe aus dem Kontext erschließen und ordnen (siehe 4.2) 2. Arbeit mit Ober- und Unterbegriffen (siehe 4.3) 3. Wortbedeutungen im Kontext vernetzen (siehe 4.1) Wörter und 1. Den Wortschatz mit semantischen Wortlisten erweitern Formulierungen üben (siehe 4.5) 2. Den Wortschatz mit Textpräsentationen festigen (siehe 4.6) 3. Zusammensetzungen und Ableitungen entschlüsseln (siehe 4.10) Wörter und 1. Den Wortschatz mit semantischen Wortlisten erweitern Formulierungen nutzen (siehe 4.5) 2. Den Wortschatz mit Textpräsentationen festigen (siehe 4.6) 3. Zusammensetzungen und Ableitungen entschlüsseln (siehe 4.10) 4. Wortbeziehungen mit Begriffsnetz und Advance Organizer visualisieren (siehe 4.13) Über Wörter und 1. Den Wortschatz mit Wortfamilien und Wortfeldern Formulierungen systematisch festigen (siehe 4.7) reflektieren 2. Mit Antonymen und Synonymen bewusst umgehen (siehe 4.8) 3. Den Wortschatz mit Mindmap und Cluster strukturieren und erweitern (siehe 4.12) 4. Wortzusammenhänge mit Strukturlegetechnik erklären (siehe 4.14) 5. Feine Unterschiede der Vieldeutigkeit von Wörtern erkennen (siehe 4.15) 6. Redewendungen bewusst aufnehmen und Metaphern bewusst anwenden (siehe 4.15, 4.16) Wörter und 1. Den Wortschatz mit Mindmap und Cluster strukturieren und Formulierungen erweitern (siehe 4.12) überprüfen 2. Wortbeziehungen mit Begriffsnetz und Advance Organizer visualisieren (siehe 4.13) 262
263 Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz Weiteres Beispiel zum Überprüfen In vielen Testsituationen werden Texte verwendet, bei denen im Anschluss angekreuzt oder/ und eine kurze Antwort gegeben werden muss. Damit kann dann der Testentwickler feststellen, wie gut ein Text verstanden wurde. Eine Variante stellen die Richtig-Falsch-Testaufgaben (True/ False-Items) dar. Sauerstoff ein unentbehrliches Gas (Lesetext, Chemie 7) Sauerstoff wurde 1771 vom Schweden Carl Wilhelm Scheele (1742 bis 1786) und unabhängig von ihm vom Engländer Joseph Priestley (1733 bis 1804) entdeckt. Sauerstoff ist in der Natur sehr weit verbreitet. Etwa die Hälfte der festen Erdrinde, neun zehntel des Wassers und gut ein Fünftel der Luft bestehen aus Sauerstoff. So besteht z. B. auch Sand (Seesand) zu 53 % aus Sauerstoff. Sauerstoff ist ein farbloses, geruchloses Gas, dass man es weder sehen, riechen noch anfassen kann. Füllt man reinen Sauerstoff in einen Luftballon, so sinkt dieser gleich auf den Erdboden. Er ist scheinbar schwerer als Luft. Daraus kann man schlussfolgern, dass Sauerstoff eine größere Dichte als Luft hat. Hält man ein brennendes Holzstäbchen in ein Gefäß mit Sauerstoff, erhellt lt sich die Flamme stark, geht aber nach kurzer Zeit aus. Sauerstoff fördert demnach h die Verbrennung. Selber ist Sauerstoff allerdings nicht brennbar. Durch starkes Abkühlen lässt sich Sauerstoff bei 183 C kondensieren (Siedetemperatur). Er liegt dann als bläuliche Flüssigkeit vor. Die Schmelztemperatur tur de- liegt bei 219 C, unterhalb dieser Temperatur erstarrt der Sauerstoff zu hellblauen Kristallen. Sauerstoff ist sehr reaktionsfreudig, d. h., das Gas reagiert leicht mit anderen n Stoffen. Deshalb verläuft jede Verbrennung mit reinem Sauerstoff heftiger und mit hellerem Licht als an der Luft. Sauerstoff löst sich etwas im Wasser (wenig wasserlöslich). Deshalb könm³ davon. Er ist für viele Vorgänge im nen Fische und andere Wasserlebewesen unter Wasser atmen. Menlich braucht ein Erwachsener 0,6 schen und Tiere führen dem Körper bei der Atmung Sauerstoff zu. Täg- Körper unentbehrlich. So sind Bewegungen wie Laufen, Springen, Schwimmen oder Tanzen nur möglich, weil der Sauerstoff durch bestimmte Reaktionen die dafür erforderliche Energie freisetzen kann. Auch unsere stets gleichbleibende Körpertemperatur von etwa 36,6 C lässt sich nur durch Verbrennungsreaktionen aufrechterhalten. Auch in der Technik laufen viele wichtige Verbrennungsreaktionen nur mit Hilfe des Sauerstoffs ab. Motoren von Kraftfahrzeugen, Flugzeugen und Schiffen erzeugen nur Leistungen, wenn außer dem Benzin (oder Kerosin) auch Sauerstoff vorhanden ist. Keine Rakete würde fliegen, wenn der entsprechende Treibstoff nicht verbrennen würde. Große Mengen von Sauerstoff werden auch zum Schweißen benötigt. In besonderen Gefahrensituationen wird Sauerstoff in Beatmungsgeräten eingesetzt (Taucher, Bergsteiger, Feuer- 263
264 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften wehrmänner). Auch in Krankenhäusern wird Sauerstoff in Reinform zum Beatmen von zu früh geborenen Säuglingen oder zum Inhalieren bei Erkrankung der Atemwege verwendet. Jeder Rettungswagen ist mit einem Sauerstoffgerät zur künstlichen Beatmung ausgerüstet. Eintr Venti 200 bar Wärmeaustauscher ustritts-ventil Mit dem sogenannten Linde-Verfahren 13 kann man Sauerstoff aus der Luft gewinnen. Dazu muss man die Luft unter hohem Druck verflüssigen und dann stark abkühlen. Bei 200 C sind beide Bestandteile der Luft (Sauerstoff und Stickstoff) flüssig. Erwärmt man nun diese flüssige Luft auf 196 C, wird Stickstoff wieder gasförmig, Sauerstoff bleibt aber noch flüssig. Dies liegt daran, dass die Siedetemperatur des Sauerstoffs bei 183 C liegt. Entspannungs-Ventil 20 bar In der Schule ist dieses Verfahren aber zu aufwendig. Sauerstoff kann man aus Stoffen gewinnen, die Sauerstoff leicht abgeben, z. B. aus Wasserstoffperoxid und aus Kaliumpermanganat. Hat man Sauerstoff hergestellt, kann flüssige Luft man ihn relativ einfach über die Glimmspanprobe nachweisen. Man hält einen glimmenden Span in das Gefäß, in dem Sauerstoff vermutet wird. Da Sauerstoff die Verbrennung fördert, flammt der Span auf und brennt mit einer hellen Flamme weiter. Das Gas selber brennt im Gegensatz zu Wasserstoff jedoch nicht. Würde nur Luft im Gefäß sein, würde der Span weiterhin glimmen, aber nicht auffammen. Durch dieses unterschiedliche Verhalten kann man Sauerstoff von Wasserstoff und Luft unterscheiden Skizze des Linde-Verfahrens (vereinfacht) nach: f2/linde-verfahren.svg/220px-linde-verfahren.svg.png ( )
265 Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz Aufgabe: Entscheide, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. Kreuze an und korrigiere die falschen Aussagen. Aussage Richtig Falsch Korrektur 1. Die Dichte von Sauerstoff ist kleiner als die der Luft. 2. Sauerstoff wurde von C. Scheele und J. Priestley entdeckt. 3. Sauerstoff ist zu ca. 20 % in der Luft enthalten. 4. Sauerstoff reagiert schwer mit anderen Stoffen. 5. Motoren von Kraftfahrzeugen erzeugen Leistungen, wenn Benzin mit Stickstoff reagiert. 6. Zum Gewinnen von Sauerstoff aus der Luft wird die Luft unter hohem Druck verflüssigt und auf 200 C abgekühlt. 7. Luft ist ein heterogenes Stoffgemisch und besteht hauptsächlich aus Sauerstoff. 8. Sauerstoff ist in Wasser etwas löslich. Deshalb können Fische unter Wasser atmen. 9. Zum Nachweis von Sauerstoff hält man einen glimmenden Holzspan in das Gefäß. 10. Sauerstoff verbrennt mit einer hellen Flamme. X X X X X X X X X X Die Dichte von Sauerstoff ist größer als die der Luft. Sauerstoff ist sehr reaktionsfreudig. Benzin reagiert (verbrennt) mit Sauerstoff. Luft ist ein homogenes Stoffgemisch und besteht hauptsächlich aus Stickstoff. Sauerstoff ist nicht brennbar. Erläuterung der Methoden anhand von Beispielen im naturwissenschaftlichen Unterricht Die folgenden Beispiele stellen eine Sammlung von Einzelmethoden dar, die sich in der Wortschatzarbeit bewährt haben und im naturwissenschaftlichen Unterricht eingesetzt werden können. 265
266 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften 4.1 Wortbedeutungen im Kontext vernetzen Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Aufgabe, in Gruppen die passenden Wörter herauszusuchen und dasjenige Wort zu unterstreichen, das am besten dem Kontext entspricht. Die Auswahl wird im Plenum begründet ausgewertet. Das Anbieten und die begründete Auswahl dieser sprachlichen Alternativen regen die Schülerinnen und Schüler zum bewussten Nachdenken über Wortbedeutungen an. Der Storch Brandenburg zählt zu den storchenreichsten Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Daher kann man im Sommer (oft, selten, nie, viele) Störche in bestimmten Regionen Brandenburgs beobachten. Sie schreiten mit (staksigen, schweren, hüpfenden) Schritten über Wiesen oder Äcker und suchen dort nach Futter. Störche fressen vor allem Insekten, Frösche und Mäuse, die sie mit einem (gewaltigen, massiven, großen) Appetit fressen. Ab August und September machen sich die Störche auf in ihre Winterquartiere im tropischen Afrika südlich der Sahara. Sie gehören zu unseren bekanntesten (Langstrecken-, Kurzstrecken-, Mittelstrecken-) Zugvögeln. Störche stehen oft auf einem Bein und stecken Kopf und Schnabel in die langen Federn des Halses, wenn sie (trainieren, ruhen, nachdenken). Störche sind mit drei bis vier, manchmal auch erst mit sechs Jahren geschlechtsreif. Meist bleiben sie ihr Leben lang mit einem Partner zusammen. Ihre Nester aus lose aufgeschichteten Zweigen und Ästen bauen sie auf Bäumen, Häusern, Kaminen und sogar auf Felsen. Der Name für solch ein Storchennest leitet sich aus dem alten Wort Hurst ab und bedeutete ursprünglich Gesträuch oder Flechtwerk. In der Fachsprache bezeichnet man ein Storchennest ( Horst, Host, Hostel ). Nach der Paarung im April legt das Weibchen im Abstand von zwei bis drei Tagen drei bis fünf weiße Eier. Die Jungen wiegen nach dem Schlüpfen gerade mal 70 (Gramm, Kilogramm, Tonnen). Weil sie reichlich zu fressen bekommen, nehmen sie pro Tag etwa 60 Gramm (zu, ab). Beide Elterntiere ziehen die Jungvögel auf. Bei der (Zucht, Aufzucht, Erziehung) werden sie immer von einem Elternteil bewacht, gewärmt oder vor Regen geschützt, wenn das andere auf (Partnersuche, Nahrungssuche, Futtersuche, Besuch im Nachbarnest) ist. Im Juni oder Juli sind die Jungen dann (reif, ausgeruht, flügge) und verlassen das Nest. Störche geben keine Laute von sich, sondern (plappern, klappern, schnattern) mit ihrem langen Schnabel. Dieses Geräusch ist weit zu hören. Es dient zur Begrüßung, zur Verständigung der Partner und es werden dadurch auch fremde Störche vom Nest verjagt. 266
267 Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz 4.2 Begriffe aus dem Kontext erschließen und ordnen & 4.3 Arbeit mit Ober- und Unterbegriffen Die Schülerinnen und Schüler werden dazu angeregt, Wortbedeutungen aus Kontexten zu entschlüsseln. Bei Bedarf schlagen die Schülerinnen und Schüler in Wörterbüchern nach oder suchen den Begriff im Internet. Ein Stoff oder ein Gemisch aus Stoffen In der Natur kommen Stoffe nur selten als Reinstoffe vor. Meistens handelt es sich um Stoffgemische, die sich aus mindestens zwei Reinstoffen zusammensetzen. Stoffgemische findet man überall. Betrachtet man ein Stück Granit, sieht man verschiedene Bestandteile. Zerkleinert man ein Granitstück mit einem Hammer, kann man es in die einzelnen Bestandteile auftrennen. Einzelne Bestandteile sind deutlich erkennbar. Die Bestandteile liegen alle im festen Zustand vor, ein solches Gemisch nennt man auch Gemenge. Vermischt man Salatöl und Wasser, schwimmt das Öl aufgrund seiner geringeren Dichte zunächst auf dem Wasser. Durch kräftiges Schütteln vermischen sich die beiden Flüssigkeiten teilweise. Dieses Gemisch von zwei Flüssigkeiten bezeichnet man als Emulsion. Vermischt man einen festen Stoff mit einer Flüssigkeit, in der dieser sich nicht löst, erhält man eine Suspension. Beim Verrühren von Gartenerde in Wasser sind die festen Bestandteile der Erde auch ohne Mikroskop zu erkennen. Sie setzen sich nach einer Weile am Boden des Gefäßes ab. Sind die Bestandteile eines Stoffgemisches mit den Augen oder mit Hilfe eines Mikroskops noch zu erkennen, liegt ein heterogenes Stoffgemisch vor. Wenn man einen Goldbarren herstellt, versucht man möglichst reines Gold zu verwenden. Ein Goldring mit dem innen versehenen Stempel 585 enthält einen garantierten Goldgehalt von 58,5 % Gold, der restliche Anteil setzt sich aus Silber, Kupfer oder Platin zusammen. Hier liegt ebenfalls ein Stoffgemisch in Form einer Legierung vor. Als Legierung bezeichnet man ein Stoffgemisch, bei dem mindestens eine Komponente aus einem Metall besteht. Die einzelnen Komponenten einer Legierung kann man jedoch selbst mit einem Mikroskop nicht mehr erkennen. Derartige Stoffgemische nennt man homogene Stoffgemische. Nicht nur Legierungen bilden homogene Stoffgemische, sondern auch Lösungen und Gemische verschiedener Gase. Beim Streuen von Kochsalz in Wasser löst sich das Salz allmählich auf und ist nach einer Weile nicht mehr zu sehen. Dass es noch im Wasser gelöst ist, könnte man leicht mit der Geschmacksprobe feststellen. Ein Beispiel für ein homogenes Stoffgemisch zwischen mehreren Gasen, stellt die gewöhnliche Atemluft dar. Sie enthält als Hauptbestandteil 78 % Volumenanteile Stickstoff, 21 % Volumenanteile Sauerstoff und 1 % Volumenanteil an anderen Gasen wie Argon oder Kohlenstoffdioxid. Dieser Text eignet sich auch dazu, Ober- und Unterbegriffe zu finden und diese in einer hierarchischen Übersicht darzustellen. Als Hilfe bietet es sich an, ein Raster vorzugeben. 267
268 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Zu jedem Begriff könnte ein Beispiel zugeordnet werden. Stoffe Reinstoffe homogene Stoffgemische 4.4 Den Wortschatz über den Rhythmus üben und festigen (Kindergarten 5. Schuljahr) Diese Lerntechnik eignet vor allem sich für Kinder im Vorschulalter bzw. der Primarstufe und soll hier nicht näher erläutert werden. 4.5 Den Wortschatz mit semantischen Wortlisten erweitern Semantische Wortlisten beinhalten Begriffe bzw. Wörter, deren vielseitige Bedeutung innerhalb eines Satzes oder Textes in nachvollziehbaren und sinnvollen Zusammenhängen erschlossen werden kann. Sie sind gute Stützen für individuelles Wortschatzlernen und lassen sich mit anderen Lerntechniken wie etwa Mindmaps oder Wortfeldern gut kombinieren. 14 Ein Beispiel stellen die Wortlisten des im Folgenden dargestellten Protokollschemas dar, welches z. B. im Fachraum als Plakat hängen könnte Selemi 2010, S. 74
269 Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz Protokolle im naturwissenschaftlichen Unterricht 15 Folgende zwei Grundregeln sollte man bei der Erstellung eines Protokolls im naturwissenschaftlichen Unterricht beachten:» Ein Protokoll wird immer im Präsens (= Gegenwart) geschrieben.» Zum Schreiben wird die unpersönliche Form (man, Passiv) verwendet. Nachfolgende Formulierung helfen bei der Erstellung eines guten Protokolls: Für die Vermutung: Ich denke, dass Ich vermute, dass Es könnte so sein, dass Vermutlich Wahrscheinlich könnte Für die Durchführung: Satzanfänge für Abläufe: Zuerst Dann Danach Schließlich Am Ende Für die Beobachtung: Für den Satzanfang: Man beobachtet, dass Man bemerkt, dass Man sieht, dass Man erkennt, dass Man riecht, dass Man hört, dass Am Reagenzglas kann man erfühlen, dass Für die Auswertung: Für den Satzanfang: Man weiß jetzt, dass Das ist geschehen, weil Das ist passiert, weil Die Erklärung dafür ist, dass Man erklärt dies folgendermaßen: Der Grund dafür ist, dass beschreibende Verben: hinzugeben man gibt hinzu einfüllen man füllt ein erhitzen man erhitzt filtrieren man filtriert eingießen man gießt ein beschreibende Verben: lösen löst sich auflösen löst sich auf hinabsinken sinkt hinab ausfallen fällt aus färben färbt sich Begründungen:, weil, da, deshalb Satzverknüpfer: Wenn, dann Nachdem, dann Weil, deshalb, trotzdem Art des Geschehens: auf einmal plötzlich stetig immer wieder langsam Schritt für Schritt nach und nach 15 Both
270 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Darstellungen, anhand derer Schülerinnen und Schüler die Wörter im Zusammenhang lernen können, eignen sich besonders bei der Arbeit mit semantischen Wortlisten. Auch diese können im Fachraum ausgehängt werden. Die Begriffe aus der Abbildung könnten den Lernenden mit der Aufforderung, diese zeichnerisch als einfachen Stromkreis darzustellen, vorgegeben werden. Wortliste: Glühbirne Leistungsverbraucher Schalter Kabel/Leitung Batterie Plus- und Minuspol Leistungserzeuger einfacher Stromkreis Schülerzeichnung: 4.6 Den Wortschatz mit Textpräsentationen festigen Sogenannte Zeichendiktate eigenen sich besonders gut, Wortschatz mit Textpräsentationen zu üben. Die Lehrkraft beschreibt ein Bild, Detail für Detail, Schritt für Schritt. Die Schülerinnen und Schüler hören aufmerksam zu und zeichnen gleichzeitig dazu das Gehörte. Anschließend präsentieren sie ihre Ergebnisse und sprechen über die Unterschiede ihrer Zeichnungen. Die Beschreibungen können auch von Schülerinnen oder Schülern vorgenommen werden. Das folgende Beispiel ist erprobt und eignet sich besonders für diese Lerntechnik. Der Wasserkreislauf Alle Wasserreservoire hängen zusammen, sie bilden den Wasserkreislauf der Erde. Dieser lässt Süßwasser aus den riesigen Salzwasservorräten der Ozeane entstehen und sorgt so dafür, dass die Süßwasservorräte ständig erneuert werden. Angetrieben wird der Wasserkreislauf von der Sonne: Sonnenstrahlung lässt Wasser aus den Ozeanen, Seen und Flüssen, dem Boden und den Lebewesen verdunsten. So gelangt es in die Atmosphäre. Durch die Winde wird der Wasserdampf über die Erde verteilt, bis er irgendwo abkühlt, dadurch wieder flüssig wird und schließlich als Niederschlag (Regen, Schnee oder Hagel) wieder in Ozeane, Seen, Flüsse und in den Boden gelangt, und von hier in die Lebewesen. Ein Teil des Wassers versickert und führt zur Neubildung von Grundwasser ( )
271 Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz 4.7 Den Wortschatz mit Wortfamilien und Wortfeldern systematisch festigen Bedeutung Beispiel Wortfamilien Zusammenfassung von Wörtern gleicher Herkunft, sie sind aus dem gleichen Stammwort entstanden brennen abbrennen verbrennen das Brennglas der Brennofen der Brennpunkt das Kalkbrennen der Brenner Wortfelder Wörter, die sinnverwandt sind und zu einem Themenfeld gehören der Wald abholzen bewirtschaften die Schonung das Gehege das Dickicht wachsen das Revier das Holz die Schichten Aufgaben- Bilde zu jedem Wort einen Satz, Schreibe einen Text zum Wortfeld beispiel aus dem die Bedeutung des jeweiligen Wortes hervorgeht. Wald unter Verwendung der angegebenen Wörter. Suche Wörter zum Wortfeld Energie und ordne die Wörter, die zusammenpassen. 271
272 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Wortfelder: Energie (Physik) 17 In Folgenden sind wichtige Begriffe und Verben zum Thema Energie zusammengefasst. WORTFELD ENERGIE Nomen Bewegungsenergie Lageenergie chemische Energie elektrische Energie Wärmeenergie Lichtenergie Verformungsarbeit umwandeln abgeben Verben übertragen aufnehmen Beschreibe die Energieumwandlungen bei den folgenden Vorgängen. Nutze möglichst viele Begriffe aus dem Wortfeld Energie. Alltagssprache Beim Autofahren treibt das Benzin das Auto an. Leo fällt ein Glas fällt aus der Hand, das Glas zersplittert. Beim Bremsen werden die Bremsscheiben des Autos heiß. Eine weiße Billardkugel prallt gegen eine schwarze, die weiße bleibt stehen und die schwarze rollt weiter. In der Küche brennt Licht. Energieumwandlung mit Fachbegriffen Chemische Energie des Benzins wird in Bewegungsenergie umgewandelt. Die Lageenergie des Glases wird in Bewegungsenergie umgewandelt. Beim Zerschellen wird Verformungsarbeit verrichtet. Die Bewegungsenergie des Autos wird in Wärmeenergie umgewandelt. Die weiße Kugel gibt Bewegungsenergie ab, die schwarze nimmt diese Energie auf. Oder: Es wird Bewegungsenergie von der weißen Kugel auf die schwarze übertragen. In der Lampe wird elektrische Energie in Lichtenergie (und Wärmeenergie) umgewandelt Pechstein 2013
273 Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz 4.8 Mit Antonymen und Synonymen bewusst umgehen Die Beschäftigung mit Antonymen und Synonymen ist wichtig für die rezeptive und produktive Wortschatzarbeit der Schülerinnen und Schüler und bietet viele Möglichkeiten, sich u. a. mit Fachwörtern bewusst auseinanderzusetzen. Beispiele und Aufgabenstellungen sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. Bedeutung Beispiel Synonyme Wörter gleicher bzw. ähnlicher Bedeutung Apfelsine = Orange Pferd = Gaul Base = Lauge Erbgut = Genom Stoff = Substanz Symbiose = Lebensgemeinschaft Parasit = Schmarotzer kondensieren = verflüssigen drehen = filmen drehen = rotieren Antonyme Wörter mit gegensätzlicher Bedeutung sauer süß sauer basisch absorbieren desorbieren Akzeptor Donator Explosion Implosion Genotyp Phänotyp Fettsucht Magersucht Jäger Beute Anode Katode Leistungsverbraucher Leistungserzeuger Aufgaben- Finde für die Wörter: Orange, Fülle das Kreuzworträtsel der beispiel Pferd, Lauge, Genom, Substanz, Parasit, Energie Wörter mit gleicher Bedeutung. Vergleiche die Bedeutungen der Wörter drehen, filmen und rotieren. Gegenteile aus. Bilde jeweils einen Satz mit den antonymen Begriffen. Kreuzworträtsel der Gegenteile 1. Gegenteil von sauer 2. Gegenteil von adsorbieren 3. Gegenteil von Räuber 4. Gegenteil von Anode 5. Gegenteil von Akzeptor 6. Gegenteil von Genotyp 7. Gegenteil von Explosion 8. Gegenteil von Fettsucht A N 3 T 4 O 5 N Y 7 M 8 E 273
274 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften 4.9 Texte mit Schlüsselwörtern entschlüsseln Schlüsselwörter sollen den Text aufschließen. Wie können die Lesenden deren Schlüsselbedeutung erkennen, wenn sie den Text nicht oder nur teilweise verstehen? Sie können allenfalls,interessante oder,verdächtige Wörter als vermeintliche Schlüsselwörter markieren. Erst wenn man den Inhalt verstanden hat, ist man fähig, Schlüsselwörter zu entdecken und zu nutzen. Mit folgenden Aufträgen kann die Lehrkraft Hilfestellungen geben: Drei-Stufen-Verfahren:» Markiere mit dem Bleistift erst Wörter, die du als Schüsselwörter vermutest.» Vergleiche anschließend deine Schlüsselwort-Kandidaten mit denen deiner Nachbarin, deines Nachbarn.» Zum Schluss werden wir die Kandidaten gemeinsam in der Klasse verhandeln. Vorschläge sammeln und gemeinsam kategorisieren:» Macht Vorschläge: Welche Wörter sollen wir unterstreichen? Anzahl der Schlüsselwörter eingrenzen:» Unterstreiche im Text maximal x Schlüsselwörter. Merkzettel entwickeln:» Stelle zu dem Text einen Merkzettel her, der maximal zehn Wörter enthalten darf. 18 Bei der Auswahl des Textes ist darauf zu achten, dass er nicht zu lang oder zu kurz ist. Die Länge des Textes sollte in einem angemessenen Verhältnis zum Inhalt stehen. Lehrbuchtexte sind oft knapp und hoch verdichtet Lesen_in_den_Naturwissenschaften.pdf ( )
275 Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz 4.10 Zusammensetzungen und Ableitungen entschlüsseln In der Tabelle sind neben einer kurzen Beschreibung der beiden Wortbildungsarten diesen auch Beispiele für Wörter aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht zugeordnet. Die anschließenden Aufgabenstellungen bieten eine Möglichkeit, wie Schülerinnen und Schüler zusammengesetzte Wörter auseinandernehmen und die Beziehungen zwischen ihnen erkennen können. Wortbildungsarten Bedeutung Beispiel Aufgabenbeispiel Zusammensetzung (Komposita) Wort, das durch Kombination von mind. zwei selbstständigen Wörtern oder Stämmen entsteht. z. B. Wärmeenergie Ein Bestandteil ist das Grundwort (Energie), der andere Teil das Bestimmungswort (Wärme), der die Bedeutung des Grundwortes spezifiziert. Atom/hülle Zell/bestandteile Becher/glas Fahrrad/ergometer Temperatur/sensor Elektronen/strahl/röhre luft/trocknen wasser/löslich schwefel/arm 4 Komposita aus dem Text sind in ihre Bestandteile zerlegt und durcheinander gebracht. Welche Teile passen zueinander? Ableitung (Derivationen) Wort, das aus einem bereits vorhandenem Wort oder Stamm durch das Anfügen von Wortbausteinen (Prä- oder Suffxen) entsteht: Präfixbildung: vortragen Suffxbildung: tragbar Beides: untragbar + Präfixe + Suffxe be/greifen ultra/kurz dis/kontinuierlich in/human an/organisch inter/molekular Pro/phase her/leiten kohlensäure/ haltig Elektrik/er lös/lich brenn/bar schwere/los funktion/al farb/los farb/ig Suche Ableitungen zu den Wörtern brennen und lösen. Bilde jeweils einen Satz mit den abgeleiteten Wörtern. Die Aggregatzustände des Wassers Die Zustands des Wassers bezeichnet man als zustände. Wasser verdampft zu Wasser, wenn zu sieden beginnt. Der punkt beträgt 100 C. Kommt Wasserdampf mit einer kalten Oberfläche in Berührung, kondensiert der Dampf wieder zu flüssigem Wasser. Beim Abkühlen von flüssigem Wasser unter 0 C erstarrt es zu festem Eis. Die Verflüssigung von Eis nennt man schmelzen. Eis schmilzt am Schmelzpunkt von 0 C. Der Schmelzpunkt bei einem Stoff entspricht dem Erstarrungspunkt. Der punkt entspricht dem Kondensationspunkt. Zustands- Wasser- Aggregat- Siedezustände punkt formen dampf 275
276 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Aufgabe: Finde ein Wort, sodass sich sinnvolle Wortzusammensetzungen der beiden Begriffe in einer Zeile ergeben. Füge selbst zwei Beispiele hinzu. Wein Laub Frosch Winter Wetter Hahn Atom Teilchen Beschleuniger Laub Baum Krone Aufgabe: Ergänze folgende Tabelle. Präfix Grundwort Suffx Ableitung Wortart Mensch -heit Menschheit Nomen mensch -lich menschlich Adjektiv Ur- mensch Urmensch Nomen Ver- sehen Versehen Nomen ver sehen -tlich versehentlich Adjektiv ein sehen einsehen Verb Band -ung Brandung Nomen ver brennen verbrennen Verb Halb leiter Halbleiter Nomen 276
277 Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz 4.11 Umgang mit Fachwortschatz und Fachtexten Wortschatzlernen und Fachlernen stellen didaktisch und lernpsychologisch eine Einheit dar. 19 Der Wortschatz der Schülerinnen und Schüler wird zum großen Teil über die Auseinandersetzung mit Fachtexten erworben. Das sind nicht selten komplizierte Texte mit vielen Fachbegriffen. Diese lassen sich entlasten, indem man Bilder (a) und Realobjekte zur Veranschaulichung oder Wortlisten mit Erklärungen von Fachbegriffen bereitstellt bzw. alltagsfremde Wörter durch realitätsnahe Synonyme (b) ersetzt. Körperbau der Kerfe (= Kerbtiere, Insekten) 20 (...) Die meisten Kerfe, z. B. Käfer, Schmetterlinge, Fliegen und Wespen, machen, ehe sie fortpflanzungsfähig werden, eine vollkommene Verwandlung (Metamorphose) durch, indem sie in Aussehen und Lebensweise gänzlich verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen. Aus dem Ei, das vom Mutterkerf in kleinerer oder größerer Anzahl mit bewundernswertem Brutinstinkt an den für die Junglarven geeignetsten Plätzen untergebracht wird, schlüpft früher oder später die Larve, so genannt wegen ihres dem späteren Vollkerf völlig unähnlichen Aussehens. Die köpf- und beinlosen Larven der Fliegen heißen Maden, die Larven der Schmetterlinge Raupen, die der Blattwespen wegen ihrer Ähnlichkeit mit den Schmetterlingsraupen Afterraupen, die Maikäfer- und Rachenbremsenlarven heißen Engerlinge, die Schnellkäferlarven Drahtwürmer. Manche Larven sondern ein Sekret ab, das an der Luft zu einem Spinnfaden erhärtet, an dem sich die junge Larve herabläßt und den die alte zu einem bald lockeren, bald festen Gehäuse, dem Kokon ( ) verspinnt. Die Larve frißt meist unermüdlich, häutet sich im Verlauf ihres Wachstums 3 4 mal, bei einigen Arten öfter, und wird schließlich zur Puppe. Diese nimmt keinerlei Nahrung zu sich und ist meist der Ortsbewegung nicht fähig. Käfer und Hautflügler haben freie ( gemeißelte ) Puppen, deren Gliedmaßen dem Rumpf frei anliegen und deshalb genau zu erkennen sind; Schmetterlinge haben bedeckte oder Mumienpuppen, welche die Umrisse des Falters nur schwach andeuten. Die Puppen vieler Kerfe ruhen im Kokon ( ). Bei zahlreichen Fliegenarten bildet die letzte Larvenhaut ein deutlich segmentiertes, die Puppe umhüllendes Tönnchen. Im Puppenstadium findet die Umwandlung der Larve zum Vollkerf (Imago) statt, der nach kürzerer oder längerer Puppenruhe schlüpft, nicht mehr wächst, fortpflanzungsfähig und meist geflügelt ist. (...) Alltagsfremde Wörter, die ersetzt werden sollten: Kerfe, Mutterkerf, Brutinstinkt, Vollkerf, Sekret, Kokon, Hautflügler, ( gemeißelte ), Rumpf, segmentiertes, Puppenruhe, fortpflanzungsfähig 19 Selemi 2010, S Amman 1983, S. 8f. 277
278 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Textentlastung durch Abbildungen und Ersatz alltagsfremder Wörter durch realitätsnahe Synonyme siehe kursiv gedruckte Textstellen Die Entwicklung von Schmetterlingen Das Wort Raupe bezeichnet keine Tierart, sondern einen Abschnitt im Leben bestimmter Tiere. Bekannt sind vor allem die Raupen von Schmetterlingen. Wenn sich Schmetterlinge fortpflanzen, legen sie z. B. auf Dill- oder Petersilienpflanzen befruchtete Eier ab. Aus ihnen schlüpft nach etwa einer Woche ein kleines, wurmähnliches Tier. Das ist die Raupe. In diesem Lebensabschnitt frisst eine Raupe viele Blätter. Sie wird schnell größer und dicker. Ihre Haut sieht aus wie ein Panzer und besteht vor allem aus Chitin, einem hornähnlichen Material. Die Haut wird schnell zu eng und platzt. Doch die Raupe bildet eine neue, viel größere Chitinhülle. Das Abstreifen und Erneuern der Haut nennt man Häutung. Nach etwa 5 Häutungen hat die Raupe ihre endgültige Größe erreicht. Nun hört sie auf zu fressen. Noch einmal platzt ihre Haut und wird abgestreift. Aus der Raupe wird nun die Puppe. Der Vorgang heißt auch Verpuppung und kann mehrere Wochen dauern. Der Name Puppe kommt daher, dass die Raupe einen scheinbar unbeweglichen Eindruck macht wie auch manche Spielpuppen. Erst nach der Phase als Puppe ist der Schmetterling ausgewachsen und kann selbst Eier ablegen. Ähnlich wie die Schmetterlinge entwickeln sich die meisten Käfer, Fliegen und Wespen. Was aus den Eiern dieser Tiere schlüpft, wird allgemein Larve genannt. Nur bei Schmetterlingen heißt die Larve Raupe, bei Fliegen dagegen Made und bei Maikäfern Engerling. Larve ist also die übergeordnete Bezeichnung. Die Entwicklung vom Ei zum ausgewachsenen Tier heißt auch Metamorphose. Das Wort kommt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich Veränderung der Gestalt. Eier Larven (Raupen) Puppe Schmetterling Zur Wiederholung der im Text verwandten Fachwörter kann man diese aus dem unten angegebenen Buchstabensalat heraussuchen und mit Artikeln, Pluralendungen und kurzen Umschreibungen aufschreiben lassen. D N F P J E M A D E W M E R T P U E I V F Y B B U J G N I L R E T T E M H C S E S O H P R O M A T E M H M N I T I H C D D E B S Ä G N U P P U P R E V N O U F M T E V R A L T K X T T C Q S A R A U P E L K H U Z V E R W A N D L U N G N U S K T H J L P U P P E G In diesem Suchrätsel sind 11 Wörter versteckt. 278
279 Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz 4.12 Den Wortschatz mit Mindmap und Cluster strukturieren und erweitern Clustering kreative Lerntechnik der Wortschatzaufbereitung; erste Ideenfindung; Ergebnis ist eine visuelle Darstellung eines Haufens zusammenhängender Gedanken (Cluster) Mindmap Gedankenkarte, um Wortschatzinhalte assoziativ und hierarchisch zu ordnen und visuell darzustellen; besonders geeignet bei Wiederholungen und Textaufbereitungen Beispiel: Cluster zum Thema Treibhauseffekt ich Politik Trockenheit globale Erwärmung Methanhydrat Wirbelstürme CO 2 CH 4 Gegenmaßnahmen Folgen Hochwasser Treibhausgase Trei reibhauseffekt natürlicher Ursachen anthropogener Zusammenhang zum Ozonloch Beispiel: Mindmap zum Thema Energie Energieumwandlungen Energieformen (I) potenzielle Energie kinetische Energie innere Energie Spannung Energieerhaltungssatz Energie ist die Fähigkeit eines Systems, Arbeit zu verrichten Wärme Leistung: Arbeit pro Zeit Energieformen (II) Technische Energie: Aufbereitete Energie wie Elektrizität, Brennstoffe, Dampf usw. Primärenergie: Rohenergie wie Sonnenstrahlung, Wind, Holz usw. Wirkungsgrad: Nutzen pro Aufwand Nutzenergie: Genutzte Energieformen wie Licht, Transportenergie, Wärme usw. 279
280 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften 4.13 Wortbeziehungen mit Begriffsnetz und Advance Organizer visualisieren Ein Begriffsnetz, auch Conceptmap genannt, ist eine Gedächtnis-Landkarte. Es stellt Begriffe und Beziehungen bildhaft in nicht linearer Verzweigung dar. Es dient, wie die Mindmap, der kognitiven Zusammenfassung und Strukturierung, indem das begriffiche Beziehungsgeflecht dargestellt wird. Folgende Vorgehensweise hat sich bewährt: 1. Sortieren: Schaue die Begriffe (Kärtchen) an und lege die weg, die du nicht kennst oder nicht gebrauchen kannst. 2. Strukturieren: Ordne die Kärtchen auf einem Blatt zu einem Netz. Lege Begriffe, die zusammengehören, näher zusammen. 3. Kleben: Klebe die Begriffe auf das Papier. 4. Beschriften und ergänzen: Zeichne Pfeile zwischen den Begriffen, die zusammengehören. Schreibe kurze Erklärungen an die Pfeile. Sieh dir die weggelegten Karten an. Wenn sie passen, dann klebe sie dazu. Samenpflanzen Blüten Insekten männliche Blütenteile Pollen weibliche Blütenteile Samen Nektar Eine mögliche Darstellung eines Begriffsnetzes mit den in der Tabelle angegebenen Begriffen: Samenpflanzen haben locken Blüten Insekten saugen bestäuben männliche Blütenteile haben haben weibliche Blütenteile nehmen auf produzieren werden transportiert entwickeln Nektar Pollen Samen 280
281 Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz Begriffsnetz: Wärmeübertragung (Physik 7/8) Aufgabe: Erstelle ein Begriffsnetz zum Thema Wärmeübertragung. Information Ein Begriffsnetz kann man sich als eine Landkarte für das Gedächtnis vorstellen. Es stellt Begriffe und Beziehungen zwischen den Begriffen dar. Ein Begriffsnetz hilft Wissen zusammenzufassen und zu strukturieren. Material Tabelle mit Begriffen, Blatt A 4, Schere, Klebestift Arbeitsanleitung» Ordne die Begriffe so auf einem Blatt an, dass Zusammenhänge deutlich werden.» Klebe die Begriffe auf dem Blatt auf.» Zeichne sinnvolle Verbindungslinien.» Beschrifte Verbindungslinien.» Ergänze das Begriffsnetz durch einfache Skizzen zur Darstellung der Sachverhalte. Auswertung» Präsentiere dein Begriffsnetz. Begründe die Anordnung. Wärmeübertragung Rotlichtlampe Golfstrom Wärmeleitung Wärmestrahlung Heizkörper Porzellan Fön schwarzes Auto Aluminium Luft hohe Temperatur Wärmeströmung Stahl helle Mütze Thermoskanne Stoff niedrige Temperatur 281
282 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Der Advance Organizer (die Lernlandkarte) stellt in konzentrierter, abstrakter Form durch Visualisierungen, Bilder, Begriffe, Strukturen usw. die wesentlichen Inhalte, Zusammenhänge und Ergebnisse auf einem Blatt übersichtlich dar. Diese Form dient dazu, den Lernenden vor der selbstständigen Erarbeitung des Stoffes einen ersten Überblick über die Struktur und die verschiedenen Inhalte des Themas zu geben. Der Lehrer stellt seinen Schülern ein neues Thema mit Hilfe eines Advance Organizers vor. Dieser dient während der ganzen Unterrichtseinheit als Gedankengerüst und Orientierungshilfe. Neue Erkenntnisse werden immer in die gesamten Zusammenhänge eingeordnet. Elemente eines gelungenen Advance Organizers» Der Unterrichtsinhalt ist auf das Wesentliche reduziert, zentrale Begriffe und Elemente sind abgebildet.» Anknüpfungspunkte an das Vorwissen der Schüler sind vorhanden (sog. Ankerplätze ).» Der Unterrichtsinhalt ist nichtlinear gegliedert.» Der Unterrichtsinhalt ist visualisiert (Unterstützung durch Bilder, Grafiken, Farbgebung usw.)» Die Organisationsstruktur des Unterrichtsaufbaus (z. B. in Expertengruppen) ist erkennbar. Wie erstellt man einen Advance Organizer?» Begriffe, Schlüsselwörter zum Themenfeld sammeln.» Ziele formulieren (fachliche und nichtfachliche).» Ankerplätze finden, um an Vorwissen anzuknüpfen.» Begriffe zu drei bis maximal vier fachlichen oder methodischen Bereichen clustern, die die Expertengruppen anzeigen.» Nichtlineare Verknüpfungen und Zusammenhänge visualisieren.» Mit Bildern und Symbolen grafisch anschaulich gestalten. Advance Organizer 1: Säuren und Basen Fritsch 2013
283 Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz Advance Organizer 2: Fotosynthese Zeitler
284 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften 4.14 Wortzusammenhänge mit Strukturlegetechnik erklären Eine Hilfe für das Verstehen von Zusammenhängen bieten strukturierende Schemata (,kognitive Landkarten ). Das sind z. B. die bereits beschriebenen Mindmaps (siehe 4.12), bei denen um einen zentralen Begriff weitere Begriffe hierarchisch angeordnet werden, und Conceptmaps (Begriffsnetze) (siehe 4.13), bei denen wichtige Begriffe als Knoten und deren Beziehungen als beschriftete Linien dargestellt werden. Als zeitsparende Alternative zur Bearbeitung von Conceptmaps schlägt Diethelm Wahl 23 die Struktur-Lege-Technik vor. Diese Methode eignet sich gut zur Selbstkontrolle des Lernens und Verstehens von Zusammenhängen. 24 Struktur-Lege-Technik am Beispiel: Redoxreaktionen (Anleitung für Schülerinnen und Schüler) Die Methode Struktur-Lege-Technik hilft euch zu prüfen, wie gut ihr die Grundlagen zum Themengebiet Redoxreaktionen verstanden habt, eventuelle Lücken zu schließen und ein vernetztes Wissen aufzubauen. Die Arbeit erfolgt in Einzel- und Partnerarbeit. Jeder Teilnehmer erhält einen Satz Begriffskärtchen. Geht folgendermaßen vor: 1. Sortieraufgabe: Sortiere die Kärtchen in zwei Stapel. In den ersten Stapel kommen alle Begriffe, die du einer Mitschülerin/einem Mitschüler erklären kannst. In einen zweiten Stapel kommen die Kärtchen, bei denen das noch nicht der Fall ist. 2. Kläre allein oder in Partnerarbeit die noch unklaren Begriffe. Dabei ist auch die Verwendung des Schulbuchs, deiner Aufzeichnungen oder eines Lexikons erlaubt. 3. Struktur-Lege-Technik: Lege die Kärtchen in einer sinnvollen Anordnung vor dir auf deinem Arbeitsplatz aus. Schaut in Partnerarbeit eure Anordnungen gegenseitig an, erklärt euch eure jeweilige Anordnung und begründet sie. Oxidationsmittel Reduktionsmittel Oxidation Reduktion Redoxreaktion Reduktionsmittel Oxidationsmittel Elektronenabgabe Elektronenaufnahme Elektronenakzeptor Elektronendonator Elektronenübergang Teilchenebene Stoffebene Halogene Alkalimetalle Chlormoleküle Natriumatome Chlor Natrium Wahl 2006, S. 178ff ( )
285 Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz 4.15 Feine Unterschiede der Vieldeutigkeit von Wörtern erkennen In allen Sprachen haben viele Wörter mehrere Bedeutungen. Deshalb ist es wichtig, den Schülerinnen und Schülern an geeigneten Beispielen diese unterschiedlichen Wortbedeutungen bewusst zu machen. Im Folgenden wird ein Unterrichtsbeispiel vorgestellt, das im naturwissenschaftlichen Unterricht in Festigungs- oder Systematisierungsphasen eingesetzt werden kann. Es stellt ein weiteres Beispiel für die Verknüpfung von Wortschatzarbeit und Fachunterricht dar. Beispiel 1: Ein Wort mit mehreren Bedeutungen 1. Finde weitere Bedeutungen für das Wort brennen. 2. Beschreibe (ggf. unter Verwendung von Literatur) diese Vorgänge. Brennen 1. Kalkbrennen Beschreibungen 2. Kohle brennt 3. es brennt unter den Nägeln 4. die Sonne brennt 5. an einer Brennnessel verbrennen 6. CD-ROM brennen 7. Chili brennt auf der Zunge 8. Brennstäbe im Kernreaktor 9. Kerze brennt 10. Glühbirne brennt 11. Alkohol brennen 3. Kreuze in der folgenden Tabelle in der richtigen Spalte an. 4. Entwickele für die chemischen Reaktionen jeweils die Wort-/Reaktionsgleichung. Vorgang chemische Reaktion physikalischer Vorgang Sonstiges 1. Kalkbrennen 2. Kohle brennt 3. es brennt unter den Nägeln 4. die Sonne brennt/sonnenbrand 5. an einer Brennnessel verbrennen 6. CD-ROM brennen 285
286 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Vorgang chemische physikalischer Sonstiges Reaktion Vorgang 7. Chili brennt auf der Zunge 8. Brennstäbe im Kernreaktor 9. Kerze brennt 10. Glühbirne brennt 11. Alkohol brennen Beispiel 2: Ähnliche Begriffe mit unterschiedlicher Bedeutung 1. Ordne den Begriffen die entsprechenden Modelle zu. Begriffe Modelle Hydroxid-Ion 2. Hydroxy- Gruppe 3. Hydronium- Ion 4. Hydrogenium A B C 5. Hydroxide D E F 6. Hydroxy-Verbindungen 7. Hydrolyse 8. hydrophil 9. Hydrathülle G A-B + H-OH A-H + B-OH H I Grafiken: Christa Penserot, LISUM
287 Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz 2. Ordne die Begriffe durch Ankreuzen den entsprechenden Oberbegriffen zu. Begriffe Teilchen funktionelle Gruppe chemische Verbindung chemische Reaktion stoffiche Eigenschaft Hydroxid-Ion Hydroxy-Gruppe Hydronium-Ion Hydrogenium Hydroxide Hydroxy- Verbindungen Hydrolyse hydrophil 3. Definiere die Begriffe. Nutze die Tabelle der Aufgabe 2 zum Finden der jeweiligen Oberbegriffe. Begriffe Hydroxid-Ion Hydroxy-Gruppe Hydronium-Ion Hydrogenium Hydroxide Hydroxy-Verbindungen Hydrolyse hydrophil Definition (Oberbegriff + charakteristische Merkmale) 287
288 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften 4. Memory Hydroxid-Ion Das Hydroxid-Ion ist ein negativ geladenes Ion ( Teilchen), das entsteht, wenn Basen mit Wasser reagieren. Hydroxy-Gruppe Die Hydroxy-Gruppe (auch Hydroxylgruppe) OH ist die funktionelle Gruppe der Alkohole und Phenole. Hydronium-Ion (Oxonium-Ion) Das Hydronium-Ion (H 3 O + ) ist ein geladenes Teilchen, das durch Anlagerung eines Protons an ein Wassermolekül entsteht. Hydrogenium Hydrogenium ist die lateinische Bezeichnung für das Element/die Atomart Wasserstoff. 288
289 Methoden auswahl für die Arbeit am Wortschatz Hydroxide = OH Metallhydroxide sind Ionenverbindungen, die aus Metall-Ionen und Hydroxid-Ionen (OH - ) aufgebaut sind. Hydroxy- Verbindungen Hydroxy-Verbindungen sind chemische Verbindungen, die mindestens eine Hydroxyl-Gruppe ( OH) im Molekül enthalten. Hydrolyse A B + H OH A H + B OH Die Hydrolyse ist eine chemische Reaktion, bei der die Aufspaltung einer chemischen Verbindung durch Anlagerung von Wasser erfolgt. hydrophil Der hydrophile Charakter einer Substanz wird durch ihre Eigenschaft bestimmt, sich in Wasser zu lösen bzw. Wasser aufzunehmen. 289
290 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften 4.16 Redewendungen bewusst aufnehmen und Metaphern bewusst anwenden Der Begriff Metapher stammt von dem griechischen Wort metaphorá (Übertragung) ab. Eine Metapher überträgt dabei die Bedeutung des einen Wortes auf die eines anderen. Aus Kamel wird so zum Beispiel Wüstenschiff. Wenn man etwas nicht wörtlich, sondern im übertragenen, bildlichen Sinne meint, meint man es also metaphorisch. Die Metapher ist ein sprachliches Bild. 26 Solche sprachlichen Bilder zu verstehen und anzuwenden, setzt einen umfangreichen Wortschatz und gut entwickelte Denkfähigkeiten voraus. Durch die Auseinandersetzung mit Redewendungen können Schülerinnen und Schüler ihren produktiven Wortschatz und ihre Ausdrucksfähigkeit erweitern. Dabei ist es wichtig, dass die Lernenden die übertragende Bedeutung der Redewendungen kennenlernen. Einige Redewendungen eignen sich dazu, sie im naturwissenschaftlichen Zusammenhang zu betrachten. Redewendung Metapher Bedeutung Bezug zu den Naturwissenschaften am Beispiel konkreter Aufgabenstellungen Biologie Nachts sind umgangssprachlich: Aufgabe: alle Katzen Nachts erscheint Vielleicht kennst du das Sprichwort: Nachts sind alle grau. alles gleich; man sieht über Mängel hinweg Katzen grau. Umgangssprachlich bedeutet das, das alles gleich erscheint oder man über Mängel hinweg sieht. Aber es gibt auch einen biologischen Zusammenhang zu diesem Sprichwort. Der Mensch sieht die bei Tageslicht farbigen Gegenstände nachts nur in Grautönen. Begründe diesen biologischen Sachverhalt. Erwartungsbild: Nachts reicht das Licht nur aus, um die Stäbchen in der Netzhaut anzuregen, die für das Dämmerungssehen verantwortlich sind. Die für das Farbsehen verantwortlichen Zapfen werden nicht erregt. Chemie Wie Feuer unvereinbar; Aufgabe: und Wasser grundverschieden; widersprüchlich; nicht zusammenpassend Feuer ist die Flammenbildung bei der Verbrennung von Stoffen unter Abgabe von Wärme und Licht. Begründe, warum man brennendes Benzin nicht mit Wasser löschen kann. Erwartungsbild: Benzin und Wasser sind nicht mischbar. Benzin ist leichter als Wasser. Brennendes Benzin schwimmt auf dem Löschwasser weiter In Anlehnung an ( )
291 Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz Redewendung Metapher Bedeutung Öl ins Feuer provozieren; einen Aufgabe: gießen Streit entfachen; einen schwelenden Konflikt zum Ausbruch bringen; Erregung/ Leidenschaft noch verstärken Bezug zu den Naturwissenschaften am Beispiel konkreter Aufgabenstellungen Erläutere die Bedeutung der Redewendung aus chemischer Sicht. Erwartungsbild: Öl ist brennbar und verlängert/vergrößert die Flammenerscheinung. Physik Etwas löst Wenn man einen Aufgabe 1: sich in Luft Gegenstand sucht, Nina hat in einem Becherglas Wasser bis zum Sieden auf. aber nicht finden kann. erhitzt. Mit der Zeit wird die im Becherglas befindliche Wassermenge immer kleiner. Ergänze den folgenden Satz: Das Wasser hat sich nicht in Luft umgewandelt, sondern Plane ein Experiment, dass deine Aussage aus (a) bestätigt und führe es durch. Erwartungsbild: Das Wasser hat sich nicht in Luft umgewandelt, sondern es hat seinen Aggregatszustand geändert, indem es gasförmig geworden ist. Experiment: Über das siedende Wasser kann eine Glasplatte gehalten werden. Daran kondensiert der Wasserdampf, der sich zuvor gebildet hat. Aufgabe 2 (Variante): Tom hat ein paar Tropfen Wasser auf einen Teller geträufelt. Nach ein paar Stunden ist das Wasser nicht mehr zu sehen. Hat es sich in Luft aufgelöst oder umgewandelt? Erläutere, was genau passiert ist. Erwartungsbild: Das Wasser hat sich nicht in Luft oder einen anderen Stoff umgewandelt. Es hat jedoch seinen Aggregatzustand geändert. Es ist gasförmig geworden und hat sich mit der Luft vermischt. 291
292 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Redewendung Metapher Lahm wie eine Schnecke sein Bedeutung Wenn ein Körper eine geringe Geschwindigkeit besitzt. Bezug zu den Naturwissenschaften am Beispiel konkreter Aufgabenstellungen Aufgabe: Wie schnell oder langsam sind Schnecken eigentlich? Plane ein Experiment, mit dem du die Geschwindigkeit einer Schnecke ermitteln kannst? Welche Messgeräte benötigst du? Führe dein Experiment durch und beantworte die eingangs gestellte Frage. 27 Erwartungsbild: Nach Messung des Weges, den die Schnecke zurücklegt, und der dafür benötigten Zeit wird die Durchschnittsgeschwindigkeit berechnet. Die folgende Tabelle kann so eingesetzt werden, dass die grauen Formulierungen von den Schülerinnen und Schülern gefunden werden sollen Der Versuch kann im Freiland durchgeführt werden, ohne dass die Tiere gequält werden.
293 Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz Fülle die folgende Tabelle aus. 28 Bild 28 Metapher/Redewendung Bedeutung Rabeneltern Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen Warteschlange wartende Reihe von Personen, Fahrzeugen einen Frosch im Hals haben die Stimme will nicht so recht blind wie ein Maulwurf man erkennt etwas schlecht einen Bären aufbinden flunkern, lügen aus einer Mücke einen Elefanten machen übertreiben 28 Abbildungen: Zeitler
294 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Bild 28 Metapher/Redewendung Bedeutung die Sau raus lassen sich austoben Mich laust der Affe! sich über etwas wundern Wüstenschiff auf einem Kamel sitzend schaukelnd durch die Wüste reiten wie der Ochs vorm Scheunentor völlig perplex sein wie die Made im Speck es sich sehr gut gehen lassen auf Kosten anderer 294
295 Methodenauswahl für die Arbeit am Wortschatz Die Arbeit mit Ober- und Unterbegriffen bietet sich als ein weiterer Arbeitsauftrag an. Ordne alle Tiere in die Übersicht ein: Tiere Wirbeltiere wirbellose Tiere Fische Lurche Kriechtiere Vögel Säuger Der Einsatz derartiger Aufgaben ist nicht unumstritten, denn die Schülerinnen und Schüler kennen häufig die Redewendungen nicht (mehr) oder sie können sich als Geburtsstätte für Fehlvorstellungen erweisen. Die Lernenden müssen in der Lage sein, die Sinnübertragungen zu verstehen, was ihnen aber oft schwer fällt. 295
296
297 5 Strategien für die Formulierung und Beispiele gelungener Aufgabenstellungen Genaue Handlungsanleitungen für die Schülerinnen und Schüler sind im Unterricht unabdingbar. Eine wichtige Rolle spielen dabei Operatoren. Dies sind Verben gleichsam Schlüsselwörter, die den Schülerinnen und Schülern signalisieren, was sie bei einer Frage oder einer Aufgabe konkret tun sollen, und zwar sowohl im Unterrichtsgespräch als auch in schriftlichen Arbeitsaufträgen. Wird eine Aufgabe unklar formuliert, führt dies zu Verunsicherung oder gar zu Missverständnissen, da das Ziel des Auftrags unklar bleibt. Eine Frage wie zum Beispiel: Welche Ursachen gibt es für den sauren Regen? lässt offen, ob die Schülerinnen und Schüler diese Ursachen einfach aufzählen sollen oder ob sie einen Text durchlesen, nach den dort erwähnten Ursachen suchen und diese dann beschreiben sollen. Möglich wäre auch, dass sie die Ursachen erklären, begründen oder diskutieren sollen. Nur leistungsstarke Schülerinnen und Schüler werden einen solchen Arbeitsauftrag so ausführen, dass möglichst viele der zu vermutenden Absichten der Lehrkraft dabei erfüllt werden. Operatoren präzisieren das Ziel von Arbeitsaufträgen, sorgen dabei für Orientierung und erleichtern die Bearbeitung von Aufgaben. Manche Lehrwerke enthalten daher Listen von Operatoren und erklären in einer für Schülerinnen und Schüler verständlichen Alltagssprache, welche geforderte Handlung mit dem jeweiligen Operator verbunden ist. Auch die Konferenz der Kultusminister (KMK) hat für einige Fächer Operatoren insbesondere für die Verwendung in der Sekundarstufe II bzw. bei der Erstellung von Klausuraufgaben zusammengestellt. Diese Listen bleiben jedoch stets fachspezifisch und sind daher als Orientierung für Schülerinnen und Schüler gerade der Sekundarstufe I nur bedingt geeignet. So gibt es z. B. für den Operator analysieren in unterschiedlichen Fächern verschiedene Definitionen. Für Schülerinnen und Schüler ist dies sehr irritierend, und das erst recht, wenn verschiedene Lehrkräfte eines Faches überdies unterschiedliche Aspekte der geforderten Tätigkeit für wichtig halten. Es wäre daher gut, wenn in einem Kollegium eine Einigung darüber hergestellt würde, welche Operatoren fachübergreifend verwendet werden können. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich nämlich, dass viele Operatoren einen gemeinsamen Bedeutungskern haben. 297
298 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Die vorliegende Liste von Operatoren aus den Bereichen Natur- und Gesellschaftswissenschaften sowie Deutsch, Mathematik und Englisch stellt den exemplarischen Versuch dar,» aus den in den einzelnen Fächern genutzten Operatoren diejenigen herauszufiltern, die in allen Fächern verwendet werden. Es wurde also eine Schnittmenge gebildet;» aus den in den Fächern genannten Definitionen den ihnen allen gemeinsamen Kern herauszufiltern;» die so gefundenen Operatoren in einer für Schülerinnen und Schüler verständlichen Sprache zu formulieren. Der Gewinn liegt in der Möglichkeit einer breiten Anwendung dieser Operatoren in vielen Fächern. Operator nennen, angeben beschreiben vergleichen erklären erläutern begründen analysieren, untersuchen diskutieren, erörtern beurteilen Handlung Informationen aufzählen, zusammentragen, wiedergeben Sachverhalte, Objekte oder Verfahren mit eigenen Worten darstellen Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln und darstellen Sachverhalte verständlich und nachvollziehbar machen und in Zusammenhängen darstellen einen Sachverhalt darstellen und unter Verwendung zusätzlicher Informationen veranschaulichen Sachverhalte, Entscheidungen bzw. Thesen durch nachvollziehbare Argumente stützen und sachlich (beispielhaft) belegen Unter einer Fragestellung wesentliche Bestandteile, Ursachen oder Eigenschaften herausarbeiten bzw. nachweisen Sich argumentativ mit verschiedenen Positionen auseinandersetzen und ggf. zu einer begründeten Schlussfolgerung gelangen Zu Sachverhalten eine selbstständige Einschätzung formulieren und begründen Um den Schülerinnen und Schülern die Bedeutung häufig verwendeter Operatoren einprägsam bewusst zu machen, bieten sich (ggf. in Vertretungsstunden) Aktivitäten an, die von der umgangssprachlichen Umschreibung auf den Operator schließen lassen. Eine Möglichkeit ist im Folgenden dargestellt. 298
299 Strategien für die Formulierung und Beispiele gelungener Aufgabenstellungen Kreuzworträtsel: Operatoren in Arbeitsanweisungen z. B. 1. zusammenpassende Begriffe mit einer Linie verbinden 2. kontrollieren, ob alles richtig ist 3. bestimmte Informationen aufzählen 4. Sachverhalte durch Argumente stützen und durch Beispiele belegen 5. das Wichtigste kurz aufschreiben 6. etwas genau beobachten, etwas feststellen 7. etwas über eine gewisse Zeit aufmerksam, genau betrachten 8. Sachverhalte verständlich, nachvollziehbar und in (ursächlichen) Zusammenhängen darstellen 9. Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln und darstellen 10. Sachverhalte, Objekte oder Verfahren mit eigenen Worten darstellen 10 1 O 2 P 3 E 4 R 5 A 6 T 7 O 8 R 9 E N 299
300 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Lösung: 10 1 Z U O R D N E N 2 Ü B E R P R Ü F E N 3 N E N N E N 4 B E G R Ü N D E N 5 Z U S A M M E N F A S S E N 6 U N T E R S U C H E N 7 B E O B A C H T E N 8 E R K L Ä R E N 9 V E R G L E I C H E N B E S C H R E I B E N Für Lernende stellt mitunter schon die Formulierung der Arbeitsaufgabe eine erste Verständnishürde dar. Deshalb ist gerade bei der sprachlichen Gestaltung der Aufgaben eine besondere Sorgfalt notwendig. Die folgenden Ausführungen geben Hinweise auf Fallstricke und alternative Möglichkeiten der Aufgabenformulierungen. Aufgabenmerkmale Beispiele vorher Beispiele nachher Operatoren statt Wie gelangen Stickstoffver- Beschreibe, auf welchen W-Fragen bindungen in den Boden? Wegen Stickstoffverbindungen in den Boden gelangen können. klare Handlungs- Welche Begriffe kannst du in Suche und markiere in dem anweisungen geben dem Buchstabengitter zum Thema Alternative Energiequellen entdecken? Buchstabengitter 10 Begriffe zum Thema Alternative Energiequellen. Sprachliche Konzentration statt Schachtelsatz hypotaktische Struktur der Aufgabenstellung erschwert das Verstehen Komplexe grammatikalische Strukturen bereiten oft Schwierigkeiten Nach dem Abstieg von einem hohen Berg stellst du fest, dass die Plastikflasche, die du auf dem Berg leergetrunken und anschließend verschlossen hast, zusammengedrückt ist und sie erst nach dem Öffnen ihre alte Form annimmt. Während einer Wanderung auf einen Berg hast du eine Flasche Mineralwasser ausgetrunken und verschlossen. Die Flasche ist aus Kunststoff. Als du auf dem Gipfel ankamst, war sie zusammengedrückt. Erst nach dem Öffnen nahm die Flasche wieder ihre alte Form an. ( klare Handlungsanweisungen geben) Was ist geschehen? Erkläre diese Beobachtung. 300
301 Strategien für die Formulierung und Beispiele gelungener Aufgabenstellungen Aufgabenmerkmale Beispiele vorher Beispiele nachher Transfer statt Reproduktion Feuerzeuge enthalten in der Regel ein Alkan-Gemisch Der in vielen Feuerzeugen enthaltene Brennstoff wird Wissen auf ähnliche neue aus: Ethan, Propan, Methyl- auch als Flüssiggas bezeich- Aufgaben übertragen propan oder Butan. Dieses lässt sich unter Druck leicht ver flüssigen. net. Dieser Begriff erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich. Eindeutigkeit der Aufgabenstellung und Verwendung von Operatoren Erfahrungswelt der Lernenden beachten Konkretisierung der Aufgaben stellung hinsichtlich der zu erwartenden Antworten Gib für jedes brennbare Gas des Gasgemisches die Reaktionsgleichung für die Verbrennung an. A) Was bedeutet das Sprichwort: Nachts sind alle Katzen grau. Erläutere die scheinbare Widersprüchlichkeit dies Begriffes Flüssiggas. Begründe die Bedeutsamkeit der Eigenschaft des Flüssiggases für das Funktionieren eines Feuerzeuges. B) Vielleicht kennst du das Sprichwort: Nachts sind alle Katzen grau. Umgangssprachlich bedeutet das, das alles gleich erscheint oder man über Mängel hinweg sieht. Aber es gibt auch einen biologischen Zusammenhang zu diesem Sprichwort. Der Mensch sieht die bei Tageslicht farbigen Gegenstände nachts nur in Grautönen. Begründe den biologischen Sachverhalt. Schülerantwort auf Aufgabe A: 301
302 Sprachsensibler Fachunterricht Naturwissenschaften Schülerantwort auf Aufgabe B: 302
Sprachsensibler Fachunterricht Handreichung zur Wortschatzarbeit in den Jahrgangsstufen 5 10 unter besonderer Berücksichtigung der Fachsprache
 s z Sprachbildung und Leseförderung in Berlin s i W h o sc T r h A t ur n j d g k a r z C ä B e i t p l g m f d h h v u Sprachsensibler Fachunterricht Handreichung zur Wortschatzarbeit in den Jahrgangsstufen
s z Sprachbildung und Leseförderung in Berlin s i W h o sc T r h A t ur n j d g k a r z C ä B e i t p l g m f d h h v u Sprachsensibler Fachunterricht Handreichung zur Wortschatzarbeit in den Jahrgangsstufen
Wortschatzarbeit im Deutschunterricht. Bad Berka, Martina Krzikalla
 Wortschatzarbeit im Deutschunterricht Wofür ich keine Sprache habe, darüber kann ich nicht reden. Ingeborg Bachmann Der Wortschatz eines Menschen ist der wichtigste Einzelindikator für seine Intelligenz.
Wortschatzarbeit im Deutschunterricht Wofür ich keine Sprache habe, darüber kann ich nicht reden. Ingeborg Bachmann Der Wortschatz eines Menschen ist der wichtigste Einzelindikator für seine Intelligenz.
Einführung. Dorothea Bolte
 Einführung Dorothea Bolte Einführung Durch die Vermittlung von Fachwissen in der Sekundarstufe I gewinnt die Wortschatzarbeit für jede Schülerin und jeden Schüler eine zusätzliche Bedeutung. Immer mehr
Einführung Dorothea Bolte Einführung Durch die Vermittlung von Fachwissen in der Sekundarstufe I gewinnt die Wortschatzarbeit für jede Schülerin und jeden Schüler eine zusätzliche Bedeutung. Immer mehr
UNTERRICHTSENTWICKLUNG
 UNTERRICHTSENTWICKLUNG 2011 Treffen mit Kleist Bildungsregion Berlin-Brandenburg Impressum Herausgeber: Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) 14974 Ludwigsfelde-Struveshof Tel.:
UNTERRICHTSENTWICKLUNG 2011 Treffen mit Kleist Bildungsregion Berlin-Brandenburg Impressum Herausgeber: Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) 14974 Ludwigsfelde-Struveshof Tel.:
Individualisierung. Individualisierung. Individualisierung. Individualisierung Individualisierung. Bausteine eines individualisierten Unterrichts
 UNTERRICHTSENTWICKLUNG Bausteine eines individualisierten Unterrichts Didaktisch-methodische Hinweise zur Unterrichtsgestaltung in den Jahrgangsstufen 7 10 Bildungsregion Berlin-Brandenburg Bausteine
UNTERRICHTSENTWICKLUNG Bausteine eines individualisierten Unterrichts Didaktisch-methodische Hinweise zur Unterrichtsgestaltung in den Jahrgangsstufen 7 10 Bildungsregion Berlin-Brandenburg Bausteine
TYPISCHE MERKMALE VON FACHTEXTEN 10. Was macht das Verstehen von Fachtexten so schwierig? 10 Was ist für Lernende an dieser Aufgabe schwierig?
 Inhaltsverzeichnis 1 TYPISCHE MERKMALE VON FACHTEXTEN 10 Was macht das Verstehen von Fachtexten so schwierig? 10 Was ist für Lernende an dieser Aufgabe schwierig? 10 Stolpersteine auf der Wortebene 11
Inhaltsverzeichnis 1 TYPISCHE MERKMALE VON FACHTEXTEN 10 Was macht das Verstehen von Fachtexten so schwierig? 10 Was ist für Lernende an dieser Aufgabe schwierig? 10 Stolpersteine auf der Wortebene 11
Wortschatzarbeit in der sprachsensiblen Schule
 Wortschatzarbeit in der sprachsensiblen Schule Für die Kommunikation in alltagssprachlichen Situationen reicht Kindern und Jugendlichen im Deutschen bereits ein Wortschatz von ca. 2000 Wörtern 1. Wird
Wortschatzarbeit in der sprachsensiblen Schule Für die Kommunikation in alltagssprachlichen Situationen reicht Kindern und Jugendlichen im Deutschen bereits ein Wortschatz von ca. 2000 Wörtern 1. Wird
Nataša Ćorić Gymnasium Mostar Bosnien und Herzegowina
 Nataša Ćorić Gymnasium Mostar Bosnien und Herzegowina n Inhalt Der passive und der aktive Wortschatz Das vernetzte Lernen Die Einführung von neuem Wortschatz Phasen der Wortschatzvermittlung Techniken
Nataša Ćorić Gymnasium Mostar Bosnien und Herzegowina n Inhalt Der passive und der aktive Wortschatz Das vernetzte Lernen Die Einführung von neuem Wortschatz Phasen der Wortschatzvermittlung Techniken
Methodenkonzept. Die Schüler und Schülerinnen erwerben Fähigkeiten in vier Methodenbereichen:
 Konzepte Thema: Methodenkonzept Methodenkonzept Ausgangspunkt Im Sinne der Prozessorientiertheit der Entwicklung unseres Schulprogramms hat sich das Lehrerkollegium des Schulverbund Wendland für eine Fortbildung
Konzepte Thema: Methodenkonzept Methodenkonzept Ausgangspunkt Im Sinne der Prozessorientiertheit der Entwicklung unseres Schulprogramms hat sich das Lehrerkollegium des Schulverbund Wendland für eine Fortbildung
Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Englisch
 Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Englisch Gültig ab 10.03.2014 auf Beschluss der Fachkonferenz Englisch vom 06.03.2014 Klasse 1/2 Vorrangige Kriterien für die Einschätzung der Leistungen sind die
Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Englisch Gültig ab 10.03.2014 auf Beschluss der Fachkonferenz Englisch vom 06.03.2014 Klasse 1/2 Vorrangige Kriterien für die Einschätzung der Leistungen sind die
Fach: Deutsch Jahrgang: 7
 In jeder Unterrichtseinheit muss bei den überfachlichen Kompetenzen an je mindestens einer Selbst-, sozialen und lernmethodischen Kompetenz gearbeitet werden, ebenso muss in jeder Einheit mindestens eine
In jeder Unterrichtseinheit muss bei den überfachlichen Kompetenzen an je mindestens einer Selbst-, sozialen und lernmethodischen Kompetenz gearbeitet werden, ebenso muss in jeder Einheit mindestens eine
Lehrplan für alle LV Sprachen - Wahlpflichtfach (S6-S7)
 Schola Europaea Büro des Generalsekretärs Referat für Pädagogische Entwicklung Ref.: 2017-09-D-25-de-2 DEUTSCHE VERSION Lehrplan für alle LV Sprachen - Wahlpflichtfach (S6-S7) GENEHMIGT VOM 12. UND 13.
Schola Europaea Büro des Generalsekretärs Referat für Pädagogische Entwicklung Ref.: 2017-09-D-25-de-2 DEUTSCHE VERSION Lehrplan für alle LV Sprachen - Wahlpflichtfach (S6-S7) GENEHMIGT VOM 12. UND 13.
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017)
 Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Schulcurriculum Gymnasium Korntal-Münchingen
 Klasse: 10 Seite 1 Minimalanforderungskatalog; Themen des Schuljahres gegliedert nach Arbeitsbereichen Übergreifende Themen, die dem Motto der jeweiligen Klassenstufe entsprechen und den Stoff des s vertiefen,
Klasse: 10 Seite 1 Minimalanforderungskatalog; Themen des Schuljahres gegliedert nach Arbeitsbereichen Übergreifende Themen, die dem Motto der jeweiligen Klassenstufe entsprechen und den Stoff des s vertiefen,
Hinweise zum Unterricht
 UNTERRICHTSENTWICKLUNG Hinweise zum Unterricht Der Seminarkurs in der gymnasialen Oberstufe (Brandenburg) Bildungsregion Berlin-Brandenburg Hinweise zum Unterricht Der Seminarkurs in der gymnasialen Oberstufe
UNTERRICHTSENTWICKLUNG Hinweise zum Unterricht Der Seminarkurs in der gymnasialen Oberstufe (Brandenburg) Bildungsregion Berlin-Brandenburg Hinweise zum Unterricht Der Seminarkurs in der gymnasialen Oberstufe
Fonds für Unterrichts- und Schulentwicklung (IMST-Fonds)
 Fonds für Unterrichts- und Schulentwicklung (IMST-Fonds) S8 Deutsch MÖGLICHKEITEN DER BETREUUNG UND FÖRDERUNG LEGASTHENER SCHÜLER/INNEN IM DEUTSCHUNTERRICHT IM RAHMEN DER WIENER MITTELSCHULE UNTER BESONDERER
Fonds für Unterrichts- und Schulentwicklung (IMST-Fonds) S8 Deutsch MÖGLICHKEITEN DER BETREUUNG UND FÖRDERUNG LEGASTHENER SCHÜLER/INNEN IM DEUTSCHUNTERRICHT IM RAHMEN DER WIENER MITTELSCHULE UNTER BESONDERER
Zum Zusammenhang von sprachlicher und mathematischnaturwissenschaftlicher
 Zum Zusammenhang von sprachlicher und mathematischnaturwissenschaftlicher Bildung Vortrag zum Auftakt des zweiten Projektjahrs in FÖRMIG-Transfer Hamburg Hamburg 29.09.2011 Das erwartet Sie Sprachliche
Zum Zusammenhang von sprachlicher und mathematischnaturwissenschaftlicher Bildung Vortrag zum Auftakt des zweiten Projektjahrs in FÖRMIG-Transfer Hamburg Hamburg 29.09.2011 Das erwartet Sie Sprachliche
MS Naturns Fachcurriculum Deutsch überarbeitet 2016
 Jahrgangsstufe: 1. Klasse Basiswissen Thema: Personenbeschreibung/Beschreibung Thema: Erzählung Kompetenzen Der Schüler/die Schülerin kann. detailliert beobachten und Gegenstände beschreiben passende Adjektive
Jahrgangsstufe: 1. Klasse Basiswissen Thema: Personenbeschreibung/Beschreibung Thema: Erzählung Kompetenzen Der Schüler/die Schülerin kann. detailliert beobachten und Gegenstände beschreiben passende Adjektive
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach
 Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Themenübersicht: 1. Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle Kompetenz 2. Literarische Texte
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Themenübersicht: 1. Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle Kompetenz 2. Literarische Texte
Fach: Deutsch Jahrgang: 5
 In jeder Unterrichtseinheit muss bei den überfachlichen Kompetenzen an je mindestens einer Selbst-, sozialen und lernmethodischen Kompetenz gearbeitet werden, ebenso muss in jeder Einheit mindestens eine
In jeder Unterrichtseinheit muss bei den überfachlichen Kompetenzen an je mindestens einer Selbst-, sozialen und lernmethodischen Kompetenz gearbeitet werden, ebenso muss in jeder Einheit mindestens eine
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Erwachsen werden, erwachsen sein. Texte mit der 5-Schritt- Lesemethode erarbeiten Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Erwachsen werden, erwachsen sein. Texte mit der 5-Schritt- Lesemethode erarbeiten Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Auf der Suche nach dem Wortschatz - Sprache erweitern
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Auf der Suche nach dem Wortschatz - Sprache erweitern Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Jahrgangsstufen 3+4
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Auf der Suche nach dem Wortschatz - Sprache erweitern Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Jahrgangsstufen 3+4
Konkretisierung der Ausbildungslinien im Fach Spanisch
 Konkretisierung der slinien im Fach Spanisch Stand: September 2012 slinie Entwicklungsstufen der slinien im VD Gym A: Unterricht konzipieren 1 Den Wortschatz und die Grammatik kommunikationsorientiert
Konkretisierung der slinien im Fach Spanisch Stand: September 2012 slinie Entwicklungsstufen der slinien im VD Gym A: Unterricht konzipieren 1 Den Wortschatz und die Grammatik kommunikationsorientiert
Thema: Beschreiben und Erklären Schwerpunkt: Aktiv und Passiv in verschiedenen Verwendungssituationen
 fächerverbindende Kooperation mit Thema: Beschreiben und Erklären Schwerpunkt: Aktiv und Passiv in verschiedenen Verwendungssituationen Vergleich zwischen Aktiv- und Passivformen Aktiv und Passiv in verschiedenen
fächerverbindende Kooperation mit Thema: Beschreiben und Erklären Schwerpunkt: Aktiv und Passiv in verschiedenen Verwendungssituationen Vergleich zwischen Aktiv- und Passivformen Aktiv und Passiv in verschiedenen
Manual zur Formulierung und Progressionsbeschreibung von Standards in den naturwissenschaftlichen Fächern und WAT
 Manual zur Formulierung und Progressionsbeschreibung von Standards in den naturwissenschaftlichen Fächern und WAT Joachim Kranz 2013 Was man prinzipiell über Standards wissen sollte Bildungsstandards Die
Manual zur Formulierung und Progressionsbeschreibung von Standards in den naturwissenschaftlichen Fächern und WAT Joachim Kranz 2013 Was man prinzipiell über Standards wissen sollte Bildungsstandards Die
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de I Mündlich kommunizieren Beitrag 8 Bildhaft
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de I Mündlich kommunizieren Beitrag 8 Bildhaft
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Erwachsen werden, erwachsen sein. Texte mit der 5-Schritt- Lesemethode erarbeiten (Klasse 8/9) Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Erwachsen werden, erwachsen sein. Texte mit der 5-Schritt- Lesemethode erarbeiten (Klasse 8/9) Das komplette Material finden Sie hier:
Kompetenzbereich: Zuhören und Sprechen
 BILDUNGSSTANDARDS in MITSPRACHE. DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE 1 (Buch-Nr. 165 472) Kompetenzen Aufgaben Kompetenzbereich: Zuhören und Sprechen Altersgemäße mündliche Texte im direkten persönlichen Kontakt
BILDUNGSSTANDARDS in MITSPRACHE. DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE 1 (Buch-Nr. 165 472) Kompetenzen Aufgaben Kompetenzbereich: Zuhören und Sprechen Altersgemäße mündliche Texte im direkten persönlichen Kontakt
Arbeitsrapport im Fach Werken
 netzwerk sims Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen 1 von 6 Arbeitsrapport im Fach Werken Zum vorliegenden Unterrichtsmaterial Das in diesem Beitrag vorgestellte Unterrichtsmaterial entstand im Rahmen
netzwerk sims Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen 1 von 6 Arbeitsrapport im Fach Werken Zum vorliegenden Unterrichtsmaterial Das in diesem Beitrag vorgestellte Unterrichtsmaterial entstand im Rahmen
Latein - Klasse 5 (2. Hj.) - Version 2 (Juni 2005) S. 1 von 5
 Latein - Klasse 5 (2. Hj.) - Version 2 (Juni 2005) S. 1 von 5 Kerncurriculum
Latein - Klasse 5 (2. Hj.) - Version 2 (Juni 2005) S. 1 von 5 Kerncurriculum
Die Familienzeitung UNTERRICHTSENTWICKLUNG
 UNTERRICHTSENTWICKLUNG Die Familienzeitung Ein Angebot für Familien im Rahmen des Unterrichtsprojekts Die Zeitung entdecken für die Jahrgangsstufen 4-7 Bildungsregion Berlin-Brandenburg Impressum Herausgeber:
UNTERRICHTSENTWICKLUNG Die Familienzeitung Ein Angebot für Familien im Rahmen des Unterrichtsprojekts Die Zeitung entdecken für die Jahrgangsstufen 4-7 Bildungsregion Berlin-Brandenburg Impressum Herausgeber:
LehrplanPLUS Mittelschule Englisch Klasse 5. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. 1. Aufbau des Lehrplans
 Mittelschule Englisch Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der Englischunterricht an der Mittelschule ist wie schon bisher - kommunikativ ausgerichtet. Die grundlegenden Voraussetzungen
Mittelschule Englisch Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der Englischunterricht an der Mittelschule ist wie schon bisher - kommunikativ ausgerichtet. Die grundlegenden Voraussetzungen
Die im Französischunterricht vermittelten Grundlagen sollen als Fundament für die Verständigung mit der frankophonen Bevölkerung der Schweiz dienen.
 Anzahl der Lektionen Bildungsziel Französisch hat weltweit und als zweite Landessprache eine wichtige Bedeutung. Im Kanton Solothurn als Brückenkanton zwischen der deutschen Schweiz und der Romandie nimmt
Anzahl der Lektionen Bildungsziel Französisch hat weltweit und als zweite Landessprache eine wichtige Bedeutung. Im Kanton Solothurn als Brückenkanton zwischen der deutschen Schweiz und der Romandie nimmt
Workshop: Die Sprach-Förderungs-Methoden-Werkzeugkiste. Systematischer Auf-und Ausbau von Wortschatz
 Workshop: Die Sprach-Förderungs-Methoden-Werkzeugkiste Netzwerktreffen der ProLesen und BiSS-Schulen, 1 Bad Berka,18.02.2016, Ina Gundermann Sprachbildung und förderung = unterrichtliches Handwerk Methoden
Workshop: Die Sprach-Förderungs-Methoden-Werkzeugkiste Netzwerktreffen der ProLesen und BiSS-Schulen, 1 Bad Berka,18.02.2016, Ina Gundermann Sprachbildung und förderung = unterrichtliches Handwerk Methoden
Kernkompetenzen. im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können
 Kernkompetenzen im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können Bereich: Kommunikation sprachliches Handeln Schwerpunkt: Hörverstehen/Hör- Sehverstehen verstehen Äußerungen und
Kernkompetenzen im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können Bereich: Kommunikation sprachliches Handeln Schwerpunkt: Hörverstehen/Hör- Sehverstehen verstehen Äußerungen und
Curriculum Deutsch Klasse 1/2
 Curriculum Deutsch Klasse 1/2 : Sprechen u. Zuhören Schwerpunkte: verstehend zuhören Gespräche führen zu anderen sprechen szenisch spielen Regelmäßige Gespräche führen, Erzählen zu Sachthemen Fachvokabular
Curriculum Deutsch Klasse 1/2 : Sprechen u. Zuhören Schwerpunkte: verstehend zuhören Gespräche führen zu anderen sprechen szenisch spielen Regelmäßige Gespräche führen, Erzählen zu Sachthemen Fachvokabular
1. Kommunikative Kompetenzen
 Schulinternes Curriculum im Fach Englisch Bilinguale Profilklasse Jahrgangsstufe 5 Stand Oktober 2013 Zunächst orientiert sich das schulinterne Curriculum und die Leistungsbewertung für die englische Profilklasse
Schulinternes Curriculum im Fach Englisch Bilinguale Profilklasse Jahrgangsstufe 5 Stand Oktober 2013 Zunächst orientiert sich das schulinterne Curriculum und die Leistungsbewertung für die englische Profilklasse
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 11. Descripción
 Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 11 Descripción Lernziele: In diesem Block wird der/die Schüler/-in lernen, das Aussehen einer Person gemäß ihres Alters und Körperbaus genau beschreiben zu können.
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 11 Descripción Lernziele: In diesem Block wird der/die Schüler/-in lernen, das Aussehen einer Person gemäß ihres Alters und Körperbaus genau beschreiben zu können.
Tanja Tajmel. Sprachhandlungen
 Tanja Tajmel Sprachhandlungen und Aufgabenstellungen FörMig Workshop, 14. April 2012 Sprachhandlungen situationsangemessene und zweckgerichtete Verwendungen von Sprache schriftlich oder mündlich phonisch
Tanja Tajmel Sprachhandlungen und Aufgabenstellungen FörMig Workshop, 14. April 2012 Sprachhandlungen situationsangemessene und zweckgerichtete Verwendungen von Sprache schriftlich oder mündlich phonisch
Sprache ist nicht alles, aber ohne Sprache ist alles nichts
 AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL Deutsches Bildungsressort Bereich Innovation und Beratung PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Dipartimento Istruzione e formazione tedesca Area innovazione e consulenza
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL Deutsches Bildungsressort Bereich Innovation und Beratung PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Dipartimento Istruzione e formazione tedesca Area innovazione e consulenza
Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch in der SI auf der Grundlage des Kernlehrplans G8
 Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch in der SI auf der Grundlage des Kernlehrplans G8 Übersicht über die Unterrichtsinhalte - Erzähltexte (kürzerer Roman, Novelle, Kriminalgeschichten) - lyrische
Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch in der SI auf der Grundlage des Kernlehrplans G8 Übersicht über die Unterrichtsinhalte - Erzähltexte (kürzerer Roman, Novelle, Kriminalgeschichten) - lyrische
Lehrplan Grundlagenfach Französisch
 toto corde, tota anima, tota virtute Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Lehrplan Grundlagenfach Französisch A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 4 3 3 4 B. Didaktische
toto corde, tota anima, tota virtute Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Lehrplan Grundlagenfach Französisch A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 4 3 3 4 B. Didaktische
Lernlandkarte oder Advance Organizer
 Lernlandkarten Im individualisierten Unterricht arbeiten Schüler zur gleichen Zeit an jeweils unterschiedlichen Themen. Wie können Lehrer/innen und Schüler/innen bei dieser Komplexität den Überblick behalten?
Lernlandkarten Im individualisierten Unterricht arbeiten Schüler zur gleichen Zeit an jeweils unterschiedlichen Themen. Wie können Lehrer/innen und Schüler/innen bei dieser Komplexität den Überblick behalten?
Christoph Selter für das Projekt PIK AS, IEEM, TU Dortmund. Die Zahlen sind nach dem Alferbeet geordnet
 Christoph Selter für das Projekt PIK AS, IEEM, TU Dortmund Die Zahlen sind nach dem Alferbeet geordnet 1 1. Entdecken, Beschreiben, Begründen Prozess- und inhaltsbezogene Kompetenzen fördern! Prozessbezogene
Christoph Selter für das Projekt PIK AS, IEEM, TU Dortmund Die Zahlen sind nach dem Alferbeet geordnet 1 1. Entdecken, Beschreiben, Begründen Prozess- und inhaltsbezogene Kompetenzen fördern! Prozessbezogene
LEHRPLAN FÜR DAS AKZENTFACH LATEIN
 LEHRPLAN FÜR DAS AKZENTFACH LATEIN A. STUNDENDOTATION Klasse 1. 2. 3. 4. Wochenstunden 3 3 x x B. DIDAKTISCHE KONZEPTION Das Akzentfach Latein schliesst an den Lateinlehrgang der Bezirksschule an und führt
LEHRPLAN FÜR DAS AKZENTFACH LATEIN A. STUNDENDOTATION Klasse 1. 2. 3. 4. Wochenstunden 3 3 x x B. DIDAKTISCHE KONZEPTION Das Akzentfach Latein schliesst an den Lateinlehrgang der Bezirksschule an und führt
3.2 Sprachsensibler (Fach-) Unterricht
 3.2 Sprachsensibler (Fach-) Unterricht Begründungszusammenhang Nach einer Studie von Hart und Risley 1 entwickelt sich das kindliche Sprechverhalten parallel zu dem elterlichen Vorbild. D.h., wenn die
3.2 Sprachsensibler (Fach-) Unterricht Begründungszusammenhang Nach einer Studie von Hart und Risley 1 entwickelt sich das kindliche Sprechverhalten parallel zu dem elterlichen Vorbild. D.h., wenn die
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Genial! Deutsch DAZ/DAF - Schritt für Schritt zukunftsfit - Schulbuch Deutsch - Serviceteil Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Genial! Deutsch DAZ/DAF - Schritt für Schritt zukunftsfit - Schulbuch Deutsch - Serviceteil Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Wenn Naturgewalt zur Katastrophe wird. Texte und Schaubilder sicher analysieren (Klasse 9/10) Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Wenn Naturgewalt zur Katastrophe wird. Texte und Schaubilder sicher analysieren (Klasse 9/10) Das komplette Material finden Sie hier:
Schulinternes Fachcurriculum (Deutsch) des Detlefsengymnasiums Glückstadt Klassenstufe 5
 Thema: Von Erlebnissen erzählen Kompetenzbereich: Schreiben (2) Integrierte Kompetenzbereiche: Sprechen und Zuhören (1), Lesen [ ] (3), Sprache und Sprachgebrauch untersuchen (4) Integrierte Fächer: Biologie
Thema: Von Erlebnissen erzählen Kompetenzbereich: Schreiben (2) Integrierte Kompetenzbereiche: Sprechen und Zuhören (1), Lesen [ ] (3), Sprache und Sprachgebrauch untersuchen (4) Integrierte Fächer: Biologie
Hinweise zur Umsetzung mit deutsch.kompetent
 1 Texten und : und Kurzprosa des 20. Jahrhunderts Erzählende Texte untersuchen Typ 4b ca. 20 Stunden - berichten über Ereignisse unter Einbeziehung eigener Bewertungen und beschreiben komplexe Vorgänge
1 Texten und : und Kurzprosa des 20. Jahrhunderts Erzählende Texte untersuchen Typ 4b ca. 20 Stunden - berichten über Ereignisse unter Einbeziehung eigener Bewertungen und beschreiben komplexe Vorgänge
Curriculum Latein, Jahrgangsstufe 9
 Curriculum Latein, Jahrgangsstufe 9 Unterrichtsgegenstände: leichte bis mittelschwere Originaltexte (Einblicke in Prosa und Poesie, z.b. anhand von Apollonius, Hygin; Phaedrus, Catull und Caesar ) Sprachkompetenz
Curriculum Latein, Jahrgangsstufe 9 Unterrichtsgegenstände: leichte bis mittelschwere Originaltexte (Einblicke in Prosa und Poesie, z.b. anhand von Apollonius, Hygin; Phaedrus, Catull und Caesar ) Sprachkompetenz
Mehrsprachigkeit und sprachliche Bildung
 Mehrsprachigkeit und sprachliche Bildung 2. Jahrestagung der DaZ-Lehrer/innen, 21.05.2013, Klagenfurt Mag. Magdalena Knappik (i.v. von Prof. Dr. İnci Dirim), Universität Wien Gliederung Mehrsprachigkeit
Mehrsprachigkeit und sprachliche Bildung 2. Jahrestagung der DaZ-Lehrer/innen, 21.05.2013, Klagenfurt Mag. Magdalena Knappik (i.v. von Prof. Dr. İnci Dirim), Universität Wien Gliederung Mehrsprachigkeit
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Von der Vorlage zum eigenen Text. Produktive Schreibformen am Sachthema "Beruf" einüben (Realschule) Das komplette Material finden
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Von der Vorlage zum eigenen Text. Produktive Schreibformen am Sachthema "Beruf" einüben (Realschule) Das komplette Material finden
DEUTSCH ALS ZIELSPRACHE
 LEHRPLANERGÄNZUNG FÜR ALLE SCHULFORMEN Die Lehrplan-Ergänzung Deutsch als Zielsprache Grit Brandt, Karina Land (LISA Halle) Halle, Januar 2017 ZIEL DES MODULS 1. Vorstellung der Lehrplanergänzung 1.1 Auftrag
LEHRPLANERGÄNZUNG FÜR ALLE SCHULFORMEN Die Lehrplan-Ergänzung Deutsch als Zielsprache Grit Brandt, Karina Land (LISA Halle) Halle, Januar 2017 ZIEL DES MODULS 1. Vorstellung der Lehrplanergänzung 1.1 Auftrag
Hausaufgabenkonzept Biologie MGB
 Entwurf: Mai 2011 Kapitel 1 BIOLOGIE Sek I - Grundsätze zur Leistungsbewertung und Hausaufgaben A: Biologie ist ein mündliches Fach in der Sekundarstufe I. B: Neben der mündlichen Beteiligung sind als
Entwurf: Mai 2011 Kapitel 1 BIOLOGIE Sek I - Grundsätze zur Leistungsbewertung und Hausaufgaben A: Biologie ist ein mündliches Fach in der Sekundarstufe I. B: Neben der mündlichen Beteiligung sind als
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Präsentieren in der Grundschule. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Präsentieren in der Grundschule Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Einführung... 5 Vom Erzählen zum Vortrag
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Präsentieren in der Grundschule Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Einführung... 5 Vom Erzählen zum Vortrag
Fach Deutsch BM Sem. 2. Sem. Total BM 2. Lerngebiete und fachliche Kompetenzen. Fachspezifischer Schullehrplan WSKV Chur
 Fachspezifischer Schullehrplan WSKV Chur Fach Deutsch BM 2 BM 2 1. Sem. 2. Sem. Total 80 80 160 Lehrmittel: Lerngebiete und fachliche Kompetenzen Lerngebiete und Teilgebiete Sem. Lek. Fachliche Kompetenzen
Fachspezifischer Schullehrplan WSKV Chur Fach Deutsch BM 2 BM 2 1. Sem. 2. Sem. Total 80 80 160 Lehrmittel: Lerngebiete und fachliche Kompetenzen Lerngebiete und Teilgebiete Sem. Lek. Fachliche Kompetenzen
Titel. Gegenstand. Schulstufe. Bezug zum Fachlehrplan. Bezug zu BiSt. Von der Praxis für die Praxis. Woher weißt du das? Sich und andere informieren
 Titel Gegenstand Schulstufe Bezug zum Fachlehrplan Bezug zu BiSt Woher weißt du das? Sich und andere informieren Deutsch 8. Schulstufe Sprache als Trägerin von Sachinformationen aus verschiedenen Bereichen
Titel Gegenstand Schulstufe Bezug zum Fachlehrplan Bezug zu BiSt Woher weißt du das? Sich und andere informieren Deutsch 8. Schulstufe Sprache als Trägerin von Sachinformationen aus verschiedenen Bereichen
ORS-Bereich V: Unterricht
 ORS-Bereich V: Unterricht Merkmale guten Unterrichts Der Unterricht ist klar und strukturiert. 3,28 3,28 3,28 3,28 Selbstständiges Lernen wird im Unterricht auf vielfache Weise gefordert und gefördert.
ORS-Bereich V: Unterricht Merkmale guten Unterrichts Der Unterricht ist klar und strukturiert. 3,28 3,28 3,28 3,28 Selbstständiges Lernen wird im Unterricht auf vielfache Weise gefordert und gefördert.
Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler
 Klasse 9 Unterrichtsvorhaben 9.1: Begegnungen in literarischen Texten 1. Leitsequenz: Kurze Erzähltexte (Deutschbuch, Kap.4, S. 77 ff.: Begegnungen - Kreatives Schreiben zu Bildern und Parabeln ; Deutschbuch,
Klasse 9 Unterrichtsvorhaben 9.1: Begegnungen in literarischen Texten 1. Leitsequenz: Kurze Erzähltexte (Deutschbuch, Kap.4, S. 77 ff.: Begegnungen - Kreatives Schreiben zu Bildern und Parabeln ; Deutschbuch,
Förderung der (Fach ) Sprache im Chemieunterricht
 Prof. Dr. B. Ralle Förderung der (Fach ) Sprache im Chemieunterricht Köln 15.10.2011 Hannah Busch Überblick Theoretische Einordnung Fachsprache im Unterricht und Sprache im Fachunterricht Besonderheiten
Prof. Dr. B. Ralle Förderung der (Fach ) Sprache im Chemieunterricht Köln 15.10.2011 Hannah Busch Überblick Theoretische Einordnung Fachsprache im Unterricht und Sprache im Fachunterricht Besonderheiten
Die Schülerinnen orientieren sich in Zeitungen.
 Schulinternes Curriculum der Ursulinenschule Hersel im Fach Deutsch Jahrgang 8 Übersicht über Unterrichtsvorhaben, Obligatorik und Klassenarbeiten Unterrichtsvorhaben Obligatorik Klassenarbeit Kurzreferate
Schulinternes Curriculum der Ursulinenschule Hersel im Fach Deutsch Jahrgang 8 Übersicht über Unterrichtsvorhaben, Obligatorik und Klassenarbeiten Unterrichtsvorhaben Obligatorik Klassenarbeit Kurzreferate
FORTGEFÜHRTE FREMDSPRACHE ALLGEMEINE HOCHSCHULREIFE
 BILDUNGSSTANDARDS FORTGEFÜHRTE FREMDSPRACHE ALLGEMEINE HOCHSCHULREIFE ÜBERSICHT 1. Konzept der Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife (BiStAHR) 2. Die Umsetzung der Bildungsstandards in RLP
BILDUNGSSTANDARDS FORTGEFÜHRTE FREMDSPRACHE ALLGEMEINE HOCHSCHULREIFE ÜBERSICHT 1. Konzept der Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife (BiStAHR) 2. Die Umsetzung der Bildungsstandards in RLP
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Grundkurs Rhetorik. Rhetorische Stilmittel kennenlernen und ihre Wirkung verstehen (Klasse 8) Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Grundkurs Rhetorik. Rhetorische Stilmittel kennenlernen und ihre Wirkung verstehen (Klasse 8) Das komplette Material finden Sie hier:
Leistungsbewertung Mathematik
 Leistungsbewertung Mathematik Sekundarstufe 1 Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Mathematik 1 von 5 Stand 05.01.2017 (gemäß Abschnitt 5 des Kernlehrplans Mathematik für SI-G8, verkürzt) Bei der
Leistungsbewertung Mathematik Sekundarstufe 1 Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Mathematik 1 von 5 Stand 05.01.2017 (gemäß Abschnitt 5 des Kernlehrplans Mathematik für SI-G8, verkürzt) Bei der
DaZ-Förderung im Deutschunterricht Sprachbewusstheit anregen, Fördersituationen schaffen. Beate Lütke. Blitzlicht
 DaZ-Förderung im Deutschunterricht Sprachbewusstheit anregen, Fördersituationen schaffen Fortbildung Sprache im Fachunterricht" 07./08.04.2011, Bozen Blitzlicht Geben Sie reihum einen kurzen Kommentar
DaZ-Förderung im Deutschunterricht Sprachbewusstheit anregen, Fördersituationen schaffen Fortbildung Sprache im Fachunterricht" 07./08.04.2011, Bozen Blitzlicht Geben Sie reihum einen kurzen Kommentar
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Bildungsstandards Deutsch / Mathematik - 7. - 10. Klasse - Jahrgangsstufentests Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Bildungsstandards Deutsch / Mathematik - 7. - 10. Klasse - Jahrgangsstufentests Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Methodenkonzept der Christian-Maar-Schule
 Methodenkonzept der Christian-Maar-Schule Inhalt 1. Vorbemerkungen... 3 2. Zielsetzung... 3 3. Methodenvermittlung im Unterricht... 4 3.1. Lern- und Arbeitstechniken... 4 3.1.1. Ausgestaltung des Arbeitsplatzes...
Methodenkonzept der Christian-Maar-Schule Inhalt 1. Vorbemerkungen... 3 2. Zielsetzung... 3 3. Methodenvermittlung im Unterricht... 4 3.1. Lern- und Arbeitstechniken... 4 3.1.1. Ausgestaltung des Arbeitsplatzes...
Englisch. Berufskolleg Gesundheit und Pflege I. Schuljahr 1. Landesinstitut für Erziehung und Unterricht Abteilung III
 Berufskolleg Gesundheit und Pflege I Schuljahr 1 2 Vorbemerkungen Die immer enger werdende Zusammenarbeit der Staaten innerhalb und außerhalb der Europäischen Union verlangt in Beruf und Alltag in zunehmendem
Berufskolleg Gesundheit und Pflege I Schuljahr 1 2 Vorbemerkungen Die immer enger werdende Zusammenarbeit der Staaten innerhalb und außerhalb der Europäischen Union verlangt in Beruf und Alltag in zunehmendem
Übersicht: schulinterner Lehrplan im Fach Deutsch (Februar 2013)
 Übersicht: schulinterner Lehrplan im Fach Deutsch (Februar 2013) Jahrgang Thema Kompetenzen 5 1 Ein neuer Start 2 Umgang mit dem Wörterbuch Nutzen von Informationsquellen das Erzählen von Erzähltem oder
Übersicht: schulinterner Lehrplan im Fach Deutsch (Februar 2013) Jahrgang Thema Kompetenzen 5 1 Ein neuer Start 2 Umgang mit dem Wörterbuch Nutzen von Informationsquellen das Erzählen von Erzähltem oder
Text- und Medienkompetenz in Klasse 5/6. Stefan Ferguson
 Text- und Medienkompetenz in Klasse 5/6 Stefan Ferguson 1. Bildungsplan bisher (BP 2004) 2. Was ist TMK? Definitionen / Übersicht 3. Erläuterung der Teilkompetenzen 4. Progression TMK 5. Aufbau von TMK
Text- und Medienkompetenz in Klasse 5/6 Stefan Ferguson 1. Bildungsplan bisher (BP 2004) 2. Was ist TMK? Definitionen / Übersicht 3. Erläuterung der Teilkompetenzen 4. Progression TMK 5. Aufbau von TMK
Gute Sprache? Schlechte Sprache? Alltagssprache? Fachsprache? Unterrichtssprache? Bildungssprache?
 Humboldt-Universität zu Berlin Warum Sprache für das fachliche Lernen wichtig ist: Methoden für einen sprachsensiblen Fachunterricht Bundesseminar, 6. Mai 2013, Retz Gute Sprache? Schlechte Sprache? Alltagssprache?
Humboldt-Universität zu Berlin Warum Sprache für das fachliche Lernen wichtig ist: Methoden für einen sprachsensiblen Fachunterricht Bundesseminar, 6. Mai 2013, Retz Gute Sprache? Schlechte Sprache? Alltagssprache?
Latein. W o r t s c h a t z. Inhalte Themenbereiche. Bereiche Fertigkeiten Kenntnisse Methodisch-didaktische Hinweise
 Latein Kompetenzen am Ende der 5. Klasse Die Schülerin, der Schüler kann den eigenen Basiswortschatz durch Sprachvergleich und Techniken der Wortableitung erweitern und Latein als Brückensprache nutzen
Latein Kompetenzen am Ende der 5. Klasse Die Schülerin, der Schüler kann den eigenen Basiswortschatz durch Sprachvergleich und Techniken der Wortableitung erweitern und Latein als Brückensprache nutzen
Kompetenzraster Deutsch 7/8
 Kompetenzraster Deutsch 7/8 Zuhören und Sprechen Schreiben Lesen Grammatik kann anderen zuhören, gezielt nachfragen und auf andere eingehen kann dem Schreibanlass angemessen schreiben, z.b. berichten,
Kompetenzraster Deutsch 7/8 Zuhören und Sprechen Schreiben Lesen Grammatik kann anderen zuhören, gezielt nachfragen und auf andere eingehen kann dem Schreibanlass angemessen schreiben, z.b. berichten,
Curriculum Deutsch Jahrgang 7 Stand November 2015
 strittige Themen diskutieren Kapitel 2 Fair sein -miteinan sprechen -Wortarten Aktiv / Passiv - ein Streitgespräch schriftlich vorbereiten - zu einem strittigen Thema recherchieren die Ergebnisse Sprechen
strittige Themen diskutieren Kapitel 2 Fair sein -miteinan sprechen -Wortarten Aktiv / Passiv - ein Streitgespräch schriftlich vorbereiten - zu einem strittigen Thema recherchieren die Ergebnisse Sprechen
Albert Einstein-Gymnasium Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch Stufe 8
 Albert Einstein-Gymnasium Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch Stufe 8 Thema des Unterrichtsvorhaben s Einführung in dramatische Texte (z.b. Friedrich Schiller: Wilhelm Tell; Molière: Der eingebildete
Albert Einstein-Gymnasium Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch Stufe 8 Thema des Unterrichtsvorhaben s Einführung in dramatische Texte (z.b. Friedrich Schiller: Wilhelm Tell; Molière: Der eingebildete
Zaubern im Mathematikunterricht
 Zaubern im Mathematikunterricht 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Die Mathematik als Fachgebiet ist so ernst, dass man keine Gelegenheit versäumen sollte, dieses Fachgebiet unterhaltsamer zu gestalten.
Zaubern im Mathematikunterricht 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Die Mathematik als Fachgebiet ist so ernst, dass man keine Gelegenheit versäumen sollte, dieses Fachgebiet unterhaltsamer zu gestalten.
Synopse für Let s go Band 3 und 4
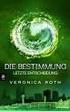 Synopse für Let s go Band 3 und 4 Umsetzung der Anforderungen des Kerncurriculums Englisch für die Sekundarstufe I an Hauptschulen Hessen 1 Kompetenzbereich Kommunikative Kompetenz am Ende der Jahrgangsstufe
Synopse für Let s go Band 3 und 4 Umsetzung der Anforderungen des Kerncurriculums Englisch für die Sekundarstufe I an Hauptschulen Hessen 1 Kompetenzbereich Kommunikative Kompetenz am Ende der Jahrgangsstufe
PLANUNGSBEISPIEL [Schuljahrgänge 7/8] Realschulabschlussbezogener Unterricht
![PLANUNGSBEISPIEL [Schuljahrgänge 7/8] Realschulabschlussbezogener Unterricht PLANUNGSBEISPIEL [Schuljahrgänge 7/8] Realschulabschlussbezogener Unterricht](/thumbs/80/82306534.jpg) PLANUNGSBEISPIEL [Schuljahrgänge 7/8] Realschulabschlussbezogener Unterricht KOMPETENZBEREICH 3: Kompetenzteilbereich: LESEN MIT TEXTEN UMGEHEN Sachtexte verstehen, reflektieren und Kompetenzen: Sachtexte
PLANUNGSBEISPIEL [Schuljahrgänge 7/8] Realschulabschlussbezogener Unterricht KOMPETENZBEREICH 3: Kompetenzteilbereich: LESEN MIT TEXTEN UMGEHEN Sachtexte verstehen, reflektieren und Kompetenzen: Sachtexte
Mathematik Anders Machen. Eine Initiative zur Lehrerfortbildung. Materialien zum Kurs. Knowledge Maps. Referenten
 Eine Initiative zur Lehrerfortbildung Materialien zum Kurs Knowledge Maps Referenten Dr. Astrid Brinkmann Dr. Ulrike Limke Projektleiter: Prof. Dr. Günter Törner Fachbereich Mathematik Universität Duisburg-Essen
Eine Initiative zur Lehrerfortbildung Materialien zum Kurs Knowledge Maps Referenten Dr. Astrid Brinkmann Dr. Ulrike Limke Projektleiter: Prof. Dr. Günter Törner Fachbereich Mathematik Universität Duisburg-Essen
Fach: Deutsch Klasse 7 Stand: Sj.09/10
 JG Inhalte Kompetenzerwartung Vorschlage zur Leistungsüberprüfung Verbindliche Inhalte: Balladen Merkmale von Balladen; zu Balladen schreiben. Diese sinngerecht und gestaltet vortragen. Untersuchen der
JG Inhalte Kompetenzerwartung Vorschlage zur Leistungsüberprüfung Verbindliche Inhalte: Balladen Merkmale von Balladen; zu Balladen schreiben. Diese sinngerecht und gestaltet vortragen. Untersuchen der
Deutsch 4. Klasse Grundschule
 Deutsch 4. Klasse Grundschule Die Schülerin, der Schüler kann 1. aktiv zuhören, Wortbedeutungen verstehen, wesentliche Aussagen erfassen, Schlussfolgerungen ziehen und das Gehörte wiedergeben 2. Meinungen,
Deutsch 4. Klasse Grundschule Die Schülerin, der Schüler kann 1. aktiv zuhören, Wortbedeutungen verstehen, wesentliche Aussagen erfassen, Schlussfolgerungen ziehen und das Gehörte wiedergeben 2. Meinungen,
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Schreiben, wie man spricht und sprechen, wie man schreibt?
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Schreiben, wie man spricht und sprechen, wie man schreibt? Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 1 Schreiben,
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Schreiben, wie man spricht und sprechen, wie man schreibt? Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 1 Schreiben,
Lernbiologische Axiome kooperativen Lernens: Lerninhalte werden behalten, wenn sie persönlich bedeutsam werden, wenn aktive Auseinandersetzung
 Lernbiologische Axiome kooperativen Lernens: Lerninhalte werden behalten, wenn sie persönlich bedeutsam werden, wenn aktive Auseinandersetzung erfolgt Auswirkungen kooperativen Lernens: zunehmende Leistungen
Lernbiologische Axiome kooperativen Lernens: Lerninhalte werden behalten, wenn sie persönlich bedeutsam werden, wenn aktive Auseinandersetzung erfolgt Auswirkungen kooperativen Lernens: zunehmende Leistungen
Studientage zur sprachlichen Bildung in allen Fächern Angebote der AG Durchgängige Sprachbildung für Sekundarschulen und Gymnasien
 Studientage zur sprachlichen Bildung in allen Fächern Angebote der AG Durchgängige Sprachbildung für Sekundarschulen und Gymnasien Sprachliche Bildung in allen Fächern ist notwendig, damit Schülerinnen
Studientage zur sprachlichen Bildung in allen Fächern Angebote der AG Durchgängige Sprachbildung für Sekundarschulen und Gymnasien Sprachliche Bildung in allen Fächern ist notwendig, damit Schülerinnen
Thesen zum Lesen und Einführung des LeseNavigators. Initiative zur Lesekompetenzförderung in der Sekundarstufe I
 Thesen zum Lesen und Einführung des LeseNavigators Initiative zur Lesekompetenzförderung in der Sekundarstufe I Werkstatt-Tage am 5.1. und 11.1.2010 Lesen bedeutet Verstehen Lesekompetenz heißt mehr als
Thesen zum Lesen und Einführung des LeseNavigators Initiative zur Lesekompetenzförderung in der Sekundarstufe I Werkstatt-Tage am 5.1. und 11.1.2010 Lesen bedeutet Verstehen Lesekompetenz heißt mehr als
Deutsch, Jahrgang 5, Realschule Friesoythe (1)
 Deutsch, Jahrgang 5, Realschule Friesoythe (1) Jahresübersicht der Themen und Unterrichtsinhalte (Die Reihenfolge der Inhalte und die vorgesehene Dauer können u.u. variieren) 1. Das gute Klassengespräch
Deutsch, Jahrgang 5, Realschule Friesoythe (1) Jahresübersicht der Themen und Unterrichtsinhalte (Die Reihenfolge der Inhalte und die vorgesehene Dauer können u.u. variieren) 1. Das gute Klassengespräch
Rahmenlehrplan Naturwissenschaft 5/6. Einführung in die Konzeption des Rahmenlehrplans Naturwissenschaften
 Rahmenlehrplan Naturwissenschaft 5/6 Einführung in die Konzeption des Rahmenlehrplans Naturwissenschaften Trends Trend 1: Angebot im Überfluss aber keine Entdeckungen! Trends Trend 2: Einfache Technik
Rahmenlehrplan Naturwissenschaft 5/6 Einführung in die Konzeption des Rahmenlehrplans Naturwissenschaften Trends Trend 1: Angebot im Überfluss aber keine Entdeckungen! Trends Trend 2: Einfache Technik
L L. Titel. Gegenstand/ Schulstufe. Bezug zum Fachlehrplan. Bezug zu BiSt. Von der Praxis für die Praxis
 Titel Gegenstand/ Schulstufe Nachts schlafen die SchülerInnen doch Meine eigene Kurzgeschichte Deutsch 8.Schulstufe Sprache als Gestaltungsmittel Bezug zum Fachlehrplan Literarische Textformen und Ausdrucksmittel
Titel Gegenstand/ Schulstufe Nachts schlafen die SchülerInnen doch Meine eigene Kurzgeschichte Deutsch 8.Schulstufe Sprache als Gestaltungsmittel Bezug zum Fachlehrplan Literarische Textformen und Ausdrucksmittel
Information zum Leistungskonzept der Nikolaus-Schule
 Information zum Leistungskonzept der Nikolaus-Schule Das Leistungskonzept der Nikolaus-Schule wurde in der vorliegenden Fassung der Schulkonferenz am 3. März 2013 vorgelegt. Es beinhaltet eine Einführung,
Information zum Leistungskonzept der Nikolaus-Schule Das Leistungskonzept der Nikolaus-Schule wurde in der vorliegenden Fassung der Schulkonferenz am 3. März 2013 vorgelegt. Es beinhaltet eine Einführung,
KRITERIEN FÜR DIE ERSTELLUNG EINER FACHARBEIT HERDER-GYMNASIUM MINDEN V151103
 KRITERIEN FÜR DIE ERSTELLUNG EINER FACHARBEIT HERDER-GYMNASIUM MINDEN V151103 Inhaltsverzeichnis: 1. Kriterien zum saspekt formale Gestaltung 2 2. Kriterien zum saspekt Inhalt und Wissenschaftlichkeit
KRITERIEN FÜR DIE ERSTELLUNG EINER FACHARBEIT HERDER-GYMNASIUM MINDEN V151103 Inhaltsverzeichnis: 1. Kriterien zum saspekt formale Gestaltung 2 2. Kriterien zum saspekt Inhalt und Wissenschaftlichkeit
Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife. Einführung, Überblick und Ausblick
 Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife Einführung, Überblick und Ausblick 1 Gliederung Verwandtschaft! Standortbestimmung: Diskursfähigkeit!
Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife Einführung, Überblick und Ausblick 1 Gliederung Verwandtschaft! Standortbestimmung: Diskursfähigkeit!
Stundenentwurf. Personenbeschreibung zum Thema Indien für eine 7. Klasse
 Germanistik I. Meyer Stundenentwurf. Personenbeschreibung zum Thema Indien für eine 7. Klasse Kriteriengeleitetes Feedback durch Erstellen einer Textlupe Unterrichtsentwurf Thema der Reihe Indien Beschreiben
Germanistik I. Meyer Stundenentwurf. Personenbeschreibung zum Thema Indien für eine 7. Klasse Kriteriengeleitetes Feedback durch Erstellen einer Textlupe Unterrichtsentwurf Thema der Reihe Indien Beschreiben
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 13. Descripción
 Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 13 Descripción ŀ Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, Szenen und Gemälde zu beschreiben und seine/ihre eigenen Eindrücke über das Gesehene wiederzugeben.
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 13 Descripción ŀ Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, Szenen und Gemälde zu beschreiben und seine/ihre eigenen Eindrücke über das Gesehene wiederzugeben.
SPRACHSENSIBLER UNTERRICHT -
 SPRACHSENSIBLER UNTERRICHT - DIFFERENZIERTES LERNEN IM CHEMIE- UND NATURWISSENSCHAFTLICHEN UNTERRICHT Kurs-Nr.: 2940 (Goethe Universität, Frankfurt a.m.) Montag, den 20.05.2019, 14.00 17.00 Uhr Veranstaltungsort:
SPRACHSENSIBLER UNTERRICHT - DIFFERENZIERTES LERNEN IM CHEMIE- UND NATURWISSENSCHAFTLICHEN UNTERRICHT Kurs-Nr.: 2940 (Goethe Universität, Frankfurt a.m.) Montag, den 20.05.2019, 14.00 17.00 Uhr Veranstaltungsort:
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Mathematik. Mathematisch argumentieren (K1)
 Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Mathematik Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, Bildungsstandards und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der Themenfelder
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Mathematik Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, Bildungsstandards und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der Themenfelder
Schulinternes Curriculum Deutsch Klasse 5 Hauptschulzweig KGS-Schneverdingen 2016
 Zu Beachten: Anzahl der en: 6 en (5-7) Dauer der en: nicht länger als 2x45 min Die Liste der Themen stellt keine verbindliche Reihenfolge dar. Im Schuljahr 5 oder 6 sollten die Schüler einen Vortrag /
Zu Beachten: Anzahl der en: 6 en (5-7) Dauer der en: nicht länger als 2x45 min Die Liste der Themen stellt keine verbindliche Reihenfolge dar. Im Schuljahr 5 oder 6 sollten die Schüler einen Vortrag /
Schulcurriculum Gymnasium Korntal-Münchingen
 Klasse: 5 Seite 1 Minimalanforderungskatalog; Themen des Schuljahres gegliedert nach Arbeitsbereichen Themen, die dem Motto der jeweiligen Klassenstufe entsprechen und den Stoff des s vertiefen, üben,
Klasse: 5 Seite 1 Minimalanforderungskatalog; Themen des Schuljahres gegliedert nach Arbeitsbereichen Themen, die dem Motto der jeweiligen Klassenstufe entsprechen und den Stoff des s vertiefen, üben,
Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS
 Ich im Umgang mit anderen (für Lerner mit Grundkenntnissen) Wir gehen aufeinander zu Was ich mir von dir wünsche Ich im Umgang mit anderen Ich und meine Freunde Mein Schultag in der Klasse Stand der Sprachkenntnisse
Ich im Umgang mit anderen (für Lerner mit Grundkenntnissen) Wir gehen aufeinander zu Was ich mir von dir wünsche Ich im Umgang mit anderen Ich und meine Freunde Mein Schultag in der Klasse Stand der Sprachkenntnisse
Modulhandbuch. für das Studium der Didaktik des Deutschen als Zweitsprache. als Didaktikfach (LA Grundschule)
 Modulhandbuch für das Studium der Didaktik des Deutschen als Zweitsprache als Didaktikfach (LA Grundschule) Stand: März 06 Einführung Seit dem Wintersemester 00/0 kann das Fach Didaktik des Deutschen als
Modulhandbuch für das Studium der Didaktik des Deutschen als Zweitsprache als Didaktikfach (LA Grundschule) Stand: März 06 Einführung Seit dem Wintersemester 00/0 kann das Fach Didaktik des Deutschen als
