Schwerhörigkeit stellt eine weit verbreitete Störung des Hörsystems dar. Schätzungen
|
|
|
- Josef Busch
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 5 1. Einleitung 1.1. Hörstörungen Schwerhörigkeit stellt eine weit verbreitete Störung des Hörsystems dar. Schätzungen gehen weltweit von rund 70 Millionen Menschen mit Schwerhörigkeit aus (Tekin et al., 2001). In Deutschland gehören Hörstörungen zu den 10 häufigsten Erkrankungen im Alter (Rieder, 2003). Eine Studie aus Großbritannien zeigt, dass ca. 10 % der über 65-jährigen und ca. 50 % der über 80-jährigen Menschen so stark von Hörstörungen betroffen sind, dass die lautsprachliche Kommunikation beeinträchtigt ist (Davies, 1995). Angesichts der steigenden Lebenserwartung ist zu erwarten, dass die Prävalenz von Hörstörungen allein aufgrund einer Zunahme der Altersschwerhörigkeit in den nächsten Jahren ansteigt. Aber auch bei Jugendlichen ist aufgrund von Freizeitlärm eine zunehmende Hörminderung festzustellen (Zenner et al., 1999). Im Kindesalter sind bleibende Hörstörungen eher selten. Nach gegenwärtigen Schätzungen liegt ihre Prävalenz in Deutschland mit 1,2 von 1000 Neugeborenen im Vergleich der entwickelten Länder (Gross et al., 2000). In Deutschland werden bei den permanenten kindlichen Hörstörungen 35 % auf eine genetische Ursache und 20 % auf eine erworbene Ursache zurückgeführt. Für 45 % der Betroffenen ist die Ätiologie unklar (nach den Datensätzen des Deutschen Zentralregisters für kindliche Hörstörungen 2001) (Gross et al., 2001). Tinnitus stellt ebenfalls eine häufige Störung des Hörsystems dar. Personen mit einem Hörverlust weisen signifikant häufiger Tinnitus auf als Personen ohne Hörverlust (Lenarz, 1992). Hesse (2000) gibt in seinen Untersuchungen an, dass 95 % der Tinnituspatienten einen messbaren Hörverlust aufweisen. In Deutschland geht man davon aus, dass 18,7 Millionen Menschen einen Tinnitus erlebt haben und 9,8 Millionen Menschen von Tinnitus betroffen sind. Nach einer epidemiologischen Studie der Deutschen Tinnitusliga werden
2 6 aber weniger als 15 % der von einem Tinnitus betroffenen Menschen letztendlich behandlungsbedürftig (Pilgramm et al., 1999). Zahlreiche Beobachtungen weisen darauf hin, dass Hypoxie (Sauerstoffmangel) und Ischämie (Sauerstoff- und Substratmangel) wesentliche pathogenetische Faktoren für die Entstehung von Hörstörungen sind. Die Mehrzahl der erworbenen Hörstörungen im Säuglingsalter wird mit Infektionen sowie prä-, peri- und postnatalen hypoxischischämischen Episoden in Verbindung gebracht (Gross et al., 2000). Infektionen stehen über die Bildung von Ödemen und Vaskulitiden ebenfalls mit Hypoxie und Ischämie in Verbindung. Durchblutungsstörungen im Innenohr sind sowohl mit Sauerstoff- als auch Substratmangel verbunden. Auch bei intensiver Lärmbelastung kommt es zu einem Sauerstoffmangel (Abfall des Sauerstoffpartialdruckes, po 2 ) in der Innenohrflüssigkeit Perilymphe (Scheibe et al., 1992). Wesentliche Mechanismen, die zu Hörstörungen führen können, sind: Haarzellverluste, Störung der Signaltransduktion im Bereich der äußeren und inneren Haarzellen sowie der Spiralganglien. Auslösende Faktoren können mechanische und toxische Störungen sowie auch Hypoxie und Ischämie sein Rolle der Haarzelle bei der Entstehung von Hörstörungen Die häufigste Ursache der sensorineuralen Schwerhörigkeit ist ein direkter Haarzellschaden (Naumann et al., 1994). An der Haarzelle findet die Signaltransduktion von der mechanischen Schallwelle auf ein elektrisches Signal statt. Sie wird durch eine Auslenkung von Stereozilien nach einem Schallsignal eingeleitet. Dies führt zum Kalium (K + )-Einstrom in die Zelle und zur Depolarisation. In deren Folge strömen Kalzium (Ca 2+ )- Ionen in die Haarzelle, und Transmitter werden am unteren Pol der Zelle freigesetzt. Die erhöhte Ca 2+ -Konzentration führt zu einer erhöhten Aktivierung von Ca 2+ -abhängigen K + -
3 7 Kanälen, und eine Repolarisation beginnt (Geisler, 2006). Ausgehend von dieser Kaskade sind für die Entstehung von Hörstörungen von besonderer Bedeutung: a) Störungen der Stereozilien und ihrer Verbindungen (Tip-Links), b) Störung der K + -Kanäle, c) Veränderung der Glutamat-Ausschüttung Störungen der Stereozilien und Tip-Links Tip-Links sind feine, extrazelluläre Filamente, die benachbarte Stereozilien miteinander verbinden und auf direktem Weg Transduktionskanäle an der Spitze der Stereozilien öffnen oder schließen. Eine Bewegung in Richtung der längsten Reihe der Stereozilien führt zu einer Dehnung der Tip-Links und Erhöhung der Öffnungswahrscheinlichkeit der Transduktionskanäle auf 100 %. Eine Bewegung in Richtung der kürzesten Reihe der Stereozilien führt zur Entlastung der Tip-Links und zum vollständigen Schließen der Transduktionskanäle. In Ruhelage besteht durch die Restspannung der Tip-Links immerhin noch eine Öffnungswahrscheinlichkeit der Transduktionskanäle von 10 % (Meyer und Gummer, 2000). Dies kann auch als Korrelat für das so genannte Grundrauschen interpretiert werden. Die Restspannung der Tip-Links wird über das Protein Myosin-VIIa gewährleistet (Kros et al., 2002). Bei Mutationen von Myosin-VIIa werden durch den Verlust der Restspannung die Transduktionskanäle erst bei Auslenkungen von 150 nm langsam eröffnet (Kachar et al., 2000), wodurch Hörstörungen bis hin zum Usher-Syndrom Typ Ib (hochgradige Innenohrschwerhörigkeit, Retinopathia pigmentosa, Störung des Vestibularorgans) hervorgerufen werden können (Resendes et al., 2001). Bei längerfristiger Abbiegung der Stereozilien setzt ein Adaptationsmechanismus ein. Dann gleitet die Insertionsstelle zur Basis des Tip-Links, wodurch dieser entspannt wird, und die Transduktionskanäle schließen sich. Damit nimmt die Steifigkeit des Haarbündels ab. Ein gegenteiliger Effekt tritt auf, wenn die intrazelluläre Ca 2+ -Konzentration absinkt.
4 8 Dann wird die Insertionsstelle des Tip-Links aktiv zurück zur Spitze des Tip-Links geschoben (Holt und Corey, 2000). Der Verlust der Tip-Links, z.b. durch Lärmeinwirkung, führt bei den äußeren Haarzellen (ÄHZ) zu permanent geöffneten Transduktionskanälen (Meyer et al., 1998). Es kommt zur Dauerdepolarisation, und die intrazelluläre Ca 2+ -Konzentration steigt an. Die Folgen sind eine Dauerkontraktion mit Verringerung der cochleären Verstärkerfunktion und eine Verformung des Cortischen Organs, was für die Entstehung von Hörstörungen eine Rolle spielen kann. Der Verlust der Tip-Links führt bei den inneren Haarzellen (IHZ) ebenfalls zur Dauerdepolarisation und zum Anstieg der intrazellulären Ca 2+ -Konzentration. Dies bewirkt bei den IHZ eine vermehrte Transmitterfreisetzung und Bildung von Aktionspotentialen, die im Gehirn als Tinnitus wahrgenommen werden können (Meyer und Gummer, 2000). Gleichzeitig kann der Neurotransmitter Glutamat auch exzitotoxisch auf die afferenten Fasern wirken, d. h., es kommt zur Degeneration der Neuronen Störung der Kalium-Kanäle Eine Störung der Transduktion kann neben Stereozilien- und Tip-Link-Schäden auch durch Veränderungen der Ionenkanäle an den Haarzellen hervorgerufen werden. Die IHZ besitzen mindestens zwei, die ÄHZ mindestens drei Arten von K + -Kanälen (Housley und Ashmore, 1992; Kros und Crawford, 1990). Unter den K + -Kanälen kommt dem KCNQ4-Kanal eine besondere Bedeutung zu. Beisel et al. (2000) konnten zeigen, dass dieser K + -Kanal in IHZ und ÄHZ exprimiert wird. Mutationen des KCNQ4-Kanals führen zu Taubheit und Epilepsie. Bei einigen Mutationen dieses Kanals ist auch Tinnitus beschrieben worden (Coucke et al., 1999; Kubisch et al., 1999). Der KCNQ4-Kanal wird diskutiert als der Kanal, der zur Prävention von progressivem Hörverlust und möglicherweise zur Tinnitusbehandlung beeinflusst werden könnte (Kubisch et al., 1999).
5 Veränderung der Glutamat-Ausschüttung Weitere Möglichkeiten zur Entstehung von Hörstörungen bei der Signaltransduktion sind Störungen im synaptischen Komplex. Die IHZ ist zu 90 % mit myelinisierten Typ I- Neuronen afferent versorgt. Die Efferenzen bilden synaptische Dendriten zu den Afferenzen. Die ÄHZ ist nur zu 5 % afferent versorgt mit unmyelisierten Typ II-Neuronen. Sowohl die Afferenzen als auch die Efferenzen ziehen bei der ÄHZ zum Zellkörper. Transmitter von Afferenzen ist das Glutamat, von Efferenzen sind es Acetylcholin (ACH), Gammaaminobuttersäure (GABA), Dopamin und noch weitere (Raphael und Altschuler, 2003). Es wird diskutiert, dass Glutamat nicht der einzige afferente Transmitter sein kann (Housley et al., 1999). In diesem Zusammenhang werden Adenosintriphosphat (ATP) Modulierungsfunktionen als Transmitter zugedacht. Kürzlich sind in der IHZ ellipsenartige Körper, die mit ca. 100 synaptischen Bläschen in enger Verbindung stehen, entdeckt worden. Diese so genannten Ribbons sollen eine kontinuierliche langsame Transmitter- Ausschüttung gewährleisten und besonders effizient bei langen Stimuli arbeiten (Fuchs et al., 2003). Während an den ÄHZ der direkte Glutamat-Rezeptor-Nachweis noch fehlt, sind die Glutamat-Rezeptoren der IHZ gut erforscht (Puel et al., 2002a). Es werden zwei Arten von Glutamat-Rezeptoren unterschieden: die ionotropen und die metabotropen. Die ionotropen Rezeptoren sind mit dem Einstrom von 1- oder 2-wertigen Kationen verbunden und werden in [alpha]-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionsäure (AMPA)-, N- Methyl-D-Aspartat (NMDA)- und Kainat-Rezeptoren unterteilt. Unter normalen Bedingungen besitzt der AMPA-Rezeptor die größte Aktivität (Puel et al., 2002a). Die metabotropen Rezeptoren entfalten ihre Wirkung über G-Proteine. An den IHZ wurden auch präsynaptische Glutamat-Rezeptoren nachgewiesen, deren Funktion aber noch unklar ist (Matsubara et al., 1996). Pujol et al. (1990) berichteten darüber, dass nach einem Schalltrauma vermehrte Glutamat-Ausschüttung nachweisbar ist, die mit einer
6 10 Dendritenschwellung einhergeht. Dieselben Effekte wurden mit Glutamat-Analoga erzeugt, sie konnten mit Glutamat-Antagonisten wie z. B. MK 801 gehemmt werden. Es wird angenommen, dass es über die NMDA-Rezeptoren zu einem exzessiven Ca 2+ - Einstrom und zur Freisetzung von Stickstoffmonoxid (NO) kommen kann (Ehrenberger und Felix, 1995). AMPA- und Kainat-Rezeptoren bewirken über den Natrium (Na + )- und Wassereinstrom eine Zellschwellung. Zusätzlich kann die Zelle über die Entleerung der Ca 2+ -Speicher des endoplasmatischen Retikulums geschädigt werden Tinnitus Tinnitus ist definiert als subjektive Wahrnehmung eines Geräusches bei Fehlen einer äußeren Geräuschquelle. In der Regel geht Tinnitus mit einer Hörstörung einher, kann aber auch als unabhängiges Symptom auftreten. Prinzipiell können ein objektiver und ein subjektiver Tinnitus unterschieden werden (Zenner, 1998). Der objektive Tinnitus, der sowohl vom Patienten als auch vom Untersucher wahrgenommen wird, ist in der Regel einer eindeutigen Diagnostik und Therapie zugänglich. Der viel häufigere subjektive Tinnitus wird nur vom Patienten wahrgenommen und wird in eine periphere Form (Schallleitungstinnitus und sensorineuraler Tinnitus) sowie in eine zentrale Form eingeteilt. Um mögliche Mechanismen der Entstehung des peripheren sensorineuralen Tinnitus zu betonen, hat Zenner diese eingeteilt in den Motor-Tinnitus (Typ I), Transduktions-Tinnitus (Typ II), Transformations-Tinnitus (Typ III) und den extrasensorischen Tinnitus (Typ IV) unterteilt (Zenner, 1998). Während beim Motor- Tinnitus Störungen im Bereich der ÄHZ angenommen werden, ordnet man dem Transduktions-Tinnitus Störungen der IHZ zu. Beim Transformations-Tinnitus werden Störungen im Bereich der Transmitterausschüttung angenommen. Störungen im Bereich Stria vascularis oder der Gefäße der Cochlea werden als Ursache für den extrasensorischen
7 11 Tinnitus vermutet (Schema 1). Der experimentelle Nachweis dieser verschiedenen Formen steht noch aus. Tinnitus Objektiver Tinnitus Subjektiver Tinnitus Peripherer Tinnitus Zentraler Tinnitus Schallleitungs Tinnitus Sensorineuraler Tinnitus Motor-Tinnitus (ÄHZ) Transduktions- Tinnitus (IHZ) Transformations- Tinnitus (Transmitter) Extrasensorischer Tinnitus (Stria Vascularis) Schema 1 Tinnitusklassifizierung Wie könnte Tinnitus im synaptischen Komplex entstehen? Puel et al. (2002b) beschrieben nach einem akustischen Schaden eine Zunahme von mrna ( messenger ribonucleic acid ) für NMDA-Rezeptoren und metabotrope Rezeptoren. Die vermehrte Ausschüttung von ACH, GABA und Dopamin über die Efferenzen soll über einen m3- cholinergen Rezeptor zur Überexpression von Glutamat-Rezeptoren und zu massiver Glutamat-Ausschüttung führen, die z.b. über vermehrte Aktionspotenziale Tinnitus
8 12 bewirken kann. Gleichzeitig wirkt die Glutamat-Ausschüttung anfänglich als trophischer Faktor und führt zum Heranwachsen der Efferenzen an den Zellkörper der IHZ Hypoxie und Ischämie Hypoxie bedeutet Sauerstoffmangel im Gewebe. Sie wird hervorgerufen durch eine Störung im Verhältnis von Sauerstoff-Angebot und Sauerstoff-Verbrauch. Hierbei kommt es zu einem Abfall des po 2 im Gewebe. Ischämie hingegen beinhaltet eine verminderte Durchblutung im Gewebe. Insgesamt ist Ischämie ein viel komplexerer Vorgang als Hypoxie, da unterschiedliche Substrate vermindert bereitgestellt und Stoffwechselprodukte nicht ausreichend eliminiert werden. Ischämie führt in der Regel auch zu schwereren Schäden als Hypoxie, da durch den Substrat- bzw. Glukosemangel die anaerobe Glykolyse beeinträchtigt ist (Gross, 2005). Die akute Reaktion auf Hypoxie ist besonders an po 2 -sensitiven Zellen ausgeprägt (Gross, 2005). In diesen Zellen befinden sich in den Membranen sauerstoffsensitive K + - Kanäle, die bei Hypoxie gehemmt werden und zur Membrandepolarisation führen. Die Folgen sind Ca 2+ -Einstrom, Neurotransmitterfreisetzung und Aktivierung afferenter Fasern, Mitochondrien-Dysfunktionen und Umschaltung auf anaerobe Glykolyse. Anders hingegen bei der chronischen Hypoxie; diese ist mit einer Veränderung der Genexpression verbunden (Gross, 2005). Im Innenohr ist sowohl mit dem Auftreten von akuter als auch chronischer Hypoxie zu rechnen Die Rolle von HIF-1 Der wichtigste Regulator der Genexpression bei Anpassung an eine Hypoxie/Ischämie ist der Transkriptionsfaktor HIF-1, dessen Aktivität über molekularen Sauerstoff und spezifische Prolinhydroxylasen reguliert wird (Semenza, 1999; Wenger und Gassmann,
9 ; Wiesener und Maxwell, 2003). HIF-1 gehört zur Familie der bhlh-pas-proteine (Basische Helix-Loop-Helix- und PER-ARNT-SIM-Homologie-Domäne). Prinzipiell sind Transkriptionsfaktoren Proteine, welche die Anbindung der RNA-Polymerasen an den Promotor eines Gens und damit die RNA-Synthese regulieren. HIF-1 ist ein Heterodimer, das aus HIF-1 alpha und HIF-1 beta besteht. HIF-1 beta ist identisch mit ARNT ( aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator ), einem Protein, das als Dimerisierungspartner für verschiedenste Proteine auftritt (Semenza, 1999). HIF-1 alpha ist beim Menschen auf dem Chromosomen 14q21-q24 lokalisiert. Es besteht aus 15 Exons, die von 14 Introns unterbrochen werden (Iyer et al., 1998). In den letzten Jahren sind weitere HIF-Transkriptionsfaktoren gefunden worden, HIF- 2 alpha und HIF-3 alpha (Gu et al., 1998; Tian et al., 1998). Beide dimerisieren ebenfalls mit ARNT. Es wird vermutet, dass HIF-1 alpha eher eine allgemeine Rolle in der Hypoxiesignalkette und Transkription spielt, während HIF-2 alpha und HIF-3 alpha mehr spezialisierte Funktionen übernehmen. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass HIF- 1 alpha und HIF-1 beta in den meisten Geweben exprimiert werden, während HIF-2 alpha und HIF-3 alpha ein eher begrenztes, organspezifisches Expressionsmuster zeigen (Eckardt et al., 2003; Kietzmann et al., 2001). Die Transkription von HIF-1 alpha erfolgt in der Regel unabhängig von Hypoxie. Bei chronischen hypoxischen Zuständen wurde aber eine erhöhte Transkription beschrieben (Semenza, 2000). Die Transkription von HIF-1 alpha lässt sich über Kinasen, Insulin, Wachstumsfaktoren ( Insulin-like growth factor, IGF-1) und Nervenwachstumsfaktoren (NGF) modulieren (Gross, 2005). Hervorzuheben ist, dass die HIF-1 alpha-mrna- Expression und Proteinexpression nicht parallel verlaufen. Die generelle Aussage, dass die Proteinsynthese unter hypoxischen Bedingungen vermindert ist, trifft für die Synthese von HIF-1 alpha und ARNT nicht zu (Gorlach et al., 2000).
10 14 Die Regulation des HIF-1 alpha-proteingehaltes erfolgt über das Ubiquitin-Proteasom- System. Die Aktivität von HIF-1 alpha ist unter normoxischen Bedingungen aufgrund des ständigen Abbaus im Proteosom extrem niedrig. Unter hypoxischen Bedingungen werden der Abbau gehemmt und HIF-1 alpha stabilisiert (Ivan et al., 2001). HIF-1 alpha gelangt dann in den Zellkern und bildet dort nach Bindung mit HIF-1 beta den HIF-1-Komplex. Nach Bindung an den Promotor wird die Zielgenexpression eingeleitet. Der begrenzende Faktor für die HIF-1-Aktivität ist der zelluläre Gehalt von HIF-1 alpha. Bei einer Hypoxieexposition mit weniger als 6 % Sauerstoff-Gehalt steigt die HIF-1-alpha- Expression exponentiell an (Jiang et al., 1996). Der Vorteil der Regulation von HIF- 1 alpha über den Abbau ist, dass der für die Hypoxie notwendige Adaptationsfaktor sofort zur Verfügung steht und nicht erst unter Energieverbrauch synthetisiert werden muss. Zu den HIF-1-Zielgenen gehören Gene, deren Produkte an der Regulation des Energiestoffwechsels, des Zelltodes, der Angiogenese, der Erythropoese, der Zellproliferation und des Katecholaminstoffwechsels beteiligt sind (Gross, 2005). Um die Transkription von Zielgenen zu aktivieren, bindet HIF-1 an hypoxia response element (HRE) Sequenzen des Promotors. Darüber hinaus ist ein Multiprotein-Komplex nötig, der neben HIF-1 mindestens aus einem benachbarten Transkriptionsfaktor und P300/CREB besteht. In der carboxy-terminalen Hälfte des HIF-1 alpha befinden sich zwei Transaktivierungsdomänen (TAD-N und TAD-C), über die unter Hypoxie die Co- Aktivatoren wie p300, CBP, SRC-1 und TIF 2 wirken. Dabei ist der Redoxzustand von TAD-C für die Interaktion von HIF-1 alpha und CBP/p300 zuständig (Jiang et al., 1997). Auch unter normoxischen Bedingungen können divalente Ionen wie Cobaltchlorid und Eisenchelatoren wie Desferrioxamin über eine Interaktion mit TAD-C eine HIF- Aktivierung bewirken (Wang und Semenza, 1993).
11 Die Wirkung von Hypoxie und Ischämie in der Cochlea Der cochleäre Hauptenergielieferant ist Glukose, die im Citratzyklus und in der Atmungskette vollständig zu ATP, Wasser und Kohlendioxid umgesetzt wird (Puschner und Schacht, 1997b; Tian et al., 1998). Der größte Teil der für die Zellfunktion der Cochlea benötigten Energie wird aus der aeroben Glykolyse und der anschließenden oxidativen Phosphorylierung in der Atmungskette gewonnen. Die Bereitstellung der Glukose erfolgt über das vaskuläre System der Cochlea und die Glukosetransporter (GLUT) (Ferrary et al., 1987; Ito et al., 1993). GLUT 1 spielt bei der Überwindung der Blut-Perilymph-Schranke eine bedeutende Rolle (Ito et al., 1993). So ist GLUT 1 vorwiegend in den Marginalzellen der Stria vascularis nachgewiesen, wo er den Glukosetransport in das intrastriale Kompartiment und damit an die Haarzellen vermittelt. Ein weiterer insulinunabhängiger Carrier, GLUT 5, ließ sich an den ÄHZ nachweisen (Geleoc et al., 1999; Nakazawa et al., 1995). Da Glykolyse und oxidative Phosphorylierung die Hauptwege der ATP-Bildung in der Cochlea sind, haben Hypoxie und Ischämie einen starken Einfluss auf den cochleären Energiemetabolismus. In Anoxie kommt es innerhalb von Sekunden zum Absinken des endocochleären Potenzials (Konishi et al., 1961). Eine Ursache dafür könnte der hohe Sauerstoffbedarf der Stria vascularis sein. Während der ATP Spiegel in der Endolymphe während Hypoxie konstant bleibt und infolge Lärmbelastung sogar ansteigt (Munoz et al., 2001), führt Ischämie zum Absinken des ATP-Spiegels im Organ Corti bis auf 10 % des Normalwertes und die endocochleären Prozesse kommen zum Erliegen (Thalmann et al., 1972). Da ATP intrazellulär überwiegend als Energielieferant von Ionenpumpen wirkt, beeinflusst ein ATP-Abfall vor allem die Aufrechterhaltung der funktionsbestimmenden Ionengradienten. ATP scheint aktiv in die Endolymphe sezerniert zu werden, wahrscheinlich ist es an der Regulation des endocochleären Potentials beteiligt (Munoz et al., 2001).
12 16 An isolierten ÄHZ konnte gezeigt werden, dass der ATP-Gehalt der Zellen bei reinem Glukoseentzug um 25 % sinkt, bei Hemmung der Glykolyse, Glykogenolyse und Glukoneogenese mittels der 2-Deoxy-Glukose-Methode sogar um 65 % (Puschner und Schacht, 1997b). Diese Ergebnisse können so interpretiert werden, dass freie oder als Glykogen gespeicherte Glukose der Hauptlieferant für die Energie der ÄHZ ist. Da kein 100 %iger ATP-Abfall zu verzeichnen war, ist anzunehmen, dass auch andere Energie liefernde Substrate wie Kreatinphosphat, Aminosäuren und Ketonkörper existieren. Die Besonderheit der Gefäßversorgung der Cochlea scheint von großer Wichtigkeit für hypoxische und ischämische Schädigungen der Cochlea zu sein. Die Regulation der Durchblutung in der Cochlea ist sehr fein abgestimmt und funktionelle Störungen haben eine große Auswirkung. Die arterielle Versorgung erfolgt über die Arteria cerebelli inferior anterior aus der Arteria basilaris weiter über die Arteria labyrinthi (Lyon und Payman, 2000). Von besonderer Bedeutung ist, dass die weitere periphere Versorgung der Cochlea in Form von verschiedenen funktionellen Endarterien erfolgt. Die Hauptversorgung (bis auf den basalen Teil der Cochlea über die Arteria vestibulocochlearis) erfolgt über die Arteria spiralis modioli. Weitere wichtige Gefäße sind die Stria vascularis und die Prominentia spiralis. So erfolgt bei experimenteller Unterbindung der Modiolusgefäße ein Verlust der Haarzellen, nicht jedoch eine Schädigung der Stria vascularis. Bei Perfusionsstörungen der Stria dagegen degeneriert diese ohne Untergang der Sinneszellen. Bei Durchtrennung der Arteria labyrinthi kommt es dann zur fast vollständigen Degeneration des Innenohres (Kiesewetter et al., 1988; Lehnhardt, 1994). Aufgrund der Nerveninnervation lässt sich das Gefäßsystem der Cochlea in einen medialen, sympathisch innervierten und in einen peripheren Bereich ohne sympathische Innervation einteilen (Nakashima et al., 2003). Beim peripheren Anteil, dem Bereich der Stria vascularis und Prominentia spiralis, könnten demnach die Endothelzellen, die Perizyten, das NO-System und ET-1 von besonderer Relevanz sein.
13 17 Eine Hörstörung, bei der Hypoxie und Ischämie besonders diskutiert werden können, ist die Altersschwerhörigkeit. Ausgehend von audiologischen und histologischen Befunden hat Schuknecht (1955; 1964) vier Grundtypen von Altersschwerhörigkeit herausgearbeitet. Der sensorische Typ mit Haarzelldegeneration und Hochtonabfall. Der neurale Typ mit überwiegender Ganglienzelldegeneration und schlechtem Sprachverstehen. Der metabolische Typ mit Atrophie der Stria vascularis. Der Innenohr-Schallleitungstyp mit Versteifung der Basilarmembran. Das morphologische Korrelat dieser Störung ist neben Atrophie und Schwund von Haarzellen eine Degeneration von Ganglien- und Nervenfasern sowie eine Atrophie des Ligamentum Spirale und der Stria vascularis (Übersicht in Beck, 1984). Für die Altersschwerhörigkeit spielen aber hypoxisch/ischämische Ursachen, hervorgerufen durch kardiovaskuläre Erkrankungen mit der Folge von Arteriosklerose sowie Hypercholesterinämie, eine nicht zu unterschätzende Rolle. Kardiovaskuläre Erkrankungen haben zwar keineswegs immer einen nachweisbaren Einfluss auf die Hörfunktion, jedoch konnte in ausgeprägten Fällen eine überproportional schlechte Sprachdiskrimination festgestellt werden (Bohme, 1987). Insgesamt scheint für das Innenohr der Grad der mikrovaskulären Schädigung bedeutsamer zu sein als ein partieller Verschluss der zuführenden zentralen Gefäße. Neben diesen nicht genetischen Faktoren kommt auch den genetisch determinierten Komponenten eine Rolle zu (Nelson und Hinojosa, 2006). Hypoxie und Ischämie werden auch als Ursache für die Entstehung von Tinnitus diskutiert. Hinsichtlich der von Zenner (1998) ausgeführten Tinnituseinteilung scheinen Hypoxie und Ischämie besonders für alle sensorineuralen Tinnitusentstehungstypen eine Rolle zu spielen. In Tabelle 1 sind wesentliche molekulare Prozesse, die durch Hypoxie/Ischämie beeinflusst werden können, zusammengestellt. Betrachtet man den Motor-Tinnitus, so kann z. B. der Einfluss von Hypoxie/Ischämie zur Modifikation der
14 18 Ca 2+ -Homeostease und Bildung von oxidativen freien Radikalen ( reactive oxygen species /ROS) führen. Im subakuten und chronischen Stadium ist beim Motor-Tinnitus weiterhin eine Modifikation der Prestin-Expression diskutierbar. Tabelle 1 Rolle von Hypoxie/Ischämie für den neurosensorischen Tinnitus (Mazurek et al., 2006). Klassifikation des Tinnitus nach Zenner (Zenner, 1998) Motor-Tinnitus Transduktions- und Transformations- Tinnitus Extrasensorischer Tinnitus Morphologisches Korrelat ÄHZ IHZ, Spiralganglion Stria vascularis, Gefäße der Cochlea Molekulare Prozesse Amplifikation der Schall induzierten Vibration der ÄHZ (Prestin) Signaltransduktion (Glutamat, GABA, Dopamin) Endocochleäres Potenzial, Ionenkanäle Störungen durch Hypoxie/Ischämie Akut Modifikation der Ca 2+ -Homeostase, ROS-Bildung Depolarisation, Erhöhte Glutamatfreisetzung, Zelltod (Apoptose/Nekrose), ROS-Bildung Autoregulation der Durchblutung, Verformbarkeit der Erythrozyten Subakut/chronisch Modifikation der Expression von Prestin, Zelltod Expression von NMDA- Untereinheiten, Veränderte NOS-Expression Expression von NOS und ET-1 Im Bereich des Transduktions- und Transformations-Tinnitus können Hypoxie und Ischämie eine Dauerdepolarisation bewirken. Über eine erhöhte Glutamatfreisetzung und Aktivierung von NMDA-Rezeptoren kann dies über Apoptose und Nekrose zum Zelltod führen. Diese glutamaterge Exzitotoxizität wurde zunächst bei Ischämie von Geweben im ZNS beobachtet (Mrsulja et al., 1978). Unter hypoxisch-ischämischen Bedingungen führt die exzessive Glutamatausschüttung über die Aktivierung postsynaptischer Glutamatrezeptoren zur veränderten Permeabilität von Ionenkanälen (Übersicht in Choi und Rothman, 1990). Dadurch strömen vermehrt Na + und Ca 2+ -Ionen in die Neurone, und es kommt zur Zellschwellung. Über die second messenger -Wirkung von Ca 2+ -Ionen
15 19 erfolgt die Aktivierung einer Kaskade von metabolischen Prozessen, an deren Ende der neuronale Zelltod steht (Ehrenberger und Felix, 1991; Meldrum et al., 1985; Pujol et al., 1990). Eine zentrale Bedeutung bei Hypoxie/Ischämie hat die Erhöhung der intrazellulären Ca 2+ -Konzentration. Die Ca 2+ -Erhöhung wird zum einen direkt über ionotrope Glutamatrezeptoren bewirkt und zum anderen über die Freisetzung aus intrazellulären Speichern (Pujol et al., 1990). Bei dem extrasensorischen Tinnitus könnten Hypoxie und Ischämie durch die Beeinflussung der Autoregulation der Durchblutung entstehen. Diese Annahme wird durch experimentelle Untersuchungen unterstützt. So führt Lärm z. B. zur Verringerung des po 2 in der Perilymphe (Lamm und Arnold, 1996; Scheibe et al., 1992) und zur Reduzierung des cochleären Blutflusses (Scheibe et al., 1993) HIF-1-abhängige Gene Hypoxie/Ischämie könnte einerseits direkt auf funktionelle Prozesse (Tabelle 1) wirken und andererseits die Expression einer Reihe von Hypoxie- bzw. HIF-1-abhängigen Genen beeinflussen, die zu akuten, subakuten bzw. chronischen Veränderungen der Durchblutung und des Signalsystems führen. Auf zwei HIF-1-abhängige Zielgene, die einen großen Einfluss auf die Veränderung der Durchblutung in der Cochlea haben können, soll nachfolgend eingegangen werden: a) Endothelin-1 (Et-1), b) Induzierte Stickstoffmonoxidsynthase (inos). a) Endothelin-1 (ET-1) ist der stärkste endogen gebildete Vasokonstriktor und der Gegenspieler von Stickstoffmonoxid (NO). ET-1 ist ein aus 21 Aminosäuren bestehendes Peptid, das in vaskulären Endothelzellen synthetisiert wird (Nakas-Icindic et al., 2004). Unter normoxischen Bedingungen wird ET-1 bereits auf der Transkriptionsebene durch NO inhibiert (Alonso und Radomski, 2003). ET-1 ist in der Cochlea (Jinnouchi, 2001) und
16 20 der Endothelin Rezeptor Typ A in der Arteria spiralis nachgewiesen worden (Scherer und Wangemann, 2002). Experimentell zeigt sich durch ET-1 ein Vasospasmus der Arteria spiralis des Modiolus (Scherer und Wangemann, 2002). Eine starke Zunahme der ET-1- Aktivität kann zu einer Vasokonstriktion im Gebiet der Stria vascularis führen. Dadurch können das endocochleäre Potenzial verändert und eine Tinnitusentstehung bewirkt werden. b) In der Cochlea sind drei Arten von Stickstoffmonoxidsynthasen nachgewiesen worden (Förstermann et al., 1998; Heinrich et al., 2004; Hess et al., 1999): die endotheliale (enos), die neuronale (nnos) und die induzierte (inos). Die Stickstoffmonoxidsynthasen produzieren NO, das als kurzlebiger Botenstoff die Relaxation der glatten Muskulatur und die Regulation des Vasotonus bewirkt (Félétou und Vanhoutte, 2006). Unter Hypoxie kann es über die inos zur Überproduktion von Peroxiden kommen, die eine direkte toxische Wirkung auf die Gefäße haben und damit das endocochleäre Potenzial beeinflussen (Hess et al., 1999; Yamane et al., 1995). Ein weiterer NO-Wirkungsmechanismus ist der synaptische Komplex. Unter normoxischen Bedingungen wirkt NO durch Rückkopplung hemmend auf die Glutamatrezeptoren. Hypoxie, die z. B. bei akustischer Überstimulation entsteht, bewirkt eine vermehrte Glutamatausschüttung und führt an den Glutamatrezeptoren zu einem vermehrten Ca 2+ -Einstrom (Ehrenberger und Felix, 1995). Durch die Aktivierung der nnos und inos können Peroxide gebildet werden, die zur Zerstörung und Degeneration der afferenten Fasern führen können (Fessenden und Schacht, 1998). Durch Veränderung der Aktionspotenziale bei diesen Umbauprozessen kann ebenso Tinnitus generiert werden Apoptose und Nekrose Die Abbauwege der Haarzellen können prinzipiell in Apoptose und Nekrose eingeteilt werden (Lipton, 1999). Die Apoptose ist der regulierte und programmierte Zelltod. Da die
17 21 Apoptose gezielt beeinflusst werden kann, ist sie für die Medizin von besonderem Interesse. Sie ist gekennzeichnet durch Zellschrumpfung, Chromatinverdichtung und DNA-Fragmentierung. Die Phagozytose erfolgt über Makrophagen ohne Entzündungsreaktion. Die programmierte Antwort der Zelle beinhaltet eine gesteigerte Transkription und Translation, die zur Synthese bestimmter, für die Vermittlung des Zelltodes verantwortlicher Proteine, z. B. Endonukleasen, führt. Zahlreiche Gene und Genprodukte beeinflussen den Ablauf der Apoptose, wie z. B. Bcl-2, Mcl-1, Fas ligand, p53, Caspase 3. Die Apoptose verläuft in drei Phasen: die Initialphase, die Festlegungsphase und die Ausführungsphase (Gross, 2005). Der apoptotische Zelltod kann über die Färbung mit Annexin nachgewiesen werden (van Tilborg et al., 2006). Annexin bindet sich irreversibel an das Phosphadidylserin, das unter Apoptose an die Außenseite der Zellmembran gelangt. Eine spezifischere Methode zur Darstellung der apoptotischen Kerne ist ein in situ DNA End labeling Assay (Gavrieli et al., 1992). Im Gegensatz dazu ist die Nekrose eine passive, nicht programmierte Form des Zelltodes. Die Nekrose führt zur Erhöhung der Permeabilität der Zytoplasmamembran mit der direkten Folge der Zellschwellung und zur Entzündungsreaktion. Der Nachweis geschädigter Zellmembranen kann über die Färbung mit Propidiumjodid erfolgen, daher wird dieser Farbstoff zum Nachweis der Nekrose eingesetzt. Propidiumjodid bindet sich an die DNS im Zellkern (Lipton, 1999). Hypoxie/Ischämie kann sowohl über Nekrose als auch Apoptose zum Zelltod führen (Beilharz et al., 1995). In der Initialphase der hypoxisch induzierten Apoptose fällt die intrazelluläre ATP-Konzentration ab, und es kommt zur Erhöhung der intrazellulären Ca 2+ - Konzentration, zur Aktivierung von Caspase 9 und zur Expression von spezifischen Rezeptoren Die Festlegungsphase ist durch das Gleichgewicht von pro- und antiapoptotischen Faktoren gekennzeichnet. Interessanterweise aktivieren HIF-1 und Hypoxie beide Typen von Faktoren, und nur die jeweiligen konkreten Bedingungen wie Zelltyp,
18 22 Dauer und Schweregrad der Hypoxie entscheiden, ob es zur Protektion oder zum Zelltod kommt. Die Apoptose wird über die Stabilisierung von p53 und die Aktivierung von Nip3 beeinflusst. Nip3 programmiert die Zelle für eine hypoxieinduzierte Apoptose (Bruick, 2000). Sowohl Nip3 als auch p53 sind HIF-1-abhängige Gene (Blagosklonny et al., 2001; Bruick, 2000). Damit erfolgt durch HIF-1 auf zellulärer Ebene nicht nur die Transaktivierung von Versorgungsgenen zum Überleben der Zelle, sondern auch von Genen, die den Zelltod einleiten. Gleichzeitig leitet HIF-1 auch die Apoptose derjenigen Zellen ein, die zu einer suffizienten Adaptation nicht mehr fähig sind (Gross, 2005). Es ist bekannt, dass die Apoptose durch verschiedene Wachstumsfaktoren unterdrückt wird, z.b. nerve growth factor (NGF), insulin-like growth factor und epidermal growth factor. In den auditorischen Neuronen führt die Wegnahme von neurotrophischen Faktoren wie NGF zum kompletten apoptotischen Zelltod der Neurone (Kew et al., 1996). Cisplatin führt ebenfalls zu einem apoptotischen Zelltod der sensorischen Zellen und Neurone des auditorischen Systems (Lefebvre et al., 2002). In verschiedenen Experimenten konnte nach Lärmbelastung bei den ÄHZ eine DNA-Kondensation und Fragmentation als Zeichen einer Apoptose sowie Schwellung der Zellkerne als Zeichen der Nekrose festgestellt werden (Hu et al., 2000; Hu et al., 2002). Über den Einfluss von Hypoxie und Ischämie auf die Art des Zelltodes im auditorischen System ist jedoch wenig bekannt Prestin Ein interessantes Molekül für die Funktion der äußeren Haarzelle (ÄHZ) ist Prestin, das auch als Motorprotein der ÄHZ bezeichnet wird (Zheng et al., 2000). Die ÄHZ können ihre Länge bis zu 5 % verändern (Ashmore, 1987; Kachar et al., 1986). Auf Depolarisation reagieren ÄHZ mit einer Verkürzung (Kontraktion) und auf Hyperpolarisation mit einer Verlängerung (Elongation) ihres Zellkörpers (Zenner et al., 1985; Zimmermann und
19 23 Fermin, 1996). Dabei werden 2 Formen unterschieden: eine schnelle Form der Längenänderung als Antwort auf akustische Stimulation und eine langsame Form (Puschner und Schacht, 1997a; Zenner et al., 1988), die Sekunden bis Minuten dauert und in vitro über die Erhöhung von intrazellulärem Ca 2+ hervorgerufen wird. Die schnelle Form der Längenänderung ist unabhängig von ATP oder Ca 2+ (Puschner und Schacht, 1997a; Zenner, 1986). Prestin befindet sich in der Außenwand der Zellmembran der ÄHZ intramembranös und wird nicht in den inneren Haarzellen exprimiert. Das Zytoskelett der ÄHZ ist aus Aktinfilamenten und querverlaufenden Spectrinfilamenten aufgebaut und über Ankerproteine mit der Plasmamembran und damit mit Membranproteinen wie Prestin verbunden (Sziklai et al., 2003). Das Protein Prestin ist durch 12 Transmembrandomänen gekennzeichnet. Auf der zweiten Transmembrandomäne befindet sich die Sulfat- Transport-Bindungsstelle. Das Protein besteht aus 744 Aminosäuren, wobei sich das N- und C-terminale Ende im Zytoplasma befinden (Adler et al., 2003; Dallos und Fakler, 2002). Über eine antikörperspezifische Markierung ist Prestin besonders hoch in der lateralen Plasmamembran der ÄHZ nachzuweisen (Belyantseva et al., 2000). Es ist interessant, dass auch menschliche Nierenzellen in Kultur, die mit Prestin transfiziert wurden, eine spannungsinduzierte Zellveränderung und eine spannungsabhängige Kapazitanz wie die ÄHZ zeigen (Zheng et al., 2000). Prestin ist in der Rattencochlea einige Tage nach der Geburt bereits nachweisbar (Belyantseva et al., 2000). Die strukturelle und funktionelle Reifung des Cortischen Organs und das Erscheinen der ÄHZ-Elektromotilität erscheinen erst zwei Wochen nach der Geburt (He et al., 1994; Ludwig et al., 2001). Mittlerweile ist auch das zugehörige Gen Pres bekannt. Es gehört zu der Gruppe der Sulfat-Anionen-Austauscher ähnlichen Proteine (SLC 26) wie auch das Gen für das Protein Pendrin, das für das Pendred Syndrom verantwortlich ist. Das Gen liegt auf dem langen Arm des Chromosomen 7 beim Menschen und des Chromosomen 5 bei der Maus
20 24 und enthält thyroid response elements im 1. Intron (Weber et al., 2002). Bei Abwesenheit von Schilddrüsenhormonen konnte eine Reduzierung von Prestin mrna und Prestin Protein nachgewiesen werden (Weber et al., 2002). Bis jetzt sind einige Mutationen des Gens nachgewiesen worden, die zu einem nichtsyndromalen Hörverlust führen (Liu et al., 2003). Haarzellantworten beim Meerschweinchen sind bis zu 70 khz nachgewiesen worden (Frank et al., 1999). Die Zellmembran besitzt jedoch ein so genanntes Tiefpassverhalten, so dass es ab 1000 Hz zur Abschwächung von elektrischen Stimuli kommt (Preyer et al., 1996). Chlorid-Ionen wirken für das Motorprotein Prestin als Sensor. Chlorid-Ionen binden sich an den zytoplasmatischen Bindungsort in Abhängigkeit von der elektrischen Spannung. Bei einer Hyperpolarisation werden Chlorid-Ionen gebunden, das Prestin- Molekül vergrößert seine Fläche, und die Haarzelle elongiert (Dallos und Fakler, 2002). Ein zweiter Regulationsmechanismus der Motorik der ÄHZ erfolgt über die efferente Rückkopplung. Bei Acethylcholin (ACH)-Freisetzung nehmen Steifigkeit der ÄHZ ab und damit deren Motilität zu. ACH bewirkt über einen intrazellulären Ca 2+ -Anstieg die Phosphorylierung von Proteinen wie Fodrin und Ankyrin. Die veränderte Geometrie der Proteine bewirkt eine Abschwächung der Verbindung zur Plasmamembran und führt zu einer Verringerung der Steifigkeit (Dallos et al., 1997). Im Hinblick auf die Entstehung des Motor-Tinnitus sind zwei Ansatzpunkte denkbar. Substanzen, die um die Chlorid-Bindungsstellen von Prestin konkurrieren (Oliver et al., 2001), wie z. B. Aspirin, können die Elektromotilität blockieren und über eine Hypomotilität zum Tinnitus führen. Andererseits können Substanzen, die in die efferente Rückkopplung eingreifen oder eine erhöhte efferente Rückkopplung bewirken, zu einer Hypermotilität führen.
21 Microarray Die unterschiedlichen Zellen, Gewebe und Organe eines Organismus sind durch spezielle morphologische und funktionelle Unterschiede gekennzeichnet. Dabei beruhen diese funktionellen Unterschiede im Wesentlichen auf einer zelltypischen Genexpression. Die differenzielle Genexpression stellt damit die treibende Kraft in der Entwicklung, Differenzierung, Regeneration und Plastizität von Geweben und Organen dar. Kenntnisse der Genexpression im Ohr spielen eine wichtige Rolle, da nur so die molekularen Mechanismen des Hörens besser verstanden sowie innovative Strategien zur Prävention des cochleären Hörverlustes entwickelt werden können. Durch die Entwicklung der Microarray-Technik ist eine umfassende Analyse der Genexpression auf mrna- und Proteinebene möglich. Da mit einer einzigen Untersuchung mehrere 1000 Gene gleichzeitig untersucht werden können, bietet diese Technik besonders gute molekulare Einblicke in Pathomechanismen wie z. B. Hypoxie und Ischämie. Das dieser Technik zugrunde liegende Prinzip besteht darin, DNA- Fragmente bekannter und unbekannter Gene auf einem Chip zu fixieren und mittels Hybridisierung die entsprechende mrna zu identifizieren und zu quantifizieren. mrna wird aus dem Versuchsgewebe isoliert und mit Hilfe der reversen Transkription in cdna umgeschrieben. Nach in vitro Transkription wird die crna mit radioaktivem ATP oder einem Fluoreszenzfarbstoff markiert (s. Abb. 2, S. 39). Anschließend erfolgt die Hybridisierung markierter crna mit ihren komplementären Sequenzen auf dem DNA- Chip. Die Intensität der radioaktiven Signale bzw. Fluoreszenzsignale ermöglicht eine quantitative Aussage der Expressionsmuster in Relation zum Referenzwert (Brown und Botstein, 1999; Stover et al., 2004). Damit erhält man Momentaufnahmen komplexer Expressionsmuster, die für die Klassifikation, Früherkennung und Prognose von Schädigungen geeignet sind.
22 26 Die Anwendbarkeit der Microarray-Technik ist dadurch begrenzt, dass eine Mindestzellzahl benötigt wird. Die Sensitivität liegt bei ca mrna-kopien pro Zelle (Kane et al., 2000; Svaren et al., 2000). Zwischenamplifikationsschritte gehen zu Lasten der Spezifität. Das Problem, dass nur bekannte Sequenzen untersucht werden können, wird mit dem Fortschreiten der entsprechenden Genomprojekte relativiert. Ungefähr Gene existieren in der humanen genetischen DNA. Ungefähr 5-10 % dieser Gene werden im Ohr exprimiert (Lin et al., 2003). Einige dieser Gene werden in der Entwicklungsphase exprimiert und postnatal inaktiviert. Andere Gene werden nur im ausgereiften Ohr exprimiert. Mit Hilfe der Microarray-Technik können erstmals die geringen Mengen Innenohrgewebe zur detaillierten Untersuchung gelangen. Erste Anwendungen der Microarray-Technik in der Innenohrforschung erfolgten zur Untersuchung der Genexpressionsmuster während der Innenohrentwicklung der Maus (Chen und Corey, 2002b), zur Erstellung eines Genexpressionsprofils des Mittel- und Innenohres der Ratte (Lin et al., 2003) sowie zur Charakterisierung der Immorto- Maushaarzelllinie UB/OC-1 (Rivolta et al., 2002). Interessant ist die Studie von Cho et al. (2002), welche die Unterschiede der Genexpression zwischen Nucleus cochlearis und Colliculus inferior sowie Organ Corti und Modiolus untersuchte. Dabei zeigten ca % der insgesamt 558 analysierten Gene eine signifikante Expression in einzelnen untersuchten Regionen. Die Autoren bezeichneten eine doppelte Erhöhung der Signale gegenüber dem Grundrauschen als signifikante Expression. Dabei wurden deutliche Unterschiede in der Genexpression des ZNS und der Cochlea festgestellt. Eine andere Arbeitsgruppe (Chen und Corey, 2002a) untersuchte die Genexpression im Innenohr mittels Genchip mit bekannten und EST/ expressed sequence tag Clustern. Morris et al. (2005) untersuchte die Genexpression von Organ Corti, Stria vascularis und Spiralganglion. Ca. 22 % der auf dem selbst entwickelten Chip vorhandenen Gene zeigten eine signifikante Expression. Andere Arbeiten vergleichen die Genexpression der Cochlea
23 27 mit der des Nierengewebes (Liu et al., 2004) oder die Expressionsverteilung einzelner Mechanorezeptoren zwischen Cochlea- und ZNS-, Leber-, Herz-, Hoden-, Augen-, Milz-, Lungen- und Hautgewebe (Hildebrand et al., 2004). Die Veränderung der Genexpression in der Cochlea unter schädigenden Einflüssen wurde ebenfalls untersucht. So wurde mittels Microarray der Einfluss von Alkohol (Da Lee et al., 2004), Cisplatin (Previati et al., 2004), Gentamycin (Nagy et al., 2004), Neomycin (Stover et al., 2004) und Lärm (Lomax et al., 2000) untersucht. In der Literatur findet sich keine Aussage zur Veränderung der Genexpression unter Hypoxie/Ischämie im Innenohr Problemstellung Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, den Einfluss von Hypoxie und Ischämie auf die Vulnerabilität von Haarzellen und auf die Genexpression von Organ Corti, Modiolus und Stria vascularis zu untersuchen, um so Rückschlüsse auf die Rolle von Hypoxie/Ischämie bei der Entstehung von Hörstörungen zu ziehen. Hierzu wurde das Modell der organotypischen Cochlea-Kultur der Ratte ausgewählt. Das in-vitro-cochlea-modell der neugeborenen Ratte bietet die Möglichkeit, den direkten Einfluss von Hypoxie/Ischämie auf verschiedene Strukturen der Cochlea zu analysieren. Dabei können die Regionen Organ Corti, Modiolus und Stria vascularis gesondert betrachtet werden. Da keine einheitlichen Aussagen in der Literatur über die Hypoxievulnerabilität von Haarzellen bestehen, soll zunächst die Hypoxievulnerabilität von inneren und äußeren Haarzellen untersucht werden. Die Ionenhomeostase des Innenohres ist von grundsätzlicher Bedeutung für die physiologische und pathologische Hörfunktion. Zum besseren Verständnis des Schädigungsmechanismus von Hypoxie/Ischämie, aber auch im
24 28 Hinblick auf Prävention und Therapie, wird der Einfluss von Kalium (K + ), Kalzium (Ca 2+ ) und Magnesium (Mg 2+ ) auf die Hypoxievulnerabilität der Haarzellen ermittelt. An der Signaltransduktion zwischen Haarzelle und Neuronen der Spiralganglien sind Glutamat und Glutamatrezeptoren unmittelbar beteiligt. Exzitotoxizität soll ein wesentlicher Schädigungsmechanismus sein. Daher ist es nahe liegend, den Einfluss von N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Antagonisten auf die hypoxisch/ischämische Haarzellschädigung zu untersuchen. Bisher ist unklar, auf welchem Weg Haarzellen durch Hypoxie/Ischämie sterben. Daher ist die Untersuchung der Relation von Apoptose zu Nekrose, die durch Hypoxie/Ischämie hervorgerufen wird, von großer Bedeutung. Da wahrscheinlich nur die Apoptose beeinflussbar ist, haben diese Erkenntnisse besonderen Einfluss auf therapeutische Ansätze. Da der Transkriptionsfaktor HIF-1 ein Schlüsselfaktor für die Anpassungsfähigkeit von Geweben an Hypoxie/Ischämie darstellt, ist von großem Interesse, welche Rolle HIF-1 in den Regionen Organ Corti, Stria vascularis und Modiolus spielt. Dabei ist die HIF-1- Expression auf mrna-ebene, Protein-Ebene und Aktivitätsebene von Bedeutung. Bei Hypoxie/Ischämie werden nicht nur HIF-1 und HIF-1-abhängige Gene in der Expression verändert, sondern eine Vielzahl von anderen Genen. Für das Innenohr liegen bis jetzt keine Erkenntnisse für die Genexpression in den Regionen Organ Corti, Stria vascularis und Modiolus unter Hypoxie/Ischämie-Bedingungen vor. Die Microarray- Analyse ermöglicht, eine Vielzahl von Gen-Veränderungen unter Normoxie und Hypoxie zu untersuchen und ist eine Basis dieser Arbeit. Durch die Microarray-Analyse werden Regulationswege besser verstanden und letztlich neue Wege für die Protektion und Therapie am Innenohr eröffnet. Für die Funktion der ÄHZ ist das Gen Prestin von besonderer Bedeutung. Da Prestin nicht auf dem Microarray-Chip enthalten ist, wurden der Prestin mrna-gehalt mittels
25 29 kompetitiver RT-PCR in der organotypischen Kultur und der Einfluss von Hypoxie/Ischämie auf die Prestinexpression gesondert untersucht.
Taubheit Julia Charl Rieke Schluckebier
 Taubheit 19.11.2015 Julia Charl Rieke Schluckebier Gliederung 1. Aufbau des Ohres 2. Akustische Wahrnehmung 3. Aufbau der Haarzellen 4. Tip-Links 5. Mechanoelektrische Transduktion a. PMCA2-Pumpe 6. Taubheit
Taubheit 19.11.2015 Julia Charl Rieke Schluckebier Gliederung 1. Aufbau des Ohres 2. Akustische Wahrnehmung 3. Aufbau der Haarzellen 4. Tip-Links 5. Mechanoelektrische Transduktion a. PMCA2-Pumpe 6. Taubheit
Glutamat und Neurotoxizitaet. Narcisse Mokuba WS 18/19
 Glutamat und Neurotoxizitaet Narcisse Mokuba WS 18/19 Gliederung 1.Teil : Glutamat als Botenstoff ; Synthese Glutamat-Rezeptoren : Aufbau & Funktion Signaluebertragung 2.Teil : Bedeutung als Gescmacksverstaerker
Glutamat und Neurotoxizitaet Narcisse Mokuba WS 18/19 Gliederung 1.Teil : Glutamat als Botenstoff ; Synthese Glutamat-Rezeptoren : Aufbau & Funktion Signaluebertragung 2.Teil : Bedeutung als Gescmacksverstaerker
BK07_Vorlesung Physiologie. 05. November 2012
 BK07_Vorlesung Physiologie 05. November 2012 Stichpunkte zur Vorlesung 1 Aktionspotenziale = Spikes Im erregbaren Gewebe werden Informationen in Form von Aktions-potenzialen (Spikes) übertragen Aktionspotenziale
BK07_Vorlesung Physiologie 05. November 2012 Stichpunkte zur Vorlesung 1 Aktionspotenziale = Spikes Im erregbaren Gewebe werden Informationen in Form von Aktions-potenzialen (Spikes) übertragen Aktionspotenziale
Signale und Signalwege in Zellen
 Signale und Signalwege in Zellen Zellen müssen Signale empfangen, auf sie reagieren und Signale zu anderen Zellen senden können Signalübertragungsprozesse sind biochemische (und z.t. elektrische) Prozesse
Signale und Signalwege in Zellen Zellen müssen Signale empfangen, auf sie reagieren und Signale zu anderen Zellen senden können Signalübertragungsprozesse sind biochemische (und z.t. elektrische) Prozesse
1 Bau von Nervenzellen
 Neurophysiologie 1 Bau von Nervenzellen Die funktionelle Einheit des Nervensystems bezeichnet man als Nervenzelle. Dendrit Zellkörper = Soma Zelllkern Axon Ranvier scher Schnürring Schwann sche Hüllzelle
Neurophysiologie 1 Bau von Nervenzellen Die funktionelle Einheit des Nervensystems bezeichnet man als Nervenzelle. Dendrit Zellkörper = Soma Zelllkern Axon Ranvier scher Schnürring Schwann sche Hüllzelle
Kulturen von humanen Nabelschnur-Endothelzellen (HUVEC) produzieren konstant Endothelin-1 (ET-1) und geben dieses in das Kulturmedium ab.
 4 ERGEBNISSE 4.1 Endothelin Kulturen von humanen Nabelschnur-Endothelzellen (HUVEC) produzieren konstant Endothelin-1 (ET-1) und geben dieses in das Kulturmedium ab. 4.1.1 Dosisabhängige Herabregulation
4 ERGEBNISSE 4.1 Endothelin Kulturen von humanen Nabelschnur-Endothelzellen (HUVEC) produzieren konstant Endothelin-1 (ET-1) und geben dieses in das Kulturmedium ab. 4.1.1 Dosisabhängige Herabregulation
postsynaptische Potentiale graduierte Potentiale
 postsynaptische Potentiale graduierte Potentiale Postsynaptische Potentiale veraendern graduierte Potentiale aund, wenn diese Aenderungen das Ruhepotential zum Schwellenpotential hin anheben, dann entsteht
postsynaptische Potentiale graduierte Potentiale Postsynaptische Potentiale veraendern graduierte Potentiale aund, wenn diese Aenderungen das Ruhepotential zum Schwellenpotential hin anheben, dann entsteht
Übertragung zwischen einzelnen Nervenzellen: Synapsen
 Übertragung zwischen einzelnen Nervenzellen: Synapsen Kontaktpunkt zwischen zwei Nervenzellen oder zwischen Nervenzelle und Zielzelle (z.b. Muskelfaser) Synapse besteht aus präsynaptischen Anteil (sendendes
Übertragung zwischen einzelnen Nervenzellen: Synapsen Kontaktpunkt zwischen zwei Nervenzellen oder zwischen Nervenzelle und Zielzelle (z.b. Muskelfaser) Synapse besteht aus präsynaptischen Anteil (sendendes
Das Wichtigste: 3 Grundlagen der Erregungs- und Neurophysiologie. - Erregungsausbreitung -
 Das Wichtigste Das Wichtigste: 3 Grundlagen der Erregungs- und Neurophysiologie - Erregungsausbreitung - Das Wichtigste: 3.4 Erregungsleitung 3.4 Erregungsleitung Elektrotonus Die Erregungsausbreitung
Das Wichtigste Das Wichtigste: 3 Grundlagen der Erregungs- und Neurophysiologie - Erregungsausbreitung - Das Wichtigste: 3.4 Erregungsleitung 3.4 Erregungsleitung Elektrotonus Die Erregungsausbreitung
Erregungsübertragung an Synapsen. 1. Einleitung. 2. Schnelle synaptische Erregung. Biopsychologie WiSe Erregungsübertragung an Synapsen
 Erregungsübertragung an Synapsen 1. Einleitung 2. Schnelle synaptische Übertragung 3. Schnelle synaptische Hemmung chemische 4. Desaktivierung der synaptischen Übertragung Synapsen 5. Rezeptoren 6. Langsame
Erregungsübertragung an Synapsen 1. Einleitung 2. Schnelle synaptische Übertragung 3. Schnelle synaptische Hemmung chemische 4. Desaktivierung der synaptischen Übertragung Synapsen 5. Rezeptoren 6. Langsame
Neurobiologie des Lernens. Hebb Postulat Die synaptische Verbindung von zwei gleichzeitig erregten Zellen wird verstärkt
 Neurobiologie des Lernens Hebb Postulat 1949 Die synaptische Verbindung von zwei gleichzeitig erregten Zellen wird verstärkt Bliss & Lomo fanden 1973 langdauernde Veränderungen der synaptischen Aktivität,
Neurobiologie des Lernens Hebb Postulat 1949 Die synaptische Verbindung von zwei gleichzeitig erregten Zellen wird verstärkt Bliss & Lomo fanden 1973 langdauernde Veränderungen der synaptischen Aktivität,
Übungsklausur Auswertung/Statistik. Dr. Yvonne Lorat
 Übungsklausur Auswertung/Statistik Dr. Yvonne Lorat Achten Sie bei Multiple-Choice-Fragen auf die Fragestellung: Welche Aussage trifft nicht zu? Hier ist nur eine Aussage falsch! Alle anderen sind richtig.
Übungsklausur Auswertung/Statistik Dr. Yvonne Lorat Achten Sie bei Multiple-Choice-Fragen auf die Fragestellung: Welche Aussage trifft nicht zu? Hier ist nur eine Aussage falsch! Alle anderen sind richtig.
Physiologische Grundlagen. Inhalt
 Physiologische Grundlagen Inhalt Das Ruhemembranpotential - RMP Das Aktionspotential - AP Die Alles - oder - Nichts - Regel Die Klassifizierung der Nervenfasern Das Ruhemembranpotential der Zelle RMP Zwischen
Physiologische Grundlagen Inhalt Das Ruhemembranpotential - RMP Das Aktionspotential - AP Die Alles - oder - Nichts - Regel Die Klassifizierung der Nervenfasern Das Ruhemembranpotential der Zelle RMP Zwischen
1. Einleitung und Ziel der Dissertation Literaturdiskussion Anatomie und Physiologie des Innenohres
 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung und Ziel der Dissertation 1 2. Literaturdiskussion 3 2.1. Anatomie und Physiologie des Innenohres 3 2.1.1. Kochlea 3 2.1.1.1. Cortisches Organ 4 2.1.1.2. Lateralwand: Stria
Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung und Ziel der Dissertation 1 2. Literaturdiskussion 3 2.1. Anatomie und Physiologie des Innenohres 3 2.1.1. Kochlea 3 2.1.1.1. Cortisches Organ 4 2.1.1.2. Lateralwand: Stria
Exzitatorische (erregende) Synapsen
 Exzitatorische (erregende) Synapsen Exzitatorische Neurotransmitter z.b. Glutamat Öffnung von Na+/K+ Kanälen Membran- Potential (mv) -70 Graduierte Depolarisation der subsynaptischen Membran = Erregendes
Exzitatorische (erregende) Synapsen Exzitatorische Neurotransmitter z.b. Glutamat Öffnung von Na+/K+ Kanälen Membran- Potential (mv) -70 Graduierte Depolarisation der subsynaptischen Membran = Erregendes
Genaktivierung und Genexpression
 Genaktivierung und Genexpression Unter Genexpression versteht man ganz allgemein die Ausprägung des Genotyps zum Phänotyp einer Zelle oder eines ganzen Organismus. Genotyp: Gesamtheit der Informationen
Genaktivierung und Genexpression Unter Genexpression versteht man ganz allgemein die Ausprägung des Genotyps zum Phänotyp einer Zelle oder eines ganzen Organismus. Genotyp: Gesamtheit der Informationen
C SB. Genomics Herausforderungen und Chancen. Genomics. Genomic data. Prinzipien dominieren über Detail-Fluten. in 10 Minuten!
 Genomics Herausforderungen und Chancen Prinzipien dominieren über Detail-Fluten Genomics in 10 Minuten! biol. Prin cip les Genomic data Dr.Thomas WERNER Scientific & Business Consulting +49 89 81889252
Genomics Herausforderungen und Chancen Prinzipien dominieren über Detail-Fluten Genomics in 10 Minuten! biol. Prin cip les Genomic data Dr.Thomas WERNER Scientific & Business Consulting +49 89 81889252
-Übersicht. 2. G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. 5. Na + -K + -Pumpe REZEPTOREN. 1. Allgemeine Definition: Rezeptoren. 3. Tyrosin-Kinase Rezeptoren
 REZEPTOREN -Übersicht 1. Allgemeine Definition: Rezeptoren 2. G-Protein-gekoppelte Rezeptoren 3. Tyrosin-Kinase Rezeptoren Beispiel: Insulin 4. Steroidhormone 5. Na + -K + -Pumpe EINFÜHRUNG Definition
REZEPTOREN -Übersicht 1. Allgemeine Definition: Rezeptoren 2. G-Protein-gekoppelte Rezeptoren 3. Tyrosin-Kinase Rezeptoren Beispiel: Insulin 4. Steroidhormone 5. Na + -K + -Pumpe EINFÜHRUNG Definition
Bipolar Disorder (BD) Nina Stremmel, Universität zu Köln,
 Bipolar Disorder (BD) Nina Stremmel, Universität zu Köln, 07.06.18 Inhalt Allgemein Genetische Grundlagen CACNA I C, NCAN, ANK3 Neurobiologische Grundlagen Dopamin und Glutamat Behandlung Allgemein Neuropsychotische
Bipolar Disorder (BD) Nina Stremmel, Universität zu Köln, 07.06.18 Inhalt Allgemein Genetische Grundlagen CACNA I C, NCAN, ANK3 Neurobiologische Grundlagen Dopamin und Glutamat Behandlung Allgemein Neuropsychotische
Die Muskulatur des Menschen
 Die Muskulatur des Menschen Motorische Einheit Im Zentrum der Muskelkontraktion steht die motorische Einheit. Sie besteht aus einem Motoneuron und der von diesem Motoneuron innervierten 1 Gruppe von Muskelfasern.
Die Muskulatur des Menschen Motorische Einheit Im Zentrum der Muskelkontraktion steht die motorische Einheit. Sie besteht aus einem Motoneuron und der von diesem Motoneuron innervierten 1 Gruppe von Muskelfasern.
Aus der Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie und internistische Intensivmedizin. der Medizinischen Fakultät Charite - Universitätsmedizin Berlin
 Aus der Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie und internistische Intensivmedizin der Medizinischen Fakultät Charite - Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Die Aktivierung des Hypoxie-induzierbaren-Transkriptionsfaktors
Aus der Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie und internistische Intensivmedizin der Medizinischen Fakultät Charite - Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Die Aktivierung des Hypoxie-induzierbaren-Transkriptionsfaktors
Arten zellulärer Signalübertragung
 Arten zellulärer Signalübertragung Hormone SignalZelle Synapse Transmittermoleküle RezeptorLigand vermittelter Zell-Zell Kontakt Hormone als Signalmoleküle Adrenalin: Cortisol: Östradiol: Glucagon: Insulin:
Arten zellulärer Signalübertragung Hormone SignalZelle Synapse Transmittermoleküle RezeptorLigand vermittelter Zell-Zell Kontakt Hormone als Signalmoleküle Adrenalin: Cortisol: Östradiol: Glucagon: Insulin:
3 Ergebnisse. 3.1 Die Speckling-Domäne von Wt1 umfaßt die Aminosäuren
 3 Ergebnisse 3.1 Die Speckling-Domäne von Wt1 umfaßt die Aminosäuren 76-120 Die Existenz verschiedener Isoformen von WT1 ist unter anderem auf die Verwendung einer für die Aminosäuren KTS kodierenden alternativen
3 Ergebnisse 3.1 Die Speckling-Domäne von Wt1 umfaßt die Aminosäuren 76-120 Die Existenz verschiedener Isoformen von WT1 ist unter anderem auf die Verwendung einer für die Aminosäuren KTS kodierenden alternativen
In dieser Doktorarbeit wird eine rezeptorvermittelte Signalkaskade für Thrombin
 Diskussion -33-4. Diskussion In dieser Doktorarbeit wird eine rezeptorvermittelte Signalkaskade für Thrombin beschrieben, die zur Differenzierung von neonatalen glatten Gefäßmuskelzellen führt. Thrombin
Diskussion -33-4. Diskussion In dieser Doktorarbeit wird eine rezeptorvermittelte Signalkaskade für Thrombin beschrieben, die zur Differenzierung von neonatalen glatten Gefäßmuskelzellen führt. Thrombin
Allgemeine Pathologie Zelltod
 Allgemeine Pathologie Zelltod Was kann mit Zellen / Geweben geschehen? - sie können ungestört bis an ihr individuelles Ende leben und müssen dann ersetzt werden - sie können veränderten Anforderungen unterliegen,
Allgemeine Pathologie Zelltod Was kann mit Zellen / Geweben geschehen? - sie können ungestört bis an ihr individuelles Ende leben und müssen dann ersetzt werden - sie können veränderten Anforderungen unterliegen,
Übungsfragen, Neuro 1
 Übungsfragen, Neuro 1 Grundlagen der Biologie Iib FS 2012 Auf der jeweils folgenden Folie ist die Lösung markiert. Die meisten Neurone des menschlichen Gehirns sind 1. Sensorische Neurone 2. Motorische
Übungsfragen, Neuro 1 Grundlagen der Biologie Iib FS 2012 Auf der jeweils folgenden Folie ist die Lösung markiert. Die meisten Neurone des menschlichen Gehirns sind 1. Sensorische Neurone 2. Motorische
Molekularbiologie 6c Proteinbiosynthese. Bei der Proteinbiosynthese geht es darum, wie die Information der DNA konkret in ein Protein umgesetzt wird
 Molekularbiologie 6c Proteinbiosynthese Bei der Proteinbiosynthese geht es darum, wie die Information der DNA konkret in ein Protein umgesetzt wird 1 Übersicht: Vom Gen zum Protein 1. 2. 3. 2 Das Dogma
Molekularbiologie 6c Proteinbiosynthese Bei der Proteinbiosynthese geht es darum, wie die Information der DNA konkret in ein Protein umgesetzt wird 1 Übersicht: Vom Gen zum Protein 1. 2. 3. 2 Das Dogma
Das Gehirn: Eine Einführung in die Molekulare Neurobiologie. A. Baumann
 Das Gehirn: Eine Einführung in die Molekulare Neurobiologie A. Baumann Das Gehirn Ligandengesteuerte Ionenkanäle Das Gehirn Ligandengesteuerte Kanäle Ligand-gated ion channels LGIC Ionotrope Rezeptoren
Das Gehirn: Eine Einführung in die Molekulare Neurobiologie A. Baumann Das Gehirn Ligandengesteuerte Ionenkanäle Das Gehirn Ligandengesteuerte Kanäle Ligand-gated ion channels LGIC Ionotrope Rezeptoren
Chemische Signale bei Tieren
 Chemische Signale bei Tieren 1. Steuersysteme der Körper: - Endokrines System (Hormonsystem) im Ueberblick 2. Wirkungsweise chemischer Signale - auf Zielzellen - Aktivierung von Signalübertragungswege
Chemische Signale bei Tieren 1. Steuersysteme der Körper: - Endokrines System (Hormonsystem) im Ueberblick 2. Wirkungsweise chemischer Signale - auf Zielzellen - Aktivierung von Signalübertragungswege
 Abbildungen Schandry, 2006 Quelle: www.ich-bin-einradfahrer.de Abbildungen Schandry, 2006 Informationsvermittlung im Körper Pioniere der Neurowissenschaften: Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Camillo
Abbildungen Schandry, 2006 Quelle: www.ich-bin-einradfahrer.de Abbildungen Schandry, 2006 Informationsvermittlung im Körper Pioniere der Neurowissenschaften: Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Camillo
2.1 Die Entstehung des Gehirns aus neuralen Stammzellen Transkriptionsfaktoren in der Gehirnentwicklung...16
 Inhaltsverzeichnis Danksagung...3 Inhaltsverzeichnis...5 Abkürzungverzeichnis...1 1 Zielsetzung...4 2 Einleitung...6 2.1 Die Entstehung des Gehirns aus neuralen Stammzellen...6 2.2 Radiale Gliazellen...9
Inhaltsverzeichnis Danksagung...3 Inhaltsverzeichnis...5 Abkürzungverzeichnis...1 1 Zielsetzung...4 2 Einleitung...6 2.1 Die Entstehung des Gehirns aus neuralen Stammzellen...6 2.2 Radiale Gliazellen...9
Epilepsie. ein Vortrag von Cara Leonie Ebert und Max Lehmann
 Epilepsie ein Vortrag von Cara Leonie Ebert und Max Lehmann Inhaltsverzeichnis Definition Epilepsie Unterschiede und Formen Ursachen Exkurs Ionenkanäle Diagnose Das Elektroenzephalogramm (EEG) Therapiemöglichkeiten
Epilepsie ein Vortrag von Cara Leonie Ebert und Max Lehmann Inhaltsverzeichnis Definition Epilepsie Unterschiede und Formen Ursachen Exkurs Ionenkanäle Diagnose Das Elektroenzephalogramm (EEG) Therapiemöglichkeiten
Expression und Funktion. von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten. Hirngewebe der Maus
 Expression und Funktion von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten Hirngewebe der Maus Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) von Dipl.-Biochem.
Expression und Funktion von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten Hirngewebe der Maus Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) von Dipl.-Biochem.
Biologie für Mediziner WS 2007/08
 Biologie für Mediziner WS 2007/08 Teil Allgemeine Genetik, Prof. Dr. Uwe Homberg 1. Endozytose 2. Lysosomen 3. Zellkern, Chromosomen 4. Struktur und Funktion der DNA, Replikation 5. Zellzyklus und Zellteilung
Biologie für Mediziner WS 2007/08 Teil Allgemeine Genetik, Prof. Dr. Uwe Homberg 1. Endozytose 2. Lysosomen 3. Zellkern, Chromosomen 4. Struktur und Funktion der DNA, Replikation 5. Zellzyklus und Zellteilung
Synaptische Übertragung und Neurotransmitter
 Proseminar Chemie der Psyche Synaptische Übertragung und Neurotransmitter Referent: Daniel Richter 1 Überblick Synapsen: - Typen / Arten - Struktur / Aufbau - Grundprinzipien / Prozesse Neurotransmitter:
Proseminar Chemie der Psyche Synaptische Übertragung und Neurotransmitter Referent: Daniel Richter 1 Überblick Synapsen: - Typen / Arten - Struktur / Aufbau - Grundprinzipien / Prozesse Neurotransmitter:
Zusammenfassung in deutscher Sprache
 Zusammenfassung in deutscher Sprache Zusammenfassung Man schätzt, dass in den Niederlanden einer von 200 Erwachsenen (=60.000) eine verborgene Nierenschädigung hat. Ungefähr 40.000 Menschen sind bekennt
Zusammenfassung in deutscher Sprache Zusammenfassung Man schätzt, dass in den Niederlanden einer von 200 Erwachsenen (=60.000) eine verborgene Nierenschädigung hat. Ungefähr 40.000 Menschen sind bekennt
Entdeckungen unter der Schädeldecke. Jean-Marc Fritschy Institut für Pharmakologie und Toxikologie
 Entdeckungen unter der Schädeldecke Jean-Marc Fritschy Institut für Pharmakologie und Toxikologie Inhalt 1. GFP, das Wunderprotein 2. Die Nervenzellen bei der Arbeit beobachten 3. Nervenzellen mit Licht
Entdeckungen unter der Schädeldecke Jean-Marc Fritschy Institut für Pharmakologie und Toxikologie Inhalt 1. GFP, das Wunderprotein 2. Die Nervenzellen bei der Arbeit beobachten 3. Nervenzellen mit Licht
Vorlesung Einführung in die Biopsychologie. Kapitel 4: Nervenleitung und synaptische Übertragung
 Vorlesung Einführung in die Biopsychologie Kapitel 4: Nervenleitung und synaptische Übertragung Prof. Dr. Udo Rudolph SoSe 2018 Technische Universität Chemnitz Grundlage bisher: Dieser Teil nun: Struktur
Vorlesung Einführung in die Biopsychologie Kapitel 4: Nervenleitung und synaptische Übertragung Prof. Dr. Udo Rudolph SoSe 2018 Technische Universität Chemnitz Grundlage bisher: Dieser Teil nun: Struktur
Wiederholungsklausur zur Vorlesung Biochemie IV im SS 2000
 Wiederholungsklausur zur Vorlesung Biochemie IV im SS 2000 am 15.11.2000 von 13.45 15.15 Uhr (insgesamt 100 Punkte, mindestens 50 erforderlich) Bitte Name, Matrikelnummer und Studienfach 1. Wie erfolgt
Wiederholungsklausur zur Vorlesung Biochemie IV im SS 2000 am 15.11.2000 von 13.45 15.15 Uhr (insgesamt 100 Punkte, mindestens 50 erforderlich) Bitte Name, Matrikelnummer und Studienfach 1. Wie erfolgt
Tyrosinkinase- Rezeptoren
 Tyrosinkinase- Rezeptoren für bestimmte Hormone gibt es integrale Membranproteine als Rezeptoren Aufbau und Signaltransduktionsweg unterscheiden sich von denen der G- Protein- gekoppelten Rezeptoren Polypeptide
Tyrosinkinase- Rezeptoren für bestimmte Hormone gibt es integrale Membranproteine als Rezeptoren Aufbau und Signaltransduktionsweg unterscheiden sich von denen der G- Protein- gekoppelten Rezeptoren Polypeptide
Zusammenfassung. Bei Patienten mit PAH zeigte sich in Lungengewebe eine erhöhte Expression von PAR-1 und PAR-2. Aktuelle Arbeiten weisen darauf
 Zusammenfassung Die pulmonal arterielle Hypertonie (PAH) ist eine schwerwiegende, vaskuläre Erkrankung, die mit einer hohen Sterblichkeit einhergeht. Die zugrundeliegenden Pathomechanismen sind multifaktoriell
Zusammenfassung Die pulmonal arterielle Hypertonie (PAH) ist eine schwerwiegende, vaskuläre Erkrankung, die mit einer hohen Sterblichkeit einhergeht. Die zugrundeliegenden Pathomechanismen sind multifaktoriell
Liebe Studentinnen und Studenten Herzlich Willkommen im II. Semester!
 Liebe Studentinnen und Studenten Herzlich Willkommen im II. Semester! 1 Signalwege 2 Inhalt des Thema 1. Einleitung - 1. Vorlesung 2. Komponenten der Signalwegen 1. Vorlesung 3. Hauptsignalwege 2. Vorlesung
Liebe Studentinnen und Studenten Herzlich Willkommen im II. Semester! 1 Signalwege 2 Inhalt des Thema 1. Einleitung - 1. Vorlesung 2. Komponenten der Signalwegen 1. Vorlesung 3. Hauptsignalwege 2. Vorlesung
Ligandengesteuerte Ionenkanäle
 Das Gehirn SS 2010 Ligandengesteuerte Ionenkanäle Ligandengesteuerte Kanäle Ligand-gated ion channels LGIC Ionotrope Rezeptoren Neurotransmission Liganden Acetylcholin Glutamat GABA Glycin ATP; camp; cgmp;
Das Gehirn SS 2010 Ligandengesteuerte Ionenkanäle Ligandengesteuerte Kanäle Ligand-gated ion channels LGIC Ionotrope Rezeptoren Neurotransmission Liganden Acetylcholin Glutamat GABA Glycin ATP; camp; cgmp;
VL.4 Prüfungsfragen:
 VL.4 Prüfungsfragen: 1. Skizzieren Sie eine chemische Synapse mit allen wesentlichen Elementen. 2. Skizzieren Sie eine elektrische Synapse mit allen wesentlichen Elementen. 3. Welche Art der Kommunikation
VL.4 Prüfungsfragen: 1. Skizzieren Sie eine chemische Synapse mit allen wesentlichen Elementen. 2. Skizzieren Sie eine elektrische Synapse mit allen wesentlichen Elementen. 3. Welche Art der Kommunikation
Synaptische Verbindungen - Alzheimer
 Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen - Alzheimer R. Brandt (Email: brandt@biologie.uni-osnabrueck.de) Synaptische Verbindungen - Synapsen,
Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen - Alzheimer R. Brandt (Email: brandt@biologie.uni-osnabrueck.de) Synaptische Verbindungen - Synapsen,
Signaltransduktion durch Zell-Zell und Zell-Matrix Kontakte
 Signaltransduktion durch Zell-Zell und Zell-Matrix Kontakte - Integrine als zentrale Adhäsionsrezeptoren - - Focal Adhesion Kinase (FAK) als zentrales Signalmolekül - Regulation von Zellfunktionen durch
Signaltransduktion durch Zell-Zell und Zell-Matrix Kontakte - Integrine als zentrale Adhäsionsrezeptoren - - Focal Adhesion Kinase (FAK) als zentrales Signalmolekül - Regulation von Zellfunktionen durch
Die motorische Endplatte und die Steuerung der Muskelkontraktion
 Die motorische Endplatte und die Steuerung der Muskelkontraktion 1. Aufbau des Muskels 2. Mechanismus und Steuerung der Muskelkontraktion 2.1 Gleitfilamenttheorie 2.2 Zyklus der Actin-Myosin Interaktion
Die motorische Endplatte und die Steuerung der Muskelkontraktion 1. Aufbau des Muskels 2. Mechanismus und Steuerung der Muskelkontraktion 2.1 Gleitfilamenttheorie 2.2 Zyklus der Actin-Myosin Interaktion
Neuronale Grundlagen bei ADHD. (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung. Dr. Lutz Erik Koch
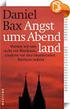 Neuronale Grundlagen bei ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung Dr. Lutz Erik Koch Die Verschreibung von Ritalin bleibt kontrovers Jeden Tag bekommen Millionen von
Neuronale Grundlagen bei ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung Dr. Lutz Erik Koch Die Verschreibung von Ritalin bleibt kontrovers Jeden Tag bekommen Millionen von
Zellen des Nervensystems, Zellbiologie von Neuronen I
 Zellen des Nervensystems, Zellbiologie von Neuronen I 1. Prinzipieller Aufbau eines Nervensystems 2. Zelltypen des Nervensystems 2.1 Gliazellen 2.2 Nervenzellen 3. Zellbiologie von Neuronen 3.1 Morphologische
Zellen des Nervensystems, Zellbiologie von Neuronen I 1. Prinzipieller Aufbau eines Nervensystems 2. Zelltypen des Nervensystems 2.1 Gliazellen 2.2 Nervenzellen 3. Zellbiologie von Neuronen 3.1 Morphologische
Immunbiologie. Teil 3
 Teil 3 Haupthistokompatibilitätskomplex (1): - es gibt einen grundlegenden Unterschied, wie B-Lymphozyten und T-Lymphozyten ihr relevantes Antigen erkennen - B-Lymphozyten binden direkt an das komplette
Teil 3 Haupthistokompatibilitätskomplex (1): - es gibt einen grundlegenden Unterschied, wie B-Lymphozyten und T-Lymphozyten ihr relevantes Antigen erkennen - B-Lymphozyten binden direkt an das komplette
Elektronenmikroskopie zeigte die Existenz der A-, P- und E- trna-bindungsstellen. Abb. aus Stryer (5th Ed.)
 Elektronenmikroskopie zeigte die Existenz der A-, P- und E- trna-bindungsstellen Die verschiedenen Ribosomen-Komplexe können im Elektronenmikroskop beobachtet werden Durch Röntgenkristallographie wurden
Elektronenmikroskopie zeigte die Existenz der A-, P- und E- trna-bindungsstellen Die verschiedenen Ribosomen-Komplexe können im Elektronenmikroskop beobachtet werden Durch Röntgenkristallographie wurden
1. Welche Arten von Zell Zell Verbindungen kennen Sie und was sind ihre Hauptaufgaben? Verschliessende Verbindungen (Permeabilitätseinschränkung)
 Fragen Zellbio 2 1. Welche Arten von Zell Zell Verbindungen kennen Sie und was sind ihre Hauptaufgaben? Verschliessende Verbindungen (Permeabilitätseinschränkung) Haftende Verbindungen (Mechanischer Zusammenhalt)
Fragen Zellbio 2 1. Welche Arten von Zell Zell Verbindungen kennen Sie und was sind ihre Hauptaufgaben? Verschliessende Verbindungen (Permeabilitätseinschränkung) Haftende Verbindungen (Mechanischer Zusammenhalt)
Synaptische Transmission
 Synaptische Transmission Wie lösen APe, die an den Endknöpfchen der Axone ankommen, die Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt aus (chemische Signalübertragung)? 5 wichtige Aspekte:
Synaptische Transmission Wie lösen APe, die an den Endknöpfchen der Axone ankommen, die Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt aus (chemische Signalübertragung)? 5 wichtige Aspekte:
Wirkungsmechanismen regulatorischer Enzyme
 Wirkungsmechanismen regulatorischer Enzyme Ein Multienzymsystem ist eine Aufeinanderfolge von Enzymen, bei der das Produkt eines vorstehenden Enzyms das Substrat des nächsten Enzyms wird. Ein regulatorisches
Wirkungsmechanismen regulatorischer Enzyme Ein Multienzymsystem ist eine Aufeinanderfolge von Enzymen, bei der das Produkt eines vorstehenden Enzyms das Substrat des nächsten Enzyms wird. Ein regulatorisches
Akkumulation von Metallen im Gehirn? Pathomechanismen und klinische Bedeutung. Dr. rer. nat. Katrin Huesker, IMD Berlin
 Akkumulation von Metallen im Gehirn? Pathomechanismen und klinische Bedeutung Dr. rer. nat. Katrin Huesker, IMD Berlin Metallquellen Atemluft Zahnersatz Lebensmittel Trinkwasser Eßgeschirr Kosmetik Endoprothesen
Akkumulation von Metallen im Gehirn? Pathomechanismen und klinische Bedeutung Dr. rer. nat. Katrin Huesker, IMD Berlin Metallquellen Atemluft Zahnersatz Lebensmittel Trinkwasser Eßgeschirr Kosmetik Endoprothesen
Christian Thoma: Schnelle Regulation durch Translationskontrolle
 Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/christian-thoma-schnelleregulation-durch-translationskontrolle/ Christian Thoma: Schnelle Regulation durch Translationskontrolle
Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/christian-thoma-schnelleregulation-durch-translationskontrolle/ Christian Thoma: Schnelle Regulation durch Translationskontrolle
Das Gehirn. Chemie Mechanik. Optik
 Hören Das Gehirn Chemie Mechanik Optik Hörbereich 20 20.000 Hz 10 3.000 Hz 20 35.000 Hz 1000 10.000 Hz 10 100.000 Hz 1000 100.000 Hz Hörbereich Menschliches Ohr: Wahrnehmbarer Frequenzbereich 16 Hz 20.000
Hören Das Gehirn Chemie Mechanik Optik Hörbereich 20 20.000 Hz 10 3.000 Hz 20 35.000 Hz 1000 10.000 Hz 10 100.000 Hz 1000 100.000 Hz Hörbereich Menschliches Ohr: Wahrnehmbarer Frequenzbereich 16 Hz 20.000
6.3 Phospholipide und Signaltransduktion. Allgemeines
 6.3 Phospholipide und Signaltransduktion Allgemeines Bei der Signaltransduktion, das heißt der Weiterleitung von Signalen über die Zellmembran in das Innere der Zelle, denkt man zuerst einmal vor allem
6.3 Phospholipide und Signaltransduktion Allgemeines Bei der Signaltransduktion, das heißt der Weiterleitung von Signalen über die Zellmembran in das Innere der Zelle, denkt man zuerst einmal vor allem
neurologische Grundlagen Version 1.3
 neurologische Grundlagen Version 1.3 ÜBERBLICK: Neurone, Synapsen, Neurotransmitter Neurologische Grundlagen Zentrale Vegetatives Peripheres Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn
neurologische Grundlagen Version 1.3 ÜBERBLICK: Neurone, Synapsen, Neurotransmitter Neurologische Grundlagen Zentrale Vegetatives Peripheres Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn
Übung 6 Vorlesung Bio-Engineering Sommersemester Nervenzellen: Kapitel 4. 1
 Bitte schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf das Übungsblatt. Falls Sie mehr Platz brauchen verweisen Sie auf Zusatzblätter. Vergessen Sie Ihren Namen nicht! Abgabe der Übung bis spätestens 21. 04. 08-16:30
Bitte schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf das Übungsblatt. Falls Sie mehr Platz brauchen verweisen Sie auf Zusatzblätter. Vergessen Sie Ihren Namen nicht! Abgabe der Übung bis spätestens 21. 04. 08-16:30
Synaptische Transmission
 Synaptische Transmission Wie lösen APe, die an den Endknöpfchen der Axone ankommen, die Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt aus (chemische Signalübertragung)? 5 wichtige Aspekte:
Synaptische Transmission Wie lösen APe, die an den Endknöpfchen der Axone ankommen, die Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt aus (chemische Signalübertragung)? 5 wichtige Aspekte:
Ca - Antagonisten. Ca-Kanal-Proteine
 Ca - Antagonisten Unter Ca-Antagonisten werden Arzneistoffe verstanden, die den Einstrom von Ca-Ionen in die Zelle durch die Ca-Kanäle verhindern. Sie werden auch als Ca-Kanal-Blocker bezeichnet. Die derzeit
Ca - Antagonisten Unter Ca-Antagonisten werden Arzneistoffe verstanden, die den Einstrom von Ca-Ionen in die Zelle durch die Ca-Kanäle verhindern. Sie werden auch als Ca-Kanal-Blocker bezeichnet. Die derzeit
2. In mindestens einer p53-wildtypzellinie (4197) ist das p53-protein durch Röntgenstrahlung induzierbar.
 1.1 ABSCHLUß-DISKUSSION Die Vorstellung, daß das funktionell aktive p53-wildtypprotein bei konstitutiver Expression nur sehr schwer nachgewiesen werden kann, ist sehr weit verbreitet und trifft unter bestimmten
1.1 ABSCHLUß-DISKUSSION Die Vorstellung, daß das funktionell aktive p53-wildtypprotein bei konstitutiver Expression nur sehr schwer nachgewiesen werden kann, ist sehr weit verbreitet und trifft unter bestimmten
1. Welche Auswirkungen auf die Expression des lac-operons haben die folgenden Mutationen:
 Übung 10 1. Welche Auswirkungen auf die Expression des lac-operons haben die folgenden Mutationen: a. Eine Mutation, die zur Expression eines Repressors führt, der nicht mehr an den Operator binden kann.
Übung 10 1. Welche Auswirkungen auf die Expression des lac-operons haben die folgenden Mutationen: a. Eine Mutation, die zur Expression eines Repressors führt, der nicht mehr an den Operator binden kann.
Zelltypen des Nervensystems
 Zelltypen des Nervensystems Im Gehirn eines erwachsenen Menschen: Neurone etwa 1-2. 10 10 Glia: Astrozyten (ca. 10x) Oligodendrozyten Mikrogliazellen Makrophagen Ependymzellen Nervenzellen Funktion: Informationsaustausch.
Zelltypen des Nervensystems Im Gehirn eines erwachsenen Menschen: Neurone etwa 1-2. 10 10 Glia: Astrozyten (ca. 10x) Oligodendrozyten Mikrogliazellen Makrophagen Ependymzellen Nervenzellen Funktion: Informationsaustausch.
Neurobiologie. Prof. Dr. Bernd Grünewald, Institut für Bienenkunde, FB Biowissenschaften
 Neurobiologie Prof. Dr. Bernd Grünewald, Institut für Bienenkunde, FB Biowissenschaften www.institut-fuer-bienenkunde.de b.gruenewald@bio.uni-frankfurt.de Synapsen II Die postsynaptische Membran - Synapsentypen
Neurobiologie Prof. Dr. Bernd Grünewald, Institut für Bienenkunde, FB Biowissenschaften www.institut-fuer-bienenkunde.de b.gruenewald@bio.uni-frankfurt.de Synapsen II Die postsynaptische Membran - Synapsentypen
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Theoretische Übungen SS 2016
 Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Theoretische Übungen SS 2016 Fragen für die Übungsstunde 4 (20.06. 24.06.) Regulation der Transkription II, Translation
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Theoretische Übungen SS 2016 Fragen für die Übungsstunde 4 (20.06. 24.06.) Regulation der Transkription II, Translation
neurologische Grundlagen Version 1.3
 neurologische Version 1.3 ÜBERBLICK: Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn Rückenmark PNS VNS Hirnnerven Sympathicus Spinalnerven Parasympathicus 1 ÜBERBLICK: Neurone = Nervenzellen
neurologische Version 1.3 ÜBERBLICK: Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn Rückenmark PNS VNS Hirnnerven Sympathicus Spinalnerven Parasympathicus 1 ÜBERBLICK: Neurone = Nervenzellen
Wie funktioniert Muskelaufbau? Eine Reise in die Welt des Muskels.
 Wie funktioniert Muskelaufbau? Eine Reise in die Welt des Muskels. Wie funktioniert Muskelaufbau? Wie funktioniert Muskelaufbau also wirklich. Immer wieder hört man Märchen wie zum Beispiel, dass Muskeln
Wie funktioniert Muskelaufbau? Eine Reise in die Welt des Muskels. Wie funktioniert Muskelaufbau? Wie funktioniert Muskelaufbau also wirklich. Immer wieder hört man Märchen wie zum Beispiel, dass Muskeln
Das Zytoskelett (Gastvorlesung R. Brandt, Neurobiologie)
 Das Zytoskelett (Gastvorlesung R. Brandt, Neurobiologie) Inhalt: 1. Struktur und Dynamik der zytoskeletalen Filamentsysteme 2. Regulation der zytoskeletalen Komponenten 3. Molekulare Motoren 4. Zytoskelett
Das Zytoskelett (Gastvorlesung R. Brandt, Neurobiologie) Inhalt: 1. Struktur und Dynamik der zytoskeletalen Filamentsysteme 2. Regulation der zytoskeletalen Komponenten 3. Molekulare Motoren 4. Zytoskelett
Hören WS 2009/2010. Hören. (und andere Sinne)
 WS 2009/2010 Hören (und andere Sinne) Hören Chemie Mechanik Optik Hörbereich 20 16.000 Hz 10 3.000 Hz 20 35.000 Hz 1000 10.000 Hz 10 100.000 Hz 1000 100.000 Hz Hörbereich Menschliches Ohr: Wahrnehmbarer
WS 2009/2010 Hören (und andere Sinne) Hören Chemie Mechanik Optik Hörbereich 20 16.000 Hz 10 3.000 Hz 20 35.000 Hz 1000 10.000 Hz 10 100.000 Hz 1000 100.000 Hz Hörbereich Menschliches Ohr: Wahrnehmbarer
Hendrik A. Wolff, Can M. Sag, Kay Neumann, Marie-Kristin Opiela, Margret Rave-Fränk, Clemens F. Hess, Lars S. Maier, Hans Christiansen
 Ionisierende Strahlung (IR) führt über Reactive Oxygen Species (ROS) und aktivierte CaMKinase II zu akuten Veränderungen im kardialen Calciumstoffwechsel und zu akuter Schädigung isolierter Kardiomyocyten
Ionisierende Strahlung (IR) führt über Reactive Oxygen Species (ROS) und aktivierte CaMKinase II zu akuten Veränderungen im kardialen Calciumstoffwechsel und zu akuter Schädigung isolierter Kardiomyocyten
Messung des Ruhepotentials einer Nervenzelle
 Messung des Ruhepotentials einer Nervenzelle 1 Extrazellulär Entstehung des Ruhepotentials K+ 4mM Na+ 120 mm Gegenion: Cl- K + kanal offen Na + -kanal zu Na + -K + Pumpe intrazellulär K+ 120 mm Na+ 5 mm
Messung des Ruhepotentials einer Nervenzelle 1 Extrazellulär Entstehung des Ruhepotentials K+ 4mM Na+ 120 mm Gegenion: Cl- K + kanal offen Na + -kanal zu Na + -K + Pumpe intrazellulär K+ 120 mm Na+ 5 mm
Transkription Teil 2. - Transkription bei Eukaryoten -
 Transkription Teil 2 - Transkription bei Eukaryoten - Inhalte: Unterschiede in der Transkription von Pro- und Eukaryoten Die RNA-Polymerasen der Eukaryoten Cis- und trans-aktive Elemente Promotoren Transkriptionsfaktoren
Transkription Teil 2 - Transkription bei Eukaryoten - Inhalte: Unterschiede in der Transkription von Pro- und Eukaryoten Die RNA-Polymerasen der Eukaryoten Cis- und trans-aktive Elemente Promotoren Transkriptionsfaktoren
Biopsychologie als Neurowissenschaft Evolutionäre Grundlagen Genetische Grundlagen Mikroanatomie des NS
 1 1 25.10.06 Biopsychologie als Neurowissenschaft 2 8.11.06 Evolutionäre Grundlagen 3 15.11.06 Genetische Grundlagen 4 22.11.06 Mikroanatomie des NS 5 29.11.06 Makroanatomie des NS: 6 06.12.06 Erregungsleitung
1 1 25.10.06 Biopsychologie als Neurowissenschaft 2 8.11.06 Evolutionäre Grundlagen 3 15.11.06 Genetische Grundlagen 4 22.11.06 Mikroanatomie des NS 5 29.11.06 Makroanatomie des NS: 6 06.12.06 Erregungsleitung
Übungsfragen zur Vorlesung "Grundlagen der Neurobiologie" (R. Brandt) 1. Aus welchen Geweben können adulte Stammzellen entnommen werden?
 Übungsfragen zur Vorlesung "Grundlagen der Neurobiologie" (R. Brandt) Stammzellen und neuronale Differenzierung Parkinson 1. Aus welchen Geweben können adulte Stammzellen entnommen werden? 2. Nennen Sie
Übungsfragen zur Vorlesung "Grundlagen der Neurobiologie" (R. Brandt) Stammzellen und neuronale Differenzierung Parkinson 1. Aus welchen Geweben können adulte Stammzellen entnommen werden? 2. Nennen Sie
Sympathikus. Parasympathikus. Supraspinale Kontrolle. Supraspinale Kontrolle Sympathikus. Parasympathikus. β1-rezeptor
 Supraspinale Kontrolle Supraspinale Kontrolle α1-rezeptor Noradrenalin und Adrenalin Synthese Abbau β1-rezeptor α2-rezeptor Wirkung: trophotrop Verlauf: v.a. im N. vagus 1. Neuron Transmitter: Acetylcholin
Supraspinale Kontrolle Supraspinale Kontrolle α1-rezeptor Noradrenalin und Adrenalin Synthese Abbau β1-rezeptor α2-rezeptor Wirkung: trophotrop Verlauf: v.a. im N. vagus 1. Neuron Transmitter: Acetylcholin
Transkription und Translation sind in Eukaryoten räumlich und zeitlich getrennt. Abb. aus Stryer (5th Ed.)
 Transkription und Translation sind in Eukaryoten räumlich und zeitlich getrennt Die Initiation der Translation bei Eukaryoten Der eukaryotische Initiationskomplex erkennt zuerst das 5 -cap der mrna und
Transkription und Translation sind in Eukaryoten räumlich und zeitlich getrennt Die Initiation der Translation bei Eukaryoten Der eukaryotische Initiationskomplex erkennt zuerst das 5 -cap der mrna und
Muskel Streckrezeptor. Mechanorezeption. primäre Sinneszelle. Reize: - Druck - Zug - Scherung
 Mechanorezeption Muskel Streckrezeptor Reize: - Druck - Zug - Scherung Wahrnehumg: - Fühlen - Hören - Körperstellung - Muskel- und Gewebespannung Rezeptoren: - mechanosensitive Dendriten - freie Nervenendigungen
Mechanorezeption Muskel Streckrezeptor Reize: - Druck - Zug - Scherung Wahrnehumg: - Fühlen - Hören - Körperstellung - Muskel- und Gewebespannung Rezeptoren: - mechanosensitive Dendriten - freie Nervenendigungen
Tinnitus Den Teufelskreis durchbrechen
 Tinnitus Den Teufelskreis durchbrechen Das Gehör Was ist Tinnitus? Teufelskreis Klangtherapie Behandlung Das menschliche Gehör Beim Gehör unterscheidet man zwischen dem peripheren und dem zentralen Hörsystem
Tinnitus Den Teufelskreis durchbrechen Das Gehör Was ist Tinnitus? Teufelskreis Klangtherapie Behandlung Das menschliche Gehör Beim Gehör unterscheidet man zwischen dem peripheren und dem zentralen Hörsystem
Schall: Longitudinalwelle periodischer Verdichtungen und Verdünnungen des Mediums
 Gehör Schall: Longitudinalwelle periodischer Verdichtungen und Verdünnungen des Mediums Schall Parameter von Schall Frequenz f Anzahl Schwingungen/sec [Hz] Schalldruck P (Pascal) Kraft /Fläche [N/m 2 ]
Gehör Schall: Longitudinalwelle periodischer Verdichtungen und Verdünnungen des Mediums Schall Parameter von Schall Frequenz f Anzahl Schwingungen/sec [Hz] Schalldruck P (Pascal) Kraft /Fläche [N/m 2 ]
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten
 Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Differentielle Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis-/trans-regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation stattfinden? Definition
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Differentielle Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis-/trans-regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation stattfinden? Definition
Biomechanisch ausgelöstes Remodeling im Herz-Kreislauf-System
 Gruppe Korff Diese Seite benötigt JavaScript für volle Funktionalität. Gruppenmitglieder Biomechanisch ausgelöstes Remodeling im Herz-Kreislauf-System Die Herz- und Kreislaufforschung gehört zu den am
Gruppe Korff Diese Seite benötigt JavaScript für volle Funktionalität. Gruppenmitglieder Biomechanisch ausgelöstes Remodeling im Herz-Kreislauf-System Die Herz- und Kreislaufforschung gehört zu den am
Membranpotential bei Neuronen
 Membranpotential bei Neuronen J. Almer 1 Ludwig-Thoma-Gymnasium 9. Juli 2012 J. Almer (Ludwig-Thoma-Gymnasium ) 9. Juli 2012 1 / 17 Gliederung 1 Aufbau der Neuronmembran 2 Ruhepotential bei Neuronen Diffusion
Membranpotential bei Neuronen J. Almer 1 Ludwig-Thoma-Gymnasium 9. Juli 2012 J. Almer (Ludwig-Thoma-Gymnasium ) 9. Juli 2012 1 / 17 Gliederung 1 Aufbau der Neuronmembran 2 Ruhepotential bei Neuronen Diffusion
Pathophysiologie des chronischen Schmerzes
 Pathophysiologie des chronischen Schmerzes H.O. H.O. Handwerker Pörtschach 25.06.2018 Berlin, 09.03.2018 90% der Patienten im organisierten Notdienst haben Rücken. Und davon 90% erwarten eine Spritze:
Pathophysiologie des chronischen Schmerzes H.O. H.O. Handwerker Pörtschach 25.06.2018 Berlin, 09.03.2018 90% der Patienten im organisierten Notdienst haben Rücken. Und davon 90% erwarten eine Spritze:
Testfragen zur 1. Vorlesung in Biochemie
 Testfragen zur 1. Vorlesung in Biochemie 1. Nennen Sie die zentralen Komponenten des Zwei-Komponenten-Systems 2. Auf welche Aminosäurereste werden die Phosphatgruppen übertragen? 3. Was wird bei der Chemotaxis
Testfragen zur 1. Vorlesung in Biochemie 1. Nennen Sie die zentralen Komponenten des Zwei-Komponenten-Systems 2. Auf welche Aminosäurereste werden die Phosphatgruppen übertragen? 3. Was wird bei der Chemotaxis
Fakten und Fragen zur Vorbereitung auf das Seminar Signaltransduktion
 Prof. Dr. KH. Friedrich, Institut für Biochemie II Fakten und Fragen zur Vorbereitung auf das Seminar Signaltransduktion Voraussetzung für einen produktiven und allseits erfreulichen Ablauf des Seminars
Prof. Dr. KH. Friedrich, Institut für Biochemie II Fakten und Fragen zur Vorbereitung auf das Seminar Signaltransduktion Voraussetzung für einen produktiven und allseits erfreulichen Ablauf des Seminars
Glutamat und Neurotoxizität
 Glutamat und Neurotoxizität Elizaveta Polishchuk; Lea Vohwinkel Januar 2016 Inhalt 1. Welche Glutamat-Rezeptoren gibt es im Gehirn? 2. Wie sind die Rezeptoren aufgebaut? 3. Funktion der Glutamatrezeptoren
Glutamat und Neurotoxizität Elizaveta Polishchuk; Lea Vohwinkel Januar 2016 Inhalt 1. Welche Glutamat-Rezeptoren gibt es im Gehirn? 2. Wie sind die Rezeptoren aufgebaut? 3. Funktion der Glutamatrezeptoren
Herz/Kreislauf V Kreislaufregulation
 Herz/Kreislauf V Kreislaufregulation Kreislaufregulation Stellgrößen für die Kreislaufregulation 'Fördervolumen' der 'Pumpe' : HMV = SV HF Gesamtwiderstand des 'Röhrensystems' Verhältnis der Teilwiderstände
Herz/Kreislauf V Kreislaufregulation Kreislaufregulation Stellgrößen für die Kreislaufregulation 'Fördervolumen' der 'Pumpe' : HMV = SV HF Gesamtwiderstand des 'Röhrensystems' Verhältnis der Teilwiderstände
Thematik der molekularen Zellbiologie Studienjahr 2004/05. I. Semester
 Thematik der molekularen Zellbiologie Studienjahr 2004/05 (Abkürzungen: V. = 45 Min. Vorlesung, S. = 45 Min. Seminar, ds. = doppeltes, 2 x 45 Min. Seminar, Ü. = 90 Min. Übung) I. Semester 1. Woche: d 1.
Thematik der molekularen Zellbiologie Studienjahr 2004/05 (Abkürzungen: V. = 45 Min. Vorlesung, S. = 45 Min. Seminar, ds. = doppeltes, 2 x 45 Min. Seminar, Ü. = 90 Min. Übung) I. Semester 1. Woche: d 1.
In den Proteinen der Lebewesen treten in der Regel 20 verschiedene Aminosäuren auf. Deren Reihenfolge muss in der Nucleotidsequenz der mrna und damit
 In den Proteinen der Lebewesen treten in der Regel 20 verschiedene Aminosäuren auf. Deren Reihenfolge muss in der Nucleotidsequenz der mrna und damit in der Nucleotidsequenz der DNA verschlüsselt (codiert)
In den Proteinen der Lebewesen treten in der Regel 20 verschiedene Aminosäuren auf. Deren Reihenfolge muss in der Nucleotidsequenz der mrna und damit in der Nucleotidsequenz der DNA verschlüsselt (codiert)
Hyperforin aktiviert TRP-Kanäle - ein neuer antidepressiver. Wirkmechanismus? Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften
 Hyperforin aktiviert TRP-Kanäle - ein neuer antidepressiver Wirkmechanismus? Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften Vorgelegt beim Fachbereich Biochemie, Chemie und Pharmazie
Hyperforin aktiviert TRP-Kanäle - ein neuer antidepressiver Wirkmechanismus? Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften Vorgelegt beim Fachbereich Biochemie, Chemie und Pharmazie
Kenntnis des Hörorgans (Corti-Organ) mit dem knöchernen und dem häutigen Labyrinth, den schneckenartigen Windungen und dem Ganglion spirale.
 Präparatedetails Organ Herkunft Färbung COCHLEA MEERSCHWEINCHEN HÄMALAUN CHROMOTROP Methode Wegen der vielen knöchernen Strukturen musste dieses Präparat vor dem Schneiden entmineralisiert werden (dies
Präparatedetails Organ Herkunft Färbung COCHLEA MEERSCHWEINCHEN HÄMALAUN CHROMOTROP Methode Wegen der vielen knöchernen Strukturen musste dieses Präparat vor dem Schneiden entmineralisiert werden (dies
Verlauf der Blutzuckerkonzentration nach der Mahlzeit. Thinkstock /istockphoto. Konzentration. Thinkstock /istockphoto VORANSICHT.
 S 6 Art der Mahlzeit Verlauf der Blutzuckerkonzentration nach der Mahlzeit Abbildung 1 Graph 1 Abbildung 2 Graph 2 Abbildung 3 www.colourbox.de Graph 3 Die verschiedenen Mahlzeiten lassen den Blutzuckerspiegel
S 6 Art der Mahlzeit Verlauf der Blutzuckerkonzentration nach der Mahlzeit Abbildung 1 Graph 1 Abbildung 2 Graph 2 Abbildung 3 www.colourbox.de Graph 3 Die verschiedenen Mahlzeiten lassen den Blutzuckerspiegel
Zusammenfassung. Abkürzungsverzeichnis
 Zusammenfassung Abkürzungsverzeichnis I IX 1. Einleitung 1 1.1. Glutamatrezeptoren.............................. 1 1.1.1. Modularer Aufbau von ionotropen Glutamatrezeptoren....... 3 1.1.2. AMPA-Rezeptoren...........................
Zusammenfassung Abkürzungsverzeichnis I IX 1. Einleitung 1 1.1. Glutamatrezeptoren.............................. 1 1.1.1. Modularer Aufbau von ionotropen Glutamatrezeptoren....... 3 1.1.2. AMPA-Rezeptoren...........................
Inhalt Genexpression Microarrays E-Northern
 Inhalt Genexpression Microarrays E-Northern Genexpression Übersicht Definition Proteinbiosynthese Ablauf Transkription Translation Transport Expressionskontrolle Genexpression: Definition Realisierung
Inhalt Genexpression Microarrays E-Northern Genexpression Übersicht Definition Proteinbiosynthese Ablauf Transkription Translation Transport Expressionskontrolle Genexpression: Definition Realisierung
Gluconeognese Neusynthese von Glucose aus Pyruvat
 Gluconeognese Neusynthese von Glucose aus Pyruvat Warum notwendig? Das Gehirn ist auf eine konstante Versorgung mit Glucose angewiesen. Eine Unterzuckerung (< 3 4 mmol/l) führt unweigerlich zur Bewußtlosigkeit
Gluconeognese Neusynthese von Glucose aus Pyruvat Warum notwendig? Das Gehirn ist auf eine konstante Versorgung mit Glucose angewiesen. Eine Unterzuckerung (< 3 4 mmol/l) führt unweigerlich zur Bewußtlosigkeit
M 3. Informationsübermittlung im Körper. D i e N e r v e n z e l l e a l s B a s i s e i n h e i t. im Überblick
 M 3 Informationsübermittlung im Körper D i e N e r v e n z e l l e a l s B a s i s e i n h e i t im Überblick Beabeablog 2010 N e r v e n z e l l e n ( = Neurone ) sind auf die Weiterleitung von Informationen
M 3 Informationsübermittlung im Körper D i e N e r v e n z e l l e a l s B a s i s e i n h e i t im Überblick Beabeablog 2010 N e r v e n z e l l e n ( = Neurone ) sind auf die Weiterleitung von Informationen
Hypothetisches Modell
 Hypothetisches Modell Das Heutige Paper Inhalt: SCF bindet Auxin direkt TIR1 ist ein Auxin Rezeptor Auxin bindet direkt an TIR1, es sind keine zusätzlichen Komponenten nötig Methode Normales Pull down
Hypothetisches Modell Das Heutige Paper Inhalt: SCF bindet Auxin direkt TIR1 ist ein Auxin Rezeptor Auxin bindet direkt an TIR1, es sind keine zusätzlichen Komponenten nötig Methode Normales Pull down
