Durchflusszytometrische Bestimmung der Farbstoffausbreitung über Gap-Junction-Kanäle
|
|
|
- Busso Albert
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Durchflusszytometrische Bestimmung der Farbstoffausbreitung über Gap-Junction-Kanäle Studienarbeit vorgelegt von Gunnar Schulz Biologisches Institut der Universität Stuttgart Abteilung Biophysik Prof. Dr. D.F. Hülser Stuttgart 1999
2 Diese Arbeit wurde von mir selbständig und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln angefertigt.
3 1 Einleitung 5 2 Material und Methoden Zellkultur Zell-Linien Zellkultur Zellzahlbestimmung Ansetzen der Monolayerkulturen Kopplungsansatz Fluoreszenzfarbstoffe Färben der Donorzellen Kopplungsansatz Probenvorbereitung Fotografische Dokumentation 10 3 Theorie zur Durchflusszytometrie Einleitung Aufbau des FACStar-Plus Kalibrierung Fokussierung Reinigung des FACStar Plus 14 4 Ergebnisse Mikroskopische Betrachtung der Calceinausbreitung Durchflusszytometrische Messung der Calceinausbreitung Vergleich der Messungen mit 1 und 2 Lasern Auswertung Zusammenfassung der Kopplungsraten Homo- und heterospezifische Kopplung Homospezifisch-heterotypische Kopplung 21 5 Diskussion 22 6 Literatur 26 7 Anhang Mikroskope IM Axiophot Zusammensetzung verwendeter Medien und Lösungen Eagels Minimum Essential Medium, Dulbecco`s Modification (DMEM) Eagels Minimum Essential Medium, Dulbecco`s Modification mit wenig Glucose RPMI-Medium Phoshatgepufferte Lösung (PBS) Trypsin Lösung 29 Danksagung 3
4 Abkürzungen: BP Bandpass CASY1 Cell Analyser System c r Cx dest. DiI DMEM DMSO ECACC FACS FSC FKS FL1 FL2 FL3.2 Kopplungsrate Connexin destilliert 1,1 -dioctadecyl-3,3,3,3 - tetramethylindocarbocyanine perchlorate Eagels Minimum Essential Medium, Dulbecco's Modifikation Dimethylsulfoxid European collection of animal cell culture Fluorescence activated cell sorter, Durchflusszytometer Forward Scatter, Detektor für gebeugtes Licht Fötales Kälberserum Fluoreszenzkanal 1 des Durchflusszytometers Fluoreszenzkanal 2 des Durchflusszytometers Fluoreszenzkanal 3.2 des Durchflusszytometers g Erdbeschleunigung, ca. 9,81m/s 2 kd Kilodalton mm millimolar NKS Neugeborenen Kälberserum nm Nanometer PBS - phosphatgepufferte Lösung PBS phosphatgepufferte Lösung mit Magnesium und Calcium SSC Side Scatter, Detektor für seitlich gestreutes Licht 4
5 Einleitung 1 Einleitung Gap-Junction-Kanäle verbinden benachbarte Vertebraten-Zellen und ermöglichen den interzellulären Transfer von geladenen und ungeladenen Molekülen bis zu einem Molekulargewicht von 1 kd. Ein Gap-Junction-Kanal ist aus zwei Halbkanälen (Connexonen) aufgebaut, die ihrerseits aus 6 ringförmig angeordneten Proteinuntereinheiten, den Connexinen bestehen. Je nach Gewebe und Spezies kommen verschiedene Connexine vor. Sie werden mit Cx und ihrem jeweiligen Molekulargewicht in kd bezeichnet. Zur Zeit sind etwa 20 unterschiedliche Connexine bekannt [1-4]. Die Existenz funktioneller Gap-Junction-Kanäle kann mit Fluoreszenzfarbstoffen untersucht werden (z.b. Lucifer Yellow). Dabei wird der Farbstoff durch eine Glasmikroelektrode in eine Zelle injiziert und die Kopplung durch Auszählen der gefärbten Zellen im Mikroskop bestimmt [5, 6]. Die Ergebnisse dieser Methode variieren, z.b. mit dem Grad der Zell-Schädigung durch die Injektion. Eine genauere Methode zur Quantifizierung der Zell-Zell Kopplung ist die Farbstoff-Beladungs-Technik mit Calcein AM [7]. Calcein AM ist ein membranpermeables Molekül, das im Inneren einer intakten Zelle durch unspezifische Esterasen hydrolisiert wird. Calcein kann nicht mehr frei durch die Membran diffundieren, aber durch Gap-Junction-Kanäle von Zelle zu Zelle gelangen. Gibt man die farbstoffbeladenen Donorzellen auf einen Monolayer ungefärbter Rezipientenzellen, kann man bei gut gekoppelten Zellen im Mikroskop schon nach Minuten die Farbstoffausbreitung beobachten. Um die Farbstoffpermeabilität zu quantifizieren, müssen Donorzellen und gefärbte Rezipientenzellen gezählt werden. Wie bei der Injektionsmethode variiert das Ergebnis mit der Qualität der mikroskopischen Ausrüstung, der Auswahl des gefärbten Areals auf dem Monolayer und der Unterscheidung zwischen gefärbten und nicht gefärbten Zellen. Ein weiterer Nachteil des Auszählens am Mikroskop ist der große Arbeitsaufwand. In dieser Arbeit wurde die Farbstoff-Beladungstechnik mit der Fluoreszenz aktivierten Durchflusszytometrie gekoppelt [8]. Durch die große Anzahl der untersuchten Zellen eines Ansatzes ermöglicht diese Methode eine verbesserte Auflösung gegenüber der Injektionsmethode. Es wurden die Kopplungsraten c r verschiedener Ansätze mit 6 Zell-Linien untersucht. Die Kopplungsrate ist die Anzahl gefärbter Rezipientenzellen pro eingesetzter Donorzelle. Es hat sich gezeigt, daß die Kopplung nicht nur vom Connexintyp (homo- und heterotypischer Kontakt), sondern auch von zellspezifischen Faktoren, wie z.b. der Connexinmenge und der Beweglichkeit der Zellen, abhängt (homo- und heterospezifischer Kontakt). 5
6 Materialien und Methoden 2 Material und Methoden 2.1 Zellkultur Zell-Linien Für meine Untersuchungen verwendete ich folgende permanent wachsende Zell-Linien. BICR/M1R k -Zellen (ECACC # ) wurde 1969 als permanent wachsende in vitro Kultur aus Zellen eines Brusttumors der Marshall Ratte etabliert [9]. HeLa-Zellen (ECACC # ) sind epitheloid wachsend, stammen aus einem menschlichen Gebärmutterhalskrebs (Cervixcarzinom) und wurden 1951 erstmals in Kultur gebracht [10]. HeLa Cx40-Zellen sind Connexin 40 tranzfizierte HeLa-Zellen [11]. HeLa Cx43-17-Zellen sind Zellen der HeLa Zell-Linie, die stabil mit Connexin 43 transfiziert wurden [12]. SV40-3T3-Zellen (SV40-3T3, Art.-Nr.: , ICN Biomedicals, Meckenheim, Deutschland) sind virustransformierte, embryonale Mausfibroblasten [13]. RIN Cx43-Zellen sind Zellen eines transplantierten Tumors in den Langerhansschen Inseln des Pankreas einer Ratte, die 1980 in Kultur gebracht [14] und 1995 stabil mit Connexin 43 transfiziert wurden [15] Zellkultur Alle Kultivierungsarbeiten sowie die Aussaat der Zellen in Petrischalen erfolgten unter sterilen Bedingungen in einer Sicherheitsarbeitsbank (LF-MRF 06.18, Prettl Laminarflow Prozesstechnik, Bempflingen, Deutschland). Alle Glasgeräte wurden für 1,5 Stunden bei 180 C im Wärmeschrank sterilisiert. Die Zellen wurden als Monolayerkulturen in Schräghalsflaschen (Cellstar Gewebekulturflaschen, 250 ml, 75 cm 2, Art.-Nr.: , Greiner, Nürtingen, Deutschland) in einem befeuchteten und begasten Brutschrank (B 5060 EK/CO 2, Heraeus, Hanau, Deutschland) bei 37 C, 100% relativer Luftfeuchtigkeit und 8% CO 2 -Gehalt kultiviert. BICR/M1R k, HeLa, HeLa Cx40 und HeLa Cx43-17 wurden in Eagels Minimum Essential Medium, Dulbecco`s Modification (DMEM, Art.-Nr.: T043-10, Biochrom, Berlin, Deutschland, Zusammensetzung siehe Anhang), SV40-3T3 in DMEM mit wenig Glucose (DMEM Low Glucose, Art.-Nr.: , Life Technologie, Karlsruhe, Deutschland, Zusammensetzung siehe Anhang) und RIN Cx43 in RPMI-Medium (RPMI 1640, Art.-Nr.: T121-10, Biochrom, Zusammensetzung siehe Anhang) kultiviert. Alle Medien wurden vor ihrer Verwendung steril filtriert. Den Medien für die BICR/M1R k und HeLa Zellen wurden je 6
7 Materialien und Methoden 10% Neugeborenen Kälberserum (NKS, Art.-Nr.: S0125, Biochrom), denen der anderen Zell- Linien jeweils 10% Fötales Kälberserum (FKS, Art.-Nr.: S0115, Biochrom) zugesetzt. Als Selektionsfaktor wurde den Medien der transfizierten Zell-Linien HeLa Cx43-17 und RIN Cx43 Geneticin (Art.-Nr.: G-9516, Sigma, Steinheim, Deutschland; RIN Cx µg/ml, Hela Cx µg/ml) und HeLa Cx40 1 µg/ml Puromycin (Art.-Nr.: P-8833, Sigma, Steinheim, Deutschland) zugesetzt. Alle Medien wurden mit Streptomycin (Art.-Nr.: 35500, Serva) und Penicillin G (Art.-Nr.: P-7794, Sigma) versetzt, um Bakteriumwachstum zu vermeiden. Alle Zell-Linien wurden 2 mal pro Woche umgesetzt. Dazu wurden sie mit PBS - gewaschen und mit 0,25%igem Trypsin (Art.-Nr.: 37290, Serva) vom Flaschenboden gelöst, in frischem Medium aufgenommen und in neue Flaschen überführt Zellzahlbestimmung Zur Zellzahlbestimmung wurde ein Cell Analyser System (CASY1, Schärfe-System, Reutlingen, Deutschland) verwendet, das nach dem Coulter Prinzip funktioniert [16]. Der Porendurchmesser der Kapillare betrug 80 µm. Es wurden je 100 µl der trypsinierten, in PBS, bzw. Medium aufgenommenen Zellen zu 19,9 ml isotonischer Lösung gegeben (Isoton II, Art.-Nr.: , Coulter, Krefeld, Deutschland). Davon wurden je dreimal 400 µl am CASY1 gemessen. Der Coulter Counter bietet die Möglichkeit eine Mindestgröße für gemessene Partikel festzulegen. Alle Teilchen, die unterhalb dieser Grenze liegen, werden als Schmutz gewertet und nicht in die Zählung einbezogen. Das CASY1 stellt das Ergebnis der Messung als Größenverteilung am Computer dar. Anhand des Diagramms wird sowohl eine Größenunter-, als auch eine Größenobergrenze festgelegt. Die Abtrennung von Schmutz und Zelldebris wird somit genauer. Des Weiteren bietet das Diagramm eine schnelle Vitalitätskontrolle [17] Ansetzen der Monolayerkulturen Für alle Untersuchungen wurden die Zellen am Vortag in Petrischälchen (Art.-Nr.: , Nunclon Surface, 60x15mm, Nalge Nunc International, Wiesbaden, Deutschland) eingesät. Dazu wurden die Zellen einer oder mehrere Kulturflaschen mit PBS - gewaschen, trypsiniert und im jeweiligen Medium aufgenommen. Die angestrebte Zellzahl am Versuchstag entsprach etwa einem konfluenten Monolayer (Tab.1). 7
8 Materialien und Methoden Tabelle 1: Anzahl der Zellen pro Petrischälchen am Versuchstag (N V ) und der am Vortag eingesäten Zellen (N S ) verschiedener Zell-Linien Zell-Linie N S N V MICR/M1R k 8(10 5 2(10 6 HeLa Cx ,8(10 6 2,4(10 6 3T3 1(10 6 3,2(10 6 RIN Cx43 5,5( (10 6 HeLa 1,8(10 6 2,4( Kopplungsansatz Fluoreszenzfarbstoffe Calcein AM (Art.-Nr.: C-3099, Molecular Probes, Eugene, USA) wird durch unspezifische Esterasen zum Fluoreszenzfarbstoff Calcein gespalten. Sein Absorptionsmaximum liegt bei 494 nm, sein Emissionsmaximum bei 517 nm. O O O O (CH3COCH2OCCH2)2N N(CH2COCH2OCCH3)2 O O O CH2 CH2 O (HOCCH2)2NCH2 CH2N(CH2COH)2 CH3CO O OCCH3 Spaltung durch HO O O O unspez. Esterasen O C OH O Calcein AM C 46 H 46 N 2 O 23, MW: Da Calcein C 30 H 26 N 2 O 13,MW: Da Abb. 1: Chemische Formel von Calcein AM und dessen Spaltung zu Calcein. 8
9 Materialien und Methoden DiI (1,1 -dioctadecyl-3,3,3,3 - tetramethylindocarbocyanine perchlorate, Art.-Nr.: D-282, Molecular Probes) lagert sich mit seinen langen Kohlenwasserstoffketten in der Plasmamembran ein. Sein Absorptionsmaximum liegt bei 549 nm, sein Emissionsmaximum bei 565 nm. H3C CH3 H3C CH3 CH CHCH N + (CH2)17 ClO4 - N (CH2)17 CH3 CH3 DiI C 59 H 97 ClN 2 O 4, MW: Da Abb. 2: Chemische Formel von DiI Färben der Donorzellen Für die Färbung wurden die Zellen mit Trypsin vereinzelt und in Medium aufgenommen. Nach einer 10 minütigen Zentrifugation bei 500g wurde der Überstand abgezogen und das Zellpellet in 2 ml Färbelösung (268 mm Glucose, 5 µm Calcein AM und 9 µm DiI in dest. H 2 O) je Schälchen resuspendiert. Während der 30 minütigen Inkubation im Brutschrank bei 37 C wurden die Zellen alle 5 Minuten mit einer Pasteurpipette suspendiert. Anschließend wurde die Lösung 10 Minuten bei 500g zentrifugiert, der Überstand abgenommen und das Zell-Pellet in ca. 5 ml PBS gewaschen. Dieser Waschschritt wurde einmal wiederholt, das Zellpellet anschließend in Medium aufgenommen und die Zellzahl am CASY1 bestimmt Kopplungsansatz Vor jedem Kopplungsansatz wurde ein Schälchen mit Rezipientenzellen ausgezählt. Die Donorzellen wurden im Verhältnis 1:50 (Donor:Rezipient) auf den Rezipientenmonolayer gegeben. Dabei wurden die Donorzellen auf dem Monolayer durch Schwenken der Schälchen gleichmäßig verteilen. Es wurden jeweils drei identische Kopplungsansätze mit 3 Stunden Kontaktzeit durchgeführt. 9
10 Materialien und Methoden Probenvorbereitung Nach der 3 stündigen Inkubation wurden die Schälchen zur Kontrolle unter einem inversen Mikroskop mit Fluoreszenzausstattung betrachtet (IM 35, Zeiss, Oberkochen, Deutschland; Filter und Objektive siehe Anhang). Anschließend wurden die Zellen mit PBS - gewaschen, trypsiniert und in 2,5 ml Medium aufgenommen. Zusätzlich zu den Kopplungsansätzen wurde immer ein Schälchen mit unbehandelten Rezipientenzellen trypsiniert. Aus jedem Ansatz wurde 1ml in ein FACS-Röhrchen (5 ml Polysteryene Round-Bottom Tube, Becton Dickinson, Heidelberg, Deutschland) überführt, mit 1 ml PBS verdünnt und im Durchflusszytometer gemessen (FACStar Plus TM, Art.-Nr.: 90111B, 1987, Becton Dickinson) Fotografische Dokumentation Zur fotografischen Dokumentation wurden die Zellen im Schälchen auf einem Deckglas kultiviert und der Kopplungsansatz wie beschrieben durchgeführt. Nach der Inkubation wurden die Deckgläser vorsichtig mit PBS gespült und auf einen Objektträger gelegt. Für die Aufnahmen wurde ein Mikroskop mit Fluoreszenzausstattung verwendet (Axiophot, Zeiss, Objektive und Filter siehe Anhang). 10
11 Theorie zur Durchflusszytometrie 3 Theorie zur Durchflusszytometrie 3.1 Einleitung Im Durchflusszytometer können flüssige Proben auf verschiedene Parameter gleichzeitig untersucht werden. Auf den Probenstrom sind 1 oder mehrere Laser fokussiert. Trifft das Laserlicht auf ein Partikel im Probenstrom, z.b. eine Zelle, wird es gestreut, von Fluoreszenzfarbstoffen absorbiert und als Licht niedrigerer Wellenlänge emittiert. Die Veränderungen des Anregungslichtes werden von verschiedenen Photomultipliern erfasst und aufgezeichnet [18]. Das verwendete FACStar-Plus ermöglicht die Erfassung von 6 Parametern eines Partikels gleichzeitig, z.b. der Größe, Granularität und mehrerer Fluoreszenzen. Durch die hohe Messgeschwindigkeit (bis 400 Partikel pro Sekunde) können sehr viele Teilchen einer Probe in kurzer Zeit gemessen werden. Die Auswertung der Daten wird durch Computer mit spezieller Software erleichtert. 3.2 Aufbau des FACStar-Plus Das Anregungslicht des FACStar-Plus wird von zwei wassergekühlten Lasern geliefert (Laser 1: 488 nm, Model.-Nr.: ENTCII-621BD, 1999; Laser 2: 513 nm, Model.-Nr.: Innova 90, 1986, Coherent, Santa Clara, USA). Die Photodiode des Forward Scatters (FSC) detektiert die Größe und Oberflächenbeschaffenheit des gemessenen Partikels. Der Photomultiplier des Side Scatters (SSC) registriert gestreutes Licht im 90 Winkel zum Anregungslicht. Das Signal lässt Schlüsse über die innere Beschaffenheit (Granularität, Komplexität) des gemessenen Partikels zu. Die 4 Photomultiplier zur Erfassung von Fluoreszenzen sind wie der SSC im 90 Winkel zum Anregungslicht angeordnet. Die Multiplier FL1 und FL2 erfassen Signale des Anregungslichtes von Laser 1 (488 nm), FL3.2 und FL4 von Laser 2 (513 nm). Je nach Emissionswellenlänge der verwendeten Fluoreszenzfarbstoffe können geeignete Filter vor die Photomultiplier gesetzt werden. Alle Daten werden auf einem Power Macintosh Computer 7300 (Apple Computer, Cupertino, Kalifornien, USA) aufgezeichnet und mit spezieller Software ausgewertet (Cell Quest Version 3.1 für Apple System, 1997, Becton Dickinson und Attractors Version 3.0 für Apple System, 1996, Becton Dickinson). 11
12 Theorie zur Durchflusszytometrie FL1 BP 530/30 FL2 BP 630/22 DM/SP 580 DM/LP 640 Linse FL4 -Halbspiegel BP 630/22 FL3.2 SSC 488/10 Strahlteiler 8/92 FSC BP 488/10 Graufilter Objektiv Linsen Laser nm Laser nm Zellen Spiegel Abb. 3: Strahlengang des FACStar Plus, incl. aller verwendeten Filter 12
13 Theorie zur Durchflusszytometrie 3.3 Kalibrierung Am Anfang jeden Messtages ist eine Feinkalibrierung nötig, um die Laser exakt auf den Probenstrom zu fokussieren. Es wurden fluoreszierende Plexiglaskügelchen genormter Größe (CaliBRITE Beads, Art.-Nr.: , Becton Dickinson) im Durchflusszytometer gemessen und die Signale anhand verschiedener Histogramme ideal eingestellt. 3.4 Fokussierung Während einer Messung wird die Proben mit einem Überdruck aus dem FACS-Röhrchen durch eine Düse (Öffnungsdurchmesser 70 µm) gedrückt. Der entstehende Probenstrom wird von einem Hüllstrom aus isotonischer Lösung (FACS Flow, Art.-Nr.: , Becton Dickinson) umflossen und dadurch stabilisiert. Der Probendruck entscheidet über den Durchmesser des Probenstroms. Er sollte so gewählt werden, dass der Probenstrom gerade so breit ist wie der Durchmesser der zu messenden Zellen. Nur so kann erreicht werden, dass sich die Zellen hintereinander aufreihen und ideal vom Anregungslicht getroffen werden (Abb.4). Für Probenkonzentrationen von Zellen pro ml liegt die ideale Durchflussrate bei etwa 400 Partikeln pro Sekunde. Düse Düse Hüllstrom Probenstrom Zellen idealer Probendruck zu hoher Probendruck gut fokussiert schlecht fokussiert Abb. 4: Darstellung des Probenstroms bei idealem und zu hohem Probendruck. 13
14 Theorie zur Durchflusszytometrie 3.5 Reinigung des FACStar Plus Vor jedem Probenwechsel muß das Durchflusszytometer mit FACS Flow gespült werden bis die Durchflussrate nahe null ist. Auf diese Weise wird das Vermischen der Proben verhindert. Nach Beenden der Messungen ist eine gründliche Reinigung wichtig, da sich im System Nischen befinden, in denen sich Material ansammeln kann. Werden die Nischen nicht gereinigt, können von dort ausgespülten Partikel folgende Messungen beeinflussen oder es können sich größere Klumpen lösen, die die Düse verstopfen. Für die Reinigung hat sich das abwechselnde Spülen mit FACS Flow und FACS Rinse (Art.-Nr.: , Becton Dickinson) am besten bewährt. 14
15 Ergebnisse 4 Ergebnisse 4.1 Mikroskopische Betrachtung der Calceinausbreitung Der lipophile Fluoreszenzfarbstoff DiI färbt die Zellmembran der Donorzellen rot. Das membranpermeable, nicht fluoreszierende Calcein AM wird im Inneren intakter Zellen durch unspezifische Esterase zum grün fluoreszierenden Calcein gespalten. Calcein ist membranimpermeabel, kann aber durch Gap-Junction-Kanäle von Zelle zu Zelle gelangen. Donorzellen sind sowohl rot, als auch grün gefärbt, gekoppelte Zellen fluoreszieren nur grün. Dies ist für die gut koppelnden BCIR/M1R k nach 2 Stunden Kontaktzeit gezeigt (Abb.5 A-C). Die Farbstoffausbreitung beschränkt sich nicht auf die Zellen mit direktem Kontakt zur Donorzelle, auch weiter entfernte Zellen des Monolayers weisen eine grüne Färbung auf. Dabei sind zunächst die Rezipientenzellen mit direktem Kontakt zur Donorzelle sehr intensiv gefärbt, die weiter entfernten nur schwach. Nach vielen Stunden Kontaktzeit ist dieser Intensitäts- Gradient nicht mehr erkennbar. Die kopplungsdefizienten HeLa zeigten keine Farbstoffausbreitung (Abb.5 D-F), auch nach 5 Stunden Kontaktzeit sind nur die intensiv fluoreszierenden Donorzellen erkennbar. A B C D E F Abb. 5: Farbstoffausbreitung in BICR/M1R k und HeLa Zellen. (A-C) BICR/M1R k Zellen. (A) Phasenkontrast. (B) Fluoreszenzbild derselben Region. Calceinausbreitung nach 2 Stunden Kontaktzeit. (C) Fluoreszenzbild der DiI gefärbten Donorzelle. (D-F) HeLa Zellen. (D) Phasenkontrast. (E) Fluoreszenzbild derselben Region. Keine Farbstoffausbreitung nach 3 Stunden Kontaktzeit erkennbar. (F) Fluoreszenzbild der DiI gefärbten Donorzellen. 15
16 Ergebnisse 4.2 Durchflusszytometrische Messung der Calceinausbreitung Vergleich der Messungen mit 1 und 2 Lasern Die Abb.6A zeigt das Ergebnis einer Messung von ungefärbten Zellen, die direkt vor der Messung mit doppelt gefärbten Donorzellen gemischt wurden. Im Diagramm sind FL1 (grüne Fluoreszenz = Calcein Signal) und FL2 (rote Fluoreszenz = DiI Signal) abgetragen. Die Ansammlung von Punkten (Punktwolke) in der linken unteren Ecke des Diagramms zeigt die Eigenfluoreszenz der ungefärbten Zellen, die obere rechte Punktwolke die grüne und rote Fluoreszenz der Donorzellen. In Abb.6B+C erkennt man zwischen diesen beiden Punktwolken eine dritte Population, die der grün fluoreszierenden gekoppelten Zellen. Zwischen Messungen mit 1 Laser (Abb.6B) und 2 Laser Anregung (Abb.6C) kann man deutliche Unterschiede in der Form der Punktwolken erkennen. Dabei stimmen die Punktwolken der ungefärbten Zellen weitgehend überein. Bei den Donorzellen in Abb.6B ist die Population rundlich und aufgrund unterschiedlichen Calceinverlustes bei der Kopplung horizontal gestreut. Die Unterpopulation der gekoppelten Zellen mit 1 Laser Anregung verläuft flach und diagonal, die mit 2 Laser Anregung breit und horizontal, erst bei höheren Calceinkonzentrationen leicht diagonal. Die Trennung zwischen ungefärbten und gekoppelten Zellen mit wenig Calcein, sowie die Identifizierung der Donorzellen fällt bei Messungen mit zwei Lasern leichter. Dies ist für die Auswertung relevant (siehe 4.2.2). 16
17 Ergebnisse FL A FL1 FL 2 (DiI) 10 4 B FL 3.2 (DiI) 10 4 C FL1 (Calcein) Abb. 6: (A) Messung ungefärbter und doppelt gefärbter BICR/M1R k -Zellen, die direkt vor der Messung gemischt wurden. (B-C) Vergleich zwischen 1 Laser Anregung und 2 Laser Anregung. (B) Diagramm FL1 gegen FL2 in Cell Quest einer Kopplungsmessung mit HeLa Cx43-17 Donorzellen und 3T3 als Rezipientenzellen, gemessen mit 1 Laser Anregung, 3h Kontaktzeit, c r =15. (C) Diagramm FL1 gegen FL3.2 derselben Messung, gemessen mit 2 Laser Anregung, c r =13. 17
18 Ergebnisse Auswertung Die Auswertungssoftware Cell Quest bietet die Möglichkeit alle gemessenen Partikel als Punkte in verschiedenen Diagrammen darzustellen. Für die Auswertung meiner Messungen ließ ich alle gemessenen Partikel in einem Punktdiagramm (FSC gegen SSC) darstellen (Abb.7A+8A). SSC 10 4 A Partikel 200 B R FL 3.2 (DiI) 10 4 C FSC D FSC 10 3 R R2 R2 R FL1 (Calcein) Abb. 7: Darstellungen der Cell Quest Auswertung anhand einer Kopplungsmessung mit BICR/M1R k -Zellen (2 Laser Anregung). (A) Darstellung aller Messereignisse im Diagramm FSC gegen SSC. (B) Histogramm zur Größenverteilung aller gemessenen Partikel. (C) Ergebnis der Messung ungefärbter Zellen. (D) Ergebnis einer Kopplungsmessung, 3h Kontaktzeit, c r =26. 18
19 Ergebnisse Um Schmutzpartikel und Zelldebris von der Auswertung auszuschließen, wurden alle Punkte, deren Größe und Granularität der von Zellen entsprachen, mit einer elektronischen Umrandung (Gate) versehen. Dabei half die im Histogramm (Abb.7B) dargestellte Größenverteilung der gemessenen Partikel bei der Festlegung der Grenzen. Im weiteren Punktdiagramm (FL1 gegen FL2/FL3.2) wurden nur die umrandeten Punkte dargestellt (Abb.7C+D). Die drei Unterpopulationen (siehe 4.2.1) wurden mit Gates markiert. Um die Abtrennung der ungefärbten Zellen von den schwach gekoppelten Zellen besser zu trennen, wurden zu jeder Messreihe ungefärbte Rezipientenzellen gemessen, die resultierende Punktwolke im Diagramm FL1 gegen FL2/FL3.2 umrandet (Abb.7C) und bei der Auswertung der Kopplungsansätze als Gate für ungefärbte Zellen verwendet. Die Anzahl der Punkte innerhalb der Gates wurde automatisch gezählt und daraus die Kopplungsrate berechnet. Das Auswertungsprogramm Attractors funktioniert ähnlich wie Cell Quest (Abb.8). Die Gates werden Attractor genannt und besitzen eine einheitliche Grundform. Die Position eines Attractor wird automatisch auf den Ereignisschwerpunkt einer Punktwolken festgelegt. Eine Vorlage mit Attractoren für jede Unterpopulation wurde erstellt und für alle Auswertungen verwendet. 19
20 Ergebnisse SSC 10 4 A Partikel B FSC FSC FL 3.2 (DiI) 10 4 C FL 3.2 (DiI) 10 4 D FL1 (Calcein) FL1 (Calcein) Abb. 8: Darstellungen der Attractors Auswertung anhand einer Kopplungsmessung mit BICR/M1R k Zellen (2 Laser Anregung). (A) Darstellung aller Messereignisse im Diagramm FSC gegen SSC. (B) Histogramm zur Größenverteilung aller gemessenen Partikel. (C) Ergebnis der Messung ungefärbter Zellen. (D) Ergebnis einer Kopplungsmessung, 3h Kontaktzeit, c r =26. 20
21 Ergebnisse Zusammenfassung der Kopplungsraten Die Kopplungsrate c r kann mit dem Durchflusszytometer sehr effizient bestimmt werden, weil die Messung vieler Zellen in kurzer Zeit möglich ist. Die Kopplungsrate kann von vielen Faktoren beeinflußt werden, z.b. den Eigenschaften der Zell-Linien (homo-, bzw. heterospezifische Kopplung), dem Connexintyp (homo-,bzw. heterotypische Kopplung), der Zelldichte des Monolayers und der Kontaktzeit der Donorzellen auf dem Monolayer (dynamische und statische Kopplung). Die Kopplungsraten sind in den Tabelle 2 zusammengefasst. Tabelle 2: Kopplungsraten der Messungen mit zwei Lasern. Donor Rezipient BICR/M1R k HeLa Cx43-17 SV40-3T3 RIN Cx43 BICR/M1R k HeLa Cx SV40-3T RIN Cx Homo- und heterospezifische Kopplung Bei den homospezifischen Ansätzen erreichten BICR/M1R k die höchste Kopplungsrate, gefolgt von HeLa Cx43-17, SV40-3T3 und RIN Cx43. Die Kopplungsraten der heterospezifischen Ansätze lagen bis auf eine Ausnahme niedriger als die der homospezifischen (siehe Tabelle 2) Homospezifisch-heterotypische Kopplung Die Messung der Farbstoffausbreitung zwischen HeLa Cx40 und HeLa Cx43-17 ergab eine geringe Kopplungsrate von c r =6. Das Ergebnis zeigt das verbesserte Auflösungsvermögen der vorgestellten Methode gegenüber älteren Methoden mit denen für diese Zell-Linien keine Kopplung nachgewiesen werden konnte. 21
22 Diskussion 5 Diskussion Die Untersuchung der Farbstoffausbreitung über Gap-Junction-Kanäle ist bereits lange etabliert [5, 6]. Bei der Injektion des Farbstoffes mit einer Glasmikroelektrode können die Zellen verletzt werden und die Membran undicht werden. Die Messungen sind aufwendig, weil jede Donorzelle einzeln angestochen werden muß und gekoppelten Zellen nur am Mikroskop gezählt werden können. Die Glasmikroelektroden können in ihrer Qualität variieren und leicht instabil werden. Zur Quantifizierung der Zell-Zell-Kopplung ist die Farbstoffinjektion aufgrund des hohen Zeitaufwandes und der unkonstanten Bedingungen nicht geeignet. Die Farbstoffbeladungstechnik in Kombination mit der Durchflusszytometrie [7, 8, 19] bietet entscheidende Verbesserungen der Kopplungsmessung. Die Donorzellen werden ohne Schaden zu nehmen mit einem Überschuss an Calcein beladen und auf den Rezipientenmonolayer gebracht. Nach der Kontaktzeit werden mit dem Durchflusszytometer pro Ansatz Zellen, darunter etwa 1000 Donorzellen, bewertet. Die große Zahl der gemessenen Zellen, die konstanten Versuchsbedingungen und die Sensibilität der durchflusszytometrischen Messung ermöglichen eine verbesserte Auflösung gegenüber den älteren Methoden. Der eindeutige Nachweis einer Kopplung zwischen HeLa Cx40 und HeLa Cx43-17 zeigt das Auflösungsvermögen der Methode am deutlichsten. Weder mit Farbstoffinjektionen, noch mit Elektrophysiologie konnte für diese Zellen eine deutliche Kopplung nachgewiesen werden [20]. Bei der Auswertung der Messdaten bereitet die Identifikation der Donorzellen keine Schwierigkeiten. Die Trennung zwischen ungefärbten und schwach Calcein gefärbten Zellen hingegen ist schwieriger, weil die Grenze zwischen ihnen fließend verläuft. Kleine Verschiebungen der Gates haben aufgrund der hohen Ereignisdichte an dieser Stelle eine große Auswirkung auf das Ergebnis. Mit der Cell Quest Software können die Gates nur manuell nach dem Ermessen des Experimentators plaziert werden. Die Auswertung gleicher Rohdaten kann so leicht zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Mit der Attractors Software kann die Auswertung standardisiert und vom Experimentator unabhängiger gemacht werden. Voraussetzung dafür ist eine einheitliche Auswertungsvorlage, die durch geringe Veränderungen an jede Messung angepasst werden kann. Die Kopplungsraten mit 1 und 2 Lasern Anregung unterscheiden sich kaum. Erst die Verteilung der Messpunkte im Diagramm FL1 gegen FL2/FL3.2 (Abb.6) zeigt die Unterschiede der Messungen deutlich. Bei Anregung mit einem Laser (488 nm) wird DiI nicht ideal angeregt, die Emission, besonders im langwelligen Bereich, ist sehr schwach. Um ein ausreichend starkes DiI Signal zu erhalten, muß die Photomultiplierverstärkung erhöht werden. Da 22
23 Diskussion Calcein bei 488 nm ideal angeregt wird, emittiert es über ein breites Wellenlängenspektrum und überlagert teilweise das DiI Signal. Durch die hohe Photomultiplierspannung wird das Signal so verstärkt, daß die Punktwolke der gefärbten Rezipientenzellen im Diagramm FL1 gegen FL2 (Abb.6B) nicht axial verläuft, wie man es bei zunehmender Grünfluoreszenz erwarten würde, sondern diagonal. Verlieren die Donorzellen bei der Kopplung Calcein, wandert die entsprechende Punktwolke diagonal in Richtung Nullpunkt, obwohl keine rote Fluoreszenz verloren geht. Bei Verwendung längerwelliger Filter an Photomultiplier FL2 wurde das DiI Signal sehr viel schwächer, bei kürzerwelligen Filtern wurde die Überlagerung des Calcein Signal dominant. Die Anregung mit dem zweiten Laser (517 nm) führte zur klareren Ergebnissen. Die DiI Emission im längerwelligen Bereich wurde durch die für den Farbstoff idealere Anregung stärker, der Einfluss des überlagerten Calcein Signals entsprechend geringer (Abb.6C). Betrachtet man Abb.6C, fällt die rundliche Form der Donorzellpopulation mit ihrer Calceinverlust bedingten axialen Streuung auf. Die Population der gekoppelten Zellen verläuft zunächst weitgehend axial, erst bei großer Calceinkonzentration überlagert das Signal den DiI Kanal. Es könnte sich dabei um Quench Effekte handeln [18]. Obwohl sich die Kopplungsraten zwischen der Anregung mit einem und zwei Lasern kaum unterscheiden, können die Unterpopulationen mit zwei Laser Anregung deutlicher voneinander getrennt werden. Die Höhe der Kopplungsrate hängt von Connenxintyp und menge, sowie von verschiedenen zellspezifischen Faktoren ab. Homospezifische Ansätze führen zu den höchsten Kopplungsraten. BICR/M1R k -Zellen koppeln von allen untersuchten Zellen, wohl aufgrund der großen Anzahl ihrer Kanäle, am besten [21]. Des Weiteren können Donorzellen mit ihren langen Ausläufern auch weit entfernt liegende Zellen des Rezipientenmonolayers erreichen. Die Zellen eines HeLa Cx43-17 Monolayers wachsen dicht aneinander, wie Steine einer Mauer. Die Kopplung wird durch die große Kontaktfläche begünstigt. Da die Zellen keine Ausläufer bilden, wird die Kopplungsrate der BICR/M1R k nicht ganz erreicht [21, 22]. SV40-3T3 Zellen bilden kleinere Ausläufer als BICR/M1R k und besitzen nicht die große Kontaktfläche der HeLa Cx Ihre Kopplungsrate liegt niedriger als die der beiden anderen Zell-Linien. Die Zellen der RIN Cx43 Zell-Linie sind im Vergleich zu den anderen untersuchten Zellen sehr klein. Sie wachsen oft in isolierten Zellhaufen, selten als konfluenter Monolayer. So können viele Donorzellen keine Kontakte aufbauen, weil sie in zellfreien Lücken liegen. BICR/M1R k Zellen eignen sich aufgrund ihrer Größe und Beweglichkeit besonders gut als Donorzellen, so koppeln sie mit HeLa Cx43-17 und SV40-3T3 nur geringfügig weniger als beim homospezifischen Ansatz. Die großen BICR/M1R k Zellen enthalten genug Calcein, um 23
24 Diskussion viele der kleinen RIN Cx43 zu füllen. Mit ihren langen Ausläufern können sie als Donorzellen auch Lücken im Monolayer RIN Cx43 überwinden und Kontakte herstellen. Aus diesen Gründen ist die Kopplungsrate sogar viel höher als bei dem homospezifischen Ansatz der RIN Cx43 Zellen. HeLa Cx43-17 Donorzellen sind kleiner als BICR/M1R k Zellen und erreichen mit ihnen eine deutlich kleinere Kopplungsrate als der homospezifische Ansatz. Mit SV40-3T3 Zellen als Rezipient ergibt sich eine geringfügig kleinere Kopplungsrate als bei dem homospezifischen Ansatz. Trotz der Größe der HeLa Cx43-17 Zellen ist die Kopplungsrate mit RIN Cx43 sehr klein. Da HeLa Cx43-17 Zellen nach 3 Stunden keine Ausläufer bilden, können nur Zellen koppeln, die direkten Kontakt zu einem RIN Cx43 Zellhaufen haben. SV40-3T3 Zellen können aufgrund ihrer geringeren Größe BICR/M1R k und HeLa Cx43-17 Rezipienten weniger stark anfärben, als dies für die jeweiligen homospezifischen Ansätze der Fall ist. RIN Cx43 Zellen eignen sich für die verwendeten Rezipientenzellen nicht als Donorzellen, da sie zu wenig Calcein aufnehmen können, um eine Farbstoffausbreitung nachzuweisen. Eine Kopplung zwischen unterschiedlichen Zell-Linien mit Cx40 oder Cx43 (heterospezifisch-heterotypische Kopplung) konnte bisher nicht nachgewiesen werden [23]. Mit Farbstoffinjektionen konnte auch für HeLa Cx40 und HeLa Cx43 keine Kopplung gezeigt werden [22]. Erst die Untersuchung mit der vorgestellten Methode hat eine deutliche Farbstoffausbreitung zwischen den beiden unterschiedlich transfizierten HeLa-Zellen gezeigt. Für die Kopplung dieses homospezifisch-heterotypischen Ansatzes müssen folglich andere Faktoren eine Rolle spielen. Denkbar wäre, daß die Zellen durch zellspezifische Adhesionsmoleküle enge Kontakte knüpfen und die Ausbildung von heterotypischen Kanälen möglich wird. Eine andere Möglichkeit wäre, daß durch die Transfektionen endogenes Cx45 zur Expression gebracht wurde und dieses für eine geringe Kopplung ausreicht. Die Kopplungsmessungen haben gezeigt, daß neben Connexintyp und menge auch zellspezifische Faktoren bei der Ausbildung von Kontakten zwischen Zellen eine Rolle spielen müssen. Die Beweglichkeit der Donorzellen, die Eigenschaften des Rezipientenmonolayers und die Oberflächenbeschaffenheit der Zellen sind dabei die wichtigsten Merkmale. Wie frühere Kopplungsmessungen mit unterschiedlichen Kontaktzeiten gezeigt haben, ist es möglich mit dem Durchflusszytometer zwischen dynamischer und statischer Kopplung zu unterscheiden [23]. Bei jedem erfolgreichen Kopplungsansatz ist nach etwas einer Stunde eine Farbstoffausbreitung messbar. In den folgenden Stunden steigt die Kopplungsrate linear an, je nach Zell-Linie schneller oder langsamer (dynamische Kopplung), um schließlich eine Sättigung zu erreichen (statische Kopplung). 24
25 Diskussion Bei Messungen ungefärbter Zellen am Durchflusszytometer fiel auf, daß zu Beginn der Messung die Eigenfluoreszenz zunahm. Die entsprechende Punktwolke wanderte diagonal nach oben, um sich dort nach etwa 2 Minuten zu stabilisieren. Die verschiedenen Zell-Linien zeigten diesen Effekt in unterschiedlicher Intensität, wobei BICR/M1R k -Zellen am stärksten reagierten. Bei Kopplungsansätzen wurde der gleiche Effekt beobachtet. Die Punktwolke der ungefärbten Zellen dehnte sich während der Messung in der Diagonalen aus, ähnlich den gekoppelten Zellen bei 1 Laser Anregung. Bei Messungen mit 2 Lasern kann ausgeschlossen werden, daß derart streuende Zellen als gekoppelt bewertet werden, bei 1 Laser Anregung kann es dagegen zu Ergebnisveränderungen kommen. Da der Anteil der gestreuten Zellen an der Gesamtpopulation etwa 3 Prozent betrug, können die erhöhten Kopplungsraten der 1 Laser Anregung wohl auf die irrtümliche Einbeziehung der gestreuten Zellen in die Population der gekoppelten Zellen zurückgeführt werden. Trotz diverser Versuche konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden, welche Ursache dieses Phänomen hat. Die Annahme, daß sich das Zellvolumen im Verlauf der Messung verändert konnte nicht bestätigt werden. 25
26 Literatur 6 Literatur 1. Kumar, N. M., and Gilula, N. B. (1992) Molecular biology and genetics of gap junction channels. Sem. Cell Biol. 3, Kumar, N. M., and Gilula, N. B. (1996) The gap junction communication channel. Cell 84, Goodenough, D. A., Goliger, J. A., and Paul, D. L. (1996) Connexins, connexons, and intercellular communication. Annu. Rev. Biochem. 65, Simon, A. M., and Goodenough, D. A. (1998) Diverse functions of vertebrate gap junctions. Trends Cell Biol. 8, Stewart, W. W. (1978) Functional connections between cells as revealed by dye-coupling with a highly fluorescent naphthalimide tracer. Cell 14, Stewart, W. W. (1981) Lucifer dyes-highly fluorescent dyes for biological tracing. Nature 292, Goldberg, G. S., Bechberger, J. F., and Naus, C. C. (1995) A pre-loading method of evaluating gap junctional communication by fluorescent dye transfer. BioTechniques 18, Kiang, D. T., Kollander, R., Lin, H. H., LaVilla, S., and Atkinson, M. M. (1994) Measurement of gap junctional communication by fluorescence activated cell sorting. In Vitro Cellular & Developmental Biology 30A, Rajewsky, M. F., and Grüneisen, A. (1972) Cell proliferation in transplanted rat tumors: influence of the host immune system. Eur. J. Immunol. 2, Gey, G. O. (1952) Tissue culture studies of the proliferative capacity of cervical carcinoma and normal epithelium. Cancer Res. 12, Hennemann, H., Suchyna, T., Lichtenberg-Fraté, H., Jungbluth, S., Dahl, E., Schwarz, J., Nicholson, B. J., and Willecke, K. (1992) Molecular cloning and functional expression of mouse connexin40, a second gap junction gene preferentially expressed in lung. J. Cell Biol. 117, Traub, O., Eckert, R., Lichtenberg-Frate, H., Elfgang, C., Bastide, B., Scheidtmann, K. H., Hülser, D. F., and Willecke, K. (1994) Immunochemical and electrophysiological characterization of murine connexin40 and -43 in mouse tissues and transfected human cells. Eur. J. Cell Biol. 64, Todaro, G. J., and Green, H. (1963) Quantitative studies of the growth of mouse embryo cells in culture and their development into established cell lines. J. Cell Biol. 17, Gazdar, A. F., Chick, W. L., Oie, H. K., Sims, H. L., King, D. L., Weir, G. C., and Lauris, V. (1980) Continuous, clonal, insulin- and somatostatin-secreting cell lines established from a transplantable rat islet cell tumor. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 77, Vozzi, C., Ullrich, S., Charollais, A., Philippe, J., Orci, L., and Meda, P. (1995) Adequate connexinmediated coupling is required for proper insulin production. J. Cell Biol. 131, Coulter, W. H. (1956) High speed automatic blood cell counter and cell size analyzer. Proc. Natl. Electr. Conf. 12, Glauner, B. (1991) Vitalitätskontrolle in der Zellkulturtechnik. BioTec 5, Shapiro, H. M. (1988) Practical Flow Cytometry 2nd Edition. Alan R. Liss-Inc. New York. 19. Tomasetto, C., Neveu, M. J., Daley, J., Horan, P. K., and Sager, R. (1993) Specificity of gap junction communication among human mammary cells and connexin transfectants in culture. J. Cell Biol. 122, Haubrich, S., Schwarz, H. J., Bukauskas, F., Lichtenberg-Fraté, H., Traub, O., Weingart, R., and Willecke, K. (1996) Incompatibility of connexin 40 and 43 hemichannels in gap junctions between mammalian cells is determined by intracellular domains. Mol. Biol. Cell 7, Brümmer, F., Zempel, G., Bühle, P., Stein, J. C., and Hülser, D. F. (1991) Retinoic acid modulates gap junctional permeability: a comparative study of dye spreading and ionic coupling in cultured cells. Exp. Cell Res. 196, Elfgang, C., Eckert, R., Lichtenberg-Fraté, H., Butterweck, A., Traub, O., Klein, R. A., Hülser, D. F., and Willecke, K. (1995) Specific permeability and selective formation of gap junction channels in connexin-transfected HeLa cells. J. Cell Biol. 129, Czyz, J., Irmer, U., Schulz, G., Mindermann, A., and Hülser, D. F. (1999) Gap Junctional Coupling Measured by Flow Cytometry. Exp. Cell Res.. 26
27 Anhang 7 Anhang 7.1 Mikroskope IM 35 Anregungslicht: HBO 100 Calcein: Anregungsfilter: BP nm, Farbteiler: 510 nm, Sperrfilter: LP 520 nm DiI: Anregungsfilter: BP nm, Farbteiler: 580 nm, Sperrfilter: LP 590 nm Objektiv: 20x Neofluar Ph 2, Zeiss, Oberkochen, Deutschland Axiophot Anregungslicht: HBO 50 Calcein: Anregungsfilter: BP nm, Farbteiler: 510 nm, Sperrfilter: LP 520 nm DiI: Anregungsfilter: BP 546 nm, Farbteiler: 580 nm, Sperrfilter: LP 590 nm Objektive: 20x Plan-Apochromat, Hellfeld; 20x Plan-Neofluar, Ph 2; 40x Plan-Neofluar Ph 3, Imm. Korr., Zeiss, Oberkochen Film: Ektachrom 400, Art.-Nr , Eastman Kodak Company, Rochester, New York, USA 7.2 Zusammensetzung verwendeter Medien und Lösungen Eagels Minimum Essential Medium, Dulbecco`s Modification (DMEM) Komponenten mg/ml Komponenten mg/ml NaCl 6400 L-Lysin HCl 146 KCl 400 L-Methionin 30 CaCl L-Phenylalanin 66 MgSO 4 (7 H 2 O 200 L-Serin 42 NaH 2 PO 4 (7 H 2 O 124 L-Threonin 95 D(+)-Glucose 4500 L-Tryptophan 16 Fe(NO 3 )3(9 H 2 O 0,1 L-Tyrosin 72 Phenolrot 15 L-Valin 94 NaHCO Choline chloride 4 L-Arginin(HCl 84 Folsäure 4 L-Cystein 48 i-inositol 7,2 L-Glutamin 580 Nicotinamid 4 Glycin 30 D-Ca pantothenat 4 L-Histidin HCl(H 2 O 42 Pyridoxal HCl 4 L-Isoleucin 105 Riboflavin 0,4 L-Leucin 105 Thiamin HCl 4 27
28 Anhang Eagels Minimum Essential Medium, Dulbecco`s Modification mit wenig Glucose Komponenten mg/ml Komponenten mg/ml NaCl 6400 L-Methionin 30 KCl 400 L-Phenylalanin 66 CaCl 2 (anhydr.) 200 L-Serin 42 MgSO 4 (anhydr.) 97,67 L-Threonin 95 NaH 2 PO 4 (H 2 O L-Tyrosin 16 D(+)-Glucose 1000 L-Tryptophan Fe(NO 3 )(9 H 2 O 0,1 (Di-Natrium-Salz) 104,18 Phenolrot 15 L-Valin 94 L-Arginin(HCl 84 Choline chloride 4 L-Cystein(HCl 62,77 Folsäure 4 L-Glutamin 584 i-inositol 7,2 Glycin 30 Nikotinamid 4 L-Histidin HCl(H 2 O 42 D-Ca pantothenat 4 L-Isoleucin 105 Pyridoxine HCl 4 L-Leucin 105 Riboflavin 0,4 L-Lysin HCl 146 Thiamin HCl RPMI-Medium Komponenten mg/ml Komponenten mg/ml NaCl 6000 L-Methionin 15 KCl 400 L-Phenylalanin 15 Ca(NO 3 ) 2 (4 H 2 O 100 L-Prolin 20 MgSO 4 (7 H 2 O 100 L-Serin 30 NaH 2 PO 4 (7 H 2 O 1512 L-Threonin 20 D(+)-Glucose 2000 L-Tryptophan 5 Phenolrot 5 L-Tyrosin 20 NaHCO L-Valin 20 L-Arginin 200 Glutathion 1 L-Asparagin 50 Biotin 0,2 L-Asparaginsäure 20 Vitamin BB12 0,005 L-Cystein 50 D-Ca-Pantothenat 0,25 L-Glutamin 300 Cholinchlorid 3 L-Glutaminsäure 20 Folsäure 1 Glycin 10 i-inositol 35 L-Histidin 15 Nicotinamid 1 L-HydroxiProlin 20 p-aminobenzoesäure 1 L-Isoleucin 50 Pyridoxin(HCl 1 L-Leucin 50 Riboflavin 0,2 L-Lysin(HCl 40 Thiamin(HCl 1 28
29 Anhang Phoshatgepufferte Lösung (PBS) Komponente mg/ml NaCl 8 KCl 0,2 Na 2 HPO 4 (2 H 2 O 1,15 KH 2 PO 4 0,2 MgCl 2 (6 H 2 O 0,1 CaCl 2 (2 H 2 O 0, Trypsin Lösung Komponente mg/ml Na 2 -EDTA (Triplex III) 0,2 NaCl 0,8 KCl 0,2 Na 2 HPO 4 (2 H 2 O 1,15 KH 2 PO 4 0,2 Streptomycin Sulfat (723 U/mg) 0,1 Penicillin G (1536 U/mg) 0,06 Trypsin 2,5 (1:250, 4U/mg) 29
30 Danksagung: An dieser Stelle möchte ich Herrn Prof. Dr. D.F. Hülser für die persönliche Betreuung und Förderung dieser Arbeit danken. Herrn Dr. Irmer danke ich besonders für seine Unterstützung am FACS, sowie den vielen hilfreichen Diskussionen und Anregungen. Den Mitarbeitern der Abteilung Biophysik danke ich für die allzeit nette Arbeitsatmosphäre. Bei meinen Eltern Elke und Jürgen Schulz möchte ich mich neben der Bereitstellung ihrer Erbanlagen auch für die großzügige finanzielle Unterstützung bedanken. 30
Zoom-Mikroskop ZM. Das universell einsetzbare Zoom-Mikroskop
 Zoom-Mikroskop ZM Das universell einsetzbare Zoom-Mikroskop Die Vorteile im Überblick Zoom-Mikroskop ZM Mikroskopkörper Kernstück des ZM ist ein Mikroskopkörper mit dem Zoom-Faktor 5 : 1 bei einem Abbildungsmaßstab
Zoom-Mikroskop ZM Das universell einsetzbare Zoom-Mikroskop Die Vorteile im Überblick Zoom-Mikroskop ZM Mikroskopkörper Kernstück des ZM ist ein Mikroskopkörper mit dem Zoom-Faktor 5 : 1 bei einem Abbildungsmaßstab
Übung 5 : G = Wärmeflussdichte [Watt/m 2 ] c = spezifische Wärmekapazität k = Wärmeleitfähigkeit = *p*c = Wärmediffusität
![Übung 5 : G = Wärmeflussdichte [Watt/m 2 ] c = spezifische Wärmekapazität k = Wärmeleitfähigkeit = *p*c = Wärmediffusität Übung 5 : G = Wärmeflussdichte [Watt/m 2 ] c = spezifische Wärmekapazität k = Wärmeleitfähigkeit = *p*c = Wärmediffusität](/thumbs/26/9283097.jpg) Übung 5 : Theorie : In einem Boden finden immer Temperaturausgleichsprozesse statt. Der Wärmestrom läßt sich in eine vertikale und horizontale Komponente einteilen. Wir betrachten hier den Wärmestrom in
Übung 5 : Theorie : In einem Boden finden immer Temperaturausgleichsprozesse statt. Der Wärmestrom läßt sich in eine vertikale und horizontale Komponente einteilen. Wir betrachten hier den Wärmestrom in
Professionelle Seminare im Bereich MS-Office
 Der Name BEREICH.VERSCHIEBEN() ist etwas unglücklich gewählt. Man kann mit der Funktion Bereiche zwar verschieben, man kann Bereiche aber auch verkleinern oder vergrößern. Besser wäre es, die Funktion
Der Name BEREICH.VERSCHIEBEN() ist etwas unglücklich gewählt. Man kann mit der Funktion Bereiche zwar verschieben, man kann Bereiche aber auch verkleinern oder vergrößern. Besser wäre es, die Funktion
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren
 Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
2 Physikalische Eigenschaften von Fettsäuren: Löslichkeit, Dissoziationsverhalten, Phasenzustände
 2 Physikalische Eigenschaften von Fettsäuren: Löslichkeit, Dissoziationsverhalten, Phasenzustände Als Fettsäuren wird die Gruppe aliphatischer Monocarbonsäuren bezeichnet. Der Name Fettsäuren geht darauf
2 Physikalische Eigenschaften von Fettsäuren: Löslichkeit, Dissoziationsverhalten, Phasenzustände Als Fettsäuren wird die Gruppe aliphatischer Monocarbonsäuren bezeichnet. Der Name Fettsäuren geht darauf
APP-GFP/Fluoreszenzmikroskop. Aufnahmen neuronaler Zellen, mit freund. Genehmigung von Prof. Stefan Kins, TU Kaiserslautern
 Über die Herkunft von Aβ42 und Amyloid-Plaques Heute ist sicher belegt, dass sich die amyloiden Plaques aus einer Vielzahl an Abbaufragmenten des Amyloid-Vorläufer-Proteins (amyloid-precursor-protein,
Über die Herkunft von Aβ42 und Amyloid-Plaques Heute ist sicher belegt, dass sich die amyloiden Plaques aus einer Vielzahl an Abbaufragmenten des Amyloid-Vorläufer-Proteins (amyloid-precursor-protein,
1.1 Auflösungsvermögen von Spektralapparaten
 Physikalisches Praktikum für Anfänger - Teil Gruppe Optik. Auflösungsvermögen von Spektralapparaten Einleitung - Motivation Die Untersuchung der Lichtemission bzw. Lichtabsorption von Molekülen und Atomen
Physikalisches Praktikum für Anfänger - Teil Gruppe Optik. Auflösungsvermögen von Spektralapparaten Einleitung - Motivation Die Untersuchung der Lichtemission bzw. Lichtabsorption von Molekülen und Atomen
Anleitung über den Umgang mit Schildern
 Anleitung über den Umgang mit Schildern -Vorwort -Wo bekommt man Schilder? -Wo und wie speichert man die Schilder? -Wie füge ich die Schilder in meinen Track ein? -Welche Bauteile kann man noch für Schilder
Anleitung über den Umgang mit Schildern -Vorwort -Wo bekommt man Schilder? -Wo und wie speichert man die Schilder? -Wie füge ich die Schilder in meinen Track ein? -Welche Bauteile kann man noch für Schilder
40-Tage-Wunder- Kurs. Umarme, was Du nicht ändern kannst.
 40-Tage-Wunder- Kurs Umarme, was Du nicht ändern kannst. Das sagt Wikipedia: Als Wunder (griechisch thauma) gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann, so dass
40-Tage-Wunder- Kurs Umarme, was Du nicht ändern kannst. Das sagt Wikipedia: Als Wunder (griechisch thauma) gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann, so dass
Abbildung durch eine Lochblende
 Abbildung durch eine Lochblende Stand: 26.08.2015 Jahrgangsstufen 7 Fach/Fächer Benötigtes Material Natur und Technik/ Schwerpunkt Physik Projektor mit F, für jeden Schüler eine Lochblende und einen Transparentschirm
Abbildung durch eine Lochblende Stand: 26.08.2015 Jahrgangsstufen 7 Fach/Fächer Benötigtes Material Natur und Technik/ Schwerpunkt Physik Projektor mit F, für jeden Schüler eine Lochblende und einen Transparentschirm
Analyse komplexer Proben mit multidimensionaler (Heart-Cut) GC-GCMS und LC-GCMS
 Analyse komplexer Proben mit multidimensionaler (Heart-Cut) GC-GCMS und LC-GCMS Dr. Margit Geißler, Susanne Böhme Shimadzu Europa GmbH, Duisburg info@shimadzu.de www.shimadzu.de Das Problem von Co-Elutionen
Analyse komplexer Proben mit multidimensionaler (Heart-Cut) GC-GCMS und LC-GCMS Dr. Margit Geißler, Susanne Böhme Shimadzu Europa GmbH, Duisburg info@shimadzu.de www.shimadzu.de Das Problem von Co-Elutionen
Und was uns betrifft, da erfinden wir uns einfach gegenseitig.
 Freier Fall 1 Der einzige Mensch Der einzige Mensch bin ich Der einzige Mensch bin ich an deem ich versuchen kann zu beobachten wie es geht wenn man sich in ihn hineinversetzt. Ich bin der einzige Mensch
Freier Fall 1 Der einzige Mensch Der einzige Mensch bin ich Der einzige Mensch bin ich an deem ich versuchen kann zu beobachten wie es geht wenn man sich in ihn hineinversetzt. Ich bin der einzige Mensch
ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht BREMERHAVEN. Der Zauberwürfel-Roboter. Paul Giese. Schule: Wilhelm-Raabe-Schule
 ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht BREMERHAVEN Der Zauberwürfel-Roboter Paul Giese Schule: Wilhelm-Raabe-Schule Jugend forscht 2013 Kurzfassung Regionalwettbewerb Bremerhaven
ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht BREMERHAVEN Der Zauberwürfel-Roboter Paul Giese Schule: Wilhelm-Raabe-Schule Jugend forscht 2013 Kurzfassung Regionalwettbewerb Bremerhaven
Handbuch ECDL 2003 Basic Modul 5: Datenbank Grundlagen von relationalen Datenbanken
 Handbuch ECDL 2003 Basic Modul 5: Datenbank Grundlagen von relationalen Datenbanken Dateiname: ecdl5_01_00_documentation_standard.doc Speicherdatum: 14.02.2005 ECDL 2003 Basic Modul 5 Datenbank - Grundlagen
Handbuch ECDL 2003 Basic Modul 5: Datenbank Grundlagen von relationalen Datenbanken Dateiname: ecdl5_01_00_documentation_standard.doc Speicherdatum: 14.02.2005 ECDL 2003 Basic Modul 5 Datenbank - Grundlagen
Das große ElterngeldPlus 1x1. Alles über das ElterngeldPlus. Wer kann ElterngeldPlus beantragen? ElterngeldPlus verstehen ein paar einleitende Fakten
 Das große x -4 Alles über das Wer kann beantragen? Generell kann jeder beantragen! Eltern (Mütter UND Väter), die schon während ihrer Elternzeit wieder in Teilzeit arbeiten möchten. Eltern, die während
Das große x -4 Alles über das Wer kann beantragen? Generell kann jeder beantragen! Eltern (Mütter UND Väter), die schon während ihrer Elternzeit wieder in Teilzeit arbeiten möchten. Eltern, die während
IDEA-Systemregale Concorde-Stauräume
 IDEA-Systemregale Concorde-Stauräume Die Anforderungen und Wünsche für ein Regal im Wohnmobilstauraum sind sehr unterschiedlich. Manche unserer Kritiker glauben auch nicht dass das IDEA-Systemregal flexibel
IDEA-Systemregale Concorde-Stauräume Die Anforderungen und Wünsche für ein Regal im Wohnmobilstauraum sind sehr unterschiedlich. Manche unserer Kritiker glauben auch nicht dass das IDEA-Systemregal flexibel
Praktikum Physik. Protokoll zum Versuch: Geometrische Optik. Durchgeführt am 24.11.2011
 Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Geometrische Optik Durchgeführt am 24.11.2011 Gruppe X Name1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuerin: Wir bestätigen hiermit, dass wir das
Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Geometrische Optik Durchgeführt am 24.11.2011 Gruppe X Name1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuerin: Wir bestätigen hiermit, dass wir das
Bei Einbeziehung in die Pensionskasse haben Sie die Möglichkeit, sich für eines von zwei Modellen zu entscheiden.
 Modellwahl Bei Einbeziehung in die Pensionskasse haben Sie die Möglichkeit, sich für eines von zwei Modellen zu entscheiden. Beispiel des Pensionsverlaufs der beiden Modelle Modell 1 Modell 2 Modell 1
Modellwahl Bei Einbeziehung in die Pensionskasse haben Sie die Möglichkeit, sich für eines von zwei Modellen zu entscheiden. Beispiel des Pensionsverlaufs der beiden Modelle Modell 1 Modell 2 Modell 1
F-Praktikum Physik: Photolumineszenz an Halbleiterheterostruktur
 F-Praktikum Physik: Photolumineszenz an Halbleiterheterostruktur David Riemenschneider & Felix Spanier 31. Januar 2001 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Auswertung 3 2.1 Darstellung sämtlicher PL-Spektren................
F-Praktikum Physik: Photolumineszenz an Halbleiterheterostruktur David Riemenschneider & Felix Spanier 31. Januar 2001 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Auswertung 3 2.1 Darstellung sämtlicher PL-Spektren................
OECD Programme for International Student Assessment PISA 2000. Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest. Deutschland
 OECD Programme for International Student Assessment Deutschland PISA 2000 Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest Beispielaufgaben PISA-Hauptstudie 2000 Seite 3 UNIT ÄPFEL Beispielaufgaben
OECD Programme for International Student Assessment Deutschland PISA 2000 Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest Beispielaufgaben PISA-Hauptstudie 2000 Seite 3 UNIT ÄPFEL Beispielaufgaben
Leichte-Sprache-Bilder
 Leichte-Sprache-Bilder Reinhild Kassing Information - So geht es 1. Bilder gucken 2. anmelden für Probe-Bilder 3. Bilder bestellen 4. Rechnung bezahlen 5. Bilder runterladen 6. neue Bilder vorschlagen
Leichte-Sprache-Bilder Reinhild Kassing Information - So geht es 1. Bilder gucken 2. anmelden für Probe-Bilder 3. Bilder bestellen 4. Rechnung bezahlen 5. Bilder runterladen 6. neue Bilder vorschlagen
Michelson-Interferometer. Jannik Ehlert, Marko Nonho
 Michelson-Interferometer Jannik Ehlert, Marko Nonho 4. Juni 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 2 Auswertung 2 2.1 Thermische Ausdehnung... 2 2.2 Magnetostriktion... 3 2.2.1 Beobachtung mit dem Auge...
Michelson-Interferometer Jannik Ehlert, Marko Nonho 4. Juni 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 2 Auswertung 2 2.1 Thermische Ausdehnung... 2 2.2 Magnetostriktion... 3 2.2.1 Beobachtung mit dem Auge...
Titel der Stunde: TELEFONIEREN, HÖFLICHKEIT
 Titel der Stunde: TELEFONIEREN, HÖFLICHKEIT Ziele der Stunde: Sicherlich benutzt jeder von euch häufig das Handy oder den Festnetzanschluss und telefoniert mal lange mit Freunden, Bekannten oder Verwandten.
Titel der Stunde: TELEFONIEREN, HÖFLICHKEIT Ziele der Stunde: Sicherlich benutzt jeder von euch häufig das Handy oder den Festnetzanschluss und telefoniert mal lange mit Freunden, Bekannten oder Verwandten.
1 mm 20mm ) =2.86 Damit ist NA = sin α = 0.05. α=arctan ( 1.22 633 nm 0.05. 1) Berechnung eines beugungslimitierten Flecks
 1) Berechnung eines beugungslimitierten Flecks a) Berechnen Sie die Größe eines beugungslimitierten Flecks, der durch Fokussieren des Strahls eines He-Ne Lasers (633 nm) mit 2 mm Durchmesser entsteht.
1) Berechnung eines beugungslimitierten Flecks a) Berechnen Sie die Größe eines beugungslimitierten Flecks, der durch Fokussieren des Strahls eines He-Ne Lasers (633 nm) mit 2 mm Durchmesser entsteht.
geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen
 geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen 70% im Beispiel exakt berechnet sind. Was würde
geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen 70% im Beispiel exakt berechnet sind. Was würde
Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Hamburg und Berlin zu einer Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele
 Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Hamburg und Berlin zu einer Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 4. März 2015 q5337/31319 Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer
Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Hamburg und Berlin zu einer Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 4. März 2015 q5337/31319 Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer
Lichtbrechung an Linsen
 Sammellinsen Lichtbrechung an Linsen Fällt ein paralleles Lichtbündel auf eine Sammellinse, so werden die Lichtstrahlen so gebrochen, dass sie durch einen Brennpunkt der Linse verlaufen. Der Abstand zwischen
Sammellinsen Lichtbrechung an Linsen Fällt ein paralleles Lichtbündel auf eine Sammellinse, so werden die Lichtstrahlen so gebrochen, dass sie durch einen Brennpunkt der Linse verlaufen. Der Abstand zwischen
PK-Website: Besuche & Seitenaufrufe 2010 und 2011
 Abb. 2011-4/278 (Ausschnitt) PK-Website: Besuche & Seitenaufrufe bis 31. Dezember 2011, 248.993 Besuche, 425.183 Seitenaufrufe SG Dezember 2011 / Januar 2012 PK-Website: Besuche & Seitenaufrufe 2010 und
Abb. 2011-4/278 (Ausschnitt) PK-Website: Besuche & Seitenaufrufe bis 31. Dezember 2011, 248.993 Besuche, 425.183 Seitenaufrufe SG Dezember 2011 / Januar 2012 PK-Website: Besuche & Seitenaufrufe 2010 und
Chlorwasserstoffgas wirkt stark reizend bis ätzend auf die Haut, insbesondere auf die Augen und die oberen Atemwege.
 5.1 Gas-Flüssig-Extraktion mit der Chromatomembran-Methode 97 5.1.4 Bestimmung von Chlorwasserstoff 5.1.4.1 Einführung Chlorwasserstoffgas wirkt stark reizend bis ätzend auf die Haut, insbesondere auf
5.1 Gas-Flüssig-Extraktion mit der Chromatomembran-Methode 97 5.1.4 Bestimmung von Chlorwasserstoff 5.1.4.1 Einführung Chlorwasserstoffgas wirkt stark reizend bis ätzend auf die Haut, insbesondere auf
Wie stark ist die Nuss?
 Wie stark ist die Nuss? Bild einer Klett-Werbung Untersuchungen von Eric Hornung, Sebastian Lehmann und Raheel Shahid Geschwister-Scholl-Schule Bensheim Wettbewerb: Schüler experimentieren Fachrichtung
Wie stark ist die Nuss? Bild einer Klett-Werbung Untersuchungen von Eric Hornung, Sebastian Lehmann und Raheel Shahid Geschwister-Scholl-Schule Bensheim Wettbewerb: Schüler experimentieren Fachrichtung
impact ordering Info Produktkonfigurator
 impact ordering Info Copyright Copyright 2013 veenion GmbH Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Dokumentation darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der veenion GmbH reproduziert, verändert
impact ordering Info Copyright Copyright 2013 veenion GmbH Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Dokumentation darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der veenion GmbH reproduziert, verändert
Biochemisches Grundpraktikum
 Biochemisches Grundpraktikum Versuch Nummer G-01 01: Potentiometrische und spektrophotometrische Bestim- mung von Ionisationskonstanten Gliederung: I. Titrationskurve von Histidin und Bestimmung der pk-werte...
Biochemisches Grundpraktikum Versuch Nummer G-01 01: Potentiometrische und spektrophotometrische Bestim- mung von Ionisationskonstanten Gliederung: I. Titrationskurve von Histidin und Bestimmung der pk-werte...
Was ich als Bürgermeister für Lübbecke tun möchte
 Wahlprogramm in leichter Sprache Was ich als Bürgermeister für Lübbecke tun möchte Hallo, ich bin Dirk Raddy! Ich bin 47 Jahre alt. Ich wohne in Hüllhorst. Ich mache gerne Sport. Ich fahre gerne Ski. Ich
Wahlprogramm in leichter Sprache Was ich als Bürgermeister für Lübbecke tun möchte Hallo, ich bin Dirk Raddy! Ich bin 47 Jahre alt. Ich wohne in Hüllhorst. Ich mache gerne Sport. Ich fahre gerne Ski. Ich
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Fachbereich Biologie, Institut für Zoologie Leitung: Prof. Dr. Wolfrum Datum: 15. April 2005
 Johannes Gutenberg-Universität Mainz Fachbereich Biologie, Institut für Zoologie Leitung: Prof. Dr. Wolfrum Datum: 15. April 2005 F1 Molekulare Zoologie Teil II: Expressionsanalyse Proteinexpressionsanalyse
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Fachbereich Biologie, Institut für Zoologie Leitung: Prof. Dr. Wolfrum Datum: 15. April 2005 F1 Molekulare Zoologie Teil II: Expressionsanalyse Proteinexpressionsanalyse
Innovation. Gewerbeanmeldungen rückläufig Abmeldungen steigen
 Innovation Gewerbeanmeldungen rückläufig Abmeldungen steigen Im Jahr 2008 gingen die Gewerbeanmeldungen in um - 4,2 % auf 70 636 im Vergleich zum Vorjahr zurück (Tab. 49). Nur in (- 7,1 %) und in - Anhalt
Innovation Gewerbeanmeldungen rückläufig Abmeldungen steigen Im Jahr 2008 gingen die Gewerbeanmeldungen in um - 4,2 % auf 70 636 im Vergleich zum Vorjahr zurück (Tab. 49). Nur in (- 7,1 %) und in - Anhalt
Grundlagen der Durchflusszytometrie. Dipl.-Ing. Markus Hermann
 Grundlagen der Durchflusszytometrie 1 Durchflusszytometrie Definition : Automatisierte Licht- und Fluoreszenzmikroskopie an Einzelzellen im kontinuierlichen Probendurchfluss! FACS: Fluorescence activated
Grundlagen der Durchflusszytometrie 1 Durchflusszytometrie Definition : Automatisierte Licht- und Fluoreszenzmikroskopie an Einzelzellen im kontinuierlichen Probendurchfluss! FACS: Fluorescence activated
Reinigung... 2. Normale Reingung der CheckStab Leitfähigkeitselektrode... 2. Gründliche Reinigung der Leitfähigkeitselektrode... 2
 Diese Anleitung fasst einige Punkte zusammen, die für eine gute Funktion der CheckStab Geräte wichtig sind. Sie ist nicht als Ersatz für das Handbuch, sondern als Ergänzung zum Handbuch gedacht. Bitte
Diese Anleitung fasst einige Punkte zusammen, die für eine gute Funktion der CheckStab Geräte wichtig sind. Sie ist nicht als Ersatz für das Handbuch, sondern als Ergänzung zum Handbuch gedacht. Bitte
Glaube an die Existenz von Regeln für Vergleiche und Kenntnis der Regeln
 Glaube an die Existenz von Regeln für Vergleiche und Kenntnis der Regeln Regeln ja Regeln nein Kenntnis Regeln ja Kenntnis Regeln nein 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Glauben Sie, dass
Glaube an die Existenz von Regeln für Vergleiche und Kenntnis der Regeln Regeln ja Regeln nein Kenntnis Regeln ja Kenntnis Regeln nein 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Glauben Sie, dass
Praktikum Nr. 3. Fachhochschule Bielefeld Fachbereich Elektrotechnik. Versuchsbericht für das elektronische Praktikum
 Fachhochschule Bielefeld Fachbereich Elektrotechnik Versuchsbericht für das elektronische Praktikum Praktikum Nr. 3 Manuel Schwarz Matrikelnr.: 207XXX Pascal Hahulla Matrikelnr.: 207XXX Thema: Transistorschaltungen
Fachhochschule Bielefeld Fachbereich Elektrotechnik Versuchsbericht für das elektronische Praktikum Praktikum Nr. 3 Manuel Schwarz Matrikelnr.: 207XXX Pascal Hahulla Matrikelnr.: 207XXX Thema: Transistorschaltungen
trivum Multiroom System Konfigurations- Anleitung Erstellen eines RS232 Protokolls am Bespiel eines Marantz SR7005
 trivum Multiroom System Konfigurations- Anleitung Erstellen eines RS232 Protokolls am Bespiel eines Marantz SR7005 2 Inhalt 1. Anleitung zum Einbinden eines über RS232 zu steuernden Devices...3 1.2 Konfiguration
trivum Multiroom System Konfigurations- Anleitung Erstellen eines RS232 Protokolls am Bespiel eines Marantz SR7005 2 Inhalt 1. Anleitung zum Einbinden eines über RS232 zu steuernden Devices...3 1.2 Konfiguration
MONICA. Garn: 100g / ~800 m; ein Lace-Garn nach Wahl Rundnadeln: 3,0-4,0 mm; je nach eigener Maschenprobe
 MONICA Garn: 100g / ~800 m; ein Lace-Garn nach Wahl Rundnadeln: 3,0-4,0 mm; je nach eigener Maschenprobe Ich habe Linate Smyrna Platinum (100g / 750 m) und Nadeln 3,5 mm verwendet und habe für meinen ersten
MONICA Garn: 100g / ~800 m; ein Lace-Garn nach Wahl Rundnadeln: 3,0-4,0 mm; je nach eigener Maschenprobe Ich habe Linate Smyrna Platinum (100g / 750 m) und Nadeln 3,5 mm verwendet und habe für meinen ersten
Pages, Keynote. und Numbers
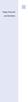 Pages, Keynote und Numbers Pages, Keynote und Numbers Die iwork-apps im Büro und unterwegs nutzen Mac und mehr. Numbers Tipps und Tricks zur Arbeit mit Tabellen Kapitel 18 Kapitel 18 Tabellen als Ganzes
Pages, Keynote und Numbers Pages, Keynote und Numbers Die iwork-apps im Büro und unterwegs nutzen Mac und mehr. Numbers Tipps und Tricks zur Arbeit mit Tabellen Kapitel 18 Kapitel 18 Tabellen als Ganzes
1. Einführung 2. 2. Erstellung einer Teillieferung 2. 3. Erstellung einer Teilrechnung 6
 Inhalt 1. Einführung 2 2. Erstellung einer Teillieferung 2 3. Erstellung einer Teilrechnung 6 4. Erstellung einer Sammellieferung/ Mehrere Aufträge zu einem Lieferschein zusammenfassen 11 5. Besonderheiten
Inhalt 1. Einführung 2 2. Erstellung einer Teillieferung 2 3. Erstellung einer Teilrechnung 6 4. Erstellung einer Sammellieferung/ Mehrere Aufträge zu einem Lieferschein zusammenfassen 11 5. Besonderheiten
Fidbox App. Version 3.1. für ios und Android. Anforderungen für Android: Bluetooth 4 und Android Version 4.1 oder neuer
 Fidbox App Version 3.1 für ios und Android Anforderungen für Android: Bluetooth 4 und Android Version 4.1 oder neuer Anforderungen für Apple ios: Bluetooth 4 und ios Version 7.0 oder neuer Die neue Exportfunktion
Fidbox App Version 3.1 für ios und Android Anforderungen für Android: Bluetooth 4 und Android Version 4.1 oder neuer Anforderungen für Apple ios: Bluetooth 4 und ios Version 7.0 oder neuer Die neue Exportfunktion
FTV 1. Semester. Spalte A Spalte B Spalte C Spalte D. Zeile 1 Zelle A1 Zelle B1 Zelle C1 Zelle D1. Zeile 3 Zelle A3 Zelle B3 Zelle C3 Zelle D3
 Eine besteht aus Zeilen und spalten von Zellen, die mit Text oder Grafik gefüllt werden können. Die wird standardmäßig mit einfachen Rahmenlinien versehen, die verändert oder entfernt werden können. Spalte
Eine besteht aus Zeilen und spalten von Zellen, die mit Text oder Grafik gefüllt werden können. Die wird standardmäßig mit einfachen Rahmenlinien versehen, die verändert oder entfernt werden können. Spalte
Sollten während der Benutzung Probleme auftreten, können Sie die folgende Liste zur Problembehebung benutzen, um eine Lösung zu finden.
 12. Problembehebung Sollten während der Benutzung Probleme auftreten, können Sie die folgende Liste zur Problembehebung benutzen, um eine Lösung zu finden. Sollte Ihr Problem nicht mit Hilfe dieser Liste
12. Problembehebung Sollten während der Benutzung Probleme auftreten, können Sie die folgende Liste zur Problembehebung benutzen, um eine Lösung zu finden. Sollte Ihr Problem nicht mit Hilfe dieser Liste
PerlDesign - GigaSign perldesign.blogspot.de - www.gigasign.de
 Cubic-RAW (Cubic Right Angle Weave) Basiswissen: Cubic RAW ist die 3-dimensionale Form der RAW-Technik. Der Faden ändert bei jedem Verarbeitungsschritt um 90 (Viertelkreis) seine Richtung, daher auch der
Cubic-RAW (Cubic Right Angle Weave) Basiswissen: Cubic RAW ist die 3-dimensionale Form der RAW-Technik. Der Faden ändert bei jedem Verarbeitungsschritt um 90 (Viertelkreis) seine Richtung, daher auch der
Was, wenn es möglich wäre, Ihre Katarakt und Ihren Astigmatismus gleichzeitig zu korrigieren?
 Was, wenn es möglich wäre, Ihre Katarakt und Ihren Astigmatismus gleichzeitig zu korrigieren? WAS IST EINE KATARAKT? Wenn wir altern, verdichten sich im Inneren der natürlichen Augenlinse die Proteine,
Was, wenn es möglich wäre, Ihre Katarakt und Ihren Astigmatismus gleichzeitig zu korrigieren? WAS IST EINE KATARAKT? Wenn wir altern, verdichten sich im Inneren der natürlichen Augenlinse die Proteine,
Zeichen bei Zahlen entschlüsseln
 Zeichen bei Zahlen entschlüsseln In diesem Kapitel... Verwendung des Zahlenstrahls Absolut richtige Bestimmung von absoluten Werten Operationen bei Zahlen mit Vorzeichen: Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren
Zeichen bei Zahlen entschlüsseln In diesem Kapitel... Verwendung des Zahlenstrahls Absolut richtige Bestimmung von absoluten Werten Operationen bei Zahlen mit Vorzeichen: Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren
Versuch: Siedediagramm eines binären Gemisches
 Versuch: Siedediagramm eines binären Gemisches Aufgaben - Kalibriermessungen Bestimmen Sie experimentell den Brechungsindex einer gegebenen Mischung bei unterschiedlicher Zusammensetzung. - Theoretische
Versuch: Siedediagramm eines binären Gemisches Aufgaben - Kalibriermessungen Bestimmen Sie experimentell den Brechungsindex einer gegebenen Mischung bei unterschiedlicher Zusammensetzung. - Theoretische
Dazu gilt Folgendes: : Hier kannst du bis zum 6. Stich problemlos abwerfen und
 1 Die wurde erstmals im Essener System erklärt und ist bis heute Standard für das Gegenspiel beim sogenannten Standard-Asssolo (Solist hat eine lange Farbe und Seitenass[e], die er runterzieht die Reststiche
1 Die wurde erstmals im Essener System erklärt und ist bis heute Standard für das Gegenspiel beim sogenannten Standard-Asssolo (Solist hat eine lange Farbe und Seitenass[e], die er runterzieht die Reststiche
1. Kennlinien. 2. Stabilisierung der Emitterschaltung. Schaltungstechnik 2 Übung 4
 1. Kennlinien Der Transistor BC550C soll auf den Arbeitspunkt U CE = 4 V und I C = 15 ma eingestellt werden. a) Bestimmen Sie aus den Kennlinien (S. 2) die Werte für I B, B, U BE. b) Woher kommt die Neigung
1. Kennlinien Der Transistor BC550C soll auf den Arbeitspunkt U CE = 4 V und I C = 15 ma eingestellt werden. a) Bestimmen Sie aus den Kennlinien (S. 2) die Werte für I B, B, U BE. b) Woher kommt die Neigung
Schritt für Schritt zur Krankenstandsstatistik
 Schritt für Schritt zur Krankenstandsstatistik Eine Anleitung zur Nutzung der Excel-Tabellen zur Erhebung des Krankenstands. Entwickelt durch: Kooperationsprojekt Arbeitsschutz in der ambulanten Pflege
Schritt für Schritt zur Krankenstandsstatistik Eine Anleitung zur Nutzung der Excel-Tabellen zur Erhebung des Krankenstands. Entwickelt durch: Kooperationsprojekt Arbeitsschutz in der ambulanten Pflege
Zahlen auf einen Blick
 Zahlen auf einen Blick Nicht ohne Grund heißt es: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Die meisten Menschen nehmen Informationen schneller auf und behalten diese eher, wenn sie als Schaubild dargeboten werden.
Zahlen auf einen Blick Nicht ohne Grund heißt es: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Die meisten Menschen nehmen Informationen schneller auf und behalten diese eher, wenn sie als Schaubild dargeboten werden.
Die Online-Meetings bei den Anonymen Alkoholikern. zum Thema. Online - Meetings. Eine neue Form der Selbsthilfe?
 Die Online-Meetings bei den Anonymen Alkoholikern zum Thema Online - Meetings Eine neue Form der Selbsthilfe? Informationsverhalten von jungen Menschen (Quelle: FAZ.NET vom 2.7.2010). Erfahrungen können
Die Online-Meetings bei den Anonymen Alkoholikern zum Thema Online - Meetings Eine neue Form der Selbsthilfe? Informationsverhalten von jungen Menschen (Quelle: FAZ.NET vom 2.7.2010). Erfahrungen können
3D-Konstruktion Brückenpfeiler für WinTrack (H0)
 3D-Konstruktion Brückenpfeiler für WinTrack (H0) Zusammenstellung: Hans-Joachim Becker http://www.hjb-electronics.de 2007 Altomünster, den 25. März 2007 Hans-Joachim Becker - 1 - Vorbemerkung Das Programm
3D-Konstruktion Brückenpfeiler für WinTrack (H0) Zusammenstellung: Hans-Joachim Becker http://www.hjb-electronics.de 2007 Altomünster, den 25. März 2007 Hans-Joachim Becker - 1 - Vorbemerkung Das Programm
PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS: VERWENDUNG DICHTEBASIERTER TEILROUTEN
 PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS: VERWENDUNG DICHTEBASIERTER TEILROUTEN Karlsruhe, April 2015 Verwendung dichte-basierter Teilrouten Stellen Sie sich vor, in einem belebten Gebäude,
PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS: VERWENDUNG DICHTEBASIERTER TEILROUTEN Karlsruhe, April 2015 Verwendung dichte-basierter Teilrouten Stellen Sie sich vor, in einem belebten Gebäude,
50. Mathematik-Olympiade 2. Stufe (Regionalrunde) Klasse 11 13. 501322 Lösung 10 Punkte
 50. Mathematik-Olympiade. Stufe (Regionalrunde) Klasse 3 Lösungen c 00 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.v. www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten. 503 Lösung 0 Punkte Es seien
50. Mathematik-Olympiade. Stufe (Regionalrunde) Klasse 3 Lösungen c 00 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.v. www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten. 503 Lösung 0 Punkte Es seien
Lasertechnik Praktikum. Nd:YAG Laser
 Lasertechnik Praktikum Nd:YAG Laser SS 2013 Gruppe B1 Arthur Halama Xiaomei Xu 1. Theorie 2. Messung und Auswertung 2.1 Justierung und Beobachtung des Pulssignals am Oszilloskop 2.2 Einfluss der Verstärkerspannung
Lasertechnik Praktikum Nd:YAG Laser SS 2013 Gruppe B1 Arthur Halama Xiaomei Xu 1. Theorie 2. Messung und Auswertung 2.1 Justierung und Beobachtung des Pulssignals am Oszilloskop 2.2 Einfluss der Verstärkerspannung
Michelson-Interferometer & photoelektrischer Effekt
 Michelson-Interferometer & photoelektrischer Effekt Branche: TP: Autoren: Klasse: Physik / Physique Michelson-Interferometer & photoelektrischer Effekt Cedric Rey David Schneider 2T Datum: 01.04.2008 &
Michelson-Interferometer & photoelektrischer Effekt Branche: TP: Autoren: Klasse: Physik / Physique Michelson-Interferometer & photoelektrischer Effekt Cedric Rey David Schneider 2T Datum: 01.04.2008 &
Einfache Varianzanalyse für abhängige
 Einfache Varianzanalyse für abhängige Stichproben Wie beim t-test gibt es auch bei der VA eine Alternative für abhängige Stichproben. Anmerkung: Was man unter abhängigen Stichproben versteht und wie diese
Einfache Varianzanalyse für abhängige Stichproben Wie beim t-test gibt es auch bei der VA eine Alternative für abhängige Stichproben. Anmerkung: Was man unter abhängigen Stichproben versteht und wie diese
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Übungsbuch für den Grundkurs mit Tipps und Lösungen: Analysis
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Übungsbuch für den Grundkurs mit Tipps und Lösungen: Analysis Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Übungsbuch für den Grundkurs mit Tipps und Lösungen: Analysis Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Info zum Zusammenhang von Auflösung und Genauigkeit
 Da es oft Nachfragen und Verständnisprobleme mit den oben genannten Begriffen gibt, möchten wir hier versuchen etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Nehmen wir mal an, Sie haben ein Stück Wasserrohr mit der
Da es oft Nachfragen und Verständnisprobleme mit den oben genannten Begriffen gibt, möchten wir hier versuchen etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Nehmen wir mal an, Sie haben ein Stück Wasserrohr mit der
14. Minimale Schichtdicken von PEEK und PPS im Schlauchreckprozeß und im Rheotensversuch
 14. Minimale Schichtdicken von PEEK und PPS im Schlauchreckprozeß und im Rheotensversuch Analog zu den Untersuchungen an LDPE in Kap. 6 war zu untersuchen, ob auch für die Hochtemperatur-Thermoplaste aus
14. Minimale Schichtdicken von PEEK und PPS im Schlauchreckprozeß und im Rheotensversuch Analog zu den Untersuchungen an LDPE in Kap. 6 war zu untersuchen, ob auch für die Hochtemperatur-Thermoplaste aus
Mobile Intranet in Unternehmen
 Mobile Intranet in Unternehmen Ergebnisse einer Umfrage unter Intranet Verantwortlichen aexea GmbH - communication. content. consulting Augustenstraße 15 70178 Stuttgart Tel: 0711 87035490 Mobile Intranet
Mobile Intranet in Unternehmen Ergebnisse einer Umfrage unter Intranet Verantwortlichen aexea GmbH - communication. content. consulting Augustenstraße 15 70178 Stuttgart Tel: 0711 87035490 Mobile Intranet
BMV Visionen 2020. Ergebnisbericht der Mitglieder Befragung
 BMV Visionen 22 Ergebnisbericht der Mitglieder Befragung Die Mitglieder Befragung wurde im Rahmen des Projekts Visionen 22 des Steirischen Blasmusikverbandes (BMV) mithilfe eines Fragebogens durchgeführt.
BMV Visionen 22 Ergebnisbericht der Mitglieder Befragung Die Mitglieder Befragung wurde im Rahmen des Projekts Visionen 22 des Steirischen Blasmusikverbandes (BMV) mithilfe eines Fragebogens durchgeführt.
Vergleichende Untersuchungen der Sarstedt Blutsenkungssysteme. S-Monovette BSG und S-Sedivette und der Messgeräte Sediplus S 200 und S 2000
 Vergleichende Untersuchungen der Sarstedt Blutsenkungssysteme S-Monovette BSG und S-Sedivette und der Messgeräte Sediplus S 200 und S 2000 Einleitung: Für Blutentnahmen einer BSG Bestimmung bietet Sarstedt
Vergleichende Untersuchungen der Sarstedt Blutsenkungssysteme S-Monovette BSG und S-Sedivette und der Messgeräte Sediplus S 200 und S 2000 Einleitung: Für Blutentnahmen einer BSG Bestimmung bietet Sarstedt
Schnittstelle DIGI-Zeiterfassung
 P.A.P.A. die kaufmännische Softwarelösung Schnittstelle DIGI-Zeiterfassung Inhalt Einleitung... 2 Eingeben der Daten... 2 Datenabgleich... 3 Zusammenfassung... 5 Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen
P.A.P.A. die kaufmännische Softwarelösung Schnittstelle DIGI-Zeiterfassung Inhalt Einleitung... 2 Eingeben der Daten... 2 Datenabgleich... 3 Zusammenfassung... 5 Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen
Statuten in leichter Sprache
 Statuten in leichter Sprache Zweck vom Verein Artikel 1: Zivil-Gesetz-Buch Es gibt einen Verein der selbstbestimmung.ch heisst. Der Verein ist so aufgebaut, wie es im Zivil-Gesetz-Buch steht. Im Zivil-Gesetz-Buch
Statuten in leichter Sprache Zweck vom Verein Artikel 1: Zivil-Gesetz-Buch Es gibt einen Verein der selbstbestimmung.ch heisst. Der Verein ist so aufgebaut, wie es im Zivil-Gesetz-Buch steht. Im Zivil-Gesetz-Buch
mehrmals mehrmals mehrmals alle seltener nie mindestens **) in der im Monat im Jahr 1 bis 2 alle 1 bis 2 Woche Jahre Jahre % % % % % % %
 Nicht überraschend, aber auch nicht gravierend, sind die altersspezifischen Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit des Apothekenbesuchs: 24 Prozent suchen mindestens mehrmals im Monat eine Apotheke auf,
Nicht überraschend, aber auch nicht gravierend, sind die altersspezifischen Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit des Apothekenbesuchs: 24 Prozent suchen mindestens mehrmals im Monat eine Apotheke auf,
Wir basteln einen Jahreskalender mit MS Excel.
 Wir basteln einen Jahreskalender mit MS Excel. In meinen Seminaren werde ich hin und wieder nach einem Excel-Jahreskalender gefragt. Im Internet findet man natürlich eine ganze Reihe mehr oder weniger
Wir basteln einen Jahreskalender mit MS Excel. In meinen Seminaren werde ich hin und wieder nach einem Excel-Jahreskalender gefragt. Im Internet findet man natürlich eine ganze Reihe mehr oder weniger
Erstellen von x-y-diagrammen in OpenOffice.calc
 Erstellen von x-y-diagrammen in OpenOffice.calc In dieser kleinen Anleitung geht es nur darum, aus einer bestehenden Tabelle ein x-y-diagramm zu erzeugen. D.h. es müssen in der Tabelle mindestens zwei
Erstellen von x-y-diagrammen in OpenOffice.calc In dieser kleinen Anleitung geht es nur darum, aus einer bestehenden Tabelle ein x-y-diagramm zu erzeugen. D.h. es müssen in der Tabelle mindestens zwei
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
 Widerrufsbelehrung Nutzt der Kunde die Leistungen als Verbraucher und hat seinen Auftrag unter Nutzung von sog. Fernkommunikationsmitteln (z. B. Telefon, Telefax, E-Mail, Online-Web-Formular) übermittelt,
Widerrufsbelehrung Nutzt der Kunde die Leistungen als Verbraucher und hat seinen Auftrag unter Nutzung von sog. Fernkommunikationsmitteln (z. B. Telefon, Telefax, E-Mail, Online-Web-Formular) übermittelt,
Eigenen Farbverlauf erstellen
 Diese Serie ist an totale Neulinge gerichtet. Neu bei PhotoLine, evtl. sogar komplett neu, was Bildbearbeitung betrifft. So versuche ich, hier alles einfach zu halten. Ich habe sogar PhotoLine ein zweites
Diese Serie ist an totale Neulinge gerichtet. Neu bei PhotoLine, evtl. sogar komplett neu, was Bildbearbeitung betrifft. So versuche ich, hier alles einfach zu halten. Ich habe sogar PhotoLine ein zweites
Physik & Musik. Stimmgabeln. 1 Auftrag
 Physik & Musik 5 Stimmgabeln 1 Auftrag Physik & Musik Stimmgabeln Seite 1 Stimmgabeln Bearbeitungszeit: 30 Minuten Sozialform: Einzel- oder Partnerarbeit Voraussetzung: Posten 1: "Wie funktioniert ein
Physik & Musik 5 Stimmgabeln 1 Auftrag Physik & Musik Stimmgabeln Seite 1 Stimmgabeln Bearbeitungszeit: 30 Minuten Sozialform: Einzel- oder Partnerarbeit Voraussetzung: Posten 1: "Wie funktioniert ein
SUPERABSORBER. Eine Präsentation von Johannes Schlüter und Thomas Luckert
 SUPERABSORBER Eine Präsentation von Johannes Schlüter und Thomas Luckert Inhalt: Die Windel Die Technik des Superabsorbers Anwendungsgebiete des Superabsorbers Ein kurzer Abriss aus der Geschichte der
SUPERABSORBER Eine Präsentation von Johannes Schlüter und Thomas Luckert Inhalt: Die Windel Die Technik des Superabsorbers Anwendungsgebiete des Superabsorbers Ein kurzer Abriss aus der Geschichte der
Programm 4: Arbeiten mit thematischen Karten
 : Arbeiten mit thematischen Karten A) Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung an der Wohnbevölkerung insgesamt 2001 in Prozent 1. Inhaltliche und kartographische Beschreibung - Originalkarte Bei dieser
: Arbeiten mit thematischen Karten A) Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung an der Wohnbevölkerung insgesamt 2001 in Prozent 1. Inhaltliche und kartographische Beschreibung - Originalkarte Bei dieser
Messung der Astronomischen Einheit nach Aristarch
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit nach Aristarch 1 Einleitung Bis ins 17. Jahrhundert war die
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit nach Aristarch 1 Einleitung Bis ins 17. Jahrhundert war die
Vermögensbildung: Sparen und Wertsteigerung bei Immobilien liegen vorn
 An die Redaktionen von Presse, Funk und Fernsehen 32 02. 09. 2002 Vermögensbildung: Sparen und Wertsteigerung bei Immobilien liegen vorn Das aktive Sparen ist nach wie vor die wichtigste Einflussgröße
An die Redaktionen von Presse, Funk und Fernsehen 32 02. 09. 2002 Vermögensbildung: Sparen und Wertsteigerung bei Immobilien liegen vorn Das aktive Sparen ist nach wie vor die wichtigste Einflussgröße
Wie kann man Kreativität und Innovation fördern? Psychologische Ansätze zum Ideenmanagement
 Wie kann man Kreativität und Innovation fördern? Psychologische Ansätze zum Ideenmanagement Dipl.-Psych. Sandra Ohly Institut f. Psychologie TU Braunschweig Vorschau Psychologische Modelle der Kreativitäts
Wie kann man Kreativität und Innovation fördern? Psychologische Ansätze zum Ideenmanagement Dipl.-Psych. Sandra Ohly Institut f. Psychologie TU Braunschweig Vorschau Psychologische Modelle der Kreativitäts
Hilfe zur Urlaubsplanung und Zeiterfassung
 Hilfe zur Urlaubsplanung und Zeiterfassung Urlaubs- und Arbeitsplanung: Mit der Urlaubs- und Arbeitsplanung kann jeder Mitarbeiter in Coffee seine Zeiten eintragen. Die Eintragung kann mit dem Status anfragen,
Hilfe zur Urlaubsplanung und Zeiterfassung Urlaubs- und Arbeitsplanung: Mit der Urlaubs- und Arbeitsplanung kann jeder Mitarbeiter in Coffee seine Zeiten eintragen. Die Eintragung kann mit dem Status anfragen,
Zahlenoptimierung Herr Clever spielt optimierte Zahlen
 system oder Zahlenoptimierung unabhängig. Keines von beiden wird durch die Wahrscheinlichkeit bevorzugt. An ein gutes System der Zahlenoptimierung ist die Bedingung geknüpft, dass bei geringstmöglichem
system oder Zahlenoptimierung unabhängig. Keines von beiden wird durch die Wahrscheinlichkeit bevorzugt. An ein gutes System der Zahlenoptimierung ist die Bedingung geknüpft, dass bei geringstmöglichem
EVANGELISCHES SCHULZENTRUM LEIPZIG in Trägerschaft des Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirks Leipzig
 Bewerbung um einen Diakonischen Einsatz Sehr geehrte Damen und Herren, die Schülerin/der Schüler.. wohnhaft in.. besucht zurzeit die 10. Klasse unseres Gymnasiums. Vom 26. Januar bis 05. Februar 2015 werden
Bewerbung um einen Diakonischen Einsatz Sehr geehrte Damen und Herren, die Schülerin/der Schüler.. wohnhaft in.. besucht zurzeit die 10. Klasse unseres Gymnasiums. Vom 26. Januar bis 05. Februar 2015 werden
Das Vermögen der privaten Haushalte in Nordrhein-Westfalen ein Überblick auf der Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
 Sozialberichterstattung NRW. Kurzanalyse 02/2010 09.07.2010 12.07.2010 Das Vermögen der privaten Haushalte in Nordrhein-Westfalen ein Überblick auf der Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008
Sozialberichterstattung NRW. Kurzanalyse 02/2010 09.07.2010 12.07.2010 Das Vermögen der privaten Haushalte in Nordrhein-Westfalen ein Überblick auf der Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008
6 Schulungsmodul: Probenahme im Betrieb
 6 Schulungsmodul: Probenahme im Betrieb WIEDNER Wie schon im Kapitel VI erwähnt, ist die Probenahme in Betrieben, die Produkte nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch herstellen oder in den Verkehr
6 Schulungsmodul: Probenahme im Betrieb WIEDNER Wie schon im Kapitel VI erwähnt, ist die Probenahme in Betrieben, die Produkte nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch herstellen oder in den Verkehr
Hilfedatei der Oden$-Börse Stand Juni 2014
 Hilfedatei der Oden$-Börse Stand Juni 2014 Inhalt 1. Einleitung... 2 2. Die Anmeldung... 2 2.1 Die Erstregistrierung... 3 2.2 Die Mitgliedsnummer anfordern... 4 3. Die Funktionen für Nutzer... 5 3.1 Arbeiten
Hilfedatei der Oden$-Börse Stand Juni 2014 Inhalt 1. Einleitung... 2 2. Die Anmeldung... 2 2.1 Die Erstregistrierung... 3 2.2 Die Mitgliedsnummer anfordern... 4 3. Die Funktionen für Nutzer... 5 3.1 Arbeiten
Pädagogik. Melanie Schewtschenko. Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe. Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig?
 Pädagogik Melanie Schewtschenko Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung.2 2. Warum ist Eingewöhnung
Pädagogik Melanie Schewtschenko Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung.2 2. Warum ist Eingewöhnung
Adobe Photoshop. Lightroom 5 für Einsteiger Bilder verwalten und entwickeln. Sam Jost
 Adobe Photoshop Lightroom 5 für Einsteiger Bilder verwalten und entwickeln Sam Jost Kapitel 2 Der erste Start 2.1 Mitmachen beim Lesen....................... 22 2.2 Für Apple-Anwender.........................
Adobe Photoshop Lightroom 5 für Einsteiger Bilder verwalten und entwickeln Sam Jost Kapitel 2 Der erste Start 2.1 Mitmachen beim Lesen....................... 22 2.2 Für Apple-Anwender.........................
Bilder Schärfen und Rauschen entfernen
 Bilder Schärfen und Rauschen entfernen Um alte Bilder, so wie die von der Olympus Camedia 840 L noch dazu zu bewegen, Farben froh und frisch daherzukommen, bedarf es einiger Arbeit und die habe ich hier
Bilder Schärfen und Rauschen entfernen Um alte Bilder, so wie die von der Olympus Camedia 840 L noch dazu zu bewegen, Farben froh und frisch daherzukommen, bedarf es einiger Arbeit und die habe ich hier
Informationsblatt Induktionsbeweis
 Sommer 015 Informationsblatt Induktionsbeweis 31. März 015 Motivation Die vollständige Induktion ist ein wichtiges Beweisverfahren in der Informatik. Sie wird häufig dazu gebraucht, um mathematische Formeln
Sommer 015 Informationsblatt Induktionsbeweis 31. März 015 Motivation Die vollständige Induktion ist ein wichtiges Beweisverfahren in der Informatik. Sie wird häufig dazu gebraucht, um mathematische Formeln
B 2. " Zeigen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Leiterplatte akzeptiert wird, 0,93 beträgt. (genauerer Wert: 0,933).!:!!
 Das folgende System besteht aus 4 Schraubenfedern. Die Federn A ; B funktionieren unabhängig von einander. Die Ausfallzeit T (in Monaten) der Federn sei eine weibullverteilte Zufallsvariable mit den folgenden
Das folgende System besteht aus 4 Schraubenfedern. Die Federn A ; B funktionieren unabhängig von einander. Die Ausfallzeit T (in Monaten) der Federn sei eine weibullverteilte Zufallsvariable mit den folgenden
Alle gehören dazu. Vorwort
 Alle gehören dazu Alle sollen zusammen Sport machen können. In diesem Text steht: Wie wir dafür sorgen wollen. Wir sind: Der Deutsche Olympische Sport-Bund und die Deutsche Sport-Jugend. Zu uns gehören
Alle gehören dazu Alle sollen zusammen Sport machen können. In diesem Text steht: Wie wir dafür sorgen wollen. Wir sind: Der Deutsche Olympische Sport-Bund und die Deutsche Sport-Jugend. Zu uns gehören
ist die Vergütung für die leihweise Überlassung von Kapital ist die leihweise überlassenen Geldsumme
 Information In der Zinsrechnung sind 4 Größen wichtig: ZINSEN Z ist die Vergütung für die leihweise Überlassung von Kapital KAPITAL K ist die leihweise überlassenen Geldsumme ZINSSATZ p (Zinsfuß) gibt
Information In der Zinsrechnung sind 4 Größen wichtig: ZINSEN Z ist die Vergütung für die leihweise Überlassung von Kapital KAPITAL K ist die leihweise überlassenen Geldsumme ZINSSATZ p (Zinsfuß) gibt
Kundenbefragung als Vehikel zur Optimierung des Customer Service Feedback des Kunden nutzen zur Verbesserung der eigenen Prozesse
 Kundenbefragung als Vehikel zur Optimierung des Customer Service Feedback des Kunden nutzen zur Verbesserung der eigenen Prozesse Vieles wurde bereits geschrieben, über die Definition und/oder Neugestaltung
Kundenbefragung als Vehikel zur Optimierung des Customer Service Feedback des Kunden nutzen zur Verbesserung der eigenen Prozesse Vieles wurde bereits geschrieben, über die Definition und/oder Neugestaltung
1 Einleitung. Lernziele. automatische Antworten bei Abwesenheit senden. Einstellungen für automatische Antworten Lerndauer. 4 Minuten.
 1 Einleitung Lernziele automatische Antworten bei Abwesenheit senden Einstellungen für automatische Antworten Lerndauer 4 Minuten Seite 1 von 18 2 Antworten bei Abwesenheit senden» Outlook kann während
1 Einleitung Lernziele automatische Antworten bei Abwesenheit senden Einstellungen für automatische Antworten Lerndauer 4 Minuten Seite 1 von 18 2 Antworten bei Abwesenheit senden» Outlook kann während
Über den Link https://www.edudip.com/academy/dbv erreichen Sie unsere Einstiegsseite:
 Anmeldung und Zugang zum Webinar Über den Link https://www.edudip.com/academy/dbv erreichen Sie unsere Einstiegsseite: Dort finden Sie die Ankündigung unserer Webinare: Wenn Sie auf den Eintrag zum gewünschten
Anmeldung und Zugang zum Webinar Über den Link https://www.edudip.com/academy/dbv erreichen Sie unsere Einstiegsseite: Dort finden Sie die Ankündigung unserer Webinare: Wenn Sie auf den Eintrag zum gewünschten
Die integrierte Zeiterfassung. Das innovative Softwarekonzept
 Die integrierte Zeiterfassung Das innovative Softwarekonzept projekt - ein komplexes Programm mit Zusatzmodulen, die einzeln oder in ihrer individuellen Zusammenstellung, die gesamte Abwicklung in Ihrem
Die integrierte Zeiterfassung Das innovative Softwarekonzept projekt - ein komplexes Programm mit Zusatzmodulen, die einzeln oder in ihrer individuellen Zusammenstellung, die gesamte Abwicklung in Ihrem
Bundesverband Flachglas Großhandel Isolierglasherstellung Veredlung e.v. U g -Werte-Tabellen nach DIN EN 673. Flachglasbranche.
 Bundesverband Flachglas Großhandel Isolierglasherstellung Veredlung e.v. U g -Werte-Tabellen nach DIN EN 673 Ug-Werte für die Flachglasbranche Einleitung Die vorliegende Broschüre enthält die Werte für
Bundesverband Flachglas Großhandel Isolierglasherstellung Veredlung e.v. U g -Werte-Tabellen nach DIN EN 673 Ug-Werte für die Flachglasbranche Einleitung Die vorliegende Broschüre enthält die Werte für
Titrationskurve einer starken Säure (HCl) mit einer starken Base (NaOH)
 Titrationskurve einer starken Säure (HCl) mit einer starken Base (NaOH) Material 250 mlbecherglas 100 ml Messzylinder 50 mlbürette, Magnetrührer, Magnetfisch, Stativmaterial phmeter Chemikalien Natronlauge
Titrationskurve einer starken Säure (HCl) mit einer starken Base (NaOH) Material 250 mlbecherglas 100 ml Messzylinder 50 mlbürette, Magnetrührer, Magnetfisch, Stativmaterial phmeter Chemikalien Natronlauge
AGROPLUS Buchhaltung. Daten-Server und Sicherheitskopie. Version vom 21.10.2013b
 AGROPLUS Buchhaltung Daten-Server und Sicherheitskopie Version vom 21.10.2013b 3a) Der Daten-Server Modus und der Tresor Der Daten-Server ist eine Betriebsart welche dem Nutzer eine grosse Flexibilität
AGROPLUS Buchhaltung Daten-Server und Sicherheitskopie Version vom 21.10.2013b 3a) Der Daten-Server Modus und der Tresor Der Daten-Server ist eine Betriebsart welche dem Nutzer eine grosse Flexibilität
