Am Ende. ohne Kohle?
|
|
|
- Joseph Bachmeier
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 böll.brief #1 GRÜNE ORDNUNGSPOLITIK #4 Dezember Monat 2016 Policy-Optionen Am Ende für Klimaschutz ohne Kohle? und Kohleausstieg Risiken für gesellschaftliche Folgekosten und Optionen zur Sicherung der Braunkohlerückstellungen DR. PAO-YU OEI FORUM ÖKOLOGISCH-SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT (FÖS) & INSTITUTE FOR ADVANCED SUSTAINABILITY STUDIES (IASS): SWANTJE FIEDLER DR. Auf DOMINIK dem rasanten SCHÄUBLE Weg in die Wissens- und Informationsgesellschaft DANIELA haben wir SETTON schon jetzt viele Menschen verloren auch darunter viele RUPERT Jugendliche. WRONSKI Fast 30 Prozent der Jugendlichen in Deutschland verfügen CLEMENS nur über unzureichende WUNDERLICH Computer- und IT-Kompetenzen und werden es schwer haben, erfolgreich am privaten, beruflichen Professorin Brigit Eickelmann hat die Ergebnisse der Studie ICILS 2013 für die Heinrich-Böll-Stiftung gezielt unter dem Aspekt Bildungsgerechtigkeit ausgewertet.
2 Das böll.brief Grüne Ordnungpolitik bietet Analysen, Hintergründe und programmatische Impulse für eine sozial-ökologische Transformation. Der Fokus liegt auf den Politikfeldern Energie, Klimaschutz, Stadtentwicklung sowie arbeits- und wirtschaftspolitische Maßnahmen zum nachhaltigen Umbau der Industriegesellschaft. Das böll.brief der Abteilung Politische Bildung Inland der Heinrich-Böll-Stiftung erscheint als E-Paper neun mal im Jahr im Wechsel zu den Themen «Teilhabegesellschaft», «Grüne Ordnungspolitik» und «Demokratiereform». Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung 3 Ausgangslage: Höchste Zeit für eine Diskussion 4 Die Folgekosten des Braunkohlebergbaus sind vielfältig und zum Teil langfristig 5 Rückstellungen zur Finanzierung der Braunkohle-Folgekosten 8 Handlungsbedarf: Welche Risiken birgt die Finanzierung über Rückstellungen? 11 Wie kann die Finanzierung der Folgekosten gesichert werden? 13 Die Autor/innen 18 Mehr zum Themenbereich 19 Impressum 20 Am Ende ohne Kohle? 2/ 20
3 Zusammenfassung Wer trägt die Folgekosten des Braunkohlebergbaus? Langfristige Gewässernachsorge, Bergschäden, Verlust biologischer Vielfalt, gesundheitliche Auswirkungen und der Klimawandel sind Beispiele dafür, dass die Gesellschaft bereits heute für einen Teil der Kosten aufkommt. Zur Wiedernutzbarmachung der beanspruchten Flächen sind die Tagebaubetreiber hingegen per Gesetz ausdrücklich verpflichtet. Allerdings ist fraglich, ob das Finanzierungsmodell der unternehmensinternen Rückstellungen sicherstellt, dass die Kosten tatsächlich von den Verursachern getragen werden. Unerwartete Kostensteigerungen, die Verschlechterung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Energiekonzerne, die die derzeit hohen Verzinsungsanforderungen für Rückstellungen und die Grenzen der Konzernhaftung im Insolvenzfall können dazu führen, dass die Verursacher nicht mehr zahlungsfähig sind. Mit den Risiken der bisherigen Rückstellungspraxis und Schritten zu deren Begrenzung befasst sich der vorliegende böll.brief. Landesregierungen und Bergbehörden können innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens Sicherheitsleistungen und mehr Transparenz von den Betreibern fordern. Mittel- und langfristig stehen unterschiedliche Instrumente zur Sicherstellung der Finanzierungsvorsorge zur Verfügung. Folgende Optionen werden empfohlen: Mit einem unabhängigen Kostengutachten sollte geprüft werden, wie hoch die Folgekosten sind, welche Risiken für Kostensteigerungen es gibt und inwiefern die gebildeten Rückstellungen ausreichend sind. Das Gutachten kann von der Bundesregierung und/oder den Landesregierungen in Auftrag gegeben werden. Gegebenenfalls sollte im Anschluss auch die Methode zur Abzinsung angepasst werden. Im Einklang mit dem Bundesberggesetz (BbergG) sollten die Bergbehörden der Länder Sicherheitsleistungen wie Barmittel und Wertpapiere von den bergbautreibenden Unternehmen verlangen. Das wird bisher kaum praktiziert, ist aber auch nachträglich möglich. Durch eine Änderung des BbergG kann die Bundesregierung die Sicherheitsleistung verpflichtend machen. Im Falle der Insolvenz von bergbautreibenden Tochterunternehmen können sich die Mutterkonzerne bisher der Verantwortung entziehen. Ein Nachhaftungsgesetz würde diese Möglichkeit stark einschränken und sollte ergänzend zu den Sicherheitsleistungen geprüft werden. Für die langfristigen Folgekosten ist die Einrichtung eines öffentlich-rechtlichen Fonds mit Nachschusspflicht der Betreiber zu prüfen. Am Ende ohne Kohle? 3/ 20
4 Ausgangslage: Höchste Zeit für eine Diskussion Die Förderung des Energieträgers Braunkohle im Tagebau ist mit erheblichen Eingriffen in Landschaft, Wasserhaushalt und Siedlungsstrukturen verbunden. Um die vom Bergbau beanspruchten Gebiete wieder nutzbar zu machen und negative Auswirkungen zu beheben, fallen Kosten in Milliardenhöhe an und das über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten nach Auskohlung der Tagebaue. Die Debatte zur Begrenzung gesellschaftlicher Folgekosten von energiewirtschaftlichen Industriebereichen bezieht sich bislang allerdings fast ausschließlich auf die Atomenergie. Die Kommission zur Finanzierung des Kernenergieausstiegs (KFK) hat der Bundesregierung jüngst empfohlen, finanzielle Mittel für die Zwischen- und Endlagerung des Atommülls in einem öffentlich-rechtlichen Fonds zu sichern. Die KFK hat mit diesem Vorschlag deutlich gemacht, dass die bisherige Praxis der Rückstellungsbildung der Energieversorger für die Finanzierung langfristiger Nachsorgemaßnahmen nicht sicher ist. Analog zum Atombereich ist die Folgekostenfinanzierung auch beim Braunkohlebergbau über unternehmensinterne Rückstellungen geregelt. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der politisch immer dringlicher werdenden Frage nach dem Zeitraum und der Ausgestaltung eines Braunkohleausstiegs muss auch in diesem Bereich der konventionellen Energieversorgung ernsthaft geprüft werden, wie die Finanzierung durch die Verursacher gesichert werden kann. Denn das Risiko, dass die Unternehmen nicht vollumfänglich für die Folgekosten aufkommen werden, erhöht sich durch die schlechte betriebswirtschaftliche Situation der Energieversorger und die dadurch angestoßenen Umstrukturierungsprozesse. Der Verkauf des Lausitzer Braunkohlegeschäfts von Vattenfall an ein Konsortium aus dem tschechischen Energieunternehmen EPH und der internationalen Finanz- und Investmentgruppe PPF macht deutlich, dass die Verantwortung für die langfristige Nachsorge übertragen werden kann und ein besonderes Augenmerk auf die Risiken des heutigen Finanzierungsmodells gelegt werden muss. Die Analyse und Handlungsempfehlungen in diesem böll.brief basieren auf der Studie Finanzielle Vorsorge im Braunkohlebereich, die das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) und das Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) in Potsdam im Auftrag mehrerer Umweltorganisationen und Stiftungen erstellt haben.[1] Dazu wurden öffentlich zugängliche Informationen der Unternehmen, Fachliteratur und Rechtsnormen ausgewertet. Zusätzlich wurden Gespräche und schriftliche Korrespondenz mit der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft mbh (MIBRAG) und RWE Power AG durchgeführt. 1 FÖS/IASS (2016): Finanzielle Vorsorge im Braunkohlebereich Optionen zur Sicherung der Braunkohlerückstellungen und zur Umsetzung des Verursacherprinzips. Berlin. Verfügbar unter: Am Ende ohne Kohle? 4/ 20
5 Die Folgekosten des Braunkohlebergbaus sind vielfältig und zum Teil langfristig Bereits während des aktiven Abbaus von Braunkohle im Tagebau, insbesondere aber nach dessen Beendigung, fallen vielfältige Kosten für die Nachsorge an. Der ausgekohlte Tagebau muss samt seiner Umgebung wieder in einen nutzbaren Zustand versetzt werden, und Schäden müssen behoben werden. Das BBergG und die verschiedenen Betriebspläne schreiben konkrete Wiedernutzbarmachungs- und Nachsorgemaßnahmen vor, deren Durchführung in der Verantwortung der Betreiber liegt. Sie umfassen folgende übergeordneten Aufgaben, die in sehr unterschiedlichen Zeiträumen anfallen:[2] Herstellung der geotechnischen und öffentlichen Sicherheit (z. B. Sicherung von Tagebaurestlochböschungen), Rückbau der nicht mehr benötigten Anlagen und Ausrüstungen (z. B. Abbruch von Industrieanlagen und Demontage/Verschrottung von Geräten), Sicherung/Beseitigung von ökologischen Altlasten (z. B. durch Sanierung von Altlastverdachtsflächen), Herstellung eines sich weitestgehend selbstregulierenden Wasserhaushaltes (z. B. Ausgleich des Grundwasserdefizits, Flutung von Tagebaurestlöchern und Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Wasserqualität), Wiedernutzbarmachung der in Anspruch genommenen Flächen[3] (z.b. zur forstoder landwirtschaftlichen Nutzung) und Schaffung von Voraussetzungen für eine in der Regionalplanung festgeschriebene Folgenutzung. 2 Drebenstedt, Carsten, Kuyumcu, Mahmut (2014): Braunkohlesanierung. Grundlagen, Geotechnik, Wasserwirtschaft, Brachflächen, Rekultivierung, Vermarktung. Berlin, S Hiermit ist die ordnungsgemäße Gestaltung der vom Bergbau in Anspruch genommenen Oberfläche unter Beachtung des öffentlichen Interesses gemeint nicht etwa die Wiederherstellung eines äquivalenten ökologischen Zustands wie zu Zeiten vor Beginn des Bergbaus, Vgl. Bergs, Stefan (2006): Rückstellungen im Braunkohlenbergbau. Wiesbaden, S. 7ff. Am Ende ohne Kohle? 5/ 20
6 Abbildung 1: Übersicht zum zeitlichen Ablauf der Zwischenbewirtschaftung und der Wiedernutzbarmachung (WNBM) [4] Zu den größten ökologischen Eingriffen des Braunkohlebergbaus gehört die erforderliche Absenkung des Grundwasserspiegels des betroffenen Gebietes, mindestens für die Dauer des Tagebaubetriebs, um die Braunkohleflöze trockenzulegen (sogenannte Sümpfung). Dies hat erhebliche Folgen für die Böden bis hin zur Verödung biologisch sensibler Feucht- und Sumpfgebiete. Die beanspruchten Flächen sind für eine Folgenutzung durch Land- oder Forstwirtschaft oftmals für viele Jahre ungeeignet. Durch Sümpfungsmaßnahmen bei den aktiven Tagebauen und den Wiederanstieg des Grundwasserspiegels nach Beendigung der Auskohlung werden zudem Sulfat und Eisenverbindungen aus dem Abraum ausgewaschen und führen zur Verockerung und Versauerung bestehender Oberflächengewässer und Grundwasserläufe. Das Lausitzer Braunkohlerevier beeinträchtigt durch die steigende Sulfatbelastung der Spree die Wasserqualität bis nach Berlin. Gewässernachsorge ist für Jahrzehnte notwendig Während ein großer Teil der Wiedernutzbarmachung während des Tagebaubetriebs und einige Jahre nach der Auskohlung durchgeführt wird (siehe Abbildung 1), kann die Wie- 4 Ebd., S. 60. Am Ende ohne Kohle? 6/ 20
7 derherstellung eines physisch und chemisch ausgeglichenen Wasserhaushalts über viele Jahrzehnte andauern. Beispielsweise wird die Flutung der rheinischen Tagebaue Hambach und Garzweiler voraussichtlich rund 40 Jahre dauern. Das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet Schwalm-Nette in Nordrhein-Westfalen muss aufwändig künstlich bewässert werden, damit das Feuchtgebiet nicht austrocknet. Andernorts muss die Trinkwasserversorgung über Fernleitungen sichergestellt werden, oder es müssen aufwändige Maßnahmen zur Wasseraufbereitung (Beispiel Sulfatbelastung der Spree) vorgenommen werden. Obwohl die bergbautreibenden Unternehmen für die Gewässernachsorge verantwortlich sind, gibt es immer wieder Streitigkeiten darüber, wer im Einzelfall für welches Gewässer und welche Maßnahmen verantwortlich ist. So gehen bereits jetzt Kosten für die Trinkwasseraufbereitung oder die Einnahmeverluste durch die eingeschränkte Nutzbarkeit für Tourismuszwecke zulasten der öffentlichen Hand. [5] Dauerhafte Sümpfungen sind Ewigkeitskosten der Braunkohle In manchen Gebieten wird es sogar notwendig sein, den Wiederanstieg des Grundwassers dauerhaft zu verhindern. Eine Studie im Auftrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag von Nordrhein-Westfalen geht davon aus, dass Wasserhaltungsmaßnahmen, beispielsweise zum Schutz von tief liegenden Gebäuden und Infrastruktur, sogar bis in alle Ewigkeit nötig sein könnten.[6] Auch weil es rechtliche Streitigkeiten um die Verursacherfrage gibt, ist insbesondere in der langen Frist eine Beteiligung der öffentlichen Hand oder privater Geschädigter nicht ausgeschlossen. Ob es im Braunkohlebergbau tatsächlich signifikante Ewigkeitslasten im Sinne unbefristeter Kosten gibt, ist bislang nicht systematisch untersucht worden und wird beispielsweise von RWE bestritten. Bergschäden: Das Problem mit der Beweislast Der Wasserentzug und die sich damit ändernde Bodenbeschaffenheit können zu Geländesackungen oder -rutschungen führen. In den Braunkohlerevieren sind Tausende Bergschäden aktenkundig. Beispiele für Schäden an Privateigentum sind etwa Feuchtigkeit, Risse oder 5 FÖS (2015): Gesellschaftliche Kosten der Braunkohle im Jahr Kurzstudie im Auftrag von Greenpeace e.v., S. 2ff. Verfügbar unter: Kosten-der-Braunkohle.pdf. 6 Krupp, Ralf (2015): Auswirkungen der Grundwasserhaltung im Rheinischen Braunkohlenrevier auf die Topographie und die Grundwasserstände, sowie daraus resultierende Konsequenzen für Bebauung, landwirtschaftliche Flächen, Infrastruktur und Umwelt, S. 5. Abrufbar unter: gruene-fraktion-nrw.de/fileadmin/user _ upload/ltf/publikationen/sonstiges/krupp _ Gutachten _ Braunkohle _ NRW _ komplett _ Web.pdf. Am Ende ohne Kohle? 7/ 20
8 Schieflagen im Mauerwerk. Die Folge sind u. a. Wertverluste der betroffenen Objekte bzw. Grundstücke. Auch öffentliche Infrastrukturen wie Kanalisationsnetze, Straßen, Bürgersteige, Versorgungsleitungen oder öffentliche Gebäude können durch Bergschäden betroffen sein. Die Kosten müssen häufig von den Geschädigten selbst getragen werden, weil es schwierig ist zu beweisen, dass der Bergbau für den Schaden verantwortlich ist. Bereits heute verursacht der Braunkohlebergbau gesellschaftliche Folgekosten Die genannten Beispiele zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der möglichen Folgekosten durch den Braunkohlebergbau. Andere gravierende Folgewirkungen wie der Verlust biologischer Vielfalt, gesundheitliche Auswirkungen durch Luftschadstoffe, Lärm und nicht zuletzt der durch CO 2 -Emissionen mitverursachte Klimawandel sind Beispiele dafür, dass die Gesellschaft bereits heute für einen Teil der Kosten aufkommt.[7] Trotz eindeutiger Rechtslage zur Zahlungspflicht treten in der Praxis immer wieder Fälle auf, in denen nicht der Verursacher bergbaubedingter Folgekosten über seine Rückstellungen herangezogen wird, sondern die Kosten von der Allgemeinheit getragen werden. Die Gefahr der Kostenübernahme durch die Allgemeinheit ist, insbesondere bei langfristigen und nicht eindeutig nachweisbaren, Bergbaufolgen hoch. Rückstellungen zur Finanzierung der Braunkohle-Folgekosten Ein relevanter Teil der skizzierten Maßnahmen zur Wiedernutzbarmachung fällt erst nach Beendigung des aktiven Tagebaubetriebs an. Bereits bei der Erstellung des Raumordnungsplans für den Abbau der Braunkohle (Braunkohlenplan) wird festgelegt, wie die beanspruchten Flächen nach der Kohlegewinnung genutzt werden, z. B. als land- oder forstwirtschaftliche Nutzfläche oder als künstlicher See.[8] Die konkreten Verpflichtungen und Maßnahmen werden in den Betriebsplänen der bergbautreibenden Unternehmen 7 Für einen umfassenden Überblick über die gesellschaftlichen Folgekosten der Braunkohle siehe FÖS (2014a): Kostenrisiken für die Gesellschaft durch den deutschen Braunkohletagebau. Studie im Auftrag von Greenpeace e. V., verfügbar unter: Folgekosten-Braunkohle.pdf; und FÖS (2015). 8 Vgl. Landesregierung Brandenburg (2009): Verordnung über den Braunkohlenplan Tagebau Jänschwalde. Verfügbar unter: Am Ende ohne Kohle? 8/ 20
9 konkretisiert und von den zuständigen Bergbehörden zugelassen. Wie hoch die Kosten dafür sein werden und wann sie anfallen, wird von den bergbautreibenden Unternehmen mit Unterstützung von Sachverständigen kalkuliert. Dabei müssen sie mögliche Kosten- und Preissteigerungen berücksichtigen und die Berechnungen regelmäßig aktualisieren.[9] Die Höhe der Rückstellungen wird von den Betreibern selbst berechnet Die Schätzung der Folgekosten und die Berechnung der Rückstellungen werden von den Unternehmen selbst durchgeführt, von Wirtschaftsprüfern jährlich im Rahmen der für Großbetriebe vorgeschriebenen Prüfung testiert und bei der Betriebsprüfung dem Finanzamt vorgelegt. Da die Unternehmen nicht verpflichtet sind, ihre Kostenschätzungen zu veröffentlichen, können diese Berechnungen bisher weder von der Öffentlichkeit noch von den Landesregierungen nachvollzogen oder überprüft werden. Lediglich das Gesamtvolumen bergbaubedingter Rückstellungen, die Zuführungen und Auflösungen und zum Teil die angesetzten Abzinsungssätze werden im Rahmen der Jahresabschlüsse und der Geschäftsberichte veröffentlicht. Abbildung 2: Übersicht über die Entwicklung bergbaubedingter Rückstellungen Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Jahresabschlüsse der jeweiligen Unternehmen 9 IDW (2015): Stellungnahme zur Rechnungslegung: Einzelfragen zur handelsrechtlichen Bilanzierung von Verbindlichkeitsrückstellungen (IDW RS HFA 34), S. 8. Am Ende ohne Kohle? 9/ 20
10 Die Höhe der Rückstellungen hängt auch von der durch das Handelsgesetzbuch (HGB) festgelegten Verzinsungsrate ab. Die Maßnahmen, für die Rückstellungen gebildet werden, werden nicht unmittelbar, sondern erst in der Zukunft durchgeführt, teils sogar erst Jahrzehnte nach der Rückstellungsbildung. Da von einer gewissen Verzinsung ausgegangen wird, ist der heute ausgewiesene Rückstellungswert niedriger als die erwarteten Kosten in der Zukunft. Von den zukünftigen Kosten aus betrachtet, wird dies als Abzinsung bezeichnet, die vom Zeitraum bis zur Fälligkeit der Zahlung und dem angenommenen Zinssatz abhängt. Dies hat speziell für langfristige Maßnahmen einen signifikanten Einfluss auf die Höhe der Rückstellungen: Je höher die angenommene Verzinsung, desto geringer der Betrag, der heute (Barwert) für die in der Zukunft anfallenden Kosten angelegt werden muss und umso größer wird der Anteil der Rückstellungsbildung, der in die Zukunft verlagert wird. Rückstellungen können von den Unternehmen frei verwendet werden Rückstellungen sind keine separat gesicherten Finanzmittel, sondern zukünftige Zahlungsverpflichtungen, die wie eine Art Schuldschein in den Geschäftsbilanzen vermerkt sind. In der Gewinn- und Verlustrechnung stellt die Rückstellungsbildung einen Aufwand mit späterem Fälligkeitszeitpunkt und Cashflow dar. Durch die Bildung zusätzlicher Rückstellungen wird der zu versteuernde Gewinn der Unternehmen gemindert. Wenn der Zeitpunkt zur Finanzierung einer Maßnahme gekommen ist, müssen die Rückstellungen aufgelöst und die Maßnahme aus den laufenden Einnahmen oder durch Liquidierung von Vermögen (z. B. Kraftwerke, Maschinen, Unternehmensbeteiligungen) der Unternehmen bezahlt werden. Bis zur Fälligkeit der Zahlung steht es den Unternehmen völlig frei, wie sie die Rückstellungen verwenden. Es ist folglich nicht bekannt, ob die Mittel in Sachanlagen wie Grundstücken, Kraftwerken oder Maschinen, in Finanzanlagen wie Unternehmensbeteiligungen, in Wertpapieren oder auch im Umlaufvermögen (z. B. Roh- und Betriebsstoffen) angelegt sind. Das HGB schreibt keine sichtbare Zuordnung von Rückstellungen (Passivseite) und Rückstellungsgegenwerten (Aktivseite) vor.[10] Es ist also nicht festgelegt, aus welchem konkreten Vermögen welche Rekultivierungsmaßnahmen finanziert werden sollen. 10 Irrek, Wolfgang, Vorfeld, Michael (2015): Liquidität und Werthaltigkeit der Anlage der freien Mittel aus der Bildung von Rückstellungen für Stilllegung, Rückbau und Entsorgung der Atomkraftwerke, S. 16. Verfügbar unter: blob/384740/3c7b60161cce4b0add0706dfaaa6f345/kmat _ 38-data.pdf. Am Ende ohne Kohle? 10/ 20
11 Handlungsbedarf: Welche Risiken birgt die Finanzierung über Rückstellungen? Das skizzierte System der handelsrechtlichen Rückstellungsbildung birgt einige ernst zu nehmende Risiken: Intransparenz von Kostenschätzung und Rückstellungsberechnung Im Jahr 2014 betrugen die bergbaubedingten Rückstellungen der Braunkohlebergbaubetreiber 3,2 Mrd. Euro. Die zugrundeliegenden unternehmensinternen Kostenschätzungen sind bislang weder für die Öffentlichkeit noch für die Landesregierungen nachvollziehbar. Es kann nicht überprüft werden, welche Folgekosten im Detail von den Kostenschätzungen abgebildet und ob die abgebildeten Kosten vollumfänglich erfasst werden. Vor allem sehr langfristige ökologische Auswirkungen des Tagebaus, z. B. im Bereich Wasserhaushalt, könnten in den kommenden Jahrzehnten Kosten verursachen, die in ihrer Dauer und Höhe schwer abzusehen sind und die deshalb in den Rückstellungen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Das Risiko der Vergesellschaftung dieser Kosten ist hoch, wie z. B. der aktuelle Umgang mit der teils schlechten Wasserqualität der Spree und weiterer Fließgewässer zeigt, die durch aktive und bereits ausgekohlte Tagebaue verursacht wurde. Auch die Frage, in welchem Umfang Ewigkeitslasten im Braunkohlebergbau existieren und inwiefern sie durch Rückstellungen abgedeckt sind, kann anhand der verfügbaren Informationen nicht abschließend beantwortet werden. Unzureichende Konzernhaftung im Insolvenzfall und wirtschaftliche Entwicklung der Konzerne Im Falle der Insolvenz könnten sich die Mutterunternehmen der Bergbaubetreiber nach geltender Gesetzeslage zum einen durch die Kündigung von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen, zum anderen durch gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen der Verantwortung für die Folgekosten entziehen. In beiden Fällen müssten in letzter Konsequenz der Staat und damit die Steuerzahler/innen für die Kosten einstehen. Dass der Insolvenzfall nicht gänzlich ausgeschlossen ist, zeigt die wirtschaftliche Entwicklung der bergbautreibenden Unternehmen und ihrer Mutterkonzerne in den letzten Jahren: Die Verschuldung lag Ende 2015 im Falle von RWE bei fast 800 %, die von Vattenfall bei 300 %. Die operative Rendite ist mit den geringeren Erlösen aus Stromverkäufen gesunken, und die konventionellen Kraftwerke haben an Wert verloren. Die Unternehmen begegnen dieser Situation teils mit umfassenden betriebswirtschaftlichen Umstrukturierungen. So hat RWE das Zukunftsgeschäft mit erneuerbaren Energien, Netzen und Vertrieb in der neuen Tochtergesellschaft Innogy gebündelt; die konventionelle Stromerzeugung (samt Atom- und Bergbaurückstellungen) und der Energiehandel verbleiben beim Mutterkonzern. Wie sich dies auf die Verantwortung für Folgekosten des konventionellen Energiegeschäfts auswirken wird, bleibt abzuwarten. Am Ende ohne Kohle? 11/ 20
12 Tabelle 1: Entwicklung der operativen Rendite von RWE AG und Vattenfall AB 10% Operative Rendite 8% 6% 4% 2% 0% -2% % -6% RWE AG Vattenfall Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Irrek/Vorfeld (2015) Gegenseitige Abhängigkeiten der Rückstellungen für Atom und Braunkohle Trotz der in der Theorie unabhängig erfolgenden Kalkulation und Ausweisung von Atom- und Braunkohlerückstellungen bestehen in der Praxis nicht von der Hand zu weisende Abhängigkeiten. Sowohl Atom- als auch Braunkohlerückstellungen stellen künftige Verbindlichkeiten dar, die sich zeitlich zum Teil überlagern. Vor allem RWE ist von beiden Nachsorgeverpflichtungen stark betroffen. Das Insolvenzrisiko wird dadurch erhöht. Zu hohe Abzinsung Das HGB schreibt vor, welche Zinssätze für die Rückstellungsberechnung je nach Fälligkeitszeitpunkt verwendet werden müssen. Ein wichtiges Element ist die Mittelung der Zinssätze über die vergangenen sieben Geschäftsjahre (siehe beispielhaft schwarze Linien in Abbildung 3 für eine Restlaufzeit von 20 Jahren). Diese Mittelung hat in einer Phase stark sinkender Zinsen (wie derzeit, siehe rote Linie in Abbildung 3) zur Folge, dass relativ hohe Zinssätze angesetzt werden und so die Rückstellungsbildung zum Teil in die Zukunft verlagert wird. Die Verlagerung der Rückstellungsbildung in die Zukunft ist angesichts der schlechten betriebswirtschaftlichen Situation der Bergbauunternehmen als zusätzliches Risiko zu werten. Am Ende ohne Kohle? 12/ 20
13 Abbildung 3: Abzinsungszinssätze gem. 53 Abs. 2 HGB für eine Restlaufzeit von 20 Jahren (schwarz) und Zinsstrukturkurve börsennotierter Bundeswertpapiere (rot, Svensson-Methode) Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Deutsche Bundesbank (2016)[11] Wie kann die Finanzierung der Folgekosten gesichert werden? Vor dem Hintergrund dieser Risiken die letztlich Risiken für die Belastung der öffentlichen Hand sind ist es dringend geboten, die derzeitige Praxis der handelsrechtlichen Rückstellungen zu ändern, um die Finanzierungsvorsorge im Braunkohlebereich durch die Betreiber auf ein tragfähiges Fundament zu stellen und möglichst insolvenzfest auszugestalten. Zu diesem Zweck eignen sich folgende Schritte: 11 Deutsche Bundesbank (2016): Abzinsungssätze gemäß 253 Abs. 2 HGB. Historische Werte. Abrufbar unter: _ und _ Kapitalmaerkte/Zinssaetze _ und _ Renditen/Abzinsungssaetze/Tabellen/tabellen.html. Letzter Zugriff am: Am Ende ohne Kohle? 13/ 20
14 Unabhängiges Kostengutachten zur Überprüfung der Folgekosten und Rückstellungsberechnung Als sofortiger Schritt sollte von der Bundesregierung (ggf. zusammen mit den betroffenen Landesregierungen) ein unabhängiges Gutachten zur Überprüfung der Kostenschätzung und Rückstellungsberechnung im Braunkohlebereich in Auftrag gegeben werden. Die wichtigsten Aufgaben des Gutachtens wären die Kostenschätzung und Rückstellungsberechnung der Unternehmen im Detail transparent zu machen, unabhängige Schätzungen der Folgekosten des Tagebaus vorzunehmen und die tatsächliche Praxis mit den unabhängigen Folgekostenschätzungen zu vergleichen. Besonders die langfristigen Kosten bzw. mögliche Ewigkeitslasten müssen untersucht werden. Die Unternehmen sollten den Gutachter/innen befristet Zugang zu den erforderlichen Daten und Informationen gewähren. Das entsprechende Gutachten sollte der Öffentlichkeit abschließend zugänglich gemacht werden. Der Stresstest zu den Atomrückstellungen hat gezeigt, dass ein solches Vorgehen umsetzbar ist.[12] Zusätzlich zum Gutachten sollten die Berichtspflichten der bergbautreibenden Unternehmen bezüglich Folgekostenschätzung und Rückstellungsbildung ausgeweitet werden. Angesichts des Risikos einer zu hohen Abzinsung ist eine Überprüfung der gesetzlich vorgegebenen Methode zur Abzinsung ratsam. [13] Sicherheitsleistungen nach 56 BBergG für den Insolvenzfall erheben 56 BBergG bietet den zuständigen Bergbehörden bereits heute die Möglichkeit, eine Sicherheitsleistung zu erheben, um sicherzustellen, dass die Wiedernutzbarmachungsverpflichtungen erfüllt werden. Im Gegensatz zu Rückstellungen können Sicherheitsleistungen vor Insolvenz geschützt werden. Mögliche Formen von Sicherheitsleistungen sind z. B. die Hinterlegung von Barmitteln oder Wertpapieren, Bankbürgschaften oder Versicherungsverträge. Die Landesregierungen sollten ihre für den Braunkohlebergbau zuständigen Bergbehörden dazu auffordern, Sicherheitsleistungen von den Bergbaubetreibern (auch nachträglich) einzufordern. Da die Erhebung einer Sicherheitsleistung bisher im Ermessen der Landesbergbehörden liegt, könnte die Bundesregierung diese auch mit einer Änderung des BBergG verbindlich machen. Im Gegensatz zu Braunkohletagebauen werden bei Kies- und Kiessandtagebauen mit Verweis auf 56 BbergG standardmäßig Sicherheitsleistungen von den Landesbergbehörden erhoben (z.b. Tagebaue Biesen, Ruhlsdorf, Wollschow). Verpflichtende Sicherheitsleistungen gibt es z. B. auch schon bei der Genehmigung von Abfallentsorgungseinrichtungen und Windenergieanlagen. Brandenburg legt dabei per Runderlass fest, dass für alle Abfallentsorgungseinrichtungen eine Sicherheitsleistung verlangt 12 WKGT (2015): Gutachtliche Stellungnahme zur Bewertung der Rückstellungen im Kernenergiebereich im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Verfügbar unter: stresstestkernenergie,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf. 13 Ebd.,S Am Ende ohne Kohle? 14/ 20
15 wird. Sicherheitsleistungen für Windenergieanlagen sind bundesweit im Baugesetzbuch (BauGB) in Form von Verpflichtungserklärungen zum Rückbau vorgeschrieben ( 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB). Haftung der Mutterkonzerne sicherstellen Um den Gefahren von gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen und der Kündigung von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zu begegnen, sollte zudem eine langfristige Nachhaftung von Mutterkonzernen für die Bergbaubetreiber hinsichtlich der Kosten der bergbaulichen Wiedernutzbarmachung und Nachsorge sichergestellt werden. Dazu müsste die Bundesregierung als ersten Schritt ein Nachhaftungsgesetz für die Braunkohlewirtschaft verabschieden. Wesentliches Ziel eines solchen Nachhaftungsgesetzes wäre es, dass die Mutterkonzerne im Falle der Insolvenz der Bergbaubetreiber für die Zahlungsverpflichtungen aufkommen. Dies gilt auch und gerade, wenn der Bergbaubetreiber als Rechtsträger erloschen ist oder wenn das Bergbaugeschäft vom Mutterkonzern getrennt wird. Im Falle solcher gesellschaftsrechtlicher Umstrukturierungen müsste dies zukünftig auch umgekehrt gelten, d. h. Tochterunternehmen müssten für ihre Mutterunternehmen nachhaften. Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der deutschen Stromwirtschaft (wirtschaftliche Situation, Umstrukturierungen, Verkauf) sind darüber hinaus weitere Maßnahmen zur langfristigen Finanzierungsvorsorge zu diskutieren (s. u.). Wenn im Gutachten zur Rückstellungsberechnung signifikante langfristige Kosten und daraus resultierende Risiken der Finanzierungsvorsorge identifiziert werden, sollte sorgfältig geprüft werden, ob eine Finanzierungsvorsorge außerhalb der entsprechenden Unternehmen infrage kommt. Je nach Kosten- und Risikobewertung ließe sich ein Eingreifen des Staates zur Sicherstellung der öffentlich-rechtlichen Pflichten zur Finanzierungsvorsorge der Bergbaubetreiber begründen, z. B. indem der Staat einen Fonds auflegt und dafür Mittel von den Betreibern einfordert. Die Eignung spezifischer Instrumente zur Sicherung der langfristigen Finanzierungsvorsorge im Braunkohlebergbau ist dann im Detail zu untersuchen (u. a. externer Fonds, Kombination interner/externer Lösungen). Folgende Instrumente sind grundsätzlich geeignet: Die Einrichtung eines öffentlich-rechtlichen Fonds mit Nachschusspflicht verspricht die höchste Sicherheit für die langfristige Finanzierungsvorsorge, da eine solche Lösung bestmöglich im Falle von Insolvenzen schützt. In einem solchen Fonds verbleibt die Verfügungsgewalt über die Fondsmittel nicht bei den Betreibern. Die finanziellen Mittel werden also einem externen Sondervermögen zugeführt.[14] Eine solche langfristige Finanzierungsvorsorge wäre insbesondere für den Bereich der 14 BBH, Irrek, Wolfgang (2014): Finanzielle Vorsorge im Kernenergiebereich - Etwaige Risiken des Status quo und mögliche Reformoptionen. Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, S. 97. Verfügbar unter: rechtsgutachten-rueckstellung-kernenergie,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=t rue.pdf. Am Ende ohne Kohle? 15/ 20
16 Wiederherstellung eines physisch und chemisch ausgeglichenen Wasserhaushalts und anderer langfristiger Folgen zentral. Der öffentlich-rechtliche Fonds könnte auch eine größere Sicherheit bei potenziell anfallenden Ewigkeitskosten bieten. Im Atombereich bereichern Vorschläge dieser Art bereits seit den 1990er-Jahren die Debatte. Zu den Vorreitern in der Ausgestaltung externer Fondslösungen zur finanziellen Vorsorge im Atombereich gehören gegenwärtig die Schweiz, Schweden und Finnland. [15] In allen drei Ländern bleibt die Verantwortung für die Stilllegungs-, Rückbauund Entsorgungsaktivitäten bei den Betreibern. Im Falle der Schweiz existiert zudem ein pauschaler Risikozuschlag von 30%. Der zentrale Unterschied zwischen dem Atom- und Braunkohlebereich liegt darin, dass das Atomgesetz regelt, dass der Staat für die Errichtung und den Betrieb eines Endlagers für den Atommüll zuständig ist, während im Braunkohlebereich allein die Betreiber für die Nachsorge verantwortlich sind. Vor diesem Hintergrund muss genau geprüft werden, inwiefern Schlussfolgerungen aus dem Atom- auch auf den Braunkohlebereich übertragen werden können. Eine Kombination von internen und externen Lösungen, für kurz- bis mittelfristige Verbindlichkeiten einerseits und langfristige Verbindlichkeiten andererseits, erscheint grundsätzlich als geeignete Lösung, um unterschiedliche Zeiträume von anfallenden Folgekosten angemessen zu berücksichtigen. Denkbar wäre hier beispielsweise eine Kombination aus Sicherheitsleistung nach 56 BBergG für kurz- bis mittelfristige Verbindlichkeiten und einem externen Fonds für langfristige Verbindlichkeiten. Von dieser Lösung verspricht man sich einen Ausgleich zwischen der Erhöhung der Finanzierungssicherheit für die Gesellschaft und der Wahrung der Wirtschaftlichkeit für die Betreiber. Eine andere Möglichkeit zur Sicherung der Finanzierungsvorsorge durch die Bergbauunternehmen bestünde grundsätzlich auch darin, ähnlich wie beim Steinkohlebergbau eine privatrechtliche Stiftung zu gründen. Die Diskussion dazu steht noch am Anfang. Diese Lösung ist jedoch nur im Rahmen einer mit den Betreibern gemeinsam getroffenen politischen Vereinbarung für einen geregelten Braunkohleausstieg denkbar. Bisher ist ein solcher Braunkohlekonsens noch nicht in Sicht. Für die Umsetzung des Verursacherprinzips bei der Bewältigung der Folgekosten ist eine tragfähige Finanzierungsstruktur für den Aufbau eines ausreichenden Stiftungsvermögens zentral. Die ursprünglichen Betreiber sollten dabei die Haftung für unerwartete Kostensteigerungen nicht auf den Staat übertragen können (Nachschusspflicht). Tabelle 2 fasst die Handlungsempfehlungen hinsichtlich der identifizierten übergeordneten Risiken zeitlich differenziert (sofort/mittelfristig) zusammen. 15 Ebd., S. 102ff; FÖS (2014b): Atomrückstellungen für Stilllegung, Rückbau und Entsorgung - Kostenrisiken und Reformvorschläge für eine verursachergerechte Finanzierung. Studie im Auftrag des BUND. Verfügbar unter: _ FOES _ Atomrueckstellungen.pdf. Am Ende ohne Kohle? 16/ 20
17 Tabelle 2: Übersicht Handlungsoptionen für die Sicherung der Finanzierungsvorsorge im Braunkohlebereich Übergeordnete Risiken Unzureichende Höhe der Rückstellungen (auch für langfristige Kosten) Mögliches Instrument Sofort umsetzbar Unabhängiges Kostengutachten > von der Bundesregierung und/oder Landesregierungen beauftragt Mittelfristig umsetzbar Rechtsrahmen für Transparenz ggf. Änderung der Abzinsungsregelungen > gesetzliche Regelungen durch die Bundesregierung Insolvenz der bergbautreibenden Tochterunternehmen Fehlende (langfristige) Sicherung der Mittel, z. B. für den Fall der Insolvenz des Mutterkonzerns Überprüfung der langfristigen Kostenrisiken Erheben einer Sicherheitsleistung nach 56 BbergG > Landesregierungen weisen Bergbehörden an Einführung eines Nachhaftungsgesetzes > gesetzliche Regelung durch die Bundesregierung ggf. verpflichtende Sicherheitsleistung oder Sicherungsvermögen > Änderung des BbergG durch die Bundesregierung ggf. öffentlich-rechtlicher Fonds mit Nachschusspflicht > Bundesregierung (und/oder Landesregierung) prüft ggf. privatrechtliche Stiftung > Bundesregierung und/oder Landesregierung prüfen und nehmen ggf. Verhandlungen auf Quelle: Eigene Darstellung nach FÖS/IASS (2016) Am Ende ohne Kohle? 17/ 20
18 Die Autor/innen Swantje Fiedler ist seit 2009 Mitarbeiterin des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS). Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin und leitet den Bereich Energiepolitik. Ihre Schwerpunkte beim FÖS sind die Konzeption und Wirkungsanalyse ökonomischer Instrumente im Bereich Energiepolitik. Dr. Dominik Schäuble arbeitet seit Oktober 2012 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) Potsdam. Im Zentrum seiner Arbeit stehen klima- und energiepolitische Instrumente zur Umsetzung der Energiewende und die Regulierung des Strommarktes. Er analysierte insbesondere Möglichkeiten zur Regulierung der CO 2 -Emissionen in der Stromerzeugung und zur zukünftigen Finanzierung erneuerbarer Energien. Daniela Setton arbeitet seit Dezember 2015 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) Potsdam. Die Diplom-Politologin analysiert energiepolitische Entscheidungsprozesse in Deutschland wie den Atomausstieg und die Beendigung des Steinkohlenbergbaus im Hinblick auf die Frage, welche Erfahrungen für die Bildung eines nationalen Kohlekonsenses hilfreich sein können. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Forschung ist die soziale Nachhaltigkeit der Energiewende. Rupert Wronski und Clemens Wunderlich arbeiten als Referenten für Energiepolitik beim Forum für Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) in Berlin. Sie beschäftigen sich mit ökomischen Instrumenten in der Energiepolitik und dem Abbau von Subventionen für konventionelle Energieträger. Am Ende ohne Kohle? 18/ 20
19 Mehr zum Themenbereich Veranstaltungen Edutainment Immer in Bewegung? Digitales Nomadentum und Voluntourismus 12. Dezember 2016 / 19 Uhr, Heinrich-Böll-Stiftung I Zoha Aghamehdi E aghamehdi@boell.de T W calendar.boell.de Edutainment Immer in Bewegung? Stadtflucht und Landflucht 21. Februar 2017 / 19 Uhr, Heinrich-Böll-Stiftung I Zoha Aghamehdi E aghamehdi@boell.de T W calendar.boell.de Publikationen Podcast Böll.Spezial Kohle und Energie Hrsg. von der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin. Erscheint demnächst W boell.de/de/podcasts/boellspezial Kohleatlas Daten und Fakten über einen globalen Brennstoff Heinrich-Böll-Stiftung in Kooperation mit BUND, 1. Aufl., Berlin 2015 W boell.de/kohleatlas Braunkohle Irrläufer der deutschen Stromerzeugung. Hrsg. von der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin Nov 2014 W boell.de/de/2014/11/07/braunkohle-irrlaeufer-der-deutschen-stromerzeugung Wärmewende in Kommunen Leitfaden für den klimafreundlichen Umbau der Wärmeversorgung, Hrsg. von der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 2015 W boell.de/de/2015/09/30/waermewende-kommunen Website die englischsprachige Webseite zur deutschen Energiewende Heinrich-Böll-Stiftung W energytransition.de Like and read us on Facebook! W Am Ende ohne Kohle? 19/ 20
20 Impressum Herausgeberin: Heinrich-Böll-Stiftung e.v., Schumannstraße 8, Berlin Kontakt: Referat Ökologie und Nachhaltigkeit, Dr. Stefanie Groll, E groll@boell.de Erscheinungsort: Erscheinungsdatum: Dezember 2016 Lizenz: Creative Commons.(CC BY-NC-ND 4.0) Verfügbare Ausgaben unter: Abonnement (per ) unter: themen.boell.de Die vorliegende Publikation spiegelt nicht notwendigerweise die Meinung der Heinrich-Böll-Stiftung wider. Am Ende ohne Kohle? 20/ 20
Finanzielle Vorsorge im Braunkohlebereich Optionen zur Sicherung der Braunkohlerückstellungen und zur Umsetzung des Verursacherprinzips
 Finanzielle Vorsorge im Braunkohlebereich Optionen zur Sicherung der Braunkohlerückstellungen und zur Umsetzung des Verursacherprinzips Fachgespräch der Bundestagsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen Jetzt
Finanzielle Vorsorge im Braunkohlebereich Optionen zur Sicherung der Braunkohlerückstellungen und zur Umsetzung des Verursacherprinzips Fachgespräch der Bundestagsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen Jetzt
Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 531 der Abgeordneten Heide Schinowsky der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 6/1190
 Landtag Brandenburg 6. Wahlperiode Drucksache 6/1499 Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 531 der Abgeordneten Heide Schinowsky der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 6/1190 Transparenz
Landtag Brandenburg 6. Wahlperiode Drucksache 6/1499 Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 531 der Abgeordneten Heide Schinowsky der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 6/1190 Transparenz
Kursbuch Kohleausstieg
 politische ökologie Kursbuch Kohleausstieg Szenarien für den Strukturwandel Juni 2017_35. Jahrgang_ISSN 0933-5722_B 8400 F Inhalt Inhaltsverzeichnis Aufbruch Einstiege Tausend gute Gründe Der Kohleausstieg
politische ökologie Kursbuch Kohleausstieg Szenarien für den Strukturwandel Juni 2017_35. Jahrgang_ISSN 0933-5722_B 8400 F Inhalt Inhaltsverzeichnis Aufbruch Einstiege Tausend gute Gründe Der Kohleausstieg
Sicherstellung der Finanzierungsvorsorge für die Atommülllagerung
 Sicherstellung der Finanzierungsvorsorge für die Atommülllagerung Rechtsanwältin Dr. Cornelia Ziehm Rechtsanwaeltin-ziehm@posteo.de Hannover, 23. Oktober 2015 Verursacherprinzip Die Atomkraftwerksbetreiber
Sicherstellung der Finanzierungsvorsorge für die Atommülllagerung Rechtsanwältin Dr. Cornelia Ziehm Rechtsanwaeltin-ziehm@posteo.de Hannover, 23. Oktober 2015 Verursacherprinzip Die Atomkraftwerksbetreiber
Was Strom wirklich kostet - Vergleich der staatlichen Förderungen un gesamtgesellschaftlichen Kosten von Atom, Kohle und erneuerbaren Energien.
 Was Strom wirklich kostet - Vergleich der staatlichen Förderungen un gesamtgesellschaftlichen Kosten von Atom, Kohle und erneuerbaren Energien. Herausgeber/Institute: FÖS Autoren: Swantje Fiedler, Bettina
Was Strom wirklich kostet - Vergleich der staatlichen Förderungen un gesamtgesellschaftlichen Kosten von Atom, Kohle und erneuerbaren Energien. Herausgeber/Institute: FÖS Autoren: Swantje Fiedler, Bettina
Finanzielle Vorsorge im Braunkohlebereich
 06 2016 Finanzielle Vorsorge im Braunkohlebereich Optionen zur Sicherung der Braunkohlerückstellungen und zur Umsetzung des Verursacherprinzips Rupert Wronski Swantje Fiedler (FÖS) unter Mitarbeit von
06 2016 Finanzielle Vorsorge im Braunkohlebereich Optionen zur Sicherung der Braunkohlerückstellungen und zur Umsetzung des Verursacherprinzips Rupert Wronski Swantje Fiedler (FÖS) unter Mitarbeit von
Was Strom wirklich kostet Ein Vergleich von Erneuerbaren, Kohle und Atom 12. Österreichisches Windenergie-Symposium Am 10.
 Was Strom wirklich kostet Ein Vergleich von Erneuerbaren, Kohle und Atom 12. Österreichisches Windenergie-Symposium Am 10. März 2016 in Wien Referentin: Swantje Fiedler Leiterin Energiepolitik & Stellvertretende
Was Strom wirklich kostet Ein Vergleich von Erneuerbaren, Kohle und Atom 12. Österreichisches Windenergie-Symposium Am 10. März 2016 in Wien Referentin: Swantje Fiedler Leiterin Energiepolitik & Stellvertretende
Unabhängiges Gutachten zur Kostenschätzung der gesamten Folgekosten der Braunkohle
 Stellungnahme zu Antrag der Fraktion der Piraten 16 STELLUNGNAHME 16/4467 A18 Prof. Dr.-Ing. C. Niemann-Delius Düsseldorf, den 16.11.2016 Unabhängiges Gutachten zur Kostenschätzung der gesamten Folgekosten
Stellungnahme zu Antrag der Fraktion der Piraten 16 STELLUNGNAHME 16/4467 A18 Prof. Dr.-Ing. C. Niemann-Delius Düsseldorf, den 16.11.2016 Unabhängiges Gutachten zur Kostenschätzung der gesamten Folgekosten
Finanzielle Vorsorge im Braunkohlebereich
 06 2016 Finanzielle Vorsorge im Braunkohlebereich Optionen zur Sicherung der Braunkohlerückstellungen und zur Umsetzung des Verursacherprinzips Rupert Wronski Swantje Fiedler (FÖS) unter Mitarbeit von
06 2016 Finanzielle Vorsorge im Braunkohlebereich Optionen zur Sicherung der Braunkohlerückstellungen und zur Umsetzung des Verursacherprinzips Rupert Wronski Swantje Fiedler (FÖS) unter Mitarbeit von
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 17/ Wahlperiode des Abgeordneten Detlef Matthiessen (Bündnis 90 / DIE GRÜNEN)
 SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 17/ 1961 17. Wahlperiode 2011-11-16 Kleine Anfrage des Abgeordneten Detlef Matthiessen (Bündnis 90 / DIE GRÜNEN) und Antwort der Landesregierung Minister für
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 17/ 1961 17. Wahlperiode 2011-11-16 Kleine Anfrage des Abgeordneten Detlef Matthiessen (Bündnis 90 / DIE GRÜNEN) und Antwort der Landesregierung Minister für
Eigentümerübergang der Braunkohle-Sparte von Vattenfall an die LEAG Holding a.s., EPH, PPF-I
 Landtag Brandenburg 6. Wahlperiode Drucksache 6/6301 Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage Nr. 2498 der Abgeordneten Heide Schinowsky der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 6/6097 Eigentümerübergang
Landtag Brandenburg 6. Wahlperiode Drucksache 6/6301 Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage Nr. 2498 der Abgeordneten Heide Schinowsky der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 6/6097 Eigentümerübergang
Parameter unternehmerischer Entscheidungen
 Parameter unternehmerischer Entscheidungen Dr. Hans-Peter Schiffer - Leiter Genehmigungen und Umweltschutz 3. Nachbarschaftsforum, Niederaußem 18. Mai 2010 SEITE 1 Generelle Parameter SEITE 2 Parameter
Parameter unternehmerischer Entscheidungen Dr. Hans-Peter Schiffer - Leiter Genehmigungen und Umweltschutz 3. Nachbarschaftsforum, Niederaußem 18. Mai 2010 SEITE 1 Generelle Parameter SEITE 2 Parameter
Finanzierung der Braunkohle-Folgekosten in Nordrhein- Westfalen. RWE-Umstrukturierung erhöht Risiken für die Deckung der Braunkohlerückstellungen
 Finanzierung der Braunkohle-Folgekosten in Nordrhein- Westfalen RWE-Umstrukturierung erhöht Risiken für die Deckung der Braunkohlerückstellungen Rupert Wronski Swantje Fiedler Hartmut Gaßner Linus Viezens
Finanzierung der Braunkohle-Folgekosten in Nordrhein- Westfalen RWE-Umstrukturierung erhöht Risiken für die Deckung der Braunkohlerückstellungen Rupert Wronski Swantje Fiedler Hartmut Gaßner Linus Viezens
Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland aktuelle Entwicklungen Energiewende konkret
 Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland aktuelle Entwicklungen Energiewende konkret 14.07.2016 Abschalten und das war s? Gorleben, Konrad usw. Rückbau und Endlagerung: Wer ist verantwortlich? Verantwortung
Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland aktuelle Entwicklungen Energiewende konkret 14.07.2016 Abschalten und das war s? Gorleben, Konrad usw. Rückbau und Endlagerung: Wer ist verantwortlich? Verantwortung
Bund-Länder-VerwaltungsabkommenszurSanierungderehemaligenDDR-TagebaueeingeplantenMittelausreichen,umdasVerockerungsprobleminden
 Deutscher Bundestag Drucksache 17/10868 17. Wahlperiode 27. 09. 2012 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Cornelia Behm, Harald Ebner, Hans-Josef Fell, weiterer Abgeordneter
Deutscher Bundestag Drucksache 17/10868 17. Wahlperiode 27. 09. 2012 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Cornelia Behm, Harald Ebner, Hans-Josef Fell, weiterer Abgeordneter
Rechtsanwältin Dr. Cornelia Ziehm, Berlin.
 Stellungnahme im Rahmen der Sachverständigenanhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Nachhaftung für Rückbauund Entsorgungskosten im Kernenergiebereich (Rückbauund Entsorgungskostennachhaftungsgesetz) -
Stellungnahme im Rahmen der Sachverständigenanhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Nachhaftung für Rückbauund Entsorgungskosten im Kernenergiebereich (Rückbauund Entsorgungskostennachhaftungsgesetz) -
Abzinsung von Verbindlichkeiten und Rückstellungen
 Abzinsung von Verbindlichkeiten und Rückstellungen Disclaimer Die im Folgenden zusammengestellten Informationen sind begleitend zum Unterricht des "geprüften Betriebswirt IHK" für das Unterrichtsfach "Bilanz-
Abzinsung von Verbindlichkeiten und Rückstellungen Disclaimer Die im Folgenden zusammengestellten Informationen sind begleitend zum Unterricht des "geprüften Betriebswirt IHK" für das Unterrichtsfach "Bilanz-
Dipl.-Wirt.-Inf. Christina Koch Übung Jahresabschluss Sommersemester Rückstellungen:
 Rückstellungen: Rückstellungen sind Passivposten für bestimmte Verpflichtungen eines Unternehmens, die zu künftigen Ausgaben führen und deren zugehöriger Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden
Rückstellungen: Rückstellungen sind Passivposten für bestimmte Verpflichtungen eines Unternehmens, die zu künftigen Ausgaben führen und deren zugehöriger Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden
EINSENDEARBEIT ZUM KURS 42261
 Einsendearbeit zum Kurs 42261 BILANZPOLITIK UND BILANZANALYSE 1 EINSENDEARBEIT ZUM KURS 42261 BILANZPOLITIK UND BILANZANALYSE KURSEINHEIT I UND II Modul: Rechnungslegung (32781) SS 2016 Aufgabe 1: Kurzfragen
Einsendearbeit zum Kurs 42261 BILANZPOLITIK UND BILANZANALYSE 1 EINSENDEARBEIT ZUM KURS 42261 BILANZPOLITIK UND BILANZANALYSE KURSEINHEIT I UND II Modul: Rechnungslegung (32781) SS 2016 Aufgabe 1: Kurzfragen
Antwort. Drucksache 16/5721. LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 16. Wahlperiode Datum des Originals: /Ausgegeben:
 LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 16. Wahlperiode Drucksache 16/5721 06.05.2014 Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 2154 vom 1. April 2014 der Abgeordneten Ralf Witzel und Dirk Wedel FDP Drucksache
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 16. Wahlperiode Drucksache 16/5721 06.05.2014 Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 2154 vom 1. April 2014 der Abgeordneten Ralf Witzel und Dirk Wedel FDP Drucksache
Technische Universität Clausthal Clausthal-Zellerfeld
 Technische Universität Clausthal Clausthal-Zellerfeld Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2010 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Technische Universität Clausthal, Clausthal-Zellerfeld
Technische Universität Clausthal Clausthal-Zellerfeld Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2010 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Technische Universität Clausthal, Clausthal-Zellerfeld
BCA AG Oberursel. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 und Lagebericht
 BCA AG Oberursel Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 und Lagebericht Dohm Schmidt Janka Revision und Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Inhaltsverzeichnis 1. Bilanz zum 31. Dezember 2013 2.
BCA AG Oberursel Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 und Lagebericht Dohm Schmidt Janka Revision und Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Inhaltsverzeichnis 1. Bilanz zum 31. Dezember 2013 2.
Wie ein schneller Atomausstieg rechtlich zu regeln ist
 27. April 2011 Wie ein schneller Atomausstieg rechtlich zu regeln ist Die Ereignisse im Atomkraftwerk Fukushima sind Anlass, auch für Deutschland die Sicherheitslage und die Risiken der Atomenergie neu
27. April 2011 Wie ein schneller Atomausstieg rechtlich zu regeln ist Die Ereignisse im Atomkraftwerk Fukushima sind Anlass, auch für Deutschland die Sicherheitslage und die Risiken der Atomenergie neu
ConValue AG. Jahresabschluss. für das Geschäftsjahr 2015
 ConValue AG Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 Kirchenstraße 9 21224 Rosengarten e-mail: info@convalue.com www.convalue.com Sitz der Gesellschaft: Rosengarten 1 Lagebericht des Vorstands Im abgelaufenen
ConValue AG Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 Kirchenstraße 9 21224 Rosengarten e-mail: info@convalue.com www.convalue.com Sitz der Gesellschaft: Rosengarten 1 Lagebericht des Vorstands Im abgelaufenen
Amtsblatt der Stadt Wesseling
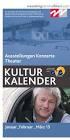 Amtsblatt der Stadt Wesseling 45. Jahrgang Ausgegeben in Wesseling am 15. Januar 2014 Nummer 02 Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 Mit der
Amtsblatt der Stadt Wesseling 45. Jahrgang Ausgegeben in Wesseling am 15. Januar 2014 Nummer 02 Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 Mit der
Verantwortung und Finanzierung infolge des Atomausstiegs XXI. Jahrestagung des IBE. Dipl. Kfm. RA Dr. Sven- Joachim Otto
 www.pwc.de/de/energiewirtschaft Verantwortung und Finanzierung infolge des Atomausstiegs XXI. Jahrestagung des IBE Dipl. Kfm. RA Dr. Sven- Joachim Otto Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich
www.pwc.de/de/energiewirtschaft Verantwortung und Finanzierung infolge des Atomausstiegs XXI. Jahrestagung des IBE Dipl. Kfm. RA Dr. Sven- Joachim Otto Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich
MAR-Leitlinien Aufschub der Offenlegung von Insiderinformationen
 MAR-Leitlinien Aufschub der Offenlegung von Insiderinformationen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DE Inhaltsverzeichnis 1 Anwendungsbereich... 3 2 Rechtsrahmen, Abkürzungen und Begriffsbestimmungen... 3 3 Zweck...
MAR-Leitlinien Aufschub der Offenlegung von Insiderinformationen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DE Inhaltsverzeichnis 1 Anwendungsbereich... 3 2 Rechtsrahmen, Abkürzungen und Begriffsbestimmungen... 3 3 Zweck...
1. Änderung und Ergänzung des Regionalen Raumordungsprogramms für den Landkreis Leer Sachlicher Teilabschnitt Windenergie.
 Landkreis Leer Kreisverwaltung 1. Änderung und Ergänzung des Regionalen Raumordungsprogramms für den Landkreis Leer 2006 Sachlicher Teilabschnitt Windenergie Entwurf - Teil 3 der Begründung - Teil 3 -
Landkreis Leer Kreisverwaltung 1. Änderung und Ergänzung des Regionalen Raumordungsprogramms für den Landkreis Leer 2006 Sachlicher Teilabschnitt Windenergie Entwurf - Teil 3 der Begründung - Teil 3 -
namens der Bundesregierung beantworte ich die o. a. Kleine Anfrage wie folgt:
 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Herrn Prof. Dr. Norbert Lammert, MdB Präsident des Deutschen Bundestages Platz der Republik 1 11011 Berlin HAUSANSCHRIFT POSTANSCHRIFT Rainer Baake Staatssekretär
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Herrn Prof. Dr. Norbert Lammert, MdB Präsident des Deutschen Bundestages Platz der Republik 1 11011 Berlin HAUSANSCHRIFT POSTANSCHRIFT Rainer Baake Staatssekretär
BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG DES ÄNDERUNGSVERTRAGS ZUM BEHERRSCHUNG- UND GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAG ZWISCHEN DER
 BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG DES ÄNDERUNGSVERTRAGS ZUM BEHERRSCHUNG- UND GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAG ZWISCHEN DER Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft, Kulmbach, und der Sternquell-Brauerei GmbH, Plauen, gemäß
BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG DES ÄNDERUNGSVERTRAGS ZUM BEHERRSCHUNG- UND GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAG ZWISCHEN DER Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft, Kulmbach, und der Sternquell-Brauerei GmbH, Plauen, gemäß
Ausstieg aus der Braunkohle in NRW
 Dirk Jansen, Geschäftsleiter BUND NRW e.v. Ausstieg aus der Braunkohle in NRW Tagung der Bundestagsfraktion DIE LINKE Bergheim, 19. Juni 2016 1 Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gegründet
Dirk Jansen, Geschäftsleiter BUND NRW e.v. Ausstieg aus der Braunkohle in NRW Tagung der Bundestagsfraktion DIE LINKE Bergheim, 19. Juni 2016 1 Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gegründet
Aufbau eines öffentlich-rechtlichen Atomfonds
 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW Berlin Anhörung der Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs Outline 1 Anlehnung an Banken-Restrukturierungsfonds 2 DIW Vorschlag
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW Berlin Anhörung der Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs Outline 1 Anlehnung an Banken-Restrukturierungsfonds 2 DIW Vorschlag
Umsetzung der Richtlinie über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie (Bergbauabfallrichtlinie)
 Umsetzung der Richtlinie über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie (Bergbauabfallrichtlinie) RD Theodor Juroszek Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Maßnahmenpaket
Umsetzung der Richtlinie über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie (Bergbauabfallrichtlinie) RD Theodor Juroszek Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Maßnahmenpaket
Kohlekraft in Energieszenarien in Deutschland
 Seminar der Grünen Jugend am 4. Mai 2013 Kohlekraft in Energieszenarien in Deutschland Uwe Nestle Mitglied im Vorstand des Forum Ökologisch Soziale Marktwirtschaft - FÖS Grünes BTWP Schlüsselprojekt: Energiewende
Seminar der Grünen Jugend am 4. Mai 2013 Kohlekraft in Energieszenarien in Deutschland Uwe Nestle Mitglied im Vorstand des Forum Ökologisch Soziale Marktwirtschaft - FÖS Grünes BTWP Schlüsselprojekt: Energiewende
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
 Bestätigungsvermerk Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der VR Equitypartner Beteiligungskapital
Bestätigungsvermerk Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der VR Equitypartner Beteiligungskapital
- Information zum Ausgleichsbetrag -
 Sehr geehrte Eigentümerinnen und Eigentümer, - Information zum Ausgleichsbetrag - seit 1993 hat die städtebauliche Sanierung unser Innenstadtgebiet unübersehbar verändert. Das Zentrum ist schöner und attraktiver
Sehr geehrte Eigentümerinnen und Eigentümer, - Information zum Ausgleichsbetrag - seit 1993 hat die städtebauliche Sanierung unser Innenstadtgebiet unübersehbar verändert. Das Zentrum ist schöner und attraktiver
Grüneisen TaxConsult GmbH Steuerberatungsgesellschaft. Deutsche Krebsstiftung Frankfurt am Main. Handelsrechtlicher Jahresabschluss
 Deutsche Krebsstiftung Frankfurt am Main Handelsrechtlicher Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 Inhaltsverzeichnis A. Auftrag 1 B. Auftragsdurchführung 3 C. Bescheinigung 4 Anlagen Bilanz zum 31. Dezember
Deutsche Krebsstiftung Frankfurt am Main Handelsrechtlicher Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 Inhaltsverzeichnis A. Auftrag 1 B. Auftragsdurchführung 3 C. Bescheinigung 4 Anlagen Bilanz zum 31. Dezember
Was kommt nach der Kohle?
 Was kommt nach der Kohle? - Braunkohlesanierung in Brandenburg - Dr. Sieglinde Reinhardt, Dipl.-Ing. Dirk Scheinemann Abteilung IV des Landesrechnungshofs IV 1 Hochbau und staatlich geförderter Hochbau
Was kommt nach der Kohle? - Braunkohlesanierung in Brandenburg - Dr. Sieglinde Reinhardt, Dipl.-Ing. Dirk Scheinemann Abteilung IV des Landesrechnungshofs IV 1 Hochbau und staatlich geförderter Hochbau
Biofrontera AG I Jahresfinanzbericht 2010 nach HGB
 Biofrontera AG I Jahresfinanzbericht 2010 nach HGB BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010 A K T I V A P A S S I V A 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 EUR EUR EUR EUR EUR EUR A. ANLAGEVERMÖGEN
Biofrontera AG I Jahresfinanzbericht 2010 nach HGB BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010 A K T I V A P A S S I V A 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 EUR EUR EUR EUR EUR EUR A. ANLAGEVERMÖGEN
Inhalt. IAS 37: Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen
 Inhalt 1. Ziele des Standards im Überblick... 2 2. Definitionen... 3 3. Anwendungsbereich... 4 4. Wesentliche Inhalte... 5 I. Ansatz einer Rückstellung in der Bilanz... 5 II. Methoden zur Rückstellungsbewertung...
Inhalt 1. Ziele des Standards im Überblick... 2 2. Definitionen... 3 3. Anwendungsbereich... 4 4. Wesentliche Inhalte... 5 I. Ansatz einer Rückstellung in der Bilanz... 5 II. Methoden zur Rückstellungsbewertung...
T T A. Umlaufvermögen A. Eigenkapital
 Kant-Hartwig & Vogel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Einbeck Bilanz zum 30. Juni 2014 A K T I V A P A S S I V A Vorjahr Vorjahr T T A. Umlaufvermögen A. Eigenkapital Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Kant-Hartwig & Vogel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Einbeck Bilanz zum 30. Juni 2014 A K T I V A P A S S I V A Vorjahr Vorjahr T T A. Umlaufvermögen A. Eigenkapital Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Umweltprüfungen bei Infrastrukturvorhaben
 Umweltprüfungen bei Infrastrukturvorhaben Einblicke in die laufende Umsetzung der UVP Änderungsrichtlinie Dr. Christof Sangenstedt, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit,
Umweltprüfungen bei Infrastrukturvorhaben Einblicke in die laufende Umsetzung der UVP Änderungsrichtlinie Dr. Christof Sangenstedt, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit,
1. welche Ausgestaltung der geplante Pensionsfonds erhalten soll, insbesondere
 14. Wahlperiode 24. 05. 2007 Antrag der Fraktion GRÜNE und Stellungnahme des Finanzministeriums Ausgestaltung des geplanten Pensionsfonds Antrag Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen
14. Wahlperiode 24. 05. 2007 Antrag der Fraktion GRÜNE und Stellungnahme des Finanzministeriums Ausgestaltung des geplanten Pensionsfonds Antrag Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen
WHITEOUT & GLARE, BERLIN BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010 P A S S I V A EUR EUR
 ANLAGE 1 WHITEOUT & GLARE, BERLIN BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010 A K T I V A P A S S I V A 31.12.2010 31.12.2009 EUR EUR A. ANLAGEVERMÖGEN I. Sachanlagen 40.207,00 62.846,25 40.207,00 62.846,25 B. UMLAUFVERMÖGEN
ANLAGE 1 WHITEOUT & GLARE, BERLIN BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010 A K T I V A P A S S I V A 31.12.2010 31.12.2009 EUR EUR A. ANLAGEVERMÖGEN I. Sachanlagen 40.207,00 62.846,25 40.207,00 62.846,25 B. UMLAUFVERMÖGEN
Braunkohlenplanung im Land Brandenburg
 Braunkohlenplanung im Land Brandenburg Kurze Einführung und Überblick Braunkohlenbergbau in der Lausitz - Ein Blick zurück Brandenburg/ Sachsen (Lausitz) 16 Tagebaue 195 Mio t/a Braunkohlenförderung 79.000
Braunkohlenplanung im Land Brandenburg Kurze Einführung und Überblick Braunkohlenbergbau in der Lausitz - Ein Blick zurück Brandenburg/ Sachsen (Lausitz) 16 Tagebaue 195 Mio t/a Braunkohlenförderung 79.000
Kernbrennstoffsteuer nach 2016?
 09 2016 KURZANALYSE IM AUFTRAG VON NATURSTROM AG Kernbrennstoffsteuer nach 2016? Argumente für eine Verlängerung der Kernbrennstoffsteuer und Abschätzung der finanziellen Auswirkungen von Swantje Fiedler
09 2016 KURZANALYSE IM AUFTRAG VON NATURSTROM AG Kernbrennstoffsteuer nach 2016? Argumente für eine Verlängerung der Kernbrennstoffsteuer und Abschätzung der finanziellen Auswirkungen von Swantje Fiedler
Definitions of Fossil Fuel Subsidies
 Definitions of Fossil Fuel Subsidies Definitions used in Germany with examples Workshop für NGOs am 10. September 2015 in Berlin Rupert Wronski Wissenschaftlicher Referent Energiepolitik Forum Ökologisch-Soziale
Definitions of Fossil Fuel Subsidies Definitions used in Germany with examples Workshop für NGOs am 10. September 2015 in Berlin Rupert Wronski Wissenschaftlicher Referent Energiepolitik Forum Ökologisch-Soziale
, ,29
 Bilanz zum 31.12.2014 Die Bilanz der Stiftung Mitarbeit für das Jahr 2014 ist durch Dr. Glade, König und Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Neuss geprüft worden. Ellerstraße
Bilanz zum 31.12.2014 Die Bilanz der Stiftung Mitarbeit für das Jahr 2014 ist durch Dr. Glade, König und Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Neuss geprüft worden. Ellerstraße
Bilanz zum
 Bilanz zum 31.12.2015 Die Bilanz der Stiftung Mitarbeit für das Jahr 2015 ist durch Dr. Glade, König und Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Neuss geprüft worden. Ellerstraße
Bilanz zum 31.12.2015 Die Bilanz der Stiftung Mitarbeit für das Jahr 2015 ist durch Dr. Glade, König und Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Neuss geprüft worden. Ellerstraße
Datenschutzreform 2018
 Datenschutzreform 2018 Die bereitgestellten Informationen sollen die bayerischen öffentlichen Stellen bei der Umstellung auf die Datenschutz-Grundverordnung unterstützen. Sie wollen einen Beitrag zum Verständnis
Datenschutzreform 2018 Die bereitgestellten Informationen sollen die bayerischen öffentlichen Stellen bei der Umstellung auf die Datenschutz-Grundverordnung unterstützen. Sie wollen einen Beitrag zum Verständnis
Jahresrechnung zum der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft Rostock (GmbH & Co.) OHG
 Jahresrechnung zum 31.12.2006 der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft Rostock (GmbH & Co.) OHG 31.12.2006 31.12.2005 Umsatzerlöse - aus Verkauf von Grundstücken 1.826.339,62 1.969.860,17 Minderung des
Jahresrechnung zum 31.12.2006 der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft Rostock (GmbH & Co.) OHG 31.12.2006 31.12.2005 Umsatzerlöse - aus Verkauf von Grundstücken 1.826.339,62 1.969.860,17 Minderung des
Musterbericht Bürgerentlastungsgesetz. für Herrn Bert Bürgerentlastungsgesetz. Musterstraße, Musterstraße
 Musterbericht Bürgerentlastungsgesetz für Herrn Bert Bürgerentlastungsgesetz Musterstraße, Musterstraße erstellt durch Martin Mustermann Steuerberater Wirtschaftprüfer Scharrenbroicher Str. 4 Rösrath www.mustermann.de
Musterbericht Bürgerentlastungsgesetz für Herrn Bert Bürgerentlastungsgesetz Musterstraße, Musterstraße erstellt durch Martin Mustermann Steuerberater Wirtschaftprüfer Scharrenbroicher Str. 4 Rösrath www.mustermann.de
Was Strom wirklich kostet Staatliche Förderungen und gesamtgesellschaftliche Kosten im Vergleich
 Was Strom wirklich kostet Staatliche Förderungen und gesamtgesellschaftliche Kosten im Vergleich WIRKUNGSGRAD Themenreihe "Klima & Energie" Am 15. Oktober 2015 in der Orange Bar, München Referentin: Swantje
Was Strom wirklich kostet Staatliche Förderungen und gesamtgesellschaftliche Kosten im Vergleich WIRKUNGSGRAD Themenreihe "Klima & Energie" Am 15. Oktober 2015 in der Orange Bar, München Referentin: Swantje
Der Nationale Normenkontrollrat hat den Regelungsentwurf geprüft.
 Berlin, 5. Juli 2016 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. 6 Abs. 1 NKRG: Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen
Berlin, 5. Juli 2016 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. 6 Abs. 1 NKRG: Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen
Entschließung des Bundesrates zur Zukunft der Verkehrsfinanzierung
 Bundesrat Drucksache 559/14 (Beschluss) 28.11.14 Beschluss des Bundesrates Entschließung des Bundesrates zur Zukunft der Verkehrsfinanzierung Der Bundesrat hat in seiner 928. Sitzung am 28. November 2014
Bundesrat Drucksache 559/14 (Beschluss) 28.11.14 Beschluss des Bundesrates Entschließung des Bundesrates zur Zukunft der Verkehrsfinanzierung Der Bundesrat hat in seiner 928. Sitzung am 28. November 2014
Testatsexemplar. Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH Bonn. Jahresabschluss zum 31. Dezember Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
 Testatsexemplar Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH Bonn Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers Inhaltsverzeichnis Seite Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
Testatsexemplar Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH Bonn Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers Inhaltsverzeichnis Seite Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013
 Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 MOBILE TIERRETTUNG E. V. Ausbau Kirschberg 15 03058 Groß-Döbbern BILANZ zum 31. Dezember 2013 Mobile Tierrettung e. V., Groß Döbbern
Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 MOBILE TIERRETTUNG E. V. Ausbau Kirschberg 15 03058 Groß-Döbbern BILANZ zum 31. Dezember 2013 Mobile Tierrettung e. V., Groß Döbbern
Übersichten zur Vorlesung JAHRESABSCHLUSS. Informationsziele
 Dr. Harald Wedell Akad. Direktor an der Universität Göttingen Professor der Pfeiffer University, Charlotte / USA Übersichten zur Vorlesung JAHRESABSCHLUSS Teil 1 Informationsziele Einführung: Begriffsabgrenzung
Dr. Harald Wedell Akad. Direktor an der Universität Göttingen Professor der Pfeiffer University, Charlotte / USA Übersichten zur Vorlesung JAHRESABSCHLUSS Teil 1 Informationsziele Einführung: Begriffsabgrenzung
Bundesministerium der Finanzen Bonn, 11. November 1999
 Bundesministerium der Finanzen Bonn, 11. November 1999 - Dienstsitz Bonn - IV C 2 - S 2176-102/99 ( Geschäftszeichen bei Antwort bitte angeben ) Telefon: (0 18 88) 6 82-15 23 (02 28) 6 82-15 23 oder über
Bundesministerium der Finanzen Bonn, 11. November 1999 - Dienstsitz Bonn - IV C 2 - S 2176-102/99 ( Geschäftszeichen bei Antwort bitte angeben ) Telefon: (0 18 88) 6 82-15 23 (02 28) 6 82-15 23 oder über
Kosten Finanzierung Markt Beschäftigungsperspektiven
 Institut Energiesysteme und Energiewirtschaft Kosten Finanzierung Markt Beschäftigungsperspektiven Sommerakademie Atomares Erbe Wolfenbüttel, 06. August 2017 Prof. Dr. Wolfgang Irrek 1 Lernziele Die Teilnehmer*innen
Institut Energiesysteme und Energiewirtschaft Kosten Finanzierung Markt Beschäftigungsperspektiven Sommerakademie Atomares Erbe Wolfenbüttel, 06. August 2017 Prof. Dr. Wolfgang Irrek 1 Lernziele Die Teilnehmer*innen
TÄTIGKEITSABSCHLÜSSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015 QUERDENKEN IDEEN UMSETZEN
 TÄTIGKEITSABSCHLÜSSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015 QUERDENKEN IDEEN UMSETZEN 2 Inhalt TÄTIGKEITSABSCHLÜSSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015 Seite 03 Seite 04 Seite 08 Seite 14 Allgemeine Erläuterungen Tätigkeitsabschluss
TÄTIGKEITSABSCHLÜSSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015 QUERDENKEN IDEEN UMSETZEN 2 Inhalt TÄTIGKEITSABSCHLÜSSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015 Seite 03 Seite 04 Seite 08 Seite 14 Allgemeine Erläuterungen Tätigkeitsabschluss
Beitrag: Milliardenloch Braunkohle? Neue Risiken für den Steuerzahler
 Manuskript Beitrag: Milliardenloch Braunkohle? Neue Risiken für den Steuerzahler Sendung vom 6. September 2016 von Jörg Göbel und Markus Reichert Anmoderation: Der Braunkohle-Tagebau hat eine dreckige
Manuskript Beitrag: Milliardenloch Braunkohle? Neue Risiken für den Steuerzahler Sendung vom 6. September 2016 von Jörg Göbel und Markus Reichert Anmoderation: Der Braunkohle-Tagebau hat eine dreckige
Testatsexemplar. Bertrandt Ingenieurbüro GmbH Köln. Jahresabschluss zum 30. September Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
 Testatsexemplar Bertrandt Ingenieurbüro GmbH Köln Jahresabschluss zum 30. September 2011 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers Inhaltsverzeichnis Seite Jahresabschluss... 1 1. Bilanz zum 30. September
Testatsexemplar Bertrandt Ingenieurbüro GmbH Köln Jahresabschluss zum 30. September 2011 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers Inhaltsverzeichnis Seite Jahresabschluss... 1 1. Bilanz zum 30. September
Das Braunkohlenplanverfahren Jänschwalde-Nord aus der Sicht eines Umweltverbandes - ausgewählte Aspekte - René Schuster,
 Das Braunkohlenplanverfahren Jänschwalde-Nord aus der Sicht eines Umweltverbandes - ausgewählte Aspekte - René Schuster, 28.05.2011 Ist das Ziel der Planung erreichbar? Wie strategisch ist die Umweltprüfung?
Das Braunkohlenplanverfahren Jänschwalde-Nord aus der Sicht eines Umweltverbandes - ausgewählte Aspekte - René Schuster, 28.05.2011 Ist das Ziel der Planung erreichbar? Wie strategisch ist die Umweltprüfung?
Testatsexemplar. Bertrandt Ingenieurbüro GmbH Gaimersheim. Jahresabschluss zum 30. September Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
 Testatsexemplar Bertrandt Ingenieurbüro GmbH Gaimersheim Jahresabschluss zum 30. September 2013 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers "PwC" bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft
Testatsexemplar Bertrandt Ingenieurbüro GmbH Gaimersheim Jahresabschluss zum 30. September 2013 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers "PwC" bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft
Raummanagement (Flächen- und Mietvertragsmanagement)
 Revision SGB III Bericht gemäß 386 SGB III Raummanagement (Flächen- und Mietvertragsmanagement) Inhaltsverzeichnis 1. Zusammenfassung... 1 2. Revisionsergebnisse. 1 2.1 Rolle der BA-Gebäude-, Bau- und
Revision SGB III Bericht gemäß 386 SGB III Raummanagement (Flächen- und Mietvertragsmanagement) Inhaltsverzeichnis 1. Zusammenfassung... 1 2. Revisionsergebnisse. 1 2.1 Rolle der BA-Gebäude-, Bau- und
LEW Verteilnetz GmbH Augsburg. Tätigkeitsabschluss für das Geschäftsjahr 2016
 LEW Verteilnetz GmbH Augsburg Tätigkeitsabschluss für das Geschäftsjahr 2016 Inhalt Allgemeine Erläuterungen 5 Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsverteilung 6 Erklärung der gesetzlichen Vertreter 13 3 4
LEW Verteilnetz GmbH Augsburg Tätigkeitsabschluss für das Geschäftsjahr 2016 Inhalt Allgemeine Erläuterungen 5 Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsverteilung 6 Erklärung der gesetzlichen Vertreter 13 3 4
Mandanteninformation. IT - Systemcheck. DR. NEUMANN SCHMEER UND PARTNER Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater
 Mandanteninformation IT - Systemcheck - Sicherheit für den Geschäftsführer - Die Informationstechnologie ist im Geschäftsalltag allgegenwärtig. Dabei werden unabhängig von der Unternehmensgröße rechtlich
Mandanteninformation IT - Systemcheck - Sicherheit für den Geschäftsführer - Die Informationstechnologie ist im Geschäftsalltag allgegenwärtig. Dabei werden unabhängig von der Unternehmensgröße rechtlich
Abgrenzung zwischen Bundes-Bodenschutzgesetz und Bundesberggesetz
 Abgrenzung zwischen Bundes-Bodenschutzgesetz und Bundesberggesetz Beschluss der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz am 11./12.09.2000, Zustimmung des Länderausschusses Bergbau (LAB) vom 15.12.2000
Abgrenzung zwischen Bundes-Bodenschutzgesetz und Bundesberggesetz Beschluss der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz am 11./12.09.2000, Zustimmung des Länderausschusses Bergbau (LAB) vom 15.12.2000
Strommarkt, Kapazitätsmechanismen, Sicherheitsreserve, Kohleausstieg
 Strommarkt, Kapazitätsmechanismen, Sicherheitsreserve, Kohleausstieg Referat von Eva Bulling-Schröter, MdB Energie- und Klimapolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion DIE LINKE. am 27. Juni 2016 Brüssel
Strommarkt, Kapazitätsmechanismen, Sicherheitsreserve, Kohleausstieg Referat von Eva Bulling-Schröter, MdB Energie- und Klimapolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion DIE LINKE. am 27. Juni 2016 Brüssel
Kommunale Energieversorger setzen auf Stabilität
 Kommunale Energieversorger setzen auf Stabilität Keyfacts über Stadtwerke - Mehr als 1000 kommunale Versorger in Deutschland - Verteilnetze: 770.000 Kilometer in kommunaler Hand - Klimaschutz vor Versorgungssicherheit
Kommunale Energieversorger setzen auf Stabilität Keyfacts über Stadtwerke - Mehr als 1000 kommunale Versorger in Deutschland - Verteilnetze: 770.000 Kilometer in kommunaler Hand - Klimaschutz vor Versorgungssicherheit
Testatsexemplar. Fraport Passenger Services GmbH Frankfurt am Main. Jahresabschluss zum 31. Dezember Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
 Testatsexemplar Fraport Passenger Services GmbH Frankfurt am Main Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers Inhaltsverzeichnis Seite Jahresabschluss... 1 1. Bilanz
Testatsexemplar Fraport Passenger Services GmbH Frankfurt am Main Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers Inhaltsverzeichnis Seite Jahresabschluss... 1 1. Bilanz
Reformbedarf und heutige Realisierungschancen verschiedener Reformansätze
 Institut Energiesysteme und Energiewirtschaft Finanzierung von Stilllegung, Rückbau und Entsorgung kommerzieller Atomkraftwerke Reformbedarf und heutige Realisierungschancen verschiedener Reformansätze
Institut Energiesysteme und Energiewirtschaft Finanzierung von Stilllegung, Rückbau und Entsorgung kommerzieller Atomkraftwerke Reformbedarf und heutige Realisierungschancen verschiedener Reformansätze
Technische Universität Clausthal Clausthal-Zellerfeld
 Technische Universität Clausthal Clausthal-Zellerfeld Prüfungsbericht Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2009 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anlage 1 Techniche Universität
Technische Universität Clausthal Clausthal-Zellerfeld Prüfungsbericht Jahresabschluss und Lagebericht 31. Dezember 2009 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anlage 1 Techniche Universität
Dr. Peter Zenker. Weites Land. Landwirtschaftliche Rekultivierung im Rheinischen Braunkohlenrevier
 Dr. Peter Zenker Weites Land Landwirtschaftliche Rekultivierung im Rheinischen Braunkohlenrevier Dr. Peter Zenker Weites Land Landwirtschaftliche Rekultivierung im Rheinischen Braunkohlenrevier 2 Dr. Peter
Dr. Peter Zenker Weites Land Landwirtschaftliche Rekultivierung im Rheinischen Braunkohlenrevier Dr. Peter Zenker Weites Land Landwirtschaftliche Rekultivierung im Rheinischen Braunkohlenrevier 2 Dr. Peter
Carl Schenck Aktiengesellschaft Darmstadt. Testatsexemplar Jahresabschluss 31. Dezember Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Carl Schenck Aktiengesellschaft Darmstadt Testatsexemplar Jahresabschluss 31. Dezember 2011 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft e e Inhaltsverzeichnis Bestätigungsvermerk Rechnungslegung
Carl Schenck Aktiengesellschaft Darmstadt Testatsexemplar Jahresabschluss 31. Dezember 2011 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft e e Inhaltsverzeichnis Bestätigungsvermerk Rechnungslegung
2.1a Akt. spez. Okt. 13: Besondere Ausgleichsregel im EEG
 2.1a Akt. spez. Okt. 13: Besondere Ausgleichsregel EEG 2.1a Seite 14 119. Erg.-Lfg., Oktober 2013 Akt. spez. Okt. 13: Konventioneller Kraftwerkspark altert 2.1b Konventioneller Kraftwerkspark in Deutschland
2.1a Akt. spez. Okt. 13: Besondere Ausgleichsregel EEG 2.1a Seite 14 119. Erg.-Lfg., Oktober 2013 Akt. spez. Okt. 13: Konventioneller Kraftwerkspark altert 2.1b Konventioneller Kraftwerkspark in Deutschland
Zum Umgang mit Darstellungen in Flächennutzungsplänen soll folgende Regelung aufgenommen werden:
 Planungsrechtliche Einschätzung des Gesetzentwurfes zur Änderung der Bay. Bauordnung (BayBO) vom 09.04.2014 Ausfüllung der Länderöffnungsklausel für die Regelung der Abstände von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung
Planungsrechtliche Einschätzung des Gesetzentwurfes zur Änderung der Bay. Bauordnung (BayBO) vom 09.04.2014 Ausfüllung der Länderöffnungsklausel für die Regelung der Abstände von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung
Umfang und Abgrenzung von Sanierungsuntersuchung und Sanierungsplanung. LLUR-Veranstaltung Altlastensanierung am
 Umfang und Abgrenzung von Sanierungsuntersuchung und Sanierungsplanung LLUR-Veranstaltung Altlastensanierung am 24.09.2015 Sanierungsuntersuchungen und Sanierungsplanung? Entwurfsplanung Schleswig-Holstein.
Umfang und Abgrenzung von Sanierungsuntersuchung und Sanierungsplanung LLUR-Veranstaltung Altlastensanierung am 24.09.2015 Sanierungsuntersuchungen und Sanierungsplanung? Entwurfsplanung Schleswig-Holstein.
IDW Prüfungsstandard: Prüfung von Energieversorgungsunternehmen (IDW PS 610) 1
 1. Vorbemerkungen IDW Prüfungsstandard: Prüfung von Energieversorgungsunternehmen (IDW PS 610) 1 (Stand: 01.03.2006) (1) Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.v. (IDW) legt in diesem IDW
1. Vorbemerkungen IDW Prüfungsstandard: Prüfung von Energieversorgungsunternehmen (IDW PS 610) 1 (Stand: 01.03.2006) (1) Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.v. (IDW) legt in diesem IDW
Carl Schenck Aktiengesellschaft Darmstadt
 Carl Schenck Aktiengesellschaft Darmstadt Testatsexemplar Jahresabschluss 31. Dezember 2014 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Inhaltsverzeichnis Bestätigungsvermerk Rechnungslegung Auftragsbedingungen,
Carl Schenck Aktiengesellschaft Darmstadt Testatsexemplar Jahresabschluss 31. Dezember 2014 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Inhaltsverzeichnis Bestätigungsvermerk Rechnungslegung Auftragsbedingungen,
Tragen die AKW-Betreiber die Atomfolgekosten? - Risiken und Reformoptionen
 Tragen die AKW-Betreiber die Atomfolgekosten? - Risiken und Reformoptionen Grohnde unter Druck am 26.03.2015 in Bielefeld Swantje Küchler Leiterin Energiepolitik, Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft
Tragen die AKW-Betreiber die Atomfolgekosten? - Risiken und Reformoptionen Grohnde unter Druck am 26.03.2015 in Bielefeld Swantje Küchler Leiterin Energiepolitik, Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft
In aller Kürze: Das Abschlussprüfungsreformgesetz
 In aller Kürze: Das Abschlussprüfungsreformgesetz Prüfungsbericht Bestätigungsvermerk Externe Rotation Inkrafttreten am 17. Juni 2016 EU-Verordnung und Abschlussprüfungsreformgesetz Prüfungsausschuss Anwendungsbereich
In aller Kürze: Das Abschlussprüfungsreformgesetz Prüfungsbericht Bestätigungsvermerk Externe Rotation Inkrafttreten am 17. Juni 2016 EU-Verordnung und Abschlussprüfungsreformgesetz Prüfungsausschuss Anwendungsbereich
IP Strategy AG. (vormals: NanoStrategy AG) Jahresabschluss. für das Geschäftsjahr 2011/2012
 IP Strategy AG (vormals: NanoStrategy AG) Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011/2012 Langenstraße 52-54 28195 Bremen Tel. 0421/5769940 Fax 0421/5769943 e-mail: info@ipstrategy.de Internet: www.ipstrategy.de
IP Strategy AG (vormals: NanoStrategy AG) Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011/2012 Langenstraße 52-54 28195 Bremen Tel. 0421/5769940 Fax 0421/5769943 e-mail: info@ipstrategy.de Internet: www.ipstrategy.de
Emeritenanstalt der Diözese Speyer - Körperschaft des öffentlichen Rechts - Speyer. Bilanz zum 31. Dezember
 I Emeritenanstalt der Diözese Bilanz zum 31. Dezember 2015 AKTIVA PASSIVA 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 A. Anlagevermögen I. Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
I Emeritenanstalt der Diözese Bilanz zum 31. Dezember 2015 AKTIVA PASSIVA 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 A. Anlagevermögen I. Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
Grundsätze ordnungsmäßiger Geschäftswertberichterstattung: HGB und US-GAAP
 Grundsätze ordnungsmäßiger Geschäftswertberichterstattung: HGB und US-GAAP Dipl.-Kfm. Andreas Duhr Wissenschaftlicher Mitarbeiter Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsprüfung
Grundsätze ordnungsmäßiger Geschäftswertberichterstattung: HGB und US-GAAP Dipl.-Kfm. Andreas Duhr Wissenschaftlicher Mitarbeiter Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsprüfung
XING News GmbH, Hamburg. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 17. August Dezember 2016
 XING News GmbH, Hamburg Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 17. August 2016-31. Dezember 2016 17.08.2016-31.12.2016 EUR 1. Rohergebnis 770.063,07 2. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter
XING News GmbH, Hamburg Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 17. August 2016-31. Dezember 2016 17.08.2016-31.12.2016 EUR 1. Rohergebnis 770.063,07 2. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter
Elmos Central IT Services GmbH, Dortmund Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2013
 Elmos Central IT Services GmbH, Dortmund Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2013 AKTIVA 31.12.2012 PASSIVA 31.12.2012 EUR EUR TEUR EUR EUR TEUR A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Elmos Central IT Services GmbH, Dortmund Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2013 AKTIVA 31.12.2012 PASSIVA 31.12.2012 EUR EUR TEUR EUR EUR TEUR A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL I. Immaterielle Vermögensgegenstände
für die 4. Sitzung des Wirtschaftsausschusses möchte ich Ihnen folgende Unterlagen zukommen
 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Postfach 71 51 24171 Kiel
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Postfach 71 51 24171 Kiel
Richtlinien zum Aktuarbericht für die Lebensversicherung
 Richtlinien zum Aktuarbericht für die Lebensversicherung Version vom August 2006 Verabschiedet vom SAV-Vorstand am 1. September 2006 Seite 1 1. Einleitung Der verantwortliche Aktuar oder die verantwortliche
Richtlinien zum Aktuarbericht für die Lebensversicherung Version vom August 2006 Verabschiedet vom SAV-Vorstand am 1. September 2006 Seite 1 1. Einleitung Der verantwortliche Aktuar oder die verantwortliche
Nutzungsvertrag. Katholische Kindertageseinrichtung, Zwischen. der Katholischen Kirchengemeinde St. in, vertreten durch den Kirchenvorstand, und
 Nutzungsvertrag Katholische Kindertageseinrichtung, Zwischen der Katholischen Kirchengemeinde St. in, vertreten durch den Kirchenvorstand, (nachfolgend Kirchengemeinde genannt) und der Katholische Kindertageseinrichtungen
Nutzungsvertrag Katholische Kindertageseinrichtung, Zwischen der Katholischen Kirchengemeinde St. in, vertreten durch den Kirchenvorstand, (nachfolgend Kirchengemeinde genannt) und der Katholische Kindertageseinrichtungen
Wesentliche Aspekte des Gutachtens Auswirkungen der Grundwasserhaltung im Rheinischen Braunkohlenrevier und Schlussfolgerungen daraus.
 Wesentliche Aspekte des Gutachtens Auswirkungen der Grundwasserhaltung im Rheinischen Braunkohlenrevier und Schlussfolgerungen daraus. Im Rheinischen Revier wird seit mehr als 100 Jahren Braunkohle gewonnen.
Wesentliche Aspekte des Gutachtens Auswirkungen der Grundwasserhaltung im Rheinischen Braunkohlenrevier und Schlussfolgerungen daraus. Im Rheinischen Revier wird seit mehr als 100 Jahren Braunkohle gewonnen.
Sanierungsgeld-Rückzahlung, Einmalzahlungsoption und Stärkungsbeitrag
 Sanierungsgeld-Rückzahlung, Einmalzahlungsoption und Stärkungsbeitrag Stand der Dinge Mündliche Verhandlung, OLG Hamm (18. Mai 2017). Zitat des Vors. Richters: Es gibt eine betriebswirtschaftliche Sichtweise.
Sanierungsgeld-Rückzahlung, Einmalzahlungsoption und Stärkungsbeitrag Stand der Dinge Mündliche Verhandlung, OLG Hamm (18. Mai 2017). Zitat des Vors. Richters: Es gibt eine betriebswirtschaftliche Sichtweise.
ConValue AG. Jahresabschluss. für das Geschäftsjahr 2013
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 Kirchenstraße 9 21224 Rosengarten e-mail: info@convalue.com www.convalue.com Sitz der Gesellschaft: Rosengarten 1 Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat der
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 Kirchenstraße 9 21224 Rosengarten e-mail: info@convalue.com www.convalue.com Sitz der Gesellschaft: Rosengarten 1 Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat der
LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 6/ Wahlperiode Errichtung von Windkraftanlagen sowie Ausgleichmaßnahmen und -zahlungen
 LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 6/5930 6. Wahlperiode 26.09.2016 KLEINE ANFRAGE der Abgeordneten Barbara Borchardt, Fraktion DIE LINKE Errichtung von Windkraftanlagen sowie Ausgleichmaßnahmen
LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 6/5930 6. Wahlperiode 26.09.2016 KLEINE ANFRAGE der Abgeordneten Barbara Borchardt, Fraktion DIE LINKE Errichtung von Windkraftanlagen sowie Ausgleichmaßnahmen
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sabine Leidig, Herbert Behrens, Karin Binder und der Fraktion DIE LINKE. Drucksache 18/16
 Deutscher Bundestag Drucksache 18/49 18. Wahlperiode 14.11.2013 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sabine Leidig, Herbert Behrens, Karin Binder und der Fraktion DIE LINKE.
Deutscher Bundestag Drucksache 18/49 18. Wahlperiode 14.11.2013 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sabine Leidig, Herbert Behrens, Karin Binder und der Fraktion DIE LINKE.
Dokument Nr. 4.1/ Stand:
 Dokument Nr. 4.1/ 2015-07-14 Stand: 14.07.2015 Vorschläge zur Anpassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft TA
Dokument Nr. 4.1/ 2015-07-14 Stand: 14.07.2015 Vorschläge zur Anpassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft TA
Abwasserbeseitigungskonzepte Wasserrahmenrichtlinie
 Abwasserbeseitigungskonzepte Wasserrahmenrichtlinie Was haben Abwasserbeseitigungskonzepte mit der Wasserrahmenrichtlinie zu tun? Gewässerbewirtschaftung Gewässer sind nach Flussgebietseinheiten zu bewirtschaften
Abwasserbeseitigungskonzepte Wasserrahmenrichtlinie Was haben Abwasserbeseitigungskonzepte mit der Wasserrahmenrichtlinie zu tun? Gewässerbewirtschaftung Gewässer sind nach Flussgebietseinheiten zu bewirtschaften
T T A. Anlagevermögen A. Eigenkapital. Finanzanlagen 16,47 0 I. Gezeichnetes Kapital ,00 100
 Delitzsch Pflanzenzucht Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Einbeck Bilanz zum 30. Juni 2016 AKTIVA Vorjahr Vorjahr T T A. Anlagevermögen A. Eigenkapital Finanzanlagen 16,47 0 I. Gezeichnetes Kapital
Delitzsch Pflanzenzucht Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Einbeck Bilanz zum 30. Juni 2016 AKTIVA Vorjahr Vorjahr T T A. Anlagevermögen A. Eigenkapital Finanzanlagen 16,47 0 I. Gezeichnetes Kapital
Was sagt die FFH-Richtlinie zu Schutz, Management und Erhaltungszielen von Natura 2000?
 Was sagt die FFH-Richtlinie zu Schutz, Management und Erhaltungszielen von Natura 2000? Frank Vassen, Referat D.3 Naturschutz, GD Umwelt, Europäische Kommission NABU talk "Natura 2000 Wie fit ist Deutschland?"
Was sagt die FFH-Richtlinie zu Schutz, Management und Erhaltungszielen von Natura 2000? Frank Vassen, Referat D.3 Naturschutz, GD Umwelt, Europäische Kommission NABU talk "Natura 2000 Wie fit ist Deutschland?"
