BILDUNGSPLAN DES GYMNASIUMS. Bildungsplan Spanisch als dritte Fremdsprache. Profilfach
|
|
|
- Arnim Fuchs
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 BILDUNGSPLAN DES GYMNASIUMS Bildungsplan 2016 Spanisch als dritte Fremdsprache Profilfach
2 KULTUS UND UNTERRICHT AMTSBLATT DES MINISTERIUMS FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG Stuttgart, den 23. März 2016 BILDUNGSPLAN DES GYMNASIUMS Vom 23. März 2016 Az /370/292 I. Der Bildungsplan des Gymnasiums gilt für das Gymnasium der Normalform und Aufbauform mit Heim sowie für Schulen besonderer Art. II. Der Bildungsplan tritt am 1. August 2016 mit der Maßgabe in Kraft, dass er erstmals für die Schülerinnen und Schüler Anwendung findet, die im Schuljahr 2016/2017 in die Klassen 5 und 6 eintreten. Gleichzeitig tritt der Bildungsplan für das Gymnasium der Normalform vom 21. Januar 2004 (Lehrplanheft 4/2004) mit der Maßgabe außer Kraft, dass er letztmals für die Schülerinnen und Schüler gilt, die vor dem Schuljahr 2016/2017 in die Klasse 6 eingetreten sind. Abweichend hiervon tritt der Fachplan Literatur und Theater am 1. August 2016 mit der Maßgabe in Kraft, dass er erstmals für Schülerinnen und Schüler Anwendung findet, die im Schuljahr 2016/2017 in die Jahrgangsstufe 1 eintreten. Gleichzeitig tritt der Bildungsplan für das Fach Literatur und Theater in der Kursstufe des Gymnasiums der Normalform und der Aufbauform mit Heim (K.u.U. 2012, S. 122) mit der Maßgabe außer Kraft, dass er letztmals für die Schülerinnen und Schüler gilt, die vor dem Schuljahr 2016/2017 in die Jahrgangsstufe 1 eingetreten sind. K.u.U., LPH 3/2016 BEZUGSSCHLÜSSEL FÜR DIE BILDUNGSPLÄNE DER ALLGEMEIN BILDENDEN SCHULEN 2016 Reihe Bildungsplan Bezieher A Bildungsplan der Grundschule Grundschulen, Schule besonderer Art Heidelberg, alle sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren S Gemeinsamer Bildungsplan der Sekundarstufe I Werkrealschulen/Hauptschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen, Schulen besonderer Art, alle sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren G Bildungsplan des Gymnasiums allgemein bildende Gymnasien, Schulen besonderer Art, sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung, sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat mit Förderschwerpunkt Hören, Stegen O Bildungsplan der Oberstufe an Gemeinschaftsschulen Gemeinschaftsschulen Nummerierung der kommenden Bildungspläne der allgemein bildenden Schulen: LPH 1/2016 Bildungsplan der Grundschule, Reihe A Nr. 10 LPH 2/2016 Gemeinsamer Bildungsplan der Sekundarstufe I, Reihe S Nr. 1 LPH 3/2016 Bildungsplan des Gymnasiums, Reihe G Nr. 16 LPH 4/2016 Bildungsplan der Oberstufe an Gemeinschaftsschulen, Reihe O Nr. 1 Der vorliegende Fachplan ist als Heft Nr. 35 (Profilbereich) Bestandteil des Bildungsplans des Gymnasiums, der als Bildungsplanheft 3/2016 in der Reihe G erscheint, und kann einzeln bei der Neckar-Verlag GmbH bezogen werden.
3 Inhaltsverzeichnis 1. Leitgedanken zum Kompetenzerwerb Bildungswert der modernen Fremdsprachen Kompetenzen Bildungswert des Faches Spanisch Didaktische Hinweise Prozessbezogene Kompetenzen Sprachbewusstheit Sprachlernkompetenz Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 8/9/ Soziokulturelles Orientierungswissen / Themen Interkulturelle kommunikative Kompetenz Funktionale kommunikative Kompetenz Hör-/Hörsehverstehen Leseverstehen Sprechen an Gesprächen teilnehmen Sprechen zusammenhängendes monologisches Sprechen Schreiben Sprachmittlung Verfügen über sprachliche Mittel: Wortschatz Verfügen über sprachliche Mittel: Grammatik Verfügen über sprachliche Mittel: Aussprache und Intonation Text- und Medienkompetenz Klassen 11/ Soziokulturelles Orientierungswissen / Themen Interkulturelle kommunikative Kompetenz Funktionale kommunikative Kompetenz Hör-/Hörsehverstehen Leseverstehen Sprechen an Gesprächen teilnehmen Sprechen zusammenhängendes monologisches Sprechen Schreiben Sprachmittlung Verfügen über sprachliche Mittel: Wortschatz Verfügen über sprachliche Mittel: Grammatik Verfügen über sprachliche Mittel: Aussprache und Intonation Text- und Medienkompetenz Operatoren Inhaltsverzeichnis 1
4 5. Anhang Verweise Abkürzungen Geschlechtergerechte Sprache Besondere Schriftauszeichnungen Glossar Inhaltsverzeichnis
5 1. Leitgedanken zum Kompetenzerwerb 1.1 Bildungswert der modernen Fremdsprachen In einer modernen und globalisierten Welt, die von zunehmender Mobilität und Vernetzung geprägt ist, stellen Fremdsprachenkenntnisse eine wichtige Grundlage für den internationalen Dialog dar. Sie befähigen den Einzelnen, sich in interkulturellen Kontexten angemessen zu bewegen. Indem sich Schülerinnen und Schüler mit sprachlicher und kultureller Vielfalt auseinandersetzen, erwerben sie interkulturelle Handlungskompetenz, die sie in die Lage versetzt, mit Individuen und Gruppen anderer Kulturen angemessen und respektvoll zu interagieren. Bei der Begegnung mit einer anderen Sprache wird der Einzelne mit einer neuen, ihm zunächst ungewohnten sprachlichen Ordnung der Welt konfrontiert. Er lernt diese neue Ordnung als andere mögliche Interpretation von Welt kennen und respektieren. Damit unterstützt der Fremdsprachenunterricht in besonderem Maße die Entwicklung von Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt und trägt zu einem friedlichen Zusammenleben in der Welt bei. In einer international geprägten Wirtschafts- und Arbeitswelt stellen Fremdsprachenkenntnisse außerdem eine wichtige Voraussetzung dar, um angemessen auf dem globalen Markt zu agieren. Ziel eines modernen Fremdsprachenunterrichts ist es deshalb, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, sich in der Fremdsprache sicher zu bewegen und sich dabei zunehmend flüssig und differenziert auszudrücken. Fremdsprachen zu lernen heißt, in fremde Welten einzutauchen und diese in steigendem Maße zu verstehen. Sie ermöglichen es den Lernenden, Wissen über fremde Denkmuster und Handlungsweisen zu erwerben und diese mit den eigenen zu vergleichen. Die Schülerinnen und Schüler können so deren kulturelle und gegebenenfalls auch historische Bedingtheit verstehen, Verständnis und Respekt für das Fremde entwickeln und Missverständnisse vermeiden. Soziokulturelles Wissen im Zusammenspiel mit interkultureller und funktionaler kommunikativer Kompetenz versetzt die Schülerinnen und Schüler in die Lage, künftig Auslandsaufenthalte und internationale Begegnungen im Rahmen von Ausbildung, Studium und Beruf sowie im Privatleben gezielt und informiert in die Wege zu leiten und erfolgreich zu bewältigen. Hier leisten die modernen Fremdsprachen einen Beitrag zur beruflichen Orientierung der Schülerinnen und Schüler. Am Gymnasium erwirbt jede Schülerin und jeder Schüler Kompetenzen in mindestens zwei Fremdsprachen. Der Vergleich von Unterschieden und Gemeinsamkeiten fördert die Einsicht in generelle sprachliche Strukturmuster und das Verständnis von Sprache als System. Die Kenntnis von Strukturen verschiedener Sprachen sowie von Strategien und Methoden des Spracherwerbs fördert darüber hinaus das Lernen weiterer Fremdsprachen jenseits der schulischen Ausbildung. Nachdenken über Sprache schult die Fähigkeit, Handlungsweisen, komplexere Sachverhalte, theoretische Erkenntnisse, Denkmuster und Wertvorstellungen zu durchdringen und in einen interkulturellen Zusammenhang zu stellen. Leitgedanken zum Kompetenzerwerb 3
6 1.2 Kompetenzen In den vorliegenden Bildungsplänen für die modernen Fremdsprachen ist die Ausbildung der interkulturellen kommunikativen Kompetenz das übergeordnete Ziel des Fremdsprachenlernens. Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen (GeR) der Sprachen von 2001 sieht in dieser interkulturellen Handlungsfähigkeit in unterschiedlichen Sprachen den Kern seines Mehrsprachigkeitskonzepts. Er definiert für alle Sprachen gültige Kriterien und Niveaus, nach denen die Sprachbeherrschung von Lernenden eingestuft werden kann. Daran orientiert sich der Kompetenzaufbau über die verschiedenen Klassen in den vorliegenden Bildungsplänen für die modernen Fremdsprachen. Die in den Bildungsplänen beschriebenen Kompetenzen entsprechen den Vorgaben der Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife der Kultusministerkonferenz (KMK) von 2012, die zu einer Vereinheitlichung der Anforderungen über die Bundesländergrenzen hinweg führen sollen. Zusammenspiel der Kompetenzbereiche ( Landesinstitut für Schulentwicklung) Das Schaubild verdeutlicht, dass die Kompetenzen, wie sie nacheinander in den vorliegenden Bildungsplänen aufgeführt sind, keine isoliert zu beherrschenden Einzelfertigkeiten sind, sondern vielmehr ineinandergreifen. Sowohl die prozessbezogenen Kompetenzen als auch die inhaltsbezogenen Kompetenzen stehen im Dienst der interkulturellen kommunikativen Kompetenz. Als prozessbezogene Kompetenzen werden Sprachbewusstheit und Sprachlernkompetenz ausgewiesen: Zum einen unterstützt die Fähigkeit, eine Sprache auch die Erstsprache bewusst zu rezipieren und zu verwenden, den Spracherwerbsprozess. Die Schülerinnen und Schüler müssen zum anderen in ihrer Sprachlernkompetenz langfristig gefördert werden, um das eigene Sprachenlernen zielgerichtet zu steuern. Dieser Prozess beginnt bereits im Fremdsprachenunterricht der Grundschule. Die Lernenden sollen Strategien und Methoden erwerben, die sie dazu befähigen, ihr Lernen 4 Leitgedanken zum Kompetenzerwerb
7 selbstständig zu organisieren und nach Ende ihrer Schulzeit im Sinne des lebenslangen Lernens weitere Fremdsprachen im außerschulischen Umfeld zu erlernen. Eine Voraussetzung dafür besteht darin, dass sie in ihrer Schullaufbahn allmählich Eigenverantwortung für ihren Lernprozess und -zuwachs übernehmen. Prozessbezogene Kompetenzen können nicht von den inhaltsbezogenen Kompetenzen losgelöst erworben werden, sie sind nicht gestuft und werden nicht unmittelbar geprüft. Der ausgewiesene Stand stellt die Zielstufe dar, die das beim Abschluss der Kursstufe zu erreichende Niveau beschreibt. Die inhaltsbezogenen Kompetenzen umfassen die als zentrales Ziel ausgewiesene interkulturelle kommunikative Kompetenz, die funktionale kommunikative Kompetenz und schließlich die Text- und Medienkompetenz. Voraussetzung für einen gelingenden Kompetenzaufbau ist, dass die Schülerinnen und Schüler angemessene sprachliche Mittel erwerben und reflektieren. Für die Realisierung der kommunikativen Kompetenzen haben sie dienende Funktion. Die Text- und Medienkompetenz verlangt den Schülerinnen und Schülern einen komplexeren Umgang mit Texten ab, der über die reine Textrezeption hinausgeht. Sie erfordert, dass Schülerinnen und Schüler Texte zunehmend tiefer durchdringen und sich produktiv mit ihnen auseinandersetzen. Die Lernenden sollen die Fähigkeit erwerben, Texte zu strukturieren und zu analysieren, sie zu reflektieren und zu bewerten beziehungsweise neu zu gestalten. In den Bildungsplänen der modernen Fremdsprachen wird von einem erweiterten Textbegriff ausgegangen. Als Texte werden demnach alle mündlichen, schriftlichen und visuellen Produkte in ihrem jeweiligen kulturellen und medialen Kontext verstanden, die analog oder digital vermittelt werden. Von entscheidender Bedeutung für den gymnasialen Fremdsprachenunterricht ist die Auseinandersetzung mit kulturell geprägten Deutungsmustern. Aus diesem Grund hat die Beschäftigung mit literarischen Texten von Autorinnen und Autoren mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund dort einen besonderen Stellenwert. Zur Text- und Medienkompetenz zählt darüber hinaus, dass die Schülerinnen und Schüler bei einer Recherche dem Internet zielgerichtet Informationen entnehmen und entsprechend der Aufgabenstellung auswerten können. Zudem lernen sie, Texte gegebenenfalls kritisch zu ihrem medialen Umfeld in Beziehung zu setzen. Damit trägt der moderne Fremdsprachenunterricht zur Medienbildung bei. Jeweils zu Beginn der inhaltsbezogenen Kompetenzen werden Themen genannt, denn die Schülerinnen und Schüler erwerben die ausgewiesenen Kompetenzen nicht losgelöst von soziokulturellem Wissen. Dies geschieht vielmehr in der ständigen Begegnung und Auseinandersetzung mit Themen, die in ihrer Progression zunehmend gesellschaftsorientiert werden und ein vertieftes kulturelles Verständnis zum Ziel haben. Methodisch-strategische Teilkompetenzen sind den funktionalen kommunikativen Kompetenzen zugeordnet. Sie sind im Bildungsplan 2016 jeweils am Ende einer Kompetenz aufgeführt und durch eine Zwischenüberschrift kenntlich gemacht. Verweise auf Teilkompetenzen anderer Bereiche der Fremdsprachenpläne zeigen, welche Teilkompetenzen Grundlage oder sinnvolle Erweiterungsmöglichkeiten darstellen. Mit den vorliegenden Verweisen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben; sie sind nicht grundsätzlich verbindlich, sondern sollen zum Querlesen einladen. Um den Lernstand, den die Schülerinnen und Schüler laut Bildungsplan aus den vorherigen in die nachfolgenden Klassen mitbringen sollen, besser nachvollziehen zu können, hat die jeweilige Teilkompetenz über alle Klassen hinweg die gleiche Nummerierung. Die Progression der einzelnen (Teil-) Kompetenzen wird so erkennbar. Mitunter wird eine Teilkompetenz ab einer bestimmten Klasse nicht Leitgedanken zum Kompetenzerwerb 5
8 mehr fortgeführt beziehungsweise sie setzt später ein. In diesen Fällen erfolgt ein konkreter Hinweis in der jeweiligen Zeile. Die Teilkompetenzen werden anhand von Operatoren beschrieben, deren jeweilige Bedeutung in der Liste im Anhang der Pläne definiert ist. Die definierten handlungsleitenden Verben dienen dazu, alle sprachlichen Operationen, die im Laufe des Erwerbs aller kommunikativen Kompetenzen erlernt werden, trennscharf zu erfassen. Es handelt sich dabei nicht um die fremdsprachlichen Prüfungsoperatoren. 1.3 Bildungswert des Faches Spanisch Spanisch ist eine der am meisten gesprochenen Weltsprachen, offizielle Sprache in mehr als 20 Ländern und Arbeitssprache in zahlreichen internationalen Organisationen, zum Beispiel bei der UNO und bei der EU. Zudem ermöglicht die spanische Sprache den Schülerinnen und Schülern den Zugang zum geopolitisch und wirtschaftlich bedeutsamen hispanophonen Sprachraum. Die spanische Sprache stellt einen Schlüssel für das Erlernen weiterer romanischer Sprachen dar, leistet damit während und nach dem Schulbesuch einen wichtigen Beitrag zur angestrebten Mehrsprachigkeit und fördert zugleich die Perspektive des lebenslangen Fremdsprachenlernens. Spanischkenntnisse ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, Einblicke in die Lebenswirklichkeit und die Kulturen Spaniens und Hispanoamerikas zu gewinnen und sich vertieft mit Denk- und Lebensweisen in der spanischsprachigen Welt auseinanderzusetzen. Dadurch werden die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt, den eigenen kulturspezifischen Hintergrund zu reflektieren und die eigenen Wertvorstellungen und Haltungen weiterzuentwickeln. Beitrag des Faches zu den Leitperspektiven In welcher Weise das Fach Spanisch einen Beitrag zu den Leitperspektiven leistet, wird im Folgenden dargestellt: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Im Spanischunterricht begegnen Schülerinnen und Schüler anderen Kulturräumen. Durch die Auseinandersetzung mit diesen Kulturräumen finden zentrale Themen wie der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen, die Folgen von sozialem Wandel und zunehmender Globalisierung sowie die Bedeutung der indigenen Kulturen Eingang in den Unterricht. Somit wird den Schülerinnen und Schülern aufgezeigt, wie sie durch zivilgesellschaftliches Engagement und politisches Handeln einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung für eine zukunftsfähige Welt leisten können. Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV) Die Beschäftigung mit der spanischen Sprache, das Kennenlernen der soziokulturellen Wirklichkeit in der hispanophonen Welt, die Auseinandersetzung mit Gesellschaft, Geographie, Geschichte, Politik, Wirtschaft und kulturellen Ausdrucksformen in den einzelnen Ländern sowie das Erleben der Vielfalt der unterschiedlichen Kulturräume tragen dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler zur verantwortungsvollen und aktiven Gestaltung einer zukunftsfähigen Welt befähigt werden. Dadurch trägt das Fach Spanisch in hohem Maße zur Entwicklung von Empathie und zu Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt in personaler, religiöser, geschlechtlicher, kultureller, ethnischer und sozialer Hinsicht bei. 6 Leitgedanken zum Kompetenzerwerb
9 Prävention und Gesundheitsförderung (PG) In der Auseinandersetzung mit Kulturräumen, in denen seit Jahrhunderten interkulturelle Begegnungen mit ihren Chancen und Risiken gelebt werden, erfahren die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung wertschätzender Kommunikation und lösungsorientierter Konfliktbewältigung. Der Spanischunterricht ermöglicht den Schülerinnen und Schülern außerdem, mit Muttersprachlern in Kontakt zu treten und in realen und virtuellen Kommunikationssituationen Kontakte und Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Dies ist ein wichtiger Beitrag, um sich als Teil einer Gemeinschaft wahrzunehmen und als Mitglied einer Gruppe Kommunikation aktiv mitzugestalten. Eine Voraussetzung für das sichere Anwenden der Fremdsprache und das zielgerichtete Vertiefen der eigenen Kenntnisse besteht darin, dass Lerntechniken sowie Kommunikationsstrategien bewusst eingesetzt werden. Diese Methoden und Strategien werden im Spanischunterricht vermittelt und eingeübt. Damit wird im Sinne der Prävention und Gesundheitsförderung ihre Fähigkeit zur Selbstregulation und zum eigenverantwortlichen Lernen gestärkt. Den Schülerinnen und Schülern werden Wege aufgezeigt, ihr eigenes Lernverhalten und ihr kommunikatives Handeln selbstwirksam und eigenständig zu steuern, ohne sich dabei zu überfordern. Berufliche Orientierung (BO) Außerdem eröffnet der Spanischunterricht den Schülerinnen und Schülern Perspektiven im Hinblick auf Praktika, Ausbildung, Studium und Beruf in den zahlreichen spanischsprachigen Ländern und trägt dadurch zur beruflichen Orientierung der Heranwachsenden bei. Angesichts des Ausbaus von Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland, Spanien und Hispanoamerika können Spanischkenntnisse von großem Nutzen sein. Partnerschaften auf vielen Ebenen ermöglichen den Schülerinnen und Schülern eine berufliche Orientierung und Zukunftschancen im spanischen Sprachraum. Medienbildung (MB) Gleichzeitig macht die zunehmende Bedeutung von Medien in der Gesellschaft deren kritische, selbstbestimmte Nutzung zu einer wichtigen Schlüsselqualifikation junger Menschen. Ein sinnvoller, reflektierter und verantwortungsvoller Umgang mit Medien wird im Spanischunterricht insbesondere im Rahmen der Text- und Medienkompetenz auf vielfältige Weise geschult. Verbraucherbildung (VB) Im Spanischunterricht erwerben die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen für ein selbstbestimmtes Konsumverhalten durch Vergleiche spanischer, hispanoamerikanischer und deutscher Alltags-, Ess- und Konsumkulturen. Durch Einblicke in globale Wirtschaftsprozesse und Produktionsbedingungen lernen sie, als verantwortungsvolle Konsumenten zu agieren. 1.4 Didaktische Hinweise Ende Klasse 10 erreichen die Schülerinnen und Schüler das GeR-Niveau B1+. Wenn sie das Fach im Anschluss als fortgeführte Fremdsprache bis zum Abitur belegen, erweitern sie ihre Kompetenzen auf das GeR-Niveau B2. Der kommunikative Ansatz des schulischen Fremdsprachenlernens verlangt im Sinne der aufgeklärten Einsprachigkeit, dass der Unterricht überwiegend in der Fremdsprache stattfindet und vom ersten Lernjahr an die Begegnung mit authentischen, auch medial vermittelten Materialien in der Fremd- Leitgedanken zum Kompetenzerwerb 7
10 sprache ermöglicht, wobei sowohl das kastilische Spanisch als auch die Standardvarietäten des hispanoamerikanischen Spanisch verwendet werden können. Die Begegnung mit der spanischen Sprache an außerschulischen Lernorten ist wo immer möglich zu fördern, damit die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit erhalten, die Lebenswirklichkeit in Spanien und Hispanoamerika unmittelbar zu erleben, zum Beispiel durch Austauschmaßnahmen, Schülerbegegnungen oder andere Kontakte mit Muttersprachlern. Ein Ansatz, der der Komplexität der kommunikativen Handlungsfähigkeit, der Kompetenzorientierung sowie der Individualisierung und Binnendifferenzierung in hohem Maße gerecht wird, ist die Aufgabenorientierung. Sie ermöglicht es einerseits, die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Teilkompetenzen isoliert zu üben, und verlangt andererseits von den Schülerinnen und Schülern, diese Teilkompetenzen zielgerichtet in einem komplexen Zusammenspiel anzuwenden. Die Förderung des Leseverstehens und des Hör-/Hörsehverstehens ist vom ersten Lernjahr an im Spanischunterricht von großer Bedeutung. Es ist darauf zu achten, bereits von Beginn an auch authentische Texte einzusetzen und den Kompetenzstand beim Leseverstehen und beim Hör-/Hörsehverstehen unabhängig von der Sprachproduktion zu erfassen. Im Bereich des Hör-/Hörsehverstehens sollen die Schülerinnen und Schüler dabei behutsam an die zahlreichen sprachlichen Varietäten der hispanophonen Welt und an die teilweise hohe Sprechgeschwindigkeit von Muttersprachlern herangeführt werden. Beim Leseverstehen gilt es, durch geeignete Maßnahmen die Lesemotivation der Schülerinnen und Schüler zu fördern, zum Beispiel durch ein Leseprojekt zum extensiven Lesen oder die Lektüre einer Ganzschrift möglichst in jeder Klasse, sowie ihnen durch den Rückgriff auf Kenntnisse aus anderen Sprachen Erfolgserlebnisse beim Lesen zu ermöglichen. Was die produktiven Kompetenzen betrifft, so sind die mündliche Sprachkompetenz und die schriftliche Ausdrucksfähigkeit gleichermaßen zu fördern. Die Fähigkeiten, an Gesprächen teilzunehmen und zusammenhängend monologisch zu sprechen, bedürfen von Anfang an einer intensiven Schulung, die auch eine gut verständliche Aussprache beinhaltet. Rezeptive und produktive Kompetenzen verbinden sich im Bereich der Sprachmittlung, die die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt, in interkulturellen Kommunikationssituationen Verständigung zu ermöglichen. Ein neues Gewicht erfährt im Spanischunterricht die Text- und Medienkompetenz, die den Schülerinnen und Schülern durch analytische und kreative Zugänge ein vertieftes Verständnis von Texten und Medien ermöglicht und sie befähigt, die so erworbenen Kenntnisse bei der Produktion verschiedener Textsorten zu nutzen. Der Erwerb aller inhaltsbezogener Kompetenzen erfolgt im Zusammenspiel mit dem Aufbau der prozessbezogenen Kompetenzen. Die Sprachbewusstheit und die Sprachlernkompetenz werden kontinuierlich über die Schuljahre hinweg gefördert und sind im Unterricht mit zu bedenken. 8 Leitgedanken zum Kompetenzerwerb
11 2. Prozessbezogene Kompetenzen 2.1 Sprachbewusstheit Die Schülerinnen und Schüler reflektieren beim Erwerb der sprachlichen Mittel die spezifischen Ausprägungen des Spanischen auch im Vergleich zu anderen Sprachen. Sie nutzen die Ausdrucksmittel zielgerichtet, setzen dabei Stil, Register sowie kulturell bestimmte Formen des Sprachgebrauchs, zum Beispiel Formen der Höflichkeit, sensibel ein und gestalten auch interkulturelle Kommunikationssituationen verantwortungsbewusst. Ihrem Gegenüber begegnen sie respektvoll und tolerant, unabhängig davon, ob dessen Identität anders geprägt ist als ihre eigene. Die Schülerinnen und Schüler erkennen sprachliche Kommunikationsprobleme und sind in der Lage, Kompensationsstrategien variabel und adressatengerecht anzuwenden. Darüber hinaus reflektieren sie die Rolle und Verwendung von Sprachen in der Welt, zum Beispiel im Kontext kultureller und politischer Gegebenheiten. In der Auseinandersetzung mit fiktionalen und nichtfiktionalen Texten erkennen, analysieren und bewerten sie über Sprache gesteuerte Beeinflussungsstrategien. Die Begegnung mit Literatur ermöglicht es ihnen darüber hinaus in besonderem Maße, Sprache in ihrer ästhetischen Dimension und als Mittel schöpferischen Ausdrucks zu erfahren. Auf diese Weise entwickeln sie Sensibilität für Sprache und sprachlich vermittelte Kommunikation. 2.2 Sprachlernkompetenz das eigene Sprachenlernen weitgehend selbstständig analysieren und gestalten. Dabei greifen sie auf ihr mehrsprachiges Wissen (Erstsprache, gegebenenfalls Zweitsprache, Fremdsprachen) und auf individuelle Sprachlernerfahrungen zurück, zum Beispiel indem sie Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Beziehungen zwischen verschiedenen Sprachen reflektieren und für ihr Sprachenlernen gewinnbringend einsetzen. Zur Erweiterung ihrer sprachlichen Kompetenzen nutzen sie vielfältige direkte, medial vermittelte, simulierte und authentische Begegnungen mit der Fremdsprache, auch an außerschulischen Lernorten. Sie verfügen über ein angemessenes Repertoire an sprachbezogenen Lernmethoden und Strate gien, die sie ebenso wie digitale Hilfsmittel zielgerichtet und eigenständig anwenden. Die Schülerinnen und Schüler schätzen ihre Sprachlernprozesse und -ergebnisse eigenverantwortlich ein und ziehen daraus Konsequenzen für ihr sprachliches Handeln und die Gestaltung weiterer Lernschritte. Prozessbezogene Kompetenzen 9
12 3. Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen 3.1 Klassen 8/9/ Soziokulturelles Orientierungswissen / Themen ihre interkulturellen, sprachlichen und medialen Kompetenzen auf der Basis von Kenntnissen in folgenden Themenbereichen anwenden: (1) Individuum und Gesellschaft Lebenswelten in Spanien und Hispanoamerika im Vergleich zur eigenen Lebenswelt (zum Beispiel Familie, Schule, Freunde, Freizeitverhalten, Kommunikation) Alltagswirklichkeiten und Zukunftsperspektiven junger Menschen in Spanien und hispanoamerikanischen Ländern (zum Beispiel Jugendarbeitslosigkeit, Leben in einer megalópolis) Grundkenntnisse über verschiedene Kulturen, Ethnien, soziale Milieus in Spanien und Hispanoamerika (zum Beispiel indígenas) Migrationsbewegungen in Spanien und Hispanoamerika (zum Beispiel hispanos, Migration nach und aus Spanien, Landflucht) Chancen und Herausforderungen der Mediengesellschaft (Medien in der spanischsprachigen Welt, zum Beispiel telenovelas) Beispiele für Partizipation in der Zivilgesellschaft (zum Beispiel Umweltschutz, soziales Engagement in ONGs) Interkulturelle kommunikative Kompetenz (4) Text- und Medienkompetenz ETH Lebensaufgaben und Selbstbestimmung ETH Pluralismus und Toleranz (*) ETH Medien und Wirklichkeiten GEO Teilsystem Gesellschaft GK Gesellschaft GK Zuwanderung nach Deutschland GK Aufgaben und Probleme des Sozialstaats GK Grundrechte BNE Teilhabe, Mitwirkung, Mitbestimmung BO Informationen über Berufe, Bildungs-, Studien- und Berufswege BTV Personale und gesellschaftliche Vielfalt MB Mediengesellschaft PG Mobbing und Gewalt; Wahrnehmung und Empfindung VB Bedürfnisse und Wünsche 10 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 8/9/10
13 (2) Gegebenheiten und Herausforderungen der Gegenwart Kenntnisse der Geographie Spaniens und Hispanoamerikas Grundkenntnisse über die politische Organisation Spaniens grundlegende Kenntnisse sozialer, politischer und wirtschaftlicher Gegebenheiten, exemplarisch an einem Land Hispanoamerikas, an einer Region Spaniens oder an Beispielen aus unterschiedlichen Ländern und Regionen Beispiele für nachhaltiges Wirtschaften und Leben: Tourismus, Umweltproblematik, comercio justo GEO Teilsystem Erdoberfläche GEO Natur- und Kulturräume GK Politisches System BNE Komplexität und Dynamik nachhaltiger Entwicklung BTV Wertorientiertes Handeln PG Mobbing und Gewalt VB Umgang mit eigenen Ressourcen (3) Kulturelle Identität Traditionen und Feste in Spanien und Hispanoamerika Sprachenvielfalt Spaniens (Regionalsprachen), Merkmale von Varietäten Hispanoamerikas (zum Beispiel voseo, Unterschiede im Wortschatz) und Entwicklungen durch Sprachkontakte (zum Beispiel spanglish und Neologismen) erste Auseinandersetzung mit historischen Meilensteinen der Geschichte Spaniens: das maurische Spanien (Zusammenleben von Arabern, Juden und Christen), Reconquista, 20./21. Jahrhundert und Hispanoamerikas: culturas precolombinas, Entdeckung und Eroberung Amerikas, 20./21. Jahrhundert Kulturelle Ausdrucksformen literarische Kurzformen (zum Beispiel Lieder, Gedichte, Comics) Lektüre einer (authentischen oder didaktisierten) Ganzschrift (zum Beispiel Theaterstück, Roman, Kurzgeschichte) Kunst (zum Beispiel Bilder, Graffitis) Werbung, Videoclips, Dokumentationen Filme, Filmausschnitte, Kurzfilme 2.1 Sprachbewusstheit Interkulturelle kommunikative Kompetenz Text- und Medienkompetenz BK (Bildende Kunst) D Literarische Texte E Soziokulturelles Orientierungswissen / Themen G Fremde Räume? Ehemalige Imperien und ihre gegenwärtigen Herausforderungen in historischer Perspektive (*) BNE Demokratiefähigkeit BTV Selbstfindung und Akzeptanz anderer Lebensformen MB Medienanalyse VB Medien als Einflussfaktoren Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 8/9/10 11
14 3.1.2 Interkulturelle kommunikative Kompetenz in vertrauten direkten und medial vermittelten interkulturellen Situationen angemessen handeln. Dabei können sie zielkulturelle Vorstellungen und Erwartungen mit ihren eigenen in Beziehung setzen und ihr soziokulturelles Wissen nutzen. (1) ihr Wissen über zielkulturelle Aspekte in verschiedenen Situationen und Themenbereichen anwenden (zum Beispiel bei den Themen Alltag, Festtraditionen, Schule, Berufswelt, Interessen und Probleme junger Menschen, politische und soziale Entwicklungen) BO Informationen über Berufe, Bildungs-, Studien- und Berufswege BTV Personale und gesellschaftliche Vielfalt PG Sucht und Abhängigkeit VB Alltagskonsum; Bedürfnisse und Wünsche (2) mit den ihnen zur Verfügung stehenden kommunikativen Mitteln vertraute interkulturelle Kommunikationssituationen weitgehend selbstständig gestalten und dabei den Umgang mit grundlegenden fremdkulturellen Konventionen beachten (zum Beispiel Signalisierung von Distanz und Nähe) BNE Werte und Normen in Entscheidungssituationen BTV Formen interkulturellen und interreligiösen Dialogs MB Kommunikation und Kooperation PG Wahrnehmung und Empfindung (3) Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei eigenen und zielkulturellen Wahrnehmungen, Einstellungen und (Vor-)Urteilen erkennen und ansatzweise analysieren BNE Werte und Normen in Entscheidungssituationen BTV Formen von Vorurteilen, Stereotypen, Klischees (4) anhand von fiktionalen Texten (Literatur, Film, Bild) vor dem zielkulturellen Hintergrund einen Perspektivenwechsel vollziehen BNE Werte und Normen in Entscheidungssituationen BTV Selbstfindung und Akzeptanz anderer Lebensformen Strategien und Methoden (5) interkulturelle Missverständnisse erkennen und zunehmend selbstständig klären BNE Friedensstrategien BTV Konfliktbewältigung und Interessenausgleich 2.1 Sprachbewusstheit Sprechen an Gesprächen teilnehmen Schreiben Sprachmittlung Verfügen über sprachliche Mittel: Grammatik (8), (10), (12) Text- und Medienkompetenz D Sprachgebrauch und Sprachreflexion ETH Ich und Andere ETH Konfliktregelung und Toleranz GK Internationale Beziehungen 12 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 8/9/10
15 3.1.3 Funktionale kommunikative Kompetenz Hör-/Hörsehverstehen didaktisierte und authentische Hör- und Hörsehtexte zu vertrauten Themen verstehen, sofern sie in deutlich artikulierter Standardsprache gesprochen werden. Sie verfügen über ein Repertoire an Erschließungsstrategien für Hör- und Hörsehtexte. Für den Schwierigkeitsgrad von Texten sind folgende Faktoren von Bedeutung: Vertrautheit mit dem Thema und der Textsorte, Informationsdichte, (fehlende) Redundanzen und Kohärenz, Textlänge, Abstraktionsgrad, Grad der Explizitheit, Diskursstruktur, Wortschatz, kulturspezifische Begriffe, Komplexität der Syntax, visuelle Unterstützung, Divergenz von Bild und Ton, Anzahl und Simultaneität der Sprecher, Sprechgeschwindigkeit, Grad der Abweichung von der Standardsprache, Stimmlage und Nebengeräusche. (1) der Hör-/Hörsehabsicht entsprechend die Hauptaussagen oder Detailinformationen aus strukturierten Hör-/Hörsehtexten weitgehend selbstständig entnehmen (Global-, Selektivund Detailverstehen) (2) bei vertrauter Thematik längere Redebeiträge und Argumentationen in den Hauptpunkten weitgehend selbstständig verstehen, sofern diese auch durch explizite Signale klar strukturiert und artikuliert sind (3) gesehene und gehörte Informationen weitgehend selbstständig zueinander in Beziehung setzen und in ihrem Zusammenhang, kulturellen Kontext, sowie in Ansätzen in ihrer Wirkung verstehen BO MB Informationen über Berufe, Bildungs-, Studien- und Berufswege Information und Wissen; Kommunikation und Kooperation (4) textinterne (verbale und nonverbale) Informationen und textexternes Wissen zunehmend selbstständig in Beziehung setzen (5) weitgehend selbstständig explizite und mit Hilfestellung auch implizite Einstellungen oder Beziehungen zwischen Sprechenden herausarbeiten BTV Personale und gesellschaftliche Vielfalt PG Mobbing und Gewalt Strategien und Methoden (6) unterschiedliche Erschließungsstrategien entsprechend der Hör-/Hörsehabsicht weitgehend selbstständig einsetzen (zum Beispiel Weltwissen aktivieren, top down und bottom up Prozesse kombinieren, Wortfelder identifizieren, Mitschreibetechniken anwenden (Flussdiagramme, Gegensatztabellen etc.), Bilder als Ergänzung oder Ablenkung von der Botschaft identifizieren) PG Selbstregulation und Lernen; Wahrnehmung und Empfindung 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Interkulturelle kommunikative Kompetenz Sprechen an Gesprächen teilnehmen Sprachmittlung Verfügen über sprachliche Mittel: Aussprache und Intonation Text- und Medienkompetenz Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 8/9/10 13
16 Leseverstehen didaktisierte und authentische Texte zu allgemeinen Themen verstehen. Sie verfügen über ein Repertoire an grundlegenden Texterschließungsstrategien. Für den Schwierigkeitsgrad von Texten sind folgende Faktoren von Bedeutung: Vertrautheit mit dem Thema und der Textsorte, Informationsdichte, Wortschatz und Komplexität der Syntax, kulturspezifische Begriffe und visuelle Unterstützung. (1) der Leseintention entsprechend die Hauptaussagen oder Einzelinformationen aus Texten zu allgemeinen Themen erschließen und sie gegebenenfalls im Detail verstehen (Global-, Selektiv-, Detailverstehen) (2) explizite und implizite Aussagen in Texten zu allgemeinen Themen erschließen (3) ein kurzes literarisches Werk oder eine didaktisierte Lektüre verstehen (4) Texte und Textteile mit Bezug auf ein spezifisches Leseziel auswählen BO Informationen über Berufe, Bildungs-, Studien- und Berufswege BTV Personale und gesellschaftliche Vielfalt MB Information und Wissen (5) die inhaltliche Struktur von Texten zu allgemeinen Themen herausarbeiten Strategien und Methoden (6) Rezeptionsstrategien der Leseabsicht entsprechend weitgehend selbstständig anwenden (zum Beispiel Markierungs- und Gliederungstechniken, Textsortenwissen, textexterne Informationen heranziehen, Hypothesen überprüfen, Verstehensinseln identifizieren und verknüpfen) (7) geeignete (digitale) Hilfsmittel (zum Beispiel ein- und zweisprachige Wörterbücher, Nachschlagewerke) zunehmend selbstständig nutzen PG Selbstregulation und Lernen 2.2 Sprachlernkompetenz Interkulturelle kommunikative Kompetenz Hör-/Hörsehverstehen Sprechen an Gesprächen teilnehmen Sprachmittlung Text- und Medienkompetenz 14 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 8/9/10
17 Sprechen an Gesprächen teilnehmen sich zunehmend flüssig, sprachlich korrekt und adressatengerecht sowie situationsangemessen an Gesprächen über vertraute persönlich und gesellschaftlich relevante Themen beteiligen. Sie verfügen über grundlegende Strategien, um in Sprechsituationen angemessen zu interagieren. (1) ein einfaches Gespräch über vertraute persönlich und gesellschaftlich relevante Themen beginnen, aufrechterhalten und beenden, dabei den Gesprächsverlauf aktiv gestalten und sich zunehmend spontan und flüssig äußern (2) Diskussionen zu vertrauten Themen aufgabengestützt führen (3) in Gesprächen und Diskussionen zu aktuell bedeutsamen Sachverhalten aufgabengestützt Stellung beziehen (4) auf Äußerungen, Nachfragen, Kommentare und Einwände anderer zunehmend sprachlich und interkulturell angemessen reagieren, indem sie gegebenenfalls Erläuterungen geben, Gefühle, Überzeugungen und Meinungen äußern und eigene Positionen formulieren BTV Konfliktbewältigung und Interessenausgleich (5) in Diskussionen über vertraute Themen eine vorgegebene Perspektive einnehmen und zunehmend selbstständig aus dieser heraus Argumente formulieren (zum Beispiel im Rollenspiel, in szenischen Verfahren) BO Fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Arbeits- und Berufswelt BTV Konfliktbewältigung und Interessenausgleich PG Wahrnehmung und Empfindung Strategien und Methoden (6) verbale und nonverbale Gesprächskonventionen situationsangemessen zunehmend selbstständig anwenden (zum Beispiel Gespräche auf verschiedene Weise eröffnen, fortführen, aufrechterhalten und beenden, aktives Zuhören signalisieren) (7) geeignete kommunikative Strategien aufgabengestützt einsetzen, um mit Nichtverstehen und Missverständnissen angemessen umzugehen (Kompensationsstrategien wie zum Beispiel Nachfragen, Paraphrasieren, Beispiele hinzufügen, Gestik und Mimik einsetzen, Denkpausen schaffen) PG Selbstregulation und Lernen; Wahrnehmung und Empfindung 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Interkulturelle kommunikative Kompetenz Hör-/Hörsehverstehen Sprechen zusammenhängendes monologisches Sprechen Sprachmittlung Text- und Medienkompetenz Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 8/9/10 15
18 Sprechen zusammenhängendes monologisches Sprechen strukturierte Darstellungen zu persönlich, fachlich und gesellschaftlich relevanten Themen geben und Positionen darlegen und vertreten. Sie verfügen über grundlegende Vortrags- und Präsentationsstrategien, um eigene mündliche Textproduktionen adressatengerecht zu planen und vorzutragen. (1) Sachverhalte, bezogen auf vertraute oder vorbereitete Themen, detailliert und strukturiert darstellen und gegebenenfalls kommentieren (2) Ansichten, Pläne oder Handlungen darstellen und begründen, dabei Alternativen entwickeln und gegebenenfalls Zusammenhänge herstellen BO Planung und Gestaltung des Übergangs in Ausbildung, Studium und Beruf (3) klar strukturierte nichtliterarische Texte sprachlich angemessen vorstellen und gegebenenfalls kommentieren und dabei zentrale Aspekte hervorheben PG Wahrnehmung und Empfindung (4) literarische Texte vorstellen und gegebenenfalls in ihren wesentlichen Merkmalen analysieren und kommentieren (zum Beispiel die zentralen Figuren hinsichtlich der markanten Merkmale beschreiben) MB Medienanalyse (5) ein selbstständig, anhand unterschiedlicher Quellen erarbeitetes gesellschaftlich relevantes Thema mithilfe von Strukturhilfen zusammenhängend und klar strukturiert präsentieren und dabei die Hauptpunkte herausarbeiten BO MB Fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Arbeits- und Berufswelt Produktion und Präsentation (6) eigene kürzere Monologe formulieren und interpretierend vortragen (zum Beispiel eine Rolle gestalten) Strategien und Methoden (7) Methoden zur Ideenfindung, Planung und Strukturierung von Präsentationen weitgehend selbstständig anwenden (zum Beispiel Brainstorming, Cluster, Mindmap, Schlüsselwörter, Gliederung) (8) geeignete Vortrags- und Präsentationsstrategien weitgehend selbstständig nutzen (zum Beispiel Blickkontakt, Körperhaltung, Stimme, Gestik, Mimik, mediale Unterstützung) (9) einfache Kompensations- und Korrekturtechniken anwenden (zum Beispiel Paraphrasieren, Beispiele nennen, lexikalische Einheiten durch Gestik und Mimik darstellen, nach dem Stocken Sätze selbstständig neu beginnen) MB PG Produktion und Präsentation Selbstregulation und Lernen 16 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 8/9/10
19 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Soziokulturelles Orientierungswissen / Themen Interkulturelle kommunikative Kompetenz Sprechen an Gesprächen teilnehmen Sprachmittlung Verfügen über sprachliche Mittel: Wortschatz Verfügen über sprachliche Mittel: Grammatik Verfügen über sprachliche Mittel: Aussprache und Intonation Text- und Medienkompetenz D Sprachgebrauch und Sprachreflexion Schreiben zusammenhängende Texte zu ihnen vertrauten Themen textsortenadäquat und adressatengerecht verfassen. Sie verfügen über grundlegende Strategien zur Steuerung des Schreibprozesses. (1) zielorientiert strukturierte Notizen und Mitteilungen auch zu auditiv, audio-/visuell vermittelten Texten verfassen MB Kommunikation und Kooperation (2) eine strukturierte Zusammenfassung eines Textes weitgehend selbstständig verfassen (3) ausführliche Berichte und Beschreibungen zunehmend selbstständig verfassen (4) Wünsche, Pläne und Vorstellungen weitgehend selbstständig zusammenhängend darstellen und begründen MB Kommunikation und Kooperation (5) eigene und fremde Ansichten und Meinungen weitgehend selbstständig kohärent formulieren und begründen BNE Teilhabe, Mitwirkung, Mitbestimmung (6) formelle und persönliche Korrespondenz zunehmend selbstständig verfassen (zum Beispiel formeller Brief, , Blogeintrag, Chatbeitrag, Kurznachricht, Anfrage, Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, persönlicher Brief) BO MB Fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Arbeits- und Berufswelt Kommunikation und Kooperation; Produktion und Präsentation (7) auf der Basis von Impulsen (zum Beispiel Stichwörter, Bilder, Lieder, Videoclips, Karikaturen) zunehmend selbstständig kreative Texte verfassen und gestalten MB Produktion und Präsentation Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 8/9/10 17
20 Strategien und Methoden (8) Methoden zur Ideenfindung, Planung und Strukturierung von Texten weitgehend selbstständig und zielgerichtet anwenden (zum Beispiel Stichwörter, Brainstorming, Mindmap, Gliederung, Erstellen eines Schreibplans) (9) (digitale) Hilfsmittel (zum Beispiel einsprachiges Wörterbuch, Schulgrammatik, Checklisten mit Stichpunkten zur Selbstkorrektur hinsichtlich Textaufbau, Syntax, Lexik oder häufiger grammatikalischer Fehler) und Strategien zum Verfassen und Überarbeiten eigener Texte weitgehend selbstständig und zielgerichtet verwenden PG Selbstregulation und Lernen 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Interkulturelle kommunikative Kompetenz Hör-/Hörsehverstehen Leseverstehen Sprechen an Gesprächen teilnehmen Sprechen zusammenhängendes monologisches Sprechen Sprachmittlung Verfügen über sprachliche Mittel: Grammatik (6), (9), (10) Text- und Medienkompetenz BK Bild D Texte und andere Medien Sprachmittlung wesentliche Inhalte mündlicher oder schriftlicher Texte zu ihnen vertrauten Themen sowohl mündlich als auch schriftlich möglichst adressatengerecht und weitgehend situationsangemessen in die jeweils andere Sprache übertragen. Hierzu nutzen sie grundlegende Strategien der funktionalen kommunikativen Kompetenzen. (1) in interkulturellen Situationen wesentliche Inhalte und Absichten möglichst adressatengerecht aufgabengestützt in der jeweils anderen Sprache wiedergeben und gegebenenfalls auf Nachfragen reagieren (2) wesentliche Inhalte bei ihnen vertrauten Themen in der jeweils anderen Sprache möglichst adressatengerecht und weitgehend situationsangemessen zusammenfassen BO Fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Arbeits- und Berufswelt (3) kurze Textteile bei Bedarf sinngemäß übertragen und gegebenenfalls übersetzen (zum Beispiel Titel, Teile von Liedtexten, Slogans) (4) für das interkulturelle Verstehen Erforderliches bei Bedarf zunehmend selbstständig erklären BNE Werte und Normen in Entscheidungssituationen BO Informationen über Berufe, Bildungs-, Studien- und Berufswege BTV Formen interkulturellen und interreligiösen Dialogs 18 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 8/9/10
21 Strategien und Methoden (5) bei der Übertragung in die jeweils andere Sprache zunehmend selbstständig interkulturelle Kompetenz nutzen und entsprechende kommunikative Strategien aufgabengestützt auswählen und anwenden (Strategien des Hör-/Hörsehverstehens, Leseverstehens, Sprechens und Schreibens sowie der Text- und Medienkompetenz) PG Selbstregulation und Lernen (6) bei der Übertragung von Informationen selbstständig Hilfsmittel einsetzen (zum Beispiel (digitale) Nachschlagewerke, (digitale) zweisprachige Wörterbücher, selbst erstellte Mindmaps, fichas de habla, Suchmaschinen) (7) vertraute Kompensationsstrategien weitgehend selbstständig anwenden (zum Beispiel Paraphrasieren, Einsatz von Gestik und Mimik, inhaltliche und sprachliche Vereinfachung, Nachfragen oder auf Nachfragen eingehen, Einsatz von automatisierten Redewendungen, Rückgriff auf Internationalismen) PG Selbstregulation und Lernen; Wahrnehmung und Empfindung 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Interkulturelle kommunikative Kompetenz Hör-/Hörsehverstehen Leseverstehen Sprechen an Gesprächen teilnehmen Schreiben Verfügen über sprachliche Mittel: Grammatik (9), (10) Verfügen über sprachliche Mittel: Aussprache und Intonation Text- und Medienkompetenz D Medien D Sprachgebrauch und Sprachreflexion E Sprachmittlung ETH Werte und Normen in der medial vermittelten Welt F Sprachmittlung MB Information und Wissen; Kommunikation und Kooperation Verfügen über sprachliche Mittel: Wortschatz Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein Repertoire an lexikalischen Einheiten, das es ihnen ermöglicht, zu vertrauten Themen verständlich und weitgehend korrekt zu kommunizieren. Sie verfügen über grundlegende Strategien zur Erschließung und Vernetzung lexikalischer Einheiten. (1) einen allgemeinen Wortschatz je nach Situation und Intention angemessen und weitgehend korrekt einsetzen, um sich zu vertrauten Themen zu äußern (2) einen umfangreichen Funktionswortschatz verstehen und weitgehend korrekt anwenden PG Selbstregulation und Lernen Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 8/9/10 19
22 Strategien und Methoden (3) Verfahren zum Memorieren, Dokumentieren und Strukturieren von lexikalischen Einheiten selbstständig anwenden (zum Beispiel Wortfeld, Wortfamilien, Mindmap, Visualisierung, (digitale) Vokabeltrainer) PG Selbstregulation und Lernen (4) Strategien der Umschreibung weitgehend selbstständig anwenden (zum Beispiel Synonyme, Beispiele, Gegensätze, Vergleiche, Definitionen) (5) neue lexikalische Einheiten weitgehend selbstständig erschließen (Rückgriff auf andere Sprachen, den Kontext, Textsorten, Illustrationen, Wortbildungsregeln (Präfixe, Suffixe)) (6) (digitale) Hilfsmittel zunehmend selbstständig nutzen (zum Beispiel ein- und zweisprachige Wörterbücher) MB Information und Wissen 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Funktionale kommunikative Kompetenz D Sprachgebrauch und Sprachreflexion Verfügen über sprachliche Mittel: Grammatik ein ihnen vertrautes Repertoire grammatischer Strukturen für die Realisierung ihrer kommunikativen Absicht nutzen sowie einige frequente Varianten verstehen. Sie verfügen über Strategien zum Erschließen von Strukturen und zur Selbstkorrektur. (1) Personen, Sachen, Tätigkeiten und Sachverhalte benennen und beschreiben und Fragen formulieren Singular und Plural der Nomen Begleiter Pronomina Adjektive Adverbien Präpositionen Konjunktionen ser/estar, hay Fragewörter (2) Ort und Zeit benennen Präpositionen präpositionale Ausdrücke Adverbien und Adverbialsätze 20 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 8/9/10
23 (3) Besitzverhältnisse benennen Possessivbegleiter Possessivpronomina BO Fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Arbeits- und Berufswelt (4) Quantifikatoren benennen Grund- und Ordnungszahlen Bruchzahlen Prozentangaben Mengenangaben Adverbien (5) verneinte Aussagen oder Einschränkungen formulieren no, no... nunca/nada/nadie/ninguno ni... ni... tampoco, sin, casi, apenas (6) Sachverhalte, Handlungen als gegenwärtig, vergangen, zukünftig darstellen alle Tempora (7) Vorgänge als gleichzeitig und in ihrer zeitlichen Abfolge und Dauer darstellen gerundio perífrasis verbales Infinitivkonstruktionen (zum Beispiel antes de, después de, al + infinitivo) (8) Vergleiche formulieren Komparativ- und Superlativformen von Adjektiven und Adverbien (9) Möglichkeit, Willen, Verpflichtung oder Bedingung formulieren, Sachverhalte als (un)möglich darstellen condicional presente, imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo realer und irrealer Bedingungssatz VB Bedürfnisse und Wünsche (10) Meinungen, Aufforderungen, Bitten, Wünsche oder Gefühle formulieren imperativo indicativo y subjuntivo (11) Zusammenhänge formulieren kausale, temporale, konsekutive, adversative, konzessive und finale Konjunktionen Relativsatz Infinitivkonstruktionen (12) Äußerungen anderer wiedergeben indirekte Rede in Präsens und Vergangenheit (13) unpersönliche Aussagen formulieren Ersatzkonstruktionen und pasiva refleja Passiv Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 8/9/10 21
24 Strategien und Methoden (14) Strategien zum Erschließen von Strukturen zunehmend selbstständig anwenden (15) (digitale) Hilfsmittel nutzen und Strategien zur Selbstkorrektur weitgehend selbstständig einsetzen (zum Beispiel Fehlervermeidungsliste) PG Selbstregulation und Lernen 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Funktionale kommunikative Kompetenz D Sprachgebrauch und Sprachreflexion Verfügen über sprachliche Mittel: Aussprache und Intonation Die Schülerinnen und Schüler beherrschen die Ausspracheregeln des kastilischen Spanisch oder einer Standardvarietät des hispanoamerikanischen Spanisch und wenden sie weitgehend korrekt an. Ihre Aussprache ist klar und verständlich, die Intonation ist angemessen. Sie verfügen über Strategien der Selbstkorrektur. (1) ein breites Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster verwenden und dabei eine klar verständliche Aussprache und angemessene Intonation zeigen, sodass im Allgemeinen keine Missverständnisse entstehen (2) typische Laute der spanischen Sprache und ihre graphische Umsetzung identifizieren und korrekt aussprechen (r, rr, ll, ch, c, s und z, g und j, b und v, Aussprache von Diphthongen, fehlende Aspiration der Konsonanten; in der Graphie: Einschieben des u oder Wechsel von c zu z beziehungsweise qu oder g zu j zum Erhalt der Aussprache, das stumme h) (3) einige repräsentative Varietäten der Zielsprache erkennen und einige Merkmale beschreiben Strategien und Methoden (4) (digitale) Medien oder Hilfsmittel zur Festigung und Selbstkorrektur der Aussprache nutzen 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Hör-/Hörsehverstehen Sprechen an Gesprächen teilnehmen Sprechen zusammenhängendes monologisches Sprechen 22 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 8/9/10
25 3.1.4 Text- und Medienkompetenz Texte mithilfe unterstützender Aufgaben verstehen, analysieren, in ihrem kulturellen Kontext deuten, zu verschiedenen weiteren kulturellen Kontexten in Beziehung setzen und die gewonnenen Kenntnisse für die Produktion eigener Texte nutzen. Sie nutzen die verschiedenen Medien der Informationsverarbeitung und -verbreitung mit Unterstützung kritisch und wenden Strategien der Textanalyse und Textproduktion weitgehend selbstständig an. Für den Schwierigkeitsgrad von Texten sind folgende Faktoren von Bedeutung: Vertrautheit mit dem Thema und der Textsorte, Informationsdichte, (fehlende) Redundanzen und Kohärenz, Textlänge, Abstraktionsgrad, Grad der Explizitheit, Diskursstruktur, Wortschatz, kulturspezifische Begriffe, Komplexität der Syntax, visuelle Unterstützung, Divergenz von Bild und Ton, Anzahl und Simultaneität der Sprecher, Sprechgeschwindigkeit, Stimmlage und Nebengeräusche. (1) didaktisierte und authentische Texte verstehen und schriftlich oder mit Hilfestellung mündlich strukturiert zusammenfassen (zum Beispiel anhand eines Textgerüsts) (2) diskontinuierliche Texte (zum Beispiel Bild, einfache Karikatur, Graphik, Tabelle) schriftlich und mündlich aufgabengestützt beschreiben, erklären und in Ansätzen dazu Stellung nehmen (3) nichtliterarische und literarische Texte angeleitet analysieren, interpretieren und die gewonnenen Aussagen am Text belegen (4) Texte mithilfe entsprechender Aufgaben und (bereitgestellter) Materialien in Ansätzen in ihrem geschichtlichen und gesellschaftlichen Kontext interpretieren (5) Aussage und Wirkung von Texten in Abhängigkeit vom jeweiligen Medium und mithilfe unterstützender Aufgaben in Ansätzen kritisch reflektieren (zum Beispiel Liedtext/Musik/ Videoclip) (6) Informationen recherchieren, dabei zunehmend selbstständig die Zuverlässigkeit der Quellen sowie die Urheberrechte beachten, die Ergebnisse bewerten und aufgabengerecht nutzen MB Medienanalyse VB Medien als Einflussfaktoren (7) gängige Textsorten (zum Beispiel Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Inhaltsangabe, Buchvorstellung, Filmempfehlung, Comic, novela gráfica, Blog, , Tagebucheintrag) und deren sprachliche, kinematographische, technische und graphische Gestaltungsmittel in ihrer Wirkung identifizieren, angeleitet interpretieren und bei der eigenen Textproduktion anwenden (zum Beispiel mithilfe von Modellen, fichas de escritura) BO MB Fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Arbeits- und Berufswelt Medienanalyse; Produktion und Präsentation (8) Texte durch das Verfassen eigener auch kreativer Texte erschließen und in Ansätzen interpretieren (9) bearbeitete literarische und nichtliterarische Textvorlagen angeleitet szenisch interpretieren und sinndarstellend vortragen Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 8/9/10 23
26 (10) Einstellungen und Handlungsmuster der Akteure und Figuren aus Textvorlagen aufgabenbezogen herausarbeiten (11) verschiedene klar zu trennende Perspektiven einnehmen, vergleichen und erklären und aus diesen heraus Stellung beziehen (12) eine eigene Perspektive herausarbeiten und plausibel darstellen (13) andere begründete Meinungen und Deutungen identifizieren und verschiedene Interpretationen von Texten aufgabengestützt erörtern BTV Selbstfindung und Akzeptanz anderer Lebensformen (14) bei künstlerisch-ästhetischen Texten (Literatur, Film) die Interpretationsoffenheit nutzen, indem sie offensichtliche Handlungsalternativen für Figuren und Darstellungsvariationen der Handlung herausarbeiten, formulieren, vergleichen und aufgabengestützt für die Interpretation heranziehen Strategien und Methoden (15) vertraute Hilfsmittel und Techniken zum vertieften sprachlichen, inhaltlichen, textuellen und medialen Verstehen und Produzieren von Texten weitgehend selbstständig anwenden (16) zusätzliche Quellen und Informationen zur Analyse und Interpretation aufgabengestützt nutzen (17) ihren über das Erstverstehen hinausgehenden Rezeptionsprozess bewerten, indem sie ihre ersten Eindrücke angeleitet reflektieren, relativieren und gegebenenfalls revidieren PG Selbstregulation und Lernen 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Interkulturelle kommunikative Kompetenz Hör-/Hörsehverstehen Leseverstehen Sprechen an Gesprächen teilnehmen Sprechen zusammenhängendes monologisches Sprechen Schreiben Sprachmittlung D Medien M Leitidee Funktionaler Zusammenhang 24 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 8/9/10
27 3.2 Klassen 11/ Soziokulturelles Orientierungswissen / Themen ihre interkulturellen, sprachlichen und medialen Kompetenzen auf der Basis von Kenntnissen in folgenden Themenbereichen anwenden: (1) Individuum und Gesellschaft sozialer Wandel (zum Beispiel demographischer Wandel, Verstädterung, soziale Kluft, Geschlechterrollen) Migrationsbewegungen von und nach Spanien/Hispanoamerika, Binnenmigration Zusammenleben verschiedener Kulturen, Ethnien, sozialer Milieus und Religionen in Spanien und Hispanoamerika Chancen und Herausforderungen der Mediengesellschaft Partizipation in der Zivilgesellschaft (zum Beispiel soziales und politisches Engagement, Emanzipationsbestrebungen von indígenas) Interkulturelle kommunikative Kompetenz Text- und Medienkompetenz E Soziokulturelles Orientierungswissen / Themen ETH Gerechtigkeit, Recht und Zusammenleben GEO Globale Herausforderung: Städte unter dem Einfluss gesellschaftlicher und naturräumlicher Veränderungen GEO Globale Herausforderungen: Disparitäre Entwicklungen GK Politische Teilhabe GK Gesellschaft BNE Komplexität und Dynamik nachhaltiger Entwicklung; Teilhabe, Mitwirkung, Mitbestimmung BO Planung und Gestaltung des Übergangs in Ausbildung, Studium und Beruf BTV Toleranz, Solidarität, Inklusion, Antidiskriminierung MB Mediengesellschaft PG Mobbing und Gewalt; Wahrnehmung und Empfindung VB Alltagskonsum; Bedürfnisse und Wünsche; Medien als Einflussfaktoren Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 11/12 25
28 (2) Gegebenheiten und Herausforderungen der Gegenwart wirtschaftliche, soziale und politische Verbindungen zwischen Spanien, Hispanoamerika, Europa und den USA Nachhaltiges Wirtschaften und Leben: Tourismus, Ökologie, Umgang mit Ressourcen Globalisierung und ihre Auswirkungen (zum Beispiel desigualdades, derechos humanos) Umgang mit der Vergangenheit in Spanien (memoria histórica) und Hispanoamerika (Aufarbeitung des diktatorialen Erbes) Emanzipationsprozesse (zum Beispiel Entkolonialisierung, Autonomiebestrebungen, Gewalt in politischen Auseinandersetzungen) G Diktaturen im 20. Jahrhundert als Gegenentwürfe zur parlamentarischen Demokratie (11.2, zweistündig) G Aktuelle Probleme postkolonialer Räume in historischer Perspektive (12.2, zweistündig) GEO Globale Herausforderungen GEO Globale Herausforderungen: Disparitäre Entwicklungen GK Internationale Beziehungen GK Frieden und Menschenrechte GK Die Europäische Union GK Internationale Beziehungen GK Frieden und Sicherheit GK Politisches System GK Wirtschaftspolitik WI Grundlagen der Ökonomie WI Globale Gütermärkte BNE Bedeutung und Gefährdungen einer nachhaltigen Entwicklung BTV Konfliktbewältigung und Interessenausgleich PG Mobbing und Gewalt; Selbstregulation und Lernen VB Alltagskonsum; Chancen und Risiken der Lebensführung; Umgang mit eigenen Ressourcen; Verbraucherrechte (3) Kulturelle Identität Elemente der kulturellen Identität (zum Beispiel regionale Zugehörigkeit, Rolle der Sprache, kritischer Umgang mit Stereotypen) vertiefte Auseinandersetzung mit Epochen der Geschichte Spaniens im 20./21. Jahrhundert: der spanische Bürgerkrieg, Franquismo, Transición, Spanien als Brücke zwischen Europa und Hispanoamerika vertiefte Auseinandersetzung mit Meilensteinen der Geschichte Hispanoamerikas: Folgen der Eroberung Amerikas, Kolonisation und Emanzipation, Diktatur, Revolution, Wege in die Demokratie Kulturelle Ausdrucksformen literarische Kurzformen (zum Beispiel Lieder, Gedichte, Comics) Lektüre mindestens einer Ganzschrift (zum Beispiel Theaterstück, Roman, novela gráfica), Kurzgeschichten und Auszüge aus literarischen Werken Kunst (zum Beispiel Bilder, Installationen, Skulpturen) Werbung, Videoclips, Dokumentationen Filme, Filmausschnitte, Kurzfilme 26 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 11/12
29 2.1 Sprachbewusstheit Interkulturelle kommunikative Kompetenz Text- und Medienkompetenz BK D (Bildende Kunst) Literarische Texte ETH Freiheit und Anthropologie G Wege in die westliche Moderne (11.1, zweistündig) G Diktaturen im 20. Jahrhundert als Gegenentwürfe zur parlamentarischen Demokratie (11.2, zweistündig) G West- und Osteuropa nach 1945: Streben nach Wohlstand und Partizipation (12.1, zweistündig) G Aktuelle Probleme postkolonialer Räume in historischer Perspektive (12.2, zweistündig) LUT BNE Demokratiefähigkeit Reflexion: Theatergeschichte, Theatertheorie und Theaterpraxis BTV Selbstfindung und Akzeptanz anderer Lebensformen MB Medienanalyse PG Mobbing und Gewalt; Wahrnehmung und Empfindung Interkulturelle kommunikative Kompetenz in direkten und medial vermittelten interkulturellen Situationen angemessen handeln. Dabei können sie zielkulturelle und eigene Vorstellungen, Erwartungen und Haltungen reflektieren und dabei ihr soziokulturelles Wissen anwenden. (1) ihr Wissen über zielkulturelle Aspekte in vielfältigen Situationen und Themenbereichen anwenden (zum Beispiel bei den Themen Alltag, Bildung, Berufswelt, gegenwärtige und historische soziopolitische Entwicklungen, globale Entwicklungen, bei literarischen Themen und Kontexten) VB Alltagskonsum (2) mit den ihnen zur Verfügung stehenden kommunikativen Mitteln interkulturelle Kommunikationssituationen gestalten und dabei fremdkulturelle Konventionen beachten (3) Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei eigenen und zielkulturellen Wahrnehmungen, Einstellungen und (Vor-)Urteilen erkennen und analysieren (4) anhand von fiktionalen Texten (Literatur, Film, Bild) vor dem zielkulturellen Hintergrund einen Perspektivenwechsel vollziehen und verschiedene (inter-/intrakulturelle) Perspektiven interpretieren BTV Toleranz, Solidarität, Inklusion, Antidiskriminierung Strategien und Methoden (5) interkulturelle Missverständnisse und Konfliktsituationen erkennen und klären PG Wahrnehmung und Empfindung 2.1 Sprachbewusstheit Text- und Medienkompetenz Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 11/12 27
30 3.2.3 Funktionale kommunikative Kompetenz Hör-/Hörsehverstehen authentische Hör- und Hörsehtexte zu vertrauten Themen verstehen. Sie verfügen über ein umfangreiches Repertoire an Erschließungsstrategien für Hör- und Hörsehtexte. Für den Schwierigkeitsgrad von Texten sind folgende Faktoren von Bedeutung: Vertrautheit mit dem Thema und der Textsorte, Informationsdichte, (fehlende) Redundanzen und Kohärenz, Textlänge, Abstraktionsgrad, Grad der Explizitheit, Diskursstruktur, Wortschatz, kulturspezifische Begriffe, Komplexität der Syntax, visuelle Unterstützung, Divergenz von Bild und Ton, Anzahl und Simultaneität der Sprecher, Sprechgeschwindigkeit, Grad der Abweichung von der Standardsprache, Stimmlage und Nebengeräusche. (1) der Hör-/Hörsehabsicht entsprechend die Hauptaussagen oder Detailinformationen aus Hör-/ Hörsehtexten entnehmen (Global-, Selektiv- und Detailverstehen) (2) auch bei weniger vertrauter Thematik längere Redebeiträge und komplexe Argumentationen verstehen, sofern diese, auch durch explizite Signale, klar strukturiert und artikuliert sind (3) gesehene und gehörte Informationen weitgehend selbstständig zueinander in Beziehung setzen und in ihrem Zusammenhang, kulturellen Kontext und in ihrer Wirkung verstehen BO MB Informationen über Berufe, Bildungs-, Studien- und Berufswege Information und Wissen; Kommunikation und Kooperation (4) textinterne Informationen und textexternes Wissen selbstständig in Beziehung setzen (5) explizite und implizite Einstellungen oder Beziehungen zwischen Sprechenden herausarbeiten BTV Personale und gesellschaftliche Vielfalt PG Mobbing und Gewalt Strategien und Methoden (6) geeignete Erschließungsstrategien entsprechend der Hör-/Hörsehabsicht gezielt und selbstständig einsetzen PG Selbstregulation und Lernen; Wahrnehmung und Empfindung 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Sprechen an Gesprächen teilnehmen Sprachmittlung Verfügen über sprachliche Mittel: Aussprache und Intonation Text- und Medienkompetenz 28 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 11/12
31 Leseverstehen authentische nichtliterarische und literarische Texte auch zu abstrakten Themen verstehen. Sie verfügen über ein umfangreiches Repertoire an Texterschließungsstrategien. Für den Schwierigkeitsgrad von Texten sind folgende Faktoren von Bedeutung: Vertrautheit mit dem Thema und der Textsorte, Informationsdichte, Wortschatz und Komplexität der Syntax, kulturspezifische Begriffe und visuelle Unterstützung. (1) der Leseintention entsprechend die Hauptaussagen oder Einzelinformationen aus Texten zu allgemeinen und abstrakten Themen herausarbeiten und sie gegebenenfalls im Detail verstehen (Global-, Selektiv-, Detailverstehen) (2) explizite und implizite Aussagen von Texten analysieren und bewerten (3) ein authentisches literarisches Werk oder mehrere Textauszüge aus literarischen Werken (zum Beispiel novela, obra dramática, cuento, poema, novela gráfica) verstehen (4) Texte und Textteile mit Bezug auf ein spezifisches Leseziel auswählen BO Informationen über Berufe, Bildungs-, Studien- und Berufswege BTV Personale und gesellschaftliche Vielfalt MB Information und Wissen (5) die inhaltliche Struktur von Texten zu allgemeinen und abstrakten Themen herausarbeiten Strategien und Methoden (6) geeignete Rezeptionsstrategien entsprechend der Leseabsicht selbstständig anwenden (7) (digitale) Hilfsmittel adäquat nutzen PG Selbstregulation und Lernen 2.2 Sprachlernkompetenz Interkulturelle kommunikative Kompetenz Hör-/Hörsehverstehen Sprechen an Gesprächen teilnehmen Sprachmittlung Text- und Medienkompetenz Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 11/12 29
32 Sprechen an Gesprächen teilnehmen sich weitgehend flüssig, sprachlich korrekt und adressatengerecht sowie situationsangemessen an Gesprächen auch über wenig vertraute und abstrakte Themen beteiligen. Sie verfügen über adäquate Strategien, um in Sprechsituationen angemessen zu interagieren. (1) ein adressatengerechtes und situationsangemessenes Gespräch beginnen, aufrechterhalten und beenden, dabei den Gesprächsverlauf aktiv gestalten und sich spontan und weitgehend flüssig äußern (2) Diskussionen zu vertrauten, auch abstrakten Themen führen (3) in Gesprächen und Diskussionen zu aktuellen wie generell bedeutsamen Sachverhalten Stellung beziehen BNE Demokratiefähigkeit (4) auf Äußerungen, Nachfragen, Kommentare und Einwände anderer sprachlich und interkulturell angemessen reagieren, indem sie gegebenenfalls Erläuterungen geben oder den eigenen Standpunkt darlegen BTV Konfliktbewältigung und Interessenausgleich (5) in Diskussionen verschiedene Perspektiven einnehmen und sprachlich differenziert formulieren (zum Beispiel eine zugewiesene Rolle in einer Debatte) BNE Teilhabe, Mitwirkung, Mitbestimmung BO Fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Arbeits- und Berufswelt BTV Konfliktbewältigung und Interessenausgleich PG Wahrnehmung und Empfindung Strategien und Methoden (6) verbale und nonverbale Gesprächskonventionen situationsangemessen selbstständig anwenden (zum Beispiel Gespräche auf verschiedene Weise eröffnen, fortführen, aufrechterhalten und beenden, aktives Zuhören signalisieren) (7) geeignete kommunikative Strategien einsetzen, um mit Nichtverstehen und Missverständnissen angemessen umzugehen (zum Beispiel Kompensationsstrategien) PG Selbstregulation und Lernen; Wahrnehmung und Empfindung 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Hör-/Hörsehverstehen Sprechen zusammenhängendes monologisches Sprechen Sprachmittlung Text- und Medienkompetenz 30 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 11/12
33 Sprechen zusammenhängendes monologisches Sprechen klar strukturierte und detaillierte Darstellungen zu allgemeinen Themen geben und Positionen begründet darlegen und vertreten. Sie verfügen über angemessene Vortrags- und Präsentationsstrategien, um eigene mündliche Produktionen situations- und adressatengerecht zu planen und vorzutragen. (1) Sachverhalte, bezogen auf ein breites Spektrum von auch abstrakten Themen, detailliert und strukturiert darstellen und gegebenenfalls kommentieren BNE Teilhabe, Mitwirkung, Mitbestimmung BO Fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Arbeits- und Berufswelt (2) Ansichten, Pläne oder Handlungen detailliert darstellen und begründen, und dabei Alternativen entwickeln und gegebenenfalls Zusammenhänge herstellen BNE Teilhabe, Mitwirkung, Mitbestimmung (3) komplexe nichtliterarische Texte sprachlich angemessen kohärent vorstellen, gegebenenfalls kommentieren und dabei wesentliche Aspekte und relevante unterstützende Details hervorheben (4) literarische Texte vorstellen, analysieren und kommentieren MB Medienanalyse (5) ein selbstständig erarbeitetes gesellschaftlich relevantes Thema sprachlich angemessen, klar strukturiert und flüssig vortragen und bei Nachfragen gegebenenfalls spontan vom vorbereiteten Konzept abweichen BO MB Fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Arbeits- und Berufswelt Produktion und Präsentation (6) eigene Monologe formulieren und interpretierend vortragen (zum Beispiel eine Rolle gestalten) MB Produktion und Präsentation Strategien und Methoden (7) selbstständig geeignete Methoden zur Ideenfindung, Planung und Strukturierung von Präsentationen anwenden (8) geeignete Vortrags- und Präsentationsstrategien selbstständig nutzen (9) Kompensations- und Korrekturtechniken spontan anwenden MB PG Produktion und Präsentation Selbstregulation und Lernen 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Soziokulturelles Orientierungswissen / Themen Sprechen an Gesprächen teilnehmen Sprachmittlung Verfügen über sprachliche Mittel: Wortschatz Verfügen über sprachliche Mittel: Grammatik Verfügen über sprachliche Mittel: Aussprache und Intonation Text- und Medienkompetenz D Sprachgebrauch und Sprachreflexion Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 11/12 31
34 Schreiben klar strukturierte Texte zu Themen ihrer Interessengebiete und zu fachlichen Themen textsortenadäquat und adressatengerecht verfassen. Sie verfügen über vielfältige Strategien zur Steuerung des Schreibprozesses. (1) Notizen zielorientiert und kohärent verfassen MB Kommunikation und Kooperation (2) Texte strukturiert zusammenfassen (3) ausführliche Berichte und Beschreibungen selbstständig verfassen (4) Wünsche, Pläne und Vorstellungen zusammenhängend darstellen und begründen MB Kommunikation und Kooperation (5) eigene und fremde Ansichten und Meinungen kohärent darstellen und begründen (6) formelle und persönliche Korrespondenz verfassen (zum Beispiel formeller Brief, , Blogeintrag, Chatbeitrag, Kurznachricht, Anfrage, Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, persönlicher Brief) BO MB Fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Arbeits- und Berufswelt Kommunikation und Kooperation; Produktion und Präsentation (7) auf der Basis von Impulsen (Stichwörter, Bilder, Lieder, Videoclips, Karikaturen) kreative Texte verfassen und gestalten MB Produktion und Präsentation Strategien und Methoden (8) Schreibprozesse selbstständig planen und umsetzen (9) (digitale) Hilfsmittel (zum Beispiel Wörterbücher, Grammatiken, Enzyklopädien) und Strategien zum Verfassen und Überarbeiten eigener Texte selbstständig und zielgerichtet verwenden PG Selbstregulation und Lernen 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Interkulturelle kommunikative Kompetenz Hör-/Hörsehverstehen Leseverstehen Sprechen an Gesprächen teilnehmen Sprechen zusammenhängendes monologisches Sprechen Sprachmittlung Text- und Medienkompetenz BK Bild D Texte und andere Medien 32 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 11/12
35 Sprachmittlung wesentliche Inhalte mündlicher oder schriftlicher Texte sowohl mündlich als auch schriftlich weitgehend adressatengerecht und situationsangemessen in die jeweils andere Sprache übertragen. Hierzu nutzen sie grundlegende Strategien der funktionalen kommunikativen Kompetenzen. (1) in interkulturellen Situationen Inhalte und Absichten adressatengerecht in der jeweils anderen Sprache wiedergeben und gegebenenfalls auf Nachfragen reagieren (2) wesentliche Inhalte bei ihnen vertrauten Themen in der jeweils anderen Sprache adressatengerecht und situationsangemessen zusammenfassen (3) kurze Textteile bei Bedarf sinngemäß übertragen (zum Beispiel für die Analyse/Interpretation relevante Teile von Sachtexten, literarischen Texten, Gedichten, Rezensionen) BO Fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Arbeits- und Berufswelt (4) für das interkulturelle Verstehen Erforderliches bei Bedarf erklären BNE Werte und Normen in Entscheidungssituationen BO Informationen über Berufe, Bildungs-, Studien- und Berufswege BTV Formen interkulturellen und interreligiösen Dialogs Strategien und Methoden (5) bei der Übertragung in die jeweils andere Sprache selbstständig interkulturelle Kompetenz nutzen und entsprechende kommunikative Strategien auswählen und anwenden (Strategien des Hör-/Hörsehverstehens, Leseverstehens, Sprechens und Schreibens sowie der Text- und Medienkompetenz) (6) bei der Übertragung von Informationen selbstständig Hilfsmittel einsetzen (zum Beispiel (digitale) Nachschlagewerke, (digitale) zweisprachige Wörterbücher, selbst erstellte Mindmaps, fichas de habla, Suchmaschinen) (7) vertraute Kompensationsstrategien selbstständig anwenden PG Selbstregulation und Lernen; Wahrnehmung und Empfindung 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Interkulturelle kommunikative Kompetenz Hör-/Hörsehverstehen Leseverstehen Sprechen an Gesprächen teilnehmen Schreiben Verfügen über sprachliche Mittel: Aussprache und Intonation Text- und Medienkompetenz D Medien D Sprachgebrauch und Sprachreflexion E Sprachmittlung F Sprachmittlung MB Information und Wissen; Kommunikation und Kooperation Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 11/12 33
36 Verfügen über sprachliche Mittel: Wortschatz Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein breites Repertoire an lexikalischen Einheiten, das es ihnen ermöglicht, auch zu wenig vertrauten und abstrakten Themen verständlich und weitgehend korrekt zu kommunizieren. Sie verfügen über Strategien zur Erschließung und Vernetzung lexikalischer Einheiten. (1) einen differenzierten Wortschatz je nach Situation und Intention angemessen und weitgehend korrekt einsetzen, um sich auch zu wenig vertrauten und abstrakten Themen zu äußern (2) einen differenzierten Funktionswortschatz verstehen und weitgehend korrekt anwenden PG Selbstregulation und Lernen Strategien und Methoden (3) Verfahren zum Memorieren, Dokumentieren und Strukturieren von lexikalischen Einheiten selbstständig anwenden (zum Beispiel Wortfeld, Wortfamilien, Mindmap, Visualisierung, (digitale) Vokabeltrainer) PG Selbstregulation und Lernen (4) Strategien der Umschreibung selbstständig anwenden (zum Beispiel Synonyme, Definitionen) (5) neue lexikalische Einheiten selbstständig erschließen (Rückgriff auf andere Sprachen, den Kontext, Textsorten, Illustrationen, Wortbildungsregeln) (6) (digitale) Hilfsmittel selbstständig nutzen (zum Beispiel ein- und zweisprachige Wörterbücher, thematische Wortschatzsammlungen) MB Information und Wissen 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Funktionale kommunikative Kompetenz D Sprachgebrauch und Sprachreflexion 34 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 11/12
37 Verfügen über sprachliche Mittel: Grammatik ein breites Repertoire grammatischer Strukturen für die Realisierung ihrer kommunikativen Absicht anwenden sowie frequente Varianten verstehen. Sie verfügen über Strategien zum Erschließen von Strukturen und zur Selbstkorrektur. (1) [in 8/9/10] (2) [in 8/9/10] (3) [in 8/9/10] (4) [in 8/9/10] (5) [in 8/9/10] (6) [in 8/9/10] Verfügen über sprachliche Mittel: Grammatik (1), (2), (3), (4), (5), (6) (7) Vorgänge als gleichzeitig und in ihrer zeitlichen Abfolge und Dauer darstellen gerundio perífrasis verbales Infinitivkonstruktionen (8) [in 8/9/10] (9) [in 8/9/10] (10) [in 8/9/10] Verfügen über sprachliche Mittel: Grammatik (8), (9), (10) (11) komplexe Zusammenhänge formulieren Nebensatzverkürzungen (12) [in 8/9/10] Verfügen über sprachliche Mittel: Grammatik (12) (13) unpersönliche Aussagen formulieren Ersatzkonstruktionen und pasiva refleja Zustands- und Vorgangspassiv Strategien und Methoden (14) Strategien zum Erschließen von Strukturen anwenden (15) (digitale) Hilfsmittel nutzen und Strategien zur Selbstkorrektur selbstständig einsetzen PG Selbstregulation und Lernen 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Funktionale kommunikative Kompetenz D Sprachgebrauch und Sprachreflexion Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 11/12 35
38 Verfügen über sprachliche Mittel: Aussprache und Intonation ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster des Kastilischen oder einer hispanoamerikanischen Varietät verwenden. Ihre Aussprache ist klar und verständlich und die Intonation angemessen. Sie verfügen über Strategien der Selbstkorrektur. (1) das Aussprache- und Intonationsmuster einer Standardvarietät verwenden und dabei eine klar verständliche Aussprache und angemessene Intonation zeigen (2) [in 8/9/10] Verfügen über sprachliche Mittel: Aussprache und Intonation (2) (3) repräsentative Varietäten der Zielsprache erkennen und einige Merkmale beschreiben Strategien und Methoden (4) (digitale) Medien oder Hilfsmittel zur Festigung und Selbstkorrektur der Aussprache nutzen PG Selbstregulation und Lernen 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Hör-/Hörsehverstehen Sprechen an Gesprächen teilnehmen Sprechen zusammenhängendes monologisches Sprechen 36 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 11/12
39 3.2.4 Text- und Medienkompetenz Texte verstehen, analysieren, in ihrem kulturellen Kontext deuten, zu verschiedenen weiteren kulturellen Kontexten in Beziehung setzen und die gewonnen Erkenntnisse für die Produktion eigener Texte nutzen. Sie nutzen die verschiedenen Medien der Informationsverarbeitung und -verbreitung zunehmend kritisch und wenden Strategien der Textanalyse und Textproduktion weitgehend selbstständig an. Für den Schwierigkeitsgrad von Texten sind folgende Faktoren von Bedeutung: Vertrautheit mit dem Thema und der Textsorte, Informationsdichte, (fehlende) Redundanzen und Kohärenz, Textlänge, Abstraktionsgrad, Grad der Explizitheit, Diskursstruktur, Wortschatz, kulturspezifische Begriffe, Komplexität der Syntax, Divergenz von Bild und Ton, Anzahl und Simultaneität der Sprecher, Sprechgeschwindigkeit, Grad der Abweichung von der Standardsprache, Stimmlage und Nebengeräusche. (1) authentische Texte verstehen und schriftlich oder mündlich zusammenfassen (2) diskontinuierliche Texte (zum Beispiel Bild, Karikatur, Graphik, Tabelle) schriftlich und mündlich beschreiben, erklären und dazu Stellung nehmen (3) nichtliterarische und literarische Texte aufgabenbezogen analysieren, interpretieren und die gewonnenen Aussagen am Text belegen (4) Texte mithilfe entsprechender Aufgaben und (bereitgestellter) Materialien in ihrem geschichtlichen und gesellschaftlichen, gegebenenfalls medialen Kontext interpretieren (5) Aussage und Wirkung von Texten in Abhängigkeit vom jeweiligen Medium in Ansätzen kritisch reflektieren (zum Beispiel Vergleich von Textvorlage und Verfilmung) (6) Informationen kritisch recherchieren, die Ergebnisse selbstständig bewerten und aufgabengerecht nutzen MB Medienanalyse VB Medien als Einflussfaktoren (7) Textsorten (zum Beispiel Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Inhaltsangabe, Buchvorstellung, Filmempfehlung, Comic, novela gráfica, Blog, , Tagebucheintrag) und deren sprachliche, kinematographische, technische und graphische Gestaltungsmittel in ihrer Wirkung identifizieren und deuten und bei der eigenen Textproduktion anwenden (zum Beispiel gattungsspezifischer Analysewortschatz und adäquate Redemittel) (8) Texte durch das Verfassen eigener auch kreativer Texte erschließen und interpretieren (9) bearbeitete literarische und nichtliterarische Textvorlagen szenisch interpretieren und sinndarstellend vortragen (10) Einstellungen und Handlungsmuster der Akteure und Figuren aus Textvorlagen aufgabenbezogen herausarbeiten (11) verschiedene Perspektiven einnehmen, vergleichen und kommentieren und aus diesen heraus Stellung beziehen (12) eine eigene Perspektive herausarbeiten und plausibel darstellen Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 11/12 37
40 (13) andere begründete Meinungen und Deutungen identifizieren und verschiedene Interpretationen von Texten erörtern BTV Selbstfindung und Akzeptanz anderer Lebensformen (14) bei künstlerisch-ästhetischen Texten (Literatur, Film) die Interpretationsoffenheit nutzen, indem sie offensichtliche Handlungsalternativen für Figuren und Darstellungsvariationen der Handlung herausarbeiten, formulieren, vergleichen und aufgabengestützt für die Interpretation heranziehen Strategien und Methoden (15) vertraute Hilfsmittel und Techniken zum vertieften sprachlichen, inhaltlichen, textuellen und medialen Verstehen und Produzieren von Texten anwenden MB Medienanalyse; Produktion und Präsentation (16) zusätzliche Quellen und Informationen zur Analyse und Interpretation weitgehend selbstständig nutzen (17) ihren über das Erstverstehen hinausgehenden vertieften Rezeptionsprozess bewerten, indem sie ihre ersten Eindrücke kritisch reflektieren, relativieren und gegebenenfalls revidieren PG Selbstregulation und Lernen 2.1 Sprachbewusstheit 2.2 Sprachlernkompetenz Interkulturelle kommunikative Kompetenz Hör-/Hörsehverstehen Leseverstehen Sprechen an Gesprächen teilnehmen Sprechen zusammenhängendes monologisches Sprechen Schreiben Sprachmittlung D Medien LUT Theaterpraktische Arbeit: Schauspiel 38 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 11/12
41 4. Operatoren In den Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen werden Operatoren (handlungsleitende Verben) verwendet. Diese sind in der vorliegenden Liste aufgeführt. Standards legen fest, welchen Anforderungen die Schülerinnen und Schüler gerecht werden müssen. Daher werden Operatoren in der Regel nach drei Anforderungsbereichen (AFB) gegliedert. Die Beschreibung dieser Anforderungsbereiche entspricht den KMK-Standards für die fortgeführte Fremdsprache 2012: Anforderungsbereich I umfasst das Wiedergeben von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang, die Verständnissicherung sowie das Anwenden und Beschreiben geübter Arbeitstechniken und Verfahren. Anforderungsbereich II umfasst das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung bekannten Zusammenhang und das selbstständige Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte. Anforderungsbereich III umfasst das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen. Nicht in allen Fällen ist eine eindeutige Zuordnung eines Operators zu einem Anforderungsbereich möglich. Operatoren Beschreibung AFB analysieren an-/verwenden, nutzen, einsetzen; beachten (korrekt) aussprechen, schreiben, vortragen ein Gespräch / eine Diskussion beginnen, aufrechterhalten (fortführen) und beenden begründen belegen inhaltliche und/oder sprachliche Aspekte eines Textes (zum Beispiel Strukturen, Motive, Intention) herausarbeiten und erklären sprachliche und inhaltliche Kenntnisse sowie Methoden und Lernstrategien durch Abstraktion und Transfer in anderen Kontexten nutzbar machen; Regeln und Konventionen zur Kenntnis nehmen und bewusst einhalten Aussprache, Intonationsmuster und Schreibweise von Wörtern und Sätzen korrekt umsetzen ein Gespräch / eine Diskussion unter Anwendung soziokulturellen Wissens sowie unter Verwendung geeigneter sprachlicher Mittel (auch Floskeln und Wendungen) und Gesprächsstrategien adressatengerecht führen Positionen, Auffassungen oder Urteile durch Argumente stützen oder widerlegen eine Deutungshypothese durch Verweis auf spezifische Textstellen nachweisen II, III II, III I III II, III I (be-)nennen Sachverhalte präzise bezeichnen, aufzählen oder auflisten I Operatoren 39
42 Operatoren Beschreibung AFB beschreiben bewerten in Beziehung setzen darstellen, darlegen erkennen, identifizieren erklären erörtern erschließen (nach-)erzählen formulieren herausarbeiten Informationen entnehmen interpretieren kommentieren Leerstellen füllen nachschlagen eine Perspektive übernehmen präsentieren Gegenstände, Personen und Vorgänge sachlich und präzise darstellen Sachverhalte, Aussagen, Positionen, Maßnahmen, Lösungen auf ihre Vor- und Nachteile hin prüfen und darauf basierend zu einem begründeten Urteil gelangen einen Sachverhalt, ein Zitat oder ein Argument aspekt- und kriterienorientiert mit einem anderen kombinieren oder in einen neuen (gegebenenfalls übergeordneten) Zusammenhang stellen Sachverhalte, Positionen sachbezogen ausführen (gelernte) sprachliche oder inhaltliche Sachverhalte (auch Strukturen und Sprechintentionen) in Texten erfassen Sachverhalte so darstellen, dass Zusammenhänge (wie Ursache, Folge) klar werden, auch unter Verwendung geeigneter Beispiele eine vorgegebene Problemstellung unter Abwägung von Argumenten diskutieren und zu einem begründeten Urteil kommen einen sprachlichen oder inhaltlichen Sachverhalt aus dem Kontext heraus und/oder unter Anwendung textexternen Wissens herleiten Erlebtes, Erdachtes, Gehörtes oder Gelesenes mit narrativer Struktur ausführen Inhalte, Sachverhalte mit eigenen Worten und unter Beachtung sprachlicher Regeln zum Ausdruck bringen Teilaspekte (zum Beispiel Strukturen, Leitgedanken, Strategien) aus einem Textganzen herauslösen und auf Wesentliches konzentriert darlegen explizite oder implizite Aussagen in einem Text erfassen den Sinngehalt eines Textes unter Berücksichtigung des Inhalts, des Aufbaus, der sprachlichen Mittel sowie textexterner Aspekte (zum Beispiel historischer, sozialer) erklären einen Sachverhalt oder eine Fragestellung kritisch beleuchten beziehungsweise Anmerkungen zu einem Sachverhalt machen fiktionale Texte sach-, textsorten- und/oder aufgabengerecht erweitern Informationen (lexikalische Einheiten, grammatische Phänomene, Aussprache) zur Texterschließung oder zur Textproduktion gezielt in adäquaten Nachschlagewerken auffinden und nutzbar machen sich in eine bestimmte Person oder Rolle hineinversetzen Sachverhalte unterschiedlicher Komplexität der Klasse oder einem Publikum vorstellen, gegebenenfalls unter Einsatz geeigneter Präsentationstechniken und -medien I, II III III II I II III II, III II, III I II, III I, II, III III III III I III III 40 Operatoren
43 Operatoren Beschreibung AFB reagieren eine Rolle gestalten Stellung beziehen, den eigenen Standpunkt vertreten Äußerungen eines Gesprächspartners angemessen verbal und/ oder nonverbal begegnen eine Rolle sprachlich und inhaltlich erarbeiten und ausfüllen (szenische Interpretation einer Figur, ausgehend von einer Textvorlage oder einer von Schülerinnen und Schülern ausgearbeiteten Gestaltung einer Leerstelle) den eigenen Standpunkt mit geeigneten Argumenten begründet darlegen beziehungsweise in einer Diskussion verteidigen I, II, III III III strukturieren nach vorgegebenen oder eigenen Kriterien ordnen II überarbeiten einen Text anhand bekannter Kriterien und Regeln auf seine Richtigkeit und/oder auf seine stilistische Qualität hin prüfen und gegebenenfalls verbessern II übersetzen Sachverhalte in einer anderen Sprache präzise wiedergeben II übertragen einen Text umgestalten einen Text verfassen vergleichen versprachlichen (global, detailliert, selektiv) verstehen Inhalte von Texten sach-, adressaten- und situationsgerecht zusammenfassen und sinngemäß in der jeweils anderen Sprache wiedergeben einen Text textsortengerecht umschreiben (zum Beispiel anderer Schluss) oder in eine andere Textsorte überführen einen Text unter Anwendung der erforderlichen Textsortenmerkmale schreiben (zum Beispiel innerer Monolog, Tagebucheintrag, Brief) Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Sachverhalten, Standpunkten und Personen feststellen und Schlüsse ziehen diskontinuierliche Texte, Bilder und Bildsequenzen unter Verwendung angemessener Redemittel präzise und sachbezogen in kontinuierliche Texte übertragen einem Text je nach Lese- oder Hörabsicht Informationen entnehmen, die aus dem Textganzen, aus für das Textverständnis relevanten Details oder aus ausgewählten Einzeltextstellen hervorgehen II III III II, III III I wiedergeben Textinhalte mit eigenen Worten ausführen I zuordnen, unterscheiden zusammenfassen einzelne Inhalte (zum Beispiel Laute) einer vorgegebenen Kategorie zuweisen Texte beziehungsweise einzelne Textaspekte sachbezogen, strukturiert und auf das Wesentliche begrenzt wiedergeben I II Operatoren 41
44 5. Anhang 5.1 Verweise Das Verweissystem im Bildungsplan 2016 unterscheidet zwischen vier verschiedenen Verweisarten. Diese werden durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet: Symbol Erläuterung Verweis auf die prozessbezogenen Kompetenzen Verweis auf andere Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen desselben Fachplans Verweis auf andere Fächer Verweis auf Leitperspektiven Die vier verschiedenen Verweisarten Die Darstellungen der Verweise weichen im Web und in der Druckfassung voneinander ab. Darstellung der Verweise auf der Online-Plattform Verweise auf Teilkompetenzen werden unterhalb der jeweiligen Teilkompetenz als anklickbare Symbole dargestellt. Nach einem Mausklick auf das jeweilige Symbol werden die Verweise im Browser detaillierter dargestellt (dies wird in der Abbildung nicht veranschaulicht): (2) anhand von einfachen Versuchen zwei Wetterelemente analysieren (zum Beispiel Niederschlag, Temperatur) Darstellung der Verweise in der Webansicht (Beispiel aus Geographie Grundlagen von Wetter und Klima ) Darstellung der Verweise in der Druckfassung In der Druckfassung und in der PDF-Ansicht werden sämtliche Verweise direkt unterhalb der jeweiligen Teilkompetenz dargestellt. Bei Verweisen auf andere Fächer ist zusätzlich das Fächerkürzel dargestellt (im Beispiel BNT für Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT) ): (2) anhand von einfachen Versuchen zwei Wetterelemente analysieren (zum Beispiel Niederschlag, Temperatur) 2.5 Methodenkompetenz Klimazonen Europas BNT Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften und der Technik MB Produktion und Präsentation Darstellung der Verweise in der Druckansicht (Beispiel aus Geographie Grundlagen von Wetter und Klima ) 42 Anhang
45 Gültigkeitsbereich der Verweise Sind Verweise nur durch eine gestrichelte Linie von den darüber stehenden Kompetenzbeschreibungen getrennt, beziehen sie sich unmittelbar auf diese. Stehen Verweise in der letzten Zeile eines Kompetenzbereichs und sind durch eine durchgezogene Linie von diesem getrennt, so beziehen sie sich auf den gesamten Kompetenzbereich. Die Verweise gelten für... (1) die Sichtweisen von Betroffenen und Beteiligten in Konfliktsituationen herausarbeiten und bewerten (zum Beispiel Elternhaus, Schule, soziale Netzwerke)... die Teilkompetenz (1) (2) Erklärungsansätze für Gewalt anhand von Beispielsituationen herausarbeiten und beurteilen (3) selbstständig Strategien zu gewaltfreien und verantwortungsbewussten Konfliktlösungen entwickeln und überprüfen (zum Beispiel Kompromiss, Mediation, Konsens)... die Teilkompetenzen (2) und (3)... alle Teilkompetenzen der Tabelle Gültigkeitsbereich von Verweisen (Beispiel aus Ethik Verantwortung im Umgang mit Konflikten und Gewalt ) 5.2 Abkürzungen Leitperspektiven Allgemeine Leitperspektiven BNE BTV PG Bildung für nachhaltige Entwicklung Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt Prävention und Gesundheitsförderung Themenspezifische Leitperspektiven BO MB VB Berufliche Orientierung Medienbildung Verbraucherbildung Anhang 43
46 Fächer des Gymnasiums Abkürzung BIO BK BKPROFIL BMB BNT CH D E1 E2 ETH F1 F2 F3 G GEO GK GR3 ITAL3 L1 L2 L3 LUT M MUS MUSPROFIL NWT PH PORT3 RAK RALE Fach Biologie Bildende Kunst Bildende Kunst Profilfach Basiskurs Medienbildung Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT) Chemie Deutsch Englisch als erste Fremdsprache Englisch als zweite Fremdsprache Ethik Französisch als erste Fremdsprache Französisch als zweite Fremdsprache Französisch als dritte Fremdsprache Profilfach Geschichte Geographie Gemeinschaftskunde Griechisch als dritte Fremdsprache Profilfach Italienisch als dritte Fremdsprache Profilfach Latein als erste Fremdsprache Latein als zweite Fremdsprache Latein als dritte Fremdsprache Profilfach Literatur und Theater Mathematik Musik Musik Profilfach Naturwissenschaft und Technik (NwT) Profilfach Physik Portugiesisch als dritte Fremdsprache Profilfach Altkatholische Religionslehre Alevitische Religionslehre 44 Anhang
47 Abkürzung REV RISL RJUED RRK RSYR RU2 RU3 SPA3 SPO SPOPROFIL WBS WI Fach Evangelische Religionslehre Islamische Religionslehre sunnitischer Prägung Jüdische Religionslehre Katholische Religionslehre Syrisch-Orthodoxe Religionslehre Russisch als zweite Fremdsprache Russisch als dritte Fremdsprache Profilfach Sport Sport Profilfach Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung (WBS) Wirtschaft 5.3 Geschlechtergerechte Sprache Im Bildungsplan 2016 wird in der Regel durchgängig die weibliche Form neben der männlichen verwendet; wo immer möglich, werden Paarformulierungen wie Lehrerinnen und Lehrer oder neutrale Formen wie Lehrkräfte, Studierende gebraucht. Ausnahmen von diesen Regeln finden sich bei Überschriften, Tabellen, Grafiken, wenn dies aus layouttechnischen Gründen (Platzmangel) erforderlich ist, Funktions- oder Rollenbezeichnungen beziehungsweise Begriffen mit Nähe zu formalen und juristischen Texten oder domänenspezifischen Fachbegriffen (zum Beispiel Marktteilnehmer, Erwerbs tätiger, Auftraggeber, (Ver )Käufer, Konsument, Anbieter, Verbraucher, Arbeit nehmer, Arbeitgeber, Bürger, Bürgermeister ), massiver Beeinträchtigung der Lesbarkeit. Selbstverständlich sind auch in all diesen Fällen Personen jeglichen Geschlechts gemeint. Anhang 45
48 5.4 Besondere Schriftauszeichnungen Klammern und Verbindlichkeit von Beispielen Im Fachplan sind einige Begriffe in Klammern gesetzt. Steht vor den Begriffen in Klammern zum Beispiel, so dienen die Begriffe lediglich einer genaueren Klärung und Einordnung. Begriffe in Klammern ohne zum Beispiel sind ein verbindlicher Teil der Kompetenzformulierung. Steht in Klammern ein unter anderem, so sind die in der Klammer aufgeführten Aspekte verbindlich zu unterrichten und noch weitere Beispiele der eigenen Wahl darüber hinaus. Kursivschreibung Fremdsprachliche Ausdrücke sind in den Fachplänen der modernen Fremdsprachen kursiv gesetzt. Gestrichelte Unterstreichungen in den gymnasialen Fachplänen In den prozessbezogenen Kompetenzen: Die gekennzeichneten Stellen sind in der Oberstufe (Klassen 10 12) zu verorten. In den inhaltsbezogenen Kompetenzen: Die gekennzeichneten Stellen reichen über das E-Niveau des gemeinsamen Bildungsplans für die Sekundarstufe I hinaus und sind explizit erst in der Klasse 10 zu verorten. Abweichung davon im Fach Spanisch 3. Fremdsprache Im Fach Spanisch 3. Fremdsprache ist Klasse 10 der erste formulierte Standard und umfasst abweichend vom ersten Spiegelstrich im obigen Absatz die Klassen 8/9/10. Leerzeilen/Leerkompetenzen in den Plänen der modernen Fremdsprache Um den Lernstand, den die Schülerinnen und Schüler laut Bildungsplan in die nächste Klasse mitbringen sollen, besser nachverfolgen zu können, hat jede Teilkompetenz über alle Klassen hinweg die gleiche Nummerierung. Die Progression der einzelnen (Teil-)Kompetenzen wird so erkennbar. Mitunter wird eine Teilkompetenz ab einer bestimmten Klasse nicht mehr fortgeführt beziehungsweise sie setzt später ein. In diesen Fällen erfolgt ein konkreter Hinweis. Beispiel 1: Leere Teilkompetenz in Klassen 7/8: (5) [in 5/6] Dies bedeutet, dass der Aufbau der Teilkompetenz bereits in Klassen 5/6 abgeschlossen ist. Die Inhalte einer solchen Teilkompetenz werden nach Bedarf auch in nachfolgenden Klassen geübt. Beispiel 2: Leere Teilkompetenz in Klassen 5/6: (5) [in 7/8] Dies bedeutet, dass der Aufbau der Teilkompetenz erst in Klassen 7/8 einsetzt. 46 Anhang
49 5.5 Glossar Im Glossar werden fachspezifische Begriffe erläutert. Begriff adressatengerecht Alltagsthemen (Themen allgemein, komplex, vertraut, vorbereitet) angeleitet aufgabengestützt bottom up fichas de habla / fichas de escritura Informationen, konkurrierend Hilfestellung, mit Lesen, extensiv Texte Erläuterung dem jeweiligen Kommunikationspartner (interkulturell) angemessen Themen, die im Alltag von Bedeutung sind, zum Beispiel Familie, Freunde, Schule, Freizeit, Lebensraum Der Arbeitsprozess wird von der Lehrkraft in bewältigbare Arbeitsschritte mit angemessenen und differenzierten Hilfestellungen aufgeteilt, vorstrukturiert und (eng) begleitet. Der Prozess wird den Schülerinnen und Schülern im Idealfall bewusst gemacht Die Aufgabe strukturiert den Arbeitsprozess der Lernenden, das heißt, sie müssen mit dem Aufgabenformat vertraut sein, um diese (selbstständig) bewältigen zu können (zum Beispiel die Operatoren kennen) Erschließung der sprachlichen Verarbeitungsebene eines Textes ausgehend von der Buchstaben-/Laut-/Wort-/Satzebene (datengeleitetes Verstehen) Zusammenstellung von Redemitteln verknüpft mit Strukturvorgaben bezüglich einer Textsorte / Kommunikationssituation / eines Sprechaktes Inhalte in einem Text, die sich scheinbar widersprechen der Arbeitsprozess der Schülerinnen und Schüler wird durch die Lehrkraft mit Unterstützungsmaterial begleitet Lektüre langer, sprachlich und inhaltlich leicht zu bewältigender Texte zur Festigung von Sprachkenntnissen und Förderung der Lesemotivation, der Schwerpunkt liegt auf dem Globalverstehen Es wird von einem weiten Textbegriff ausgegangen. Zu diesem Textbegriff gehören graphische, visuelle, auditive und audiovisuelle Texte, die durch verschiedenste Medien transportiert werden können (zum Beispiel handschriftlich, visuell, digital, verbal, nonverbal) authentische Texte Originaltexte, die für Muttersprachler aufgezeichnet oder produziert wurden bearbeitete Texte Texte, bei denen die Ergebnisse des Hör-/Hörseh- oder Leseverstehens (erste Verstehensebene) gesichert wurden und eine erste inhaltliche und sprachliche Analyse (zweite Verstehensebene) erfolgt ist didaktisierte Texte Texte, die speziell für Unterrichtssituationen produziert oder adaptiert wurden diskontinuierliche Texte Bilder und Wort-Bild-Kombinationen (zum Beispiel Broschüre, Karikatur, Diagramm, Graphik, Plakat, Schaubild, schematische Darstellungen, Webseiten, auch Abkürzungen und Symbole aus Kurzbotschaften) Anhang 47
50 Begriff kontinuierliche Texte Erläuterung fortlaufend geschriebene Texte mit sprachlich realisierter Themenentfaltung kreative Texte von Schülerinnen und Schülern produzierte Texte, bei denen der persönliche Ausdruck und die Fantasie im Vordergrund stehen literarische Texte fiktionale Texte, die besondere Stilmittel aufweisen (zum Beispiel Romane, Dramen, Gedichte, Filme) Themen abstrakte Themen Themen, die sich im Gedanklichen/Theoretischen bewegen (zum Beispiel Umgang miteinander, Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit) allgemeine Themen Themen, die in der Öffentlichkeit präsent sind und diskutiert werden (zum Beispiel Wahlen, Umweltschutz, Tourismus, Medienkonsum) komplexe Themen facettenreiche, vielschichtige Themen (zum Beispiel Umgang mit einer Diktatur) vertraute Themen Themen, die im Unterricht oder von den Schülerinnen und Schülern selbstständig erarbeitet werden vorbereitete Themen top down Varietäten einer Sprache Verstehensinseln Verstehensprozesse Wortschatz Themen, die die Schülerinnen und Schüler im Unterricht oder zu Hause vorbereiten Erschließung der inhaltlichen Verarbeitungsebene eines Textes durch Inferenz und Hypothesenbildung (Aktivierung von Weltwissen, konzeptgeleitetes Verstehen) nach regionalen Unterschieden (diatopische Varietäten, zum Beispiel el andaluz, el español rioplatense) nach sozialen Gruppen (diastratische Varietäten, zum Beispiel lenguaje juvenil) nach Sprechsituationen (diaphasische Varietäten, zum Beispiel español coloquial) verstandene Textteile, von denen ausgehend gezielt das Erschließen des Gesamttextes erfolgt Gleichzeitig ablaufende bottom up und top down Prozesse Funktions- und Interpretationswortschatz: sprachliche Einheiten, die vom thematischen Kontext unabhängig zur Strukturierung, Analyse oder Interpretation von Texten dienen 48 Anhang
51 Impressum Kultus und Unterricht Ausgabe C Herausgeber Internet Verlag und Vertrieb Urheberrecht Bildnachweis Gestaltung Druck Bezugsbedingungen Amtsblatt des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg Bildungsplanplanhefte Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Postfach , Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Schulentwicklung, Heilbronner Str. 172, Stuttgart Neckar-Verlag GmbH, Villingen-Schwenningen Die fotomechanische oder anderweitig technisch mögliche Reproduktion des Satzes beziehungsweise der Satzordnung für kommerzielle Zwecke nur mit Genehmigung des Herausgebers. Robert Thiele, Stuttgart Ilona Hirth Grafik Design GmbH, Karlsruhe Konrad Triltsch Print und digitale Medien GmbH, Ochsenfurt Soweit die vorliegende Publikation Nachdrucke enthält, wurden dafür nach bestem Wissen und Gewissen Lizenzen eingeholt. Die Urheberrechte der Copyrightinhaber werden ausdrücklich anerkannt. Sollten dennoch in einzelnen Fällen Urheberrechte nicht berücksichtigt worden sein, wenden Sie sich bitte an den Herausgeber. Alle eingesetzten beziehungsweise verarbeiteten Rohstoffe und Materialien entsprechen den zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Normen beziehungsweise geltenden Bestimmungen und Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. Der Herausgeber hat bei seinen Leistungen sowie bei Zulieferungen Dritter im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten umweltfreundliche Verfahren und Erzeugnisse bevorzugt eingesetzt. Juni 2016 Die Lieferung der unregelmäßig erscheinenden Bildungsplanplanhefte erfolgt automatisch nach einem festgelegten Schlüssel. Der Bezug der Ausgabe C des Amtsblattes ist verpflichtend, wenn die betreffende Schule im Verteiler (abgedruckt auf der zweiten Umschlagseite) vorgesehen ist (Verwaltungsvorschrift vom 22. Mai 2008, K.u.U. S. 141). Die Bildungsplanplanhefte werden gesondert in Rechnung gestellt. Die einzelnen Reihen können zusätzlich abonniert werden. Abbestellungen nur halbjährlich zum 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres schriftlich acht Wochen vorher bei der Neckar-Verlag GmbH, Postfach 1820, Villingen-Schwenningen.
52
SPANISCH OBERSTUFENCURRICULUM
 SPANISCH OBERSTUFENCURRICULUM KERNCURRICULUM SCHULCURRICULUM Hör- und Hör-/Sehverstehen KOMMUNIKATIVE FERTIGKEITEN Gesprächen, Berichten, Diskussionen, Referaten etc. folgen, sofern Standardsprache gesprochen
SPANISCH OBERSTUFENCURRICULUM KERNCURRICULUM SCHULCURRICULUM Hör- und Hör-/Sehverstehen KOMMUNIKATIVE FERTIGKEITEN Gesprächen, Berichten, Diskussionen, Referaten etc. folgen, sofern Standardsprache gesprochen
Synopse für Let s go Band 3 und 4
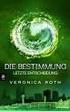 Synopse für Let s go Band 3 und 4 Umsetzung der Anforderungen des Kerncurriculums Englisch für die Sekundarstufe I an Hauptschulen Hessen 1 Kompetenzbereich Kommunikative Kompetenz am Ende der Jahrgangsstufe
Synopse für Let s go Band 3 und 4 Umsetzung der Anforderungen des Kerncurriculums Englisch für die Sekundarstufe I an Hauptschulen Hessen 1 Kompetenzbereich Kommunikative Kompetenz am Ende der Jahrgangsstufe
Bildungsplan 2016 Allgemein bildende Schulen Gymnasium
 Bildungsplan 2016 Allgemein bildende Schulen Gymnasium Anhörungsfassung Stand: 26. Januar 2016 Stuttgart 2016 Impressum Herausgeber: Urheberrecht: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg,
Bildungsplan 2016 Allgemein bildende Schulen Gymnasium Anhörungsfassung Stand: 26. Januar 2016 Stuttgart 2016 Impressum Herausgeber: Urheberrecht: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg,
Synopse für Let s go Band 1 und 2
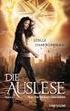 Synopse für Let s go Band 1 und 2 Umsetzung der Anforderungen des Kerncurriculums Englisch für die Sekundarstufe I an Hauptschulen Hessen 1 Kompetenzbereich Kommunikative Kompetenz am Ende der Jahrgangsstufe
Synopse für Let s go Band 1 und 2 Umsetzung der Anforderungen des Kerncurriculums Englisch für die Sekundarstufe I an Hauptschulen Hessen 1 Kompetenzbereich Kommunikative Kompetenz am Ende der Jahrgangsstufe
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Englisch. Funktionale kommunikative Kompetenz (F) Hör-/Hörsehverstehen
 Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Englisch Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, Bildungsstandards und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der Themenfelder
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Englisch Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, Bildungsstandards und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der Themenfelder
Bildungsplan. gymnasiale Oberstufe. Anlage zum Rahmenplan Neuere Fremdsprachen
 Bildungsplan gymnasiale Oberstufe Anlage zum Rahmenplan Neuere Fremdsprachen zur Umsetzung der Bildungsstandards im Fach Neuere Fremdsprachen für die Allgemeine Hochschulreife Impressum Herausgeber: Freie
Bildungsplan gymnasiale Oberstufe Anlage zum Rahmenplan Neuere Fremdsprachen zur Umsetzung der Bildungsstandards im Fach Neuere Fremdsprachen für die Allgemeine Hochschulreife Impressum Herausgeber: Freie
Historische und kulturelle Entwicklungen
 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben: Einführungsphase EF und Qualifikationsphasen Q1/Q2 Die nachfolgenden Übersichten beschreiben in übersichtlicher Form die verbindlichen Unterrichtsinhalte der Oberstufe
Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben: Einführungsphase EF und Qualifikationsphasen Q1/Q2 Die nachfolgenden Übersichten beschreiben in übersichtlicher Form die verbindlichen Unterrichtsinhalte der Oberstufe
Synopse zu Red Line 5 und 6
 Bildungsstandards und Inhaltsfelder Synopse zu Red Line 5 und 6 Realschule, Englisch, Klasse 9 und 10 für Hessen Vorbemerkung Das Kerncurriculum Englisch für hessische Realschulen gibt Auskunft über die
Bildungsstandards und Inhaltsfelder Synopse zu Red Line 5 und 6 Realschule, Englisch, Klasse 9 und 10 für Hessen Vorbemerkung Das Kerncurriculum Englisch für hessische Realschulen gibt Auskunft über die
Lehrplan Grundlagenfach Französisch
 toto corde, tota anima, tota virtute Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Lehrplan Grundlagenfach Französisch A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 4 3 3 4 B. Didaktische
toto corde, tota anima, tota virtute Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Lehrplan Grundlagenfach Französisch A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 4 3 3 4 B. Didaktische
Handreichung zu Sprechprüfungen in den modernen Fremdsprachen
 Handreichung zu Sprechprüfungen in den modernen Fremdsprachen für die Bildungsgänge, die zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht und zur allgemeinen Hochschulreife oder zu beruflichen Kenntnissen und
Handreichung zu Sprechprüfungen in den modernen Fremdsprachen für die Bildungsgänge, die zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht und zur allgemeinen Hochschulreife oder zu beruflichen Kenntnissen und
SPANISCH KLASSE 9 GRAMMATIK METHODEN BEITRAG ZUM SCHULCURRICULUM KOMPETENZEN UND INHALTE
 SPANISCH KLASSE 9 KOMPETENZEN UND INHALTE GRAMMATIK METHODEN BEITRAG ZUM SCHULCURRICULUM Folgende Kompetenzen werden fortlaufend gefestigt und erweitert: -Hör- und Sehverstehen - Schreiben - Phonologische
SPANISCH KLASSE 9 KOMPETENZEN UND INHALTE GRAMMATIK METHODEN BEITRAG ZUM SCHULCURRICULUM Folgende Kompetenzen werden fortlaufend gefestigt und erweitert: -Hör- und Sehverstehen - Schreiben - Phonologische
Beispiel für einen schulinternen Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe. Spanisch
 Beispiel für einen schulinternen Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Spanisch 1 GK (n) EF Yo me presento Soziokulturelles Orientierungswissen über persönliche Angaben, Befinden, Familie,
Beispiel für einen schulinternen Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Spanisch 1 GK (n) EF Yo me presento Soziokulturelles Orientierungswissen über persönliche Angaben, Befinden, Familie,
Englisch. Berufskolleg Gesundheit und Pflege I. Schuljahr 1. Landesinstitut für Erziehung und Unterricht Abteilung III
 Berufskolleg Gesundheit und Pflege I Schuljahr 1 2 Vorbemerkungen Die immer enger werdende Zusammenarbeit der Staaten innerhalb und außerhalb der Europäischen Union verlangt in Beruf und Alltag in zunehmendem
Berufskolleg Gesundheit und Pflege I Schuljahr 1 2 Vorbemerkungen Die immer enger werdende Zusammenarbeit der Staaten innerhalb und außerhalb der Europäischen Union verlangt in Beruf und Alltag in zunehmendem
Kernkompetenzen. im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können
 Kernkompetenzen im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können Bereich: Kommunikation sprachliches Handeln Schwerpunkt: Hörverstehen/Hör- Sehverstehen verstehen Äußerungen und
Kernkompetenzen im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können Bereich: Kommunikation sprachliches Handeln Schwerpunkt: Hörverstehen/Hör- Sehverstehen verstehen Äußerungen und
Fachinformationen (Englisch) (gültig ab Schuljahr 2015/2016)
 Fachinformationen (Englisch) (gültig ab Schuljahr 2015/2016) SEKUNDARSTUFE II STUFE LEISTUNGSKURS 1. Eingeführte Lehr- und Lernmittel Context 21, Cornelsen Verlag, Berlin 2010 2. Schulcurriculum Sekundarstufe
Fachinformationen (Englisch) (gültig ab Schuljahr 2015/2016) SEKUNDARSTUFE II STUFE LEISTUNGSKURS 1. Eingeführte Lehr- und Lernmittel Context 21, Cornelsen Verlag, Berlin 2010 2. Schulcurriculum Sekundarstufe
LehrplanPLUS Mittelschule Englisch Klasse 5. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. 1. Aufbau des Lehrplans
 Mittelschule Englisch Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der Englischunterricht an der Mittelschule ist wie schon bisher - kommunikativ ausgerichtet. Die grundlegenden Voraussetzungen
Mittelschule Englisch Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der Englischunterricht an der Mittelschule ist wie schon bisher - kommunikativ ausgerichtet. Die grundlegenden Voraussetzungen
LehrplanPLUS Realschule Englisch Klasse 5. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. 1. Aufbau des Lehrplans
 Realschule Englisch Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der Englischunterricht an der Realschule ist wie schon bisher kommunikativ ausgerichtet. Die grundlegenden Voraussetzungen für eine
Realschule Englisch Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der Englischunterricht an der Realschule ist wie schon bisher kommunikativ ausgerichtet. Die grundlegenden Voraussetzungen für eine
BILDUNGSSTANDARDS GYMNASIUM FORTGEFÜHRTE FREMDSPRACHE
 BILDUNGSSTANDARDS GYMNASIUM FORTGEFÜHRTE FREMDSPRACHE 1. Kompetenzbereiche für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch / Französisch) (GY) Diese Grafik schließt an die entsprechende Darstellung der Kompetenzen
BILDUNGSSTANDARDS GYMNASIUM FORTGEFÜHRTE FREMDSPRACHE 1. Kompetenzbereiche für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch / Französisch) (GY) Diese Grafik schließt an die entsprechende Darstellung der Kompetenzen
Kantonsschule Ausserschwyz. Spanisch. Kantonsschule Ausserschwyz 289
 Kantonsschule Ausserschwyz Spanisch Kantonsschule Ausserschwyz 289 Bildungsziele Für das Schwerpunktfach Die Schüler und Schülerinnen - sind fähig, sich in der Weltsprache Spanisch schriftlich und mündlich
Kantonsschule Ausserschwyz Spanisch Kantonsschule Ausserschwyz 289 Bildungsziele Für das Schwerpunktfach Die Schüler und Schülerinnen - sind fähig, sich in der Weltsprache Spanisch schriftlich und mündlich
Schulcurriculum Gymnasium Korntal-Münchingen
 Klasse: 5 Seite 1 Minimalanforderungskatalog; Themen des Schuljahres gegliedert nach Arbeitsbereichen Themen, die dem Motto der jeweiligen Klassenstufe entsprechen und den Stoff des s vertiefen, üben,
Klasse: 5 Seite 1 Minimalanforderungskatalog; Themen des Schuljahres gegliedert nach Arbeitsbereichen Themen, die dem Motto der jeweiligen Klassenstufe entsprechen und den Stoff des s vertiefen, üben,
Einführungsphase. Schulinternes Curriculum Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Fach Französisch. Unterrichtsvorhaben für das erste Quartal:
 Schulinternes Curriculum Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Fach Französisch Einführungsphase Unterrichtsvorhaben für das erste Quartal: Thema: Les jeunes, leurs espoirs: entre rêves et réalités Identité
Schulinternes Curriculum Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Fach Französisch Einführungsphase Unterrichtsvorhaben für das erste Quartal: Thema: Les jeunes, leurs espoirs: entre rêves et réalités Identité
Berufliche Orientierung im Bildungsplan 2016
 Berufliche Orientierung im Bildungsplan 2016 Ausbildungs- und Studienorientierung in Baden- Württemberg Sandra Brenner Kultusministerium/ Ref. 34 (Arbeitsbereich Berufliche Orientierung) Bildungsplan 2016
Berufliche Orientierung im Bildungsplan 2016 Ausbildungs- und Studienorientierung in Baden- Württemberg Sandra Brenner Kultusministerium/ Ref. 34 (Arbeitsbereich Berufliche Orientierung) Bildungsplan 2016
GK EF (n) Unterrichtsvorhaben II:
 Unterrichtsvorhaben I: GK EF (n) Unterrichtsvorhaben II: Thema: Hola, buenos días! (presentarse) Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) Kompetenzen: Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: Auskunft über
Unterrichtsvorhaben I: GK EF (n) Unterrichtsvorhaben II: Thema: Hola, buenos días! (presentarse) Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) Kompetenzen: Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: Auskunft über
Fachlehrplan Fachgymnasium
 Fachlehrplan Fachgymnasium Stand: 9.2.2015 Französisch Der vorliegende Fachlehrplan entstand auf der Grundlage des Fachlehrplans Französisch Gymnasium/Fachgymnasium (2014). An der Erarbeitung des Fachlehrplans
Fachlehrplan Fachgymnasium Stand: 9.2.2015 Französisch Der vorliegende Fachlehrplan entstand auf der Grundlage des Fachlehrplans Französisch Gymnasium/Fachgymnasium (2014). An der Erarbeitung des Fachlehrplans
Kerncurriculum Französisch 5/6 Hölderlin-Gymnasium Nürtingen Seite 1. Französisch. Klassenstufe 6
 Hölderlin-Gymnasium Nürtingen Seite 1 Französisch Klassenstufe 6 Kerncurriculum und schuleigenes Curriculum (integriert) Kommunikative Fähigkeiten Hör- und Hör-/Sehverständnis Laute und Intonationsmuster
Hölderlin-Gymnasium Nürtingen Seite 1 Französisch Klassenstufe 6 Kerncurriculum und schuleigenes Curriculum (integriert) Kommunikative Fähigkeiten Hör- und Hör-/Sehverständnis Laute und Intonationsmuster
Schulinternes Curriculum Deutsch Klasse 7 Stiftisches Gymnasium Düren
 1) Strittige Themen diskutieren 1. Halbjahr Sprechen Zuhören Schreiben Lesen Umgang mit en Medien - intentional, situations- adressatengerecht erzählen - einen eigenen Standpunkt vortragen argumentativ
1) Strittige Themen diskutieren 1. Halbjahr Sprechen Zuhören Schreiben Lesen Umgang mit en Medien - intentional, situations- adressatengerecht erzählen - einen eigenen Standpunkt vortragen argumentativ
Die im Französischunterricht vermittelten Grundlagen sollen als Fundament für die Verständigung mit der frankophonen Bevölkerung der Schweiz dienen.
 Anzahl der Lektionen Bildungsziel Französisch hat weltweit und als zweite Landessprache eine wichtige Bedeutung. Im Kanton Solothurn als Brückenkanton zwischen der deutschen Schweiz und der Romandie nimmt
Anzahl der Lektionen Bildungsziel Französisch hat weltweit und als zweite Landessprache eine wichtige Bedeutung. Im Kanton Solothurn als Brückenkanton zwischen der deutschen Schweiz und der Romandie nimmt
Orange Line Band 6 Erweiterungskurs
 Orange Line Band 6 Erweiterungskurs Synopse des Kernlehrplans für Englisch Sekundarstufe I Bildungsstandards und Inhaltsfelder Das neue Kerncurriculum für Hessen (Stand Nov. 2010) Klasse 10 Vorbemerkung
Orange Line Band 6 Erweiterungskurs Synopse des Kernlehrplans für Englisch Sekundarstufe I Bildungsstandards und Inhaltsfelder Das neue Kerncurriculum für Hessen (Stand Nov. 2010) Klasse 10 Vorbemerkung
Interkulturelle kommunikative Kompetenz. Funktionale kommunikative Kompetenz:
 GK(f) EF 1. Unterrichtsvorhaben: Jóvenes en España Aspekte der persönlichen Lebensgestaltung und des Alltagslebens Jugendlicher in Spanien: convivencia social, el paro juvenil, redes sociales sich der
GK(f) EF 1. Unterrichtsvorhaben: Jóvenes en España Aspekte der persönlichen Lebensgestaltung und des Alltagslebens Jugendlicher in Spanien: convivencia social, el paro juvenil, redes sociales sich der
Fachlehrplan Englisch
 Bildungszentrum für Technik Frauenfeld Fachlehrplan Englisch 1. Allgemeine Bildungsziele Fremdsprachen sind in der mehrsprachigen Schweiz und in einer globalisierten Welt eine unerlässliche Voraussetzung
Bildungszentrum für Technik Frauenfeld Fachlehrplan Englisch 1. Allgemeine Bildungsziele Fremdsprachen sind in der mehrsprachigen Schweiz und in einer globalisierten Welt eine unerlässliche Voraussetzung
Fachlehrplan Französisch
 Bildungszentrum für Technik Frauenfeld Fachlehrplan Französisch 1. Allgemeine Bildungsziele Fremdsprachen sind in der mehrsprachigen Schweiz und in einer globalisierten Welt eine unerlässliche Voraussetzung
Bildungszentrum für Technik Frauenfeld Fachlehrplan Französisch 1. Allgemeine Bildungsziele Fremdsprachen sind in der mehrsprachigen Schweiz und in einer globalisierten Welt eine unerlässliche Voraussetzung
Kerncurriculum Französisch, 3. Lernjahr (Découvertes Band III)
 Kerncurriculum Französisch, 3. Lernjahr (Découvertes Band III) Die vorliegenden Raster sind ein Beispiel für ein Kerncurriculum Französisch (3. Lernjahr) auf der Grundlage des Lehrwerks Découvertes III.
Kerncurriculum Französisch, 3. Lernjahr (Découvertes Band III) Die vorliegenden Raster sind ein Beispiel für ein Kerncurriculum Französisch (3. Lernjahr) auf der Grundlage des Lehrwerks Découvertes III.
Lehrbuch: Punto de vista. Nueva edición. Cornelsen Verlag Kernlehrplan 2014 Wochenstunden: 4 (Q1: ca. 150 h, Q2: ca. 110h)
 Curriculum Spanisch GK(n) Lehrbuch: Punto de vista. Nueva edición. Cornelsen Verlag Kernlehrplan 2014 Wochenstunden: 4 (Q1: ca. 150 h, Q2: ca. 110h) nhaltlicher Narrative Texte in Auszügen auditive Formate
Curriculum Spanisch GK(n) Lehrbuch: Punto de vista. Nueva edición. Cornelsen Verlag Kernlehrplan 2014 Wochenstunden: 4 (Q1: ca. 150 h, Q2: ca. 110h) nhaltlicher Narrative Texte in Auszügen auditive Formate
Realgymnasium Schlanders
 Realgymnasium Schlanders Fachcurriculum aus Englisch Klasse: 5 RG Ab Schuljahr 2014/2015 1/5 Lernziele / Methodisch-didaktische Grundsätze Die Schüler/innen sollen sich ihrem Alter und den sprachlichen
Realgymnasium Schlanders Fachcurriculum aus Englisch Klasse: 5 RG Ab Schuljahr 2014/2015 1/5 Lernziele / Methodisch-didaktische Grundsätze Die Schüler/innen sollen sich ihrem Alter und den sprachlichen
Fachinformationen (Englisch) (gültig ab Schuljahr 2015/2016)
 Fachinformationen (Englisch) (gültig ab Schuljahr 2015/2016) SEKUNDARSTUFE II STUFE GRUNDKURS 1. Eingeführte Lehr- und Lernmittel Keine 2. Schulcurriculum Sekundarstufe II (Englisch Grundkurs Stufe ) The
Fachinformationen (Englisch) (gültig ab Schuljahr 2015/2016) SEKUNDARSTUFE II STUFE GRUNDKURS 1. Eingeführte Lehr- und Lernmittel Keine 2. Schulcurriculum Sekundarstufe II (Englisch Grundkurs Stufe ) The
Hinweise zur Vorbereitung auf die Abiturprüfung 2013 Prüfungsschwerpunkte Englisch. Grundkurs
 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Hinweise zur Vorbereitung auf die Abiturprüfung 2013 Grundkurs Die angegebenen Schwerpunkte sind im Zusammenhang
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Hinweise zur Vorbereitung auf die Abiturprüfung 2013 Grundkurs Die angegebenen Schwerpunkte sind im Zusammenhang
Hermann Hesse-Gymnasium Calw. Schulcurriculum Englisch. Zielsetzung - 1
 Zielsetzung Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der englischen Sprache im Alltag nimmt das Fach Englisch als 1. Fremdsprache eine herausragende Stellung ein. Die Schulcurricula zielen auf eine ständig sich
Zielsetzung Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der englischen Sprache im Alltag nimmt das Fach Englisch als 1. Fremdsprache eine herausragende Stellung ein. Die Schulcurricula zielen auf eine ständig sich
Bildungsplan Stufe 10 Kompetenzen und Inhalte Kerncurriculum und konkrete Beispiele
 Kern- und Schulcurriculum im Fach Spanisch - Stufe 10 Vorbemerkungen 1. Die in den ersten drei Jahren zu erreichenden Kompetenzen und die damit verknüpften inhaltlichen Kenntnisse werden prinzipiell durch
Kern- und Schulcurriculum im Fach Spanisch - Stufe 10 Vorbemerkungen 1. Die in den ersten drei Jahren zu erreichenden Kompetenzen und die damit verknüpften inhaltlichen Kenntnisse werden prinzipiell durch
Standards für die Berufsoberschule in den Fächern Deutsch, fortgeführte Pflichtfremdsprache, Mathematik
 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland BESCHLUSSSAMMLUNG DER KMK, BESCHLUSS-NR. 471 R:\B1\KMK-BESCHLUSS\RVBOS-DPM98-06-26.DOC Standards für
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland BESCHLUSSSAMMLUNG DER KMK, BESCHLUSS-NR. 471 R:\B1\KMK-BESCHLUSS\RVBOS-DPM98-06-26.DOC Standards für
CURRICOLO DI TEDESCO L2
 CURRICOLO DI TEDESCO L2 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Biennium 1 Stufenprofile Hörverstehen im Alltag häufig gebrauchte Formeln (Begrüßungen, Verabschiedungen, Entschuldigungen, ) verstehen in
CURRICOLO DI TEDESCO L2 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Biennium 1 Stufenprofile Hörverstehen im Alltag häufig gebrauchte Formeln (Begrüßungen, Verabschiedungen, Entschuldigungen, ) verstehen in
Kompetenzorientiertes Kerncurriculum basierend auf dem Lehrplan Rheinland/Pfalz, Realschule, Französisch als zweite Fremdsprache, 2000
 Realschule Jahrgang: 9/10 Fach: Französisch Kompetenzorientiertes Kerncurriculum basierend auf dem Lehrplan Rheinland/Pfalz, Realschule, Französisch als zweite Fremdsprache, 2000 Die Schülerinnen und Schüler
Realschule Jahrgang: 9/10 Fach: Französisch Kompetenzorientiertes Kerncurriculum basierend auf dem Lehrplan Rheinland/Pfalz, Realschule, Französisch als zweite Fremdsprache, 2000 Die Schülerinnen und Schüler
1. Kommunikative Kompetenzen
 Schulinternes Curriculum im Fach Englisch Bilinguale Profilklasse Jahrgangsstufe 5 Stand Oktober 2013 Zunächst orientiert sich das schulinterne Curriculum und die Leistungsbewertung für die englische Profilklasse
Schulinternes Curriculum im Fach Englisch Bilinguale Profilklasse Jahrgangsstufe 5 Stand Oktober 2013 Zunächst orientiert sich das schulinterne Curriculum und die Leistungsbewertung für die englische Profilklasse
Schulcurriculum Gymnasium Korntal-Münchingen
 Klasse: 8 Seite 1 Minimalanforderungskatalog; Themen des Schuljahres gegliedert nach Arbeitsbereichen Themen, die dem Motto der jeweiligen Klassenstufe entsprechen und den Stoff des s vertiefen, üben,
Klasse: 8 Seite 1 Minimalanforderungskatalog; Themen des Schuljahres gegliedert nach Arbeitsbereichen Themen, die dem Motto der jeweiligen Klassenstufe entsprechen und den Stoff des s vertiefen, üben,
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Politik und Wirtschaft. Analysekompetenz (A)
 Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Politik und Wirtschaft Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, Bildungsstandards und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Politik und Wirtschaft Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, Bildungsstandards und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der
Schulinternes Curriculum Französisch für die Sekundarstufe II
 Wülfrath Kastanienallee 63 Städtisches Gymnasium 42489 Wülfrath Schulinternes Curriculum Französisch für die Sekundarstufe II Basierend auf dem Kernlehrplan Französisch für die Sekundarstufe II gymnasiale
Wülfrath Kastanienallee 63 Städtisches Gymnasium 42489 Wülfrath Schulinternes Curriculum Französisch für die Sekundarstufe II Basierend auf dem Kernlehrplan Französisch für die Sekundarstufe II gymnasiale
Orange Line 1 und 2. Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufe 6
 Orange Line 1 und 2 Abgleich mit dem Kerncurriculum für die Realschule in Hessen Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufe 6 Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 Alle Rechte vorbehalten Von dieser
Orange Line 1 und 2 Abgleich mit dem Kerncurriculum für die Realschule in Hessen Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufe 6 Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 Alle Rechte vorbehalten Von dieser
LEHRPLAN FRANZÖSISCH SPORT- UND MUSIKKLASSE
 LEHRPLAN FRANZÖSISCH SPORT- UND MUSIKKLASSE STUNDENDOTATION GF 3. KLASSE 1. SEM. 3 2. SEM. 3 4. KLASSE 1. SEM. 3 2. SEM. 3 5. KLASSE 1. SEM. 2 2. SEM. 2 6. KLASSE 1. SEM. 2 2. SEM. 2 7. KLASSE 1. SEM.
LEHRPLAN FRANZÖSISCH SPORT- UND MUSIKKLASSE STUNDENDOTATION GF 3. KLASSE 1. SEM. 3 2. SEM. 3 4. KLASSE 1. SEM. 3 2. SEM. 3 5. KLASSE 1. SEM. 2 2. SEM. 2 6. KLASSE 1. SEM. 2 2. SEM. 2 7. KLASSE 1. SEM.
Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung im Fach Politik Klasse 7 und 8
 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung im Fach Politik Klasse 7 und 8 Stand: November 2014 KR Grundlegendes: Das Fach Politik in der Realschule trägt dazu bei, dass die Lernenden politische, gesellschaftliche
Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung im Fach Politik Klasse 7 und 8 Stand: November 2014 KR Grundlegendes: Das Fach Politik in der Realschule trägt dazu bei, dass die Lernenden politische, gesellschaftliche
Unterrichtsvorhaben: Dem Täter auf der Spur Sachlich berichten
 Dem Täter auf der Spur Sachlich berichten Zeitrahmen: ca. 22 Stunden Kompetenzerwartungen Die SuS erzählen intentional und adressatengerecht (3.1.2). indem sie Kriminalberichte eigenständig verfassen sowie
Dem Täter auf der Spur Sachlich berichten Zeitrahmen: ca. 22 Stunden Kompetenzerwartungen Die SuS erzählen intentional und adressatengerecht (3.1.2). indem sie Kriminalberichte eigenständig verfassen sowie
SPANISCH (FOTOUR) Kompetenzen am Ende des 1. Bienniums. Zweite Fremdsprache Spanisch Fachoberschule für Tourismus. Die Schülerin, der Schüler kann
 SPANISCH (FOTOUR) en am Ende des 1. Bienniums Zweite Fremdsprache Spanisch Fachoberschule für Tourismus Die Schülerin, der Schüler kann kurze Texte und Gespräche verstehen, wenn in deutlich artikulierter
SPANISCH (FOTOUR) en am Ende des 1. Bienniums Zweite Fremdsprache Spanisch Fachoberschule für Tourismus Die Schülerin, der Schüler kann kurze Texte und Gespräche verstehen, wenn in deutlich artikulierter
Kantonsschule Ausserschwyz. Englisch. Kantonsschule Ausserschwyz 155
 Kantonsschule Ausserschwyz Englisch Kantonsschule Ausserschwyz 155 Bildungsziele Für das Grundlagenfach Der Englischunterricht befähigt Schülerinnen und Schüler, sich in der Welt sprachlich zurechtzufinden
Kantonsschule Ausserschwyz Englisch Kantonsschule Ausserschwyz 155 Bildungsziele Für das Grundlagenfach Der Englischunterricht befähigt Schülerinnen und Schüler, sich in der Welt sprachlich zurechtzufinden
Fach: Religion Jahrgang: 6
 In jeder Unterrichtseinheit muss bei den überfachlichen Kompetenzen an je mindestens einer Selbst-, sozialen und lernmethodischen Kompetenz gearbeitet werden, ebenso muss in jeder Einheit mindestens eine
In jeder Unterrichtseinheit muss bei den überfachlichen Kompetenzen an je mindestens einer Selbst-, sozialen und lernmethodischen Kompetenz gearbeitet werden, ebenso muss in jeder Einheit mindestens eine
Schulcurriculum Gymnasium Korntal-Münchingen
 Klasse: 9 Seite 1 Minimalanforderungskatalog; Themen des Schuljahres gegliedert nach Arbeitsbereichen I. Sprechen Praktische Rhetorik sich in komplexeren Kommunikationssituationen differenziert und stilistisch
Klasse: 9 Seite 1 Minimalanforderungskatalog; Themen des Schuljahres gegliedert nach Arbeitsbereichen I. Sprechen Praktische Rhetorik sich in komplexeren Kommunikationssituationen differenziert und stilistisch
Fremdsprachen- und Medienzentrum Universität Greifswald Februar Modulbeschreibungen. Anlage zur Akkreditierung für UNIcert
 Modulbeschreibungen Anlage zur Akkreditierung für UNIcert 1 Modul: Fremdsprache Zielniveau UNIcert Basis (vergleichbar mit Stufe A2 des GER) Voraussetzung für Zulassung zur Prüfung Die Studierenden verfügen
Modulbeschreibungen Anlage zur Akkreditierung für UNIcert 1 Modul: Fremdsprache Zielniveau UNIcert Basis (vergleichbar mit Stufe A2 des GER) Voraussetzung für Zulassung zur Prüfung Die Studierenden verfügen
Übersicht zu den Unterrichtsvorhaben der Klasse 7:
 Übersicht zu den Unterrichtsvorhaben der Klasse 7: 1. Detektivgeschichten Bestimmung von Nebensatzarten und ihrer Funktionen 2. Einen Jugendroman untersuchen Figuren und Handlung 3. Sachbezogener Gebrauch
Übersicht zu den Unterrichtsvorhaben der Klasse 7: 1. Detektivgeschichten Bestimmung von Nebensatzarten und ihrer Funktionen 2. Einen Jugendroman untersuchen Figuren und Handlung 3. Sachbezogener Gebrauch
Städtische Gesamtschule Langerfeld. Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe. Englisch
 Städtische Gesamtschule Langerfeld Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Englisch 1 Inhalt 1 1.1 1.1.1 1.1.2 Entscheidungen zum Unterricht Unterrichtsvorhaben Übersichtsraster
Städtische Gesamtschule Langerfeld Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Englisch 1 Inhalt 1 1.1 1.1.1 1.1.2 Entscheidungen zum Unterricht Unterrichtsvorhaben Übersichtsraster
Anlage 2: Modulbeschreibungen Bereich Allgemeine Qualifikation (AQua) Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent
 Anlage 2: Modulbeschreibungen Bereich Allgemeine Qualifikation (AQua) Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent SLK-BA-AQUA-FS- A1 Inhalte und Qualifikationsz iele Lehr- und Lernformen Fremdsprachen
Anlage 2: Modulbeschreibungen Bereich Allgemeine Qualifikation (AQua) Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent SLK-BA-AQUA-FS- A1 Inhalte und Qualifikationsz iele Lehr- und Lernformen Fremdsprachen
Kompetenz. Auswertung von Bildern, Internetauftritten, Zeitungsartikeln und Sachtexten
 Gymnasium Herkenrath Curriculum Q1-2 Spanisch 14.01.2016 Q1 1. Quartal Unterrichtsvorhaben Andalucía: turismo y medio ambiente Globale Herausforderungen und Zukunftsentwürfe Interkulturelle kommunikative
Gymnasium Herkenrath Curriculum Q1-2 Spanisch 14.01.2016 Q1 1. Quartal Unterrichtsvorhaben Andalucía: turismo y medio ambiente Globale Herausforderungen und Zukunftsentwürfe Interkulturelle kommunikative
Planung von kompetenzorientiertem Unterricht im Fach Französisch auf der Grundlage des Lehrplans
 Planung von kompetenzorientiertem Unterricht im Fach Französisch auf der Grundlage des Lehrplans Vorbemerkungen Die vorliegenden Planungsbeispiele sollen zeigen, wie im kompetenzorientierten Unterricht
Planung von kompetenzorientiertem Unterricht im Fach Französisch auf der Grundlage des Lehrplans Vorbemerkungen Die vorliegenden Planungsbeispiele sollen zeigen, wie im kompetenzorientierten Unterricht
Lernentwicklungsbericht Schuljahr 2013/2014
 Mathematik Lernentwicklungsbericht Schuljahr 2013/2014 Name: xx 10 8 10/10 8 10 Punkte in jedem Niveau möglich Niveau G 4 2 Niveau M 0 Mathe Deutsch Englisch Niveau E Niveau G- entspricht Niveau M- entspricht
Mathematik Lernentwicklungsbericht Schuljahr 2013/2014 Name: xx 10 8 10/10 8 10 Punkte in jedem Niveau möglich Niveau G 4 2 Niveau M 0 Mathe Deutsch Englisch Niveau E Niveau G- entspricht Niveau M- entspricht
Stoffverteilungsplan Deutsch Unterrichtsthemen Kompetenzen Aufgabentypen
 Stoffverteilungsplan Deutsch Unterrichtsthemen Kompetenzen Aufgabentypen Seite 1 von 6 Deutsch Klasse 7 Unterrichtsvorhaben Themen/ Inhalte [ Konkretisierung durch das Lehrbuch ] Sprechen und Zuhören Kompetenzen
Stoffverteilungsplan Deutsch Unterrichtsthemen Kompetenzen Aufgabentypen Seite 1 von 6 Deutsch Klasse 7 Unterrichtsvorhaben Themen/ Inhalte [ Konkretisierung durch das Lehrbuch ] Sprechen und Zuhören Kompetenzen
Kompetenzraster Deutsch 7/8
 Kompetenzraster Deutsch 7/8 Zuhören und Sprechen Schreiben Lesen Grammatik kann anderen zuhören, gezielt nachfragen und auf andere eingehen kann dem Schreibanlass angemessen schreiben, z.b. berichten,
Kompetenzraster Deutsch 7/8 Zuhören und Sprechen Schreiben Lesen Grammatik kann anderen zuhören, gezielt nachfragen und auf andere eingehen kann dem Schreibanlass angemessen schreiben, z.b. berichten,
LEHRPLAN ITALIENISCH SPORT- UND MUSIKKLASSE
 LEHRPLAN ITALIENISCH SPORT- UND MUSIKKLASSE STUNDENDOTATION SF 4. KLASSE 1. SEM. 3 2. SEM. 3 5. KLASSE 1. SEM. 4 2. SEM. 4 6. KLASSE 1. SEM. 3 2. SEM. 3 7. KLASSE 1. SEM. 4 2. SEM. 4 Zielniveaus nach GER
LEHRPLAN ITALIENISCH SPORT- UND MUSIKKLASSE STUNDENDOTATION SF 4. KLASSE 1. SEM. 3 2. SEM. 3 5. KLASSE 1. SEM. 4 2. SEM. 4 6. KLASSE 1. SEM. 3 2. SEM. 3 7. KLASSE 1. SEM. 4 2. SEM. 4 Zielniveaus nach GER
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg Schulversuch 44-6512.-2328/103 vom 30. Juli 2012 Lehrplan für das Berufskolleg Berufskolleg für Praktikantinnen und Praktikanten Fachschule für
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg Schulversuch 44-6512.-2328/103 vom 30. Juli 2012 Lehrplan für das Berufskolleg Berufskolleg für Praktikantinnen und Praktikanten Fachschule für
Die Schülerinnen orientieren sich in Zeitungen.
 Schulinternes Curriculum der Ursulinenschule Hersel im Fach Deutsch Jahrgang 8 Übersicht über Unterrichtsvorhaben, Obligatorik und Klassenarbeiten Unterrichtsvorhaben Obligatorik Klassenarbeit Kurzreferate
Schulinternes Curriculum der Ursulinenschule Hersel im Fach Deutsch Jahrgang 8 Übersicht über Unterrichtsvorhaben, Obligatorik und Klassenarbeiten Unterrichtsvorhaben Obligatorik Klassenarbeit Kurzreferate
Bildungsplan 2016: Die Leitperspektive BTV. Bildungsplan Die Leitperspektive Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV)
 Bildungsplan 2016 Die Leitperspektive Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV) Gliederung Vorbemerkung: Die doppelte Funktion eines Bildungsplans 1. Wofür eigentlich Leitperspektiven? 2. Die
Bildungsplan 2016 Die Leitperspektive Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV) Gliederung Vorbemerkung: Die doppelte Funktion eines Bildungsplans 1. Wofür eigentlich Leitperspektiven? 2. Die
ENGLISCH DRITTE SPRACHE
 ENGLISCH DRITTE SPRACHE 1 Stundendotation G1 G2 G3 G4 G5 G6 Grundlagenfach 4 3 4 3 3 4 Schwerpunktfach Ergänzungsfach Weiteres Pflichtfach Weiteres Fach GER A2 A2+ B1 B2 B2+ C1, 2 Didaktische Hinweise
ENGLISCH DRITTE SPRACHE 1 Stundendotation G1 G2 G3 G4 G5 G6 Grundlagenfach 4 3 4 3 3 4 Schwerpunktfach Ergänzungsfach Weiteres Pflichtfach Weiteres Fach GER A2 A2+ B1 B2 B2+ C1, 2 Didaktische Hinweise
Schulinternes Curriculum Differenzierungskurs Französisch
 NORBERT - GYMNASIUM Knechtsteden Staatlich anerkanntes privates katholisches Gymnasium für Jungen und Mädchen Schulinternes Curriculum Differenzierungskurs Französisch Norbert-Gymnasium Knechtsteden Schulcurriculum
NORBERT - GYMNASIUM Knechtsteden Staatlich anerkanntes privates katholisches Gymnasium für Jungen und Mädchen Schulinternes Curriculum Differenzierungskurs Französisch Norbert-Gymnasium Knechtsteden Schulcurriculum
FRANZÖSISCH ZWEITE LANDESSPRACHE
 FRANZÖSISCH ZWEITE LANDESSPRACHE 1 Stundendotation G1 G2 G3 G4 G5 G6 Grundlagenfach 4 4 4 3 Schwerpunktfach Ergänzungsfach Weiteres Pflichtfach Weiteres Fach GER A2 A2+ B1 B1+ DELF B1 2 Didaktische Hinweise
FRANZÖSISCH ZWEITE LANDESSPRACHE 1 Stundendotation G1 G2 G3 G4 G5 G6 Grundlagenfach 4 4 4 3 Schwerpunktfach Ergänzungsfach Weiteres Pflichtfach Weiteres Fach GER A2 A2+ B1 B1+ DELF B1 2 Didaktische Hinweise
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg Schulversuch 41-6623.1-08/231 vom 17. September 2009 Lehrplan für das Berufskolleg Einjähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg Schulversuch 41-6623.1-08/231 vom 17. September 2009 Lehrplan für das Berufskolleg Einjähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife
Zentralabitur 2019 Spanisch
 Zentralabitur 2019 Spanisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2019 Spanisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2018 Russisch
 Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2018 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien,
Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2018 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien,
Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch Sekundarstufe I Orientiert am Kernlehrplan G8, bezogen auf das Deutschbuch von Cornelsen, Neue Ausgabe
 Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch Sekundarstufe I Orientiert am Kernlehrplan G8, bezogen auf das Deutschbuch von Cornelsen, Neue Ausgabe K l a s s e 8 UV Thema Teilkompetenzen (Auswahl) Kompetenzbereich(e)
Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch Sekundarstufe I Orientiert am Kernlehrplan G8, bezogen auf das Deutschbuch von Cornelsen, Neue Ausgabe K l a s s e 8 UV Thema Teilkompetenzen (Auswahl) Kompetenzbereich(e)
Erzbischöfliche Liebfrauenschule Köln. Schulinternes Curriculum Fach: Französisch
 Erzbischöfliche Liebfrauenschule Köln Schulinternes Curriculum Fach: Französisch Französisch als 2. Fremdsprache Kommunikative Kompetenzen Im Unterricht den Darstellungen, Argumentationen und Diskussionen
Erzbischöfliche Liebfrauenschule Köln Schulinternes Curriculum Fach: Französisch Französisch als 2. Fremdsprache Kommunikative Kompetenzen Im Unterricht den Darstellungen, Argumentationen und Diskussionen
Unterrichtseinheit im Bereich Reflexion über Sprache (Klasse 5)
 im Bereich Reflexion über Sprache (Klasse 5) Latein/Englisch Im Kontext des s Zeit Wortarten entdecken ca. 12 Std. Verb, 8 Std. andere Worten 5 Erster Zugang zur Sprache als Regelsystem: Wortarten (Verb/Tempus)
im Bereich Reflexion über Sprache (Klasse 5) Latein/Englisch Im Kontext des s Zeit Wortarten entdecken ca. 12 Std. Verb, 8 Std. andere Worten 5 Erster Zugang zur Sprache als Regelsystem: Wortarten (Verb/Tempus)
Zentralabitur 2019 Russisch
 Zentralabitur 2019 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2019 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung (WBS)
 Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung (WBS) Das Fach Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung (WBS) Leitgedanken zum Kompetenzerwerb Ziele der ökonomischen Bildung Ökonomisch geprägte Lebenssituationen
Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung (WBS) Das Fach Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung (WBS) Leitgedanken zum Kompetenzerwerb Ziele der ökonomischen Bildung Ökonomisch geprägte Lebenssituationen
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 10. Descripción
 Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 10 Descripción Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, ohne fremde Hilfe die gewünschten Informationen zu erhalten und für oder gegen etwas zu argumentieren.
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 10 Descripción Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, ohne fremde Hilfe die gewünschten Informationen zu erhalten und für oder gegen etwas zu argumentieren.
Französisch 3. Fremdsprache (Klasse 9)
 Französisch 3. Fremdsprache (Klasse 9) Im Verlauf des zweiten Lernjahrs bewältigen die Schüler auch etwas komplexere Kommunikationssituationen in französischer Sprache. Die Wiederholung von Kenntnissen
Französisch 3. Fremdsprache (Klasse 9) Im Verlauf des zweiten Lernjahrs bewältigen die Schüler auch etwas komplexere Kommunikationssituationen in französischer Sprache. Die Wiederholung von Kenntnissen
Lehrplan für das Grundlagenfach Englisch
 (August 2012) Lehrplan für das Grundlagenfach Englisch Richtziele des schweizerischen Rahmenlehrplans Grundkenntnisse 1.1 Über die grundlegenden Kenntnisse der englischen Sprache verfügen, welche Kommunikation
(August 2012) Lehrplan für das Grundlagenfach Englisch Richtziele des schweizerischen Rahmenlehrplans Grundkenntnisse 1.1 Über die grundlegenden Kenntnisse der englischen Sprache verfügen, welche Kommunikation
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Musik. Musik hören und beschreiben
 Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Musik Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, Bildungsstandards und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der Themenfelder in
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Musik Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, Bildungsstandards und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der Themenfelder in
Zentralabitur 2019 Chinesisch
 Zentralabitur 2019 Chinesisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2019 Chinesisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Bildungsstandards Deutsch
 Bildungsstandards Deutsch Hören, Sprechen und Miteinander-Reden H1: Verständlich erzählen und anderen verstehend zuhören 1 Erlebnisse erzählen 2 Über Begebenheiten und Erfahrungen zusammenhängend sprechen
Bildungsstandards Deutsch Hören, Sprechen und Miteinander-Reden H1: Verständlich erzählen und anderen verstehend zuhören 1 Erlebnisse erzählen 2 Über Begebenheiten und Erfahrungen zusammenhängend sprechen
Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch Sekundarstufe I Orientiert am Kernlehrplan G8, bezogen auf das Deutschbuch von Cornelsen, Neue Ausgabe
 Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch Sekundarstufe I Orientiert am Kernlehrplan G8, bezogen auf das Deutschbuch von Cornelsen, Neue Ausgabe K l a s s e 5 UV Thema Teilkompetenzen (Auswahl) Kompetenzbereich(e)
Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch Sekundarstufe I Orientiert am Kernlehrplan G8, bezogen auf das Deutschbuch von Cornelsen, Neue Ausgabe K l a s s e 5 UV Thema Teilkompetenzen (Auswahl) Kompetenzbereich(e)
Kriterien für die schriftliche Leistungsmessung moderne Fremdsprachen. (Französisch)
 Kriterien für die schriftliche smessung moderne Fremdsprachen (Französisch) 1. Aufgabenbereiche Alle Anforderungsbereiche (s. Punkt 4. Anforderungsbereiche) werden in den Klassenarbeiten abgedeckt; es
Kriterien für die schriftliche smessung moderne Fremdsprachen (Französisch) 1. Aufgabenbereiche Alle Anforderungsbereiche (s. Punkt 4. Anforderungsbereiche) werden in den Klassenarbeiten abgedeckt; es
Selbsteinschätzungsbogen für Fremdsprachenkenntnisse
 Sprachenzentrum Weiterbildung Selbsteinschätzungsbogen für Fremdsprachenkenntnisse Der nachfolgende Bogen orientiert sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) und seinen Zielniveaus und kann
Sprachenzentrum Weiterbildung Selbsteinschätzungsbogen für Fremdsprachenkenntnisse Der nachfolgende Bogen orientiert sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) und seinen Zielniveaus und kann
Schulinternes Fachcurriculum Französisch Klasse 9
 Schulinternes Fachcurriculum Französisch Klasse 9 Klasse 9 ergänzend und vertiefend Mögliche Projekte Und Umsetzungsbeispiele profilierend fördernd Kommunikative Kompetenz Hörverstehen/Hör-Seh-Verstehen:
Schulinternes Fachcurriculum Französisch Klasse 9 Klasse 9 ergänzend und vertiefend Mögliche Projekte Und Umsetzungsbeispiele profilierend fördernd Kommunikative Kompetenz Hörverstehen/Hör-Seh-Verstehen:
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Geschichte. Wahrnehmungskompetenz für Kontinuität und Veränderung in der Zeit
 Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Geschichte Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der Themenfelder in den Kurshalbjahren
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Geschichte Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der Themenfelder in den Kurshalbjahren
Kern- und Schulcurriculum Spanisch Klasse Stand Schuljahr 2009/10
 Kern- und Schulcurriculum Spanisch Klasse 8-10 Stand Schuljahr 2009/10 VORGABEN DURCH DIE STANDARDS Kompetenzen und Inhalte - Klasse 8-10: Grundeinteilungen Die Inhalte in den Klassen 8-10 orientieren
Kern- und Schulcurriculum Spanisch Klasse 8-10 Stand Schuljahr 2009/10 VORGABEN DURCH DIE STANDARDS Kompetenzen und Inhalte - Klasse 8-10: Grundeinteilungen Die Inhalte in den Klassen 8-10 orientieren
CURRICULUM AUS ENGLISCH 1. Biennium FOWI/SOGYM/SPORT
 1. Klasse Kompetenzen am Ende des 1. Bienniums Die Schülerin, der Schüler kann wesentliche Hauptaussagen verstehen, Hauptinformationen entnehmen wenn relativ langsam gesprochen wird und klare Standardsprache
1. Klasse Kompetenzen am Ende des 1. Bienniums Die Schülerin, der Schüler kann wesentliche Hauptaussagen verstehen, Hauptinformationen entnehmen wenn relativ langsam gesprochen wird und klare Standardsprache
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Teil Literaturdidaktik
 Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Teil Literaturdidaktik E I N F Ü H R U N G A R B E I T S B E R E I C H E D E S D E U T S C H U N T E R R I C H T E S U N D B I L D U N G S S T A N D A R D S Tutorium
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Teil Literaturdidaktik E I N F Ü H R U N G A R B E I T S B E R E I C H E D E S D E U T S C H U N T E R R I C H T E S U N D B I L D U N G S S T A N D A R D S Tutorium
Schulcurriculum Gymnasium Korntal-Münchingen
 Klasse: 6 Seite 1 Minimalanforderungskatalog; Themen des Schuljahres gegliedert nach Arbeitsbereichen I) Kommunikative Fertigkeiten Themen, die dem Motto der jeweiligen Klassenstufe entsprechen und den
Klasse: 6 Seite 1 Minimalanforderungskatalog; Themen des Schuljahres gegliedert nach Arbeitsbereichen I) Kommunikative Fertigkeiten Themen, die dem Motto der jeweiligen Klassenstufe entsprechen und den
Kernkompetenzen im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können
 Kernkompetenzen im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können Bereich: Kommunikation sprachliches Handeln Schwerpunkt : Hörverstehen/Hör- Sehverstehen 1 / 2 entnehmen Äußerungen
Kernkompetenzen im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können Bereich: Kommunikation sprachliches Handeln Schwerpunkt : Hörverstehen/Hör- Sehverstehen 1 / 2 entnehmen Äußerungen
SPANISCH (SPÄT BEGINNENDE FREMDSPRACHE WIRD AB KLASSE 10 UNTERRICHTET) BILDUNGSSTANDARDS FÜR SPANISCH (SPÄT BEGINNENDE FREMDSPRACHE)
 BILDUNGSSTANDARDS FÜR SPANISCH (SPÄT BEGINNENDE FREMDSPRACHE) 475 SPANISCH (SPÄT BEGINNENDE FREMDSPRACHE WIRD AB KLASSE 10 UNTERRICHTET) 476 LEITGEDANKEN ZUM KOMPETENZERWERB FÜR SPANISCH (SPÄT BEGINNENDE
BILDUNGSSTANDARDS FÜR SPANISCH (SPÄT BEGINNENDE FREMDSPRACHE) 475 SPANISCH (SPÄT BEGINNENDE FREMDSPRACHE WIRD AB KLASSE 10 UNTERRICHTET) 476 LEITGEDANKEN ZUM KOMPETENZERWERB FÜR SPANISCH (SPÄT BEGINNENDE
Englisch. Lehrplan für Bildungsgänge die in drei Jahren zur Fachhochschulreife führen. Schuljahr 1, 2 und 3. Englisch 1
 Englisch 1 Lehrplan für Bildungsgänge die in drei Jahren zur Fachhochschulreife führen Englisch Schuljahr 1, 2 und 3 2 Englisch Vorbemerkungen Die englische Sprache spielt als internationale Verkehrssprache
Englisch 1 Lehrplan für Bildungsgänge die in drei Jahren zur Fachhochschulreife führen Englisch Schuljahr 1, 2 und 3 2 Englisch Vorbemerkungen Die englische Sprache spielt als internationale Verkehrssprache
GRUNDWISSEN Englisch E 2 1. bis 3. Lernjahr GRAMMATIK MÜNDLICHE AUSDRUCKSFÄHIGKEIT
 GRUNDWISSEN Englisch E 2 1. bis 3. Lernjahr GRAMMATIK MÜNDLICHE AUSDRUCKSFÄHIGKEIT present tense (simple, progressive), simple past; going to-future Vollverben, Hilfsverben (be, have, do, can, must) alle
GRUNDWISSEN Englisch E 2 1. bis 3. Lernjahr GRAMMATIK MÜNDLICHE AUSDRUCKSFÄHIGKEIT present tense (simple, progressive), simple past; going to-future Vollverben, Hilfsverben (be, have, do, can, must) alle
Wahlpflicht- und Profilfächer an Gemeinschaftsschulen
 Wahlpflicht- und Profilfächer an Gemeinschaftsschulen Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Wahlpflicht- und Profilfächer Alle Schülerinnen und Schüler belegen verpflichtend je ein Fach aus dem Wahlpflichtbereich
Wahlpflicht- und Profilfächer an Gemeinschaftsschulen Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Wahlpflicht- und Profilfächer Alle Schülerinnen und Schüler belegen verpflichtend je ein Fach aus dem Wahlpflichtbereich
INFORMATIONS- TECHNISCHE GRUNDBILDUNG
 BILDUNGSSTANDARDS FÜR INFORMATIONSTECHNISCHE GRUNDBILDUNG 309 INFORMATIONS- TECHNISCHE GRUNDBILDUNG 310 LEITGEDANKEN ZUM KOMPETENZERWERB FÜR INFORMATIONSTECHNISCHE GRUNDBILDUNG I. Leitgedanken zum Kompetenzerwerb
BILDUNGSSTANDARDS FÜR INFORMATIONSTECHNISCHE GRUNDBILDUNG 309 INFORMATIONS- TECHNISCHE GRUNDBILDUNG 310 LEITGEDANKEN ZUM KOMPETENZERWERB FÜR INFORMATIONSTECHNISCHE GRUNDBILDUNG I. Leitgedanken zum Kompetenzerwerb
Inhaltlicher Stand: 23. März 2016
 Bildungsplan 2016 Allgemein bildende Schulen Endfassung Inhaltlicher Stand: 23. März 2016 Stuttgart 2016 BP2016BW-ALLG-SEK1-E1 / Inhaltlicher Stand: 23. März 2016 / PDF generiert am 06.06.2016 09:24 Impressum
Bildungsplan 2016 Allgemein bildende Schulen Endfassung Inhaltlicher Stand: 23. März 2016 Stuttgart 2016 BP2016BW-ALLG-SEK1-E1 / Inhaltlicher Stand: 23. März 2016 / PDF generiert am 06.06.2016 09:24 Impressum
