Die medikamentöse Therapie des Morbus Parkinson
|
|
|
- Justus Zimmermann
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Diplomarbeit Die medikamentöse Therapie des Morbus Parkinson eingereicht von Antonia Zernatto zur Erlangung des akademischen Grades Doktorin der gesamten Heilkunde (Dr. med. Univ.) an der Medizinischen Universität Graz ausgeführt am Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie unter der Anleitung von Eckhart Beubler Mag. pharm. Dr. phil. Univ.-Prof. für Pharmakologie i.r. Josef Donnerer Dr. med. univ. ao. Univ.-Prof. Univ.-Doz. für Pharmakologie Graz,
2 Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe, andere als die angegebenen Quellen nicht verwendet habe und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Graz, am Antonia Zernatto eh i
3 Abstract Parkinson s disease is a neurodegenerative disease of the basal ganglia. Its symptoms are diverse. The clinically manifest diagnosis is currently based on the evidence of motoric cardinal symptoms akinesia, respectively bradykinesia, rigor and postural instability. The typical gait of the patient shows a slightly bent-forward posture doing short steps without arm movement. The actual cause of Parkinson s disease has not been found yet. According to current opinion of experts the disease is a combination of oxidative stress, mitochondrial dysfunction, neuroinflammation as well as misfolding and aggregation of proteins. The idiopathic form of the disease is caused by degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra. The resulting dopamine deficiency causes an imbalance in the nigrostriatal neuron system which is responsible for arbitrary motor activity. The division into different stages is based on the classification according to Braak, which describes the neurological affliction by Lewy bodies. As the disease is not curable as of today, it is the therapeutic aim to counterbalance the functional consequences of the dopamine deficiency in the basal ganglia. This can be achieved by several strategies: The dopamine can be substituted directly or the dopamine receptor can be stimulated directly or dopamine depletion can be prevented. The active pharmaceutical agents in question are Levodopa, dopamine receptor antagonists, catechol-o-methyltransferase-inhibitors, monoaminoxidase-b-inhibitors, NMDA-receptor-antagonists, and centrally acting anticholinergia. L-Dopa is still considered the most effective substance for treating Parkinson s disease. The introduction of the L-DOPA therapy has largely improved the prognosis with regard to life expectancy, since the complications caused by the disease can be delayed considerably in most patients. The therapy of non-motoric symptoms of Parkinson s disease poses a major challenge as well. Occasionally the variety and complexity of these symptoms actually require psychiatric care. Even if conventional pharmacotherapy has been expended, there are therapeutical alternatives, such as the invasive drug pump with subcutaneously applicated Apomorphine or L-DOPA administered by intestinal tube or deep brain stimulation. ii
4 Inhaltsverzeichnis Abstract Abkürzungsverzeichnis ii v 1 Einleitung 1 2 Definition des Morbus Parkinson Epidemiologie Pathogenese und Äthiologie Klinik und Diagnostik Historie 12 4 Die medikamentöse Therapie der motorischen Symptome Pharmakologische Angriffspunkte Direkte Gabe von Dopamin Direkte Aktivierung der Dopaminrezeptoren Hemmung des Dopamin-Abbaus Wirkstoffklassen und ihr therapeutischer Einsatz L-Dopa (Levodopa) Dopaminrezeptoragonisten Hemmstoffe der Catechol-O-Methyltransferase Hemmstoffe der Monoaminoxidase-B NMDA-Rezeptor-Antagonisten Anticholinergika (Muskarinrezeptor-Antagonisten) Die medikamentöse Therapie der nicht - motorischen Symptome Neuropsychiatrische Störungen Depression Psychose Autonome Dysfunktionen Orthostatische Hypotension iii
5 5.2.2 Detrusordysfunktion Erektile Dysfunktion Obstipation Störungen des Schlaf-/ Wachrhythmus Schmerz Alternative Therapiemöglichkeiten Pumpentherapien bei Morbus Parkinson Apomorphinpumpe Per Jejunal-Sonde appliziertes Levodopa Tiefe Hirnstimulation bei Morbus Parkinson Pragmatische Therapieentscheidungen Wann und mit welchem Medikament soll die Therapie beginnen? Therapie bei frühem Erkrankungsbeginn Therapie bei spätem Erkrankungsbeginn Therapieeinleitung Therapieeinleitung mit L-DOPA Therapieeinleitung mit Non-Ergot-Dopaminagonisten Therapieeinleitung mit MAO-B-Hemmer Erhaltungstherapie Therapie von motorischen Komplikationen Therapie von Wirkungsfluktuationen Therapie von Dyskinesien Therapie des Tremors Therapie der akinetischen Krise Das Problem mit den Generica Blick in die Zukunft Safinamid Zusammenfassung 57 Literaturverzeichnis 59 Abbildungsverzeichnis 64 iv
6 Abkürzungsverzeichnis COMT Catechol-O-Methyltransferase DATATOP Deprenyl and Tocopherol Antioxidative Therapy of Parkinsonism GABA Gamma-Amino-Buttersäure L-DOPA L-Dihydroxyphenylalanin MAO Monoaminoxidase MPTP 1-Methyl-1-4-Phenyl-1,2,3,6-Tetrahydropyridin NMDA N-Methyl-D-Aspartat PANDA Parkinson Neuropsychometric Dementia Assessment PDE-5 Phosphodiesterase-5 RBD REM-Sleep-Behavior-Disorder RCT randomized controlled trials REM rapid eye movement SSRI Serotonin-Reuptake-Inhibitors UDPRS United Parkinson s Disease Rating Scale WHO World Health Organisation v
7 Kapitel 1 Einleitung Der Morbus Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung der Basalganglien und äußert sich durch ein Zusammenwirken von erhöhtem Muskeltonus, verminderter Beweglichkeit und Tremor. [25] Die Fragestellung dieser Diplomarbeit bezieht sich auf die medikamentöse Therapie des Morbus Parkinson und ihre Entwicklung. Es wird der medikamentöse Werdegang hinsichtlich der zeitlichen Entwicklung erörtert; was gab es in der Vergangenheit, was ist heutiger Standard und was wird es in Zukunft geben. Die Bedeutung der Fragestellung ergibt sich durch die Prävalenz. Die Prävalenz ist zwischen den ethnischen Regionen sehr unterschiedlich und hängt stark vom Alter ab. Orientierend kann man jedoch eine Prävalenz von / Einwohner annehmen. Aufgrund der Veränderung der Alterspyramide wird angenommen, dass in Deutschland in den nächsten 15 Jahren eine Zunahme von 50% zu erwarten ist. Epidemiologisch wird eine geschlechtsspezifische Erkrankungshäufigkeit in einem Verhältnis von Männern zu Frauen mit 1,46 beschrieben. Auch wenn das männliche Geschlecht etwas häufiger betroffen ist, ist die Relevanz durchaus für beide Geschlechter gegeben. [14,16,24,52] Aus diesem Grund möchte ich hiermit vermerken, dass der Patient in meiner Arbeit für beide Geschlechter steht. Der Neuigkeitswert dieser literarischen Recherche ergibt sich aus einer detaillierten Übersicht der medikamentösen Therapiemöglichkeiten der parkinsonschen Erkrankung. Da es nach wie vor keine Heilung dieser degenerativen Erkrankung gibt, ist das Therapiemanagement von großer Wichtigkeit. Um Resistenzentwicklungen möglichst hinauszuzögern und Nebenwirkungen gering zu halten, ist ein guter Überblick über die verschiedenen Medikamentengruppen unumgänglich. Um diesen zu ermöglichen, wird in dieser Arbeit auch die Vergangenheit und der Werdegang des heutigen Wissens über den Morbus Parkinson berücksichtigt. [52] 1
8 Kapitel 2 Definition des Morbus Parkinson Der Morbus Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung der Basalganglien und zählt zu den hyperton-hypokinetischen Syndromen. Er ist gekennzeichnet durch eine typische Symptomentrias, die sich durch einen erhöhten Muskeltonus (Rigor), eine verminderte Beweglichkeit (Akinesie) und einen Tremor äußert. Diese Kombination an Symptomen wird als Parkinson-Syndrom verstanden. [25] Ätiologisch ist der Morbus Parkinson prinzipiell vom Parkinson-Syndrom zu unterscheiden, da er nur die idiopathische Variante dieser Erkrankung beschreibt. Zum Syndrom hingegen zählt man noch den funktionellen Parkinsonismus, welcher durch Arzneimittel wie Neuroleptika, einige Antidepressiva, Valproinsäure etc. hervorgerufen werden kann, und den Pseudoparkinsonismus, welcher im Rahmen von Morbus Alzheimer, vaskulär bedingter Demenz oder nach Vergiftungen auftreten kann. [24, 25] Der Morbus Parkinson wird, gemeinsam mit der Multisystematrophie und der Demenz mit Lewy-Körperchen, zu den α-synucleinopathien gezählt. Wohingegen die progressive supranukleäre Blickparese und die kortikobasale Degeneration zu den atypischen Parkinsonsyndromen gezählt werden. [15] Ursache der idiopathischen Krankheitsform ist die Degeneration der dopaminergen Neurone in der Substantia nigra. Im Rahmen des Krankheitsverlaufs werden durch den Degenerationsprozess weitere Hirnareale involviert, sodass die Unterscheidung von der alzheimerbedingten Demenz nur durch den zeitlichen Ablauf erfolgen kann. [24] 2.1 Epidemiologie Epidemiologisch betrachtet sind 1-2% der Bevölkerung über 65 Jahren in Deutschland an Parkinson erkrankt. Die Prävalenz unterscheidet sich zwischen den ethnischen Gruppen und Regionen und ist stark vom Alter abhängig. Orientierend kann man jedoch eine Prävalenz von / Einwohner annehmen. Eine weitere Annahme basierend auf der Veränderung der Alterspyramide ist, dass es in Deutschland in den nächsten 15 Jahren eine Zunahme von 50% zu erwarten ist. [52] 2
9 2.2 Pathogenese und Äthiologie Wie bereits erwähnt, ist beim idiopathischen Morbus Parkinson die Degeneration der dopaminergen Neurone in der Substantia nigra ursächlich. Der daraus resultierende Dopaminmangel bringt das nigrostriatale Neuronensystem, welches für die Willkürmotorik verantwortlich ist, in Ungleichgewicht. Dieses komplex aufgebaute System hat seine Zellkörper in der Pars compacta der Substantia nigra und innerviert, über Dopamin als Transmitter, GABAerge und cholinerge Neurone im Neostriatum. Die Kardinalsymptome treten auf, wenn der striatale Dopaminspiegel um 60-80% reduziert ist, wobei zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als die Hälfte der dopaminergen Neurone in der Substantia nigra degeneriert ist. [16, 51] Die Motorik im Allgemeinen wird über die Pyramidenbahn als Impulsgeber und über die extrapyramidal-motorische Schleife als Kontrolle reguliert. Das pyramidale System besteht aus der direkten Bahn vom Cortex zu den motorischen Hirnnervenkernen (Tractus corticobulbaris alias Tractus corticonuclearis) und der ebenfalls direkten Bahn vom Cortex ins Rückenmark (Tractus corticospinalis). Dieses pyramidale System wird über die extrapyramidal-motorische Basalganglienschleife moduliert. Diese verläuft vom Cortex über die Basalganglien zum Thalamus und wieder zurück zum Cortex. Sie gibt ein Feedback, durch welches ein motorischer Handlungsentwurf zu einem koordinierten Bewegungsablauf moduliert werden kann. Dadurch werden gewollte Bewegungen gefördert und ungewollte blockiert. Die Neuroanatomie der Extrapyramidalmotorik besteht primär aus den Glutamatneuronen, die vom Cortex zum Corpus striatum ziehen. Das Corpus striatum besteht aus dem Nucleus caudatus und dem Putamen und stellt den Eingangskern der Basalganglien dar, in dem vom Cortex aus GABAerge und cholinerge Neurone aktiviert werden. Sekundär ziehen von dort aus zwei Bahnen weiter zum Thalamus, eine direkte und eine indirekte Bahn. Die direkte Bahn führt einerseits über den Globus pallidus medialis und andererseits über die Substantia nigra reticularis zum Thalamus. Die indirekte Bahn hat eine Zwischenschaltung einerseits im Globus pallidus lateralis und andererseits im Nucleus subthalamicus. Diese zwei Schleifen der Extrapyramidalmotorik werden wiederum von striatalen cholinergen Interneuronen und von den nigro-striatalen Dopaminneuronen gesteuert, hauptsächlich über den Transmitter Gamma-Amino-Buttersäure (GABA). Wenn man nun noch die einzelnen Transmitterfunktionen im Extrapyramidalsystem im Überblick betrachtet, kann man die pharmakologisch therapeutischen Ansätze besser nachvollziehen. Es ist nach wie vor nicht ganz erforscht, wie die Neurone und Transmitter zusammenwirken, um eine Bewegung entstehen zu lassen; und daher ist auch der Pathomechanismus des Morbus Parkinson noch nicht ganz verstanden. Der aktuelle Wissenstand beschreibt es so: die cholinergen Interneurone im Corpus striatum werden über Dopamin (D2-Rezeptoren) gehemmt, die GABA-Neurone (D1-Rezeptoren) der di- 3
10 rekten Bahn verstärkt und die GABA-Neurone der indirekten Bahn (D2-Rezeptoren) gehemmt. Dadurch wird bei einem Dopaminmangel die Aktivität der cholinergen Interneurone nicht gehemmt, die GABA-Neurone der direkten Bahn werden gehemmt und die der indirekten Bahn enthemmt. Dadurch wird die Hemmung der GABAergen Neurone im Thalamus gesteigert, wodurch sich die Aktivität der thalamo-kortikalen Glutamatneurone verringert. Dies hat zur Folge, dass die Hemmung von ungewollten Bewegungen zu stark ist sodass die gewollten ebenfalls gehemmt werden. Das Resultat ist der Morbus Parkinson. [1] Abbildung 2.1: Vereinfachte Darstellung des extrapyramidalen Kontrollsystems beim A = Gesunden und B = Parkinson - Patient [1] grün = Dopamin, blau = GABA, rot = Glutamat und gelb = Acethylcholin Histologisch betrachtet, findet man häufig in den melaninhaltigen degenerierten Neuronen eosinophile, zytoplasmatische Einschlusskörperchen, genannt Lewy-Körperchen, umgeben von aktivierten Mikroglia-Zellen, welche die Abwehrzellen des Gehirns darstellen. Diese Lewy-Körperchen enthalten diverse Proteine wie α-synuclein, Ubiquitin und Proteasomen. Ob die Lewy-Körperchen tatsächlich für die Zellen schädlich sind oder sie etwa schützen, ist noch nicht geklärt. Man hat auch festgestellt, dass nicht nur die Neurone der Substantia nigra atrophieren, sondern auch die im Vagus- Kern, Edinger-Westphal-Kern, Raphe-Kernen, Brücke, Spinalganglien, Mesenzephalon und in den peripheren sympathischen Ganglien. Dadurch entsteht ein weiterer Mangel an Neurotransmittern wie Noradrenalin, Adrenalin, Serotonin, sowie GABA und Acethylcholin. [52] 4
11 Die Klassifikation nach Braak lässt eine stadienhafte Einteilung zu, indem sie den neurologischen Befall durch die Lewy-Körperchen beschreibt. Nach Braak werden als erstes der Bulbus olfactorius, die Medulla oblongata und das Tegmentum pontis befallen, wobei bis dahin noch keine Symptome auftreten. Bei Fortschreiten der Erkrankung werden die Substantia nigra, Areale des Mesencephalons und des basalen Vorderhirn sowie zuletzt der Neocortex befallen. [5] Demnach hat der Krankheitsprozess sechs Stadien, wobei die ersten zwei asymptomatisch und die letzten vier symptomatisch verlaufen. Das Auftreten der Symptome hängt eng mit dem Befall der Substantia nigra zusammen und tritt erst im dritten Stadium auf. Eine detaillierte Auflistung ist in den Abbildungen 2.2a und 2.2b dargestellt. (a) Stadieneinteilung nach Braak (b) Topographische Darstellung der Ausbreitung von Lewy-Körper Abbildung 2.2: Stadieneinteilung nach Braak gemessen an der Ausbreitung von Lewy-Körper [52] Die Ursache des Morbus Parkinson ist bis heute noch nicht geklärt. Einerseits kann man 5% der Erkrankungsfälle durch genetische Faktoren erklären und weiters schätzt man das Erkrankungsrisiko einer einzelnen Person, durch genetische Faktoren, auf 30% ein, jedoch konnte man die genetische Komponente bei Studien mit eineiigen Zwillingen noch nicht nachweisen. Andererseits macht man metabolische Störungen für gefundene Mutationen verantwortlich. Hauptsächlich werden Umweltgifte, vor allem aus der Landwirtschaft, als pathogenetische Faktoren beschuldigt. Es gibt auch Hypothesen mit dem sogenannten MPTP - Modell (1-Methyl-4-Phenyl-1,2,3,6-Tetrahydropyridin). 5
12 Eine Injektion von MPTP bei Mäusen führt zu einer parkinsonoiden Erkrankung, die sich nur durch den isolierten Befall der Substatia nigra und dem unzuverlässigen Nachweis von Lewy - Körperchen, von dem echten Morbus Parkinson unterscheiden lässt. Letztendlich folgert man zurzeit, dass die Ursache eine Kombination aus oxidativem Stress, mitochondrialer Funktionsstörung, Neuroinflammation sowie Fehlfaltung und Aggregation von Proteinen darstellt. [46, 52] 2.3 Klinik und Diagnostik Die Klinik des Morbus Parkinson besteht, entsprechend der multisystemischen Pathogenese, aus einem breit gefächerten Symptomenspektrum. Als die derzeit gültigen klinischen Diagnosekriterien gilt allerdings nur der Nachweis der motorischen Kardinalsymptome. Diese sind die bereits erwähnten Symptome Akinesie bzw Bradykinesie, Tremor und Rigor. [52] Die Bradykinesie ist für die Diagnosestellung und auch für den Patienten die wichtigste motorische Einschränkung. Sie beschreibt im Allgemeinen die Verlangsamung des Bewegungstempos. Hat der Patient auch Schwierigkeiten mit der Initiation seiner Bewegung, spricht man zusätzlich von Akinesie. Und sobald auffällig wird, dass bei mehreren Wiederholungen der Bewegung die Amplitude sich verringert, spricht man von Hypokinesie. Dies äußert sich in vermindertem Armschwingen beim Gehen oder beim Immerkleinerwerden der Schrift, genannt Mikrographie. Das Gehen wird kleinschrittig, die Sprache hypophon und emotionslos. Das talgig glänzende Gesicht, aufgrund der Seborrhoe, zeigt eine Hypomimie und eine Sialorrhoe, welche allerdings eher auf eine verminderte Schluckmotorik als auf eine Hypersalivation zurückzuführen ist. Anamnestisch kann der Patient auch von Schwierigkeiten beim Zuknöpfen des Hemdes, beim Rasieren oder beim Benutzen eines Schraubenziehers berichten. Die klinischen Untersuchungsmethoden der Bradykinesie sind am besten an der oberen Extremität anwendbar. Deutlich zeigt sie sich bei Supinations- und Pronationsbewegungen, Faustschluss- und -Öffnung und bei repetitiven Zeigefinger-Daumen-Kontakten. Als typisch wird die stetige Abnahme der Bewegungsamplitude angesehen, die ein frühes Zeichen der Erkrankung sein kann. Da der Krankheitsverlauf in der Regel unilateral fortschreitet, ist der Seitenvergleich von großer Bedeutung. Da die Bradykinesie am meisten zur motorischen Behinderung des Patienten beiträgt, stellt ihre Verminderung das erste therapeutische Ziel dar. [25, 52] Der Tremor tritt bei etwa 3/4 der Parkinson-Patienten im Krankheitsverlauf auf. Der Zeitpunkt kann sehr unterschiedlich sein. [25] Beim Tremor handelt es sich um rhythmische, oszillierende und unwillkürliche Bewegungen von mindestens einem Körperteil. Er ist ein Netzwerkphänomen, zu dem vor allem die Basalganglienschleife und die zerebello-thalamo-kortikale Schleife beitragen. [11, 33] Der distale Ruhetremor ist mit 6
13 einer Frequenz von zirka 5/Sekunde typisch. Am deutlichsten ist er zu sehen, wenn der Patient eine entspannte Liegeposition einnimmt. Diagnostisch von Bedeutung ist die Eigenschaft des Tremors, dass er durch geistige Beschäftigung wie Rechenaufgaben und Emotionen getriggert werden kann und wiederum durch Willkürmotorik die Tremoramplitude abnimmt. Die am häufigsten vom Tremor betroffenen Körperteile sind Hände und Arme, Beine, Gesicht und Zunge. Selten findet man bei Parkinson-Patienten auch einen Haltetremor und einen Intentionstremor. [25, 52] Der Rigor bezeichnet eine Erhöhung des Muskeltonus, die während eines Bewegungsablaufes auftritt und unabhängig von Geschwindigkeit und der Bewegung im Gelenk ist. Diagnostisch wird das Hand- oder das Ellbogengelenk vom Untersucher abwechselnd in Extensions- und Flexionsstellung gebracht. Zusätzlich muss der Patient die andere Hand zum Faustschluss bringen. Wenn sich dadurch der Muskeltonus an der passiv bewegten Extremität erhöht, ist das Symptom positiv. Diese Untersuchungstechnik nennt man Manöver nach Fromment. Wenn der Muskeltonus während der Bewegung ruckartig immer wieder nachgibt, wird das als Zahnradphänomen bezeichnet. Wieder ist zur Diagnostik zu bemerken, dass der Seitenvergleich unumgänglich ist, da das Manöver nach Fromment auch bei gesunden älteren Menschen positiv sein kann. Der Rigor kann sehr schmerzhaft sein, besonders oft im Schulter- und Hüftgelenk. [25, 52] Nach der Definition von Örtel W. [52], wird zur bereits erwähnten Symptomentrias noch die posturale Störung gezählt, da der Verlust dieser Reflexe beim Patienten eine Instabilität bewirkt, die zu schweren Stürzen führen kann und somit ebenfalls zu krankheitsdefinierenden Symptomen zählt. [52] Resultierend aus der Bradykinesie, Rigor, Verlust posturaler Reflexe und ebenfalls hinzukommender orthostatischer Dysfunktion, ergibt sich das typische Gangbild des Parkinson-Patienten: leicht nach vorne gebeugt, nach vorne geschobener Kopf, kleinschrittig, oft schlurfender Gang, ohne Mitbewegung der Arme; für das Drehen am Ort werden viele kleine Wendeschritte benötigt. [25] Das Freezing beschreibt eine Blockade in der Bewegung, die als Starthemmung oder als motorische Blockade imponieren kann. Dieses Phänomen kann oft durch verbale oder visuelle Rhythmuskommandos unterbrochen werden. [52] Die nicht motorischen Symptome des Morbus Parkinson sind breit gefächert und beinhalten neuropsychiatrische Störungen wie Depression, Schlafstörungen, autonome Dysfunktion und sensorische Symptome, wie Schmerzen. Siehe Abbildung 2.3 Diese Symptome waren schon zum Zeitpunkt der Entdeckung bekannt, wurden jedoch eher als Melancholie gedeutet. Allerdings sind die Details durch die Forschung in den letzten zwei Jahrzehnten immer umfangreicher geworden. Sie treten häufig bereits zu Beginn der Erkrankung auf. Es wird sogar postuliert, dass manche den motorischen Störungen vorausgehen können, jedoch werden sie nicht 7
14 Abbildung 2.3: Übersicht nicht motorischer Symptome [52] als bestätigende Symptome zur Diagnose anerkannt. Zu diesen Frühsymptomen zählen Hyposmie, Sleep Behaviour Disorder, Depression und Obstipation. Gesichert ist, dass die nicht motorischen Symptome im Laufe der Erkrankung zunehmen und die Lebensqualität stark reduzieren. Somit stellen sie ebenfalls eine therapeutische Herausforderung dar. [42, 52] Die Depression mit ihrer Störung von Antrieb und Affektivität ist bereits bei einem Drittel der Patienten von Anfang an vorhanden. Der Zusammenhang zwischen Pathologie und Klinik ist in diesem Bezug noch nicht ganz geklärt, jedoch wird vermutet, dass gestörte Neurotransmissionen im noradrenergen und/oder serotonergen System sowie im mesokortikalen bzw mesolimbischen System ursächlich sind. Zu den häufigsten Symptomen der Depression zählen Interessensverlust und Anhedonie, welche die Reduktion von positivem Empfinden beschreibt. Weiters werden Ängstlichkeit, Panikattacken, Schlafstörungen und Erschöpfbarkeit zu den häufigen Symptomen gezählt. Auch tritt relativ früh im Krankheitsverlauf eine kognitive Dysfunktion auf, welche anfangs nur bei detaillierten neuropsychologischen Tests, wie dem Mini Mental Test bzw dem für Parkinson-Demenz spezielle PANDA (Parkinson Neuropsychometric Dementia Assessment) bemerkbar wird. Auffallend sind hierbei Defizienzen in der Handlungsplanung und Wortflüssigkeit. Anfänglich wirkt sich die verminderte Kognition nicht auf den Alltag aus, ähnlich der Alzheimer-Erkrankung. Jedoch erhöht sie ab 8
15 dem Lebensjahr die Wahrscheinlichkeit, unabhängig vom motorischen Verlauf, eine Demenz zu entwickeln. [17, 52] Es können sich auch Psychosen entwickeln, die sich in Form von Illusionen, Halluzinationen, Verwirrtheit, Wahnvorstellungen, paranoider Wahrnehmungsverarbeitung und Impulskontrollstörungen äußern. Initial werden intensive Träume berichtet, wobei ab dem Auftreten von Illusionen und Halluzinationen die Psychose als manifest gilt. Hauptsächlich wird von visuellen Erscheinungen berichtet und seltener von akustischen oder taktilen Halluzinationen, wobei sie dann in Kombination auftreten können. In der Diagnostik und Behandlung der Parkinsonerkrankung werden Psychosen deutlich unterschätzt und sind nur durch gezieltes Fragen erkennbar. Störungen der Schlaf-Wach-Regulation sind, je nach Untersuchungsgenauigkeit, bei bis zu 90% der Patienten zu finden. Zu ihnen zählen Ein- und Durchschlafstörungen, welche eine reduzierte Schlafeffizienz zur Folge haben. Dadurch resultiert eine pathologische Tagesmüdigkeit. Ebenfalls zugehörig ist die REM-Schlaf-assoziierte Verhaltensstörung (RBD), die sich durch die fehlende Muskelatonie im REM-Schlaf äußert und während traumassoziierten Bewegungsabläufen eine erhebliche Verletzungsgefahr für den Bettpartner darstellt. Diese Art von Schlafsstörung kann in jedem Stadium der Parkinson-Erkrankung auftreten. Ein Umstand, der den Alltag ebenfalls erschwert, ist die autonome Dysfunktion. Zu ihr zählt man orthostatische Hypotension sowie urogenitale und gastrointestinale Dysfunktionen. Die Prävalenzen sind deutlich seltener als bei den vorher beschriebenen Symptomen: orthostatische Hypotension mindestens 30%, Blasenfunktionsstörungen 32% und chronische Obstipation mit 36%; Die Prävalenzen steigen mit der Dauer der Erkrankung, vor allem bei mehr als 10-jähriger Krankheitsdauer. Die orthostatische Dysfunktion wird oft mit Verschwommensehen, posturaler Instabilität, Vertigo sowie orthostatischen Synkopen geschildert. Die Blasenentleerungsstörungen umfassen Polakisurie mit starkem Harndrang und Restharnbildung, sowie Dranginkontinenz. Ebenfalls nicht untypisch sind sexuelle Funktionsstörungen, die sich beim Mann als erektile und ejakulatorische Dysfunktion äußern. Diese treten meist einige Jahre nach dem Beginn der motorischen Störungen auf. Als nahezu universelles Symptom gilt die Hyposmie, welche die Störung der Geruchswahrnehmung beschreibt. Sie tritt in zahlreichen Studien bei über 90% der Patienten auf. Oft sind auch Parästhesien und Schmerzen der Grund für den ersten Arztbesuch, vor allem in der oberen Extremität. Die Schmerzen werden oft als krampfartig-ziehend beschrieben, wobei die Lokalisation von lokal bis diffus variieren kann. Auch schmerzhafte Hitzegefühle werden berichtet. Diese Symptome sind oft Schuld an ärztlichen Fehldiagnosen und unnützen orthopädischen Behandlungen. [52] Da die klinischen Symptome nicht bei jedem Morbus-Parkinson-Patienten gleich 9
16 ausgeprägt sind, unterscheidet man sie in drei verschiedene Subtypen: akinetisch-rigider Typus, Tremordominanz-Typus und Äquivalenz-Typus; Der akinetisch-rigide Typ hat den ungünstigsten Verlauf, vor allem wenn eine Gangstörung und eine Sprachstörung dominieren. Der Tremor ist seltener ausgeprägt. Hinzu treten dann kognitive und emotionale Dysfunktionen deutlich früher als bei den anderen Subtypen. Jedoch ist der Beginn der Erkrankung im Schnitt später als beim Tremordominanz-Typ. Dieser ist hauptsächlich gekennzeichnet durch wenig Hypokinesie und Rigor. Der Tremor ist oft schwer behandelbar, jedoch äußert sich die neurologische und psychiatrische Komponente wesentlich milder. Beim Äquivalenz-Typus sind die drei Kardinalsymptome Rigor, Tremor und Bradykinesie gleichstark ausgeprägt. Um die klinischen Symptome untereinander im Verlauf zu vergleichen und zu beurteilen, dienen mehrere Skalen. Zum einen die hier angeführte Rating Scale von Webster [25] und zum anderen die sehr detaillierte UPDRS (United Parkinson s Disease Rating Scale), siehe 2.4, welche, grob gesagt, aus vier Teilen besteht: Kognition und Stimmung, Aktvitäten des täglichen Lebens, der motorische Gesamtbefund und Komplikationen der Therapie; [25, 52] Abbildung 2.4: Rating Scale von Webster [25] Zur Übersicht der zeitlichen Abfolge der Symptome ist hier noch ein Bild aus Örtels Parkinson-Syndrome und andere Bewegungsstörungen [52] angeführt. 2.5 Zur bestätigenden Diagnostik werden spezielle pharmakologische Funktionstests eingesetzt, wie der L-Dopa-Test und der Apomorphin-Test. Als positives Ansprechen 10
17 Abbildung 2.5: zeitlicher Verlauf [25] auf die Tests wird es gewertet, wenn die Symptome, bewertet nach dem UPDRS, sich um mehr als 30% verbessern, wobei der Tremor ausgenommen ist. Beim L-Dopa-Test wird dem Patienten L-Dopa in Kombination mit einem Decarboxylase-Hemmer verabreicht. Alternativ dazu kann Apomorphin plus Domperidon, zur Vorbeugung von Übelkeit, verabreicht werden. [47] Die atypischen Parkinson - Syndrome stellen differentialdiagnostisch eine Herausforderung dar. Sie sind oft nur durch rasche Progression und schlechtes oder fehlendes Ansprechen auf das L - DOPA gekennzeichnet. [15] Auch mittels der Positronen - Emissions - Topographie (PET) und der Single - Photon - Emissions - Topographie (SPECT) können bestätigende Tests durchgeführt werden. Sie können einerseits die Verfügbarkeit von Dopamintransportern im Striatum nachweisen. Andererseits können sie ein Urteil über die Dopaminsynthese und -speicherung sowie die Verfügbarkeit vesikulärer Monoaminotransporter im Striatum zulassen. [6] 11
18 Kapitel 3 Historie Unter den ersten historischen Dokumenten, in denen die Symptomatik des Morbus Parkinson erwähnt wurde, sind jene von Franciscus de le Böe ( ), in denen er erstmals den Tremor beschrieb. Francois Biossier de Sauvages de la Croix ( ) beschrieb den typischen kleinschrittigen Gang, als dessen Ursache er allerdings eine verminderte Flexibilität der Muskelfasern interpretierte. Seine Aufzeichnungen wurden zitiert vom namensgebenden James Parkinson, einem Arzt und Naturforscher aus einem Londoner Vorort. Er beschrieb 1817 in einer medizinischen Arbeit die Symptome Tremor und Rigor. Die Akinesie wurde von ihm als Parese gedeutet. Die historisch erste präzise Beschreibung der Akinesie wurde von Wilhelm von Humboldt ( ) verfasst. Er beschrieb 1830, mit wissenschaftlicher Genauigkeit, eine eigentümliche Ungeschicklichkeit seiner rechten Hand. Er beobachtete die typische Charakteristik der Bradykinesie mit verminderter Feinmotorik bei erhaltener grober Kraft. Siehe 3.1a. Jean Martin Charcot ( ), einer der bedeutendsten Ärzte in der Geschichte des Hôpital de la Salpêtière, unterschied erstmals den Ruhetremor vom Intentionstremor und schlug die Namensgebung der Erkrankung nach James Parkinson vor. Aus dem Jahre 1877 wurde ein Rezept ausfindig gemacht, das beweist, dass Charcot bereits eine empirische Pharmakotherapie anwendete mittels Belladonna- und Mutterkornalkaloiden. Siehe 3.1b. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren auch schon zahlreiche nicht motorische Symptome detailliert beschrieben worden, vor allem die autonomen Dysfunktionen. Friedrich H. Lewy ( ) beschrieb 1912 erstmals die nach ihm benannten Lewy - Körperchen als neuropathologisches Hauptkennzeichen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der striatale Dopaminmangel im Gehirn der Parkinson - Patienten entdeckt und die symptomatische Behandlung mit L - DOPA begonnen. [32, 48, 49, 52] 12
19 (a) Die Statue von Wilhelm von Humboldt zeigt die typische gebeugte und flektierte Haltung der Parkinson - Erkrankung (b) Ein 1877 ausgestelltes Rezept zur Behandlung der Parkinson - Erkrankung Abbildung 3.1: Historische Bilder zur Therapie des Morbus Parkinson [32] 13
20 Kapitel 4 Die medikamentöse Therapie der motorischen Symptome Prinzipiell kann man sagen, dass sich seit der Entdeckung von L-Dopa die medikamentösen Therapieoptionen beim Morbus Parkinson revolutioniert haben, sodass man heute einen relativen Reichtum an unterschiedlichen Wirkstoffklassen zur Verfügung hat. [47] Da die Erkrankung bis zum heutigen Tage noch nicht heilbar ist, ist das therapeutische Ziel, die funktionellen Konsequenzen des Dopaminmangels in den Basalganglien auszugleichen. [13] 4.1 Pharmakologische Angriffspunkte Der Ausgleich des Dopaminmangels kann durch mehrere Strategien erzielt werden. Es kann das Dopamin direkt ersetzt werden oder der Dopamin-Rezeptor direkt stimuliert werden oder der Abbau des Dopamins verhindert werden. Einen Überblick gibt die Abbildung Direkte Gabe von Dopamin Da Dopamin die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren kann, muss mit einer Vorstufe gearbeitet werden, die das kann. L-3,4-Dihydroxy-phenylalanin alias Levodopa alias L-DOPA, ist eine direkte Vorstufe und wird durch einen Aminosäure-Transporter in das Zentralnervensystem eingeschleust. Diese Vorstufe wird dann im ZNS mittels der DOPA-Decarboxylase in Dopamin umgewandelt. [24] Dieser Metabolismus hat den Nachteil, dass es zur Bildung von freien Sauerstoffradikalen kommen kann. Dies führt zur Toxizität und trägt somit zur weiteren neuronalen Zelldegeneration bei. Ebenfalls nachteilig ist, dass das L-Dopa nicht nur im ZNS umgewandelt wird, sondern auch in der Peripherie, da maximal 10% der applizierten Dosis die Blut-Hirn-Schranke tatsächlich passieren. Dies hat zur Folge, dass starke Nebenwirkungen entstehen können. Aus die- 14
21 sem Grund werden immer Inhibitoren der DOPA-Decarboxylase mitverabreicht. Diese bleiben ausschließlich in der Peripherie und hemmen dort die Metabolisierung. Das L-DOPA wird jedoch auch über die Katechol-O-Methyltransferase weiter abgebaut, sodass man durch diese Enzymhemmung ebenfalls die Verfügbarkeit von L-DOPA steigert. [14] Direkte Aktivierung der Dopaminrezeptoren Die direkte Aktivierung der Dopaminrezeptoren durch Rezeptor-Agonisten hat den Vorteil, dass keine potenziell toxischen Dopaminmetabolite entstehen können. Andererseits sind die Nebenwirkungen durch Fibrosierungen diverser innerer Organe nicht zu verachten. [14, 24] Hemmung des Dopamin-Abbaus Wenn man den Metabolismus des Dopamins im Striatum inhibiert, steigen dadurch die Spiegel, und somit die Verfügbarkeit von Dopamin, an. [14] Abbildung 4.1: therapeutische Ansätze mit Levodopa [25] 4.2 Wirkstoffklassen und ihr therapeutischer Einsatz Die hier in Frage kommenden Wirkstoffklassen sind das Levodopa, die Dopaminrezeptoragonisten, die Catechol-O-Methyltransferase-Hemmer, die Monoaminoxidase-B- Inhibitoren, die NMDA-Rezeptor-Antagonisten und zentral wirksame Anticholinergika. 15
22 4.2.1 L-Dopa (Levodopa) Es ist ein linksdrehendes Stereoisomer von Dihydroxy-Phenylalanin, somit hat es die gleiche Struktur und gleiche Summenformel wie Dopamin, unterscheidet sich jedoch in der räumlichen Anordnung der Atome. [12] Siehe Strukturformel 4.2. Es ist eine Aminosäure, die beim physiologischen ph-wert von 7,4 schwer löslich ist. Aufgrund seiner Catecholstruktur ist sie leicht oxidierbar. Pharmakodynamisch betrachtet, kann es die Blut-Hirn-Schranke passieren und wird dort zu Dopamin decarboxyliert. Um diesen Vorgang zu ermöglichen, müssen im Corpus striatum noch funktionsfähige Nervenzellen übrig sein. Diese Decarboxylierung findet aber auch in einigen anderen Hirnregionen mit dopaminerger und catecholaminerger Innervation sowie in den Blutgefäßen statt. [13] Pharmakokinetisch betrachtet wird das L-DOPA im Dünndarm zu 70-80% über ein aktives Transportsystem für aromatische Aminosäuren resorbiert. Das Transportsystem des Dünndarmes ähnelt demjenigen, welches das L-DOPA weiter durch die Blut-Hirn-Schranke schleust. Die DOPA-Decarboxylase findet sich in der Peripherie in der Darmwand, Leber und Nieren. Durch die Kombination mit peripher wirksamen Decarboxylasehemmern wird die Bioverfügbarkeit erhöht, sodass die therapeutische Dosis von 4-8 g pro Tag auf 0,3-0,6 g täglich reduziert werden kann wobei sich die Dosis immer nach dem Effekt richtet. Vorzugsweise werden die Wirkstoffe Benserazid und Carbidopa zur Hemmung der Decarboxylase eingesetzt. Das L-DOPA wird jedoch ebenfalls von zu zirka einem Drittel von der Catechol-O-Methyltransferase zu inaktivem 3-O-Methyl-DOPA methyliert. Somit bietet sich durch die Hemmung dieses Enzyms ein weiterer pharmakologischer Angriffspunkt. Die weitere Verstoffwechslung erfolgt über zahlreiche Metaboliten, zum Beispiel als Homovanillinsäure, die über den Urin ausgeschieden werden. [13,24] Einen Überblick über die chemischen Vorgänge gibt die Abbildung 4.5. Therapeutische Verwendung Nach wie vor gilt L-DOPA als der effizienteste Wirkstoff zur Therapie des Mb. Parkinson. Die Symptome, die am besten darauf ansprechen, sind Akinesie und Rigor. Der Tremor stellt wieder eine Ausnahme dar und spricht manchmal weniger gut an. Im Grunde kann man sagen, dass sich die motorischen Symptome unter dieser Therapie wesentlich bessern, was sich auf die Lebensqualität positiv auswirken kann, da sich die körperliche Beweglichkeit wieder steigert. Dies hat auch zur Folge, dass sich die depressiven Begleitsymptome ebenfalls bessern. Wenn die Therapie sich über mehrere Jahre zieht, lässt die Wirkung immer mehr nach, sodass man die Dosis stets erhöhen muss. Dies lässt sich durch die fortschreitende Degeneration der nigrostriatalen Neuronen erklären. [13] Weiters werden die schwankende Resorption und die kurze Halbwerts- 16
23 Abbildung 4.2: Chemische Darstellung des Metabolismus von Levodopa [16] zeit dafür verantwortlich gemacht. [14] Als Standardpräparation wird L-DOPA immer in Kombination Levodopa/Benserazid oder Levodopa/Carbidopa (siehe Carbidopa 4.3) als Tabletten oder Kapseln in variierender Stärke hergestellt. Die Bioverfügbarkeit liegt bei 90%. Die Tabletten können geteilt werden und können zerkaut werden, sodass die Wirkung schneller eintritt. Ebenfalls ist eine dispersible Form verfügbar, bei der die maximale Plasmakonzentration noch früher erreicht wird. Daher wird sie eher als Zusatzoder Notfallsmedikament eingesetzt. Nach Einnahme einer L-DOPA-Standardpräparation ist der Wirkungseintritt normalerweise nach min. Die Wirkungsdauer variiert je nach Dauer der Erkrankung. In der frühen Krankheitsphase kann die Wirkung in der Regel 4-5 Stunden andauern, im Einzelfall sogar bis zu 8 Stunden. In der späten Phase jedoch ist die Wirkung auf 1,5-2 Stunden verkürzt. [52] Abbildung 4.3: Strukturformel von Carbidopa [16] Wenn man L-DOPA als Monotherapie einsetzt, natürlich in Kombination mit einem Decarboxylasehemmer, dann können Tagesdosen von über 1200 mg erreicht werden. [13] Im frühen Krankheitsstadium kann die Dosierung relativ gering gehalten werden, sodass eine dreimal tägliche Einnahme der Standardpräparation von mg den Patienten vorübergehend beschwerdefrei machen. Diese Phase wird auch als honeymoon-period bezeichent. Im späteren Verlauf, wenn die Dosis erhöht werden 17
24 muss, sollte darauf geachtet werden, dass die dreimalige Einzeldosis auf 5-8 mal am Tag fraktioniert wird. Dadurch kann man die Spitzenwerte der Plasmaspiegel reduzieren, um Nebenwirkungen zu vermeiden. Alternativ zur Dosissteigerung kann eine Kombinationstherapie mit COMT-Hemmer oder Dopaminagonisten eingeleitet werden. Die L-DOPA Monotherapie wird heutzutage bei jüngeren Patienten nicht mehr eingesetzt, da die Dopaminagonisten als Monotherapie initial eine gleich gute Wirkung haben. [13] Durch die Einführung der Therapie mit L-DOPA hat sich die Prognose im Bezug auf die Lebensdauer wesentlich verbessert, da die krankheitsbedingten Komplikationen großteils lange hinaus gezögert werden können. Andererseits wird durch L-DOPA, nach heutigem Wissensstand, die Krankheitsprogression nicht aufgehalten. [52] Die Dosierungen von L-DOPA sind in Abbildung 4.5 aufgelistet. Unerwünschte Wirkungen und Komplikationen Bei den unerwünschten Wirkungen muss unterschieden werden zwischen denen, die durch in der Peripherie gebildetes Dopamin enstehen und jene, welche durch zentral gebildetes Dopamin entstehen. Durch in der Peripherie gebildetes Dopamin kann Übelkeit und Brechreiz auftreten. Dies lässt sich durch die Stimulation des Brechzentrums in der Medulla oblongata erklären. Das liegt außerhalb der Blut-Hirn-Schranke und wird vor allem zu Therapiebeginn und bei Dosisteigerung gereizt. Zur Prophylaxe kann Domperidon mitverabreicht werden, da es überwiegend peripher Dopamin-D2-Rezeptoren blockiert. Weiters kann eine Hemmung der Magenmotorik auftreten. Ebenfalls sind kardiovaskuläre Nebenwirkungen nicht selten, vor allem die Hypotonie (30% Häufigkeit). Das durch Decarboxylierung in der Peripherie enstehende Dopamin aktiviert einerseits α-adrenozeptoren an den Gefäßen. Dadurch kommt es zur Vasokonstriktion, was den Blutdruck eigentlich steigert. Andererseits werden jedoch auch vasodilatierende β-adrenozeptoren und Dopaminrezeptoren im Mesenterialgefäßgebiet mit ebenfalls dilatierender Funktion aktiviert. Dies wirkt sich blutdrucksenkend aus. Und als dritter Mechanismus wirkt der Dopaminmetabolit Noradrenalin an α-adrenozeptoren in der Medulla oblongata, wodurch der Sympathikotonus und somit der Blutdruck gesenkt werden. Als weiterer Nebeneffekt stimuliert Dopamin kardiale β-adrenozeptoren, wodurch Tachykardien und Arrhythmien auftreten können. [13] Durch zentral gebildetes Dopamin leiden zirka ein Drittel der Parkinson-Patienten an Dyskinesien. Das sind unwillkürliche Überbewegungen im Bereich der Extremitäten, des Rumpfes und des Kopfes. Wichtig ist der Unterschied zu den tardiven Dyskinesien, ausgelöst durch Neuroleptika, denn dort ist die Gesichtsmuskulatur stark mitbetroffen. Die Dyskinesien treten vor allem zirka zwei Stunden nach der Einnahme von L-DOPA auf, da der hohe Plasmaspiegel eine übermäßige Stimulation von Dopaminrezeptoren im Striatum bewirkt. [13, 14] Die Behandlung der Dyskinesien ist das 18
25 schwierigste Behandlungsziel, da es verlangt, die Patienten medikamentös so einzustellen, dass sie bei maximaler Beweglichkeit am wenigsten dyskinetisch sind. Zur Auswahl stehen Fraktionierung von L-DOPA, Dosisreduktion von Beigabe von Dopaminagonisten und Einführen eines COMT-Hemmers (siehe Catechol-O-Methyltransferase). [13] Das Risiko, Dyskinesien zu entwickeln, hängt nicht nur von der Dosierung des L-DOPA ab, sondern auch vom Erkrankungsalter, Geschlecht sowie vom Körpergewicht. [2] So kann man davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von motorischen Komplikationen und Dyskinesien etwa 10% pro Jahr unter Levodopa-Therapie beträgt. [28] Ebenfalls ist eine Expertenmeinung, dass eine Dosierung von Levodopa bis zu 400 mg mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Dyskinesien verursacht, jedoch Dosen von mg relativ sicher Dyskinesien hervorrufen können. [19] Eine weitere therapeutische Herausforderung ist das sogenannte On-Off-Phänomen. Als solches werden Wirkungsfluktuationen bezeichnet, sodass Phasen von maximaler Wirkung sich mit Phasen von minimaler Wirkung abwechseln können. [14] Dadurch ensteht ein schneller Wechsel zwischen guter Beweglichkeit und plötzlicher ausgeprägter Bradykinesie, dem bereits schon erwähnten Freezing. Zusätzlich zur psychischen Komponente des Morbus Parkinson kommen noch psychische Nebenwirkungen wie Hyperaktivität, Verwirrtheit, Halluzinationen, Depression sowie Psychosen hinzu. Sie treten mit einer Häufigkeit von 25% auf und limitieren ebenfalls die Dosierung von L-DOPA. Auch das tuberoinfundibuläre System wird über dessen Dopaminneuronen beeinflusst, sodass es zu einer Abnahme des Plasmaprolactins kommt, was jedoch für die Therapie keine Konsequenzen hat. Das Wachstumshormon wird allerdings nicht beeinflusst. [13] Ein Überblick über die Nebenwirkungen gibt die Abbildung Seit der Einführung von Levodopa in den späten 1960ern wird in der Literatur ein Zusammenhang von Levodopa und dem malignen Melanom diskutiert. Als Ursache wird die L-DOPA-abhängige Synthese von Melanin in den Melanozyten diskutiert. Durch die Substitution könnte hier eine Induktion der Synthese passieren. Ebenfalls zur Diskussion steht die immunsupprimierende Wirkung von Levodopa, da es dadurch zu einer gesteigerten Sekretion von melanozytenstimulierenden Hormonen kommen könnte. Ob wahr oder nicht, seit 1976 ist daher die L-DOPA-Therapie bei Patienten mit Verdacht auf oder diagnostizierten malignen Melanom kontraindiziert. Zusätzlich wird auch ein regelmäßiges Hautscreening empfohlen. [9, 27] Wechselwirkungen Die Interaktionen ergeben sich einerseits durch die Pyridoxin-(Vitamin-B6)-Abhängigkeit der DOPA-Decarboxylase. Durch Einnahme von Vitamin B6 steigert sich die periphere Decarboxylierung von L-DOPA und reduziert somit den therapeutischen Effekt. Andererseits können Dopaminrezeptoren von typischen Neuroleptika wie Phenothiazi- 19
26 ne und Butyrophenone, Risperidon, Metoclopramid, Benzodiazepine, Isoniazid, Phenytoin und Papaverin blockiert werden, sodass die Wirkung ebenfalls stark reduziert wird. Daher eignen sich, zum Beispiel, atypische Neuroleptika, wie zum Beispiel Clozapin, besser zur Therapie von Parkinson assoziierten Psychosen, da die Blockade der Dopaminrezeptoren verringert ist. Nichtselektive Monoaminooxidasehemmer sollten ebenfalls nicht mit L-DOPA kombiniert werden, da sie in nicht voraussagbarer Weise die zentrale und periphere Wirkung von L-DOPA verstärken. Es kann aber auch bei Kombination mit dem selektiven Selegilin eine Dosisanpassung von Levodopa erforderlich werden, da schwere orthostatische Hypotonien auftreten können. [13, 36] Antihypertensiva: Eine symptomatische orthostatische Hypotonie kann auftreten, wenn eine zusätzliche Gabe von Levodopa und Decarboxylase-Hemmer bei Patienten hinzugefügt wird, die bereits Antihypertensiva erhalten, daher muss mann eventuell eine Dosisanpassung machen. Antidepressiva: Bei zusätzlicher Gabe von trizyklischen Antidepressiva kann eine Hypertonie und Dyskinesie auftreten. Anticholinergika: Sie können eine synergistische Wirkung mit Levodopa haben und einerseits den Tremor verbessern und andererseits Dyskinesien verstärken. Es kann aber auch eine Reduktion der Wirkung von Levodopa erfolgen, indem die Anticholinergika die Resorption verzögern, sodass eine Dosisanpassung erforderlich werden kann. COMT-Hemmer: Diese Kombination kann eventuell die Bioverfügbarkeit von Levodopa erhöhen, wodurch eine Dosisanpassung nötig werden kann. Amantadin besitzt ebenfalls eine synergistische Wirkung mit Levodopa, sodass sich die unerwünschten Wirkungen von Levodopa verstärken können und eine Dosisanpassung erfolgen sollte. Die kardiovaskulären Nebenwirkungen von Levodopa können sich durch die zusätzliche Gabe von Sympathomimetika verstärken. Es kann unter Levodopa-Therapie zu Chelatbildungen im gastrointestinalen Trakt kommen, die zu einer verringerten Resorption führen können. Die Resorption von Levodopa kann auch bei Patienten, die sich proteinreich ernähren, reduziert sein, da Levodopa sich kompetitiv zu gewissen Aminosäuren verhält. [36] Dopaminrezeptoragonisten Ursprünglich wurde diese Substanzklasse aus Ergotalkaloiden hergestellt. Das sind polyzyklische, basische Verbindungen aus dem Pilz Calviceps purpurea, welcher in Getreideähren wächst. Der erste Vertreter war Bromocriptin. Die daraus weiterentwickelten Dopaminrezeptoragonisten sind Apomorphin, Lisurid, Cabergolin, Pergolid und α-dihydroergocriptin. Sie gehören ebenfalls in die Gruppe der Ergotalkaloide. Die neue- 20
27 ren Wirkstoffe gelten als Non-Ergot -Dopaminrezeptoragonisten. Dies sind Ropinirol, Piribedil, Pramipexol und Rotigotin. Sie gelten als Mittel der ersten Wahl bzw. als Dopaminrezeptoragonisten der zweiten Wahl. Diese zehn Wirkstoffe sind seit 2011 in Deutschland zugelassen. [13,52] Apomorphin ist einer der ältesten und stärkesten Dopaminagonisten. Die räumliche Struktur ist geprägt als Morphinderivat, in welches ein dem L-DOPA ähnliches Molekül eingebettet ist. Dieses Molekül ist für die gemischte Wirkung an den D1- und an den D2-Rezeptoren verantwortlich. Die Morphinderivat- Struktur hat weder eine narkotische Wirkung noch ein Abhängigkeitspotenzial. [47] Abbildung 4.4: Pergolid vertretet die Ergoline, Pramipexol die Non-Ergoline. Die Ergoline, als Derivate der Lysergsäure, enthalten ihre Strukturformeln in versteckter Form das Dopaminmolekül (durch rote Farbe im Pergolidmolekül gekennzeichnet [16] Pharmakodynamisch stellen sie eine gute Alternative zur L-DOPA-Therapie dar, da sie von der metabolischen Kapazität der dopaminergen Nervenendigungen unabhängig sind. Weiters haben sie eine verlängerte Wirkungsdauer, sodass die On-Off-Symptomatik gemildert wird. Sie müssen auch nicht in eine wirksame Form umgewandelt werden. Das hat jedoch wieder zum Nachteil, dass sie auch in der Peripherie direkt wirksam sind und mehr Nebenwirkungen verursachen. Sie stimulieren vorwiegend striatale D2- und D3-Dopaminrezeptoren. Wobei die Affinität zu den D2 am größten ist und nach wie vor Unklarheit herrscht, ob die zusätzliche Aktivität an D1- oder D3-Rezeptoren therapeutische Vorteile bringt. Die einzelnen Substanzen der Dopaminagonisten unterscheiden sich in ihrer Halbwertszeit, ihrem Metabolismus, ihrer Aktivität an Dopaminrezeptoren sowie in ihrem Nebenwirkungsprofil. [13, 52] Bromocriptin ist einerseits ein Agonist an D2-Rezeptoren und hemmt andererseits die Prolactin-Freisetzung. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Indikationen wie Beendigung der Laktation, Galaktorrhoe und Prolactin-sezernierende Hypophysentumore. Pergolid wirkt an D1- und D2-Rezeptoren und ist strukturverwandt mit Bromocriptin. Ropinirol und Pramipexol, die Non-Ergot -Derivate, besitzen hohe Affinitäten zu D2- und D3-Rezeptoren. [13] 21
28 Die Halbwertszeiten variieren zwischen 2 Stunden bei Lisurid, bis 6-12 Stunden bei Bromocriptin, Pergolid, Ropirinol und Pramipexol. Cabergolin hat sogar eine Halbwertszeit von zirka 60 Stunden. Durch die längere Wirkungsdauer ist die Rezeptorstimulation gleichmäßiger und führt zu weniger stark fluktuierenden Symptomen. Diese typischen Langzeitkomplikationen von L-DOPA können somit durch die zusätzliche Gabe von Dopaminagonisten gemildert werden. Bei subkutan appliziertem Apomorphin tritt die Wirkung durchschnittlich nach 10 Minuten ein und dauert weitere 45 Minuten an. [47] Die Ausscheidung erfolgt von den Non-Ergot -Derivaten über die Niere, die der Ergotalkaloide über die Leber. [13] Therapeutische Verwendung Dopaminagonisten können entweder als Monotherapie oder auch in Kombination mit jeder anderen Form von pharmakologischer Parkinson-Therapie eingesetzt werden. Sie sind sowohl bei de-novo-patienten als auch im Spätstadium indiziert. Allerdings stellt im fortgeschrittenen Stadium eine kognitive Dysfunktion oder Demenz eine relative Kontraindikation dar, da die Dopaminagonisten das Auftreten von Halluzinationen fördern und verstärken können. Die Entscheidung, welcher Wirkstoff in welcher Erkrankungsphase eingesetzt wird, ist individuell zu entscheiden. Wobei die unterschiedlichen Halbwertszeiten eine eher untergeordnete Rolle spielen. Sie werden oft in der Anfangsphase als Monotherapie eingesetzt, da dadurch der Einsatz von L-DOPA auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden kann und damit die Entwicklung von Dyskinesien unter L-DOPA eventuell verzögert wird. Prinzipiell wird heute empfohlen Parkinson-Patienten unter 55a mit Dopaminrezeptoragonisten zu behandeln. Im direkten Vergleich zur L-DOPA-Monotherapie kommt es in den ersten 3-5 Jahren unter Dopaminrezeptoragonisten seltener zu Dyskinesien, jedoch wird die Lebensqualität nach aktuellen Studien ähnlich eingestuft. Weiters wird in der Fachliteratur von Örtel W. [52] anhand der Studie (Pramipexol-Parkinson Study Group 2002a) der Schluss gezogen, dass im Langzeitverlauf die initiale Monotherapie mit Dopaminagonisten einer initialen Monotherapie mit L-DOPA, mit entsprechender Dosisanpassung, bezüglich der Inzidenz von Dyskinesien nicht überlegen ist. Auch der Verlauf der Erkrankung kann durch Dopaminagonisten nicht verzögert werden. [13, 52] Die Dosierungen und die Pharmakokinetik sind in Abbildung 4.5 dargestellt. Als orale Dopaminagonisten werden Pramipexol, Ropirinol, Rotigotin, Pergolid und Piribedil eingesetzt. Es wurde ihnen die Wirksamkeit als Monotherapie in plazebokontrollierten Studien nachgewiesen. Wobei für Pramipexol und Ropirinol auch in der frühen Kombinationstherapie mit L-DOPA und zur Minderung von Fluktuationen unter langjähriger L-DOPA-Therapie eine positive Wirkung nachgewiesen wurde. Pramipexol und Ropirinol stehen auch als Retardpräparationen zur Verfügung. Dadurch kann die Einnahme auf einmal täglich reduziert werden, was wiederum der soge- 22
Cindy Former & Jonas Schweikhard
 Cindy Former & Jonas Schweikhard Definition Krankheitsbild Entdeckung Ursachen Biochemische Grundlagen Diagnostik Therapie Quellen Morbus Parkinson ist eine chronisch progressive neurodegenerative Erkrankung
Cindy Former & Jonas Schweikhard Definition Krankheitsbild Entdeckung Ursachen Biochemische Grundlagen Diagnostik Therapie Quellen Morbus Parkinson ist eine chronisch progressive neurodegenerative Erkrankung
Wie können wir in Zukunft diese Fragen beantworten?
 Parkinson Krankheit: Diagnose kommt sie zu spät? Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder Mannheim (23. September 2010) - Die Frage, ob derzeit die Diagnosestellung einer Parkinson-Erkrankung zu spät kommt,
Parkinson Krankheit: Diagnose kommt sie zu spät? Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder Mannheim (23. September 2010) - Die Frage, ob derzeit die Diagnosestellung einer Parkinson-Erkrankung zu spät kommt,
Die vielen Gesichter des Parkinson
 Die vielen Gesichter des Parkinson Prof. Rudolf Töpper Asklepios Klinik Harburg Sylt Harburg (Hamburg) Falkenstein Ini Hannover Bad Griesbach Sichtweisen der Erkrankung Klinik Hamburg-Harburg typischer
Die vielen Gesichter des Parkinson Prof. Rudolf Töpper Asklepios Klinik Harburg Sylt Harburg (Hamburg) Falkenstein Ini Hannover Bad Griesbach Sichtweisen der Erkrankung Klinik Hamburg-Harburg typischer
Leitlinien orientierte Parkinson-Therapie
 Leitlinien orientierte Parkinson-Therapie Auf was muss man achten? Prof. Dr. Wolfgang Greulich Leitlinien orientierte Parkinson-Therapie 2016 Leitlinien 2016 Parkinson-Syndrome Klassifikation 1. Idiopathisches
Leitlinien orientierte Parkinson-Therapie Auf was muss man achten? Prof. Dr. Wolfgang Greulich Leitlinien orientierte Parkinson-Therapie 2016 Leitlinien 2016 Parkinson-Syndrome Klassifikation 1. Idiopathisches
Medikamentöse Behandlung bei motorischen Komplikationen in der Spätphase der Parkinsonerkrankung
 Medikamentöse Behandlung bei motorischen Komplikationen in der Spätphase der Parkinsonerkrankung Daniela Berg Zentrum für Neurologie und Hertie-Institut für Klinische Hirnforschung Universität Tübingen
Medikamentöse Behandlung bei motorischen Komplikationen in der Spätphase der Parkinsonerkrankung Daniela Berg Zentrum für Neurologie und Hertie-Institut für Klinische Hirnforschung Universität Tübingen
15. Informationstagung der Reha Rheinfelden. Pharmakotherapie des idiopathischen Parkinsonsyndroms
 15. Informationstagung der Reha Rheinfelden Pharmakotherapie des idiopathischen Parkinsonsyndroms Dr. med. Florian von Raison, assoziierter Arzt, Neurologische Klinik, Universitätsspital (USB) Donnerstag,
15. Informationstagung der Reha Rheinfelden Pharmakotherapie des idiopathischen Parkinsonsyndroms Dr. med. Florian von Raison, assoziierter Arzt, Neurologische Klinik, Universitätsspital (USB) Donnerstag,
Parkinson häufig von Depression und Demenz begleitet
 ENS 2013: Neurologen tagen in Barcelona Parkinson häufig von Depression und Demenz begleitet Barcelona, Spanien (9. Juni 2013) - Morbus Parkinson ist im fortgeschrittenen Stadium oft von Demenz oder Depression
ENS 2013: Neurologen tagen in Barcelona Parkinson häufig von Depression und Demenz begleitet Barcelona, Spanien (9. Juni 2013) - Morbus Parkinson ist im fortgeschrittenen Stadium oft von Demenz oder Depression
Symptome und Diagnosestellung des Morbus Parkinson
 meine Hand zittert habe ich etwa Parkinson? Symptome und Diagnosestellung des Morbus Parkinson Dr. med. Sabine Skodda Oberärztin Neurologische Klinik Morbus Parkinson chronisch fortschreitende neurodegenerative
meine Hand zittert habe ich etwa Parkinson? Symptome und Diagnosestellung des Morbus Parkinson Dr. med. Sabine Skodda Oberärztin Neurologische Klinik Morbus Parkinson chronisch fortschreitende neurodegenerative
Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme
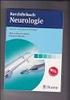 Morbus Parkinson 2 Morbus Parkinson Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Eigene Bilder Morbus Parkinson 4 Morbus Parkinson 3 Was ist Parkinson?» Die
Morbus Parkinson 2 Morbus Parkinson Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Eigene Bilder Morbus Parkinson 4 Morbus Parkinson 3 Was ist Parkinson?» Die
INHALT TEIL 1 ALLGEMEINER TEIL... 17
 TEIL 1 ALLGEMEINER TEIL... 17 DEFINITION... 18 Was ist die Parkinson-Krankheit?... 18 Was sind die ersten Anzeichen?... 19 Wer diagnostiziert Parkinson?... 19 Seit wann kennt man Parkinson?... 20 SYMPTOME...22
TEIL 1 ALLGEMEINER TEIL... 17 DEFINITION... 18 Was ist die Parkinson-Krankheit?... 18 Was sind die ersten Anzeichen?... 19 Wer diagnostiziert Parkinson?... 19 Seit wann kennt man Parkinson?... 20 SYMPTOME...22
PARKINSON. Die Krankheit verstehen und bewältigen. Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder
 Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder PARKINSON Die Krankheit verstehen und bewältigen Unter Mitarbeit von: Dr. med. Manfred Georg Krukemeyer Prof. Dr. med. Gunnar Möllenhoff Dipl.-Psych. Dr. Ellen Trautmann
Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder PARKINSON Die Krankheit verstehen und bewältigen Unter Mitarbeit von: Dr. med. Manfred Georg Krukemeyer Prof. Dr. med. Gunnar Möllenhoff Dipl.-Psych. Dr. Ellen Trautmann
in der industrialisierten Welt stark ansteigt und auch weiter ansteigen wird, ist mit einer weiteren Zunahme der Zahl der Betroffenen
 Vorwort Der Morbus Parkinson, also die Parkinson sche Krankheit (lat. Morbus = Krankheit), ist eine häufige neurologische Krankheit. Mit höherem Lebensalter steigt die Wahrscheinlichkeit, an dieser Erkrankung
Vorwort Der Morbus Parkinson, also die Parkinson sche Krankheit (lat. Morbus = Krankheit), ist eine häufige neurologische Krankheit. Mit höherem Lebensalter steigt die Wahrscheinlichkeit, an dieser Erkrankung
Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters
 Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters J. Bufler Neurologische Klinik des ISK Wasserburg Präsentation, Stand November 2008, Martin Spuckti Seite 1 Vier Giganten der Geriatrie
Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters J. Bufler Neurologische Klinik des ISK Wasserburg Präsentation, Stand November 2008, Martin Spuckti Seite 1 Vier Giganten der Geriatrie
Die Parkinson Krankheit. Diagnostik und Therapie
 Die Parkinson Krankheit Diagnostik und Therapie Was bedeutet eigentlich Parkinson? James Parkinson stellte bei seinen Patienten ein auffälliges Zittern der Hände fest und bezeichnete die Krankheit als
Die Parkinson Krankheit Diagnostik und Therapie Was bedeutet eigentlich Parkinson? James Parkinson stellte bei seinen Patienten ein auffälliges Zittern der Hände fest und bezeichnete die Krankheit als
Es gibt verschiedene Neurotransmitter und für jeden Neurotransmitter gibt es eigene, spezifische Rezeptoren.
 MORBUS PARKINSON neu dargestellt von Edwin H. Bessai Im Gehirn (wie im gesamten Nervensystem) werden die Impulse von Zelle zu Zelle übertragen. Die Zellen sind miteinander durch Kontaktstellen, sog. Synapsen,
MORBUS PARKINSON neu dargestellt von Edwin H. Bessai Im Gehirn (wie im gesamten Nervensystem) werden die Impulse von Zelle zu Zelle übertragen. Die Zellen sind miteinander durch Kontaktstellen, sog. Synapsen,
Nichtmotorische Störungen bei Parkinsonkrankheit
 Nichtmotorische Störungen bei Parkinsonkrankheit Selbsthilfegruppe Parkinson Landkreis Ebersberg Gasthof Altschütz 12.10.11 Dr. Claus Briesenick Neurologe und Psychiater, Baldham Definition Die Parkinsonkrankheit
Nichtmotorische Störungen bei Parkinsonkrankheit Selbsthilfegruppe Parkinson Landkreis Ebersberg Gasthof Altschütz 12.10.11 Dr. Claus Briesenick Neurologe und Psychiater, Baldham Definition Die Parkinsonkrankheit
Die Parkinson Krankheit. Diagnostik und Therapie
 Die Parkinson Krankheit Diagnostik und Therapie Was bedeutet eigentlich Parkinson? James Parkinson stellte bei seinen Patienten ein auffälliges Zittern der Hände fest und bezeichnete die Krankheit als
Die Parkinson Krankheit Diagnostik und Therapie Was bedeutet eigentlich Parkinson? James Parkinson stellte bei seinen Patienten ein auffälliges Zittern der Hände fest und bezeichnete die Krankheit als
Tiefe Hirnstimulation bei Bewegungsstörungen. Klinik für Neurologie Klinik für Neurochirurgie
 Tiefe Hirnstimulation bei Bewegungsstörungen Klinik für Neurologie Klinik für Neurochirurgie Bewegungsstörung Die Parkinson Krankheit (Morbus Parkinson) zählt zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen
Tiefe Hirnstimulation bei Bewegungsstörungen Klinik für Neurologie Klinik für Neurochirurgie Bewegungsstörung Die Parkinson Krankheit (Morbus Parkinson) zählt zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen
Vorwort. Abkürzungsverzeichnis. 1 'Anatomie und Physiologie der Gedächtnisfunktion. 1.1 Anatomische Grundlagen des Gedächtnisses 2
 i Inhaltsverzeichnis Vorwort Abkürzungsverzeichnis V XIII TEIL A Demenz 1 'Anatomie und Physiologie der Gedächtnisfunktion 1.1 Anatomische Grundlagen des Gedächtnisses 2 1.2 Funktionen des Gedächtnisses
i Inhaltsverzeichnis Vorwort Abkürzungsverzeichnis V XIII TEIL A Demenz 1 'Anatomie und Physiologie der Gedächtnisfunktion 1.1 Anatomische Grundlagen des Gedächtnisses 2 1.2 Funktionen des Gedächtnisses
Kasuistische Beiträge zur modernen Pharmakotherapie mit Quetiapin
 Kasuistische Beiträge zur modernen Pharmakotherapie mit Quetiapin Hans-Peter Volz Siegfried Kasper Hans-Jürgen Möller Inhalt Vorwort 17 A Allgemeiner Teil Stürmiücn (I l.-.l. 1.1 Extrapyramidal-motorische
Kasuistische Beiträge zur modernen Pharmakotherapie mit Quetiapin Hans-Peter Volz Siegfried Kasper Hans-Jürgen Möller Inhalt Vorwort 17 A Allgemeiner Teil Stürmiücn (I l.-.l. 1.1 Extrapyramidal-motorische
Naturprodukt AtreMorine kann Parkinsonpatienten. Spanische Wissenschaftler finden heraus!
 Naturprodukt AtreMorine kann Parkinsonpatienten helfen? Spanische Wissenschaftler finden heraus! Datum : 18/11/2016 Ramón Cacabelos, Experte für neurodegenerative Erkrankungen und genomische Medizin, und
Naturprodukt AtreMorine kann Parkinsonpatienten helfen? Spanische Wissenschaftler finden heraus! Datum : 18/11/2016 Ramón Cacabelos, Experte für neurodegenerative Erkrankungen und genomische Medizin, und
Neue Wege in der Parkinsontherapie? Update Neurologie 2016
 Neue Wege in der Parkinsontherapie? Update Neurologie 2016 Tobias Warnecke Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Übersicht 1 Pharmakotherapie
Neue Wege in der Parkinsontherapie? Update Neurologie 2016 Tobias Warnecke Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Übersicht 1 Pharmakotherapie
Beurteilung der striatalen Dopamin-D2-Rezeptorblockade durch Neuroleptika mit Hilfe der
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Nuklearmedizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktorin: Frau Prof. Dr. med. habil. T. Mende Beurteilung der striatalen Dopamin-D2-Rezeptorblockade
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Nuklearmedizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktorin: Frau Prof. Dr. med. habil. T. Mende Beurteilung der striatalen Dopamin-D2-Rezeptorblockade
Behandlung nicht-motorischer. Beschwerden
 Düsseldorfer Patienten-Seminar Parkinson Behandlung nicht-motorischer Stefan Groiß Klinik für Neurologie Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Beschwerden 19.04.2008 Nicht-motorische Symptome Für die Lebensqualität
Düsseldorfer Patienten-Seminar Parkinson Behandlung nicht-motorischer Stefan Groiß Klinik für Neurologie Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Beschwerden 19.04.2008 Nicht-motorische Symptome Für die Lebensqualität
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
 Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Die Behandlung der Parkinson-Erkrankung setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Dazu gehört zunächst eine Aufklärung
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Die Behandlung der Parkinson-Erkrankung setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Dazu gehört zunächst eine Aufklärung
Kein Hinweis für eine andere Ursache der Demenz
 die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
Versorgung von Patienten mit Tiefer Hirnstimulation in Dülmen. Neurologische Klinik Dülmen - Christophorus-Kliniken
 in Dülmen Neurologische Klinik Dülmen - Christophorus-Kliniken 1 in der Neurologischen Klinik Dülmen 1.Einleitung 2.Der geeignete Patient für die Tiefe Hirnstimulation 3.Vorbereitung vor der Operation
in Dülmen Neurologische Klinik Dülmen - Christophorus-Kliniken 1 in der Neurologischen Klinik Dülmen 1.Einleitung 2.Der geeignete Patient für die Tiefe Hirnstimulation 3.Vorbereitung vor der Operation
Parkinson-Syndrom Definition
 Definition Symptomkomplex aus Hypo- oder Akinese Rigor und Ruhetremor. Ätiologie Zwei Hauptformen des Parkinson-Syndroms werden unterschieden: Beim Morbus Parkinson (idiopathisches Parkinson- Syndrom,
Definition Symptomkomplex aus Hypo- oder Akinese Rigor und Ruhetremor. Ätiologie Zwei Hauptformen des Parkinson-Syndroms werden unterschieden: Beim Morbus Parkinson (idiopathisches Parkinson- Syndrom,
Morbus Parkinson Ratgeber
 Morbus Parkinson Ratgeber Impressum Zarenga GmbH, Bonn 2015 Zarenga GmbH, Pfaffenweg 15, 53227 Bonn Alle Rechte sind vorbehalten. Dieses Buch, einschließlich seiner einzelnen Teile ist urheberrechtlich
Morbus Parkinson Ratgeber Impressum Zarenga GmbH, Bonn 2015 Zarenga GmbH, Pfaffenweg 15, 53227 Bonn Alle Rechte sind vorbehalten. Dieses Buch, einschließlich seiner einzelnen Teile ist urheberrechtlich
Parkinson-Syndrome Parkinson-Syndrome Themen dieses Vortrags: 1.) Überblick über Parkinson-Syndrome 2.) Morbus Parkinson Pathophysiologie
 Parkinson-Syndrome Parkinson-Syndrome Themen dieses Vortrags: 1.) Überblick über Parkinson-Syndrome 2.) Morbus Parkinson - Pathophysiologie - Epidemiologie - Symptome - Diagnostik - Therapie 3.) Parkinson-plus
Parkinson-Syndrome Parkinson-Syndrome Themen dieses Vortrags: 1.) Überblick über Parkinson-Syndrome 2.) Morbus Parkinson - Pathophysiologie - Epidemiologie - Symptome - Diagnostik - Therapie 3.) Parkinson-plus
Basalganglien: Pharmakotherapie des Morbus Parkinson. Morbus Parkinson. M. Parkinson: 1% der über 65-jährigen
 Pharmakotherapie des Morbus Parkinson M. Parkinson: 1% der über 65-jährigen 1817 Parkinson: Paralysis agitans 1960 Hornykiewicz: Dopaminmangel ( 80% symptomatisch) Einführung der L-DOPA-Therapie 1982 Californische
Pharmakotherapie des Morbus Parkinson M. Parkinson: 1% der über 65-jährigen 1817 Parkinson: Paralysis agitans 1960 Hornykiewicz: Dopaminmangel ( 80% symptomatisch) Einführung der L-DOPA-Therapie 1982 Californische
Behandlung: Medikamente und Chirurgie
 Parkinson Krankheit Behandlung: Medikamente und Chirurgie Parkinson Weiterbildung 14. November 2014 Priv. Doz. Dr. H. Grehl Neurologische Klinik Evangelisches Klinikum Niederrhein Duisburg 2 Diagnosestellung!
Parkinson Krankheit Behandlung: Medikamente und Chirurgie Parkinson Weiterbildung 14. November 2014 Priv. Doz. Dr. H. Grehl Neurologische Klinik Evangelisches Klinikum Niederrhein Duisburg 2 Diagnosestellung!
M. Parkinson Ursache und Diagnose
 M. Parkinson Ursache und Diagnose Historisches Häufigkeit Diagnose Manifestationstypen Ähnliche Krankheiten Ursache(n) Zusatzuntersuchungen Prof. Dr. med. Helmut Buchner und klinische Neurophysiologie
M. Parkinson Ursache und Diagnose Historisches Häufigkeit Diagnose Manifestationstypen Ähnliche Krankheiten Ursache(n) Zusatzuntersuchungen Prof. Dr. med. Helmut Buchner und klinische Neurophysiologie
Patienten können von früherem Behandlungsbeginn profitieren
 Morbus Parkinson Patienten können von früherem Behandlungsbeginn profitieren Düsseldorf (24. September 2015) - Erhaltung der Selbstständigkeit in den Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) und der gesundheitsbezogenen
Morbus Parkinson Patienten können von früherem Behandlungsbeginn profitieren Düsseldorf (24. September 2015) - Erhaltung der Selbstständigkeit in den Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) und der gesundheitsbezogenen
Herausforderungen für Klinik und Praxis
 Therapie des Morbus Parkinson Herausforderungen für Klinik und Praxis Würzburg (15. März 2013) - Das idiopathische Parkinson Syndrom ist weit mehr als nur eine Bewegungsstörung. Nicht-motorische Symptome
Therapie des Morbus Parkinson Herausforderungen für Klinik und Praxis Würzburg (15. März 2013) - Das idiopathische Parkinson Syndrom ist weit mehr als nur eine Bewegungsstörung. Nicht-motorische Symptome
Pharmakologie und Toxikologie für Naturwissenschaftler SS Neurotransmitter. Dopamin (DA) Dopaminerge Synapsen. Pharmaka:
 Pharmakologie und Toxikologie für Naturwissenschaftler SS 2016 Neurotransmitter Dopamin (DA) Dopaminerge Synapsen Pharmaka: A: Anti-Parkinson-Mittel, B: Antipsychotika(Neuroleptika) Klaus Resch Institut
Pharmakologie und Toxikologie für Naturwissenschaftler SS 2016 Neurotransmitter Dopamin (DA) Dopaminerge Synapsen Pharmaka: A: Anti-Parkinson-Mittel, B: Antipsychotika(Neuroleptika) Klaus Resch Institut
Vorbote von Parkinson-Krankheit und Lewy-Körper-Demenz
 Schlafstörung IRBD Vorbote von Parkinson-Krankheit und Lewy-Körper-Demenz Berlin (3. Juni 2013) - Die Langzeitbeobachtung von 44 Patienten mit der seltenen Traum-Schlafverhaltensstörung IRBD (Idiopathic
Schlafstörung IRBD Vorbote von Parkinson-Krankheit und Lewy-Körper-Demenz Berlin (3. Juni 2013) - Die Langzeitbeobachtung von 44 Patienten mit der seltenen Traum-Schlafverhaltensstörung IRBD (Idiopathic
Möglichkeiten zur Optimierung der Parkinson-Therapie
 Möglichkeiten zur Optimierung der Parkinson-Therapie Proceedings vom 9th /nt. Symposium on Parkinsan 's Disease, 5. - 9. Juni 1988 in Jerusalem Unter Mitarbeit von P. Clarenbach, J. Haan, B. Hofferberth,
Möglichkeiten zur Optimierung der Parkinson-Therapie Proceedings vom 9th /nt. Symposium on Parkinsan 's Disease, 5. - 9. Juni 1988 in Jerusalem Unter Mitarbeit von P. Clarenbach, J. Haan, B. Hofferberth,
Ursachen, Klinik, Klassifikation und Pharmakotherapie des Parkinson-Syndroms. (a Abb. 1). Dabei enthalten die
 Schwerpunkt Parkinson 103 Ursachen, Klinik, Klassifikation und Pharmakotherapie des Parkinson-Syndroms Etwa ein bis zwei Prozent der Bevölkerung über 65 Jahren leiden an der Parkinson- Krankheit, die im
Schwerpunkt Parkinson 103 Ursachen, Klinik, Klassifikation und Pharmakotherapie des Parkinson-Syndroms Etwa ein bis zwei Prozent der Bevölkerung über 65 Jahren leiden an der Parkinson- Krankheit, die im
Aktivierende Therapien bei Parkinson-Syndromen
 Aktivierende Therapien bei Parkinson-Syndromen Bearbeitet von Andres O. Ceballos-Baumann, Georg Ebersbach 3., aktualisierte Auflage. 2017. Buch. 140 S. Gebunden ISBN 978 3 13 241186 9 Format (B x L): 17
Aktivierende Therapien bei Parkinson-Syndromen Bearbeitet von Andres O. Ceballos-Baumann, Georg Ebersbach 3., aktualisierte Auflage. 2017. Buch. 140 S. Gebunden ISBN 978 3 13 241186 9 Format (B x L): 17
Historisches. Schwäche und Tremor. Übergreifen auf die Gegenseite Feinmotorische Störungen (Schreiben, Knöpfen etc.) Haltungs- und Gangstörungen
 M. Parkinson Ursache Diagnose - Behandlung Historisches Häufigkeit Diagnose Manifestationstypen Ähnliche Krankheiten Ursache(n) Zusatzuntersuchungen Behandlung Prof. Dr. med. Helmut Buchner und klinische
M. Parkinson Ursache Diagnose - Behandlung Historisches Häufigkeit Diagnose Manifestationstypen Ähnliche Krankheiten Ursache(n) Zusatzuntersuchungen Behandlung Prof. Dr. med. Helmut Buchner und klinische
Möglichkeiten und Grenzen der stationären Behandlung bei Demenzerkrankten
 Möglichkeiten und Grenzen der stationären Behandlung Dr. med. Hans-Dietrich Ehrenthal Seite 1 Von der Alterspyramide zum Alterspilz Seite 2 Multimorbidität im Alter Alter / Anzahl körperl. Störungen 0
Möglichkeiten und Grenzen der stationären Behandlung Dr. med. Hans-Dietrich Ehrenthal Seite 1 Von der Alterspyramide zum Alterspilz Seite 2 Multimorbidität im Alter Alter / Anzahl körperl. Störungen 0
Geschichte. Epidemiologie. Pathologie. Pathogenese. Pathologie. James Parkinson ( ) Englischer Arzt und Paläontologe
 23.5.29 Geschichte James Parkinson (755 82) Englischer Arzt und Paläontologe An Essay on the Shaking Palsy (87) Parkinson'sche Erkranung wurde zuerst von dem französichen Neurologen Jean-Martin Charcot
23.5.29 Geschichte James Parkinson (755 82) Englischer Arzt und Paläontologe An Essay on the Shaking Palsy (87) Parkinson'sche Erkranung wurde zuerst von dem französichen Neurologen Jean-Martin Charcot
Biologische Psychologie II
 Parkinson-Erkrankung: Ca. 0,5% der Bevölkerung leidet an dieser Krankheit, die bei Männern ungefähr 2,5 Mal häufiger auftritt als bei Frauen! Die Krankheit beginnt mit leichter Steifheit oder Zittern der
Parkinson-Erkrankung: Ca. 0,5% der Bevölkerung leidet an dieser Krankheit, die bei Männern ungefähr 2,5 Mal häufiger auftritt als bei Frauen! Die Krankheit beginnt mit leichter Steifheit oder Zittern der
Alzheimer-Krankheit: Antworten auf die häufigsten Fragen
 Dr. med. Günter Krämer Alzheimer-Krankheit: Antworten auf die häufigsten Fragen Hilfreiche Informationen für Interessierte und Betroffene TRIAS i Inhalt i Zu diesem Buch Benennung und Einordnung Was ist
Dr. med. Günter Krämer Alzheimer-Krankheit: Antworten auf die häufigsten Fragen Hilfreiche Informationen für Interessierte und Betroffene TRIAS i Inhalt i Zu diesem Buch Benennung und Einordnung Was ist
Parkinson. durch Medikamente. Dr. Ilona Csoti, Ärztliche Direktorin. Patienteninformation. Praxisstempel Stand April 2010
 www.desitin.de Parkinson symptome durch Medikamente Praxisstempel Patienteninformation 213100 Stand April 2010 Dr. Ilona Csoti, Ärztliche Direktorin Liebe Leserin, lieber Leser, das vorliegende Informationsblatt
www.desitin.de Parkinson symptome durch Medikamente Praxisstempel Patienteninformation 213100 Stand April 2010 Dr. Ilona Csoti, Ärztliche Direktorin Liebe Leserin, lieber Leser, das vorliegende Informationsblatt
Tiefe Hirnstimulation - Wann ist eine Operation sinnvoll. Florian Hatz Ethan Taub
 Tiefe Hirnstimulation - Wann ist eine Operation sinnvoll Florian Hatz Ethan Taub Parkinson-Erkrankung Parkinson-Erkrankung Dopaminkonzentration Im Gehirn Therapie - Wirkung Dauer -> Dopaminkonzentration
Tiefe Hirnstimulation - Wann ist eine Operation sinnvoll Florian Hatz Ethan Taub Parkinson-Erkrankung Parkinson-Erkrankung Dopaminkonzentration Im Gehirn Therapie - Wirkung Dauer -> Dopaminkonzentration
Die Parkinson-Krankheit
 Die Parkinson-Krankheit Grundlagen, Klinik, Therapie Bearbeitet von Manfred Gerlach, Heinz Reichmann, Peter Riederer Neuausgabe 2007. Buch. xxi, 453 S. Hardcover ISBN 978 3 211 48307 7 Format (B x L):
Die Parkinson-Krankheit Grundlagen, Klinik, Therapie Bearbeitet von Manfred Gerlach, Heinz Reichmann, Peter Riederer Neuausgabe 2007. Buch. xxi, 453 S. Hardcover ISBN 978 3 211 48307 7 Format (B x L):
Restless legs - Syndrom. Stefan Weis, Neckarsulm
 Restless legs - Syndrom Stefan Weis, Neckarsulm Kurzbeschreibung I Das Restless-Legs-Syndrom ist eine chronisch-progrediente Erkrankung mit sehr variabler klinischer Ausprägung von milden, intermittierenden
Restless legs - Syndrom Stefan Weis, Neckarsulm Kurzbeschreibung I Das Restless-Legs-Syndrom ist eine chronisch-progrediente Erkrankung mit sehr variabler klinischer Ausprägung von milden, intermittierenden
Zusammenfassung in deutscher Sprache
 Zusammenfassung in deutscher Sprache Zusammenfassung Man schätzt, dass in den Niederlanden einer von 200 Erwachsenen (=60.000) eine verborgene Nierenschädigung hat. Ungefähr 40.000 Menschen sind bekennt
Zusammenfassung in deutscher Sprache Zusammenfassung Man schätzt, dass in den Niederlanden einer von 200 Erwachsenen (=60.000) eine verborgene Nierenschädigung hat. Ungefähr 40.000 Menschen sind bekennt
1.1 WAS IST EINE DEMENZ?
 1.1 WAS IST EINE DEMENZ? Derzeit leiden in Deutschland etwa 1,6 Millionen Menschen an Demenz Tendenz steigend. Demenzen treten überwiegend in der zweiten Lebenshälfte auf. Ihre Häufigkeit nimmt mit steigendem
1.1 WAS IST EINE DEMENZ? Derzeit leiden in Deutschland etwa 1,6 Millionen Menschen an Demenz Tendenz steigend. Demenzen treten überwiegend in der zweiten Lebenshälfte auf. Ihre Häufigkeit nimmt mit steigendem
individualisierten Therapie
 Gastrointestinale Störungen bei Morbus Parkinson: Herausforderung für Klinik und Praxis in der individu Gastrointestinale Störungen bei Morbus Parkinson Herausforderung für Klinik und Praxis in der individualisierten
Gastrointestinale Störungen bei Morbus Parkinson: Herausforderung für Klinik und Praxis in der individu Gastrointestinale Störungen bei Morbus Parkinson Herausforderung für Klinik und Praxis in der individualisierten
neurologische Grundlagen Version 1.3
 neurologische Grundlagen Version 1.3 ÜBERBLICK: Neurone, Synapsen, Neurotransmitter Neurologische Grundlagen Zentrale Vegetatives Peripheres Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn
neurologische Grundlagen Version 1.3 ÜBERBLICK: Neurone, Synapsen, Neurotransmitter Neurologische Grundlagen Zentrale Vegetatives Peripheres Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn
M. Parkinson. Diagnostik und Therapie. Definitionen
 M. Parkinson Diagnostik und Prof. Dr. med. Markus Jüptner Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie Wallstr. 3, 45468 Mülheim Tel.: 0208 / 47 97 17 Fax: 0208 / 444 36 41 Mail: Praxis@JueptnerMH.de
M. Parkinson Diagnostik und Prof. Dr. med. Markus Jüptner Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie Wallstr. 3, 45468 Mülheim Tel.: 0208 / 47 97 17 Fax: 0208 / 444 36 41 Mail: Praxis@JueptnerMH.de
Pathophysiologie. Klinik. Pathophysiologie. Medikamentöse Therapie. Medikamentöse Therapie
 Neurologische Klinik Dülmen Pathophysiologie Therapiestandard bei M. Parkinson Neues aus Dülmen Pablo Pérez-González Neurotransmitter für die Übertragung von Infos zwischen den Nervenzellen verantwortlich
Neurologische Klinik Dülmen Pathophysiologie Therapiestandard bei M. Parkinson Neues aus Dülmen Pablo Pérez-González Neurotransmitter für die Übertragung von Infos zwischen den Nervenzellen verantwortlich
Parkinson: Zunehmende Aufmerksamkeit für nicht-motorische Störungen eröffnet neue Therapieoptionen
 European Neurological Society (ENS) 2009: Neurologen tagen in Mailand Parkinson: Zunehmende Aufmerksamkeit für nicht-motorische Störungen eröffnet neue Therapieoptionen Mailand, Italien (22. Juni 2009)
European Neurological Society (ENS) 2009: Neurologen tagen in Mailand Parkinson: Zunehmende Aufmerksamkeit für nicht-motorische Störungen eröffnet neue Therapieoptionen Mailand, Italien (22. Juni 2009)
Block 2. Medikamentenkunde Teil 1. Übersicht Block 2. Psychopharmaka. Anxioly7ka Hypno7ka. An7depressiva. Phasenprophylak7ka. An7demen7va.
 Block 2 Medikamentenkunde Teil 1 Übersicht Block 2 F2: Schizophrenie Anamnese & Diagnostik mit Fallbeispielen F6: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen Medikamentenkunde I Neurologische Grundlagen Prüfungssimulation
Block 2 Medikamentenkunde Teil 1 Übersicht Block 2 F2: Schizophrenie Anamnese & Diagnostik mit Fallbeispielen F6: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen Medikamentenkunde I Neurologische Grundlagen Prüfungssimulation
Parkinson - Die Krankheit verstehen und bewältigen
 Parkinson - Die Krankheit verstehen und bewältigen Unter Mitarbeit von Dr. med. Manfred Georg Krukemeyer, Prof. Dr. med. Gunnar Möllenhoff und Dipl.- Psych. Dr. Ellen Trautmann Bearbeitet von Claudia Trenkwalder
Parkinson - Die Krankheit verstehen und bewältigen Unter Mitarbeit von Dr. med. Manfred Georg Krukemeyer, Prof. Dr. med. Gunnar Möllenhoff und Dipl.- Psych. Dr. Ellen Trautmann Bearbeitet von Claudia Trenkwalder
Bedeutung von MAO-B-Hemmern
 DGN-Kongress 2014: Rasagilin verlässlicher Therapiepartner im Krankheitsverlauf Individuelle Konzepte in der Parkinson-Therapie: Bedeutung von MAO-B-Hemmern München (17. September 2014) - Wie kann der
DGN-Kongress 2014: Rasagilin verlässlicher Therapiepartner im Krankheitsverlauf Individuelle Konzepte in der Parkinson-Therapie: Bedeutung von MAO-B-Hemmern München (17. September 2014) - Wie kann der
neurologische Grundlagen Version 1.3
 neurologische Version 1.3 ÜBERBLICK: Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn Rückenmark PNS VNS Hirnnerven Sympathicus Spinalnerven Parasympathicus 1 ÜBERBLICK: Neurone = Nervenzellen
neurologische Version 1.3 ÜBERBLICK: Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn Rückenmark PNS VNS Hirnnerven Sympathicus Spinalnerven Parasympathicus 1 ÜBERBLICK: Neurone = Nervenzellen
Psychopharmaka. Physiologische, pharmakologische und pharmakokinetische Grundlagen für ihre klinische Anwendung. Herausgegeben von Werner P.
 Psychopharmaka Physiologische, pharmakologische und pharmakokinetische Grundlagen für ihre klinische Anwendung Herausgegeben von Werner P. Koella Mit Beiträgen von E. Eichenberger, P.L. Herrling, U. Klotz,
Psychopharmaka Physiologische, pharmakologische und pharmakokinetische Grundlagen für ihre klinische Anwendung Herausgegeben von Werner P. Koella Mit Beiträgen von E. Eichenberger, P.L. Herrling, U. Klotz,
Multiple Systematrophie (MSA)
 1 Multiple Systematrophie (MSA) MSA vereint begrifflich folgende historisch früher beschriebene neurodegenerative Erkrankungen: - Olivopontocerebellare Atrophie - Striatonigrale Degeneration - Shy-Drager-Syndrom
1 Multiple Systematrophie (MSA) MSA vereint begrifflich folgende historisch früher beschriebene neurodegenerative Erkrankungen: - Olivopontocerebellare Atrophie - Striatonigrale Degeneration - Shy-Drager-Syndrom
Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen Diagnose
 Morbus Fabry - Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen - Vom unklaren Sympto Morbus Fabry Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen
Morbus Fabry - Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen - Vom unklaren Sympto Morbus Fabry Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen
Hirn unter Strom Therapiemöglichkeit bei M. Parkinson
 27. Jahrestagung der ÖANCK 5. 6. 2012, Seifenfabrik Graz Hirn unter Strom Therapiemöglichkeit bei M. Parkinson DGKS Nilsa Fischer Univ. Klinik Wien - AKH, Neurochirurgie Inhaltsverzeichnis:! Grundlage
27. Jahrestagung der ÖANCK 5. 6. 2012, Seifenfabrik Graz Hirn unter Strom Therapiemöglichkeit bei M. Parkinson DGKS Nilsa Fischer Univ. Klinik Wien - AKH, Neurochirurgie Inhaltsverzeichnis:! Grundlage
Parkinson: (differentielle) Diagnosis
 Parkinson: (differentielle) Diagnosis Professor Bastiaan R. Bloem Parkinson Center Nijmegen (ParC) Medizinisches Zentrum der Universität Radboud @BasBloem Teilnehmende Organisationen: Eine faszinierende
Parkinson: (differentielle) Diagnosis Professor Bastiaan R. Bloem Parkinson Center Nijmegen (ParC) Medizinisches Zentrum der Universität Radboud @BasBloem Teilnehmende Organisationen: Eine faszinierende
PARKINSON. Die Krankheit verstehen und bewältigen
 Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder PARKINSON Die Krankheit verstehen und bewältigen Unter Mitarbeit von Dr. med. Manfred Georg Krukemeyer, Priv.-Doz. Dr. med. Gunnar Möllenhoff und Dipl.-Psych. Dr. Ellen
Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder PARKINSON Die Krankheit verstehen und bewältigen Unter Mitarbeit von Dr. med. Manfred Georg Krukemeyer, Priv.-Doz. Dr. med. Gunnar Möllenhoff und Dipl.-Psych. Dr. Ellen
Prof. Dr. med. Jörn P. Sieb. Restless Legs: Endlich wieder ruhige Beine. I Mit Selbsttests zur sicheren Diagnose. I Wieder erholsam schlafen TRIAS
 Prof. Dr. med. Jörn P. Sieb Restless Legs: Endlich wieder ruhige Beine I Mit Selbsttests zur sicheren Diagnose I Wieder erholsam schlafen TRIAS Geleitworte Vorwort 8 10 Was bedeutet RLS? 14 - Die medizinische
Prof. Dr. med. Jörn P. Sieb Restless Legs: Endlich wieder ruhige Beine I Mit Selbsttests zur sicheren Diagnose I Wieder erholsam schlafen TRIAS Geleitworte Vorwort 8 10 Was bedeutet RLS? 14 - Die medizinische
Parkinson- Erkrankung
 Parkinson- Erkrankung Dr. med. Falk von Zitzewitz Neurologe und Psychiater (Nervenarzt) Schillerplatz 7 71638 Ludwigsburg Inhaltsangabe zur Parkinsonerkrankung Differentialdiagnose Parkinson- Syndrom Frühsymptomatik
Parkinson- Erkrankung Dr. med. Falk von Zitzewitz Neurologe und Psychiater (Nervenarzt) Schillerplatz 7 71638 Ludwigsburg Inhaltsangabe zur Parkinsonerkrankung Differentialdiagnose Parkinson- Syndrom Frühsymptomatik
Auf der 84. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN), die noch bis zum 1. Oktober in
 Restless-Legs-Syndrom: Ein besseres Leben ist möglich Die Qual der ruhelosen Beine ist eine kaum bekannte Volkskrankheit Wiesbaden (29. September 2011) Bis zu zehn Prozent der Bevölkerung sind von einem
Restless-Legs-Syndrom: Ein besseres Leben ist möglich Die Qual der ruhelosen Beine ist eine kaum bekannte Volkskrankheit Wiesbaden (29. September 2011) Bis zu zehn Prozent der Bevölkerung sind von einem
Rolle von PET und SPECT in der Differentialdiagnose von Parkinson- Syndromen
 Rolle von PET und SPECT in der Differentialdiagnose von Parkinson- Syndromen Rüdiger Hilker Neurowoche und DGN 2006 20.09.2006 1. Methodik nuklearmedizinischer Bildgebung 2. Biomarker-Konzept bei Parkinson-
Rolle von PET und SPECT in der Differentialdiagnose von Parkinson- Syndromen Rüdiger Hilker Neurowoche und DGN 2006 20.09.2006 1. Methodik nuklearmedizinischer Bildgebung 2. Biomarker-Konzept bei Parkinson-
DEFINITION. Seit wann kennt man Parkinson?
 DEFINITION Seit wann kennt man Parkinson? Der erste Arzt, der in moderner Zeit die Krankheit beschrieben hat, war Sir James Parkinson (1755 1824), praktischer Arzt, Apotheker, Geologe und Paläontologe
DEFINITION Seit wann kennt man Parkinson? Der erste Arzt, der in moderner Zeit die Krankheit beschrieben hat, war Sir James Parkinson (1755 1824), praktischer Arzt, Apotheker, Geologe und Paläontologe
Bildgebende Verfahren zur Erkennung von Parkinsonsyndromen
 I N F O R M A T I O N S B R O S C H Ü R E Bildgebende Verfahren zur Erkennung von Parkinsonsyndromen 4 VORWORT 5 Liebe Patientin, Lieber Patient, Verantwortlich für den Inhalt dieser Informationsbroschüre:
I N F O R M A T I O N S B R O S C H Ü R E Bildgebende Verfahren zur Erkennung von Parkinsonsyndromen 4 VORWORT 5 Liebe Patientin, Lieber Patient, Verantwortlich für den Inhalt dieser Informationsbroschüre:
Parkinson-Krankheit: Neue Leitlinie für Diagnostik und Therapie veröffentlicht
 Parkinson-Krankheit: Neue Leitlinie für Diagnostik und Therapie veröffentlicht Berlin (6. April 2016) Rechtzeitig vor dem Welt-Parkinson-Tag am 11. April veröffentlicht die Deutsche Gesellschaft für Neurologie
Parkinson-Krankheit: Neue Leitlinie für Diagnostik und Therapie veröffentlicht Berlin (6. April 2016) Rechtzeitig vor dem Welt-Parkinson-Tag am 11. April veröffentlicht die Deutsche Gesellschaft für Neurologie
Morbus Parkinson. Was gibt es Neues in Diagnostik und Therapie? Priv. Doz. Dr. Sylvia Boesch Medical University Innsbruck Innsbruck, AUSTRIA
 Morbus Parkinson Was gibt es Neues in Diagnostik und Therapie? Priv. Doz. Dr. Sylvia Boesch Medical University Innsbruck Innsbruck, AUSTRIA Motorische Kardinal -Symptome Rigor Erhöhung des Muskeltonus
Morbus Parkinson Was gibt es Neues in Diagnostik und Therapie? Priv. Doz. Dr. Sylvia Boesch Medical University Innsbruck Innsbruck, AUSTRIA Motorische Kardinal -Symptome Rigor Erhöhung des Muskeltonus
Morbus Parkinson Restless-Legs- Syndrom. Heinz Reichmann. Neurologie / Psychiatrie. Unter Berücksichtigung aktuellster. internationaler Leitlinien
 ISSN 1434-3975 43603 Nr. 71 / 2017 Mai 2017 / 7. Aulage / 7. Auflage Neurologie / Psychiatrie Heinz Reichmann Morbus Parkinson Restless-Legs- Syndrom Therapie des Morbus Parkinson Diagnosealgorithmus Schweregradeinteilung
ISSN 1434-3975 43603 Nr. 71 / 2017 Mai 2017 / 7. Aulage / 7. Auflage Neurologie / Psychiatrie Heinz Reichmann Morbus Parkinson Restless-Legs- Syndrom Therapie des Morbus Parkinson Diagnosealgorithmus Schweregradeinteilung
Früh- und Vorbotensymptome der Parkinsonerkrankung
 Früh- und Vorbotensymptome der Parkinsonerkrankung 5. Hiltruper Parkinson-Tag 20. Mai 2015 Referent: Dr. Christoph Aufenberg, Oberarzt der Klinik für Neurologie Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup Westfalenstraße
Früh- und Vorbotensymptome der Parkinsonerkrankung 5. Hiltruper Parkinson-Tag 20. Mai 2015 Referent: Dr. Christoph Aufenberg, Oberarzt der Klinik für Neurologie Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup Westfalenstraße
Pharmaka, die das Gehirn beeinflussen
 Pharmaka, die das Gehirn beeinflussen Psychopharmaka: Anxiolytika/Tranquilanzien Narkotika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antiepileptika Migränemittel Mittel zur Behandlung degenerativer Erkrankungen Angststörungen
Pharmaka, die das Gehirn beeinflussen Psychopharmaka: Anxiolytika/Tranquilanzien Narkotika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antiepileptika Migränemittel Mittel zur Behandlung degenerativer Erkrankungen Angststörungen
der Psycho pharmaka Margot Schmitz Grundlagen, Standardtherapien und neue Konzepte STEINKOPFF Unter Mitarbeit von Rainer Dorow
 Margot Schmitz LJ Grundlagen, Standardtherapien und neue Konzepte der Psycho pharmaka Unter Mitarbeit von Rainer Dorow Dritte überarbeitete und erweiterte Auflage STEINKOPFF Inhaltsverzeichnis 1 Psychopharmaka
Margot Schmitz LJ Grundlagen, Standardtherapien und neue Konzepte der Psycho pharmaka Unter Mitarbeit von Rainer Dorow Dritte überarbeitete und erweiterte Auflage STEINKOPFF Inhaltsverzeichnis 1 Psychopharmaka
Wenn Unruhe zum Alltag wird: Das Restless Legs Syndrom quält Millionen
 Wenn Unruhe zum Alltag wird: Das Restless Legs Syndrom quält Millionen Als die Symptome schlimmer wurden, war es für mich unmöglich, ein Konzert zu besuchen. Ich war unfähig still zu sitzen. Die Menschen
Wenn Unruhe zum Alltag wird: Das Restless Legs Syndrom quält Millionen Als die Symptome schlimmer wurden, war es für mich unmöglich, ein Konzert zu besuchen. Ich war unfähig still zu sitzen. Die Menschen
Alzheimer und andere Demenzformen
 Alzheimer und andere Demenzformen Antworten auf die häufigsten Fragen von Günter Krämer, Hans Förstl Neuausgabe Enke 2008 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 8304 3444 3 Zu Leseprobe schnell
Alzheimer und andere Demenzformen Antworten auf die häufigsten Fragen von Günter Krämer, Hans Förstl Neuausgabe Enke 2008 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 8304 3444 3 Zu Leseprobe schnell
Therapeutische Entscheidungen bei Patienten mit Parkinsonsyndrom
 Zürich, 24. Januar 2008 Therapeutische Entscheidungen bei Patienten mit Parkinsonsyndrom Hans-Peter Ludin hans.p.ludin@hin.ch 1 Vorbemerkung Unser Konzept der Krankheit ist im Wandel begriffen: Der Dopaminmangel
Zürich, 24. Januar 2008 Therapeutische Entscheidungen bei Patienten mit Parkinsonsyndrom Hans-Peter Ludin hans.p.ludin@hin.ch 1 Vorbemerkung Unser Konzept der Krankheit ist im Wandel begriffen: Der Dopaminmangel
Ein intensives kombiniertes Therapieprogramm für Menschen mit Morbus Parkinson bestehend aus LSVT LOUD und LSVT-BIG
 LSVT Hybrid Ein intensives kombiniertes Therapieprogramm für Menschen mit Morbus Parkinson bestehend aus LSVT LOUD und LSVT-BIG MediClin Reha-Zentrum Roter Hügel Bayreuth Fachklinik für Neurologie und
LSVT Hybrid Ein intensives kombiniertes Therapieprogramm für Menschen mit Morbus Parkinson bestehend aus LSVT LOUD und LSVT-BIG MediClin Reha-Zentrum Roter Hügel Bayreuth Fachklinik für Neurologie und
Schizophrenie. Molekulare und biochemische Ursachen neuraler Krankheiten WS 15/16 Hüsna Öztoprak, Barbara Paffendorf
 Schizophrenie Molekulare und biochemische Ursachen neuraler Krankheiten WS 15/16 Einleitung Was ist Schizophrenie? Aus dem griechischem: schizein = spalten und phren = Geist,Seele Keine Spaltung der Persönlichkeit
Schizophrenie Molekulare und biochemische Ursachen neuraler Krankheiten WS 15/16 Einleitung Was ist Schizophrenie? Aus dem griechischem: schizein = spalten und phren = Geist,Seele Keine Spaltung der Persönlichkeit
W. Beindl, Juli Multimedikation und Parkinson - Risiken minimieren, Effizienz erhöhen -
 W. Beindl, Juli 2016 Multimedikation und Parkinson - Risiken minimieren, Effizienz erhöhen - Stationäre Aufnahmen wegen Arzneimittelunfällen Metaanalyse: Howard RL et al.: Brit.J.Clin.Pharmacol.2007 Studie
W. Beindl, Juli 2016 Multimedikation und Parkinson - Risiken minimieren, Effizienz erhöhen - Stationäre Aufnahmen wegen Arzneimittelunfällen Metaanalyse: Howard RL et al.: Brit.J.Clin.Pharmacol.2007 Studie
Pharmakologie des Zentralen Nervensystems 2: Dopaminerges System
 Pharmakologie des Zentralen Nervensystems 2: Dopaminerges System Prof. Dr. Ralf Stumm Institut für Pharmakologie und Toxikologie Drackendorfer Straße 1 07747 Jena 03641 9 325680 Ralf.Stumm@med.uni-jena.de
Pharmakologie des Zentralen Nervensystems 2: Dopaminerges System Prof. Dr. Ralf Stumm Institut für Pharmakologie und Toxikologie Drackendorfer Straße 1 07747 Jena 03641 9 325680 Ralf.Stumm@med.uni-jena.de
Angststörungen. Pharmaka, die das Gehirn beeinflussen
 Pharmaka, die das Gehirn beeinflussen Psychopharmaka: Anxiolytika/Tranquilanzien Narkotika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antiepileptika Migränemittel Angststörungen phobische Störungen Agoraphobie (Platzangst),
Pharmaka, die das Gehirn beeinflussen Psychopharmaka: Anxiolytika/Tranquilanzien Narkotika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antiepileptika Migränemittel Angststörungen phobische Störungen Agoraphobie (Platzangst),
BAnz AT B5. Beschluss
 Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die utzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB V Opicapon
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die utzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB V Opicapon
Aktuelle Behandlung bei M. Parkinson: Update Früh - bis Spätphase. Prof. Dr. J. Kassubek Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum Ulm
 Aktuelle Behandlung bei M. Parkinson: Update Früh - bis Spätphase Prof. Dr. J. Kassubek Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum Ulm Hawkes et al., Parkinsonism Rel Dis 2010 Morbus Parkinson: Therapie-Prinzipien
Aktuelle Behandlung bei M. Parkinson: Update Früh - bis Spätphase Prof. Dr. J. Kassubek Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum Ulm Hawkes et al., Parkinsonism Rel Dis 2010 Morbus Parkinson: Therapie-Prinzipien
INHALTSVERZEICHNIS ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 1 1 EINLEITUNG/ZIEL DER DISSERTATION 3 2 LITERATURDISKUSSION 5
 INHALTSVERZEICHNIS Seite ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 1 1 EINLEITUNG/ZIEL DER DISSERTATION 3 2 LITERATURDISKUSSION 5 2.1 Definition der Intelligenzminderung 5 2.2 Symptome der Intelligenzminderung 5 2.3 Diagnostik
INHALTSVERZEICHNIS Seite ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 1 1 EINLEITUNG/ZIEL DER DISSERTATION 3 2 LITERATURDISKUSSION 5 2.1 Definition der Intelligenzminderung 5 2.2 Symptome der Intelligenzminderung 5 2.3 Diagnostik
Bewegungsstörungen. Demenzen. und. am Anfang war das Zittern. (movement disorders) und. Neuro-Geriatrie Fachtage in Haiger,,
 am Anfang war das Zittern Bewegungsstörungen (movement disorders) und Demenzen und Psycho-Neuro Neuro-Geriatrie Fachtage in Haiger,, 9.06.2009 Referent Alexander Simonow Neurologische Praxis, Herborn Bewegungsstörungen
am Anfang war das Zittern Bewegungsstörungen (movement disorders) und Demenzen und Psycho-Neuro Neuro-Geriatrie Fachtage in Haiger,, 9.06.2009 Referent Alexander Simonow Neurologische Praxis, Herborn Bewegungsstörungen
Die Schizophrenie und das Glutamat: Neue Medikamente jenseits vom Dopamin?
 Die Schizophrenie und das Glutamat: Neue Medikamente jenseits vom Dopamin? Prof. Dr. Walter E. Müller Department of Pharmacology Biocentre of the University 60439 Frankfurt / M Die Dopaminhypothese der
Die Schizophrenie und das Glutamat: Neue Medikamente jenseits vom Dopamin? Prof. Dr. Walter E. Müller Department of Pharmacology Biocentre of the University 60439 Frankfurt / M Die Dopaminhypothese der
Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln DR. KATALIN MÜLLNER
 Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln DR. KATALIN MÜLLNER Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln - Definition Auch als Arzneimittelinteraktionen Viele Patienten erhalten gleichzeitig mehrere Medikamente
Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln DR. KATALIN MÜLLNER Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln - Definition Auch als Arzneimittelinteraktionen Viele Patienten erhalten gleichzeitig mehrere Medikamente
REM-Schlafverhaltensstörung RBD
 RBD-Patiententag 20.07.2012 REM-Schlafverhaltensstörung RBD RBD Formen und diagnostische Probleme Prof. Dr. W. H. Oertel, Prof. Dr. G. Mayer, Prof. Dr. F. Rosenow, PD Dr. V. Ries, Dr. D. Vadasz Frau E.
RBD-Patiententag 20.07.2012 REM-Schlafverhaltensstörung RBD RBD Formen und diagnostische Probleme Prof. Dr. W. H. Oertel, Prof. Dr. G. Mayer, Prof. Dr. F. Rosenow, PD Dr. V. Ries, Dr. D. Vadasz Frau E.
Das Nervensystem. Die Unterteilung des ZNS
 Das Nervensystem Die Unterteilung des ZNS 1. Vorderhirn 1a. Telencephalon 1. Neocortex, Basalggl. Seitenventrikel (Prosencephalon) (Endhirn) limbisches System Bulbus olfact 1b. Diencephalon 2. Thalamus
Das Nervensystem Die Unterteilung des ZNS 1. Vorderhirn 1a. Telencephalon 1. Neocortex, Basalggl. Seitenventrikel (Prosencephalon) (Endhirn) limbisches System Bulbus olfact 1b. Diencephalon 2. Thalamus
Antihypertonika (allgemein)
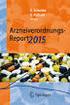 (allgemein) Beta-Blocker Beloc, Tenormin ACE-Hemmer Enac, Hypren L-Carnitin AT1-Blocker Atacand, Blopress antagonisten Verapabene, Isoptop Thiazide Fludex Speziell betroffene Wirkstoffe und Arzneimittel
(allgemein) Beta-Blocker Beloc, Tenormin ACE-Hemmer Enac, Hypren L-Carnitin AT1-Blocker Atacand, Blopress antagonisten Verapabene, Isoptop Thiazide Fludex Speziell betroffene Wirkstoffe und Arzneimittel
Inhaltsverzeichnis. 1 Einleitung Geschichtlicher Überblick Begriffsbestimmung... 5
 1 Einleitung................................................. 1 2 Geschichtlicher Überblick................................... 2 3 Begriffsbestimmung........................................ 5 4 Epidemiologie,
1 Einleitung................................................. 1 2 Geschichtlicher Überblick................................... 2 3 Begriffsbestimmung........................................ 5 4 Epidemiologie,
Therapie des Morbus Parkinson. Neues und Altbewährtes
 Therapie des Morbus Parkinson Neues und Altbewährtes 31.10.2015 PD Dr. med. Sabine Skodda Neurologische Universitätsklinik Knappschaftskrankenhaus Bochum Symptomverlauf beim Morbus Parkinson Theoretische
Therapie des Morbus Parkinson Neues und Altbewährtes 31.10.2015 PD Dr. med. Sabine Skodda Neurologische Universitätsklinik Knappschaftskrankenhaus Bochum Symptomverlauf beim Morbus Parkinson Theoretische
