Werkzeugmaschinenlabor der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Lehrstuhl für Produktionsmanagement Prof. Dr.-Ing. A.
|
|
|
- Eugen Ursler
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Werkzeugmaschinenlabor der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen Lehrstuhl für Produktionsmanagement Prof. Dr.-Ing. A. Kampker Fabrikplanung - Standortplanung II Standortstrukturplanung und Standortwahl Vorlesungsverantwortlicher: Dipl.-Ing. Thomas Gartzen Steinbachstr. 53 B Raum 516 Tel.: T.Gartzen@wzl.rwth-aachen.de Standortplanung II V 5/6 S. 0
2 Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis Seite 1 Vorlesungslandschaft Seite 2 Terminübersicht Seite 3 Gliederung der Vorlesungsreihe Seite 4 Glossar Seite 5 Ziele der Vorlesung Seite 6 Vorlesung Globale Standortentwicklung Seite 9 Vorgehensweise zur Standortplanung und -bewertung Seite 15 Gründe der Standorterschließung Seite 17 Strategische Ausrichtung Seite 18 Standortfaktoren Seite 21 Anforderungsprofil Seite 26 Modelle und Verfahren zur Auswahl, Bewertung und Auslegung von Standorten Seite 28 Grobauswahl Seite 29 Detailauswahl Seite 30 Bilanz der Vorlesung Seite 34 Fragen zur Vorlesung Seite 35 Literaturhinweise Seite 37 Standortplanung II V 5/6 S. 1
3 Vorlesungslandschaft des Lehrstuhls für Produktionssystematik Produktionsmanagement I Einführung in das Produktionsmanagement F&E, Produktplanung und Konstruktion Materialwirtschaft, Arbeitsplanung & -steuerung Unternehmens- & Prozessmodellierung Produktionsstrategien, Komplexitätsmanagement Fertigungs- und montagegerechte Konstruktion Konstruktionsaufgabe in Kleingruppe Konstruktionsbeispiele Konstruktionsrichtlinien Fabrikplanung Standortplanung Production Systems Logistik Produktionsmanagement II V1 IT im Produktionsmanagement V2 Enterprise Resource Planning I V3 Enterprise Resource Planning II V4 Enterprise Resource Planning III V5 Supply Chain Management I Trends (Gastvorlesung durch Prof. Elsenbach) V6 Supply Chain Management II V7 Supply Chain Management III V8 Product Lifecycle Management I V9 Product Lifecycle Management II V10 Digitale Fabrikplanung und Simulation V11 Customer Relationship Management V12 Business Engineering - Methodik zur Systemauswahl (Trovarit) Business Engineering Strategie und Management Unternehmensprozesse Rechnungswesen und Investitionsentscheidung Technische Investitions- Planung Fertigungsmittelplanung Technologieplanung Kostenrechnung Innovationsmanagement Integrierte Managementaufgabe Produkt- und Produktprogrammplanung Organisation und Mitarbeiterverhalten Seite 2 Standortplanung II V 5/6 S. 2
4 Terminübersicht: Fabrikplanung - Deutsch - Vorlesung: Übung: Mo, 08:00-09:30 AH III Mo, 09:45-11:15 AH III lfd. Nr. Vorlesungsthema Datum Verantwortlich V1 Einführung in die Fabrikplanung V2 Einführung in die Fabrikplanung V3 Standortplanung I - Planung des Wertschöpfungsumfangs V4 Standortplanung I - Planung des Wertschöpfungsumfangs V5 Standortplanung II - Standortplanung und Bewertung V6 Standortplanung II - Standortplanung und Bewertung V7 Production Systems I - Prozess und Ressourcenplanung V8 Production Systems I - Prozess und Ressourcenplanung Extern Vortrag - Production Systems (Lisa Dräxlmaier GmbH) V9 Production Systems II - Organisationsgestaltung und Lean Production V10 Production Systems II - Organisationsgestaltung und Lean Production V11 Logistik I - Logistikplanung V12 Logistik I - Logistikplanung V13 Logistik II - Layoutplanung V14 Logistik II - Layoutplanung Ü11/12 Logistik I - Logistikplanung Ü13/14 Logistik II - Layoutplanung V15 Highlights Hr. Nowacki Tel Hr. Nowacki Tel Hr. Kupke Tel Hr. Kupke Tel Hr. Gartzen Tel Hr. Gartzen Tel Hr. Swist Tel Hr. Swist Tel Priv. Doz. Prof. Dr. Jörg M. Elsenbach Hr. Koch Tel Hr. Koch Tel Hr. Attig Tel Hr. Attig Tel Hr. Fuchs Tel Hr. Fuchs Tel Hr. Attig Tel Hr. Fuchs Tel Hr. Nowacki Tel Standortplanung II V 5/6 S. 3
5 Gliederung der Vorlesungsreihe Fabrikplanung Anforderungen an die Fabrikplanung Einordnung in die Unternehmensplanung V1/2: Einführung Fabrikplanungsprozesse Branchenspezifika Standortplanung I, II V3/4 V5/6 Planung des Standortwahl Wertschöpfungsumfangs Make or Buy Standorttypen Verteilung von Wertschöpfungsumfängen Case: Eickhoff Produktionsnetze Production Systems I, II V7/8 V9/10 Technologie Organisation in der Prozesse Produktion Betriebsmittel Produktionsprinzipien Personal Lean Production Logistik I, II V11/12 V13/14 Beschaffungslogistik Materialfluss Produktionslogistik Distributionslogistik Layoutkonzepte Gebäude Highlights V15: Summary Beispiele V = Vorlesung Seite 4 Die Vorlesungsreihe gliedert sich in ihrem Hauptteil in die Standortplanung, die Festlegung des Produktionskonzeptes und die Definition der Logistik. Dabei umfasst die Standortplanung einerseits die Festlegung des Wertschöpfungsumfangs und andererseits die Standortwahl, wobei zu beachten ist, dass die Lebensdauer einer Fabrik viel höher ist als die eines Produktes. Aufgrund der nicht exakten Planbarkeit eines Produktes muss über ein breites Spektrum geplant werden. Die Konzeption des Production Systems schließt die Prozess- und Ressourcenplanung mit ein. Die Gestaltung der Logistik beinhaltet neben der Layoutgestaltung auch die Lagerplanung. Standortplanung II V 5/6 S. 4
6 Glossar: Wettbewerbsstrategie Ausgehend von der Gesamtunternehmensstrategie, die sich vornehmlich mit der Fokussierung auf das Betätigungsfeld des Unternehmens beschäftigt, bestimmt die Wettbewerbsstrategie die Art und Weise, mit der innerhalb dieser Betätigungsfelder der Wettbewerb bestritten werden soll. Es können dabei grundsätzlich zwei unterschiedliche Ansätze zur Erklärung von Wettbewerbsvorteilen unterschieden werden. Einerseits lassen sich Wettbewerbsvorteile auf die Ausstattung des Unternehmens mit Ressourcen zurückführen (ressourcenorientierter Ansatz), andererseits durch eine Steigerung des Kundennutzens, d.h. durch für den Kunden wichtige und von diesem auch wahrgenommene Leistungsmerkmale (marktorientierter Ansatz/ PORTER sche Wettbewerbsstrategien). PORTER sche Wettbewerbsstrategien Kostenführerschaft und Differenzierung, Konzentration auf Schwerpunkte Kostenführerschaft Ziel der Strategie der Kostenführerschaft ist es, einen relativen Kostenvorsprung gegenüber den Wettbewerbern zu erreichen. Der dadurch erzielbare Wettbewerbsvorteil liegt in der Möglichkeit, zu niedrigsten Preisen am Markt anzubieten und entsprechend eine große Kundenzahl und den damit einhergehenden Umsatz zu sichern. Differenzierung Mit der Differenzierungsstrategie wird das Ziel verfolgt, das angebotene Produkt so zu gestalten, dass es sich in den von den Abnehmern als wichtig erachteten Eigenschaften positiv von den Produkten der Wettbewerber abhebt. Dieser gestiftete Zusatznutzen bzw. die Einzigartigkeit werden entsprechend mit einer Preisprämie honoriert. Konzentration auf Schwerpunkte Die Konzentration auf Schwerpunkte zielt im Gegensatz zur Kostenführerschafts- und Differenzierungsstrategie vornehmlich auf eine engere Ausrichtung auf eine spezielle Marktnische ab, in der dann wiederum eine Entscheidung über den Typ des angestrebten Wettbewerbsvorteils (Kostenführerschaft oder Differenzierung) getroffen werden muss. Insourcing Erhöhung des eigenen Wertschöpfungsumfangs Outsourcing Verminderung des eigenen Wertschöpfungsumfangs Standortplanung II V 5/6 S. 5
7 Ziele der Vorlesung: Die globale Unternehmens- und Standortausrichtung sowie die Organisation von Produktionsnetzwerken kennen lernen. Die methodische Vorgehensweise zur Standortplanung und -bewertung erlernen. Modelle und Verfahren zur Auswahl und Bewertung von Standortalternativen beherrschen können. Standortplanung II V 5/6 S. 6
8 Standortplanung I & II V3/4 Wertschöpfung Entwicklung des Wertschöpfungsumfangs Wertschöpfungsstrukturen Wertschöpfungsdimensionen Leistungsbreite Leistungsintensität Leistungstiefe Planung des Wertschöpfungsumfangs Make-or-Buy Strategische Bewertung Wirtschaftliche Bewertung V5/6 Standortstrukturplanung Globale Standortentwicklung (Strategien/ Rollen) Ablauf der Standortplanung- und bewertung Standortwahl Standortfaktoren Anforderungsprofile Bewertungs- und Auswahlmethoden (Grob-/ Detailauswahl) Seite 7 Standortplanung II V 5/6 S. 7
9 Standortplanung II V5 Standortstrukturplanung Globale Standortentwicklung (Strategien/ Rollen) Ablauf der Standortplanung- und bewertung V6 Standortwahl Standortfaktoren Anforderungsprofile Bewertungs- und Auswahlmethoden (Grob-/ Detailauswahl) Seite 8 Standortplanung II V 5/6 S. 8
10 Gliederung 1 Globale Standortentwicklung 2 Vorgehensweise zur Standortplanung und -bewertung 3 Modelle und Verfahren zur Auswahl, Bewertung und Auslegung von Standorten Seite 9 Standortplanung II V 5/6 S. 9
11 Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit haben erfolgreiche Unternehmen neue Beschaffungs- und Absatzmärkte international erschlossen China und Indien gewinnen für Direktinvestitionen deutscher Produktionsbetriebe an Attraktivität. Quelle: Internetpräsenz Trumpf, MAG, Freudenberg, Gildemeister, 2010; Legende: Produktionsstandort Seite 10 Ein Blick auf die langfristige Entwicklung der ausländischen und deutschen Direktinvestitionen verdeutlicht den Grad der zunehmenden Internationalisierung der Produktion und der Produktionsstätten. Neben Indien verfügt China als Zielland von Direktinvestitionen im internationalen Vergleich über eine hohe Anziehungskraft. Bildeten noch in den 90er Jahren die USA das Hauptziel deutscher Direktinvestitionen, wird heute bevorzugt China als Hauptinvestitionsland gehandelt. Die Aussagen deutscher Unternehmen lassen auch für die kommenden Jahre ein hohes Investitionsvolumen der deutschen Wirtschaft in China erwarten. Der Kapitaleinsatz im Ausland führt dabei nicht zu einem Rückgang der Inlandsinvestitionen. Vielmehr weisen die im Ausland investierenden Unternehmen eine ebenso hohe Bereitschaft zum Kapitaleinsatz im Binnenland auf wie die Gesamtwirtschaft. Die inländischen Beschäftigungspläne der auslandsaktiven Industrieunternehmen sind sogar höher als im gesamtindustriellen Vergleich. Dies lässt sich zum Teil mit der im Durchschnitt besseren Geschäftslage dieser Unternehmen begründen. Das finanzielle Engagement der Unternehmen im Ausland zahlt sich häufig auch am Heimatstandort aus. Ohne ausländischen Kapitaleinsatz gerieten die Unternehmen in die Gefahr, an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren und möglicherweise ganz aus dem Markt gedrängt zu werden mit der Folge, dass auch an den Heimatstandorten ein Stellenabbau notwendig wäre. Standortplanung II V 5/6 S. 10
12 Deutsche Unternehmen investieren verstärkt in Europa und China Investitionsziele deutscher Industrieunternehmen in % 1) EU EU-Beitrittsländer 2004 China Russland, Ukraine, Südosteuropa inkl. Türkei Nordamerika Asien ohne China andere 11 Quelle: DIHK 2007, Investitionen im Ausland, S. 8; Legende: 1) Mehrfachnennungen möglich Seite 11 Die Bedeutung der EU-15-Staaten (Mitgliedsstaaten bis einschließlich 2003) als Zielort deutscher Auslandsinvestitionen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Der immer enger zusammenwachsende europäische Binnenmarkt sowie die Vorteile des weitgehend einheitlichen Währungsraums sorgen dafür, dass die EU-15-Staaten von im Ausland investierenden Unternehmen inzwischen wieder am häufigsten als Zielregion genannt werden. Damit stellen die EU- Beitrittsstaaten aus dem Jahr 2004 zwar immerhin noch die zweitwichtigste Zielregion deutscher Auslandsinvestitionen dar, jedoch werden inzwischen die GUS-Staaten einschließlich Südosteuropa und auch China ähnlich oft genannt. Zu erklären ist diese Entwicklung unter anderem mit dem ökonomischen Aufholprozess der nun nicht mehr ganz so neuen EU-Mitglieder von 2004 in den letzten Jahren, der auch das Lohnniveau nach oben verschoben hat. Gleichzeitig befinden sich diese Staaten seit Anfang 2007 in direkter Konkurrenz zu den noch jüngeren EU-Mitgliedern Rumänien und Bulgarien. China ist nicht nur wegen seines günstigen Lohnniveaus, sondern vor allem wegen des enormen Potenzials seines boomenden Inlandsmarktes interessant. Gerade die größeren deutschen Unternehmen bauen daher ihre Präsenz in der demnächst wichtigsten asiatischen Volkswirtschaft aus, um auch in der Zukunft global erfolgreich zu sein. Vor allem der (aufgrund der boomenden Energiewirtschaft) wachsende Absatzmarkt in Russland scheint für die deutschen Industrieunternehmen attraktiv zu sein, da sich hier ein steigender Bedarf nach deutschen Produkten entwickelt. Standortplanung II V 5/6 S. 11
13 Das Motiv der Kostenersparnis bei Auslandsinvestitionen verliert an Bedeutung Motive für Auslandsinvestitionen deutscher Industrieunternehmen in % Kostenersparnis Markterschließung Vertrieb und Kundendienst Quelle: DIHK 2007, Investitionen im Ausland, S.4 Seite 12 Der Trend der zunehmenden Bedeutung marktstrategischer Überlegungen bei abnehmendem Kostenmotiv ist seit dem Jahr 2003 zu beobachten. Er erklärt sich vor allem aus den Chancen der rasant zunehmenden Vernetzung der Weltwirtschaft, dem Bedeutungsgewinn der neuen Märkte in Ost- und Südosteuropa, Russland und Asien sowie der immer tieferen ökonomischen Integration Europas. Vor dem Hintergrund der Fortschritte am Standort Deutschland wollen die heimischen Industrieunternehmen die sich im Zuge dieser Entwicklung neu ergebenen Chancen und Geschäftsfelder auf den Auslandsmärkten nutzen. Sie setzen daher ihre Internationalisierungs-strategie weiter fort. Deutlich wird auch, dass sich die deutsche Wirtschaft immer weiter international vernetzt. Einheitliche Standards, weitreichende Freihandelsbestimmungen sowie verlässliche Rechtssysteme werden damit immer wichtiger für den dauerhaften Erfolg der Unternehmen. Standortplanung II V 5/6 S. 12
14 Produktionsverlagerer und Rückverlagerer 35 % Verlagerung in den 2 Jahren vor realisiert Rückverlagerung in den 2 Jahren vor realisiert (1995 nicht erhoben) 30 % 30 % 25 % 20 % 26 % 15 % 10 % 5 % 18 % 21 % 7 % 7 % 21 % 7 % 0 % 4 % Die Standortplanung wird nicht ausreichend beherrscht! Quelle: Arthur D. Little 2004 Seite 13 Wenn es um die Auswahl von neuen Standorten ging, spielten in jüngster Vergangenheit strategische Erwägungen nur eine untergeordnete Rolle. Chancen blieben vielfach ungenutzt und Risiken wurden falsch bewertet. Ursache hierfür war häufig die beinahe alleinige Fokussierung auf Kostengesichtspunkte: das Argument Reduktion von Personalkosten durch günstigere Lohn- und Nebenkosten an ausländischen Standorten ist das dominierende Motiv für Produktionsverlagerungen. Aspekte wie bspw. Kompetenz-, Markt- und Kundenorientierung gewinnen nur langsam an Gewicht. Die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns bei alleiniger Kostenfokussierung ist folglich hoch. Dies bestätigt auch die Quote enttäuschter Rückverlagerer. In den deutschen Metall- und Elektroindustrie hat sich die Zahl der Rückverlagerer im Zeitraum von 1997 bis 1999 nahezu verdoppelt. Seit 2001 liegt das Verhältnis von Rückverlagerern zu Verlagerern konstant bei 1:3. Standortplanung II V 5/6 S. 13
15 Zeithorizonte unterschiedlicher Planungsaufgaben für Produktionsbetriebe Standortplanung Generalbebauungsplan Zeithorizont Jahre Zeithorizont Jahre Strukturplanung Programmplanung Zeithorizont 3-10 Jahre Zeithorizont 1-10 Jahre Kapazitätsplanung Zeithorizont 1-12 Monate heute Quelle: Eversheim 1996 Seite 14 Als Teil der Fabrikplanung kommt der Standortwahl und der funktionsgerechten und wirtschaftlichen Bodennutzung des Standortes eine besondere Bedeutung zu. Dies gilt sowohl für Überlegungen zu vorhandenen Standorten als auch für die Wahl und Beplanung von neuen Standorten. Die Entscheidung für oder gegen einen Standort wird dabei häufig kurzfristig getroffen, die Folgen einer Standortwahl haben jedoch langfristig großen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung eines Unternehmens. Zahlreiche Beispiele zeigen, dass Standortwahl und Generalbebauung oder Entwicklungsplan über Jahrzehnte konsequent angewandt, ein unzertrennlicher Bestandteil einer erfolgeichen Unternehmensstrategie sein muss. Standortplanung II V 5/6 S. 14
16 Gliederung 1 Globale Standortentwicklung 2 Vorgehensweise zur Standortplanung und -bewertung 3 Modelle und Verfahren zur Auswahl, Bewertung und Auslegung von Standorten Seite 15 Standortplanung II V 5/6 S. 15
17 Methodischer Ablauf einer Standortplanung und -bewertung Unternehmerische Initiative Bestimmung des Wertschöpfungsumfangs Strategische Ausrichtung des Standortes im Unternehmensnetzwerk Netzwerkkonzept (Erweiterung, Zukauf, Verlagerung) Global Footprint Design Ermittlung der Standortfaktoren Standortwahl Erstellung eines Anforderungsprofil (Mindest-, Festanforderungen) Vergleich der möglichen Standortalternativen und Grobauswahl Bewertung der bevorzugten Standorte (Kosten, Rendite, Termine) Entscheidung Quelle: i. A. a. Kettner 1984, S. 105 Seite 16 Die Abbildung zeigt eine systematische Vorgehensweise zur Standortplanung und - bewertung. Dieses Vorgehen lässt sich grob in die zwei Phasen des Global Footprint Design und der Standortwahl unterteilen. Ausgangspunkt für die Standortplanung bildet die unternehmerische Initiative. Nach der Initiierung der Standortplanung wird derjenige Wertschöpfungsumfang identifiziert, den der neuen Standort umfassen soll. Hieraus, sowie im Einklang mit der verfolgten Unternehmensstrategie, folgt die strategische Ausrichtung des neuen Standortes. Unter Berücksichtigung dieser Eingangsinformationen erfolgt die Integration des neuen Standortes in das bestehende Produktionsnetzwerk. Reicht eine Erweiterung des Stammwerkes oder muss ein neuer Standort erschlossen werden? Kann dies durch Akquise eines existierenden Standortes erfolgen? Wie wird der Standort erschlossen bzw. gestaltet? Nachdem das Global Footprint Design, die Phase der Gestaltung des globalen Produktionsnetzwerks abgeschlossen ist, tritt die Planung in die Phase der Standortwahl ein. Es werden die erfolgskritischen Standortfaktoren zusammengestellt und ein umfassendes Anforderungsprofil an den neuen Standort aufgebaut. Die Standortwahl wird mit den folgenden Bewertungsphasen abgeschlossen: Eine erste grobe Standortbewertung dient der Reduzierung der Alternativenmenge. Daran schließt ein detaillierte qualitative und quantitative Bewertung aussichtsreicher Standorte an, um eine Standortentscheidung herbeizuführen. Standortplanung II V 5/6 S. 16
18 Gründe der Standorterschließung Motivation Firmengründung Erschließung neuer Märkte Diversifikation (lateral) Behördliche Auflagen Platzmangel Änderung Marktstruktur Ungünstige Arbeitskraftbeschaffung Ungenügende Ver- und Entsorgung Betriebswirtschaftliche Gründe (Kostensenkung, Steuern, billigeres Personal, ) Neugründung Verlagerung Zielfaktor Produktion neuer Produkte an neuem Standort Neubeschaffung von Ressourcen Ausgliederung von Unternehmensteilen Massive Nutzung bestehender Ressourcen Platzmangel im Hauptwerk Verlegung der Verwaltung (auf Stadtgebiet) Trennung von F&E von der Produktion Provisorische Außenstellen (Fertigwarenlager, Hilfs- und Nebenbetriebe, Rohstofflager, einzelne Betriebsbereiche) Dezentralisierung Ausgliederung von Unternehmensteilen Massive Nutzung bestehender Ressourcen Seite 17 Die Erschließung eines neuen Standorts lässt sich prinzipiell in drei Erschließungsstrategien einteilen. Abhängig von der Motivation und dem verfolgten Ziel der Standorterschließung werden die Strategien in Neugründung, Verlagerung und Dezentralisierung unterschieden. Verfolgt die Neugründung hauptsächlich das Ziel, dem Unternehmenswachstum und der räumlichen Diversifizierung Rechnung zu tragen, so zielen eine Verlagerung und Dezentralisierung auf eine funktionale Diversifizierung ab. Es wird eine effektive und effiziente Nutzung der an den Standorten vorhandenen Ressourcen angestrebt. Standortplanung II V 5/6 S. 17
19 Globale Unternehmens- und Standortspositionierung global Globaler Markterschließer Bedient die wichtigsten Weltmärkte aus eigenen Fertigungs- und Vertriebsstandorten (Vor-Ort-Präsenz) Global Footprint Champion Wählt für jede Unternehmensfunktion optimalen Standort und nutzt Ressourcen effizient im globalen Netzwerk Marktzugang Heimatstandort Wertschöpfer Nutzt die Ressourcen und Stärken des Standorts und bedient aus heimischen Werken lokale und globale Kunden Power Generation Regionaler Kostensenker Verlagert lohnkostenintensive Fertigungsund Montageschritte in Niedriglohnländer aus und nutzt Osteuropa oder Ostasien als verlängerte Werkbank fokussiert fokussiert Quelle: WZL/ Roland Berger 2004 Ausnutzung Kosteneffizienz global Seite 18 Industrieunternehmen nutzen vier Globalisierungsstrategien, um sich mit Blick auf Marktzugang und Kosteneffizienz zu positionieren. Der Heimatstandort-Wertschöpfer" fokussiert sich auf die Stärken seiner Entwicklungsund Fertigungsstandorte. Nachteile für diese Unternehmen sind höhere Faktorkosten und geringere Flexibilität bei der Anpassung von Kapazitäten bei Lastspitzen oder -tälern. Darüber hinaus fordert globale Marktpräsenz zunehmend auch Vor-Ort- Kompetenz, z. B. bei Entwicklung und Service. Der "Regionale Kostensenker" kann durch eine Mischkalkulation der Kosten entlang der Wertschöpfungskette seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Die kosteneffiziente Verteilung der Wertschöpfung an Hoch- und Niedriglohnländer ermöglicht die Bedienung des mittleren Preissegments. Hochwertige Arbeitsplätze am Standort Deutschland können dadurch gesichert und ausgebaut werden. Die Herausforderung steckt in den teilweise hohen Anfangsinvestitionen und den notwendigen "Lernkurveneffekten" beim Hochfahren von Anlagen in Niedriglohnländern. Der "Globale Markterschließer" verfügt über guten Zugang und hohe Akzeptanz in den wichtigsten Weltmärkten und hat sich durch eigene Entwicklung und Fertigung oder durch gezielte Zukäufe von lokalen Unternehmen führende Marktpositionen erarbeitet und kann schnell auf lokale Marktbedürfnisse reagieren. Herausforderungen sind häufig eine nicht optimale Kostensituation und geringe Synergien, da Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten in mehreren Weltmärkten parallel vorgehalten werden und eine kritische Größe unter Umständen nicht erreicht wird. Der "Global Footprint Champion erzielt Kosten- und Effizienzgewinne entlang der gesamten Wertschöpfungskette, indem er Funktionen an einem Standort bündelt oder ggf. auslagert. Die weltweite Präsenz fördert Wachstum und Positionierung in wichtigen Weltmärkten, nutzt Produkt- und Prozess-Know-how auf globaler Basis und optimiert die Faktorkosten an jedem Standort. Die Herausforderungen liegen darin, das globale Wertschöpfungsportfolio effizient zu managen, alle Prozesse intelligent zu vernetzen und damit eine optimale Ausnutzung der jeweiligen lokalen Ressourcen- und Know-how- Vorteile sicherzustellen. Standortplanung II V 5/6 S. 18
20 Herstellkostenbetrachtung für den Aufbau eines lokalen Montagestandortes für Werkzeugmaschinen in China (Fallbeispiel) Prozent Einsparungen 94 Zusatzkosten HK D Transport der Teile Logistik Gesamtmaschine Fertigung Montage HK China Logistik Kosten Qualität + Komplexität Zölle, Steuern Tatsächliche HK China Angaben in % bezogen auf die Herstellkosten in Deutschland, HK: Herstellkosten Seite 19 Bei der Bewertung der Wertschöpfungsverteilung müssen viele verschiedene Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Einflussfaktoren, die einen Einfluss auf die Wertschöpfungsverteilung haben können, sind z. B. Lohnkosten, Energiekosten oder Rohstoffkosten an den Standorten bzw. Logistikkosten, Zölle oder Wechselkurse. Die Relevanz der einzelnen Einflussfaktoren hängt dabei von der Netzwerkstruktur sowie von regionalen Rahmenbedingungen der Standorte ab. In jüngster Vergangenheit standen bei der monetären Bewertung von Standorterschließungen in erster Linie die Lohnkosteneinsparungen im Vordergrund. Diese Fokussierung auf die Arbeitskosten führt nicht selten zu einem Herstellkostenszenario, das entscheidende Kostenpositionen vernachlässigt und das Szenario vermeintlich rentabel aussehen lässt. Oftmals finden bei der Bewertung des Standorts Logistik- und Komplexitätskosten keine Berücksichtigung. Unter Komplexitätskosten werden beispielsweise Aufwendungen verstanden, die für die Koordination vor Ort anfallen wie etwa Lieferantenbewertungen und -entwicklung. Ebenso können so genannte Schutzzölle eine wesentliche Rolle spielen, wenn importierte Komponenten oder Halbfertigwaren künstlich verteuert werden, um den Vertrieb inländisch hergestellter Produkte zu fördern. Letztendlich müssen für die realistische Bewertung einer Standorterschließung den Einsparungen bedingt durch die spezifischen Standortfaktoren die entstehenden Zusatzkosten entgegengesetzt werden. Dies bedeutet, dass Standorte nicht auf Lohnkosten-, sondern auf Stückkostenbasis miteinander verglichen werden müssen. Standortplanung II V 5/6 S. 19
21 Standortplanung II V5 Standortstrukturplanung Globale Standortentwicklung (Strategien/ Rollen) Ablauf der Standortplanung- und bewertung V6 Standortwahl Standortfaktoren Anforderungsprofile Bewertungs- und Auswahlmethoden (Grob-/ Detailauswahl) Seite 20 Standortplanung II V 5/6 S. 20
22 Gliederung der Standortfaktoren Standortwahl globaler Standort regionaler Standort lokaler Standort Standortkennzeichnung Ergebnis technischwirtschaftlich Regionalbereich politischwirtschaftlich Globalbereich Wirtschaftraum eines Staates technischgeographisch Fabrikgelände Wirtschaftraum einer Stadt Grundstück Hamburg Berlin Beispiel Aachen München Deutschland Quelle: Eversheim 1996, i. A. a. Kettner 1984, S. 107; i. A. a. Grundig 2000, S. 225 Raum Aachen Steinbachstr. 19 Seite 21 Weite Verbreitung hat die Einteilung der Standortfaktoren in drei Ebenen, der globalen, lokalen und regionalen Ebene, gefunden. Die Faktoren jeder Ebene weisen einen zunehmenden Grad an Detaillierung auf. Die globalen Faktoren beschreiben die nationale Situation eines Staates oder eines Wirtschaftsraumes mit besonderem Fokus auf die politischen, ökonomischen und sozialen Verhältnisse. Durch die regionalen Standortfaktoren werden die Wirtschaftsräume eines Staates gekennzeichnet. In der regionalen Standortplanung wird eine geeignete Region oder Stadt ermittelt. Die Regionen können dabei in ihren flächenmäßigen Ausdehnungen stark variieren. Standortfaktoren dieser Ebene sind meist technisch-wirtschaftlicher Natur. Die lokalen Standortfaktoren dienen der detaillierten Beschreibung des konkreten Standorts sowie dessen Umfelds. Die Erfassung der lokalen Faktoren stellt sich in der Praxis i. A. als langwierig und mühsam heraus. Selbst interessierte Standortanbieter können zum Teil keine umfassenden Informationen vollständig und aktuell zur Verfügung stellen. Im Rahmen der lokalen Standortplanung wird die Auswahl eines Fabrikgeländes durchgeführt. Standortplanung II V 5/6 S. 21
23 Gruppierung von Standortfaktoren lokal regional global Allgemeine Angaben - Bevölkerungszahl - Außenpolitik -... Verkehrslage - Straßennetz - Schienennetz - Wasserstraßen - Flughäfen - Lage zum Kunden -... Wirtschaft - Wirtschaftspolitik - Kapitalverkehr - Warenverkehr - Investitionshilfen - Steuern - Anteil der Industrie am BSP -... Energie - Elektrizität - Öl - Gas - Kohle - Energiepreise -... Arbeitsmarkt - Arbeitslöhne - Streiktage - Bildung - Anteil Industriearbeiter/ Bevölkerung - Verhältnis Facharbeiter/ ungelernte Arbeiter -... Grundstücksmarkt - Grundstückspreis - Grundwasserstand - Grundstücksgefälle - Bodenstruktur und -beschaffenheit - spätere Zukaufsmöglichkeiten - Stand der Erschließung -... Umweltschutz - Abfallbeseitigung - Emissionen - Lärm - sonstige Auflagen -... Wasser - Härte - Verfügbarkeit - Preis -... Quelle: Grundig 2000 Seite 22 Innerhalb der drei Ebenen der Standortfaktoren lassen sich unterschiedliche Aspekte der Standortwahl zu Faktorengruppen zusammenfassen. Da in einigen Fällen eine klare Trennung zwischen globalen und regionalen sowie zwischen regionalen und lokalen Standortfaktoren nicht möglich ist, können durchaus Überschneidungen entstehen. In diesem Fall müssen die entsprechenden Faktoren sowohl bei der globalen und regionalen bzw. bei der regionalen und lokalen Bewertung berücksichtigt werden. Eine Faktorgruppe, die auf beiden Ebenen Berücksichtigung findet, ist z. B. die Gruppe Arbeitsmarkt. Zu den Faktoren gehören grundsätzlich Aspekte wie die geographischen Kostenunterschiede bzgl. des Personals sowie der Bestand an Arbeitskraftreserven. Die geographischen Personalkostenunterschiede können hinsichtlich der regionalen und internationalen Einflüsse differenziert werden, wobei internationale Unterschiede weit größere Spielräume aufweisen. Bzgl. des Bestandes der Arbeitskräfte lässt sich unterscheiden in die Qualität der Arbeitskräfte und in die Quantität. Die Quantität beschreibt das Angebot an Arbeitskräften in der jeweiligen Region, welche abhängt von der entsprechenden Anzahl an der in der Region beschäftigten Personen sowie den Reserven des Arbeitsmarkts. Die Qualität der Arbeitskraftreserven bezeichnet die Qualifikation der Arbeitskräfte vor Ort. Standortplanung II V 5/6 S. 22
24 Der Wettbewerbsdruck für den Standort Deutschland wird nicht nachlassen Lohnkostenunterschiede +X % / a jährliche Zuwachsrate ,57 19,27 17,90 22,35 27,87 29, % / a +10 % / a +7 % /a 0,58 1,59 1,08 0,33 0,90 0, % / a +6 % / a +6 % /a 7,15 2,65 5,39 5,04 1,50 3,80 9,17 11,54 +3,9 % / a +1,5 % / a +2,5 % / a +1 % / a Indonesien China Indien Russland Polen Tschechien Korea Japan USA Deutschland Der Arbeitskostenvorteil der Niedriglohnländer wird auf absehbare Zeit nicht schrumpfen! Quelle: IDW Köln/eigene Recherchen Seite 23 Die Löhne der alten Industrieländer des Westens sind einem Konvergenzprozess unterworfen, an dem auf der anderen Seite die Löhne der Marktwirtschaften in Osteuropa und Asien beteiligt sind. Die Globalisierung schafft, auch ohne dass Menschen zwischen den Ländern wandern können, einen gemeinsamen Arbeitsmarkt mit den Chinesen, Polen, Tschechen und vielen anderen Niedriglohngebieten. Auf diesem gemeinsamen Arbeitsmarkt nähern sich die Löhne aneinander an. Allerdings ist die beobachtete Konvergenzgeschwindigkeit im Sinne der so genannten Sigma-Konvergenz derart gering, dass der Arbeitskostenvorteil der Niedriglohnländer auf absehbare Zeit bestehen bleiben wird. Selbst wenn man unterstellt, dass die Konvergenzgeschwindigkeit in Osteuropa 2% pro Jahr beträgt, wird sich immer noch eine Halbwertszeit von 35 Jahre ergeben. Die Lohnkosten der osteuropäischen Länder werden dann im Jahr 2020 erst bei 39% und im Jahr 2030 bei 50% der westdeutschen Lohnkosten angekommen sein. Es wird also eine ganze Generation dauern, bis die osteuropäischen Länder im Verhältnis zu Westdeutschland dort stehen, wo die südwesteuropäischen Länder bezüglich ihrer Lohnkosten schon beim EU-Beitritt standen. Noch langsamer konvergieren die chinesischen Lohnkosten an das europäische Niveau. Die chinesischen Lohnkosten werden im Falle einer zwei-prozentigen Sigma-Konvergenz zum westdeutschen Niveau im Jahr 2020 bei 34% und im Jahr 2030 bei 46% der westdeutschen Lohnkosten liegen. Bei 50% werden sie erst im Jahr 2034 angekommen sein [vgl. Sinn 2005, S. 19ff]. Somit sehen sich die deutschen Unternehmen auch zukünftig aufgrund hoher Lohnkostenunterschiede einem globalen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Standortplanung II V 5/6 S. 23
25 Arbeitskosten vs. Produktivität Arbeitskosten 1) [EUR/h] Arbeitsproduktivität je geleistete Arbeitsstunde 21,22 Europa (25) 100 % 26,22 Deutschland 105,8 % 23,94 USA 115,4 % 20,38 Japan 79,1 % 9,56 Portugal 59,1 % 4,74 Polen 47,6 % Quelle: Eurostat 2005; Legende: 1) in der Industrie Seite 24 Es dürfen nicht nur die reinen Kosten, die der Faktor Arbeit verursacht, für die Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit herangezogen werden, sondern es muss den Kosten ebenso die Produktivität der Arbeit gegenüber gestellt werden. Hohe Arbeitskosten belasten die internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft so lange nicht, wie sie von den entsprechenden Produktivitätsvorteilen kompensiert werden können. Ein geeignetes Maß zur Beurteilung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit stellt beispielsweise die Entwicklung der Lohnstückkosten (Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmer in Relation zum realen Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen) dar, die den Produktivitätsfortschritt mit berücksichtigt. Standortplanung II V 5/6 S. 24
26 Arbeitskosten vs. Arbeitsvolumen Westdeutschland Niederlande USA 1982 = USA Entwicklung der realen Arbeitskosten je Arbeitstunde [%] Niederlande 1982 = 100 Westdeutschland Entwicklung des Arbeitsvolumen [%] 90 Quelle: ifo Seite 25 In Ländern wie den USA bzw. den Niederlanden wuchs in den vergangenen 25 Jahren das Arbeitsvolumen (wesentlich) stärker als der Lohn. Demgegenüber haben die realen Arbeitskosten pro Stunde in Deutschland in den letzten 25 Jahren um fast 40% zugenommen, während sich das Arbeitsvolumen kaum veränderte. Standortplanung II V 5/6 S. 25
27 Bestandteile eines Anforderungsprofils für einen Produktionsstandort Beschaffungs/ Absatzmärkte Technologieentwicklung Wettbewerb Umfeldsicht Wechselkurse Unternehmenssicht Produktion (Netzwerksicht) Produktion (Werksicht) m 2 Produktionsstrategie Standortanforderungen Anforderungsgerechte Konzeption eines Produktionsstandortes Seite 26 Unter Standortfaktoren werden Merkmale des physischen Standortes bzw. seiner Umwelt verstanden, welche aus strategischer, operativer und ökonomischer Sicht die Wahl eines Standortes maßgebend beeinflussen und somit die standortspezifischen Einflussgrößen des Erfolgs eines Unternehmens darstellen [vgl. Kontny 1999, S.37]. Die Anforderungen an einen Standort und damit die Ausprägungen dieser Beschreibungsgrößen werden durch die so genannten Standortkriterien beschrieben. Sie sind aus den unternehmens- bzw. standortspezifischen Zielsetzungen ableitbar und ergeben zusammengefasst das so genannte Standortanforderungsprofil. Standortplanung II V 5/6 S. 26
28 Beispiel für ein Anforderungsprofil Festforderungen (k.o.) Mindestforderungen global -Stabile politische Verhältnisse -Freie Marktwirtschaft -Freier Kapitalverkehr -Freier Warenverkehr - -Anteil der Industrie am Bruttosozialprodukt >40% -Investitionshilfen >15% -Anteil der Industriearbeiter / Bevölkerung >10% -Arbeitszeit pro Jahr >1550 Stunden -ølohn pro Monat <1610 regional lokal Quelle: Eversheim Straßenverkehr -Schienenverkehr -Verfügbarkeit von Grundstücken -kurzfristige Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte -Straßenanschluss (BAB) -Lage in Industriezone -Elektrizität 10 KV, 8 MW -Wasseranschluss/ Kanalisation -Erschließung beendet -Grundstücksfläche m2 -Investitionshilfen >15% -Anteil der Industriearbeiter / Bevölkerung >10% -ø Gehalt eines Angestellten <15 /Stunde -ø Gehalt eines Facharbeiters <11,5 /Stunde -Verhältnis Facharbeiter / ungelernte Arbeiter >1 -ø Grundstückspreis inklusive Erschließung <20 /m2 -Grundstückspreis inklusive Erschließung <20 /m2 -Grundwasserspiegel >4m unter Geländeniveau -Grundstücksgefälle <1% -Elektrizität: Spannung >10KV Leistung >8MW Seite 27 Die Standortkriterien werden zu einem Standortanforderungsprofil zusammengefasst. Dabei werden drei verschiedene Arten der Ausprägung von Anforderungen unterschieden: Festanforderungen Mindestanforderungen Wunschanforderungen Festanforderungen müssen in jedem Fall erfüllt sein. Erfüllt ein Standort dies Anforderungen nicht, kommt diese Standortalternative nicht in Frage. solch Kriterien bezeichnet man daher als K.-o.-Kriterien. Mindestanforderungen sind bis bzw. ab einem bestimmten Grenzwert, dem Schwellwert, verbindlich. Wird dieser unter- bzw. überschritten, sind auch sie K.-o.-Kriterien. Wunschanforderungen sind Forderungen, die zusätzlich zu den Fest- und Mindestforderungen definiert werden. Die Wunschforderungen müssen nicht erfüllt werden. Bei der Standortbewertung finden sie zumeist dann positive Berücksichtigung, wenn Fest- und Mindestanforderungen bei zwei Standortalternativen in gleicher Weise erfüllt sind. Standortplanung II V 5/6 S. 27
29 Gliederung 1 Globale Standortentwicklung 2 Vorgehensweise zur Standortplanung und -bewertung 3 Modelle und Verfahren zur Auswahl, Bewertung und Auslegung von Standorten Seite 28 Standortplanung II V 5/6 S. 28
30 Grobauswahl möglicher Standortalternativen Standort S 4 Kriterium Eigenschaft Standort S 2 Kriterium Eigenschaft Standort S 1 Kriterium Eigenschaft Standortanforderungen Festforderungen F i F 1, F 2,..., F n Mindestforderungen M i M 1, M 2,..., M n Stufe 1 Ermittlung möglicher Standorte Vergleich der Anforderungen mit den Eigenschaften der Standortfaktoren Alle Festforderungen F i erfüllt? ja Alle Schwellwerte der Mindestforderungen M i erfüllt? ja Standort S 4 Kriterium Eigenschaft Standort S 1 Kriterium Eigenschaft Ungeeigneter Standort S Festforderung F i nicht erfüllt Ungeeigneter Standort S Mindestforderung M i nicht erfüllt Quelle: Eversheim 1996 Seite 29 Die Grobauswahl ist im Sinne einer schnellen und einfachen Planung hilfreich, da so der notwendige Bewertungsaufwand für die Vorauswahl prinzipiell geeigneter Standorte auf ein Minimum reduziert werden kann. Die Grobauswahl erfolgt durch einen Vergleich von Standortanforderungsprofil und Standorteigenschaften. Wird auf der globalen oder der regionalen Ebene festgestellt, dass der Standort nicht geeignet ist, entfällt die Betrachtung der verbleibenden Ebenen. Als Auswahlkriterien werden die Fest- und Mindestanforderungen herangezogen. Nur wenn eine Alternative alle Festanforderungen sowie die Schwellwerte aller Mindestanforderungen erfüllt, kommt sie als Standort in Frage. Standortplanung II V 5/6 S. 29
31 Qualitative Standortbewertung mittels der Nutzwertanalyse Standort S 4 Kriterium Eigenschaft Standort S 1 Kriterium Eigenschaft Stufe 2 Ermittlung des geeigneten Standortes Quelle: Eversheim 1996 Gewichtungsfaktoren G i G 1, G 2,..., G n Bewertungskriterien K i K 1, K 2,..., K n Kriterium K i K 1 K 2 K n Summe Bildung der Nutzwerte möglicher Standortalternativen N = n G E i= 1 i i Gewichtung G i G 1 G 2 Rang 1 2 G n Standortalternativen S 1 S 2 S 3 S 4 Nutzwerte Standort S 2 N = 432 Standort S 4 N = 328 Erfüllungsgrad E i E 1, E 2,..., E n Seite 30 Hinter der so genannten Nutzwertanalyse verbirgt sich ein einfaches Punktbewertungsverfahren, das in der Praxis vor allem wegen seiner leichten Handhabung und seines plausiblen Aufbaus weite Verbreitung gefunden hat. Allgemein geht es darum, die qualitative Bewertung verschiedener sich ausschließender Handlungsalternativen (Standort, Produktideen, Investitionsprojekte o. ä.) in eine einheitliche quantitative Nutzskala zu transformieren. Dabei geht man nach folgendem Grundschema vor: 1. Kriterien (Standortfaktoren) werden erhoben und operational formuliert. 2. Kriterien werden gewichtet. 3. Jede Alternative wird hinsichtlich der einzelnen Kriterien auf einer normierten Skala bewertet. Es ergeben sich so genannte Teilnutzwerte. 4. Der Gesamtnutzen einer Alternative wird durch Addition auf einer normierten Skala ermittelt, wobei die Teilnutzwerte mit ihren jeweiligen Kriteriengewichten multipliziert werden. 5. Die Alternative mit dem höchsten Gesamtnutzen wird ausgewählt. Standortplanung II V 5/6 S. 30
32 Quantitative Standortbewertung mittels der dynamischen Investitionsrechnung Kapitalwertberechnung C T = 1 0 t=0 ( ) -t Σ Z t + i Beispiel: Zinssatz = 10% Periode Zahlungen C 0 = ( )*1,1-0 + ( )*1, *1, *1,1-3 = , Annuitätenberechnung (Kapitalwert) r = C 0 KWF (i,t) = C 0 i ( 1+ i) T ( 1+i ) T -1 Wert C 0 0 r 1 r 2 r 3 r 4 Periode Legende: C 0 : Kapitalwert T: Projektdauer Z t : Zahlungsströme KWF: Kapitalwiedergewinnungsfaktor t: Periode i: Zinssatz r: Annuität, Rente Seite 31 Von den zahlreichen dynamischen Investitionsrechnungsverfahren, die zur Beurteilung von Investitionsobjekten geeignet sind, bieten sich für eine wirtschaftliche Bewertung vor allem die Kapitalwertberechnung und die Annuitätenberechnung an. Der Kapitalwert eines Investitionsprojektes entspricht dem zum Anfangszeitpunkt entnehmbaren bzw. (falls negativ) zuzuschießenden Betrag. Hierbei werden alle Auszahlungen und Einzahlungen auf den aktuellen Zeitpunkt zurückgerechnet. Ein Investitionsprojekt ist genau dann angemessen, wenn der Kapitalwert positiv ist. Folglich ist eine Investition um so vorteilhafter, je höher der Kapitalwert ist. Von mehreren Investitionsprojekten ist dasjenige zu wählen, das den höchsten Kapitalwert aufweist. Der Bezugszeitpunkt muss dabei für alle Investitionsprojekte gleich sein. Nachteilig wirkt sich bei der Kapitalwertberechnung aus, dass ein fester Zinssatz zugrunde liegen muss. Ebenso können keine Steuern berücksichtigt werden. Die Annuität oder Rente ist der dem Projekt entnehmbare (bzw. zuzuschießende) gleich hohe Betrag am Ende eines jeden Jahres der Laufzeit. Somit handelt es sich um äquidistante Zahlungen, die zu jedem Zeitpunkt t in gleicher Höhe r vorliegen. Demnach fällt die erste Rentenzahlung bei t = 1, die letzte Zahlung bei t = T an. Der Kapitalwert wird auf alle Perioden gleichmäßig verteilt, so dass dem Projekt in jeder Periode eine gleich hohe Rente entnommen werden kann. Standortplanung II V 5/6 S. 31
33 Quantitative Standortbewertung mittels der dynamischen Investitionsrechnung Verfahren Wirtschaftliche Bewertung Entscheidungskriterium: Kapitalwert Amortisationszeit Wählbare Entscheidungsalternativen Zahlungen [ ] Liquidationserlös Zahlungsreihe Kapitalwert (mit Liquidationserlös) Periodendauer T Input: Investitionszahlungen Zu erwartende Erträge Kalkulatorische Zinsfüße Amortisationsdauer (mit Liquidationserlös) Kapitalwert (ohne Liquidationserlös) Quelle: in Anlehnung an Männel 1992 Amortisationsdauer (ohne Liquidationserlös) Seite 32 Dynamische Amortisationsrechnungen werden in erster Linie zur Unterstützung von Makeor-Buy-Entscheidungen unter Berücksichtigung schwankender Bedarfe im Zusammenhang mit für die Eigenfertigung notwendigen Investitionen durchgeführt. Generell soll durch dynamische Amortisationsrechnungen ermittelt werden, ob der Übergang vom Fremdbezug zur Eigenfertigung bestimmter Produkte wirtschaftlich sinnvoll ist. Bei mehreren konkurrierenden Investitionsprojekten dienen sie der Auswahl des günstigsten Projekts. Grundlage jeder Amortisationsrechnung bildet ein vollständiger Finanzplan. In ihm werden für die in den jeweiligen Perioden erwarteten Bedarfe die Kosten des Fremdbezugs und die laufenden Kosten der Eigenfertigung erfasst. Die über den gesamten Planungszeitraum kumulierten erzielbaren Ersparnisse werden den einmalig anfallenden Investitionsauszahlungen gegenübergestellt. Dies ermöglicht die Ermittlung des Amortisationszeitpunktes und damit eine Abschätzung des Risikos der geplanten Investition. Soll zusätzlich eine Aussage über die Rentabilität des Investitionsvorhabens getroffen werden, kann die Amortisationsrechnung z.b. durch eine Kapitalwertberechnung erweitert werden. Dabei werden die in den jeweiligen Perioden ermittelten Investitionsüberschüsse zur Erfassung zu berücksichtigender Zinsen auf den Kalkulationszeitpunkt diskontiert. Standortplanung II V 5/6 S. 32
34 Sensitivitätsanalyse zur Abschätzung potenzieller Risiken eines Standortaufbaus in Europa (Fallbeispiel) A Steigerungsfaktor B.1 Neue Bundesländer Kosten Steigerungsfaktor bezogen auf A B.2 Italien Kosten Steigerungsfaktor bezogen auf A B.3 Tschechien Kosten Steigerungsfaktor bezogen auf A Löhne Anzahl bestehende MA am neuen Standort 10% 10% 10% Bestehender Standort (A) 2,7% Neuer Standort - neue MA 90% 2,7% 90% 2,0% 30% 7,0% Neuer Standort - bestehende MA 110% 2,7% 120% 2,0% 145% 3,0% Gehälter Anzahl bestehende MA am neuen Standort 15% 15% 15% Bestehender Standort (A) 2,7% Neuer Standort - neue MA 90% 2,7% 90% 2,0% 35% 7,0% Neuer Standort - bestehende MA 110% 2,7% 120% 2,0% 150% 3,0% Energie Strom 6,5% 100% 6,5% 115% 6,5% 70% 6,5% Prozessgase 1,5% 100% 1,5% 100% 1,5% 100% 1,5% Erdgas 4,5% 100% 4,5% 95% 4,5% 65% 4,5% Frachten Entfernungen zum bestehenden Standort [100km] Zusatzeingangsfrachten 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Ausgangsfrachten 2,5% 118% 2,5% 214% 2,5% 170% 2,5% Vorteilhaftigkeit 0 A B.1 B.2 B.3 Sensitivitätsanalyse hinsichtlich Lohnkosten, Energiepreise und Transportkosten Weitere Kriterien*: Ausschuss, Bearbeitungszeit, Qualifikationsaufwand, Steuern, Zölle, Währungskurse *Experteninterviews zum Thema Beherrschung der Wertschöpfungsverteilung, WZL 2009 Seite 33 Eine rein statische Betrachtung des Ist-Zustands ist bei der monetären Bewertung der Vorteilhaftigkeit einer Standortwahl nicht hinreichend. Ziel ist die vorrausschauende Planung und Bewertung des Standorts. Um die Auswirkung von geänderten Rahmenbedingungen sowie potenzielle Risiken in die Bewertung einfließen zu lassen, müssen die Standortalternativen dynamisch betrachtet werden. Mit Hilfe der Sensitivitätsanalyse lässt sich z. B. die Auswirkung von eventuellen Lohn-, Transport- oder Energiekostensteigerungen auf die Vorteilhaftigkeit der Standortalternativen untersuchen. Somit kann eine Aussage über die Robustheit des Standorts hinsichtlich ökonomischer Schwankungen und Risiken getroffen werden. Standortplanung II V 5/6 S. 33
35 Bilanz der Vorlesung Die Wirtschaftsräume der Welt sind heute durch den internationalen Handel und Wettbewerb unlöslich miteinander verbunden. Damit sind Unternehmen mehr denn je gefordert, sich zur Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit in der internationalen Wettbewerbsarena zu positionieren. Sie können das In- und Auslandsgeschäft nicht länger als getrennte betriebliche Bereiche betrachten. Eine internationale Betätigung ist nicht nur als Zusatzgeschäft, sondern als grundlegender Bestandteil der gesamten Unternehmenstätigkeit anzusehen. Für produzierende Unternehmen bedeutet dies, dass sie zunehmend gefordert sind, global verteilte Produktionsstandorte aufzubauen und zu betreiben. Treiber hierfür sind zum einen die immer wichtiger werdende Marktnähe (Kundennähe), zum anderen die Erfüllung von Local-Content -Anforderungen sowie die Nutzung von Standortfaktoren (beispielsweise niedrige Lohnkosten). Darüber hinaus ist ein Verkürzen der Logistikkette in Zeiten einer Justin-Time-Versorgung für Zuliefererunternehmen häufig zwingender Grund für die Eröffnung von Standorten in der Nähe des Kunden. Die Nutzung global verteilter Produktionsstandorte birgt demnach viele Vorteile. Dies impliziert jedoch, dass die Globalisierung auch beherrscht wird. Hierbei gilt es, insbesondere Synergieeffekte bei der Erschließung neuer Standorte zu nutzen sowie die Produktionsumfänge einzelner Werke geeignet zu koordinieren; denn erst durch die Kombination verschiedener Produktionsstandorte in einem unternehmensweiten Produktionsnetz können deren spezifische Stärken jeweils optimal genutzt werden. Neben der Fähigkeit zum grenzüberschreitenden Transfer von Wissen und Erfahrungen wird der Erfolg entscheidend davon abhängen, inwieweit es gelingt, einzelne Standorte gemäß der Unternehmensstrategie zu positionieren. Vor diesem Hintergrund wurde in dieser Vorlesung die strategiespezifische globale Standortplanung und -bewertung näher beleuchtet. Aufbauend auf den vorangegangenen Vorlesungen 3 und 4 wurden mögliche strategische Positionierungsalternativen diskutiert und damit Wertschöpfungsumfänge von Produktionsstandorten in globalen, unternehmensinternen Produktionsnetzwerken abgeleitet. Für die Wahl eines Produktionsstandorts wurde ein Ordnungsrahmen für die Klassifikation von Standortfaktoren eingeführt. Im Fokus des sich anschließenden Teils der Vorlesung stand die eigentliche Standortebene. Hier wurden Möglichkeiten der Standorterschließung vorgestellt und diskutiert sowie auf die Erstellung von Standort-Anforderungsprofilen eingegangen. Der letzte Abschnitt beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit den in der Praxis anzutreffenden Methoden und Lösungsverfahren zur Bewertung und Auswahl eines geeigneten Standortes. Die Übung zu dieser Vorlesung besteht aus zwei Aufgaben. Im Rahmen des realen Fallbeispiels werden in der ersten Aufgabe potenzielle Produktionsstandorte mit Hilfe qualitativer Bewertungsmethoden der Standortplanung und -bewertung ermittelt. Die ausgewählten Standorte werden nachfolgend in der zweiten Aufgabe einer quantitativen Bewertung unterzogen, um den geeigneten Standort zu identifizieren. Standortplanung II V 5/6 S. 34
36 Fragen zur Vorlesung: Welches sind die Hauptmotive deutscher Unternehmen für ein Auslands-engagement und welche Entwicklung ist dabei zu beobachten? Welchen vier Globalisierungsstrategien bedienen sich Industrieunternehmen im Hinblick auf Marktzugang und Kosteneffizienz? Welche beiden Klassifizierungsmerkmale zur Einordnung globaler Netzwerkorganisationen kennen Sie und welche Typen lassen sich mit ihrer Hilfe identifizieren? Aus welchen Grundelementen besteht die Struktur eines Standortanforderungsprofils? Standortplanung II V 5/6 S. 35
37 Fragen zur Vorlesung (Fortsetzung): Welchen Zweck dient die Anwendung der Nutzwertanalyse? Was verstehen Sie unter einem vollständigen Finanzplan und wozu dient er bei der Standortwahl? Standortplanung II V 5/6 S. 36
38 Literaturhinweise: Abele, E: Handbuch Globale Produktion, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2006 Aggteleky, B.: Fabrikplanung Werksentwicklung und Betriebsrationalisierung Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien 1982 Dichtl, E., Hardock, P.: Produktionsverlagerung von Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus ins Ausland Ergebnisse einer empirischen Studie, Frankfurt a. M., 1997 Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK): Investitionen im Ausland, Berlin, 2007 Euringer, P.: Wettbewerbsfähigkeit durch richtige Standortauswahl- und bewertung, Zeitschrift für Logistik, Band 16, Heft 3, S , 1995 Eversheim, W., Schuh, G.: Betriebshütte - Produktion und Management 7. völlig neu bearbeitete Auflage, Springer Verlag, Berlin, 1996 Ferdows, K.: Managing International Manufacturing, North-Holland, 1989 Franz, O.: Globalisierung Herausforderung und Chance für den deutschen Mittelstand, Düsseldorf, 1999 Geissbauer, R., Schuh, G.: Global Footprint Design Die Spielregeln der internationalen Wertschöpfung beherrschen, Studie Roland Berger Strategy Consultants, 2004 Grundig, C.-G.: Fabrikplanung, Carl Hanser Verlag, München, 2000 Harre, J.: Strategische Standortstrukturplanung für multinationale produzierende Unternehmen, Shaker Verlag, Aachen, 2006 Kettner, H.: Leitfaden der systematischen Fabrikplanung, Carl Hanser Verlag, München, 1984 Kinkel, S. (Hrsg.): Erfolgsfaktor Standortplanung, Springer Verlag, Berlin 2004 Kontny, H.: Standortplanung für internationale Verbundproduktionssysteme Gabler Verlag/ DUV, Wiesbaden, 1999 Krystek, U. (Hrsg.), Zur, E.: Handbuch Internationalisierung: Globalisierung Eine Herausforderung für die Unternehmensführung, Springer Verlag, Berlin 2002 Kutschker, M., Schmidt, S. : Internationales Management, Oldenbourg Verlag, München Wien, 2004 Lange-Stalinski, T.: Methodik zur Gestaltung und Bewertung mobiler Produktionssysteme, Shaker Verlag, Aachen, 2002 Standortplanung II V 5/6 S. 37
Werkzeugmaschinenlabor der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Lehrstuhl für Produktionsmanagement Prof. Dr.-Ing. A.
 Werkzeugmaschinenlabor der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen Lehrstuhl für Produktionsmanagement Prof. Dr.-Ing. A. Kampker Fabrikplanung Standortplanung II Standortplanung und -bewertung
Werkzeugmaschinenlabor der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen Lehrstuhl für Produktionsmanagement Prof. Dr.-Ing. A. Kampker Fabrikplanung Standortplanung II Standortplanung und -bewertung
Werkzeugmaschinenlabor der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
 Werkzeugmaschinenlabor der RheinischWestfälischen Technischen Hochschule Aachen Lehrstuhl für Produktionssystematik Prof. Dr.Ing. Dipl.Wirt. Ing. G. Schuh Fabrikplanung Standortplanung II Standortplanung
Werkzeugmaschinenlabor der RheinischWestfälischen Technischen Hochschule Aachen Lehrstuhl für Produktionssystematik Prof. Dr.Ing. Dipl.Wirt. Ing. G. Schuh Fabrikplanung Standortplanung II Standortplanung
Leseprobe. Investition und Finanzierung
 Investition und Finanzierung Kapitel 2 - Investitionsrechnung 2.1 Methoden der Investitionsrechnung 2.2 Statische Investitionsrechnung - Kosten- und Gewinnvergleichsverfahren 2.2.1 Kostenvergleichsverfahren
Investition und Finanzierung Kapitel 2 - Investitionsrechnung 2.1 Methoden der Investitionsrechnung 2.2 Statische Investitionsrechnung - Kosten- und Gewinnvergleichsverfahren 2.2.1 Kostenvergleichsverfahren
Auslandsinvestitionen nord-westfälischer Unternehmen: Südosteuropa auf dem Vormarsch, China auf dem Rückzug
 Auslandsinvestitionen nord-westfälischer Unternehmen: Südosteuropa auf dem Vormarsch, China auf dem Rückzug Kapital sucht Wachstumsmärkte oder eben die Nähe so ein jüngstes Fazit des Instituts der deutschen
Auslandsinvestitionen nord-westfälischer Unternehmen: Südosteuropa auf dem Vormarsch, China auf dem Rückzug Kapital sucht Wachstumsmärkte oder eben die Nähe so ein jüngstes Fazit des Instituts der deutschen
Wirtschaftlichkeitsberechnung der Energiesparmaßnahmen
 Wirtschaftlichkeitsberechnung der Energiesparmaßnahmen Die nachfolgend Beschriebenen Verfahren und Berechnungen sind Grundlage der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der eingesetzten Einblasverfahren. Grundlagen
Wirtschaftlichkeitsberechnung der Energiesparmaßnahmen Die nachfolgend Beschriebenen Verfahren und Berechnungen sind Grundlage der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der eingesetzten Einblasverfahren. Grundlagen
Übungsblatt 4. t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 Zahlungen Projekt A e. Sie stellt einen Spezialfall der Kapitalwertmethode dar.
 Aufgaben Kapitel 4: Investitionsrechnung (Grundlagen, Kapitalwertmethode, Annuitätenmethode) 1. Zu den statischen Investitionsrechenverfahren gehören a. der statische Renditevergleich b. die Rentabilitätsrechnung
Aufgaben Kapitel 4: Investitionsrechnung (Grundlagen, Kapitalwertmethode, Annuitätenmethode) 1. Zu den statischen Investitionsrechenverfahren gehören a. der statische Renditevergleich b. die Rentabilitätsrechnung
INVESTITION. Betriebswirtschaftslehre
 INVESTITION : Investition Umwandlung von Zahlungsmittel in langfristig gebundene Produktionsfaktoren bzw. Vermögenswerte Sachvermögen, Finanzvermögen, immaterielles Vermögen Probleme: - langfristige Kapitalbindung
INVESTITION : Investition Umwandlung von Zahlungsmittel in langfristig gebundene Produktionsfaktoren bzw. Vermögenswerte Sachvermögen, Finanzvermögen, immaterielles Vermögen Probleme: - langfristige Kapitalbindung
Einfluss von Industrie 4.0 auf die Standortbestimmung für die Industriegüterproduktion. Bachelorarbeit
 Einfluss von Industrie 4.0 auf die Standortbestimmung für die Industriegüterproduktion Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft
Einfluss von Industrie 4.0 auf die Standortbestimmung für die Industriegüterproduktion Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft
Shared Services: Grundlegende Konzeption und konkrete Umsetzung im Bereich Human Resources
 Wirtschaft Christine Rössler Shared Services: Grundlegende Konzeption und konkrete Umsetzung im Bereich Human Resources Diplomarbeit Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Diplom-Betriebswirtin
Wirtschaft Christine Rössler Shared Services: Grundlegende Konzeption und konkrete Umsetzung im Bereich Human Resources Diplomarbeit Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Diplom-Betriebswirtin
Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach:
![Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach: Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach:](/thumbs/50/26220103.jpg) Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Zielsetzung Jedes Unternehmen setzt sich Ziele Egal ob ein Unternehmen neu gegründet oder eine bestehende Organisation verändert werden soll, immer wieder
Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Zielsetzung Jedes Unternehmen setzt sich Ziele Egal ob ein Unternehmen neu gegründet oder eine bestehende Organisation verändert werden soll, immer wieder
Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001)
 Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001) Diese Erklärung wurde vom ENBGF auf dem Netzwerktreffen am 16. Juni 2001 verabschiedet und auf der anschließenden
Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001) Diese Erklärung wurde vom ENBGF auf dem Netzwerktreffen am 16. Juni 2001 verabschiedet und auf der anschließenden
Branchendialog mit der chemischen Industrie
 Branchendialog mit der chemischen Industrie hier: Spitzengespräch am 3. März 215 Ausgewählte Ergebnisse der Online Konsultation mit der chemischen Industrie. (Alle Daten, die pro Frage nicht 1 % ergeben,
Branchendialog mit der chemischen Industrie hier: Spitzengespräch am 3. März 215 Ausgewählte Ergebnisse der Online Konsultation mit der chemischen Industrie. (Alle Daten, die pro Frage nicht 1 % ergeben,
Exposé zur Safari-Studie 2002: Der Mensch in IT-Projekten Tools und Methoden für den Projekterfolg durch Nutzerakzeptanz
 Exposé zur Safari-Studie 2002: Der Mensch in IT-Projekten Tools und Methoden für den Projekterfolg durch Nutzerakzeptanz Inhalt: Viele IT-Projekte scheitern nicht aus technisch bedingten Gründen, sondern
Exposé zur Safari-Studie 2002: Der Mensch in IT-Projekten Tools und Methoden für den Projekterfolg durch Nutzerakzeptanz Inhalt: Viele IT-Projekte scheitern nicht aus technisch bedingten Gründen, sondern
Wirtschaftlichkeit des Projekts. Wintersemester 2005/06 Prof. Dr.-Ing. Christian Averkamp
 Fachhochschule öln Wintersemester 005/06 Prof. Dr.-Ing. Christian Averkamp Fachhochschule öln Die Wirtschaftlichkeitsanalyse: Ermitteln der betriebswirtschaftlichen Nutzen/osten eines Projekts. Verfahren
Fachhochschule öln Wintersemester 005/06 Prof. Dr.-Ing. Christian Averkamp Fachhochschule öln Die Wirtschaftlichkeitsanalyse: Ermitteln der betriebswirtschaftlichen Nutzen/osten eines Projekts. Verfahren
Supply Chain Risk Management - Risiken in der Logistik sicher beherrschen
 Workshop Supply Chain Risk Management - Risiken in der Logistik sicher beherrschen 31. Deutscher Logistik-Kongress Berlin 23. Oktober 2014 Technische Universität Hamburg-Harburg Institut für Logistik und
Workshop Supply Chain Risk Management - Risiken in der Logistik sicher beherrschen 31. Deutscher Logistik-Kongress Berlin 23. Oktober 2014 Technische Universität Hamburg-Harburg Institut für Logistik und
Marketing - Management
 Merkmale für den Prozess des Marketings: Philosophieaskpekt: Die bewusste Absatz- und Kundenorientierung aller Unternehmensbereiche. Verhaltensaspekt: Erfassung und Beobachtung der für eine Unternehmung
Merkmale für den Prozess des Marketings: Philosophieaskpekt: Die bewusste Absatz- und Kundenorientierung aller Unternehmensbereiche. Verhaltensaspekt: Erfassung und Beobachtung der für eine Unternehmung
2011 WACHSTUM SETZT SICH IM JAHR NACH DER KRISE FORT
 2011 WACHSTUM SETZT SICH IM JAHR NACH DER KRISE FORT Die Einschätzung der Geschäftslage durch die befragten Logistiker fällt im weiterhin sehr positiv aus. Anders als in den Vormonaten ist die Logistikklimakurve
2011 WACHSTUM SETZT SICH IM JAHR NACH DER KRISE FORT Die Einschätzung der Geschäftslage durch die befragten Logistiker fällt im weiterhin sehr positiv aus. Anders als in den Vormonaten ist die Logistikklimakurve
LEAN MANAGEMENT UND KOSTENSENKUNG
 REIS ENGINEERING & CONSULTING IHR PARTNER FÜR LEAN MANAGEMENT UND KOSTENSENKUNG Fabrikplanung, Werkentwicklung Industriebauplanung Produktionsprozessoptimierung Materialflussplanung Anlagenprojektierung
REIS ENGINEERING & CONSULTING IHR PARTNER FÜR LEAN MANAGEMENT UND KOSTENSENKUNG Fabrikplanung, Werkentwicklung Industriebauplanung Produktionsprozessoptimierung Materialflussplanung Anlagenprojektierung
Investitionsrechnung
 Investitionsrechnung Vorlesung Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Wissenschaftszentrum Weihenstephan Sommersemester 2008 Technische Universität München Univ.-Prof. Frank-Martin Belz Inhaltsübersicht Teil
Investitionsrechnung Vorlesung Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Wissenschaftszentrum Weihenstephan Sommersemester 2008 Technische Universität München Univ.-Prof. Frank-Martin Belz Inhaltsübersicht Teil
Je produzierter Einheit ist ein beim Halbautomaten ein Preis von 350,00 zu erzielen. Aus Marketinggründen sinkt dieser beim Vollautomaten auf 330,00.
 Statische Investitionsrechnung Im Zuge eines Auftragbooms sieht sich die Firma Hauscomfort gezwungen, die Produktion elektrischer Klimageräte auf nun 2000 Einheiten jährlich auszuweiten. Die zu diesem
Statische Investitionsrechnung Im Zuge eines Auftragbooms sieht sich die Firma Hauscomfort gezwungen, die Produktion elektrischer Klimageräte auf nun 2000 Einheiten jährlich auszuweiten. Die zu diesem
Schlecht und Partner Schlecht und Collegen. Due Diligence
 Schlecht und Partner Schlecht und Collegen Due Diligence Wir über uns Schlecht und Partner sind erfahrene Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Unsere Partnerschaft stützt sich auf eine langjährige Zusammenarbeit
Schlecht und Partner Schlecht und Collegen Due Diligence Wir über uns Schlecht und Partner sind erfahrene Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Unsere Partnerschaft stützt sich auf eine langjährige Zusammenarbeit
Marketing. Leseprobe
 Marketing Kapitel 3 Marktanalyse und Zielgruppe 3.1 Datenquellen für die Marktanalyse 3.2 Elemente der Marktanalyse 3.2.1 Stärken-Schwächen-Analyse des eigenen Unternehmens 3.2.2 Wettbewerbs- und Branchenanalyse
Marketing Kapitel 3 Marktanalyse und Zielgruppe 3.1 Datenquellen für die Marktanalyse 3.2 Elemente der Marktanalyse 3.2.1 Stärken-Schwächen-Analyse des eigenen Unternehmens 3.2.2 Wettbewerbs- und Branchenanalyse
Die deutsche Gießerei-Industrie als Zulieferer des Maschinenbaus im globalen Wettbewerb. Risiken und Chancen am Beispiel der Stahlgießereien
 Die deutsche Gießerei-Industrie als Zulieferer des Maschinenbaus im globalen Wettbewerb Risiken und Chancen am Beispiel der Stahlgießereien - 1 - 1 Überblick Stahlguss weltweit 2 Stahlguss f. den Maschinenbau;
Die deutsche Gießerei-Industrie als Zulieferer des Maschinenbaus im globalen Wettbewerb Risiken und Chancen am Beispiel der Stahlgießereien - 1 - 1 Überblick Stahlguss weltweit 2 Stahlguss f. den Maschinenbau;
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
 1 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre S c r i p t ( Teil 4 ) [ Dr. Lenk ] 2 5.4 Produktion als Wettbewerbsfaktor...3 5.4.1 Standortentscheidungen...3 5.4.2 Marktbearbeitung...5 6. Marketing...6 6.1
1 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre S c r i p t ( Teil 4 ) [ Dr. Lenk ] 2 5.4 Produktion als Wettbewerbsfaktor...3 5.4.1 Standortentscheidungen...3 5.4.2 Marktbearbeitung...5 6. Marketing...6 6.1
6. Einheit Wachstum und Verteilung
 6. Einheit Wachstum und Verteilung Wirtschaftswachstum und Wohlstand (1) Wachstum: Wirtschaftswachstum = Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts real = zu konstanten Preisen Beispiele (2006): Österreich:
6. Einheit Wachstum und Verteilung Wirtschaftswachstum und Wohlstand (1) Wachstum: Wirtschaftswachstum = Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts real = zu konstanten Preisen Beispiele (2006): Österreich:
WEISER, KUCK & COMP. Management und Personalberatung BDU
 WEISER, KUCK & COMP. Management und Personalberatung BDU PROFIL FÜR DIE POSITION PROJECT DIRECTOR (M/F) IMPLEMENTATION OF SAP - MASCHINEN- UND ANLAGENBAU - Unternehmen und Markt Unser Klient - mit einer
WEISER, KUCK & COMP. Management und Personalberatung BDU PROFIL FÜR DIE POSITION PROJECT DIRECTOR (M/F) IMPLEMENTATION OF SAP - MASCHINEN- UND ANLAGENBAU - Unternehmen und Markt Unser Klient - mit einer
Industrie 4.0 Ist der Einkauf gerüstet?
 Industrie 4.0 Ist der Einkauf gerüstet? Das Thema Industrie 4.0 und damit auch Einkauf 4.0 ist derzeit in aller Munde. Aber was genau verbirgt sich dahinter? Was sind die Anforderungen an die Unternehmen
Industrie 4.0 Ist der Einkauf gerüstet? Das Thema Industrie 4.0 und damit auch Einkauf 4.0 ist derzeit in aller Munde. Aber was genau verbirgt sich dahinter? Was sind die Anforderungen an die Unternehmen
Produktbaukästen entwickeln. Unsere Roadmap zum Erfolg
 Produktbaukästen entwickeln Unsere Roadmap zum Erfolg Welche Varianten / Optionen sollen entwickelt werden? Die Fähigkeit, kundenindividuelle Lösungen zu marktfähigen Preisen anzubieten, wird in Zeiten
Produktbaukästen entwickeln Unsere Roadmap zum Erfolg Welche Varianten / Optionen sollen entwickelt werden? Die Fähigkeit, kundenindividuelle Lösungen zu marktfähigen Preisen anzubieten, wird in Zeiten
Helbling IT Solutions
 helbling Helbling IT Solutions Ihre IT-Lösung aus einer Hand Wettbewerbsvorteile durch IT-gestützte Geschäftsprozesse Die Helbling IT Solutions AG fokussiert sich auf die Integration von Product- Lifecycle-Management-Lösungen
helbling Helbling IT Solutions Ihre IT-Lösung aus einer Hand Wettbewerbsvorteile durch IT-gestützte Geschäftsprozesse Die Helbling IT Solutions AG fokussiert sich auf die Integration von Product- Lifecycle-Management-Lösungen
Dynamisches Investitionsrechenverfahren. t: Zeitpunkt : Kapitalwert zum Zeitpunkt Null : Anfangsauszahlung zum Zeitpunkt Null e t
 Kapitalwertmethode Art: Ziel: Vorgehen: Dynamisches Investitionsrechenverfahren Die Kapitalwertmethode dient dazu, die Vorteilhaftigkeit der Investition anhand des Kapitalwertes zu ermitteln. Die Kapitalwertverfahren
Kapitalwertmethode Art: Ziel: Vorgehen: Dynamisches Investitionsrechenverfahren Die Kapitalwertmethode dient dazu, die Vorteilhaftigkeit der Investition anhand des Kapitalwertes zu ermitteln. Die Kapitalwertverfahren
FH Flensburg - Kompetenzzentrum Logistik und Supply Chain Management. Professor Dr. Winfried Krieger Dipl.Kfm. (FH) Michael Solle
 FH Flensburg - Kompetenzzentrum Logistik und Supply Chain Management Professor Dr. Winfried Krieger Dipl.Kfm. (FH) Michael Solle Logistik grenzenlos bewegen 1. Grenzüberschreitendes deutsch- dänisches
FH Flensburg - Kompetenzzentrum Logistik und Supply Chain Management Professor Dr. Winfried Krieger Dipl.Kfm. (FH) Michael Solle Logistik grenzenlos bewegen 1. Grenzüberschreitendes deutsch- dänisches
Direktinvestitionen der international tätigen Unternehmen als Schlüsselfaktor für Wachstum und Wohlstand in der Schweiz
 Presserohstoff 24. August 2006 Direktinvestitionen der international tätigen Unternehmen als Schlüsselfaktor für Wachstum und Wohlstand in der Schweiz Volkswirtschaftliche Bedeutung der Direktinvestitionen
Presserohstoff 24. August 2006 Direktinvestitionen der international tätigen Unternehmen als Schlüsselfaktor für Wachstum und Wohlstand in der Schweiz Volkswirtschaftliche Bedeutung der Direktinvestitionen
52U Investitionsrechnung Lösungshinweise
 BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE I 52U Investitionsrechnung Lösungshinweise 2010.12 Prof. Dr. Friedrich Wilke Investition 52 Investitionsrechnung 1 Kostenvergleichsrechnung Abschreibungskosten Beispiel (Aufgabe
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE I 52U Investitionsrechnung Lösungshinweise 2010.12 Prof. Dr. Friedrich Wilke Investition 52 Investitionsrechnung 1 Kostenvergleichsrechnung Abschreibungskosten Beispiel (Aufgabe
Markt der Standardanwendungssoftware für ERP mit einem Vergleich der konzeptionellen Struktur der Angebote
 Informatik Martin Unsöld Markt der Standardanwendungssoftware für ERP mit einem Vergleich der konzeptionellen Struktur der Angebote Studienarbeit 1 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware...2 2 Enterprise
Informatik Martin Unsöld Markt der Standardanwendungssoftware für ERP mit einem Vergleich der konzeptionellen Struktur der Angebote Studienarbeit 1 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware...2 2 Enterprise
Kriterien zur Analyse der Geschäftsfeldsituation
 Kriterien zur Analyse der Geschäftsfeldsituation Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Kriterien vor, die zur Analyse der Geschäftsfeldsituation zu betrachten sind. Die Kriterien sollen helfen, ein Gefühl
Kriterien zur Analyse der Geschäftsfeldsituation Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Kriterien vor, die zur Analyse der Geschäftsfeldsituation zu betrachten sind. Die Kriterien sollen helfen, ein Gefühl
Betriebswirtschaftliche Schwerpunkte der Unternehmensgründung I
 Michael Schefczyk unter Mitarbeit von Frank Pankotsch Betriebswirtschaftliche Schwerpunkte der Unternehmensgründung I - Kopfkurs - Professionalisierungsstudium Start Up Counselling Das dieser Veröffentlichung
Michael Schefczyk unter Mitarbeit von Frank Pankotsch Betriebswirtschaftliche Schwerpunkte der Unternehmensgründung I - Kopfkurs - Professionalisierungsstudium Start Up Counselling Das dieser Veröffentlichung
» Variable Vergütung. Zielerreichung und Auszahlung der variablen Vergütung für das Jahr 2012
 » Variable Vergütung Zielerreichung und Auszahlung der variablen Vergütung für das Jahr 2012 Variable Vergütung Zielerreichung und Auszahlung der variablen Vergütung für das Jahr 2012 Ziel der Erhebung»
» Variable Vergütung Zielerreichung und Auszahlung der variablen Vergütung für das Jahr 2012 Variable Vergütung Zielerreichung und Auszahlung der variablen Vergütung für das Jahr 2012 Ziel der Erhebung»
B. Verfahren der Investitionsrechnung
 Auf einen Blick: Statische Investitionsrechnungsverfahren die klassischen Verfahren zur Berechnung der Vorteilhaftigkeit einer Investition. Dynamische Investitionsrechnungsverfahren der moderne Weg zur
Auf einen Blick: Statische Investitionsrechnungsverfahren die klassischen Verfahren zur Berechnung der Vorteilhaftigkeit einer Investition. Dynamische Investitionsrechnungsverfahren der moderne Weg zur
Vorwort. Management Consulting
 Vorwort Eine weltweit schnelle und zuverlässige Ersatzteilversorgung spielt für einen erfolgreichen After-Sales-Service in der Investitionsgüterindustrie eine immer wichtigere Rolle. Um den zunehmenden
Vorwort Eine weltweit schnelle und zuverlässige Ersatzteilversorgung spielt für einen erfolgreichen After-Sales-Service in der Investitionsgüterindustrie eine immer wichtigere Rolle. Um den zunehmenden
Einkauf als Bindeglied zwischen Lieferant, Logistik und Produktion
 Einkauf als Bindeglied zwischen Lieferant, Logistik und Produktion Wolfram Bernhardt Leiter Einkauf Produktionsmaterialien Europa, 3M Deutschland, Neuss 85 Der Referent Name Bernhardt Vorname Wolfram Jahrgang
Einkauf als Bindeglied zwischen Lieferant, Logistik und Produktion Wolfram Bernhardt Leiter Einkauf Produktionsmaterialien Europa, 3M Deutschland, Neuss 85 Der Referent Name Bernhardt Vorname Wolfram Jahrgang
Mehr Effektivität und Effizienz in Marketing, Werbung, Unternehmenskommunikation. Chancen jetzt nutzen, Potentiale ausschöpfen!
 Mehr Effektivität und Effizienz in Marketing, Werbung, Unternehmenskommunikation Chancen jetzt nutzen, Potentiale ausschöpfen! Darauf kommt es an: Die richtigen Dinge richtig tun 50% aller Marketingausgaben
Mehr Effektivität und Effizienz in Marketing, Werbung, Unternehmenskommunikation Chancen jetzt nutzen, Potentiale ausschöpfen! Darauf kommt es an: Die richtigen Dinge richtig tun 50% aller Marketingausgaben
Materialien zur Vorlesung Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
 Materialien zur Vorlesung Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre Teil III: Rechnungs- und Finanzwesen Investitionsrechnung Dr. Horst Kunhenn Fachhochschule Münster, ITB Steinfurt Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Materialien zur Vorlesung Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre Teil III: Rechnungs- und Finanzwesen Investitionsrechnung Dr. Horst Kunhenn Fachhochschule Münster, ITB Steinfurt Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Was gehört in eine Markt- und Standortanalyse
 Was gehört in eine Markt- und Standortanalyse In einer Markt- und Standortanalyse werden zu folgenden Bereichen Aussagen getroffen: Marktinformationen Markt- bzw. Einzugsgebiet Zielgruppe Wettbewerbssituation
Was gehört in eine Markt- und Standortanalyse In einer Markt- und Standortanalyse werden zu folgenden Bereichen Aussagen getroffen: Marktinformationen Markt- bzw. Einzugsgebiet Zielgruppe Wettbewerbssituation
Prozessorganisation Mitschriften aus den Vorlesung bzw. Auszüge aus Prozessorganisation von Prof. Dr. Rudolf Wilhelm Feininger
 Prozesse allgemein Typische betriebliche Prozesse: Bearbeitung von Angeboten Einkauf von Materialien Fertigung und Versand von Produkten Durchführung von Dienstleistungen Prozessorganisation befasst sich
Prozesse allgemein Typische betriebliche Prozesse: Bearbeitung von Angeboten Einkauf von Materialien Fertigung und Versand von Produkten Durchführung von Dienstleistungen Prozessorganisation befasst sich
Strategie ist ein Erfolgsfaktor gute Strategiearbeit steigert das Ergebnis
 Strategie ist ein Erfolgsfaktor gute Strategiearbeit steigert das Ergebnis 2 Die Strategie legt die grundsätzliche Ausrichtung eines Unternehmens fest und bestimmt die Gestaltung der Ressourcen und Kompetenzen
Strategie ist ein Erfolgsfaktor gute Strategiearbeit steigert das Ergebnis 2 Die Strategie legt die grundsätzliche Ausrichtung eines Unternehmens fest und bestimmt die Gestaltung der Ressourcen und Kompetenzen
Barbara Mayerhofer, Univ. Salzburg, Fachbereich Geographie und Geologie
 Barbara Mayerhofer, Univ. Salzburg, Fachbereich Geographie und Geologie 1960 2050 Veränderung der Weltbevölkerung bis 2030 Aufgaben zum Film: mit offenen Karten: Bevölkerungsentwicklung und Politik (arte,
Barbara Mayerhofer, Univ. Salzburg, Fachbereich Geographie und Geologie 1960 2050 Veränderung der Weltbevölkerung bis 2030 Aufgaben zum Film: mit offenen Karten: Bevölkerungsentwicklung und Politik (arte,
Innovation als Motor einer zukunftsorientierten Landwirtschaft
 Innovation als Motor einer zukunftsorientierten Landwirtschaft Innovations-Projekt-Info-Tag 13. September 2016 Dr. Walter Wagner WAGNER MANAGEMENT CONSULTING Univ.-Lektor Dipl.-Ing. Dr. Walter Wagner Büro
Innovation als Motor einer zukunftsorientierten Landwirtschaft Innovations-Projekt-Info-Tag 13. September 2016 Dr. Walter Wagner WAGNER MANAGEMENT CONSULTING Univ.-Lektor Dipl.-Ing. Dr. Walter Wagner Büro
CAMELOT Management Consultants AG
 CAMELOT Management Consultants AG Referenzbeispiele im Umfeld Operations und Kurzportrait Köln, November 2016 Referenzbeispiel Automobilzulieferer Globaler Automobilzulieferer: Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit
CAMELOT Management Consultants AG Referenzbeispiele im Umfeld Operations und Kurzportrait Köln, November 2016 Referenzbeispiel Automobilzulieferer Globaler Automobilzulieferer: Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und betriebliche Gesundheitsförderung
 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und betriebliche Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich durch leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, die dafür sorgen, dass das Unternehmen mit
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und betriebliche Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich durch leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, die dafür sorgen, dass das Unternehmen mit
Vorgaben zur Erstellung eines Businessplans
 Vorgaben zur Erstellung eines Businessplans 1. Planung Dem tatsächlichen Verfassen des Businessplans sollte eine Phase der Planung vorausgehen. Zur detaillierten Ausarbeitung eines Businessplans werden
Vorgaben zur Erstellung eines Businessplans 1. Planung Dem tatsächlichen Verfassen des Businessplans sollte eine Phase der Planung vorausgehen. Zur detaillierten Ausarbeitung eines Businessplans werden
Aufgabe 2 Investitionscontrolling Amortisationsrechnung, Nutzwertanalyse. Dipl.-Kfm. Klaus Schulte
 Aufgabe 2 Investitionscontrolling Amortisationsrechnung, Nutzwertanalyse Dipl.-Kfm. Klaus Schulte Aufgabe 2a), 10 Punkte Skizzieren Sie die zentralen Aspekte der statischen und der dynamischen Amortisationsrechnung.
Aufgabe 2 Investitionscontrolling Amortisationsrechnung, Nutzwertanalyse Dipl.-Kfm. Klaus Schulte Aufgabe 2a), 10 Punkte Skizzieren Sie die zentralen Aspekte der statischen und der dynamischen Amortisationsrechnung.
Fertigungsstrategien. Reorganisationskonzepte für eine schlanke Produktion und Zulieferung. Horst Wildemann
 Fertigungsstrategien Reorganisationskonzepte für eine schlanke Produktion und Zulieferung Horst Wildemann Inhaltsverzeichnis Vorwort Inhaltsverzeichnis Seite V XV Abbildungsverzeichnis XXI 1 Fertigungsstrategien
Fertigungsstrategien Reorganisationskonzepte für eine schlanke Produktion und Zulieferung Horst Wildemann Inhaltsverzeichnis Vorwort Inhaltsverzeichnis Seite V XV Abbildungsverzeichnis XXI 1 Fertigungsstrategien
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
 1 Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor wir uns mit Dank und guten Wünschen von Ihnen verabschieden, möchte ich an dieser Stelle ein Resümee zur heutigen Veranstaltung geben und die wesentlichen
1 Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor wir uns mit Dank und guten Wünschen von Ihnen verabschieden, möchte ich an dieser Stelle ein Resümee zur heutigen Veranstaltung geben und die wesentlichen
Strategieentwicklung Der Weg zu einer erfolgreichen Unternehmensstrategie global denken, lokal handeln.
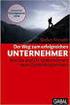 CONSULTING PEOPLE Strategieentwicklung Der Weg zu einer erfolgreichen Unternehmensstrategie global denken, lokal handeln. Analyse / Ziele / Strategieentwicklung / Umsetzung / Kontrolle Report: August 2012
CONSULTING PEOPLE Strategieentwicklung Der Weg zu einer erfolgreichen Unternehmensstrategie global denken, lokal handeln. Analyse / Ziele / Strategieentwicklung / Umsetzung / Kontrolle Report: August 2012
Dezentral oder zentral - Wie nahe muss die Logistik dem Kunden heute kommen? Wolfgang Winter Director Supply Chain D-A-CH
 Dezentral oder zentral - Wie nahe muss die Logistik dem Kunden heute kommen? Wolfgang Winter Director Supply Chain D-A-CH Das Office Depot Unternehmensprofil Umsatz 2006: US$ 15,0 Mrd - davon 24,3% außerhalb
Dezentral oder zentral - Wie nahe muss die Logistik dem Kunden heute kommen? Wolfgang Winter Director Supply Chain D-A-CH Das Office Depot Unternehmensprofil Umsatz 2006: US$ 15,0 Mrd - davon 24,3% außerhalb
Unternehmensstrukturen
 Michael Thiele Kern kompetenzorientierte Unternehmensstrukturen Ansätze zur Neugestaltung von Geschäftsbereichsorganisationen Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Stephan Zelewski DeutscherUniversitäts Verlag
Michael Thiele Kern kompetenzorientierte Unternehmensstrukturen Ansätze zur Neugestaltung von Geschäftsbereichsorganisationen Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Stephan Zelewski DeutscherUniversitäts Verlag
Whitepaper: Agile Methoden im Unternehmenseinsatz
 Whitepaper: Agile Methoden im Unternehmenseinsatz Agilität ist die Fähigkeit eines Unternehmens, auf Änderungen in seinem Umfeld zu reagieren und diese zum eigenen Vorteil zu nutzen. Inhaltsverzeichnis
Whitepaper: Agile Methoden im Unternehmenseinsatz Agilität ist die Fähigkeit eines Unternehmens, auf Änderungen in seinem Umfeld zu reagieren und diese zum eigenen Vorteil zu nutzen. Inhaltsverzeichnis
Die deutsche Automobilzulieferindustrie: Herausforderungen und Chancen. Dr. Jürgen M. Geißinger Vorsitzender des Vorstands, Schaeffler AG
 Die deutsche Automobilzulieferindustrie: Herausforderungen und Chancen. Dr. Jürgen M. Geißinger Vorsitzender des Vorstands, Schaeffler AG Fachkonferenz zukunftmobil der IG Metall, Augsburg, 08. Juli 2013
Die deutsche Automobilzulieferindustrie: Herausforderungen und Chancen. Dr. Jürgen M. Geißinger Vorsitzender des Vorstands, Schaeffler AG Fachkonferenz zukunftmobil der IG Metall, Augsburg, 08. Juli 2013
Dezentralisierung in der deutschen Investitionsgüterindustrie
 Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen Kulturwissenschaftliches Institut Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie Institut Arbeit und Technik Dr. Erich Latniak Dezentralisierung in der deutschen
Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen Kulturwissenschaftliches Institut Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie Institut Arbeit und Technik Dr. Erich Latniak Dezentralisierung in der deutschen
Methodenbeschreibung zur Auswahl der Gefragten Berufe Inhalt
 Methodenbeschreibung zur Auswahl der Gefragten Berufe Inhalt 1. Ausgangslage... 2 2. Statistiken und Kennzahlen... 2 3. Identifikation der Gefragten Berufe... 3 4. Interpretation der Gefragten Berufe...
Methodenbeschreibung zur Auswahl der Gefragten Berufe Inhalt 1. Ausgangslage... 2 2. Statistiken und Kennzahlen... 2 3. Identifikation der Gefragten Berufe... 3 4. Interpretation der Gefragten Berufe...
Betriebsräte im Innovationsprozess
 Betriebsräte im Innovationsprozess Betriebs- und Personalrätekonferenz INNOVATION UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DURCH MITBESTIMMUNG Erfurt 18.03.2013 Kontext des aktuellen Innovationsgeschehens Internationalisierung
Betriebsräte im Innovationsprozess Betriebs- und Personalrätekonferenz INNOVATION UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DURCH MITBESTIMMUNG Erfurt 18.03.2013 Kontext des aktuellen Innovationsgeschehens Internationalisierung
2.BEFT - Referat. von Taro Fruhwirth, 5HBa
 2.BEFT - Referat von Taro Fruhwirth, 5HBa Verfahren der statischen und dynamischen Investitionsrechnung Welche Dimension hat die Investitionsrechnung allgemein? Welche Unterschiede sind bei der statischen
2.BEFT - Referat von Taro Fruhwirth, 5HBa Verfahren der statischen und dynamischen Investitionsrechnung Welche Dimension hat die Investitionsrechnung allgemein? Welche Unterschiede sind bei der statischen
GRUNDLAGEN DER INDUSTRIELLEN STANDORTWAHL
 Modul GEO 202 Einführung in die Humangeographie II Wirtschaftsgeographie GRUNDLAGEN DER INDUSTRIELLEN STANDORTWAHL Prof. Dr. Sebastian Kinder 1 Fragestellungen für für diese diese Vorlesung: Welche Faktoren
Modul GEO 202 Einführung in die Humangeographie II Wirtschaftsgeographie GRUNDLAGEN DER INDUSTRIELLEN STANDORTWAHL Prof. Dr. Sebastian Kinder 1 Fragestellungen für für diese diese Vorlesung: Welche Faktoren
Pressemitteilung Seite 1
 Seite 1 Essen, den 18. März 2008 RWI Essen: Deutsche Konjunktur derzeit im Zwischentief Das RWI Essen geht für das Jahr 2008 weiterhin von einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,7%
Seite 1 Essen, den 18. März 2008 RWI Essen: Deutsche Konjunktur derzeit im Zwischentief Das RWI Essen geht für das Jahr 2008 weiterhin von einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,7%
Standort Deutschland 2011. Deutschland und Europa im Urteil internationaler Manager
 Standort Deutschland 2011 Deutschland und Europa im Urteil internationaler Manager Befragungssample Befragung von 812 international tätigen Unternehmen durch telefonische Interviews der Führungskräfte
Standort Deutschland 2011 Deutschland und Europa im Urteil internationaler Manager Befragungssample Befragung von 812 international tätigen Unternehmen durch telefonische Interviews der Führungskräfte
Presseinformation. Bouwfonds-Studie identifiziert Deutschlands attraktivste Regionen für Wohnungsbau
 Presseinformation Bouwfonds-Studie identifiziert Deutschlands attraktivste Regionen für Wohnungsbau Studie Wohnungsmärkte im Vergleich untersucht Situation in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden
Presseinformation Bouwfonds-Studie identifiziert Deutschlands attraktivste Regionen für Wohnungsbau Studie Wohnungsmärkte im Vergleich untersucht Situation in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden
 1 2 Wir alle spüren es, die Terminvorgaben bei der Erstellung der technischen Dokumentation werden immer straffer. Dies betrifft natürlich auch den Bereich der Übersetzung. Oft fehlt bei den Übersetzern
1 2 Wir alle spüren es, die Terminvorgaben bei der Erstellung der technischen Dokumentation werden immer straffer. Dies betrifft natürlich auch den Bereich der Übersetzung. Oft fehlt bei den Übersetzern
Aufgabe 1: Investitionscontrolling Statische Verfahren der Investitionsrechnung Interne Zinsfuß-Methode. Dr. Klaus Schulte. 20.
 Aufgabe 1: Investitionscontrolling Statische Verfahren der Investitionsrechnung Interne Zinsfuß-Methode Dr. Klaus Schulte 20. Januar 2009 Aufgabe 1 a), 6 Punkte Die statischen Verfahren der Investitionsrechnung
Aufgabe 1: Investitionscontrolling Statische Verfahren der Investitionsrechnung Interne Zinsfuß-Methode Dr. Klaus Schulte 20. Januar 2009 Aufgabe 1 a), 6 Punkte Die statischen Verfahren der Investitionsrechnung
Pressekonferenz auf der SPS IPC Drives 2014
 Klaus Helmrich, Mitglied des Vorstands der Siemens AG Pressekonferenz auf der SPS IPC Drives 2014 siemens.com/sps-messe Divisionen (Globale P&L) Go-to-market Siemens Vision 2020 Amerika Mittlerer Osten,
Klaus Helmrich, Mitglied des Vorstands der Siemens AG Pressekonferenz auf der SPS IPC Drives 2014 siemens.com/sps-messe Divisionen (Globale P&L) Go-to-market Siemens Vision 2020 Amerika Mittlerer Osten,
WER ERFAHRUNG HAT, SCHAFFT PERSPEKTIVEN. Menschen. die begeistern. hill-webersdorfer.at
 WER ERFAHRUNG HAT, SCHAFFT PERSPEKTIVEN. Menschen die begeistern. hill-webersdorfer.at 2 3 Menschen und Unternehmen beeinflussen sich in ihrer Entwicklung gegenseitig. Unser Ziel ist die optimale Verbindung
WER ERFAHRUNG HAT, SCHAFFT PERSPEKTIVEN. Menschen die begeistern. hill-webersdorfer.at 2 3 Menschen und Unternehmen beeinflussen sich in ihrer Entwicklung gegenseitig. Unser Ziel ist die optimale Verbindung
Einkaufsoptimierung als kritischer Erfolgsfaktor
 Einkaufsoptimierung als kritischer Erfolgsfaktor Thomas Grommes Executives Essentials Düsseldorf, 29. Juni 2016 Überblick Aktionsfelder bei der Optimierung des Einkaufs Bedeutung des Einkaufs für das Unternehmen
Einkaufsoptimierung als kritischer Erfolgsfaktor Thomas Grommes Executives Essentials Düsseldorf, 29. Juni 2016 Überblick Aktionsfelder bei der Optimierung des Einkaufs Bedeutung des Einkaufs für das Unternehmen
ESF-Jahrestagung ESF : Ressourcen bündeln, Zukunft gestalten. Dialogrunde 4:
 Dialogrunde 4: Bildung nach der Schule: Förderung des lebenslangen Lernens ESF-Jahrestagung 2013 ESF 2014-2020: Ressourcen bündeln, Zukunft gestalten 11. November 2013, Cottbus Bildung nach der Schule:
Dialogrunde 4: Bildung nach der Schule: Förderung des lebenslangen Lernens ESF-Jahrestagung 2013 ESF 2014-2020: Ressourcen bündeln, Zukunft gestalten 11. November 2013, Cottbus Bildung nach der Schule:
Global Sourcing in Indien. Besonderheiten und Lieferantenauswahlprozess
 Wirtschaft Marc Sieper Global Sourcing in Indien. Besonderheiten und Lieferantenauswahlprozess Projektarbeit Bergische Universität Wuppertal Fachbereich B Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Hausarbeit
Wirtschaft Marc Sieper Global Sourcing in Indien. Besonderheiten und Lieferantenauswahlprozess Projektarbeit Bergische Universität Wuppertal Fachbereich B Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Hausarbeit
Business Plan Assistent
 Business Plan Assistent TOPSIM Startup! Produktion Version 3.0 TERTIA Edusoft GmbH Ablauf des Seminars Gründungsvorbereitung Gründung Geschäftstätigkeit Startup! Web Business Plan Teilnehmersystem Planungstool
Business Plan Assistent TOPSIM Startup! Produktion Version 3.0 TERTIA Edusoft GmbH Ablauf des Seminars Gründungsvorbereitung Gründung Geschäftstätigkeit Startup! Web Business Plan Teilnehmersystem Planungstool
Ein Weiterbildungskonzept für (Nachwuchs-)Führungskräfte in einem mittelständischen Unternehmen
 Wirtschaft Imke Krome Ein Weiterbildungskonzept für (Nachwuchs-)Führungskräfte in einem mittelständischen Unternehmen Am Beispiel der X GmbH & Co. KG Diplomarbeit Fachhochschule Osnabrück University of
Wirtschaft Imke Krome Ein Weiterbildungskonzept für (Nachwuchs-)Führungskräfte in einem mittelständischen Unternehmen Am Beispiel der X GmbH & Co. KG Diplomarbeit Fachhochschule Osnabrück University of
2. a) Welche Teil-Bereiche gehören zum betrieblichen Rechnungswesen? b) Wodurch sind diese Bereiche gekennzeichnet?
 0.1 Aufgaben des Rechnungswesens 0 Einführung 0.1 Aufgaben des Rechnungswesens 0.2 Gliederung des Rechnungswesens 0.3 Controlling 0.4 EDV-gestütztes Rechnungswesen 1. Welche Aufgaben erfüllt das Rechnungswesen
0.1 Aufgaben des Rechnungswesens 0 Einführung 0.1 Aufgaben des Rechnungswesens 0.2 Gliederung des Rechnungswesens 0.3 Controlling 0.4 EDV-gestütztes Rechnungswesen 1. Welche Aufgaben erfüllt das Rechnungswesen
Business IT Alignment
 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt Fakultät Informatik und Wirtschaftsinformatik Prof. Dr. Kristin Weber Business IT Alignment Dr. Christian Mayerl Senior Management Consultant,
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt Fakultät Informatik und Wirtschaftsinformatik Prof. Dr. Kristin Weber Business IT Alignment Dr. Christian Mayerl Senior Management Consultant,
Executive Summary. Problemstellung. Vorgehen
 Executive Summary Problemstellung In den letzten Jahren sind die Investitionen in den Rohstoffmarkt von institutionellen Anlegern Hand in Hand mit den Rohstoffpreisen angestiegen. Diese Entwicklung führt
Executive Summary Problemstellung In den letzten Jahren sind die Investitionen in den Rohstoffmarkt von institutionellen Anlegern Hand in Hand mit den Rohstoffpreisen angestiegen. Diese Entwicklung führt
Den Serviceerfolg planen, steuern und messen
 Ein Leitfaden für die Investitionsgüterindustrie IMPULS München, den 13. Mai 2011 IMPULS - Die Serviceberater - Kirchplatz 5a 82049 Pullach Tel: 089-388899-30; Fax: 089-388899-31 Internet: Impuls-consulting.de
Ein Leitfaden für die Investitionsgüterindustrie IMPULS München, den 13. Mai 2011 IMPULS - Die Serviceberater - Kirchplatz 5a 82049 Pullach Tel: 089-388899-30; Fax: 089-388899-31 Internet: Impuls-consulting.de
Kapitel 2, Führungskräftetraining, Kompetenzentwicklung und Coaching:
 Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Unternehmensplanspiel ARTARIS AG
 Unternehmensplanspiel ARTARIS AG Lernziel Begreifbar machen, wie ein Industrieunternehmen funktioniert und wie es im harten Wettbewerb durch unternehmerisches Verhalten rentabel wachsen kann www.management-innovation.com
Unternehmensplanspiel ARTARIS AG Lernziel Begreifbar machen, wie ein Industrieunternehmen funktioniert und wie es im harten Wettbewerb durch unternehmerisches Verhalten rentabel wachsen kann www.management-innovation.com
Marktentwicklung der Stahlindustrie in Europa
 Marktentwicklung der Stahlindustrie in Europa Dr. Wolfgang Eder, Vorsitzender des Vorstandes, Frankfurt, am 24. Juni 2016 www.voestalpine.com voestalpine Group Überblick 2 24. Juni 2016 VDMA-Jahrestagung
Marktentwicklung der Stahlindustrie in Europa Dr. Wolfgang Eder, Vorsitzender des Vorstandes, Frankfurt, am 24. Juni 2016 www.voestalpine.com voestalpine Group Überblick 2 24. Juni 2016 VDMA-Jahrestagung
Antwort zu Aufgabe 1.1
 Antwort zu Aufgabe 1.1 a) Die Betonung der Exportquote beruht auf einer recht merkantilistischen Sichtweise ( Exporte gut, Importe schlecht ), drückt sie doch aus, wie viel an das Ausland verkauft wurde.
Antwort zu Aufgabe 1.1 a) Die Betonung der Exportquote beruht auf einer recht merkantilistischen Sichtweise ( Exporte gut, Importe schlecht ), drückt sie doch aus, wie viel an das Ausland verkauft wurde.
HR Digital Awareness Workshop für Personalmanager
 »»Kienbaum HR Digital Awareness Workshop für Personalmanager »»Was ist der Kienbaum HR Digital Awareness Workshop? Nach Jahren fast endloser Diskussion um die Bedeutungssicherung bzw. Positionierung und
»»Kienbaum HR Digital Awareness Workshop für Personalmanager »»Was ist der Kienbaum HR Digital Awareness Workshop? Nach Jahren fast endloser Diskussion um die Bedeutungssicherung bzw. Positionierung und
Produktivität steigern und Kosten senken in Consumer Supply Chains
 M A N A G E M E N T T A L K Produktivität steigern und Kosten senken in Consumer Supply Chains Datum I Ort 24. MAI 2016 Courtyard by Marriott Zürich Nord, Zürich-Oerlikon Referenten STEFAN GÄCHTER Leiter
M A N A G E M E N T T A L K Produktivität steigern und Kosten senken in Consumer Supply Chains Datum I Ort 24. MAI 2016 Courtyard by Marriott Zürich Nord, Zürich-Oerlikon Referenten STEFAN GÄCHTER Leiter
Industrie 4.0. Integrative Produktion. Aachener Perspektiven. Aachener Perspektiven. Industrie 4.0. Zu diesem Buch
 Zu diesem Buch»Industrie 4.0«zählt zu den Zukunftsprojekten der Hightech-Strategie der Bundesregierung. Sie umfasst nicht nur neue Formen intelligenter Produktions- und Automatisierungstechnik, sondern
Zu diesem Buch»Industrie 4.0«zählt zu den Zukunftsprojekten der Hightech-Strategie der Bundesregierung. Sie umfasst nicht nur neue Formen intelligenter Produktions- und Automatisierungstechnik, sondern
Das Weltszenario morgen: Globale Verschiebung der ökonomischen Gewichte bis 2050
 Das Weltszenario morgen: Globale Verschiebung der ökonomischen Gewichte bis 2050 B. Esser 1 Das Weltszenario morgen: Globale Verschiebung der ökonomischen Gewichte bis 2050 Bernhard Esser Direktor HSBC
Das Weltszenario morgen: Globale Verschiebung der ökonomischen Gewichte bis 2050 B. Esser 1 Das Weltszenario morgen: Globale Verschiebung der ökonomischen Gewichte bis 2050 Bernhard Esser Direktor HSBC
Workshop 1: Strategische Planung
 BPW Business School Strategie Workshop 1: Strategische Planung Hans-Jürgen Buschmann Strategie - Organisation - Mediation BPW Business ist eine Initiative des Businessplan-Wettbewerbs Berlin-Brandenburg
BPW Business School Strategie Workshop 1: Strategische Planung Hans-Jürgen Buschmann Strategie - Organisation - Mediation BPW Business ist eine Initiative des Businessplan-Wettbewerbs Berlin-Brandenburg
Unternehmenspolitik. Unternehmensführung im strategischen Kontext. Inhalt
 Unternehmenspolitik. Unternehmensführung im strategischen Kontext Inhalt Seite 1 Grundlagen und Überblick 1 1.1 Unternehmenspolitik, strategische Führung, strategisches Management 1 1.1.1 Begriff und Gegenstand
Unternehmenspolitik. Unternehmensführung im strategischen Kontext Inhalt Seite 1 Grundlagen und Überblick 1 1.1 Unternehmenspolitik, strategische Führung, strategisches Management 1 1.1.1 Begriff und Gegenstand
Arbeitsschutz in der 4.0-Welt
 Arbeitsschutz in der 4.0-Welt Präsentation anlässlich des Arbeitsmedizinischen Kolloquiums München, 9. März 2016 Dr. Christoph Serries Bundesministerium für Arbeit und Soziales Überblick 1. Einführung:
Arbeitsschutz in der 4.0-Welt Präsentation anlässlich des Arbeitsmedizinischen Kolloquiums München, 9. März 2016 Dr. Christoph Serries Bundesministerium für Arbeit und Soziales Überblick 1. Einführung:
Entwicklungsberatung - wir begleiten und unterstützen Sie
 Entwicklungsberatung - wir begleiten und unterstützen Sie Eine umfassende Betreuung Ihrer Entwicklung im Rahmen einzelner PE/OE-Maßnahmen und integrierter, ganzheitlicher Entwicklungsprogramme ist uns
Entwicklungsberatung - wir begleiten und unterstützen Sie Eine umfassende Betreuung Ihrer Entwicklung im Rahmen einzelner PE/OE-Maßnahmen und integrierter, ganzheitlicher Entwicklungsprogramme ist uns
P R E SSEINFORM AT I ON. Erfolgreich in Deutschland produzieren
 P R E SSEINFORM AT I ON Erfolgreich in Deutschland produzieren Auch in Zeiten globalen Wettbewerbs, steigenden Preisdrucks und hoher Lohnkosten lässt sich in Deutschland wirtschaftlich produzieren. Entscheidende
P R E SSEINFORM AT I ON Erfolgreich in Deutschland produzieren Auch in Zeiten globalen Wettbewerbs, steigenden Preisdrucks und hoher Lohnkosten lässt sich in Deutschland wirtschaftlich produzieren. Entscheidende
Einleitung. 1. Untersuchungsgegenstand und Relevanz. Gegenstand der hier vorliegenden Arbeit ist die Mediation als Instrument der Konfliktlösung
 Einleitung 1. Untersuchungsgegenstand und Relevanz Gegenstand der hier vorliegenden Arbeit ist die Mediation als Instrument der Konfliktlösung 1 und damit v.a. als Mittel außergerichtlicher Konfliktbeilegung
Einleitung 1. Untersuchungsgegenstand und Relevanz Gegenstand der hier vorliegenden Arbeit ist die Mediation als Instrument der Konfliktlösung 1 und damit v.a. als Mittel außergerichtlicher Konfliktbeilegung
Abhängig Beschäftigte mit wöchentlichen Arbeitszeiten
 AZ ARBEITSZEITEN Abhängig Beschäftigte mit wöchentlichen Arbeitszeiten unter 15 Stunden Teilzeitarbeit steigt bei Männern und geht bei Frauen zurück Bearbeitung: Dietmar Hobler, Svenja Pfahl, Sonja Weeber
AZ ARBEITSZEITEN Abhängig Beschäftigte mit wöchentlichen Arbeitszeiten unter 15 Stunden Teilzeitarbeit steigt bei Männern und geht bei Frauen zurück Bearbeitung: Dietmar Hobler, Svenja Pfahl, Sonja Weeber
Innovation und Nachhaltigkeit durch e-manufacturing
 Innovation und Nachhaltigkeit durch e-manufacturing Nicola Knoch, EOS GmbH, Krailling EOS wurde 1989 gegründet - Seit 2002 Weltmarktführer für High-End Laser-Sintersysteme EOS Geschichte 1989 Gründung
Innovation und Nachhaltigkeit durch e-manufacturing Nicola Knoch, EOS GmbH, Krailling EOS wurde 1989 gegründet - Seit 2002 Weltmarktführer für High-End Laser-Sintersysteme EOS Geschichte 1989 Gründung
Deutschland-Check Nr. 37
 Wirtschaftsfreundlichkeit des regionalen Umfelds Ergebnisse des IW-Unternehmervotums Bericht der IW Consult GmbH Köln, 11. April 2013 Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH Konrad-Adenauer-Ufer
Wirtschaftsfreundlichkeit des regionalen Umfelds Ergebnisse des IW-Unternehmervotums Bericht der IW Consult GmbH Köln, 11. April 2013 Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH Konrad-Adenauer-Ufer
Erfahrungen bei der Einführung von Wissensmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen und Verknüpfung mit Web 2.
 Erfahrungen bei der Einführung von Wissensmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen und Verknüpfung mit Web 2.0 Technologien Workshop am 19.4.2011 2 CIMTT Zentrum für Produktionstechnik und
Erfahrungen bei der Einführung von Wissensmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen und Verknüpfung mit Web 2.0 Technologien Workshop am 19.4.2011 2 CIMTT Zentrum für Produktionstechnik und
Automobilbranche in Deutschland
 Automobilbranche in Deutschland Die Deutsche Automobilbranche ist eines der wichtigsten Industriezweige der deutschen Wirtschaft. Keine andere Branche ist so groß und Beschäftigt so viele Menschen wie
Automobilbranche in Deutschland Die Deutsche Automobilbranche ist eines der wichtigsten Industriezweige der deutschen Wirtschaft. Keine andere Branche ist so groß und Beschäftigt so viele Menschen wie
CfSM. www.cfsm.de. in der Praxis. Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky. BME-Sonderveranstaltung zum Tag der Logistik
 Optimierung von Supply Chains in der Praxis Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky BME-Sonderveranstaltung zum Tag der Logistik 14.04.2011 Was ist SC opt? SC opt stellt einen Ansatz zur Optimierung i von Wertschöpfungsnetzwerken
Optimierung von Supply Chains in der Praxis Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky BME-Sonderveranstaltung zum Tag der Logistik 14.04.2011 Was ist SC opt? SC opt stellt einen Ansatz zur Optimierung i von Wertschöpfungsnetzwerken
