3.4 Frontotemporale lobäre Degenerationen
|
|
|
- Margarete Hummel
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 3.4 Frontotemporale lobäre Degenerationen 3.4 Frontotemporale lobäre Degenerationen J. Diehl-Schmid Terminologie Frontotemporale lobäre Degenerationen (FTLD) stellen eine klinisch, neuropathologisch und genetisch heterogene Gruppe von Erkrankungen dar, die durch eine bevorzugt den Frontal- und/oder die Temporallappen betreffende Atrophie charakterisiert ist. Die erste Beschreibung einer FTLD erfolgte durch den Prager Neurologen Arnold Pick im Jahre Er publizierte den Fall eines 71-jährigen Patienten mit einer progressiven Geistesschwäche, bei dem eine hochgradige Sprachstörung aphatischen Charakters auffiel. In der Autopsie fand sich eine ausgeprägte Atrophie des linken Temporallappens (Pick 1892). In den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts rückte die Pick-Krankheit vor allem in der deutschsprachigen Literatur in den Mittelpunkt des Interesses; zahlreiche Fallbeschreibungen wurden publiziert (Schneider 1927). Mit zunehmender Verlagerung des Interesses auf die Alzheimer-Krankheit gerieten die FTLD jedoch in den Hintergrund. Erst in den 1980er-Jahren nahmen sich Forschungsgruppen vor allem in England und Schweden des Themas wieder an und verwendeten viel Mühe darauf, Patientenkollektive zusammenzustellen. Schließlich wurden in der Konsensuskonferenz 1994 die klinischen und pathologischen Kriterien der FTLD, die sog. Lund-Manchester Kriterien (The Lund-and-Manchester-Groups 1994) definiert, die 1998 revidiert wurden (revidierte Lund-Manchester-Kriterien, gelegentlich auch als Neary-Kriterien bezeichnet; s. auch Kapitel 1, Abschnitt Diagnostik und Klassifikation von Demenzerkrankungen mit fokalen Atrophien, S. 99 ff). Seitdem werden nach der Lokalisation des neurodegenerativen Prozesses und damit nach der Symptomatik 3 klinische Syndrome unterschieden (Neary et al. 1998): Frontotemporale Demenz: Bei dieser Demenzform, der häufigsten klinischen Manifestation der FTLD, ist der neurodegenerative Prozess in erster Linie auf den Frontallappen fokussiert. Von einigen Autoren wird die frontotemporale Demenz auch als frontale Variante der frontotemporalen Demenz bezeichnet. Durchzusetzen scheint sich die Terminologie der aktuellen, revidierten Diagnosekriterien, die die frontotemporale Demenz als behaviorale Variante der frontotemporalen Demenz bezeichnet (Rascovsky et al. 2011a). Dieser Terminus wird auch im Folgenden verwendet werden. Semantische Demenz (auch temporale Variante der frontotemporale Demenz oder semantische Variante der primär-progredienten Aphasie genannt): Diese wird durch eine bilaterale, häufig asymmetrische, linksbetonte Atrophie der anterioren Temporallappen verursacht. Progrediente, nicht flüssige Aphasie (auch nicht flüssige Variante der primär-progressiven Aphasie): Diese ist durch einen Nervenzelluntergang vor allen des frontalen inferioren Gyrus, des Prämotorkortex und der Insel der sprachdominanten Hemisphäre gekennzeichnet Epidemiologie Prävalenz und Inzidenz der FTLD sind relativ gering. Die Zahlen beruhen auf vergleichsweise kleinen Studien. Die Prävalenz wird auf 3 15 von erwachsenen Personen unter 65 Jahren geschätzt (Ratnavalli et al. 2002; Rosso 2003). Die Inzidenz wird mit 3 4 von Personen in der entsprechenden Altersklasse angegeben (Knopman et al. 2004; Mercy et al. 2008). Sowohl in Hinblick auf die Prävalenz als auch auf die Inzidenz entsprechen die Zahlen in etwa denen der präsenilen Alzheimer- Krankheit. Der durchschnittliche Beginn der Erkrankung liegt bei der behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz bei 58 Jahren, bei der semantischen Demenz bei 60 und bei der progredienten, nicht flüssigen Aphasie bei 63 Jahren (Johnson et al. 2005), wobei es einzelne Patienten gibt, bei denen die ersten Symptome schon in der 3. Lebensdekade auftreten. Bei einem Teil der Patienten liegt der Erkrankungsbeginn allerdings jenseits des 65. Lebensjahrs (Gislason et al. 2003), sodass die FTLD ihrem Ruf als präsenile Erkrankung nicht wirklich gerecht wird. Von der behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz und von der semantischen Demenz scheinen etwas mehr Männer als Frauen betroffen zu sein; bei der progredienten, nicht flüssigen Aphasie ist das Verhältnis umgekehrt (Johnson et al. 2005) Symptomatik Behaviorale Variante der frontotemporalen Demenz Bei schleichendem Beginn der Erkrankung und allmählicher Verschlechterung wirken die Patienten zunehmend oberflächlich und desinteressiert, einhergehend mit einem Verlust an Empathie bei gleichzeitiger Affektverflachung. Soziale Kontakte werden aufgegeben; der Antrieb ist gemindert. Diese Veränderungen sind sicherlich dem größten Teil der Patienten mit behavioraler Variante der frontotemporalen Demenz gemein. Die ansonsten auftretenden Verhaltensauffälligkeiten unterscheiden sich in Art und Ausmaß jedoch sehr, sowohl zwischen den Patienten als auch beim individuellen Patienten im Verlauf. Bei einem Teil der Patienten stehen Enthemmung und Distanzlosigkeit im Vordergrund und führen dazu, dass die Erkrankten sich taktlos und sozial inadäquat benehmen. 233
2 3 Krankheiten mit Demenz Nicht selten führt die Enthemmung auch zu auffälligem bzw. gefährlichem Verhalten im Straßenverkehr. Untersuchungen zeigten, dass Patienten mit behavioraler Variante der frontotemporalen Demenz und semantischer Demenz als Autofahrer aggressiver und risikoreicher fahren im Gegensatz zu Patienten mit Alzheimer-Krankheit, deren Fahrstil sich zwar auch verändert, die aber eher langsam, übervorsichtig und unsicher fahren (Ernst et al. 2010). Einige Patienten mit behavioraler Variante der frontotemporalen Demenz fallen durch Reizbarkeit und Aggressivität auf. Unmäßige Nahrungsaufnahme, unter anderem von Süßigkeiten, ist nicht selten im Verlauf zu beobachten; bei einigen Patienten tritt auch ein vermehrter Alkohol- und/oder Nikotinkonsum auf. Veränderte Essgewohnheiten dahingehend, dass bestimmte Nahrungsmittel bevorzugt werden, können vorkommen. Motorische Unruhe mit Bewegungsdrang wie auch ritualistische oder sich stereotyp wiederholende Verhaltensweisen, die meist komplexer sind als die bei Patienten mit Alzheimer-Demenz beschriebenen Bewegungsabläufe, treten teilweise schon in frühen Stadien der Erkrankung auf. Einige Patienten bestehen z. B. auf regelmäßigen Aktivitäten zur bestimmten Tageszeit. Manchmal sammeln die Patienten mehr oder weniger sinnvolle Dinge bis hin zu Müll. Einige Patienten fixieren sich auf Puzzles, Kreuzworträtsel, Sudoku oder auch Glücksspiele. Bei manchen Patienten fallen hypochondrische Fixierungen auf; sie klagen gehäuft über zum Teil merkwürdig anmutende körperliche Beschwerden. Typischerweise ist die Krankheitseinsicht der Patienten deutlich reduziert, häufig sogar ganz aufgehoben (Neary et al. 1998; Hodges 2007; Rascovsky et al. 2011a). Die kognitiven Störungen der behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz betreffen vor allem die Bereiche der Aufmerksamkeit und der exekutiven Funktionen. Letzteres ist ein Sammelbegriff für alle mentalen Prozesse höherer Ordnung, die planmäßiges, zielgerichtetes und effektives Handeln ermöglichen. Der Sprachantrieb ist meist reduziert (Perry u. Hodges 2000), wenngleich in Einzelfällen ein ausgesprochener Rededrang zu beobachten ist. Zeitliche und örtliche Orientiertheit sowie visuellräumliche Fähigkeiten sind gewöhnlich lange im Verlauf nur gering beeinträchtigt. Die Gedächtnisleistung kann in den frühen Stadien der Erkrankung weitgehend unbeeinträchtigt sein und ist im Verlauf meist besser als diejenige von Patienten mit Alzheimer-Demenz (Hodges u. Miller 2001). Auffallende Defizite zeigen die Patienten dagegen in Tests der sozialen Kognition, z. B. in Tests der Theory of Mind (Adenzato et al. 2010). Bewegungsstörungen gehören nicht zum typischen Bild der reinen behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz; jedoch können extrapyramidal-motorische Symptome im Verlauf auftreten, vor allem eine Bradykinese sowie Haltungs- bzw. Gangstörungen. Die Patienten sind manchmal schon früh im Krankheitsverlauf harninkontinent, später auch stuhlinkontinent (Neary et al. 1998; Diehl-Schmid et al. 2007a). Die aktuellen Diagnosekriterien der behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz sind in Tab. 3.5 dargestellt. Bis zu 15 % der Patienten mit FTLA leiden gleichzeitig an einer amyotrophen Lateralsklerose (Lomen-Hoerth et al. 2003). Es kommt zu Funktionseinschränkungen der Muskulatur der Extremitäten und des Rumpfes bzw. der Gesichtsmuskulatur. Faszikulationen, Hyperreflexie, Spastik und Krampi treten im Verlauf auf (Brooks et al. 2000). Zusätzlich zu den motorischen Symptomen können im Verlauf einer amyotrophen Lateralsklerose Symptome der behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz, sehr selten auch der semantischen Demenz oder der progredienten, nicht flüssigen Aphasie, vorkommen. In rund 5% der Fälle entwickelt sich das Vollbild der behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz bzw. der semantischen Demenz oder der progredienten, nicht flüssigen Aphasie. Andererseits können aber auch im Verlauf einer behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz (selten einer semantischen Demenz oder der progredienten, nicht flüssigen Aphasie) die Symptome einer amyotrophen Lateralsklerose dazukommen (Murphy et al. 2007). Auf die gemeinsame neuropathologische Grundlage von FTLA und amyotropher Lateralsklerose wird in Kapitel 1 (Abschnitt Neuropathologie, S. 67 ff) hingewiesen. Semantische Demenz Die semantische Demenz ist durch eine Störung des semantischen Wissens infolge eines allmählichen Verlusts des semantischen Gedächtnisses (die Komponente des Langzeitgedächtnisses, die unser Weltwissen wie auch das Wissen über Worte und deren Bedeutung beinhaltet) gekennzeichnet. Die Patienten verlieren das Wissen über die Bedeutung von Worten, Namen, Gesichtern, Gegenständen usw. Es kommt zu schweren Störungen des Benennens und des Sprachverständnisses (Neary et al. 1998; Gorno-Tempini et al. 2011). Die aktuellen Diagnosekriterien sind in Tab. 3.6 dargestellt. Die semantische Demenz ist durch eine flüssige Aphasie gekennzeichnet; die Sprache ist in Form, Geschwindigkeit und Quantität lange Zeit unauffällig. Die auftretenden Wortfindungsstörungen werden umschifft oder durch Füllwörter und Floskeln ersetzt. Die Sprache wird trotz erhaltener Flüssigkeit zunehmend inhaltsleer (Hodges et al. 2007a). Semantische Paraphasien treten in der Spontansprache eher diskret auf, sind aber in Tests des Benennens schon früh im Verlauf offensichtlich. Nach und nach reduziert sich der (sowohl aktive als auch passive) Wortschatz, bis zuletzt nur noch Füllwörter und Floskeln übrig sind, die die Patienten oft stereotyp perseverieren (Hod- 234
3 3.4 Frontotemporale lobäre Degenerationen Tab.3.5 Behaviorale Variante der frontotemporalen Demenz (bvftd). Revidierte Diagnosekriterien (Quelle: Rascovscy et al. 2011a). Revidierte Diagnosekriterien der bvftd I. Voraussetzung: neurodegenerative Erkrankung mit progredienter Verschlechterung von Verhalten und/oder Kognition, die durch den Untersucher z. B. im Rahmen von mehreren Untersuchungen beobachtet werden kann oder anamnestisch (von einem verlässlichen Informanten) berichtet wird II. Mögliche bvftd: 3 der folgenden Symptome (A F) sind erforderlich (anhaltend oder wiederkehrend, nicht vereinzelt oder selten auftretend): A: frühzeitig 1) Enthemmung (obligat ist mindestens 1 der Symptome A.1 A.3): A.1: sozial unangemessenes Verhalten A.2: Verlust von Umgangsformen oder Anstand A.3: impulsive, unüberlegte oder achtlose Handlungen B: frühzeitig Apathie oder Passivität (mindestens 1 der Symptome von B.1 B.2): B.1: Apathie (fehlender Antrieb) B.2: Passivität (Trägheit, Schwerbeweglichkeit) C: frühzeitig Verlust von Mitgefühl oder Einfühlungsvermögen (mindestens 1 der Symptome von C.1 C.2): C.1: vermindertes Eingehen auf Bedürfnisse und Gefühle anderer C.2: vermindertes Interesse an sozialen Kontakten und Beziehungen, Abnahme persönlicher Wärme D: frühzeitig perseveratives, stereotypes oder zwanghaftes/ritualisiertes Verhalten (mindestens 1 der Symptome von D.1 D.3): D.1: einfache repetitive Bewegungen D.2: zwanghaftes oder ritualisiertes komplexes Verhalten D.3: sprachliche Stereotypien E: Hyperoralität und Veränderungen der Ernährung (mindestens 1 der Symptome von E.1 E.3): E.1: veränderte Vorlieben für Speisen E.2: Essanfälle, vermehrter Konsum von Alkohol oder Zigaretten E.3: In-den-Mund-Nehmen oder Verzehren von nicht essbarem Material F: neuropsychologisches Profil: Defizit von Exekutive/Produktion bei relativ unveränderten Gedächtnis- und visuell-räumlichen Leistungen (obligat sind alle Symptome von F.1 F.3): F.1: Defizit bei Aufgaben mit exekutiver Komponente F.2: relativ erhaltenes episodisches Gedächtnis F.3: relativ erhaltene visuell-räumliche Leistungen III. Wahrscheinliche bvftd: alle folgenden Kriterien (A C) müssen vorliegen: A: die Kriterien für die mögliche bvftd werden erfüllt B: der Patient zeigt eine deutliche Minderung der Leistungsfähigkeit (nach Angaben der Bezugspersonen oder nachweisbar anhand entsprechender Werte der Clinical-Dementia-Rating-Skala oder des Functional Activity Questionnaire) C: die Befunde der kranialen Bildgebung sind mit der bvftd vereinbar (mindestens 1 Befund aus C.1 C.2): C.1: frontale und/oder anteriore temporale Atrophie im kranialen MRT oder CT C.2: frontale Hypoperfusion oder frontaler Hypometabolismus im PET oder SPECT IV. bvftd mit definitiver FTLA-Pathologie (Kriterium A und entweder B oder C): A: die Kriterien für mögliche oder wahrscheinliche bvftd Demenz sind erfüllt B: histopathologischer Nachweis einer FTLA durch Biopsie oder Autopsie C: Vorliegen einer bekannten pathogenen Mutation V. Ausschlusskriterien für bvftd: A und B sind Ausschlusskriterien, C kann bei möglicher bvftd Demenz vorliegen, ist aber Ausschlusskriterium für die wahrscheinliche bvftd: A: die Defizite lassen sich besser durch andere nicht degenerative Erkrankungen des Nervensystems oder andere Erkrankungen erklären B: die Verhaltensauffälligkeiten lassen sich besser durch eine psychische Erkrankung erklären C: die Biomarker weisen stark auf das Vorliegen einer Alzheimer-Krankheit oder einer anderen neurodegenerativen Erkrankung hin 1) frühzeitig bedeutet: Auftreten des jeweiligen Symptoms innerhalb der ersten 3 Jahre nach Beschwerdebeginn 235
4 3 Krankheiten mit Demenz Tab.3.6 Klinische 1) Diagnose der semantischen Variante der primär-progredienten Aphasie (Quelle: Gorno-Tempini et al. 2011). Klinische Diagnose der semantischen Variante der primär-progredienten Aphasie Beide der folgenden Hauptkriterien müssen vorliegen Mindestens 3 der folgenden Kriterien müssen zusätzlich vorliegen Störung des Einzelwortbenennens (Bilder oder Objekte), insbesondere bei wenig vertrauten oder niederfrequenten Items Störung des Einzelwortverständnisses gestörtes Wissen über Objekte und/oder Personen, insbesondere bei wenig bekannten oder niederfrequenten Items Oberflächendyslexie und/oder -dysgrafie 1) Für die bildgebungsgestützte Diagnose müssen zusätzlich eine Atrophie und/oder eine Hypoperfusion bzw. ein Hypometabolismus vor allem im Bereich der anterioren Temporallappen vorliegen. ges et al. 2007b). Inhaltlich wird die Sprache schließlich nahezu unverständlich; dies scheint den Patienten selbst aber nicht aufzufallen. Die Wortflüssigkeit ist reduziert, wobei die phonematische Wortflüssigkeit aber relativ besser ist als die semantische (Marczinski et al. 2006). Die Fähigkeit des Nachsprechens ist für kürzere Wörter gut; bei längeren Wörtern fällt auf, dass das Wiederholen ohne semantisches Wissen erfolgt. Beim Lesen kommt es aus demselben Grund zur Oberflächendyslexie, wenn Patienten ein Wort laut vorlesen sollen, das anders als geschrieben ausgesprochen wird (z. B. Niveau ); sie lesen Buchstaben für Buchstaben. Ein weiteres für die semantische Demenz typisches Merkmal sind ausgeprägte Sprachverständnisschwierigkeiten. Vor allem das Verständnis einzelner Wörter ist gestört, egal ob mündlich oder schriftlich dargeboten. Mit zunehmender Sprachverständnisstörung reduziert sich die Fähigkeit der Patienten, an Unterhaltungen teilzunehmen. Mit dem Verlust des semantischen Wissens geht bei der semantischen Demenz eine Störung der Objekterkennung einher (Mesulam et al. 2009). Während Gegenstände, die sich im alltäglichen Gebrauch des Patienten befinden, anfangs noch problemlos verwendet werden, zeigt sich bei einem Teil der Patienten schon früh eine Unfähigkeit, weniger alltägliche Gegenstände (z. B. einen Hefter) richtig zu benutzen. Diese Störung kann so weit fortschreiten, bis die Patienten nichts mehr mit einer Schere, einem Löffel oder einer Bürste anfangen können. Aufgrund der Störung des konzeptuellen Wissens haben die Patienten auch Schwierigkeiten, z. B. auditorisch, gustatorisch oder anderweitig dargebotenes Material zu erkennen, wohingegen das Erkennen von Zahlen und Farben offensichtlich lange weitgehend intakt ist (Hodges u. Miller 2001). Das episodische Gedächtnis ist zumindest zu Beginn der Erkrankung gut erhalten. Auch die Orientierung und die visuokonstruktiven Fähigkeiten sind lange weitgehend normal (Diehl et al. 2005a). Manchmal schon mit Beginn der ersten sprachlichen Symptome, spätestens aber im weiteren Verlauf treten auch bei der semantischen Demenz Veränderungen des Sozialverhaltens und des Affekts auf, ähnlich wie bei der behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz (Bozeat et al. 2000). Hier zeigen sich vor allem Apathie, Reizbarkeit und ein Verlust an emotionaler Wärme. Die Patienten wirken zunehmend auf sich und bestimmte Interessen eingeengt; bei machen Patienten tritt eine übermäßige Sparsamkeit zutage. Manchmal fällt eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten auf, die sich z. B. im ausschließlichen Essen bestimmter Nahrungsmittel äußert. Im Verlauf zeigt sich häufig zwanghaft anmutendes, perseveratives Verhalten (Lösen von Kreuzworträtseln, Ausschneiden von Anzeigen aus der Zeitung) zusammen mit einer zunehmenden Enthemmung, die zu taktlosem, dissozialem und sogar delinquentem Verhalten führen kann (Diehl et al. 2005b). Hintergrundwissen Schwierigkeiten beim Erkennen von Gesichtern im Sinne einer Prosopagnosie stehen bei denjenigen Patienten zu Beginn der Erkrankung im Vordergrund der Symptomatik, bei denen der neurodegenerative Prozess im rechten Temporallappen lokalisiert ist (Seeley et al. 2005). Verglichen mit der linksbetonten semantischen Demenz sind bei der rechtsbetonten die Wortfindungs- und die Sprachverständnisstörungen seltener, eine Veränderung des Sozialverhaltens und ein Verlust der Krankheitseinsicht dagegen häufiger. Progrediente nicht-flüssige Aphasie Im Vordergrund der schleichend beginnenden Sprachstörung stehen ausgeprägte Wortfindungsstörungen, häufig begleitet von Pausen, in denen die Patienten das richtige Wort suchen ( Tab. 3.7; Gorno-Tempini et al. 2011). Die Wortfindung ist hierbei auf der Ebene des phonematischen Zugriffs gestört; dies wird von den Patienten als Tip-of-the-Tounge -Phänomen geschildert. Sie wissen also, was sie sagen möchten, bekommen das Wort aber nicht über die Lippen. Das schriftliche Benennen fällt den Patienten daher leichter. Das Benennen von Verben ist schwerer beeinträchtigt als das Benennen von Gegenständen (Graham u. Rochon 2007). Dementsprechend finden sich auch in der Spontansprache relativ weniger Verben. Das Sprechtempo ist insgesamt verlangsamt. In Tests der Wortflüssigkeit schneiden Patienten mit progredienter, nicht flüssiger Aphasie (PNFA) unterdurch- 236
5 3.4 Frontotemporale lobäre Degenerationen Tab.3.7 Klinische 1) Diagnose der agrammatischen/nicht flüssigen Variante der primär-progredienten Aphasie (Quelle: Gorno-Tempini et al. 2011). Klinische Diagnose der semantischen Variante der agrammatischen/nicht flüssigen Aphasie Beide der folgenden Hauptkriterien müssen vorliegen Mindestens 2 der 3 folgenden Kriterien müssen zusätzlich vorliegen grammatikalische Fehler und (syntaktische) Vereinfachung des sprachlichen Output Sprachanstrengung mit Störung der phonematischen Ebene mit Elisionen, Substitutionen, Additionen oder Entstellungen von Lauten (kann das Bild einer Sprechapraxie widerspiegeln) gestörtes Verständnis syntaktisch komplexer Sätze; Verständnis syntaktisch simpler Sätze ist weitgehend erhalten erhaltenes Einzelwortverständnis erhaltenes Objektwissen 1) Für die bildgebungsgestützte Diagnose müssen zusätzlich eine Atrophie und/oder eine Hypoperfusion bzw. ein Hypometabolismus des frontalen Inselgebiets links vorliegen. schnittlich ab, wobei die phonematische Wortflüssigkeit (z. B. S-Wörter) relativ stärker reduziert ist als die semantische (z. B. Tiere; Marczinski u. Kertesz 2006). Weiterhin finden sich bei der PNFA grammatikalische Fehler und Störungen der Syntax. Im Verlauf kommt es nicht selten zu einem angestrengt wirkenden Telegrammstil, der dem Sprachstil von Patienten mit Broca-Aphasie nach akutem ischämischem Ereignis sehr ähnelt. In unterschiedlichem Ausmaß liegt eine Sprechapraxie vor, bei der die Programmierung von Sprechbewegungen gestört ist, sodass es zu phonologischen Fehlern, Artikulationsstörungen bzw. phonematischen Paraphasien kommt. Nicht selten fällt zudem eine ausgeprägte Dysarthrie bzw. Dysarthrophonie mit einer Störung des normalen Sprechrhythmus und der Betonung auf. Während das Sprachverständnis für einzelne Wörter intakt ist, ist das Verständnis für ganze Sätze und deren grammatikalischen Aufbau eingeschränkt. Dabei werden die wichtigen Wörter im Gespräch erkannt, sodass adäquate Antworten erfolgen (Mesulam 2003; Grossman et al. 2004; Hodges et al. 2007a). Merke Die Erinnerungsfähigkeit für Alltagsereignisse, das Urteilsvermögen und die soziale Kompetenz zusammen mit der Fähigkeit, die Alltagsaktivitäten zu erledigen, bleiben bei Patienten mit progredienter, nicht flüssiger Aphasie lange unbeeinträchtigt (Sonty et al. 2003). Leicht ausgeprägte Verhaltensauffälligkeiten, am häufigsten Apathie, treten im Verlauf auf, sollten das klinische Bild aber über einen längeren Zeitraum nicht dominieren. Die Krankheitseinsicht von Patienten mit PNFA ist in den frühen Stadien der Erkrankung uneingeschränkt; sie erkennen ihre Defizite und leiden meist auch darunter, sich nicht mehr problemlos verständigen zu können. Im Verlauf nimmt diese Krankheitseinsicht jedoch ab (Bank u. Weintraub 2008). Nicht selten entwickeln sich im fortgeschrittenen Stadium zudem eine deutliche Wesensveränderung und Verhaltensauffälligkeiten, sodass die Patienten letztlich nicht mehr von Patienten mit einer fortgeschrittenen frontotemporalen Demenz unterscheidbar sind (Kertesz et al. 2003). Die Sprachstörung schreitet im Verlauf häufig bis zum völligen Mutismus fort. Hintergrundwissen Von der PNFA und der semantischen Demenz wird neuerdings eine weitere Form der Sprachstörung abgegrenzt: die logopenische progrediente Aphasie (LPA) mit Wortfindungsstörungen und reduziertem Output bei gleichzeitig jedoch relativ gut erhaltener Syntax und Phonologie und ohne offensichtliche Sprachanstrengung und Sprechapraxie (Gorno-Tempini et al. 2008). Klinisch fehlen bei der LPA der für die progrediente, nicht flüssige Aphasie typische Agrammatismus und die Probleme der Artikulation. Dagegen ist das Verständnis für Satzstrukturen schwer beeinträchtigt. Bei Patienten mit logopenischer progredienter Aphasie finden sich zudem vergleichsweise häufiger als bei semantischer Demenz und PNFA schon im Frühstadium nicht sprachliche kognitive Symptome, vor allem Gedächtnisdefizite. Am ehesten scheint die LPA als atypische, sprachbetonte Form der Alzheimer-Krankheit zu werten zu sein. Untersuchungen mit Amyloid-PET ( 11 C-PIB-PET) machten deutlich, dass bei Patienten mit logopenischer progredienter Aphasie eine PIB-Anreicherung nachweisbar ist (Rabinovici et al. 2008). In einer neuropathologischen Untersuchung ließ sich bei Patienten mit progredienter, nicht flüssiger Aphasie die Pathologie einer FTLA nachweisen. Bei einem Großteil der Patienten mit LPA zeigte sich dagegen eine Alzheimer-Pathologie. Beim individuellen Patienten war in dieser Studie allerdings kein klinischer Prädiktor aufzufinden, der eine zweifelsfreie Zuordnung zur Pathologie hätte erlauben können (Mesulam et al. 2008). Eine Übersicht über die bei PNFA, semantischer Demenz und LPA unterschiedlichen Befunde zeigt Tab
6 3 Krankheiten mit Demenz Tab.3.8 Befunde von nicht flüssiger, progredienter Aphasie (PNFA), semantischer Demenz und logopenischer Aphasie (LPA). Diagnostik PNFA Semantische Demenz LPA Klinik strukturelle Bildgebung funktionelle Bildgebung Agrammatismus Wortfindungsstörungen Sprechapraxie phonematische Paraphasien Atrophie inferior frontal/inselregion links z. B. Hypometabolismus frontal links semantisches Defizit flüssige, inhaltsleere Sprache Sprachverständnisstörung Störung der Objekterkennung Atrophie anterior temporal links (und zum Teil rechts) z.b. Hypometabolismus anterior temporal links (und zum Teil rechts) Wortfindungsstörungen reduzierter Output Phonologie und Syntax relativ erhalten Atrophie posterior temporal und inferior parietal links z.b. Hypometabolismus temporoparietal links Pathologie Tau-positiv, TDP-43-positiv meist Tau-negativ, TDP-43-positiv Tau-Fibrillen, amyloide Plaques Kortikobasale Degeneration und progressive supranukleäre Paralyse Sowohl klinisch als auch histopathologisch gibt es Überschneidungen zwischen den FTLA und atypischen Parkinson-Syndromen. Patienten mit kortikobasaler Degeneration bzw. progressiver supranukleärer Paralyse können im Verlauf die für eine progrediente, nicht flüssige Aphasie typische Sprachstörung oder Verhaltensveränderungen wie bei der behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz entwickeln. Andererseits gibt es Patienten mit FTLA, die im Verlauf die motorischen Symptome der kortikobasalen Degeneration oder der progressiven supranukleären Paralyse entwickeln (Kertesz et al. 2005). Die kortikobasale Degeneration (CBD) wurde früher als ein rein neurologisches Syndrom betrachtet. Die motorischen Merkmale der CBD sind progressive, asymmetrische und L-DOPA-resistente Rigidität und Apraxie, das Zeichen der fremdartigen Extremität ( Alien Limb Sign ) sowie Myoklonie, Dystonie und Tremor (Boeve et al. 2003). Die ersten Patienten mit kortikobasaler Degeneration wurden von Spezialisten aus dem Gebiet der Bewegungsstörungen beschrieben, sodass kognitive Beeinträchtigungen oder Verhaltensveränderungen weniger berücksichtigt und dokumentiert wurden. Einige Patienten zeigen aber schon früh im Krankheitsverlauf Störungen der Kognition mit Betonung frontal-exekutiver Funktionen (Grimes et al. 1999), teilweise auch Gedächtnisstörungen und/oder eine verminderte Sprachproduktion bzw. eine PNFA, die bis zum Mutismus fortschreiten kann (Lang 2003). Bei einem Teil der Patienten mit CBD sind Verhaltensänderungen festzustellen, die den bei der behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz auftretenden Auffälligkeiten sehr ähnlich sind, wie Antriebsminderung, Interessensverlust, sozialer Rückzug, Persönlichkeitsveränderungen und Reizbarkeit (Kertesz u. Munoz 2004). Die progressive supranukleäre Paralyse (PSP) ist das häufigste akinetisch-rigide Syndrom nach der Parkinson- Krankheit. Die charakteristischen motorischen Symptome der PSP sind axiale Rigidität, Bradykinese, vertikale Blickparese bzw. Verlangsamung der vertikalen Sakkaden, Extension des Nackens und posturale Instabilität. Die Bewegungsstörungen sprechen kaum auf Dopamin an. In der Bildgebung zeigt sich im Verlauf häufig eine Vergrößerung des III. Ventrikels mit Erweiterung der Cisterna interpeduncularis und der Cisterna magna bei Mittelhirnatrophie sowie eine frontotemporale Atrophie (Litvan 2004). Ein Teil der Patienten mit PSP zeigt gleichzeitig mit (manchmal schon vor) Beginn der neurologischen Symptome kognitive Störungen, wie Verlangsamung, reduzierte Aufmerksamkeit, herabgesetzte Wortflüssigkeit, erhöhte Interferenzanfälligkeit und Perseverationstendenz bei vergleichsweise gut erhaltenen Gedächtnisleistungen (Grafman et al. 1990; Pillon et al. 1993). Darüber hinaus können zum Teil ausgeprägte Verhaltensänderungen auftreten (Litvan 2004; Yatabe et al. 2011). Bei einem Teil der Patienten mit PSP zeigen sich eine Sprechapraxie bzw. eine PNFA (Josephs u. Duffy 2008) Verlauf und Todesursachen Der durchschnittliche Krankheitsverlauf von Krankheitsbeginn bis zum Tod beträgt bei der behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz durchschnittlich 7 10 Jahre (Rascovsky et al. 2011b). Patienten mit semantischer Demenz haben eine längere Überlebenszeit mit rund 13 Jahren (Hodges u. Patterson 2007b). Es gibt rasch progrediente Krankheitsverläufe, ebenso wie sehr schleichende Verläufe (1 30 Jahre; Diehl-Schmid et al. 2007b). Patienten mit Tau-negativer Pathologie weisen einen rascheren Verlauf auf als Patienten mit Tau-positiver Pathologie. Auch das Vorhandensein von extrapyramidalmotorischer Symptomatik bzw. das gleichzeitige Auftreten einer Motoneuronerkrankung beeinflussen den Verlauf ungünstig (Rascovsky et al. 2011b). Die häufigsten Todesursachen sind Atemwegserkrankungen, hier vor allem (Aspirations-)Pneumonien, gefolgt von kardialen bzw. kardiovaskulären Erkrankungen und Kachexien (Nunnemann et al. 2011). 238
7 3.4.5 Ätiologie und Risikofaktoren Merke Bislang sind keine nicht genetischen Risikofaktoren für die FTLA bekannt (Rosso et al. 2003; Diehl et al. 2005c). Insbesondere hat zunehmendes Alter der wichtigste Risikofaktor für die Entstehung der Alzheimer-Demenz keinen Einfluss auf die Entwicklung einer FTLA. Bei Patienten mit einer FTLA findet sich eine positive Familienanamnese in % der Fälle (Chow et al. 1999). Eine autosomal-dominante Vererbung liegt in rund 10 % der Fälle vor (Goldman et al. 2004); sie kommt am häufigsten bei der behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz vor und stellt bei der semantischen Demenz die Ausnahme dar (Goldman et al. 2005). Bisher wurden mehrere Gene identifiziert: Im MAPTau- Gen auf Chromosom 17 und dem ebenfalls auf Chromosom 17 lokalisierten Progranulingen finden sich die meisten Mutationen. In seltenen Fällen sind Mutationen an folgenden Genen nachweisbar (Mackenzie et al. 2010a): VCP-Gen (Genmutation verursacht die seltene familiäre Einschlusskörpermyopathie mit Paget-Knochenerkrankung und frontotemporaler Degeneration) Chromatin-modifying-Protein-2B-Gen auf Chromosom 3 FUS-Gen auf Chromosom 16 TAR-DNA-binding-Protein-Gen auf Chromosom 1 C90RF72-Gen auf Chromosom Frontotemporale lobäre Degenerationen Pathologie Die Gemeinsamkeit des makroskopischen neuropathologischen Befunds hat den FTLA ihren Namen gegeben. Mit unterschiedlich scharfer Begrenzung gegen die umgebenden, nicht betroffenen Areale erstreckt sich die zerebrale Atrophie auf den frontalen und/oder den temporalen Kortex ( Abb. 3.3). In wechselndem Ausmaß können Basalganglien sowie das motorische System in Mitleidenschaft gezogen sein. Neben unspezifischen Veränderungen in diesen Hirnregionen mit Nervenzellverlust und reaktiver Gliose finden sich in nahezu allen Gehirnen von Patienten mit FTLA abnorme Proteinablagerungen in Form von neuronalen und glialen Einschlusskörperchen. Die derzeit gängige neuropathologische Klassifikation der FTLA basiert auf der immunhistochemischen und biochemischen Charakterisierung der Proteinkomponenten, die in diesen Einschlusskörperchen verklumpen (Cairns et al. 2007). Bei etwa % der Patienten mit FTLA bestehen diese Einschlusskörperchen aus dem MAPTau, dessen physiologische Funktion unter anderem die Stabilisierung der axonalen Mikrotubuli ist. Die pathologischen Einschlüsse, die aus hyperphosphoryliertem Tau-Protein bestehen, können dabei sowohl in Nervenzellen als auch in Oligodendrozyten und Astrozyten auftreten. Diese Gruppe der FTLA kann als Tauopathien zusammengefasst werden. Dazu gehören familiäre Fälle, die durch Mutationen im MAPTau-Gen verursacht werden, und sporadische Fälle, die sich in Hinblick auf morphologische Aspekte und die Verteilung der Einschlusskörperchen unterscheiden. Zu den sporadischen Fällen zählen z. B. die FTLA mit Pick- Körperchen. Auch die kortikobasale Degeneration und die progressive supranukleäre Paralyse sind Tauopathien. Die größte Gruppe der FTLA (bis zu 70 %) war bislang durch das Auftreten von Tau-negativen Einschlüssen charakterisiert, die sich nur mit dem unspezifischen Marker- Abb.3.3 Atrophie des frontalen und temporalen Kortex (mit freundlicher Genehmigung von Prof. I. Mackenzie, UBC, Vancouver/Canada). 239
8 3 Krankheiten mit Demenz protein Ubiquitin anfärben lassen und deshalb zunächst als FTLA-U bezeichnet wurden. Im Jahre 2006 gelang die Identifizierung des TDP-43 als Hauptproteinkomponente in diesen Einschlüssen bei den meisten FTLA-U-Fällen (Neumann et al. 2006). Unter dem Begriff TDP-43-Proteinopathien werden nun familiäre Formen der FTLA, die durch Mutationen in den Genen für Progranulin und VCP verursacht werden, familiäre Formen mit einer Koppelung an Chromosom 9p sowie sporadische FTLA-U-Fälle mit oder ohne Motoneuronbeteiligung zusammengefasst. Aufgrund der Morphologie und Verteilung der TDP-43- positiven Einschlusskörperchen können 4 unterschiedliche histologische Subtypen der FTLA-U unterschieden werden, die interessanterweise relativ gut mit den unterschiedlichen klinischen Syndromen der FTLA und mit dem zugrunde liegenden Gendefekt bei familiären FTLA- U-Formen korrelieren (Mackenzie et al. 2010b). TDP-43 ist ein hoch konserviertes Kernprotein. Im Krankheitsprozess kommt es zu einer Umverteilung ins Zytoplasma; dort kommt es dann zur Bildung der Einschlusskörperchen. TDP-43 ist auch Bestandteil der charakteristischen neuronalen Einschlusskörperchen bei allen Patienten mit amyotropher Lateralsklerose (Neumann et al. 2006), ausgenommen bei rund 1 % der Träger von Mutationen im Gen der zytosolischen Kupfer-/Zink-Superoxiddismutase (Mackenzie et al. 2007). Zur physiologischen Funktion von TDP-43 ist bislang nur wenig bekannt; es scheint jedoch eine Rolle bei der Verarbeitung von mrna zu haben. Zukünftige Studien werden die zugrunde liegenden Ursachen und Konsequenzen der TDP-43-Akkumulation im neurodegenerativen Prozess klären müssen. Bei rund 10 % der FTLA findet sich das Protein FUS in den neuronalen Einschlusskörperchen (Neumann et al. 2009). FUS ist wie TDP-43 ein DNA-/RNA-bindendes Protein. Eine Unterscheidung der histopathologischen FTLA-Untergruppen ist derzeit klinisch und laborchemisch nicht möglich, auch wenn es einige Hinweise auf Korrelationen zwischen klinischem Typ und zugrunde liegender Pathologie gibt (Josephs et al. 2006; Coon et al. 2011): Bei Patienten mit behavioraler Variante der frontotemporalen Demenz liegt eine Tau-negative und TDP-43-positive Pathologie etwas häufiger vor als eine Tau-positive Pathologie. Bei der semantischen Demenz sind häufiger TDP-43- positive Einschlusskörperchen nachweisbar. Bei Patienten mit progredienter, nicht flüssiger Aphasie ist zu in etwa gleichen Teilen eine Tau-negative wie auch eine Taupositive Pathologie nachweisbar. Dabei weisen Patienten mit einer gleichzeitig offensichtlichen Sprechapraxie eher eine Tau-positive Pathologie auf als Patienten ohne Sprechapraxie. Eine Tau-Pathologie scheint bevorzugt bei älteren Patienten mit langsamem Verlauf der Erkrankung vorzuliegen (Hodges et al. 2003). Patienten mit FUS-positiver Pathologie entwickeln allem Anschein nach vorzugsweise eine behaviorale Variante der frontotemporalen Demenz, erkranken sehr früh (Krankheitsbeginn < 40 Jahre) und weisen in der MRT eine auffällige Kaudatusatrophie auf (Seelaar et al. 2010) Diagnostik Die Diagnostik beinhaltet neben einer ausführlichen Anamnese und Fremdanamnese eine internistische bzw. neurologische Untersuchung (mit besonderem Fokus auf extrapyramidal-motorischen Symptomen, Augenbewegungsstörungen und Schädigungen des 1. bzw. 2. Motoneurons), eine neuropsychologische Testung und Laboruntersuchungen (Blutbild, Serumchemie, Vitamin B 12, Folsäure, Treponema-pallidum-Hämagglutinationstest-Antikörper) sowie eine CT bzw. eine MRT des Schädels. Einen wichtigen Beitrag zur (Differenzial-)Diagnose leisten Verfahren der funktionellen Bildgebung (SPECT, PET) und die Liquoruntersuchung. Fremdanamnese Größten Wert ist auf die Fremdanamnese zu legen. Da die Patienten selbst zumeist eine deutlich reduzierte oder sogar aufgehobene Krankheitseinsicht haben, werden ihre Aussagen selten der Realität entsprechen. Praxistipp Bei der Befragung des Angehörigen empfiehlt es sich, diese durchzuführen, ohne dass der Patient im Raum ist. Zur standardisierten Erfassung der Verhaltensauffälligkeiten bieten sich fremdanamnestische Interviews an, wie die Frontal Systems Behavior Scale (Grace u. Malloy 2001) oder das Frontal Behavioral Inventory. Neuropsychologische Untersuchung Eine neuropsychologische Untersuchung sollte in jedem Fall Tests des Gedächtnisses, der Wortflüssigkeit, des Benennens und der visuell-räumlichen Fähigkeiten beinhalten. Die in den meisten Memory-Kliniken Deutschlands eingesetzte CERAD-Testbatterie empfiehlt sich hierfür. Diese beinhaltet auch den kurzen Mini-Mental- Status-Test. Zusätzlich sollten die exekutiven Fähigkeiten untersucht werden. Eine Auswahl von Tests der Exekutivfunktionen bietet Tab.3.9. Bei den Sprachvarianten können der Aachener Aphasie-Test bzw. Subtests dieses Tests sowie die Bogenhauser Semantik-Untersuchung zum Einsatz kommen. Strukturelle und funktionelle Bildgebung Den klinischen Syndromen behaviorale Variante der frontotemporalen Demenz, semantische Demenz und progrediente, nicht flüssige Aphasie können mittels bildgebender Techniken morphologische und funktionelle 240
9 3.4 Frontotemporale lobäre Degenerationen Tab.3.9 Auswahl von Tests der Exekutivfunktionen. Testbezeichnung Quelle Stroop-Test Stroop 1935 Trail-Making-Test A und B Reitan 1958 Ruff Figural Fluency Test Ruff et al Wisconsin-Card-Sorting-Test Heaton et al Test zum kognitiven Schätzen Brand et al Turm von Hanoi Shallice 1982 Veränderungen zugeordnet werden, die mit den typischen Symptomen korrelieren. Da es sich um chronischprogrediente Erkrankungen handelt, lässt sich so außerdem auch das Fortschreiten dieser Schädigungen nachvollziehen. Bei der behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz findet sich im frühen Stadium eine beide Hemisphären betreffende Atrophie des präfrontalen Kortex und der anterioren Inselregionen, zum Teil auch des anterioren temporalen Kortex und der Basalganglien (Seeley 2009). Allerdings ist auch ein unauffälliger intrazerebraler MRT-Befund mit einer behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz vereinbar (Gregory et al. 1999). Bei der semantischen Demenz findet sich eine häufig asymmetrische (meist links > rechts) Atrophie der Temporallappen, dabei vor allem des Temporalpols (Gorno- Tempini et al. 2004). Bei Patienten mit progredienter, nicht flüssiger Aphasie zeigt sich eine Hirnatrophie vor allem im Temporallappen und in der Inselregion linkshemisphärisch (Gorno-Tempini et al. 2004). Mittels FDG-PET kann eine Reduktion des Glukosemetabolismus jeweils in denselben Regionen nachgewiesen werden ( Abb. 3.4; Mosconi et al. 2008). Zur Abgrenzung gegen die (frontale Variante der) Alzheimer-Krankheit ist die Bildgebung mittels Amyloid-PET geeignet, in der das für die Alzheimer-Krankheit typische intrazerebrale Amyloid dargestellt werden kann. Eine Studie zeigte, dass sich Patienten mit semantischer Demenz allein durch das Ergebnis der Bildgebung mittels Amyloid-PET eindeutig von Patienten mit Alzheimer-Erkrankung abgrenzen ließen (Drzezga et al. 2008). Nicht ganz so eindeutige Ergebnisse lieferten diesbezügliche Studien an Patienten mit der behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz bzw. mit progredienter, nicht flüssiger Aphasie (Rabinovici et al. 2007; Engler et al. 2008). In beiden Gruppen gab es einige Patienten, die klinisch als FTLA klassifiziert worden waren, die aber einen positiven Befund in der Amyloid-PET hatten. Es ist unklar, ob die Patienten klinisch falsch klassifiziert waren oder ob das Amyloidsignal falsch-positiv war. Zukünftige Studien, die eine neuropathologische Untersuchung nach dem Tod der untersuchten Patienten beinhalten, werden die Frage beantworten können, inwieweit die Amyloidbildgebung zur sicheren Differenzialdiagnose geeignet ist. Liquordiagnostik Die Untersuchung des Liquors ist sinnvoll zum Ausschluss infektiöser, entzündlicher oder paraneoplastischer Erkrankungen. Die Analyse der Konzentrationen der Neurodegenerationsmarker Amyloid-β 1-42, Tau- und Phospho-Tau-Protein scheinen in Bezug auf ihren Beitrag zur (Differenzial-)Diagnose nur bedingt hilfreich. Amyloid-β 1-42 kann in der Abgrenzung zur Alzheimer-Krankheit hilfreich sein, bei der im Gegensatz zu den FTLA eine erniedrigte Konzentration nachweisbar ist (Riemenschneider et al. 2002). Die Konzentration von Tau-Protein im Liquor ist im Durchschnitt bei Patienten mit FTLA im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen normal bis leicht erhöht. Die Konzentration von Phospho-Tau-Protein entspricht bei der behavioralen Variante der fronto- Abb.3.4a-c Zerebraler Glukosemetabolismus, dargestellt mit der 18 F18-FDG-PET. Oberflächendarstellung; Ansicht von links lateral, reduzierter Metabolismus in grün (mit freundlicher Genehmigung von Prof. A. Drzezga, TU München). a Alzheimer-Demenz. b Behaviorale Variante der frontotemporalen Demenz. c Semantische Demenz. 241
10 3 Krankheiten mit Demenz temporalen Demenz der von Kontrollpersonen, bei den Formen der primär-progressiven Aphasie (semantische Demenz und progrediente nicht-flüssige Aphasie) ist sie leicht erhöht (Bibl et al. 2011; van Harten et al. 2011). Merke Liquormarker, die spezifisch für die FTLA sind, wurden bislang nicht identifiziert. In diesem Zusammenhang sei aber darauf hingewiesen, dass bei Patienten mit Progranulinmutation der Serumprogranulinspiegel reduziert zu sein scheint (Schofield et al. 2010) Differenzialdiagnostik Diagnostik im Frühstadium Es wird davon ausgegangen, dass die FTLA, vor allem die behaviorale Variante der frontotemporalen Demenz und die semantische Demenz, im Frühstadium der Erkrankung häufig gar nicht erkannt werden. Die diagnostische Latenz zwischen dem Auftreten der ersten Symptome und der richtigen Diagnose werden mit rund 4 Jahren bei der behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz und bei der semantischen Demenz bzw. mit rund 3 Jahren bei der progredienten, nicht flüssigen Aphasie angegeben (Diehl-Schmid et al. 2007b). Die ersten Symptome sind unspezifisch und häufig wenig richtungweisend. Angehörige, die retrospektiv die ersten, auffälligen Symptome nennen sollten, gaben bei Patienten mit behavioraler Variante der frontotemporalen Demenz ebenso wie bei Patienten mit semantischer Demenz am häufigsten Persönlichkeitsveränderungen an, gefolgt von Vergesslichkeit und Wortfindungsstörungen. Bei der progredienten, nicht flüssigen Aphasie waren Wortfindungsstörungen das herausragende Symptom (Pijnenburg et al. 2004; Diehl-Schmid et al. 2007b). Verhaltensauffälligkeiten, vor allem in Kombination mit dem oftmals relativ jungen Alter der Patienten, führen nicht zwingend zu dem Verdacht auf das Vorliegen einer Demenzerkrankung. Viele Angehörige interpretieren eine Wesensveränderung sogar lange überhaupt nicht als krankhaft, sondern führen diese auf äußere Umstände, wie Überforderung am Arbeitsplatz, Berentung oder Partnerschaftskonflikte, zurück, sodass eine Vorstellung beim Arzt erst verzögert erfolgt. Auch die reduzierte Krankheitseinsicht der Patienten trägt häufig dazu bei, dass eine ärztliche Konsultation erst spät gesucht wird. Zudem können im Frühstadium insbesondere der behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz und der semantischen Demenz die Befunde vor allem einfacher neuropsychologischer Tests unauffällig sein, und es kann bei der behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz eine unauffällige zerebrale Bildgebung vorliegen. Das Prädemenzstadium der FTLA (ähnlich dem Mild cognitive Impairment bei der Alzheimer-Krankheit) ist bislang nicht beschrieben oder gar definiert, sodass es hier keine Anhaltspunkte oder gar Warnzeichen für den diagnostizierenden Arzt gibt. Differenzialdiagnostische Abgrenzung zur Alzheimer-Demenz Die Alzheimer-Demenz ist die häufigste Differenzialdiagnose zur behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz, semantischer Demenz und progredienter, nichtflüssiger Aphasie (Perry u. Hodges 2000). Ursächlich für Fehldiagnosen sind in erster Linie Überlappungen der klinischen Symptomatik (Levy et al. 1996). Im Verlauf einer Alzheimer-Demenz entwickeln die meisten Patienten Verhaltensauffälligkeiten; andererseits treten bei Patienten mit FTLA kognitive Defizite auf. Die neuroradiologischen Befunde sind zwar in der Gruppe der Patienten, allerdings nicht immer im Einzelfall diagnostisch wegweisend (Knopman et al. 2005). Zudem erfüllen viele der Patienten mit FTLA im Verlauf der Erkrankung die Diagnosekriterien der Alzheimer-Demenz (Varma et al. 1999). Zahlreiche Studien, die neuropsychologische und neuropsychiatrische wie auch morphologische und funktionelle zerebrale Veränderungen bei Patienten mit FTLA und Alzheimer-Demenz verglichen haben, trugen jedoch dazu bei, dass zumindest in spezialisierten Zentren die FTLA klinisch mit hoher diagnostischer Sicherheit von der Alzheimer-Demenz unterschieden werden können. Zwar kam eine Reihe von Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass Patienten mit Alzheimer-Demenz und Patienten mit FTLA in unterschiedlichen neuropsychologischen Tests ähnlich abschneiden; vor allem gelang der Nachweis signifikanter Unterschiede in Frontalhirntests nicht (Pachana et al. 1996). Aber aktuelle Studien, die sich sehr um große, homogene Patientenpopulationen in vergleichbaren Stadien der Demenz bemühten, deckten deutliche Unterschiede in den Leistungen auf. So weisen Patienten mit Alzheimer-Demenz umfassendere Defizite in verbaler und visueller Gedächtnisleistung auf als Patienten mit behavioraler Variante der frontotemporalen Demenz. Patienten mit semantischer Demenz dagegen schneiden deutlich schlechter beim Benennen und in Tests der semantischen Wortflüssigkeit ab als Patienten mit Alzheimer-Demenz. Einige Studien fanden, dass Patienten mit behavioraler Variante der frontotemporalen Demenz in einzelnen frontal-exekutiven Tests, z. B. beim Generieren einer phonematischen Wortliste, ausgeprägtere Defizite aufwiesen als Patienten mit Alzheimer-Demenz. Es zeigte sich zudem, dass Patienten mit behavioraler Variante der frontotemporalen Demenz Tests der Visuokonstruktion besser bearbeiten als Patienten mit Alzheimer-Demenz (Perry u. Hodges 2000; Kramer et al. 2003; Diehl et al. 2005d; Mathias u. Morphett 2010). 242
GERONTO SPEZIAL. Frontotemporale Demenz. G. Nelles, Köln
 GERONTO SPEZIAL Frontotemporale Demenz G. Nelles, Köln Fallbeispiel Herr XYZ, 65 Jahre Unter Arbeitsbelastung zunehmende Gedächtnisstörungen. Herr XYZ berichtet, dass er in letzter Zeit häufig nach Wörtern
GERONTO SPEZIAL Frontotemporale Demenz G. Nelles, Köln Fallbeispiel Herr XYZ, 65 Jahre Unter Arbeitsbelastung zunehmende Gedächtnisstörungen. Herr XYZ berichtet, dass er in letzter Zeit häufig nach Wörtern
Frontotemporale Demenzen richtig erkennen
 Frontotemporale Demenzen richtig erkennen Thomas Duning Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Häufigkeit der Ätiologie von Demenzerkrankungen
Frontotemporale Demenzen richtig erkennen Thomas Duning Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Häufigkeit der Ätiologie von Demenzerkrankungen
Diagnostische Möglichkeiten der Demenzerkrankung 5. Palliativtag am in Pfaffenhofen
 Diagnostische Möglichkeiten der Demenzerkrankung 5. Palliativtag am 12.11.2011 in Pfaffenhofen Dr. Torsten Mager, Ärztl. Direktor der Danuvius Klinik GmbH Übersicht Epidemiologische Zahlen Ursache häufiger
Diagnostische Möglichkeiten der Demenzerkrankung 5. Palliativtag am 12.11.2011 in Pfaffenhofen Dr. Torsten Mager, Ärztl. Direktor der Danuvius Klinik GmbH Übersicht Epidemiologische Zahlen Ursache häufiger
Seltene Demenzen. Frontotemporal lobäre Degeneration. lic. phil. Gregor Steiger-Bächler Neuropsychologie-Basel
 Seltene Demenzen Frontotemporal lobäre Degeneration lic. phil. Gregor Steiger-Bächler Frontotemp. lobäre Degeneration LS-1 Primär progressive Aphasie Frontotemporale Demenz LS-2 kann kombiniert sein Leitsyndrom-1
Seltene Demenzen Frontotemporal lobäre Degeneration lic. phil. Gregor Steiger-Bächler Frontotemp. lobäre Degeneration LS-1 Primär progressive Aphasie Frontotemporale Demenz LS-2 kann kombiniert sein Leitsyndrom-1
Kein Hinweis für eine andere Ursache der Demenz
 die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
Demenzdiagnostik. Constanze Meier. Diplom-Psychologin SKH Rodewisch
 Demenzdiagnostik Constanze Meier Diplom-Psychologin SKH Rodewisch Gliederung Begriffsbestimmung Demenz Demenzdiagnostik Formen der Demenz Begriffsbestimmung Demenz Aber noch schlimmer als sämtlicher Glieder
Demenzdiagnostik Constanze Meier Diplom-Psychologin SKH Rodewisch Gliederung Begriffsbestimmung Demenz Demenzdiagnostik Formen der Demenz Begriffsbestimmung Demenz Aber noch schlimmer als sämtlicher Glieder
Präsenile Demenzen Thomas Duning Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster
 Präsenile Demenzen Thomas Duning Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Präsenile Demenz = Definition Klassische Demenz vom Typ Alzheimer Präsenile
Präsenile Demenzen Thomas Duning Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Präsenile Demenz = Definition Klassische Demenz vom Typ Alzheimer Präsenile
Eine andere Demenz. was macht frontotemporale Demenzen aus?
 Eine andere Demenz was macht frontotemporale Demenzen aus? Dr. med. Gerthild Stiens LVR-Klinik Bonn Gerontologisches Forum, 09.11.2015 Frontotemporale Lobärdegenerationen (FTLD) Gruppe von neurodegenerativen
Eine andere Demenz was macht frontotemporale Demenzen aus? Dr. med. Gerthild Stiens LVR-Klinik Bonn Gerontologisches Forum, 09.11.2015 Frontotemporale Lobärdegenerationen (FTLD) Gruppe von neurodegenerativen
Präsenile Demenzen Thomas Duning Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster
 Präsenile Demenzen Thomas Duning Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Präsenile Demenz = Definition Klassische Demenz vom Typ Alzheimer Präsenile
Präsenile Demenzen Thomas Duning Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Präsenile Demenz = Definition Klassische Demenz vom Typ Alzheimer Präsenile
Demenz. Demenz...und wenn es nicht Alzheimer ist? Häufigkeit (%) von Demenzerkrankungen in der Bevölkerung. Delir. Depression
 ...und wenn es nicht Alzheimer ist? Nutritiv-toxisch Neurodegeneration Vaskuläre Erkrankungen Neoplastisch Zukunft Alter Gerontologica - 4.6.2004 Wiesbaden Empfehlungen für die Praxis Unterstützung für
...und wenn es nicht Alzheimer ist? Nutritiv-toxisch Neurodegeneration Vaskuläre Erkrankungen Neoplastisch Zukunft Alter Gerontologica - 4.6.2004 Wiesbaden Empfehlungen für die Praxis Unterstützung für
Vaskuläre Demenz G. Lueg Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster
 Vaskuläre Demenz G. Lueg Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Verteilung der Demenz 3-10% LewyKörperchenDemenz 3-18% Frontotemporale Demenz
Vaskuläre Demenz G. Lueg Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Verteilung der Demenz 3-10% LewyKörperchenDemenz 3-18% Frontotemporale Demenz
Die vielen Gesichter des Parkinson
 Die vielen Gesichter des Parkinson Prof. Rudolf Töpper Asklepios Klinik Harburg Sylt Harburg (Hamburg) Falkenstein Ini Hannover Bad Griesbach Sichtweisen der Erkrankung Klinik Hamburg-Harburg typischer
Die vielen Gesichter des Parkinson Prof. Rudolf Töpper Asklepios Klinik Harburg Sylt Harburg (Hamburg) Falkenstein Ini Hannover Bad Griesbach Sichtweisen der Erkrankung Klinik Hamburg-Harburg typischer
Definition der Demenz. Alltagsrelevante Abnahme von Gedächtnis und anderen kognitiven Funktionen, die länger als 6 Monate besteht.
 Definition der Demenz Alltagsrelevante Abnahme von Gedächtnis und anderen kognitiven Funktionen, die länger als 6 Monate besteht. Klinik der Demenz 1. Störung kognitiver Funktionen Gedächtnis ("er vergisst
Definition der Demenz Alltagsrelevante Abnahme von Gedächtnis und anderen kognitiven Funktionen, die länger als 6 Monate besteht. Klinik der Demenz 1. Störung kognitiver Funktionen Gedächtnis ("er vergisst
Neuropsychologie des Hydrocephalus. Dr. Michael Lingen
 Neuropsychologie des Hydrocephalus Dr. Michael Lingen Was ist Neuropsychologie? interdisziplinäres Teilgebiet der Psychologie und der Neurowissenschaften befasst sich mit der Variation physiologischer
Neuropsychologie des Hydrocephalus Dr. Michael Lingen Was ist Neuropsychologie? interdisziplinäres Teilgebiet der Psychologie und der Neurowissenschaften befasst sich mit der Variation physiologischer
Neuropsychologische Untersuchungen in der Praxis: Wann sind welche Tests sinnvoll?
 Neuropsychologische Untersuchungen in der Praxis: Wann sind welche Tests sinnvoll? Sophia Reul Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Welche
Neuropsychologische Untersuchungen in der Praxis: Wann sind welche Tests sinnvoll? Sophia Reul Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Welche
Symptome und Diagnosestellung des Morbus Parkinson
 meine Hand zittert habe ich etwa Parkinson? Symptome und Diagnosestellung des Morbus Parkinson Dr. med. Sabine Skodda Oberärztin Neurologische Klinik Morbus Parkinson chronisch fortschreitende neurodegenerative
meine Hand zittert habe ich etwa Parkinson? Symptome und Diagnosestellung des Morbus Parkinson Dr. med. Sabine Skodda Oberärztin Neurologische Klinik Morbus Parkinson chronisch fortschreitende neurodegenerative
dr. andrea flemmer Demenz natürlich behandeln Das können Sie selbst tun So helfen Sie als Angehöriger
 dr. andrea flemmer Demenz natürlich behandeln Das können Sie selbst tun So helfen Sie als Angehöriger Den Feind erkennen: Was ist Demenz? 17 lung der Krankheitsgeschichte (Anamnese) helfen, an die sich
dr. andrea flemmer Demenz natürlich behandeln Das können Sie selbst tun So helfen Sie als Angehöriger Den Feind erkennen: Was ist Demenz? 17 lung der Krankheitsgeschichte (Anamnese) helfen, an die sich
Wie können wir in Zukunft diese Fragen beantworten?
 Parkinson Krankheit: Diagnose kommt sie zu spät? Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder Mannheim (23. September 2010) - Die Frage, ob derzeit die Diagnosestellung einer Parkinson-Erkrankung zu spät kommt,
Parkinson Krankheit: Diagnose kommt sie zu spät? Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder Mannheim (23. September 2010) - Die Frage, ob derzeit die Diagnosestellung einer Parkinson-Erkrankung zu spät kommt,
Programm Demenz-Prävention
 Programm Demenz-Prävention Mehr Lebensqualität durch individuelle Maßnahmen im Frühstadium der Erkrankung Ministère de la Santé Villa Louvigny/Allée Marconi L-2120 Luxembourg Tel. 00352/ 27861312 info@demence.lu/info@demenz.lu
Programm Demenz-Prävention Mehr Lebensqualität durch individuelle Maßnahmen im Frühstadium der Erkrankung Ministère de la Santé Villa Louvigny/Allée Marconi L-2120 Luxembourg Tel. 00352/ 27861312 info@demence.lu/info@demenz.lu
Die wichtigsten Formen der Demenz. B. Kopp
 Die wichtigsten Formen der Demenz B. Kopp Definition Syndromdefinition Demenz: Der Begriff Demenz bezeichnet ein klinisches Syndrom. ICD-10-Definition: Demenz (ICD-10-Code: F00-F03) ist ein Syndrom als
Die wichtigsten Formen der Demenz B. Kopp Definition Syndromdefinition Demenz: Der Begriff Demenz bezeichnet ein klinisches Syndrom. ICD-10-Definition: Demenz (ICD-10-Code: F00-F03) ist ein Syndrom als
Gliederung. 1. Biochemie 1.1. Synukleinopathien 1.2. Tauopathien 1.3. Amyloidopathien
 Gliederung 1. Biochemie 1.1. Synukleinopathien 1.2. Tauopathien 1.3. Amyloidopathien 2. Neurodengeneration 2.1. Aggregate 2.2. Klinische Einteilung 2.3. Pathologie 2.4. Ergebnisse 3. Bildgebung 3.1. M.
Gliederung 1. Biochemie 1.1. Synukleinopathien 1.2. Tauopathien 1.3. Amyloidopathien 2. Neurodengeneration 2.1. Aggregate 2.2. Klinische Einteilung 2.3. Pathologie 2.4. Ergebnisse 3. Bildgebung 3.1. M.
Neurodegenerative Demenzen: Es ist nicht immer Alzheimer
 Neurodegenerative Demenzen: Es ist nicht immer Alzheimer PD Dr. Brit Mollenhauer Prof. Dr. Claudia Trenkwalder Paracelsus-Elena Klinik, Kassel Neurologisches Krankenhaus für Bewegungsstörungen Prävalenz
Neurodegenerative Demenzen: Es ist nicht immer Alzheimer PD Dr. Brit Mollenhauer Prof. Dr. Claudia Trenkwalder Paracelsus-Elena Klinik, Kassel Neurologisches Krankenhaus für Bewegungsstörungen Prävalenz
Neuropsychologische Differenzialdiagnostik bei Demenz
 Neuropsychologische Differenzialdiagnostik bei Demenz Fortbildung DGN-Kongress Mannheim AG Kognitive Neurologie Dr. Anne Ebert Allgemeine Differenzialdiagnosen bei Demenz: Vorbestehende Intelligenzminderung
Neuropsychologische Differenzialdiagnostik bei Demenz Fortbildung DGN-Kongress Mannheim AG Kognitive Neurologie Dr. Anne Ebert Allgemeine Differenzialdiagnosen bei Demenz: Vorbestehende Intelligenzminderung
Was bleibt da für die klassische MRT-Bildgebung übrig?
 11. Bremer MR-Symposium Demenzerkrankungen Was bleibt da für die klassische MRT-Bildgebung übrig? G. Schuierer Zentrum Neuroradiologie Regensburg Alzheimerdemenz ~60% Alzheimerdemenz ~60% Mischform AD-vaskulär~15%
11. Bremer MR-Symposium Demenzerkrankungen Was bleibt da für die klassische MRT-Bildgebung übrig? G. Schuierer Zentrum Neuroradiologie Regensburg Alzheimerdemenz ~60% Alzheimerdemenz ~60% Mischform AD-vaskulär~15%
Demenz Wie halte ich mich geistig fit? Vortrag Demenz Christian Koch 1
 Demenz Wie halte ich mich geistig fit? Vortrag Demenz 28.02.12 Christian Koch 1 Inhalt Was ist überhaupt eine Demenz? Was gibt es für Demenzarten? Was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Vortrag Demenz
Demenz Wie halte ich mich geistig fit? Vortrag Demenz 28.02.12 Christian Koch 1 Inhalt Was ist überhaupt eine Demenz? Was gibt es für Demenzarten? Was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Vortrag Demenz
Demenz Hintergrund und praktische Hilfen Dr. med. Christine Wichmann
 Demenz Hintergrund und praktische Hilfen Dr. med. Christine Wichmann Lebenserwartung in Deutschland 100 80 Männer Frauen 60 40 20 0 1871 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Demenz Hintergrund und praktische Hilfen Dr. med. Christine Wichmann Lebenserwartung in Deutschland 100 80 Männer Frauen 60 40 20 0 1871 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Jüngere Menschen mit Demenz Medizinische Aspekte. in absoluten Zahlen. Altersgruppe zwischen 45 und 64 Jahren in Deutschland: ca.
 Prävalenz und Inzidenz präseniler en Jüngere Menschen mit Medizinische Aspekte Priv.Doz. Dr. med. Katharina Bürger Alzheimer Gedächtniszentrum Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie LudwigMaximiliansUniversität
Prävalenz und Inzidenz präseniler en Jüngere Menschen mit Medizinische Aspekte Priv.Doz. Dr. med. Katharina Bürger Alzheimer Gedächtniszentrum Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie LudwigMaximiliansUniversität
Peritonealdialyse und Demenz
 Peritonealdialyse und Demenz Definition: lat. dementia, zu demens unvernünftig bzw. mens Verstand, de von weg, abnehmend ohne Geist ist ein psychiatrisches Syndrom, das bei verschiedenen degenerativen
Peritonealdialyse und Demenz Definition: lat. dementia, zu demens unvernünftig bzw. mens Verstand, de von weg, abnehmend ohne Geist ist ein psychiatrisches Syndrom, das bei verschiedenen degenerativen
Wissen. Demenz Was ist das?
 19 Wissen Demenz Was ist das? Demenz Wie häufig tritt sie auf? Demenz Welche Formen sind bekannt? Demenz Welche Phasen gibt es? Demenz Wie kommt der Arzt zu einer Diagnose? Demenz Welche Therapien gibt
19 Wissen Demenz Was ist das? Demenz Wie häufig tritt sie auf? Demenz Welche Formen sind bekannt? Demenz Welche Phasen gibt es? Demenz Wie kommt der Arzt zu einer Diagnose? Demenz Welche Therapien gibt
Leichte kognitive Beeinträchtigung (mild cognitive impairment) und Differentialdiagnosen
 Leichte kognitive Beeinträchtigung (mild cognitive impairment) und Differentialdiagnosen Thomas Duning Andreas Johnen Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität
Leichte kognitive Beeinträchtigung (mild cognitive impairment) und Differentialdiagnosen Thomas Duning Andreas Johnen Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität
Frontotemporale Demenz Informationen für Betroffene und Angehörige
 Frontotemporale Demenz Informationen für Betroffene und Angehörige Bei den frontotemporalen Lobärdegenerationen (FTLD), wie der Fachausdruck für eine ganze Krankheitsgruppe heißt, lassen sich drei typische
Frontotemporale Demenz Informationen für Betroffene und Angehörige Bei den frontotemporalen Lobärdegenerationen (FTLD), wie der Fachausdruck für eine ganze Krankheitsgruppe heißt, lassen sich drei typische
Morbus Parkinson Ratgeber
 Morbus Parkinson Ratgeber Impressum Zarenga GmbH, Bonn 2015 Zarenga GmbH, Pfaffenweg 15, 53227 Bonn Alle Rechte sind vorbehalten. Dieses Buch, einschließlich seiner einzelnen Teile ist urheberrechtlich
Morbus Parkinson Ratgeber Impressum Zarenga GmbH, Bonn 2015 Zarenga GmbH, Pfaffenweg 15, 53227 Bonn Alle Rechte sind vorbehalten. Dieses Buch, einschließlich seiner einzelnen Teile ist urheberrechtlich
Schizophrenie. Krankheitsbild und Ursachen
 Schizophrenie Krankheitsbild und Ursachen Inhalt Definition Zahlen und Daten Symptomatik Positivsymptome Negativsymptome Ursachen Diagnostik Klassifikation Verlauf und Prognose 2 Schizophrenie - Krankheitsbild
Schizophrenie Krankheitsbild und Ursachen Inhalt Definition Zahlen und Daten Symptomatik Positivsymptome Negativsymptome Ursachen Diagnostik Klassifikation Verlauf und Prognose 2 Schizophrenie - Krankheitsbild
Dr. Martin Conzelmann 1
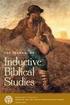 Demenz? Was ist Demenz und was kann man dagegen tun? Dr. Martin Conzelmann 17. Februar 2011 Erstbeschreibung einer Alzheimer- Demenz Am 25. November 1901 begegnete Alzheimer der Patientin, die ihn berühmt
Demenz? Was ist Demenz und was kann man dagegen tun? Dr. Martin Conzelmann 17. Februar 2011 Erstbeschreibung einer Alzheimer- Demenz Am 25. November 1901 begegnete Alzheimer der Patientin, die ihn berühmt
Seltene Demenzen. Posteriore Corticale Atrophie. lic. phil. Gregor Steiger-Bächler 01-04-2011. Neuropsychologie-Basel
 Seltene Demenzen Posteriore Corticale Atrophie lic. phil. Gregor Steiger-Bächler Posteriore corticale atrophie Merkmale: Schleichender Beginn, oft in der 5. oder 6. Dekade, langsam progredienter Verlauf
Seltene Demenzen Posteriore Corticale Atrophie lic. phil. Gregor Steiger-Bächler Posteriore corticale atrophie Merkmale: Schleichender Beginn, oft in der 5. oder 6. Dekade, langsam progredienter Verlauf
Aktuelles zur Diagnose und Therapie von Alzheimer und anderen Demenzformen
 Aktuelles zur Diagnose und Therapie von Alzheimer und anderen Demenzformen Alexander Kurz Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Technische Universität München Hintergrund Nervenzelluntergang ist häufigste
Aktuelles zur Diagnose und Therapie von Alzheimer und anderen Demenzformen Alexander Kurz Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Technische Universität München Hintergrund Nervenzelluntergang ist häufigste
Symposium Dement, depressiv oder beides? - Problemstellung -
 Symposium 1.7.2014 Dement, depressiv oder beides? - Problemstellung - Katja Werheid Klinische Gerontopsychologie Institut für Psychologie, Humboldt-Universität zu Berlin katja.werheid@hu-berlin.de Agenda
Symposium 1.7.2014 Dement, depressiv oder beides? - Problemstellung - Katja Werheid Klinische Gerontopsychologie Institut für Psychologie, Humboldt-Universität zu Berlin katja.werheid@hu-berlin.de Agenda
Kooperationstagung zum Thema Demenz Strategien für eine gemeinsame Versorgung
 Kooperationstagung zum Thema Demenz Strategien für eine gemeinsame Versorgung Arbeitsgruppe 4: Wege und Möglichkeiten der Betreuung und Pflege demenzkranker Menschen zu Hause AG 4: Wege und Möglichkeiten
Kooperationstagung zum Thema Demenz Strategien für eine gemeinsame Versorgung Arbeitsgruppe 4: Wege und Möglichkeiten der Betreuung und Pflege demenzkranker Menschen zu Hause AG 4: Wege und Möglichkeiten
Schlaganfall, was nun?
 Schlaganfall, was nun? Neurologisch bedingte Sprach- und Sprechstörungen Corinna Rolf & Dr. phil. Uta Lürßen Dipl. Sprachheilpädagoginnen Inhalt Begrüßung und Vorstellung Einführung in das Thema Ursachen
Schlaganfall, was nun? Neurologisch bedingte Sprach- und Sprechstörungen Corinna Rolf & Dr. phil. Uta Lürßen Dipl. Sprachheilpädagoginnen Inhalt Begrüßung und Vorstellung Einführung in das Thema Ursachen
Demenz - Krankheitsbild, Erleben und Hilfen für den Umgang
 Demenz - Krankheitsbild, Erleben und Hilfen für den Umgang Fortbildung Wohnberater/in für ältere und behinderte Menschen 15. März 2016, München Claudia Bayer-Feldmann Dipl.Psych. Wahrnehmungen im Alltag
Demenz - Krankheitsbild, Erleben und Hilfen für den Umgang Fortbildung Wohnberater/in für ältere und behinderte Menschen 15. März 2016, München Claudia Bayer-Feldmann Dipl.Psych. Wahrnehmungen im Alltag
DEMENZ EIN LEITFADEN FÜR DAS ARZT- PATIENTEN-GESPRÄCH
 ADDITIONAL SLIDE KIT DEMENZ EIN LEITFADEN FÜR DAS ARZT- PATIENTEN-GESPRÄCH Autoren: Der Leitfaden Demenz wurde durch Schweizer Allgemeinmediziner, Geriater, Neurologen, Neuropsychologen und Psychiater
ADDITIONAL SLIDE KIT DEMENZ EIN LEITFADEN FÜR DAS ARZT- PATIENTEN-GESPRÄCH Autoren: Der Leitfaden Demenz wurde durch Schweizer Allgemeinmediziner, Geriater, Neurologen, Neuropsychologen und Psychiater
6 höhere Funktionen der Wahrnehmung - Teil 2. Referent: Philipp Schneider
 6 höhere Funktionen der Wahrnehmung - Teil 2 Referent: Philipp Schneider Überblick Agnosien Warringtons zweistufiges Objekterkennungsmodell Prosopagnosie Unterschiede zwischen Gesichts- und Objekterkennung
6 höhere Funktionen der Wahrnehmung - Teil 2 Referent: Philipp Schneider Überblick Agnosien Warringtons zweistufiges Objekterkennungsmodell Prosopagnosie Unterschiede zwischen Gesichts- und Objekterkennung
Demenz: Vaskuläre Demenz und Tauopathien (FTD, CBD, PSP)
 Demenz: Vaskuläre Demenz und Tauopathien (FTD, CBD, PSP) Prof. Dr. phil Helmut Hildebrandt Klinikum Bremen-Ost, Neurologie Universität Oldenburg, Psychologie Mögliche vaskuläredemenz: Quantifizierbar gemessenes
Demenz: Vaskuläre Demenz und Tauopathien (FTD, CBD, PSP) Prof. Dr. phil Helmut Hildebrandt Klinikum Bremen-Ost, Neurologie Universität Oldenburg, Psychologie Mögliche vaskuläredemenz: Quantifizierbar gemessenes
Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters
 Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters J. Bufler Neurologische Klinik des ISK Wasserburg Präsentation, Stand November 2008, Martin Spuckti Seite 1 Vier Giganten der Geriatrie
Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters J. Bufler Neurologische Klinik des ISK Wasserburg Präsentation, Stand November 2008, Martin Spuckti Seite 1 Vier Giganten der Geriatrie
Das klinische Spektrum der ALS. Albert C. Ludolph, Ulm
 Das klinische Spektrum der ALS Albert C. Ludolph, Ulm Die häufigste Motoneuronerkrankung: die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) Rasch fortschreitende, erst fokale, sich kontinuierlich ausbreitend, dann
Das klinische Spektrum der ALS Albert C. Ludolph, Ulm Die häufigste Motoneuronerkrankung: die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) Rasch fortschreitende, erst fokale, sich kontinuierlich ausbreitend, dann
Demenz Diagnose und Therapie. PD Dr. Horst Gerhard Philippusstift Essen /KKE 2015
 Demenz Diagnose und Therapie PD Dr. Horst Gerhard Philippusstift Essen /KKE 2015 Demenz Genauen Ursachen der Krankheit noch unklar Demenz ist ein Sammelbegriff für verschiedene Krankheiten, denen der fortschreitende
Demenz Diagnose und Therapie PD Dr. Horst Gerhard Philippusstift Essen /KKE 2015 Demenz Genauen Ursachen der Krankheit noch unklar Demenz ist ein Sammelbegriff für verschiedene Krankheiten, denen der fortschreitende
Geistige Einschränkungen und Demenz als Symptom der Krankheit
 Geistige Einschränkungen und Demenz als Symptom der Krankheit Wir sprechen über Gedächtnisstörungen oder geistige Beeinträchtigungen dann, wenn folgende Einschränkungen vorliegen: Störungen des Gedächtnisses
Geistige Einschränkungen und Demenz als Symptom der Krankheit Wir sprechen über Gedächtnisstörungen oder geistige Beeinträchtigungen dann, wenn folgende Einschränkungen vorliegen: Störungen des Gedächtnisses
HuBerTDA Handeln im Hier und Jetzt! Bereit zum Demenz- und Alterssensiblen Krankenhaus
 HuBerTDA Handeln im Hier und Jetzt! Bereit zum Demenz- und Alterssensiblen Krankenhaus Auftaktsymposium Medizinische und gerontopsychiatrische Grundlagen zum Syndrom Demenz 25.05.2016 Stefan Blumenrode
HuBerTDA Handeln im Hier und Jetzt! Bereit zum Demenz- und Alterssensiblen Krankenhaus Auftaktsymposium Medizinische und gerontopsychiatrische Grundlagen zum Syndrom Demenz 25.05.2016 Stefan Blumenrode
Als meine Oma Ilse seltsam wurde, dachte ich an alles nur nicht an Eiweißablagerungen und Zellschwund in ihrem Gehirn. Das mag für Mediziner von
 Als meine Oma Ilse seltsam wurde, dachte ich an alles nur nicht an Eiweißablagerungen und Zellschwund in ihrem Gehirn. Das mag für Mediziner von hohem Interesse sein, aber für Angehörige und Mitmenschen
Als meine Oma Ilse seltsam wurde, dachte ich an alles nur nicht an Eiweißablagerungen und Zellschwund in ihrem Gehirn. Das mag für Mediziner von hohem Interesse sein, aber für Angehörige und Mitmenschen
Rolle von PET und SPECT in der Differentialdiagnose von Parkinson- Syndromen
 Rolle von PET und SPECT in der Differentialdiagnose von Parkinson- Syndromen Rüdiger Hilker Neurowoche und DGN 2006 20.09.2006 1. Methodik nuklearmedizinischer Bildgebung 2. Biomarker-Konzept bei Parkinson-
Rolle von PET und SPECT in der Differentialdiagnose von Parkinson- Syndromen Rüdiger Hilker Neurowoche und DGN 2006 20.09.2006 1. Methodik nuklearmedizinischer Bildgebung 2. Biomarker-Konzept bei Parkinson-
PSYCHIATRISCHE ANSÄTZE DER KUNSTTHERAPIE KARL-HEINZ MENZEN
 PSYCHIATRISCHE ANSÄTZE DER KUNSTTHERAPIE KARL-HEINZ MENZEN Psychose Psychose Die Grenzen innerhalb der eigenen Person und der Person und Aussenwelt werden unklar. Die Wahrnehmung der Dinge und Personen
PSYCHIATRISCHE ANSÄTZE DER KUNSTTHERAPIE KARL-HEINZ MENZEN Psychose Psychose Die Grenzen innerhalb der eigenen Person und der Person und Aussenwelt werden unklar. Die Wahrnehmung der Dinge und Personen
Psychische Störungen Einführung. PD Dr. Peter Schönknecht Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universitätsklinikum Leipzig
 Psychische Störungen Einführung PD Dr. Peter Schönknecht Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universitätsklinikum Leipzig Psychopathologische Symptome Psychopathologische Symptome
Psychische Störungen Einführung PD Dr. Peter Schönknecht Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universitätsklinikum Leipzig Psychopathologische Symptome Psychopathologische Symptome
Sprachliche Phänomene vor der Demenz - gibt es schon Symptome?
 Sprachliche Phänomene vor der Demenz - gibt es schon Symptome? Julia Siegmüller, Henrik Bartels & Wolfgang Sucharowski 1 2 Frühstadien Lebensumgebung: selbstständig organisiertes Leben Selbstreflexion:
Sprachliche Phänomene vor der Demenz - gibt es schon Symptome? Julia Siegmüller, Henrik Bartels & Wolfgang Sucharowski 1 2 Frühstadien Lebensumgebung: selbstständig organisiertes Leben Selbstreflexion:
Veränderungen und Auswirkungen im Rahmen einer Demenzerkrankung. bei Menschen mit geistiger Behinderung. Dr. Sinikka Gusset-Bährer
 Veränderungen und Auswirkungen im Rahmen einer Demenzerkrankung bei Menschen mit geistiger Behinderung Dr. Sinikka Gusset-Bährer Überblick Symptome im frühen Stadium der Demenzerkrankung mittleren und
Veränderungen und Auswirkungen im Rahmen einer Demenzerkrankung bei Menschen mit geistiger Behinderung Dr. Sinikka Gusset-Bährer Überblick Symptome im frühen Stadium der Demenzerkrankung mittleren und
Demenz. Wir werden alt. Fragen. Übersicht bewahren
 1 Wir werden alt Demenz Abklärungen durch den Hausarzt/die Hausärztin Dr. med. Markus Anliker Facharzt für Allgemeinmedizin, speziell Geriatrie Schmidgasse 8, 6300 Zug markus.anliker@bluewin.ch 2 Fragen
1 Wir werden alt Demenz Abklärungen durch den Hausarzt/die Hausärztin Dr. med. Markus Anliker Facharzt für Allgemeinmedizin, speziell Geriatrie Schmidgasse 8, 6300 Zug markus.anliker@bluewin.ch 2 Fragen
Dement in die Rettungsstelle, was nun? von. Christoph Steber. Krankenpfleger Diplom-Pflegewirt (FH)
 Dement in die Rettungsstelle, was nun? von Christoph Steber Krankenpfleger Diplom-Pflegewirt (FH) E.R.N.A 2013 Demenz in der Rettungsstelle 2 Dement in die Rettungsstelle, was nun! E.R.N.A 2013 Demenz
Dement in die Rettungsstelle, was nun? von Christoph Steber Krankenpfleger Diplom-Pflegewirt (FH) E.R.N.A 2013 Demenz in der Rettungsstelle 2 Dement in die Rettungsstelle, was nun! E.R.N.A 2013 Demenz
Tango oder Tee oder Teboninoder Tabletten? Was hilft wirklich? Angehörige in der Demenzpflege. Angeh.-gruppe Nov 16 Dr. med. N.
 Angehörige in der Demenzpflege Tango oder Tee oder Teboninoder Tabletten? Was hilft wirklich? 1 Was ist eine Demenz und wie entsteht sie? Wie kann ich helfen? Kann ich vorbeugen? Was kann ich tun, damit
Angehörige in der Demenzpflege Tango oder Tee oder Teboninoder Tabletten? Was hilft wirklich? 1 Was ist eine Demenz und wie entsteht sie? Wie kann ich helfen? Kann ich vorbeugen? Was kann ich tun, damit
Kognitive Störungen. Olivia Geisseler, MSc. Neuropsychologin, Universitätsspital Zürich
 Kognitive Störungen bei MS Patienten Olivia Geisseler, MSc. Neuropsychologin, Universitätsspital Zürich Übersicht MS MS ist die häufigste neurologische Erkrankung des frühen Erwachsenenalters 2.5 Millionen
Kognitive Störungen bei MS Patienten Olivia Geisseler, MSc. Neuropsychologin, Universitätsspital Zürich Übersicht MS MS ist die häufigste neurologische Erkrankung des frühen Erwachsenenalters 2.5 Millionen
kontrolliert wurden. Es erfolgte zudem kein Ausschluss einer sekundären Genese der Eisenüberladung. Erhöhte Ferritinkonzentrationen wurden in dieser S
 5.8 Zusammenfassung Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse dieser Studie erscheint die laborchemische Bestimmung der Transferrinsättigung zur Abklärung einer unklaren Lebererkrankung und Verdacht
5.8 Zusammenfassung Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse dieser Studie erscheint die laborchemische Bestimmung der Transferrinsättigung zur Abklärung einer unklaren Lebererkrankung und Verdacht
Neuropsychologische Differenzialdiagnose der Demenzen
 Neuropsychologische Differenzialdiagnose der Demenzen Prof.Dr.Claus-W.Wallesch BDH-Klinik Elzach Die Verdachtsdiagnose einer Demenz wird meist vom Hausarzt gestellt. In der Praxis genügen Anamnese, klinische
Neuropsychologische Differenzialdiagnose der Demenzen Prof.Dr.Claus-W.Wallesch BDH-Klinik Elzach Die Verdachtsdiagnose einer Demenz wird meist vom Hausarzt gestellt. In der Praxis genügen Anamnese, klinische
Grundlagen der Demenz- Welche Formen gibt es und worin unterscheiden sie sich. H. Ernst
 Grundlagen der Demenz- Welche Formen gibt es und worin unterscheiden sie sich H. Ernst Woher kommt der Name? Von lat. de = abnehmend mens = Geist Definition Entscheidende Abnahme der intellektuellen Leistungsfähigkeit
Grundlagen der Demenz- Welche Formen gibt es und worin unterscheiden sie sich H. Ernst Woher kommt der Name? Von lat. de = abnehmend mens = Geist Definition Entscheidende Abnahme der intellektuellen Leistungsfähigkeit
Herausforderungen der Demenz-Früherkennung bei Menschen mit Intelligenzminderung
 Workshop 1 der Fachtagung Menschen mit geistiger Behinderung und Demenz verstehen und begleiten : Früherkennung von Demenzerkrankungen bei geistig behinderten Menschen Früherkennung - Warum so wichtig?
Workshop 1 der Fachtagung Menschen mit geistiger Behinderung und Demenz verstehen und begleiten : Früherkennung von Demenzerkrankungen bei geistig behinderten Menschen Früherkennung - Warum so wichtig?
Altwerden ist immer noch die einzige Möglichkeit, lange zu leben
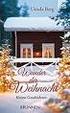 Altwerden ist immer noch die einzige Möglichkeit, lange zu leben (Hugo von Hofmannsthal, 1874-1929) Foto/Quelle: Can Stock Photo Muss Alter zwangsläufig Krankheit bedeuten? Nicht unbedingt Foto/Quelle:
Altwerden ist immer noch die einzige Möglichkeit, lange zu leben (Hugo von Hofmannsthal, 1874-1929) Foto/Quelle: Can Stock Photo Muss Alter zwangsläufig Krankheit bedeuten? Nicht unbedingt Foto/Quelle:
Alzheimer Demenz. Demenz - Definition. - Neueste Forschungsergebnisse - Neuropathologie der Demenz n=1050. Alzheimer Krankheit: Neuropathologie
 Demenz - Definition Alzheimer Demenz - Neueste Forschungsergebnisse - Beeinträchtigung von geistigen (kognitiven) Funktionen (z.b. Gedächtnis, Sprache, Orientierung) dadurch bedingte deutliche Beeinträchtigung
Demenz - Definition Alzheimer Demenz - Neueste Forschungsergebnisse - Beeinträchtigung von geistigen (kognitiven) Funktionen (z.b. Gedächtnis, Sprache, Orientierung) dadurch bedingte deutliche Beeinträchtigung
Patientensicherheit im OP Patienten mit Demenz. Herzlich Willkommen!
 Patientensicherheit im OP Patienten mit Demenz Herzlich Willkommen! DGKP Leo Hutter akad. geprüfter Experte für OP Pflege 2007 DGKP Diplom in Klagenfurt LKH Graz Ortho Station GGZ der Stadt Graz LKH Univ.Klinik
Patientensicherheit im OP Patienten mit Demenz Herzlich Willkommen! DGKP Leo Hutter akad. geprüfter Experte für OP Pflege 2007 DGKP Diplom in Klagenfurt LKH Graz Ortho Station GGZ der Stadt Graz LKH Univ.Klinik
Schizophrenie. Gliederung. Neuronale Dysfunktion & Gewalt
 Schizophrenie Neuronale Dysfunktion & Gewalt Seminar: Forensische Neuropsychologie Dozent: Dr. B. Schiffer Referentin: Christine Heinemann SS09 Gliederung Einführung Methode Ergebnisse Fazit 23. Mai 2009
Schizophrenie Neuronale Dysfunktion & Gewalt Seminar: Forensische Neuropsychologie Dozent: Dr. B. Schiffer Referentin: Christine Heinemann SS09 Gliederung Einführung Methode Ergebnisse Fazit 23. Mai 2009
Psychiatrische Symptome im Rahmen epileptischer Anfälle. Dr. med. Klaus Meyer Klinik Bethesda Tschugg
 Psychiatrische Symptome im Rahmen epileptischer Anfälle Dr. med. Klaus Meyer Klinik Bethesda Tschugg Frau 35 jährig o mittelgradige Intelligenzminderung o komplex fokale und sekundär generalisierte Anfälle
Psychiatrische Symptome im Rahmen epileptischer Anfälle Dr. med. Klaus Meyer Klinik Bethesda Tschugg Frau 35 jährig o mittelgradige Intelligenzminderung o komplex fokale und sekundär generalisierte Anfälle
Leichte kognitive Beeinträchtigung, Demenz und Depression Leichte kognitive Beeinträchtigung, Demenz und Depression
 Leichte kognitive Beeinträchtigung, Demenz und Depression Jeannette Overbeck Kurz A, Diehl J, Riemenschneider M et al. Leichte kognitive Störung, Fragen zu Definition, Diagnose,Prognose und Therapie. (2004)
Leichte kognitive Beeinträchtigung, Demenz und Depression Jeannette Overbeck Kurz A, Diehl J, Riemenschneider M et al. Leichte kognitive Störung, Fragen zu Definition, Diagnose,Prognose und Therapie. (2004)
Das Alter hat nichts Schönes oder doch. Depressionen im Alter Ende oder Anfang?
 Das Alter hat nichts Schönes oder doch Depressionen im Alter Ende oder Anfang? Depressionen im Alter Gedanken zum Alter was bedeutet höheres Alter Depressionen im Alter Häufigkeit Was ist eigentlich eine
Das Alter hat nichts Schönes oder doch Depressionen im Alter Ende oder Anfang? Depressionen im Alter Gedanken zum Alter was bedeutet höheres Alter Depressionen im Alter Häufigkeit Was ist eigentlich eine
Gerontopsychiatrie. Dr. medic. Ligia Comaniciu Leyendecker
 Gerontopsychiatrie ligley66@gmail.com ligley66@gmail.com Gerontopsychiatrie 1 / 19 Outline 1 Demenz 2 Demenz bei Alzheimerkrankheit 3 Vaskuläre Demenz 4 Andere Demenzformen 5 Diagnostische Verfahren 6
Gerontopsychiatrie ligley66@gmail.com ligley66@gmail.com Gerontopsychiatrie 1 / 19 Outline 1 Demenz 2 Demenz bei Alzheimerkrankheit 3 Vaskuläre Demenz 4 Andere Demenzformen 5 Diagnostische Verfahren 6
Fortbildungsveranstaltung für Angehörige von an Demenz Erkrankten
 Fortbildungsveranstaltung für Angehörige von an Demenz Erkrankten Dr. Hartmut Bauer Marien-Hospital Euskirchen Alzheimergesellschaft Kreis Euskirchen e.v. In Zusammenarbeit mit der Alzheimergesellschaft
Fortbildungsveranstaltung für Angehörige von an Demenz Erkrankten Dr. Hartmut Bauer Marien-Hospital Euskirchen Alzheimergesellschaft Kreis Euskirchen e.v. In Zusammenarbeit mit der Alzheimergesellschaft
Pathophysiologie 3 Möglichkeiten werden diskutiert: 1. Entzündung Dolor Rubor Tumor Calor Schmerz Rötung Schwellung Wärme 2. Sympathische Störungen
 Pathophysiologie 3 Möglichkeiten werden diskutiert: 1. Entzündung Dolor Rubor Tumor Calor Schmerz Rötung Schwellung Wärme 2. Sympathische Störungen ausgeprägte autonome Störungen beim CRPS 3. Maladaptive
Pathophysiologie 3 Möglichkeiten werden diskutiert: 1. Entzündung Dolor Rubor Tumor Calor Schmerz Rötung Schwellung Wärme 2. Sympathische Störungen ausgeprägte autonome Störungen beim CRPS 3. Maladaptive
Abgrenzung zur Demenz: Delir und Depression Wie lautet Ihre Botschaft?
 Geriatrische Fachklinik Georgenhaus Meiningen Abgrenzung zur Demenz: Delir und Depression Wie lautet Ihre Botschaft? J. Zeeh 13. Alzheimer-Tag Thüringen, Weimar 27. September 2014 Mein Vortrag: 1.Demenz
Geriatrische Fachklinik Georgenhaus Meiningen Abgrenzung zur Demenz: Delir und Depression Wie lautet Ihre Botschaft? J. Zeeh 13. Alzheimer-Tag Thüringen, Weimar 27. September 2014 Mein Vortrag: 1.Demenz
Alzheimer-Krankheit und andere Demenzen Brain-Net
 Alzheimer-Krankheit und andere Demenzen Brain-Net Die bundesweite Hirngewebebank gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung Demenz was ist das eigentlich? Die Demenz zählt zu den häufigsten
Alzheimer-Krankheit und andere Demenzen Brain-Net Die bundesweite Hirngewebebank gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung Demenz was ist das eigentlich? Die Demenz zählt zu den häufigsten
Menschen mit Demenz - Krankheitsbilder und Behandlungsoptionen
 5. Fachveranstaltung der STGAG/PKM und des Spitex Verbandes Thurgau am 14.05.2013 Menschen mit Demenz - Krankheitsbilder und Behandlungsoptionen Dr. med. Jacques-Emmanuel Schaefer Demenz, eine Alterskrankheit...!?
5. Fachveranstaltung der STGAG/PKM und des Spitex Verbandes Thurgau am 14.05.2013 Menschen mit Demenz - Krankheitsbilder und Behandlungsoptionen Dr. med. Jacques-Emmanuel Schaefer Demenz, eine Alterskrankheit...!?
Demenzkampagne Rheinland-Pfalz
 Demenzkampagne Rheinland-Pfalz 1 Abgrenzung zum normalen Altern Vergessen gehört ebenso zum Leben wie erinnern. Beim Altern lassen alle Körperfunktionen nach, auch das Gedächtnis bekommt Lücken. Aber nicht
Demenzkampagne Rheinland-Pfalz 1 Abgrenzung zum normalen Altern Vergessen gehört ebenso zum Leben wie erinnern. Beim Altern lassen alle Körperfunktionen nach, auch das Gedächtnis bekommt Lücken. Aber nicht
Gangstörung? Demenz? Blasenschwäche? Altershirndruck (NPH) ist behandelbar!
 Gangstörung? Demenz? Blasenschwäche? Altershirndruck (NPH) ist behandelbar! EINLEITUNG Gangstörungen und Stürze, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Blasenschwäche. Dies sind Symptome, von denen viele
Gangstörung? Demenz? Blasenschwäche? Altershirndruck (NPH) ist behandelbar! EINLEITUNG Gangstörungen und Stürze, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Blasenschwäche. Dies sind Symptome, von denen viele
Kognitive Leistungsfähigkeit. Therapeutische Intervention Jahre 5-10 Jahre Vorklinische Phase Vorklinischer Beginn der Erkrankung 100 %
 Gereon Nelles, Köln Kognitive Leistungsfähigkeit 100 % Therapeutische Intervention Amyloidablagerung 15-30 Jahre 5-10 Jahre Vorklinische Phase Vorklinischer Beginn der Erkrankung Klinische Phase Klinischer
Gereon Nelles, Köln Kognitive Leistungsfähigkeit 100 % Therapeutische Intervention Amyloidablagerung 15-30 Jahre 5-10 Jahre Vorklinische Phase Vorklinischer Beginn der Erkrankung Klinische Phase Klinischer
Nuklearmedizin- Zentralnervensystem. dr. Erzsébet Schmidt Institut für Nuklearmedizin, Universität Pécs
 Nuklearmedizin- Zentralnervensystem dr. Erzsébet Schmidt Institut für Nuklearmedizin, Universität Pécs - Man sieht nur das, was funktioniert! - Strukturgebende Verfahren (CT, MR): Makrostruktur des Gehirns
Nuklearmedizin- Zentralnervensystem dr. Erzsébet Schmidt Institut für Nuklearmedizin, Universität Pécs - Man sieht nur das, was funktioniert! - Strukturgebende Verfahren (CT, MR): Makrostruktur des Gehirns
Sprachen im Gehirn. Marco Monachino. Christina Backes
 Sprachen im Gehirn Marco Monachino Christina Backes Überblick Allgemeines und Aufbau Sprachzentren Neurolinguistische Verarbeitung Methoden der Neurolinguistik 2 Allgemeines Das Gehirn wiegt bei einem
Sprachen im Gehirn Marco Monachino Christina Backes Überblick Allgemeines und Aufbau Sprachzentren Neurolinguistische Verarbeitung Methoden der Neurolinguistik 2 Allgemeines Das Gehirn wiegt bei einem
AVWS Diagnostik aus sprachtherapeutischer Sicht
 AVWS Diagnostik aus sprachtherapeutischer Sicht Birke Peter, Klinische Sprechwissenschaftlerin Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde Universitätsmedizin Leipzig Direktor: Univ.-Prof.
AVWS Diagnostik aus sprachtherapeutischer Sicht Birke Peter, Klinische Sprechwissenschaftlerin Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde Universitätsmedizin Leipzig Direktor: Univ.-Prof.
NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen. Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten
 NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten Die Krankheit Parkinson ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die progredient verläuft
NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten Die Krankheit Parkinson ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die progredient verläuft
Molekulare Bildgebung von Morbus Alzheimer
 Molekulare Bildgebung von Morbus Alzheimer Dr. Ludger Dinkelborg - Piramal Imaging - Düsseldorf 24 June 2014 Übersicht Einführung in die molekulare Bildgebung Morbus Alzheimer (MA) als Herausforderung
Molekulare Bildgebung von Morbus Alzheimer Dr. Ludger Dinkelborg - Piramal Imaging - Düsseldorf 24 June 2014 Übersicht Einführung in die molekulare Bildgebung Morbus Alzheimer (MA) als Herausforderung
(Woher) wissen wir, was Menschen mit Demenz brauchen?
 (Woher) wissen wir, was Menschen mit Demenz brauchen? Univ.-Prof. Dr. med. Andreas Fellgiebel Universitätsmedizin Mainz Klinik für Psychiatrie und Wissen wir, was Menschen mit Demenz brauchen? Ja. Menschen
(Woher) wissen wir, was Menschen mit Demenz brauchen? Univ.-Prof. Dr. med. Andreas Fellgiebel Universitätsmedizin Mainz Klinik für Psychiatrie und Wissen wir, was Menschen mit Demenz brauchen? Ja. Menschen
PET und SPECT in der Neurologie
 PET und SPECT in der Neurologie Themen Epilepsie Demenz Hirntumoren Klinik für Nuklearmedizin München LMU Verfahren Methoden Schnittbilddiagnostik auf Basis von 3D Datensätzen SPECT = Single Photon Emissions
PET und SPECT in der Neurologie Themen Epilepsie Demenz Hirntumoren Klinik für Nuklearmedizin München LMU Verfahren Methoden Schnittbilddiagnostik auf Basis von 3D Datensätzen SPECT = Single Photon Emissions
Geriatric Depression Scale (GDS) Nach Sheikh und Yesavage 1986
 Geriatric Depression Scale (GDS) Nach Sheikh und Yesavage 1986 Die Geriatric Depression Scale nach Sheikh und Yesavage 1986 umfasst in der Kurzform 15 Fragen Die kognitive Situation sollte vorher mit Hilfe
Geriatric Depression Scale (GDS) Nach Sheikh und Yesavage 1986 Die Geriatric Depression Scale nach Sheikh und Yesavage 1986 umfasst in der Kurzform 15 Fragen Die kognitive Situation sollte vorher mit Hilfe
Demenz und Alzheimer. Krankheit des Vergessens. 1 Demenz und Alzheimer
 Demenz und Alzheimer Krankheit des Vergessens 1 Demenz und Alzheimer Inhalt Was versteht man unter Demenz? Symptome und Krankheitsverlauf Formen von Demenz Demenz - Diagnostik Folgen von Demenz Risikofaktoren
Demenz und Alzheimer Krankheit des Vergessens 1 Demenz und Alzheimer Inhalt Was versteht man unter Demenz? Symptome und Krankheitsverlauf Formen von Demenz Demenz - Diagnostik Folgen von Demenz Risikofaktoren
M. Parkinson Ursache und Diagnose
 M. Parkinson Ursache und Diagnose Historisches Häufigkeit Diagnose Manifestationstypen Ähnliche Krankheiten Ursache(n) Zusatzuntersuchungen Prof. Dr. med. Helmut Buchner und klinische Neurophysiologie
M. Parkinson Ursache und Diagnose Historisches Häufigkeit Diagnose Manifestationstypen Ähnliche Krankheiten Ursache(n) Zusatzuntersuchungen Prof. Dr. med. Helmut Buchner und klinische Neurophysiologie
Multiple Sklerose (MS)
 Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Multiple Sklerose 2 Multiple Sklerose (MS) Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Multiple Sklerose 4 Multiple Sklerose 3 Klinischer Fall..\3) Sammlung\Klinischer
Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Multiple Sklerose 2 Multiple Sklerose (MS) Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Multiple Sklerose 4 Multiple Sklerose 3 Klinischer Fall..\3) Sammlung\Klinischer
Beeinflusst Epilepsie das Gedächtnis?
 Beeinflusst Epilepsie das Gedächtnis? Klinik für Epileptologie Universität Bonn Tag der offenen Tür, 14.4.2007 EPIxxxx/x Ursachen kognitiver Störungen bei Epilepsie Strukturell nicht variabel Funktionell
Beeinflusst Epilepsie das Gedächtnis? Klinik für Epileptologie Universität Bonn Tag der offenen Tür, 14.4.2007 EPIxxxx/x Ursachen kognitiver Störungen bei Epilepsie Strukturell nicht variabel Funktionell
Gerontopsychiatrische Aspekte
 Gerontopsychiatrische Aspekte Dr. Peter Tonn, Hamburg 01.09.2014-02.09.2014 Ablauf und Inhalt Einführung Psychopathologischer Befund Recht und Ethik Krankheitsbilder Behandlungsmöglichkeiten Download:
Gerontopsychiatrische Aspekte Dr. Peter Tonn, Hamburg 01.09.2014-02.09.2014 Ablauf und Inhalt Einführung Psychopathologischer Befund Recht und Ethik Krankheitsbilder Behandlungsmöglichkeiten Download:
Anatomie und Symptomatik bei Hirnveränderungen. Dr. med. Katharina Seystahl Klinik für Neurologie Universitätsspital Zürich
 Anatomie und Symptomatik bei Hirnveränderungen Dr. med. Katharina Seystahl Klinik für Neurologie Universitätsspital Zürich Übersicht 1. Anatomisch-funktionelle Grundlagen 2. Symptome bei Hirnveränderungen
Anatomie und Symptomatik bei Hirnveränderungen Dr. med. Katharina Seystahl Klinik für Neurologie Universitätsspital Zürich Übersicht 1. Anatomisch-funktionelle Grundlagen 2. Symptome bei Hirnveränderungen
Modul Psychische Gesundheit (Bella-Studie)
 U. Ravens-Sieberer, N. Wille, S. Bettge, M. Erhart Modul Psychische Gesundheit (Bella-Studie) Korrespondenzadresse: Ulrike Ravens-Sieberer Robert Koch - Institut Seestraße 13353 Berlin bella-studie@rki.de
U. Ravens-Sieberer, N. Wille, S. Bettge, M. Erhart Modul Psychische Gesundheit (Bella-Studie) Korrespondenzadresse: Ulrike Ravens-Sieberer Robert Koch - Institut Seestraße 13353 Berlin bella-studie@rki.de
Demenz. Fotografin Ursula Markus
 Demenz Fotografin Ursula Markus Inhalte 1. Was ist eine Demenz? Wie äußert sich die Demenz bei Menschen Wie verändert sich das Gedächtnis bei Menschen mit Demenz? Welche Stadien der Demenz gibt es? Wie
Demenz Fotografin Ursula Markus Inhalte 1. Was ist eine Demenz? Wie äußert sich die Demenz bei Menschen Wie verändert sich das Gedächtnis bei Menschen mit Demenz? Welche Stadien der Demenz gibt es? Wie
Alzheimer Krankheit. Dr. med. Günter Krämer
 Dr. med. Günter Krämer Alzheimer Krankheit Ursachen, Krankheitszeichen, Untersuchung, Behandlung Für Angehörige, Betreuer, Selbsthilfegruppen und alle, die sich über das Krankheitsbild informieren wollen
Dr. med. Günter Krämer Alzheimer Krankheit Ursachen, Krankheitszeichen, Untersuchung, Behandlung Für Angehörige, Betreuer, Selbsthilfegruppen und alle, die sich über das Krankheitsbild informieren wollen
Biologische Psychologie II Peter Walla
 Kapitel 16 Lateralisierung, Sprache und das geteilte Gehirn Das linke und das rechte Gehirn: Das menschliche Gehirn besteht aus 2 cerebralen Hemisphären, die voneinander getrennt sind, abgesehen von den
Kapitel 16 Lateralisierung, Sprache und das geteilte Gehirn Das linke und das rechte Gehirn: Das menschliche Gehirn besteht aus 2 cerebralen Hemisphären, die voneinander getrennt sind, abgesehen von den
Frontotemporale Demenzen. Dr. med. T.Jochum Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie SRH Waldklinikum Gera
 Frontotemporale Demenzen Dr. med. T.Jochum Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie SRH Waldklinikum Gera Fallbeispiel: Ernst S., 64 Jahre Aufnahmegrund Gedächtnis- und Wortfindungsstörungen seit ca.
Frontotemporale Demenzen Dr. med. T.Jochum Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie SRH Waldklinikum Gera Fallbeispiel: Ernst S., 64 Jahre Aufnahmegrund Gedächtnis- und Wortfindungsstörungen seit ca.
Bewegung und körperliche Aktivität - gut für alle!
 Bewegung und körperliche Aktivität - gut für alle! Tue Gutes und rede darüber! Fachtag Gerontopsychiatrie Mfr. 24. Juni 2015 ZEUS - Zentrum für Erwachsenen- und Seniorensport Gerd Miehling - Dipl.-Sportlehrer,
Bewegung und körperliche Aktivität - gut für alle! Tue Gutes und rede darüber! Fachtag Gerontopsychiatrie Mfr. 24. Juni 2015 ZEUS - Zentrum für Erwachsenen- und Seniorensport Gerd Miehling - Dipl.-Sportlehrer,
