Endbericht. Projektnummer Mental health promotion im Setting Volksschule (SCHUPS Schule und psychische Gesundheit) Projekttitel
|
|
|
- Simon Koenig
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Endbericht Dieser Endbericht ist zur Veröffentlichung bestimmt und kann über die Website des FGÖ von interessierten Personen abgerufen werden. Er dient dazu, die Erfahrungen aus dem Projekt anderen zur Verfügung zu stellen, um bewährte Aktivitäten und Methoden weiter zu verbreiten. Damit aus Fehlern auch gelernt werden kann, ist es selbstverständlich ebenso wichtig, Dinge zu beschreiben, die sich nicht bewährt haben und Änderungen zwischen ursprünglichen Plänen und der realen Umsetzung nachvollziehbar zu machen. Beginnen Sie den Bericht mit einer kurzen Darstellung des Konzeptes, ähnlich wie bereits bei der Antragstellung. Beschreiben Sie dann die konkrete Projektdurchführung und gehen Sie anschließend ausführlich auf Ergebnisse und Empfehlungen ein wie in der Inhaltsstruktur auf der Folgeseite vorgegeben. Projektnummer 1604 Projekttitel Mental health promotion im Setting Volksschule (SCHUPS Schule und psychische Gesundheit) Projektträger/in Unterstützungsverein Schulpsychologie Steiermark Projektlaufzeit Erreichte Zielgruppengröße Autoren/Autorinnen adresse/n Ansprechpartner/innen Ca. 980 Personen Mag. Birgit Zechner, Mag. Ulrike Bredt, Mag. Schiwa Shirazian Datum
2 1. Kurzzusammenfassung Stellen Sie Ihr Projekt im Umfang von maximal Zeichen (inkl. Leerzeichen), gegliedert in zwei Abschnitte, dar: Projektbeschreibung Ergebnisse und Fazit Von April 2009 bis März 2013 wurde das einmalige, neuartige und prototypische Pilotprojekt Schups Schule und psychische Gesundheit an vier Grazer Volksschulen durchgeführt, welches vom Fonds Gesundes Österreich, Land Steiermark Bildungsressort, Land Steiermark Gesundheitsressort und dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur finanziert und vom Unterstützungsverein Schulpsychologie in Kooperation mit der Abteilung Schulpsychologie im Landesschulrat und Styria vitalis abgewickelt wurde. Ziel von Schups war es, die psychosoziale Gesundheit aller am Schulleben beteiligten Personen und in diesem Zusammenhang auch die Leistungsfähigkeit von SchülerInnen zu fördern. Erreicht werden sollte dies durch den Einsatz von zwei Psychologinnen, die jeweils einen Tag pro Woche an einer Schule verbrachten, um dort Kindern, Eltern und LehrerInnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Außerdem wurden an den Schulen mit Hilfe externer ReferentInnen Jahresschwerpunkte zu psychosozialen Themen abgehalten. Mit diesen Interventionen gelang eine starke Unterstützung aller handelnden Personen im Schulhaus, der SchülerInnen und der Eltern. Druckpunkte, die im Schulleben aufgetreten sind, konnten frühzeitig erkannt werden und bei Bedarf wurde rechtzeitig Abhilfe geschaffen. Großes Gewicht wurde auf die bestmögliche Vernetzung aller bereits vorhandenen Unterstützungsstrukturen (BeratungslehrerIn, Schulpsychologe/in, SchulärztIn etc.) gelegt. Ebenso sollten schulinterne und schulexterne Unterstützungsmöglichkeiten durch die am Standort tätigen Psychologinnen vernetzt werden, um in Einzelfällen rasch und frühzeitig intervenieren zu können. Die Erfahrungen aus diesem Projekt zeigen ganz deutlich, dass, wenn regelmäßig PsychologInnen an den Schulen sind, um für SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern Ansprechpartner bei Problemen zu sein, die psychische Gesundheit aller Beteiligten einerseits, und andererseits das Klima an der Schule immens verbessert wird. Dies führt auch zu besseren Lernerfolgen der SchülerInnen. 2. Projektkonzept Beschreiben Sie welche Überlegungen zum Projekt geführt haben, welche Organisationen bzw. Partner/innen das Projekt entwickelt haben, ob und welche Anleihen Sie an allfälligen Vorbildprojekten oder Vorläuferprojekten genommen haben. Probleme, auf die das Projekt abgezielt und an welchen Gesundheitsdeterminanten (Einflussfaktoren auf Gesundheit) das Projekt angesetzt hat. das/die Setting/s in dem das Projekt abgewickelt wurde und welche Ausgangslage dort gegeben war. 2
3 die Zielgruppe/n des Projekts (allfällige Differenzierung in primäre und sekundäre Zielgruppen Multiplikatoren/Multiplikatorinnen etc.). die Zielsetzungen des Projekts - angestrebte Veränderungen, Wirkungen, strukturelle Verankerung. Schule ist ein wichtiger Lebens- und Entwicklungsbereich von Kindern und Jugendlichen. Zudem ist Schule die Arbeitswelt vieler Erwachsener und der Verantwortungsbereich vieler Eltern. Schule wird als Lebensraum auch mit den Lebensproblemen der SchülerInnen konfrontiert, birgt als solcher aber auch Chancen für die Entwicklung ihrer SchülerInnen. Der Auftrag der österreichischen Schule wird hauptsächlich in der Wissensvermittlung und im Vorbereiten auf das Leben gesehen. Übersehen wird dabei allerdings oft, dass Kinder und Jugendliche ihre wahrscheinlich wichtigste Zeit in der Schule verbringen. Die Zeit in der neben der körperlichen und geistigen Entwicklung auch die psychosoziale Entwicklung einen besonderen Stellenwert einnimmt. Dabei nimmt die Volksschule eine besondere Rolle ein. Gerade in den ersten Jahren wird Schullust- oder Unlust geprägt (in engem Zusammenhang mit der Lust zu Lernen, sich weiterzubilden). Schule hat weiters einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung von Eigenverantwortlichkeit, Handlungs- und Leistungsfähigkeit und auf den Selbstwert sowie das Selbstvertrauen von Kindern und Jugendlichen. Hinzu kommt die oft nicht wahrgenommene Vorbildfunktion im Umgang mit Fehlern, mit anders sein, mit sozialen Anforderungen, ethischen Grundprinzipien und vor allem dem Miteinander in einer zunehmend heterogenen Welt. Schule ist somit nur vordergründig ein Ort der Wissensvermittlung. Schule ist für SchülerInnen im Hintergrund ein Bereich ihres Lebens, ein Bereich ihrer Emotionen, ihrer Sozialkontakte, ein Bereich in dem es sich zu behaupten gilt, ein Bereich in dem auch Platz für ihre Probleme in Anspruch genommen werden muss, die sie nicht einfach zu Hause lassen können (das ist der Bereich der für die SchülerInnen im Vordergrund steht, vor allem auch deshalb, da die Lust zu lernen beim Großteil der SchülerInnen innerhalb kürzester Zeit verloren geht). Leider haben aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen und Ansprüche viele Kinder Probleme % der Schulkinder weisen Entwicklungsdefizite im Sprachbereich, 5 10 % haben Entwicklungsrückstände in der Grob- und Feinmotorik. 10 % leiden unter Angststörungen (z. B. Schulphobien, Sozialphobien), 8 % haben aggressiv-dissoziale Störungen, 4-6 % depressive oder hyperkinetische Störungen (Dordel, 1998, Krombolz, 2005; Straßburg et al, 2003). Die Schule als Ort der Wissensvermittlung ist Teil der Gesellschaft (Paulus, 2004) und wird gleichsam Mitverantwortliche wie Opfer des Leistungsdruckes unserer aktuellen Zeit. Hinzu kommen Probleme von LehrerInnen, deren Ausbildung sich mit den gesellschaftlichen Ansprüchen und Anforderungen weiterentwickelt. LehrerInnen schätzen ihr Ansehen in der Gesellschaft schlechter ein, als es tatsächlich gesehen wird (IFES, 2006) und erleben Faktoren wie Rollenkonflikte, belastendes SchülerInnenverhalten, psychische Belastungen, Zeitstress belastend (Sehbinder, Gerich, 2006). Zwischen SchülerInnen und LehrerInnen stehen die Eltern. Manche von ihnen sind selbst mit den gesellschaftlichen Anforderungen des Leistungsdruckes, des Statusinnehabens und der neuen Familienkonstellationen überfordert. Zudem kommen sie teilweise selbst aus einer Schulzeit, an die sie schlechte Erinnerungen haben, oder von der der Eindruck geblieben ist, nichts gelernt zu haben oder auf das Leben nicht vorbereitet geworden zu sein (Bauer, 3
4 2007). Nun stehen sie zwischen den Leistungs- und Verhaltensproblemen ihrer Kinder und den Vorwürfen der LehrerInnen, ihrem Erziehungsauftrag nicht nachzukommen. Zu guter letzt wird die Institution Schule sowie alle SchulpartnerInnen von Politik und Medien überwiegend kritisiert. Die Liste der Vorwürfe an alle am Schulleben beteiligten Personen ist lang, Unterstützung aber kaum vorhanden. Im Fokus dieser wenigen Unterstützung steht dann in erster Linie die Leistungsverbesserung. Was kann getan werden um die Leistung unserer SchülerInnen zu verbessern? Diese Frage stellt man sich vor allem stets nach den Ergebnissen der neuesten PISA-Studie! Die Frage: Was kann man tun damit es den SchulpartnerInnen im Lebensraum Schule besser geht? wird kaum gestellt. Dabei wird z. B. im Survey der WHO (Health behavior in Schoolaged Children, 2002), ein hoher Zusammenhang zwischen Schulleistung und Gesundheit (r=0,696), oder auch Schulleistung und Lebenszufriedenheit (r=0,782) belegt. Der Slogan der Weltgesundheitsorganisation: There is no health without mental health. ist für den Lebensraum Schule und die damit einhergehende Leistungsfähigkeit als grundlegend zu erachten. Fasst man die aktuellen Ergebnisse aus der HBSC-Studie und die Studie zum Wohlbefinden Österreichischer SchülerInnen (Eder, 2005) zusammen, wirken folgende Einflussfaktoren zentral auf das Wohlbefinden (ausgedrückt in Lebensqualität, wenig psychosomatischen Beschwerden und einem subjektiv sehr gut eingeschätzten Gesundheitszustand) der SchülerInnen: Qualität des Unterrichts (z. B. Schülerzentriertheit, soziale und didaktische Merkmale des Unterrichts etc.) Subjektiv wahrgenommener Schulerfolg Zufriedenheit mit Leistung Sich auskennen Integration bei SchülerInnen und LehrerInnen (Gute Beziehungen zwischen SchülerInnen untereinander und zu den LehrerInnen) Schul- und Klassenklima Erlebter Sozial- und Leistungsdruck Arbeitsplatz Schule (Gemütlichkeit, Ausstattung) Persönliche Bedeutsamkeit des Unterrichts (v.a. bei älteren SchülerInnen) Passung der Schule (vor allem bei älteren SchülerInnen) Beteiligungsmöglichkeiten SchülerInnen, die gerne zur Schule gehen, zeigen einerseits mehr Leistungsbereitschaft, andererseits auch ein positiveres Gesundheitsverhalten (ausgedrückt in Tabak- und Alkoholkonsum) und beteiligen sich konstruktiver im Unterricht (Eder, 2005). Gerade die Leistungsbereitschaft und die Chance auf eine produktive Unterrichtsbeteiligung der SchülerInnen sind Faktoren, die wiederum positiv auf die LehrerInnen-Gesundheit wirken können, da gerade störendes SchülerInnen-Verhalten einen starken Belastungsfaktor für LehrerInnen darstellt (Sehbinber, Gerich 2006). Die oben genannten Zusammenhänge zeigen auf, dass bei der Förderung der psychosozialen Gesundheit im Setting Schule auf mehreren Ebenen interveniert werden muss, um nachhaltige Gesundheit zu gewährleisten. 4
5 Paulus (2004) beschreibt vier Interventionsebenen, auf denen die psychosoziale Gesundheit gefördert werden kann: Abbildung 1: Beteiligte Personengruppen (Quelle: RückRat für die Seele, S. 13; Paulus, 2002) Gesundheitsförderung setzt auf den Ebenen Gesamte Schulumwelt und Unterrichts- bzw. Curriculumsgestaltung an. Zusätzlich benötigen eine beträchtliche Anzahl an SchülerInnen Unterstützung bei psychosozialen Problemen im Sinne von primärer bzw. sekundärer Prävention. Diese wird großteils von LehrerInnen bewerkstelligt und erfolgt mit wenig externen Ressourcen. In diesem Bereich wünschen sich viele Schulen mehr Unterstützung Unterstützung die nur zum Teil von der Schulpsychologie und anderen Institutionen gewährleistet werden kann. Gesundheitsförderung und Prävention können nicht im therapeutischen Bereich wirken, jedoch den Weg zu diesen Quellen flüssig machen. Eine Gesundheitsfördernde Schule übernimmt (im Rahmen ihrer Möglichkeiten) Verantwortung für die Entwicklung der SchülerInnen und LehrerInnen mit dem Ziel, deren Gesundheit und Leistungsfähigkeit langfristig zu gewährleisten (Setteroboulte, Hurrelmann, 2006). Das durchgeführte Projekt soll Volksschulen in der Steiermark ermöglichen, diese Verantwortung (mit Focus auf die psychosoziale Entwicklung) bestmöglich übernehmen zu können und den Rahmen der Möglichkeiten optimal auszuschöpfen. Im Rahmen einer Voruntersuchung hat sich das Projektteam intensiv mit aktuellen psychologischen Ressourcen als Unterstützung für SchulpartnerInnen auseinandergesetzt. Dazu wurden Fragestellungen im Rahmen einer Fragebogenerhebung an Volksschulen aus dem Raum Knittelfeld, als Stichprobe vom Land, und Volksschulen aus der Stadt Graz bearbeitet. Die Fragen bezogen sich vor allem auf das Wissen um das Vorhandensein der möglichen Ressource Schulpsychologie und um den Bedarf eines Ansprechpartners, einer Ansprechpartnerin bei schulischen Problemen. Die Fragebögen wurden sowohl SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen vorgegeben. Die Ergebnisse zeigten, dass einerseits nur ein geringes Wissen um 5
6 diese Ressource vorhanden ist, andererseits von der Bedürfnislage der SchulpartnerInnen dezidiert der Wunsch nach Unterstützung gefordert wird. Basierend auf der Voruntersuchung wurde dann ein schulpsychologisches Projekt in einer Grazer Volksschule (VS Geidorf) installiert. Im Rahmen dieses Projektes wurde Aufklärungsarbeit über die Ressource Schulpsychologie geleistet. Weiters wurden mit der Direktorin Entlastungsgespräche geführt. Für die SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern wurden Beratungsgespräche angeboten. Im Rahmen des Projektes zeigte sich, dass psychische Gesundheit im Kontext Schule, auch im Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit sowohl von SchülerInnen als auch von LehrerInnen, immer mehr an Bedeutung zunimmt. Ein Abschlussgespräch am Ende dieses Projektes zeigte, dass die Beratungsgespräche als unterstützend wahrgenommen wurden und es wurde der Wunsch nach einer Fortführung des Projektes geäußert. Die Erfahrungen von Seiten der Schulpsychologie zeigen, dass der Bedarf an schulpsychologischen Ressourcen steigt. Vorderrangig ist die Aufgabe der Schulpsychologie die Diagnostik (z. B. Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf, Schulreife) und die darauf basierende Beratung. Was aber tun mit dem ständig wachsenden Anteil betreuungsbedürftiger SchülerInnen, ausgebrannter LehrerInnen und verunsicherter Eltern? Der Fokus des Initiativwerdens liegt in Österreich leider hauptsächlich im kurativen Bereich, in dem Symptome behandelt werden sollen. Das gesundheitspsychologische Motto Gesund bleiben statt wieder gesund werden scheint in diesem Zusammenhang auch in dem System Schule zielführend zu sein. Schwierigkeiten früh genug erkennen, gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen in der Schule und die Fähigkeit zur adäquaten Problemlösung bei den SchulpartnerInnen sind wichtige Erfolgsvariablen. Ziel von zukünftigen Verbesserungsmaßnahmen aktueller Schulsituationen kann nur in Empowerment liegen, was bedeutet, Schulen dabei zu unterstützen stark gegenüber gesellschaftlicher Anforderungen zu werden und es zu bleiben. Ziel des durchgeführten Projektes ( Mentalhealth promotion im Setting Volksschule bzw. SCHUPS - Schule und psychische Gesundheit ) war eine bestmögliche Unterstützung aller handelnden Personen im Schulhaus, der SchülerInnen und der Eltern. Intention des Projektes war es, Druckpunkte, die im Schulleben auftreten können, frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf rechtzeitig Abhilfe zu schaffen. Großer Schwerpunkt wurde auf die bestmögliche Vernetzung aller bereits vorhandenen Unterstützungsstrukturen (BeratungslehrerIn, Schulpsychologe/in, SchulärztIn etc.) gelegt. Ebenso sollten schulinterne und schulexterne Unterstützungsmöglichkeiten durch die am Standort tätigen Psychologinnen vernetzt werden, um in Einzelfällen rasch und frühzeitig intervenieren zu können. Es sollten Zielsetzungen und Maßnahmen für alle SchulpartnerInnen hinsichtlich der Förderung von Wohlbefinden und (psychischer) Gesundheit in der Schule (Prävention) erarbeitet werden. Daraus ableitend sollte und soll sich ein standortbezogenes Konzept entwickeln, um ein bestmögliches schulisches Unterstützungssystem aufzubauen, das auch auf andere Schulstandorte übertragen werden könnte. Unterstützung soll in diesem Zusammenhang möglichst rasch und unbürokratisch erfolgen. Zusammengefasst war die Zielsetzung des beantragten Projektes die Förderung bzw. Erhaltung der psychosozialen Gesundheit und der Leistungsfähigkeit von SchülerInnen (und LehrerInnen). Basierend auf die Interventionsebenen von Paulus (2002) sollen Schulen: 6
7 ihre Einflussmöglichkeiten in Bezug auf eine gesunde psychosoziale Entwicklung der Kinder, aber auch der LehrerInnen selbst, erkennen und anerkennen [Interventionsebene 1] selbständig an selbstgesteckten Zielen für die Weiterentwicklung von förderlichen Rahmenbedingungen arbeiten [Interventionsebene 1] und Determinanten von Wohlbefinden und psychosozialer Gesundheit (Beziehungen zwischen SchülerInnen, SchülerInnen & LehrerInnen etc.) im Unterricht und Schulalltag so beeinflussen, dass eine positive Gesundheitsentwicklung wahrscheinlich ist [Interventionsebene II] die Unterrichtsgestaltung dahingehend weiterentwickeln, dass auch SchülerInnen mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf über eine gute Schulzufriedenheit verfügen und ihre Leistungspotenziale optimal ausnützen können [Interventionsebene III] das schulpsychologische Zusatzangebot bzw. andere Unterstützungsangebote für SchülerInnen mit therapeutischem Interventionsbedarf kennen und bei Bedarf in Anspruch nehmen. 3. Projektdurchführung Beschreiben Sie wie die Projektaktivitäten/-maßnahmen und Methoden in welchem zeitlichen Ablauf umgesetzt wurden. die Projektgremien/Strukturen und die Rollenverteilung im Projekt. umgesetzte Vernetzungen und Kooperationen. allfällige Veränderungen/Anpassungen des Projektkonzeptes, der Projektstruktur und des Projektablaufes inkl. Begründung. Insgesamt vier Schulen wurden über den geplanten Projektantrag informiert, wobei in drei dieser Schulen das Kollegium entschieden hat, an diesem Projekt teilzunehmen und großes Interesse signalisiert wurde. Folgende Schulen haben am Projekt teilgenommen: VS St. Veit, VS Geidorf, VS Triester Für die Durchführung des Projektes waren an jeder teilnehmenden Schule Psychologinnen für einen Tag pro Woche u.a. für Beratungs- und Entlastungsgespräche anwesend. Des Weiteren wurde eine Kooperation mit dem Programm Gesunde Volksschule von Styria vitalis eingerichtet. Zum einen wurde die Prozessbegleitung im Rahmen dieses Programms von MitarbeiterInnen von Styria vitalis durchgeführt und zum anderen konnten die Schulen ReferentInnen aus dem Pool von Styria vitalis wählen, die Expertise zu psychosozialen Themenstellungen haben, um die gesetzten Jahresschwerpunkte in Form von Workshops umzusetzen. Im Rahmen dieses Projektes wurde durch die Teilnahme der drei Schulen ein fiktiver Schulverbund organisiert. Zu diesem Zweck waren Vernetzungstreffen der Projektleitung mit der DirektorIn und 1-2 LehrerInnen-Vertretungen der jeweiligen Schule vorgesehen. Mit Hilfe dieser Vernetzung sollten standortspezifische Erfahrungen für die jeweils andere Schule nutzbar gemacht werden. Des Weiteren wurden die drei Volksschulen im Rahmen des Projektes Mitglied im Netzwerk Gesunder Volksschulen von Styria vitalis. Die Erfahrungen, die die Schulen im Rahmen ihres 7
8 Sonderprojektes machten, konnten und können nach wie vor in das Netzwerk Gesunder Volksschulen von Styria vitalis eingebracht werden. Die Schulen haben die Möglichkeit, ihre Interventionen in der Netzwerkzeitung aktuell zu präsentieren und an Vernetzungstreffen (z.b. jährliches Schulstarttreffen oder regionalen Fortbildungsveranstaltungen) teilzunehmen. In der ersten Phase des Projektes (Diagnosephase) fanden in der Zeit von April 2009 September 2009 eine Ist-Zustandserhebung auf SchülerInnen-, Eltern- und LehrerInnenebene mit Hilfe von Fragebögen, ein Basisworkshop und Diagnoseworkshops statt. Der Basisworkshop wurde im April 2009 umgesetzt und vom Team Unterstützungsverein Schulpsychologie (Dr. Josef Zollneritsch, Mag. Ulrike Bredt, Mag. Birgit Zechner) und dem Team Styria vitalis (Mag. Eva Deutsch, Mag. Doris Kuhness) durchgeführt. Bei diesem Workshop wurden den LehrerInnen aller teilnehmenden Schulen allgemeine Zusammenhänge zwischen Schule und psychosozialer Gesundheit und der Interventionsrahmen erklärt. In diesem Rahmen konnten sich die PädagogInnen kennenlernen und die Motivation und innere Beteiligung wurde gefördert. Gemeinsam wurde auch ein neuer Name für das Projekt gefunden, welcher v.a. auch für die SchülerInnen einprägsamer sein sollte man einigte sich auf den Namen SCHUPS Schule und psychische Gesundheit. (siehe Beilage 2) Der Diagnoseworkshop erfolgte für jeden Schulstandort getrennt. Es wurden gemeinsam mit dem gesamten LehrerInnen-Kollegium Ressourcen und Handlungsfelder zum Thema psychosoziale Gesundheit anhand der fünf Schulentwicklungsfelder (Lehren & Lernen, Lebensraum Klasse & Schule, Professionalität und Personalentwicklung, Schulpartnerschaft und Außenbeziehungen, Schulorganisation & Schulmanagement) auf den vier Interventionsebenen definiert und erarbeitet. Am Ende des Diagnoseworkshops standen globale Ziele, die die Schule mit dem Projekt im ersten Jahr erreichen möchte. Auch diese Workshops wurden vom Team Styria vitalis und dem Team Unterstützungsverein Schulpsychologie durchgeführt und fanden im Zeitraum von Mai 2009 Juni 2009 statt. (siehe Beilagen 3a 3c) Im Juni 2009 wurde auch die Ist-Zustandserhebung auf SchülerInnen-, LehrerInnen- und Elternebene durchgeführt. Die Befragung erfolgte mittels Fragebögen und wurde vom Team Unterstützungsverein Schulpsychologie durchgeführt. Die Auswertung erfolgte durch die Evaluatorinnen (Frau Mag. Dr. Sabine Bergner und Frau Mag. Christine Kragl) im Zeitraum Juli 2009 September Die Durchführungs- bzw. Umsetzungsphase begann schließlich im September Für die im Projekt beschäftigten Psychologinnen wurden in jeder Schule der genaue Präsenztag und die Kernzeit (von 7:30 11:30 Uhr) fixiert, wobei bei Bedarf eine flexible Arbeitszeitgestaltung möglich war. Im Rahmen des Projektes waren die Hauptaufgaben der Psychologinnen beispielsweise Beratungs- und Entlastungsgespräche mit SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen, Klasseninterventionen, Diagnostik, usw. Aber auch die Vernetzung mit Schulpsychologie, BeratungslehrerInnen, Schulärztinnen und schulexternen Unterstützungsressourcen (SozialarbeiterInnen, ErziehungshelferInnen, ) nahmen einen wichtigen Teil der Arbeit ein, um bei Bedarf rasch und niederschwellig intervenieren zu können. Weiters wurde das Projekt im Rahmen von Elternabenden und Schulforen vorgestellt. Es bestand somit v.a. für Eltern die Möglichkeit eines persönlichen Kennenlernens und des Nachfragens bei Unklarheiten. Die Präsenz an den Elternabenden und Konferenzen wurde sowohl von Seiten der Eltern als auch der LehrerInnen gut in Anspruch genommen, da in 8
9 diesem Rahmen die Kontaktaufnahme erleichtert wurde und die Hemmschwelle somit noch mehr herabgesetzt war. Es fanden erste Vernetzungstreffen mit schulinternen Unterstützungssystemen statt, um das Projekt vorzustellen und ein persönliches Kennenlernen zu ermöglichen. Im Oktober 2009 wurden im Rahmen eines Zielworkshops die Ergebnisse aus dem Diagnoseworkshop durch die DirektorInnen vorgestellt und die ersten Ergebnisse aus der IST- Zustandserhebung von den externen Evaluatorinnen präsentiert. Die Ergebnisse wurden auch in Form von detaillierten Berichten an die Schulen übermittelt. Ein weiteres Ziel dieses Workshops war das Formulieren eines ersten Jahresschwerpunktes für jede Schule und das Auswählen dazupassender Module. Das Team aus der VS Geidorf wählte als Jahresschwerpunkt für das erste Projektjahr das Thema Klassengemeinschaft stärken. Module, die diesem Ziel dienen sollten, waren Neues Lernen in Resonanz und So ein Theater. Durch diese Module soll das Selbstvertrauen, die Selbst- und Sozialkompetenz gefördert werden. Das LehrerInnen-Kollegium der VS St. wollte im ersten Projektjahr über zwei Module zum Thema Selbstwert & Konfliktmanagement arbeiten. Das Modul 1x1 des Streitens soll Kinder unterstützen, Konflikte altersadäquat selbst zu lösen und mit dem Modul Auf das Gute schauen soll bei Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen ein ressourcenorientierter Blick eingeübt werden. Für die VS Triester war es im ersten Projektjahr wichtig, an der Verbesserung der sozialen Beziehungen und der Stärkung des Gefühls von Sicherheit bei den SchülerInnen in Kooperation mit den Eltern zu arbeiten. Dazu wurden die Module So ein Theater und Es war eh nur Spaß (Mobbing + Prävention) gewählt. In der Durchführungsphase begann dann die Maßnahmenplanung der Projektgruppe (LehrerInnen-Team, ProzessbegleiterInnen und Psychologinnen) mit einem in der Diagnosephase definierten Handlungsbereich. Es wurde an jeder Schule ein Planungsworkshop durchgeführt, bei dem auf das Handlungsfeld bezogene Thema (z.b. Selbstwert fördern, Selbstwirksamkeit fördern) wieder anhand der fünf Schulentwicklungsfelder spezifische Ressourcen und Belastungen definiert wurden. Dazu wurden Feinziele, die innerhalb eines Schuljahres erreicht werden könnten, erarbeitet. Gemeinsam mit den externen ReferentInnen wurden die Inhalte und Ziele der jeweils gewählten Module besprochen und die Termine für die Umsetzung vereinbart. Pro Klasse standen 8 12 Unterrichtseinheiten für das jeweilige Modul (z.b. Soziales Lernen, Konfliktmanagement, Kommunikationsförderung, Life-Skills-Erweiterung) zur Verfügung. Dieser Zeitrahmen wird auch im Programm der Gesunden Volksschule von Styria vitalis für die direkte Intervention mit den SchülerInnen zur Verfügung gestellt und stellt eine gute Arbeitsbasis dar. Begleitend zu den Interventionen in den Klassen wurden Eltern- und LehrerInnenfortbildungen zu den gewählten Themenschwerpunkten angeboten. In der Umsetzungsphase arbeiteten somit externe ReferentInnen, das Team von Styria vitalis und die Psychologinnen mit SchülerInnen-, LehrerInnen und Elterngruppen. Wichtig waren auch Vernetzungen mit den ProjektpartnerInnen und den externen ReferentInnen der Workshops, um weitere Vorgehensweisen und weiterführende Maßnahmen zu besprechen. Im Sinne der Vernetzung fanden Ende 2009 und Anfang 2010 Steuergruppentreffen mit dem Steuerungsteam der jeweiligen Schule statt. Diese Treffen dienten dazu, Erwartungen und Vorstellungen noch einmal zu thematisieren und bisherige Wahrnehmungen zu reflektieren. Im Rahmen dieser Treffen wurde auch ein Malwettbewerb unter den SchülerInnen vorgeschlagen, um ein eigenes SCHUPS-Logo zu kreieren. Alle SchülerInnen der teilnehmenden Schulen hatten die Möglichkeit daran teilzunehmen. Gewonnen hat eine Schülerin aus der VS 9
10 St. Veit. Das Logo wurde prämiert und im Zuge dessen wurde sogar ein eigen komponiertes SCHUPS-Lied präsentiert. Auf Wunsch der VS St. Veit fand auch ein Vernetzungstreffen mit dem Elternverein der Schule statt, um zu besprechen, wie man das Projekt gut in die Elternschaft kommunizieren kann. Es wurden daraufhin Folder zum Projekt und auch Plakate entworfen, welche in den Schuleingangsbereichen aufgehängt wurden. (siehe Beilagen 4 und 5) Am Ende des ersten Projektjahres (Mai 2010) wurde über einen Reflexionsworkshop im gesamten LehrerInnen-Kollegium bewertet, inwieweit die selbst gesetzten Ziele erreicht werden konnten. Ziel war es somit, die Ergebnisse aus der Zusammenarbeit im Schuljahr 2009/2010 zu sichern, Erreichtes wahrnehmbar zu machen und offene Punkte für die weitere Zusammenarbeit festzuhalten. Im Juni 2010 fand wieder eine Fragebogenerhebung auf Eltern-, LehrerInne- und SchülerInnenebene statt. Die Erhebungsinstrumente wurden von den Evaluatorinnen entwickelt bzw. wurden die Fragebögen der ersten Erhebung modifiziert. Befragt wurden SchülerInnen der zweiten bis vierten Schulstufe, alle LehrerInnen und Eltern. Im Gegensatz zur Ist- Zustandserhebung im Juni 2009 wurden die SchülerInnen der ersten Klassen nicht befragt, da sich zeigte, dass die daraus gewonnenen Daten nicht verwertbar waren. Neben der Fragebogenerhebung wurden durch die Evaluatorinnen auch halbstrukturierte Interviews mit dem Team Unterstützungsverein Schulpsychologie, dem Team Styria vitalis und den Steuerungsteams der Schulen durchgeführt, um ergänzende Informationen zur Projektzielerreichung zu erhalten. Mit Beginn des zweiten Projektjahres (2010/2011) startete natürlich wieder die wöchentliche Präsenz der Psychologinnen in den Schulen. Das Projekt wurde in den ersten Klassen vorgestellt und in den anderen Klassen wurde wieder daran erinnert. Es fanden Vernetzungsgespräche mit den DirektorInnen, dem Team Styria vitalis und dem Evaluatorinnen-Team statt, um den aktuellen Stand und die weiteren Vorgehensweisen zu besprechen. Im Oktober 2010 wurde auch wieder ein Steuergruppen-Treffen mit den Steuerungsteams der Schulen durchgeführt. Ziel dieses Treffens war es einerseits, das vergangene Schuljahr gemeinsam zu reflektieren und andererseits noch einmal zu besprechen, ob es hinsichtlich der weiteren Schritte Unklarheiten gibt bzw. ob noch andere Maßnahmen zu setzen sind. Weiters gab es erste Rückmeldungen zur Evaluation. Die ausführliche Rückmeldung zu den Evaluationsergebnissen fand Ende November 2010 statt. Die Ergebnisse jeder Schule wurden zusammengefasst und verglichen, somit konnten Erfahrungen der einen Schule für die anderen sichtbar gemacht werden. Im Dezember 2010 wurde das Projekt in einer weiteren Schule durch das Team Unterstützungsverein Schulpsychologie und das Team Styria vitalis vorgestellt. Die VS Peter Rosegger war seit längerem an einer Teilnahme am Projekt interessiert. Nach Rücksprache mit Frau Mag. Rohrauer-Näf und Abklärung ob dies unser Budget erlaubt, wurde ein Termin für diese Erstpräsentation vereinbart. In Folge wurde entschieden, dass die Schule ab Jänner 2011 in einem reduzierten Ausmaß am Projekt teilnehmen wird, jedoch von der Evaluierung ausgeschlossen ist. 10
11 Seit Jänner 2011 gab es auch eine Änderung im Personal Frau Mag. Schiwa Shirazian war als Karenzvertretung für Frau Mag. Ulrike Bredt als zweite Psychologin im Projekt tätig. Auch im zweiten Projektjahr fanden für jede Schule Planungsworkshops statt. Ziel war wiederum, für jede Schule einen Jahresschwerpunkt zu wählen, Feinziele abzustimmen, die innerhalb eines Schuljahres erreicht werden könnten und dazu passende Module zu wählen. Einige LehrerInnen-Teams (VS Geidorf, VS St. Veit) wollten am Vorjahr anknüpfen und somit dasselbe Jahresthema z.b. Die Gemeinschaften der Klassen stärken mit denselben Maßnahmen vertiefen. Die Workshops wurden so gewählt, dass sie auf die im vergangenen Jahr durchgeführten Workshops aufbauen. Mit der VS Triester wurde im zweiten Projektjahr in Kooperation mit den beiden Netzwerken Wir sind Graz und Seelische Gesundheit (SCHUPS) das Afrika-Projekt (mit Fred Ohenhen) umgesetzt. Ziele waren u.a. die Begegnung mit Menschen aus einem fremden Kulturkreis, Sensibilisierung für Andere und das soziale Klima stärken. Die VS Peter Rosegger wählte für ihre Schule das Modul 1x1 des Streitens. Im März 2011 fand wieder ein Steuergruppen-Treffen mit allen Steuerungsteams der Schulen, dem Team Schulpsychologie Steiermark und dem Team Styria vitalis statt. Ziel dieses Treffens war es einerseits, die neue Schule (VS Peter Rosegger) im Team zu begrüßen und andererseits zu besprechen, ob es hinsichtlich der weiteren Schritte Unklarheiten gibt bzw. ob noch andere Maßnahmen zu setzen sind. Es wurde weiters gemeinsam entschieden, dass die Reflexion der einzelnen Workshops im zweiten Projektjahr für jede Schule getrennt stattfinden wird. Die Erfahrung zeigte, dass eine ausführliche, effektive Reflexion genügend Raum und Zeit benötigt. Aufgrund der hohen TeilnehmerInnenzahl (Teilnahme vom gesamten LehrerInnen-Kollegium aus vier Schulen) hätte sich eine gemeinsame Reflexion als nicht sinnvoll erweisen. Da die Vernetzung und der Austausch der Schulen jedoch ein wichtiges Ziel des Projektes war, wurde für Herbst 2011 ein gemeinsamer Vernetzungstermin geplant. Im Mai 2011 konnten die Schulen an einem Netzwerktreffen bei Styria vitalis teilnehmen. Durch die Mitgliedschaft im Netzwerk Gesunder Schulen von Styria vitalis hatten und haben die Schulen die Möglichkeit, ihre Schule als gesundheitsförderndes Setting weiterzuentwickeln. Weiters soll der Austausch im Schulverbund und die Vermittlung von Wissen über externe und interne Unterstützungsressourcen dazu beitragen, um die Nachhaltigkeit des Projektes zu gewährleisten. Auf Wunsch der LehrerInnen der VS St. Veit wurden die SCHUPS-Psychologinnen und Dr. Josef Zollneritsch im Mai 2011 zu einer Konferenz eingeladen, um mit der gesamten LehrerInnengruppe erneut Erwartungen abzugleichen, die Rolle der psychologischen Unterstützungsleistung noch einmal zu definieren und Verbesserungsmöglichkeiten in der Alltagskommunikation zu diskutieren. Am Ende des zweiten Projektjahres (Mai/Juni 2011) wurde wieder über einen Reflexionsworkshop (in diesem Jahr getrennt für jede Schule) bewertet, inwieweit die selbst gesetzten Ziele erreicht werden konnten. Was die laufenden Evaluierungsaktivitäten betrifft wurden im Juli 2011 wieder halbstrukturierte Interviews mit dem Team Unterstützungsverein Schulpsychologie und dem Team Styria 11
12 vitalis durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Interviews flossen in den Evaluierungsendbericht ein. Wie auch in den Jahren zuvor startete mit Schulbeginn 2011/2012 die Präsenz der Psychologinnen in den Schulen. In den ersten Klassen und Vorschulklassen wurde das SCHUPS- Projekt vorgestellt, in allen anderen Klassen wurde an das Projekt erinnert. Auch bei den Elternabenden wurde das Projekt wieder vorgestellt. Um spontane schnelle Kommunikation im Alltag zwischen LehrerInnen und Psychologinnen besser gelingen lassen zu können und um im nächsten Schritt eine bessere Kooperation entwickeln zu können, wurden für jede Schule Mappen angelegt, in denen Termine eingetragen werden konnten. Somit waren auch die Zeit und der Ort für Kommunikation klarer vereinbart. Ende September 2011 wurde das in einem Steuergruppentreffen geplante Vernetzungstreffen umgesetzt. Ziele der Veranstaltung waren einerseits die Vernetzung der Schulen. Schulen/LehrerInnen sollten andere Schulkulturen kennenlernen und voneinander lernen (Was nehmen LehrerInnen als Unterstützungsressource wahr? Wie können diese verankert werden? Strukturen, Haltungen etablieren für Nachhaltigkeit, ). Andererseits sollten sie Know-how zu Unterstützungskonzepten bekommen und erfahren - Wie ist so etwas entwickelbar? Im Rahmen des Vernetzungstreffens wurde ersichtlich, dass die Zusammenarbeit mit externen Unterstützungssystemen (z.b. SozialarbeiterInnen) zum Teil nicht befriedigend ist. Aus diesem Grund und im Sinne der Nachhaltigkeit, wurde angedacht, ein Vernetzungstreffen mit allen internen (z.b. BeratungslehrerInnen, SchulärztInnen,..) und externen Unterstützungssystemen zu organisieren. Damit sollten Aufgabenfelder und Kompetenzbereiche geklärt werden und eine möglichst rasche und unbürokratische Zusammenarbeit ermöglicht werden. Mit diesem Schritt sollte es zudem erleichtert werden, das bisher aufgebaute standortbezogene Unterstützungskonzept weiter zu entwickeln, um ein bestmögliches schulisches Unterstützungssystem aufzubauen, das auch auf andere Schulstandorte übertragen werden könnte. Im dritten Projektjahr konnten die Schulen einen letzten Jahresschwerpunkt wählen. Die VS Geidorf knüpfte einerseits mit dem Thema Klassengemeinschaft stärken an den Vorjahren an, wählte aber zusätzlich ein Modul zum Thema Medienkompetenz (Fernesehen, Computer & Co). Der Jahresscherpunkt der VS Triester zielte in diesem Jahr auf Sport und Bewegung ab. Dazu passend, v.a. um die soziale Komponente in diesem Bereich zu fördern, wählte das Team das Modul Teambuilding im Turnsaal. Die VS Peter Rosegger arbeitete im dritten Projektjahr zum Thema Ermutigungspädagogik mit dem Modul Auf das Gute schauen und die VS St. Veit hatte in diesem Jahr als Schwerpunktthema den Schulhausbau. Daran wollte das Team anknüpfen und sie setzten statt eines Moduls ein Projekt mit Fratz Graz um, das die Schule bei der Schulhofgestaltung unterstützt ( Vom Schulhof zum Spielhof ). Das Anliegen der Schule war und ist, dass der Außenbereich kindgerecht gestaltet ist und hierfür eine Beteiligung von Kindern, Eltern und LehrerInnen in die Planung einfließen sollte. Dieses Projekt war bis Projektende noch nicht abgeschlossen. Die Umbauarbeiten begannen im Frühjahr
13 Im Oktober 2011 und Anfang 2012 fanden Steuergruppen-Treffen statt, mit dem Ziel den aktuellen Stand an den Schulen zu besprechen. Weiters wurde der Zeitplan für das letzte Projektjahr (Präsenz der Psychologinnen, Evaluation, Umsetzung der Workshops, ) besprochen. Die Reflexionsworkshops für das dritte Projektjahr fanden wieder getrennt für jede Schule statt. Im Mai bzw. Juni 2012 wurden die Workshops in der VS St. Veit und VS Peter Rosegger durchgeführt. Für die beiden anderen Schulen wurde vereinbart, die Reflexion des dritten Jahres in die Gesamtreflexion zu integrieren, da die Workshops in einigen Klassen noch nicht abgeschlossen waren. Die Gesamtreflexionen fanden bis Ende 2012 statt und wurden ebenfalls getrennt für jede Schule umgesetzt. Im Rahmen der Gesamtreflexion wurden mit den Schulen noch einmal Ziele und Maßnahmen in Erinnerung gerufen und visualisiert. Schulen sollten reflektieren, welche Veränderungen wahrgenommen wurden und welche Themen für die Zukunft wichtig sind. (siehe Beilagen 6a 6c) Im Sinne der Nachhaltigkeit des Projektes wurde ein SCHUPS-Abschlusstreffen geplant und im Oktober 2012 mit dem Thema Wie kann die Kooperation mit Schulen bzw. mit den Unterstützungssystemen gut gelingen? umgesetzt. Bei dieser gemeinsamen Abschlussveranstaltung wurden Unterstützungsmöglichkeiten durch schulsysteminterne und -externe Supportsysteme (z.b. SchulpsychologInnen, SozialarbeiterInnen, BeratungslehrerInnen, SchulärztInnen, ) vorgestellt und diskutiert. Auch den Supportsystemen Schulaufsicht und LehrerInnenfortbildung wurde ein besonderer Platz eingeräumt. (siehe Beilage 7) Weiters wurde eine Pressekonferenz geplant, um die Wirksamkeit des Projektes verstärkt öffentlich zu machen und erste Evaluierungsergebnisse zu präsentieren. Die Pressekonferenz fand am in der VS Triester statt. (siehe Beilage 8) Im Rahmen der Evaluierung fand von Juni 2012 bis Ende 2012 die Abschlussbefragung statt. Die Evaluierung wurde für alle Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen in Form einer Fragebogenerhebung durchgeführt. (siehe Beilagen 9a 9d) Ebenfalls fanden Evaluierungs-Interviews, zum einen mit den DirektorInnen bzw. dem Steuerteam der jeweiligen Schule und zum anderen mit dem Team Unterstützungsverein Schulpsychologie und dem Team von Styria vitalis, statt. Die Ergebnisse der Evaluierung wurden im Rahmen eines Steuergruppen-Treffens durch die Evaluatorinnen am rückgemeldet. Zu diesem Treffen waren das jeweilige Steuerteam der Schule und natürlich auch alle interessierten LehrerInnen eingeladen. Die Ergebnisse der gesamten Evaluation wurden präsentiert und diskutiert. Es wurde der Abschlussbericht ausgehändigt bzw. in Folge auch an die Schulen geschickt. Es obliegt somit den Schulen, diesen auch den Eltern zugänglich zu machen. (siehe Beilage 10) Im letzten Projektmonat (März 2013) gab es erneut eine personelle Veränderung. Aufgrund einer beruflichen Veränderung von Frau Mag. Schiwa Shirazian, wurde Frau Mag. Ulrike Bredt zusätzlich angestellt. 13
14 4. Ergebnisse und Evaluation Beschreiben Sie bitte die Ergebnisse des Projekts und der Evaluation. Stellen Sie dar welche Projektergebnisse und -wirkungen aufgetreten sind. ob bzw. inwieweit die Projektziele erreicht werden konnten. ob bzw. inwieweit die Zielgruppe(n) erreicht werden konnten. wie evaluiert wurde, ob das Projekt den folgenden Grundprinzipien der Gesundheitsförderung entspricht und welche Ergebnisse dabei erzielt wurden: - Nachhaltigkeit - Gesundheitliche Chancengerechtigkeit und Zielgruppenorientierung - Setting- und Determinantenorientierung - Ressourcenorientierung und Empowerment - Partizipation (Informationen zu den Qualitätskriterien und Indikatoren finden sie im Leitfaden zur Projektförderung des Fonds Gesundes Österreich.) ob und wie die Projektergebnisse verbreitet/bekannt gemacht wurden. Beschreiben Sie weiters welche Evaluationsform (Selbstevaluation/externe Evaluation) gewählt wurde und warum. die Fragestellungen und Methoden der Evaluation. wie sich die Evaluation aus Projektsicht bewährt hat: - Waren Fragestellung, Methoden und Art der Durchführung angemessen und hilfreich für die Steuerung und Umsetzung des Projektes? - Konnte die Evaluation nützliche Befunde für die Bewertung der Projektergebnisse liefern? Die Evaluation des Projektes wurde von externen Evaluatorinnen (Fr. Mag. Dr. Sabine Bergner und Fr. Mag. Christine Kragl) durchgeführt. Im Juni 2009, 2010 und 2012 fanden quantitative Analysen zu zufriedenheits-, gesundheitsund leistungsbezogenen Aspekten aller SchulpartnerInnen statt. Im Juli 2010, 2011 und 2012 wurden zusätzlich qualitative Projektevaluierungen in Form von halbstrukturierten Interviews (welche vom Evaluatorinnenteam entwickelt wurden) durchgeführt, um ergänzende Informationen zur Projektzielerreichung zu erhalten. Im Evaluierungs-Abschlussbericht wurden alle zur Verfügung stehenden Informationen der vergangenen Jahre integriert und hinsichtlich der Projektziele ausgewertet. Im Rahmen der Projektabschlussevaluierung wurde mit Bezug auf zufriedenheits-, gesundheits- und leistungsbezogene Aspekte über den Status quo und über die in den genannten Aspekten vollzogene Veränderung Auskunft gegeben. Um den Status quo festzuhalten, wurden die Ergebnisse der Evaluierung aus dem Jahr 2012 herangezogen. Um Veränderungen über die Projektjahre zu beschreiben, wurden die Ergebnisse der Evaluierungen aus den Jahren 2009, 2010 und 2012 miteinander verglichen. Dabei wurden immer die Angaben derselben Personengruppen verglichen. Die Stärke der vorliegenden Projektevaluierung liegt insbesondere darin, dass sie von externen ExpertInnen durchgeführt wurde, die weder an den durchgeführten Interventionen teilnahmen noch mit den SchulpartnerInnen (Eltern, LehrerInnen, SchülerInnen) fachspezifisch in Verbindung standen. Nur durch solch eine außenstehende Sichtweise kann der naturgemäß getrübte Blick der Selbsteinschätzung bestmöglich objektiviert werden. Die Objektivierung 14
15 der Selbsteinschätzung wurde zudem durch die Verwendung von Fragebogendaten gestützt. Die Ergebnisse der Evaluierung sind auf Daten von Fragebogenerhebungen zurückzuführen. Die eingesetzten Erhebungsinstrumente wurden von den Evaluatorinnen ausgewählt und aus diversen, gut erprobten Fragebögen des pädagogischen Bereichs zusammengestellt. Die Erhebungsinstrumente für die LehrerInnen und Eltern beinhalten Skalen des Linzer Fragebogens zum Schul- und Klassenklima (LFSK 4-8; Eder & Mayr, 2000), des Fragebogens zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen (Ravens- Sieberer & Bullinger, 2000) sowie des Dresdener Fragebogens für Schulen mit besonderem pädagogischem Profil (Schmechtig, Adolph & Melzer, 2009). Zusätzlich beinhaltete der LehrerInnen-Fragebogen ausgewählte Skalen des Erholungs-Belastungs-Fragebogens (Kallus, 1995). Der Fragebogen für die SchülerInnen beider Grundstufen enthält ausgewählte Skalen des Linzer Fragebogens zum Schul- und Klassenklima (LFSK 4-8; Eder & Mayr, 2000), der Feedbackbögen zu den Projekten Qualität in Schulen (QIS; und School Psychology Information Program (SPIP; Schulpsychologie Steiermark), des Fragebogens zur Erfassung der gesundheitsbezogene Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen (Ravens-Sieberer & Bullinger, 2000) sowie des Dresdener Fragebogens für Schulen mit besonderem pädagogischem Profil (Schmechtig, Adolph & Melzer, 2009). Zusätzlich wurden spezielle Items entwickelt, anhand derer die Erreichung der inhaltlichen Ziele des SCHUPS-Projektes überprüft werden sollte. Die Fragebogen-Erhebungen wurden von den Psychologinnen durchgeführt. Diese verteilten die entsprechenden Fragebögen an alle SchülerInnen, LehrerInnen sowie Eltern und sammelten diese nach dem Ausfüllen wieder ein. Zum Schutz der Anonymität konnten die Fragebögen in verschlossenen Kuverts abgegeben werden. Weiters erfolgte die Dateneingabe von externen Personen. Die Datenauswertung und Interpretation wurde vom Evaluatorinnenteam durchgeführt und erfolgte mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS Im Rahmen der Evaluierung wurden insgesamt 957 Personen im Jahr 2012, 830 im Jahr 2010 und 1027 im Jahr 2009 befragt. Personen, welche befragt wurden waren SchülerInnen der Grundstufe 1 (1. und 2. Klassen), SchülerInnen der Grundstufe 2 (3. und 4. Klassen), LehrerInnen und Eltern. Die Rücklaufquote für die Fragebögen der SchülerInnen am Projektende (2012) beträgt 93 % für die Grundstufe 1 und 94 % für die Grundstufe 2. Die Rücklaufquote bei den LehrerInnen beläuft sich auf 63 % und die der Eltern auf 73%. Das übergeordnete Projektziel, nämlich die psychosoziale Gesundheit sowie die Leistungsfähigkeit von SchülerInnen und LehrerInnen zu erhalten und zu fördern, wurde in vier Teilziele unterteilt. Die Evaluierung erfolgte jeweils aus drei unterschiedlichen Perspektiven: LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern. Im Folgenden werden die wichtigsten Evaluierungsergebnisse zusammengefasst. Detaillierte Ergebnisse sind umfangreich im Evaluierungsendbericht dargestellt. (siehe Beilage Im Rahmen des ersten Projektziels sollten Schulen ihre Einflussmöglichkeiten in Bezug auf eine gesunde psychosoziale Entwicklung der Kinder, aber auch der LehrerInnen selbst, erkennen und anerkennen. 15
16 Als Indikatoren für das Wohlbefinden wurden für die LehrerInnen die Arbeitszufriedenheit (z.b. Rahmenbedingungen, Schulleitung, Elternbeziehungen, KollegInnenbeziehungen, ) sowie das subjektive Belastungserleben (allgemeine Erholung, allgemeine Belastung, Sinnverlust/Burnout) herangezogen. Die Arbeitszufriedenheit der LehrerInnen steht in direktem Zusammenhang mit deren Wohlbefinden und psychosozialer Gesundheit. Beides hat sich während des Projektzeitraumes nicht bedeutsam verändert, wobei die Arbeitszufriedenheit jedoch schon zu Projektbeginn als durchschnittlich bis sehr hoch interpretiert werden konnte und das subjektive Belastungserleben im Durchschnitt lag. Festzuhalten ist, dass die Arbeitszufriedenheit als auch das Belastungserleben von Faktoren abhängen, welche nicht durch das Projekt beeinflusst wurden, wie beispielsweise private Umstände oder strukturelle Bedingungen. Jedoch gibt es einen leichten Lernzuwachs sowohl bei den LehrerInnen als auch bei den Eltern - betreffend der Faktoren, die die Gesundheit und das Wohlbefinden beeinflussen. Was die Zufriedenheit der Eltern betrifft, wurden zwei Bereiche erhoben: die Zufriedenheit der Eltern mit der Schule als Lebensraum und die Zufriedenheit mit der Arbeit der LehrerInnen. Die Ergebnisse zeigen, dass beide Bereiche als hoch bis sehr hoch interpretiert werden können. 91 % der befragten Eltern sind mit der sozialen Qualität der Schule (soziales Klima in der Schule, zwischenmenschlicher Umgang in der Schule, etc.) sehr bzw. eher zufrieden. Für die SchülerInnen wurden als Indikatoren für das Wohlbefinden und die psychosoziale Gesundheit die Schulzufriedenheit, der Selbstwert und auch das schulische Leistungsselbstkonzept als mögliche Einflussfaktoren herangezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die genannten Faktoren im Rahmen des Projektes zum positiven verändert haben. Betrachtet man die Evaluierungsergebnisse von LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern gemeinsam, wurde das erste Projektziel erreicht. Das zweite Projektziel besteht aus zwei Teilen. Zum einen sollten Schulen selbständig an selbstgesteckten Zielen für die Weiterentwicklung von förderlichen Rahmenbedingungen arbeiten und zum anderen Determinanten von Wohlbefinden und psychosozialer Gesundheit (Beziehungen zwischen SchülerInnen, SchülerInnen & LehrerInnen etc.) im Unterricht und Schulalltag so beeinflussen, dass eine positive Gesundheitsentwicklung wahrscheinlich ist. Das Ziel wurde aus Sicht der LehrerInnen dahingehend erreicht, dass jedes Jahr ein Schwerpunkt selbständig gewählt werden konnte und in Form von Workshops an dem jeweiligen Thema (z.b. Ermutigungspädagogik, Stärkung der Gemeinschaft, ) gearbeitet wurde. Die Maßnahmen haben sich jedoch nur geringfügig auf die Zufriedenheit der LehrerInnen und somit auf das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit ausgewirkt. Somit kann ein Teilziel nur als teilweise erreicht betrachtet werden. Aus Sicht der SchülerInnen wurde das zweite Projektziel zur Gänze erreicht. Die selbstgesteckten Ziele für die Weiterentwicklung von gesundheitsförderlichen Rahmenbedingungen durch die LehrerInnen wurden wie bereits erwähnt, mit der Durchführung von Workshops umgesetzt, an denen alle SchülerInnen teilnehmen konnten. Wie auch schon im ersten Projektziel beschrieben, haben sich die Schulzufriedenheit, der Selbstwert und auch das schulische Leistungsselbstkonzept der SchülerInnen im Rahmen des Projekts positiv verändert. Somit ist eine positive Gesundheitsentwicklung der SchülerInnen möglich. Die Eltern wurden in die konkrete Zielsetzung (in die Wahl des Jahresschwerpunktes) nicht einbezogen, somit konnte nur der zweite Teil dieses Zieles evaluiert werden. Es kann fest- 16
17 gehalten werden, dass sich, aus Sicht der Eltern, der Selbstwert, das emotionale Belastungserleben und das Ausmaß der psychovegetativen Verstimmung der Kinder im Laufe des Projektes geringfügig zum positiven verändert haben. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass auch das zweite Projektziel als (großteils) erfüllt gilt. Das dritte Projektziel bezieht sich auf die Unterrichtsgestaltung. Schulen sollen diese dahingehend weiterentwickeln, dass auch SchülerInnen mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf über eine gute Schulzufriedenheit verfügen und ihre Leistungspotenziale optimal ausnützen können. Die Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler wird von verschiedenen Aspekten beeinflusst. Die Unterrichtsgestaltung wird jedoch als maßgebliche Determinante betrachtet (Eder & Mayr, 2000). In der vorliegenden Evaluierung wird somit davon ausgegangen, dass die Unterrichtsgestaltung zur Veränderung der Zufriedenheit der Kinder beigetragen hat. Die Ergebnisse zeigen, dass es am Projektbeginn noch bedeutsame Unterschiede in der Zufriedenheit von SchülerInnen mit und ohne Unterstützungsbedarf gab. Diese Unterschiede haben sich im Laufe des Projektes verringert, das bedeutet, am Projektende zeigen sich in den meisten Zufriedenheitsbereichen keine statistisch signifikanten bzw. bedeutsamen Unterschiede mehr. Es kann somit der Schluss gezogen werden, dass das dritte Projektziel erreicht wurde. Im Rahmen des vierten Projektzieles sollten die Schulen das schulpsychologische Zusatzangebot bzw. andere Unterstützungsangebote für SchülerInnen mit therapeutischem Interventionsbedarf kennen lernen und bei Bedarf in Anspruch nehmen. Auch für die Evaluierung dieses Zieles wurden LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen befragt, und zwar zu ihrem Wissensstand und den Informationsbedarf über (schul)psychologische Zusatzangebote bzw. externe Unterstützungsstrukturen. LehrerInnen konnten im Laufe des Projekts immer mehr Wissen über (externe) Unterstützungsstrukturen erlangen. Zu Beginn des Projektes fühlten sich LehrerInnen nur zu einem Drittel ausreichend über Unterstützungsstrukturen informiert, zu Projektende sind es bereits 85 %. Auch die Inanspruchnahme dieser Strukturen (z.b. SozialarbeiterInnen, SchulpsychologInnen,..) hat sich im Rahmen des Projektes erhöht. Auch Eltern (63 %) hatten am Projektende mehr Wissen darüber, wohin sie sich bei psychosozialen Problemen wenden können. Der Bedarf nach weiteren Informationen zu externen Unterstützungsstrukturen blieb im Laufe des Projektes relativ konstant. Weiters zeigte sich, dass Eltern viele der im Projekt angebotenen Unterstützungsstrukturen in Anspruch nahmen, was als Hinweis auf deren Notwendigkeit interpretiert werden kann. Aus Sicht der SchülerInnen kann festgehalten werden, dass der Bekanntheitsgrad der Psychologinnen vor Ort (SCHUPS-Psychologinnen) im Laufe des Projekts deutlich gestiegen ist. 82 % der befragten SchülerInnen kennen zu Projektende die Psychologinnen. Über die beiden letzten Jahre verringerte sich die Inanspruchnahme geringfügig. Möglicherweise kamen nach einer ersten Phase der Neugierde und des Kennenlernens nur noch jene Kinder zu den Psychologinnen, welche tatsächlichen Unterstützungsbedarf hatten. Zusammenfassend kann man sagen, dass auch das vierte Projektziel erreicht wurde. 17
Projekt Mental health promotion im Setting Volksschule SCHUPS - Schule und psychische Gesundheit
 Projekt Mental health promotion im Setting Volksschule SCHUPS - Schule und psychische Gesundheit Elternfragebogen Sehr geehrte Eltern! Sehr geehrte Erziehungsberech2gte! Im heurigen Schuljahr findet die
Projekt Mental health promotion im Setting Volksschule SCHUPS - Schule und psychische Gesundheit Elternfragebogen Sehr geehrte Eltern! Sehr geehrte Erziehungsberech2gte! Im heurigen Schuljahr findet die
Mental Health Promotion
 Mental Health Promotion in Grazer Volksschulen erste Schritte im Projekt Gefördert durch: Ein Projekt des Unterstützungsvereins Schulpsychologie in Kooperation mit Styria vitalis Was ist Gesundheit? körperlich
Mental Health Promotion in Grazer Volksschulen erste Schritte im Projekt Gefördert durch: Ein Projekt des Unterstützungsvereins Schulpsychologie in Kooperation mit Styria vitalis Was ist Gesundheit? körperlich
-JAHRESGESPRÄCHE- Ein Projekt zur Förderung der Führungskultur
 -JAHRESGESPRÄCHE- Ein Projekt zur Förderung der Führungskultur Anregungen zur Vorbereitung des Jahresgesprächs Ziele: Das Jahresgespräch ist ein jährliches Gespräch zwischen direkter/m Vorgesetzten/m und
-JAHRESGESPRÄCHE- Ein Projekt zur Förderung der Führungskultur Anregungen zur Vorbereitung des Jahresgesprächs Ziele: Das Jahresgespräch ist ein jährliches Gespräch zwischen direkter/m Vorgesetzten/m und
GFA Ganztagsschule. 3. österreichische Fachtagung zur Gesundheitsfolgenabschätzung, , Graz
 GFA Ganztagsschule 3. österreichische Fachtagung zur Gesundheitsfolgenabschätzung, 25.06.2015, Graz 1 Ausgangslage gefördertes Projekt aus den Mitteln Gemeinsame Gesundheitsziele (Rahmen Pharmavertrag)
GFA Ganztagsschule 3. österreichische Fachtagung zur Gesundheitsfolgenabschätzung, 25.06.2015, Graz 1 Ausgangslage gefördertes Projekt aus den Mitteln Gemeinsame Gesundheitsziele (Rahmen Pharmavertrag)
Naturwissenschaftliches Projektmanagement
 Naturwissenschaftliches Projektmanagement Allgemeine Grundlagen Was ist ein Projekt? Ein Projekt ist keine Routinetätigkeit, sondern klar definiert: klare Aufgabenstellung mit messbaren Zielen und Ergebnissen
Naturwissenschaftliches Projektmanagement Allgemeine Grundlagen Was ist ein Projekt? Ein Projekt ist keine Routinetätigkeit, sondern klar definiert: klare Aufgabenstellung mit messbaren Zielen und Ergebnissen
Gütesiegel Gesunde Schule OÖ & SQA
 Gütesiegel Gesunde Schule OÖ & SQA Angelika Mittendorfer-Jusad OÖGKK Dr. Gertrude Jindrich LSR OÖ Konzept zur Qualitätssicherung Qualitätssicherungsinstrument - Entwicklung des Gütesiegels Gesunde Schule
Gütesiegel Gesunde Schule OÖ & SQA Angelika Mittendorfer-Jusad OÖGKK Dr. Gertrude Jindrich LSR OÖ Konzept zur Qualitätssicherung Qualitätssicherungsinstrument - Entwicklung des Gütesiegels Gesunde Schule
Was ist der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ)? Was ist Gesundheitsförderung? Warum eine Kooperation zwischen Jugendhilfe und Gesundheitsförderung?
 Was ist der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ)? Was ist Gesundheitsförderung? Warum eine Kooperation zwischen Jugendhilfe und Gesundheitsförderung? Dr. Rainer Christ Informationsveranstaltung, 22. November
Was ist der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ)? Was ist Gesundheitsförderung? Warum eine Kooperation zwischen Jugendhilfe und Gesundheitsförderung? Dr. Rainer Christ Informationsveranstaltung, 22. November
Kompetenz Gesundheit Arbeit (KoGA) Betriebliches Gesundheitsmanagement im Bundesdienst
 Kompetenz Gesundheit Arbeit (KoGA) Betriebliches Gesundheitsmanagement im Bundesdienst Inhaltsverzeichnis 1 Was bedeutet KoGA... 2 2 Ziele von KoGA... 3 3 Das KoGA-Projekt... 3 3.1 Projektbausteine...
Kompetenz Gesundheit Arbeit (KoGA) Betriebliches Gesundheitsmanagement im Bundesdienst Inhaltsverzeichnis 1 Was bedeutet KoGA... 2 2 Ziele von KoGA... 3 3 Das KoGA-Projekt... 3 3.1 Projektbausteine...
Voraussetzungen für gelingende Inklusion im Bildungssystem aus Sicht der Jugendhilfe
 Voraussetzungen für gelingende Inklusion im Bildungssystem aus Sicht der Jugendhilfe Günter Wottke (Dipl. Soz. Päd. BA) Abteilungsleiter Soziale Dienste Kinder- und Jugendamt Heidelberg Inklusion - Grundsätzliches
Voraussetzungen für gelingende Inklusion im Bildungssystem aus Sicht der Jugendhilfe Günter Wottke (Dipl. Soz. Päd. BA) Abteilungsleiter Soziale Dienste Kinder- und Jugendamt Heidelberg Inklusion - Grundsätzliches
Das zweijährige Projekt XUND und DU wird im Auftrag des Gesundheitsfonds
 Beilage zum Pressetext Kurzfassung Das zweijährige Projekt XUND und DU wird im Auftrag des Gesundheitsfonds Steiermark in Kooperation mit beteiligung.st und LOGO jugendmanagement umgesetzt und im Rahmen
Beilage zum Pressetext Kurzfassung Das zweijährige Projekt XUND und DU wird im Auftrag des Gesundheitsfonds Steiermark in Kooperation mit beteiligung.st und LOGO jugendmanagement umgesetzt und im Rahmen
Hinweise zur Durchführung einer Befragung bei Lehrpersonen, SchülerInnen und Eltern
 QUIMS-Evaluationsinstrumente Hinweise r Durchführung einer Befragung bei Lehrpersonen, SchülerInnen und Eltern Handlungsfeld: Förderung des Schulerfolgs Qualitätsmerkmal: Die Lehrpersonen beurteilen das
QUIMS-Evaluationsinstrumente Hinweise r Durchführung einer Befragung bei Lehrpersonen, SchülerInnen und Eltern Handlungsfeld: Förderung des Schulerfolgs Qualitätsmerkmal: Die Lehrpersonen beurteilen das
Gesundheits- und Risikoverhalten von Berliner Kindern und Jugendlichen
 Gesundheits- und Risikoverhalten von Berliner Kindern und Jugendlichen Ergebnisse der HBSC- Studie 2006 Pressekonferenz 17.09.2008 SenGesUmV - I A- Stand Juni 08 / Folie -1- Gliederung Was ist die HBSC-Studie?
Gesundheits- und Risikoverhalten von Berliner Kindern und Jugendlichen Ergebnisse der HBSC- Studie 2006 Pressekonferenz 17.09.2008 SenGesUmV - I A- Stand Juni 08 / Folie -1- Gliederung Was ist die HBSC-Studie?
Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
 Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Fachtagung 17.09.2008, Luzern Alles too much! Stress, Psychische Gesundheit, Früherkennung und Frühintervention in Schulen Barbara Fäh, Hochschule für
Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Fachtagung 17.09.2008, Luzern Alles too much! Stress, Psychische Gesundheit, Früherkennung und Frühintervention in Schulen Barbara Fäh, Hochschule für
Zyklisch evaluieren 1 (Auszug aus dem Leitfaden zur Selbstevaluation )
 Zyklisch evaluieren 1 (Auszug aus dem Leitfaden zur Selbstevaluation ) Auf Basis des Qualitätsrahmens für Schulen in Baden-Württemberg lassen sich die unterschiedlichen Bereiche mit dem hier dargestellten
Zyklisch evaluieren 1 (Auszug aus dem Leitfaden zur Selbstevaluation ) Auf Basis des Qualitätsrahmens für Schulen in Baden-Württemberg lassen sich die unterschiedlichen Bereiche mit dem hier dargestellten
Evaluierung von Anti-Stress Programmen innerhalb der SKEI Gewerkschaft Ergebnisse der Pilot-Studie
 Evaluierung von Anti-Stress Programmen innerhalb der SKEI Gewerkschaft Ergebnisse der Pilot-Studie Dr. Paulino Jiménez Mag. a Anita Dunkl Mag. a Simona Šarotar Žižek Dr. Borut Milfelner Dr.Alexandra Pisnik-Korda
Evaluierung von Anti-Stress Programmen innerhalb der SKEI Gewerkschaft Ergebnisse der Pilot-Studie Dr. Paulino Jiménez Mag. a Anita Dunkl Mag. a Simona Šarotar Žižek Dr. Borut Milfelner Dr.Alexandra Pisnik-Korda
Vom Bericht zur Zielvereinbarung
 Vom Bericht zur Zielvereinbarung Zielvereinbarungen = = gemeinsames Festlegen anzustrebender Ergebnisse für einen bestimmten Zeitraum Weg, um Weiterentwicklung und innovative Prozesse strukturiert zu steuern
Vom Bericht zur Zielvereinbarung Zielvereinbarungen = = gemeinsames Festlegen anzustrebender Ergebnisse für einen bestimmten Zeitraum Weg, um Weiterentwicklung und innovative Prozesse strukturiert zu steuern
So setzen Sie Ihr BGF-Projekt um BGF für Unternehmen ab 50 Beschäftigte. Jetzt neu: Mehr Beratung!
 So setzen Sie Ihr BGF-Projekt um BGF für Unternehmen ab 50 Beschäftigte Jetzt neu: Mehr Beratung! Definition: Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) Gesundheit ist umfassendes körperliches, psychisches
So setzen Sie Ihr BGF-Projekt um BGF für Unternehmen ab 50 Beschäftigte Jetzt neu: Mehr Beratung! Definition: Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) Gesundheit ist umfassendes körperliches, psychisches
Handout zur Fachveranstaltung
 Pilotprojekt "Kinder in Frauenhäusern - Entwicklung von Angeboten und Erprobung von Wegen zur verbesserten Unterstützung und interdisziplinären Versorgung von Kindern in Frauenhäusern" Ein Projekt der
Pilotprojekt "Kinder in Frauenhäusern - Entwicklung von Angeboten und Erprobung von Wegen zur verbesserten Unterstützung und interdisziplinären Versorgung von Kindern in Frauenhäusern" Ein Projekt der
Ziel des Workshops. Damit Gesundheit der einfachere Weg ist.
 Nachhaltigkeit Von der ersten Projektidee zur praktischen Umsetzung Gesundheitsförderung trifft Jugendarbeit FGÖ Tagung, 19. September 2009, Salzburg Ziel des Workshops Erfahrungen aus dem laufenden, regionalen
Nachhaltigkeit Von der ersten Projektidee zur praktischen Umsetzung Gesundheitsförderung trifft Jugendarbeit FGÖ Tagung, 19. September 2009, Salzburg Ziel des Workshops Erfahrungen aus dem laufenden, regionalen
Prof. Dr. Peter Paulus Institut für Psychologie Universität Lüneburg Prävention und Gesundheitsförderung im Kontext von Schule
 Prof. Dr. Peter Paulus Institut für Psychologie Universität Lüneburg Prävention und Gesundheitsförderung im Kontext von Schule Symposium Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche 15.
Prof. Dr. Peter Paulus Institut für Psychologie Universität Lüneburg Prävention und Gesundheitsförderung im Kontext von Schule Symposium Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche 15.
Gütesiegel Gesunde Schule OÖ
 Gütesiegel Gesunde Schule OÖ Schulen, die das Gütesiegel Gesunde Schule OÖ besitzen Das Gütesiegel Gesunde Schule OÖ ist eine gemeinsame Initiative des Landesschulrats für OÖ, der Oberösterreichischen
Gütesiegel Gesunde Schule OÖ Schulen, die das Gütesiegel Gesunde Schule OÖ besitzen Das Gütesiegel Gesunde Schule OÖ ist eine gemeinsame Initiative des Landesschulrats für OÖ, der Oberösterreichischen
Schulische Lern- und Lebenswelten -
 Ziele des Projekts: Das Schulentwicklungsprojekt Schulische Lern- und Lebenswelten ist ein Angebot für weiterführende Schulen in Rheinland-Pfalz. Es befördert schulische Qualitätsentwicklung durch die
Ziele des Projekts: Das Schulentwicklungsprojekt Schulische Lern- und Lebenswelten ist ein Angebot für weiterführende Schulen in Rheinland-Pfalz. Es befördert schulische Qualitätsentwicklung durch die
Gesundheitsfolgenabschätzung (Health Impact Assessment)
 Gesundheitsfolgenabschätzung (Health Impact Assessment) Ein Instrument zur Umsetzung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik am Beispiel der Kindergesundheit Christine Knaller, Sabine Haas ÖGPH Tagung
Gesundheitsfolgenabschätzung (Health Impact Assessment) Ein Instrument zur Umsetzung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik am Beispiel der Kindergesundheit Christine Knaller, Sabine Haas ÖGPH Tagung
Das MitarbeiterInnengespräch
 Das MitarbeiterInnengespräch Vorwort des Vizerektors für Personal der Universität Innsbruck Was ist ein MitarbeiterInnengespräch? Ablauf eines MitarbeiterInnengesprächs Themen eines MitarbeiterInnengesprächs
Das MitarbeiterInnengespräch Vorwort des Vizerektors für Personal der Universität Innsbruck Was ist ein MitarbeiterInnengespräch? Ablauf eines MitarbeiterInnengesprächs Themen eines MitarbeiterInnengesprächs
Praxisforschungsprojekt Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) des Jugendamtes Duisburg
 Prof. Dr. Peter Bünder Fachgebiet Erziehungswissenschaft Forschungsschwerpunkt Beruf & Burnout-Prävention Prof. Dr. Thomas Münch Fachgebiet Verwaltung und Organisation Forschungsschwerpunkt Wohlfahrtsverbände
Prof. Dr. Peter Bünder Fachgebiet Erziehungswissenschaft Forschungsschwerpunkt Beruf & Burnout-Prävention Prof. Dr. Thomas Münch Fachgebiet Verwaltung und Organisation Forschungsschwerpunkt Wohlfahrtsverbände
Fragebogen fit im job Seite 1. Funktion. Seit wann setzen Sie Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit ihrer Mitarbeiter/innen?
 Fragebogen fit im job Seite 1 Einreichung zu 2016 DATENBLATT Unternehmen Branche Kontaktperson Funktion Telefon PLZ / rt Straße Website E-Mail Fax Zutreffendes bitte ankreuzen: Bitte Beschäftigtenzahl
Fragebogen fit im job Seite 1 Einreichung zu 2016 DATENBLATT Unternehmen Branche Kontaktperson Funktion Telefon PLZ / rt Straße Website E-Mail Fax Zutreffendes bitte ankreuzen: Bitte Beschäftigtenzahl
Hinweise zur Durchführung einer Befragung bei Lehrund Betreuungspersonen, SchülerInnen sowie Eltern
 Quims Evaluationsinstrumente Hinweise r Durchführung einer Befragung bei Lehrund Betreuungspersonen, SchülerInnen sowie Eltern Handlungsfeld: Förderung des Schulerfolgs: Stufenübergang Qualitätsmerkmal:
Quims Evaluationsinstrumente Hinweise r Durchführung einer Befragung bei Lehrund Betreuungspersonen, SchülerInnen sowie Eltern Handlungsfeld: Förderung des Schulerfolgs: Stufenübergang Qualitätsmerkmal:
Konzept Lehren und Lernen Medienbildung (L+L-MB)
 Konzept Lehren und Lernen Medienbildung (L+L-MB) Förderung der Medienkompetenz der Lernenden, der Eltern und der Lehrpersonen Überarbeitete Version Juli 2014 Ausgangslage Medien ändern sich in unserer
Konzept Lehren und Lernen Medienbildung (L+L-MB) Förderung der Medienkompetenz der Lernenden, der Eltern und der Lehrpersonen Überarbeitete Version Juli 2014 Ausgangslage Medien ändern sich in unserer
Qualitätsanalyse in NRW
 Qualitätsanalyse in NRW An allen Bezirksregierungen wurden 2006 eigenständige Dezernate 4Q eingerichtet Diese haben am 01. August 2006 angefangen, als Verfahren der externen Evaluation Schulen datengestützt
Qualitätsanalyse in NRW An allen Bezirksregierungen wurden 2006 eigenständige Dezernate 4Q eingerichtet Diese haben am 01. August 2006 angefangen, als Verfahren der externen Evaluation Schulen datengestützt
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter. Gesundheitsförderung
 Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter Gesundheitsförderung Mehr Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz Kindergarten Im Rahmen der Gesundheitsförderung Öffentlicher Dienst hat sich die BVA zum
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter Gesundheitsförderung Mehr Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz Kindergarten Im Rahmen der Gesundheitsförderung Öffentlicher Dienst hat sich die BVA zum
Schulsozialarbeit heute Herausforderungen und Gelingensbedingungen
 Schulsozialarbeit heute Herausforderungen und Gelingensbedingungen Workshop 26. Januar 2016 Impressum Herausgeber Kreis Borken Der Landrat Bildungsbüro Burloer Straße 93; 46325 Borken Redaktion Anne Rolvering,
Schulsozialarbeit heute Herausforderungen und Gelingensbedingungen Workshop 26. Januar 2016 Impressum Herausgeber Kreis Borken Der Landrat Bildungsbüro Burloer Straße 93; 46325 Borken Redaktion Anne Rolvering,
Qualitätsstandards in KIWI-Horten
 Qualitätsstandards in KIWI-Horten In den Bereichen Offenes Arbeiten Partizipation Aufgabenbetreuung Raumgestaltung Freizeitpädagogik Projektarbeit mit Kindern Planung und Reflexion der pädagogischen Arbeit
Qualitätsstandards in KIWI-Horten In den Bereichen Offenes Arbeiten Partizipation Aufgabenbetreuung Raumgestaltung Freizeitpädagogik Projektarbeit mit Kindern Planung und Reflexion der pädagogischen Arbeit
Interne Evaluation als Instrument der Qualitätsentwicklung an bayerischen Schulen Reflexionsworkshop in Hirschberg
 Interne Evaluation als Instrument der Qualitätsentwicklung an bayerischen Schulen 13.01.2009 4. Reflexionsworkshop in Hirschberg Seerosenmodell Das Seerosenmodell Die Blüte ist der sichtbare Bereich beobachtbares
Interne Evaluation als Instrument der Qualitätsentwicklung an bayerischen Schulen 13.01.2009 4. Reflexionsworkshop in Hirschberg Seerosenmodell Das Seerosenmodell Die Blüte ist der sichtbare Bereich beobachtbares
PROJEKTKONZEPT. Kurz gesagt: Es geht darum, sich zuhause zu fühlen.
 PROJEKTKONZEPT AUSGANGSLAGE Junge Menschen mit Fluchterfahrungen befinden sich in einer Extremsituation. Traumatisierende Erlebnisse im Heimatland oder auf der Flucht, ein unsicherer Aufenthaltsstatus
PROJEKTKONZEPT AUSGANGSLAGE Junge Menschen mit Fluchterfahrungen befinden sich in einer Extremsituation. Traumatisierende Erlebnisse im Heimatland oder auf der Flucht, ein unsicherer Aufenthaltsstatus
Konzept und Massnahmenplan Psychosoziale Gesundheit im schulischen Kontext
 Konzept und Massnahmenplan Psychosoziale Gesundheit im schulischen Kontext Teilprojekt der Dachstrategie Gesundheitsförderung und Prävention der Schul- und Sportdepartements der Stadt Zürich Erfa-Treffen
Konzept und Massnahmenplan Psychosoziale Gesundheit im schulischen Kontext Teilprojekt der Dachstrategie Gesundheitsförderung und Prävention der Schul- und Sportdepartements der Stadt Zürich Erfa-Treffen
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)/ Gesundheitsförderung
 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)/ Gesundheitsförderung Mitarbeiterversammlung des Kirchenkreises Verden, Kreiskirchenverbandes Osterholz-Scharmbeck/Rotenburg/Verden und der Diakoniestationen ggmbh
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)/ Gesundheitsförderung Mitarbeiterversammlung des Kirchenkreises Verden, Kreiskirchenverbandes Osterholz-Scharmbeck/Rotenburg/Verden und der Diakoniestationen ggmbh
Pilotprojekt Steiermark
 Pilotprojekt Steiermark GEMEINSAM IN BALANCE BLEIBEN Ein Projekt der STGKK in Kooperation mit Styria vitalis INHALTE Hintergrundmodell (Konzept) Rahmenbedingungen Projektziele Projektverlauf in den Schulen
Pilotprojekt Steiermark GEMEINSAM IN BALANCE BLEIBEN Ein Projekt der STGKK in Kooperation mit Styria vitalis INHALTE Hintergrundmodell (Konzept) Rahmenbedingungen Projektziele Projektverlauf in den Schulen
Fortschreibung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Neuss. Wissenschaftliche Begleitung
 Fortschreibung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Neuss Wissenschaftliche Begleitung 11.06.2015 Prof. Dr. Ulrich Deinet, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften Bundesweit stellen sich ähnliche
Fortschreibung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Neuss Wissenschaftliche Begleitung 11.06.2015 Prof. Dr. Ulrich Deinet, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften Bundesweit stellen sich ähnliche
Berufstage im Oberwallis
 Département de la formation et de la sécurité Service de la formation professionnelle Office d'orientation scolaire et professionnelle du Haut-Valais Departement für Bildung und Sicherheit Dienststelle
Département de la formation et de la sécurité Service de la formation professionnelle Office d'orientation scolaire et professionnelle du Haut-Valais Departement für Bildung und Sicherheit Dienststelle
Kommentiertes Beispiel für eine Unterrichtseinheit nach dem Unterrichtsprinzip Berufssprache Deutsch
 Kommentiertes Beispiel für eine Unterrichtseinheit nach dem Unterrichtsprinzip Berufssprache Deutsch Grundlegende Informationen zur Unterrichtseinheit: Beruf: Schuljahr: Lernfeld: Thema: Richtig trinken
Kommentiertes Beispiel für eine Unterrichtseinheit nach dem Unterrichtsprinzip Berufssprache Deutsch Grundlegende Informationen zur Unterrichtseinheit: Beruf: Schuljahr: Lernfeld: Thema: Richtig trinken
14. Dezember 2015 Konzept der SV-Projektwoche. Schülervertretung der Lichtenbergschule Darmstadt SV-PROJEKTWOCHE
 0 Schülervertretung der Lichtenbergschule Darmstadt SV-PROJEKTWOCHE 06. 08. Juli 2016 2015/16 1 SV-PROJEKTWOCHE KONZEPT Gliederung 1. Motivation und Zielführung 1.1 Innerschulische Relationen 1.2 Ausbildung
0 Schülervertretung der Lichtenbergschule Darmstadt SV-PROJEKTWOCHE 06. 08. Juli 2016 2015/16 1 SV-PROJEKTWOCHE KONZEPT Gliederung 1. Motivation und Zielführung 1.1 Innerschulische Relationen 1.2 Ausbildung
Betriebliche Gesundheitsförderung. Gesunde Kultur Im Krankenhaus 2009
 Betriebliche Gesundheitsförderung Gesunde Kultur Im Krankenhaus 2009 Ablauf Teil 1: Betriebliche Gesundheitsförderung Teil 2: Gesundheitsbefragung Teil 3: Gesundheitszirkel Teil 4: BGF-Angebot der OÖ Regionalstelle
Betriebliche Gesundheitsförderung Gesunde Kultur Im Krankenhaus 2009 Ablauf Teil 1: Betriebliche Gesundheitsförderung Teil 2: Gesundheitsbefragung Teil 3: Gesundheitszirkel Teil 4: BGF-Angebot der OÖ Regionalstelle
Instrumente zur Selbstevaluation an Schulen: Unterrichtsqualität
 Instrumente zur Selbstevaluation an Schulen: Unterrichtsqualität Orientierungsrahmen Ziele Übersicht der Instrumente Hinweise zur Durchführung und Auswertung Beratung / Unterstützung Rückmeldung Dezernat
Instrumente zur Selbstevaluation an Schulen: Unterrichtsqualität Orientierungsrahmen Ziele Übersicht der Instrumente Hinweise zur Durchführung und Auswertung Beratung / Unterstützung Rückmeldung Dezernat
Entwicklungsplan VS Meisenweg
 Entwicklungsplan VS Meisenweg Stand: 14.10.2012 Beispiel Entwicklungsplan 2012-15 VS Meisenweg 8 Klassen, kleinstädtischer Bereich Ziele und Vorhaben für die Schuljahre 2012-15 Rahmenzielvorgabe des BMUKK:
Entwicklungsplan VS Meisenweg Stand: 14.10.2012 Beispiel Entwicklungsplan 2012-15 VS Meisenweg 8 Klassen, kleinstädtischer Bereich Ziele und Vorhaben für die Schuljahre 2012-15 Rahmenzielvorgabe des BMUKK:
MindMatters Psychische Gesundheit in der Schule Weiterverbreitung in der Schweiz
 MindMatters Psychische Gesundheit in der Schule Weiterverbreitung in der Schweiz 1. Einleitung: Die Idee MindMatters ist ein Programm zur Förderung der psychischen Gesundheit an Schulen der Sekundarstufe
MindMatters Psychische Gesundheit in der Schule Weiterverbreitung in der Schweiz 1. Einleitung: Die Idee MindMatters ist ein Programm zur Förderung der psychischen Gesundheit an Schulen der Sekundarstufe
Berichtspräsentation der Elternbefragung zur Schulqualität an der Schule am Webersberg Homburg
 Berichtspräsentation der Elternbefragung zur Schulqualität an der Schule am Webersberg Homburg Thomas Meyer Leiter der am Landesinstitut für Pädagogik und Medien (LPM) Saarbrücken 2011 1. Zusammenfassung
Berichtspräsentation der Elternbefragung zur Schulqualität an der Schule am Webersberg Homburg Thomas Meyer Leiter der am Landesinstitut für Pädagogik und Medien (LPM) Saarbrücken 2011 1. Zusammenfassung
Arbeitsgruppe: Kooperation zwischen Schule und außerschulischen Partnern
 2. Kultur.Forscher!- Netzwerktreffen am 09. und 10. Oktober 2009 in Berlin Arbeitsgruppe: Kooperation zwischen Schule und außerschulischen Partnern Moderation Harriet Völker und Jürgen Schulz Einführung:
2. Kultur.Forscher!- Netzwerktreffen am 09. und 10. Oktober 2009 in Berlin Arbeitsgruppe: Kooperation zwischen Schule und außerschulischen Partnern Moderation Harriet Völker und Jürgen Schulz Einführung:
Leitbildarbeit im Rahmen der schulischen Qualitätssicherung und -entwicklung
 Leitbildarbeit im Rahmen der schulischen Qualitätssicherung und -entwicklung Informationsbaustein im Rahmen der Informationsveranstaltung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung Referat 77 Qualitätssicherung
Leitbildarbeit im Rahmen der schulischen Qualitätssicherung und -entwicklung Informationsbaustein im Rahmen der Informationsveranstaltung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung Referat 77 Qualitätssicherung
Beispiel Guter Praxis
 Beispiel Guter Praxis A. Allgemeine Informationen über das Unternehmen Unternehmen / Organisation Wozabal Management GmbH Anschrift Freistädter Straße 230 Stadt 4040 Linz Land Österreich Name Arno Friedl
Beispiel Guter Praxis A. Allgemeine Informationen über das Unternehmen Unternehmen / Organisation Wozabal Management GmbH Anschrift Freistädter Straße 230 Stadt 4040 Linz Land Österreich Name Arno Friedl
Schulische Handlungsfelder und Rahmenbedingungen der Prävention aus Sicht des Kultusministeriums
 Schulische Handlungsfelder und Rahmenbedingungen der Prävention aus Sicht des Kultusministeriums Ministerium für Kultus Jugend und Sport, Referat 56 Stuttgart 2011 Praktische Umsetzung in Baden- Württemberg
Schulische Handlungsfelder und Rahmenbedingungen der Prävention aus Sicht des Kultusministeriums Ministerium für Kultus Jugend und Sport, Referat 56 Stuttgart 2011 Praktische Umsetzung in Baden- Württemberg
Gesundheitsförderung. Organisationsentwicklung. Weiterentwicklung der Kita zu einer gesundheitsförderlichen Einrichtung
 Gesundheitsförderung als Organisationsentwicklung Weiterentwicklung der Kita zu einer gesundheitsförderlichen Einrichtung 1 Liebe Leiterinnen und Leiter von Kindertageseinrichtungen, liebe pädagogische
Gesundheitsförderung als Organisationsentwicklung Weiterentwicklung der Kita zu einer gesundheitsförderlichen Einrichtung 1 Liebe Leiterinnen und Leiter von Kindertageseinrichtungen, liebe pädagogische
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) in der Parlamentsdirektion. Wien, 28. Jänner 2013 Mag. a Birgit Kriener
 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) in der Parlamentsdirektion Impuls-Vortrag zum Projektstart Wien, 28. Jänner 2013 Mag. a Birgit Kriener Betriebliches Gesundheitsmanagement was ist das? Betriebliches
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) in der Parlamentsdirektion Impuls-Vortrag zum Projektstart Wien, 28. Jänner 2013 Mag. a Birgit Kriener Betriebliches Gesundheitsmanagement was ist das? Betriebliches
Fragebogen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I / II
 Fragebogen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I / II Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen über deine Schule zu? 1 Ich fühle mich in unserer Schule wohl. 2 An unserer Schule gibt es klare
Fragebogen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I / II Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen über deine Schule zu? 1 Ich fühle mich in unserer Schule wohl. 2 An unserer Schule gibt es klare
Psychosoziale Gesundheit
 Psychosoziale Gesundheit Susanne Borkowski (MSW) KinderStärken e.v. WHO-Definition von Gesundheit Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein
Psychosoziale Gesundheit Susanne Borkowski (MSW) KinderStärken e.v. WHO-Definition von Gesundheit Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein
Sprache macht stark! - Grundschule Projektinformationen
 Sprache macht stark! - Grundschule Projektinformationen 1. Was sind die Ziele des Projekts Sprache macht stark! Grundschule? Sprache macht stark! Grundschule ist ein Beratungsprojekt für Grundschulen mit
Sprache macht stark! - Grundschule Projektinformationen 1. Was sind die Ziele des Projekts Sprache macht stark! Grundschule? Sprache macht stark! Grundschule ist ein Beratungsprojekt für Grundschulen mit
Konzeption der. Schulsozialarbeit. an der Astrid-Lindgren-Schule in der Stadt Schwentinental
 Konzeption der Schulsozialarbeit an der Astrid-Lindgren-Schule in der Stadt Schwentinental Inhalt 1. Rechtsgrundlagen und Ziele der Arbeit 2. Angebotsstruktur 2.1 Arbeit mit einzelnen Schülern und Schülerinnen
Konzeption der Schulsozialarbeit an der Astrid-Lindgren-Schule in der Stadt Schwentinental Inhalt 1. Rechtsgrundlagen und Ziele der Arbeit 2. Angebotsstruktur 2.1 Arbeit mit einzelnen Schülern und Schülerinnen
Fortbildungskonzept. der Ellef-Ringnes-Grundschule
 der Ellef-Ringnes-Grundschule Berlin, August 2015 Einleitung Durch unsere sich rasant ändernde Gesellschaft ist Schule ein Ort, wo sich das schulische Leben ständig verändert. Immer wieder gibt es neue
der Ellef-Ringnes-Grundschule Berlin, August 2015 Einleitung Durch unsere sich rasant ändernde Gesellschaft ist Schule ein Ort, wo sich das schulische Leben ständig verändert. Immer wieder gibt es neue
Fragebogen zur Einleitung oder Verlängerung einer ambulanten Psychotherapie
 Fragebogen zur Einleitung oder Verlängerung einer ambulanten Psychotherapie Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, dieser Fragebogen soll helfen, Ihre ambulante Psychotherapie einzuleiten bzw.
Fragebogen zur Einleitung oder Verlängerung einer ambulanten Psychotherapie Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, dieser Fragebogen soll helfen, Ihre ambulante Psychotherapie einzuleiten bzw.
FEM ELTERNAMBULANZ im Wiener Wilhelminenspital Spezialambulanz für psychische Krisen rund um die Schwangerschaft
 FEM ELTERNAMBULANZ im Wiener Wilhelminenspital Spezialambulanz für psychische Krisen rund um die Von Mag.a Daniela Kern und Mag.a Franziska Pruckner FEM- Institut für Frauen und Männergesundheit FEM in
FEM ELTERNAMBULANZ im Wiener Wilhelminenspital Spezialambulanz für psychische Krisen rund um die Von Mag.a Daniela Kern und Mag.a Franziska Pruckner FEM- Institut für Frauen und Männergesundheit FEM in
Was ist Schulsozialarbeit?
 Was ist Schulsozialarbeit? Schulsozialarbeit übernimmt eine Scharnierfunktion zwischen Schule und Familie. Sie erfasst und bearbeitet soziale Probleme und persönliche Nöte von Kindern und Jugendlichen,
Was ist Schulsozialarbeit? Schulsozialarbeit übernimmt eine Scharnierfunktion zwischen Schule und Familie. Sie erfasst und bearbeitet soziale Probleme und persönliche Nöte von Kindern und Jugendlichen,
Gesunde Gemeinde als Basis für intergenerative Begegnung
 Die Aschenlauge unserer Großmütter Gesunde Gemeinde als Basis für intergenerative Begegnung Land Niederösterreich Focus Umweltbildung 2009 Susi Satran St. Pölten, 28. Oktober 2009 Gesundheitsförderung
Die Aschenlauge unserer Großmütter Gesunde Gemeinde als Basis für intergenerative Begegnung Land Niederösterreich Focus Umweltbildung 2009 Susi Satran St. Pölten, 28. Oktober 2009 Gesundheitsförderung
ZUM SCHARFSTELLEN DES BEAMERS ZUM SCHARFSTELLEN DES BEAMERS. Dr. in Susanne Hanzl. Unterstützungsangebote im Wiener Krankenanstaltenverbund bei
 ZUM SCHARFSTELLEN DES BEAMERS ABC 123 ZUM SCHARFSTELLEN DES BEAMERS ABC 123 ZUM SCHARFSTELLEN DES BEAMERS Diese PDF-Präsentation startet im Vollbildmodus. Es kann ausgedruckt und kopiert werden. Eine unberechtigte
ZUM SCHARFSTELLEN DES BEAMERS ABC 123 ZUM SCHARFSTELLEN DES BEAMERS ABC 123 ZUM SCHARFSTELLEN DES BEAMERS Diese PDF-Präsentation startet im Vollbildmodus. Es kann ausgedruckt und kopiert werden. Eine unberechtigte
Glück macht Schule - die Ziele
 - die Ziele Glückliche und selbstsichere SchülerInnen Lebenskompetenzen Psychische und physische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen Gewaltprävention Wohlbefinden der LehrerInnen - das Vorbild Willy-Hellpach-Schule
- die Ziele Glückliche und selbstsichere SchülerInnen Lebenskompetenzen Psychische und physische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen Gewaltprävention Wohlbefinden der LehrerInnen - das Vorbild Willy-Hellpach-Schule
NQF Inclusive - Pilot Evaluation Gesundheits- und Sozialbetreuung, MCAST, MT Befragungsergebnisse TeilnehmerInnen
 NQF Inclusive - Pilot Evaluation Gesundheits- und Sozialbetreuung, MCAST, MT Befragungsergebnisse TeilnehmerInnen Durchgeführt von auxilium, Graz Mai 2011 Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen
NQF Inclusive - Pilot Evaluation Gesundheits- und Sozialbetreuung, MCAST, MT Befragungsergebnisse TeilnehmerInnen Durchgeführt von auxilium, Graz Mai 2011 Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen
Stiftung PASSAGGIO Geschäftsbericht 2009
 Stiftung PASSAGGIO Geschäftsbericht 2009 Das Betriebsjahr 2009 stand ganz im Zeichen der Umwandlung des Rechtskleides. Aus PASSAGGIO AG wurde die Stiftung PASSAGGIO. Im Februar 1999 wurde PASSAGGIO als
Stiftung PASSAGGIO Geschäftsbericht 2009 Das Betriebsjahr 2009 stand ganz im Zeichen der Umwandlung des Rechtskleides. Aus PASSAGGIO AG wurde die Stiftung PASSAGGIO. Im Februar 1999 wurde PASSAGGIO als
Das voxmi-curriculum. Erstellt von. Mag. Erika Hummer Mag. Martina-Huber-Kriegler Mag. Ursula Maurič dem Team der voxmi-lehrer/innen.
 Das voxmi-curriculum Erstellt von Mag. Erika Hummer Mag. Martina-Huber-Kriegler Mag. Ursula Maurič dem Team der voxmi-lehrer/innen Graz/Wien 2013 INHALT 1. voxmi-lehrer/innen: Kompetenzprofil 2. voxmi-curriculum
Das voxmi-curriculum Erstellt von Mag. Erika Hummer Mag. Martina-Huber-Kriegler Mag. Ursula Maurič dem Team der voxmi-lehrer/innen Graz/Wien 2013 INHALT 1. voxmi-lehrer/innen: Kompetenzprofil 2. voxmi-curriculum
Presseinformation. Gütesiegelverleihung Gesunde Schule OÖ
 Herausgeber: Institut für Gesundheitsplanung - Weißenwolffstraße 5/EG/1-4020 Linz Tel. 0732/784036 - institut@gesundheitsplanung.at - www.gesundheitsplanung.at Presseinformation Gütesiegelverleihung Gesunde
Herausgeber: Institut für Gesundheitsplanung - Weißenwolffstraße 5/EG/1-4020 Linz Tel. 0732/784036 - institut@gesundheitsplanung.at - www.gesundheitsplanung.at Presseinformation Gütesiegelverleihung Gesunde
IMC Fachhochschule Krems GmbH A-3500 Krems, Piaristengasse 1. Roland BÄSSLER und Christina BÄSSLER. Studie im Auftrag von
 IMC Fachhochschule Krems GmbH A-3500 Krems, Piaristengasse 1 Gesundheitsförderung für Frauen Bericht zum Pretest und Dokumentation Roland BÄSSLER und Christina BÄSSLER Studie im Auftrag von Krems 2004
IMC Fachhochschule Krems GmbH A-3500 Krems, Piaristengasse 1 Gesundheitsförderung für Frauen Bericht zum Pretest und Dokumentation Roland BÄSSLER und Christina BÄSSLER Studie im Auftrag von Krems 2004
Seminarbeschreibung: Persönliches Gesundheitsmanagement für Führungskräfte.
 Seminarbeschreibung: Persönliches Gesundheitsmanagement für Führungskräfte. Kurzbeschreibung: Das Seminar Persönliches Gesundheitsmanagement für Führungskräfte" zielt darauf ab, das Wissen und die Handlungskompetenzen
Seminarbeschreibung: Persönliches Gesundheitsmanagement für Führungskräfte. Kurzbeschreibung: Das Seminar Persönliches Gesundheitsmanagement für Führungskräfte" zielt darauf ab, das Wissen und die Handlungskompetenzen
Lernkulturentwicklung
 Stand: Juni 2015 Beispiel Projektplan Schulentwicklung und Gewaltprävention für die Entwicklungsbereiche Lernkultur, Schulkultur, Konfliktmanagement, Soziales Lernen, Elternarbeit, Gestaltung des Schulgebäudes
Stand: Juni 2015 Beispiel Projektplan Schulentwicklung und Gewaltprävention für die Entwicklungsbereiche Lernkultur, Schulkultur, Konfliktmanagement, Soziales Lernen, Elternarbeit, Gestaltung des Schulgebäudes
MDK-Prüfung. Formular zur Bewertung von MDK- Prüfungen
 Seite 1 von 14 Unser Ziel ist es, konkret die Praxis der MDK-Prüfung sowie die Bewertung und Umsetzung der Transparenzvereinbarung zu analysieren. Wir möchten in Ihrem Interesse auf Grundlage objektivierter
Seite 1 von 14 Unser Ziel ist es, konkret die Praxis der MDK-Prüfung sowie die Bewertung und Umsetzung der Transparenzvereinbarung zu analysieren. Wir möchten in Ihrem Interesse auf Grundlage objektivierter
Lehrpersonenbefragung zur Schulsozialarbeit
 Instrument S128 Lehrpersonenbefragung r Schulsozialarbeit Dieser Fragebogen kann als Item-Pool für die Erstellung eines eigenen bedürfnisgerechten Fragebogens r Befragung von Lehrpersonen eingesetzt werden.
Instrument S128 Lehrpersonenbefragung r Schulsozialarbeit Dieser Fragebogen kann als Item-Pool für die Erstellung eines eigenen bedürfnisgerechten Fragebogens r Befragung von Lehrpersonen eingesetzt werden.
01./ , Erkner, Forum 10
 01./02.11. 2016, Erkner, Forum 10 Betriebliches Gesundheitsmanagement in der Pflege Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Stärkung gesundheitlicher Ressourcen im Unternehmen Sabine Peistrup/Anke
01./02.11. 2016, Erkner, Forum 10 Betriebliches Gesundheitsmanagement in der Pflege Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Stärkung gesundheitlicher Ressourcen im Unternehmen Sabine Peistrup/Anke
Fünf Schritte zur Zusammenarbeit. Gemeinsam aktiv für unsere Gesellschaft.
 Fünf Schritte zur Zusammenarbeit. 1. Unter http://engagement.telekom.de tragen Sie Ihre Kontaktdaten ein. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie Ihre Log-in-Daten. 2. In einem Datenblatt zur Projekterfassung
Fünf Schritte zur Zusammenarbeit. 1. Unter http://engagement.telekom.de tragen Sie Ihre Kontaktdaten ein. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie Ihre Log-in-Daten. 2. In einem Datenblatt zur Projekterfassung
So richtig weitergebracht hat mich das eigentlich nicht Wie Schüler Angebote zur Berufsorientierung der Schule sehen
 Dr. Helen Knauf So richtig weitergebracht hat mich das eigentlich nicht Wie Schüler Angebote zur Berufsorientierung der Schule sehen 1. Hintergrund: Projekt Berufsorientierung und Lebensplanung Jugendliche
Dr. Helen Knauf So richtig weitergebracht hat mich das eigentlich nicht Wie Schüler Angebote zur Berufsorientierung der Schule sehen 1. Hintergrund: Projekt Berufsorientierung und Lebensplanung Jugendliche
(Folgevereinbarung) der. Eigenverantwortlichen Schule SBBS 3 Ludwig-Erhard-Schule Erfurt Er. vertreten durch. Herr Schneidmüller.
 ZIELVEREINBARUNG (Folgevereinbarung) der Eigenverantwortlichen Schule SBBS 3 Ludwig-Erhard-Schule Erfurt Er vertreten durch Herr Schneidmüller mit dem Staatlichen Schulamt Mittelthüringen vertreten durch
ZIELVEREINBARUNG (Folgevereinbarung) der Eigenverantwortlichen Schule SBBS 3 Ludwig-Erhard-Schule Erfurt Er vertreten durch Herr Schneidmüller mit dem Staatlichen Schulamt Mittelthüringen vertreten durch
Fachtagung 2014 Seelisches und soziales Wohlbefinden in der Kita. Katharina Ehmann, Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.v.
 Fachtagung 2014 Seelisches und soziales Wohlbefinden in der Kita Katharina Ehmann, Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.v. Resilienzförderung in Hintergrund Zunahme psychischer Erkrankungen
Fachtagung 2014 Seelisches und soziales Wohlbefinden in der Kita Katharina Ehmann, Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.v. Resilienzförderung in Hintergrund Zunahme psychischer Erkrankungen
Schulinterne Evaluation im Rahmen des Projektes MSRG - Mehr Schulerfolg! Susanna Endler
 Schulinterne Evaluation im Rahmen des Projektes MSRG - Mehr Schulerfolg! Schulinterne Evaluation ist ein bewusst eingeleiteter, geplanter und kontinuierlicher Prozess zur Verbesserung der Arbeit und der
Schulinterne Evaluation im Rahmen des Projektes MSRG - Mehr Schulerfolg! Schulinterne Evaluation ist ein bewusst eingeleiteter, geplanter und kontinuierlicher Prozess zur Verbesserung der Arbeit und der
Schule Rotweg, Horgen
 Bildungsdirektion Kanton Zürich Fachstelle für Schulbeurteilung Evaluationsbericht, Juni 2011 Schule Rotweg, Horgen 1 Vorwort Wir freuen uns, Ihnen den Evaluationsbericht für die Primarschule Rotweg vorzulegen.
Bildungsdirektion Kanton Zürich Fachstelle für Schulbeurteilung Evaluationsbericht, Juni 2011 Schule Rotweg, Horgen 1 Vorwort Wir freuen uns, Ihnen den Evaluationsbericht für die Primarschule Rotweg vorzulegen.
Elternbefragung Sekundarschule Hatzenbühl
 Elternbefragung Sekundarschule Hatzenbühl April 2012 Meine Tochter/mein Sohn besucht die folgende Klasse: A1a, A1b, B1, A2a, A2b, B2, A3a, A3b, B3 (treffendes ankreuzen) trifft voll trifft nicht Startfrage
Elternbefragung Sekundarschule Hatzenbühl April 2012 Meine Tochter/mein Sohn besucht die folgende Klasse: A1a, A1b, B1, A2a, A2b, B2, A3a, A3b, B3 (treffendes ankreuzen) trifft voll trifft nicht Startfrage
Stellenbeschreibung. Die sozialpädagogische Arbeit an der Beruflichen Schule des Kreises Stormarn in Ahrensburg
 Stellenbeschreibung Die sozialpädagogische Arbeit an der Beruflichen Schule des Kreises Stormarn in Ahrensburg Unterrichtszeiten und Pausen S.Rininsland I. Dabrowski 7:40 8:10 Gespräche im Lehrerzimmer
Stellenbeschreibung Die sozialpädagogische Arbeit an der Beruflichen Schule des Kreises Stormarn in Ahrensburg Unterrichtszeiten und Pausen S.Rininsland I. Dabrowski 7:40 8:10 Gespräche im Lehrerzimmer
Erfolgsfaktor Soziale Kompetenz
 Erfolgsfaktor Soziale Kompetenz Online-Fragebogen zur Erhebung der sozialen Kompetenz in OÖ Betrieben Der Fragebogen - Der Prozess - Der Ergebnisbericht Erfolgsfaktor Soziale Kompetenz Rahmenbedingungen
Erfolgsfaktor Soziale Kompetenz Online-Fragebogen zur Erhebung der sozialen Kompetenz in OÖ Betrieben Der Fragebogen - Der Prozess - Der Ergebnisbericht Erfolgsfaktor Soziale Kompetenz Rahmenbedingungen
BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG. Lehrlingshäuser der Wirtschaftskammer Steiermark Betriebsgesellschaft m.b.h.
 BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG Lehrlingshäuser der Wirtschaftskammer Steiermark Betriebsgesellschaft m.b.h. Warum Betriebliche Gesundheitsförderung? Die Flexibilität am Arbeitsmarkt fordert immer neue
BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG Lehrlingshäuser der Wirtschaftskammer Steiermark Betriebsgesellschaft m.b.h. Warum Betriebliche Gesundheitsförderung? Die Flexibilität am Arbeitsmarkt fordert immer neue
Das Konzept Operativ Eigenständige Schule OES für berufliche Schulen in Baden-Württemberg
 Das Konzept Operativ Eigenständige Schule OES für berufliche Schulen in Baden-Württemberg Susanne Thimet DEQA-VET-Jahresfachveranstaltung am 22.09.2009 in Bonn Ansprechpartner Verantwortlich im Kultusministerium:
Das Konzept Operativ Eigenständige Schule OES für berufliche Schulen in Baden-Württemberg Susanne Thimet DEQA-VET-Jahresfachveranstaltung am 22.09.2009 in Bonn Ansprechpartner Verantwortlich im Kultusministerium:
Arbeitsprogramm. Villa. in Volkmarsen. Schuljahr 14/15
 Arbeitsprogramm Schuljahr 14/15 Villa in Volkmarsen Seite 1 Inhaltsverzeichnis 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 2. 3. 4. 5. 6. Implementierte schulische Arbeitsschwerpunkte im Überblick Arbeitsschwerpunkt
Arbeitsprogramm Schuljahr 14/15 Villa in Volkmarsen Seite 1 Inhaltsverzeichnis 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 2. 3. 4. 5. 6. Implementierte schulische Arbeitsschwerpunkte im Überblick Arbeitsschwerpunkt
Unternehmen Gesundheit! Zahlen, Daten, Fakten
 Das Projekt Unternehmen Gesundheit! Ein Netzwerk für die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements für die Sozialwirtschaft wird im Rahmen des Programms rückenwind Für die Beschäftigten in
Das Projekt Unternehmen Gesundheit! Ein Netzwerk für die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements für die Sozialwirtschaft wird im Rahmen des Programms rückenwind Für die Beschäftigten in
Pflegeheim Am Nollen Gengenbach
 Pflegeheim Am Nollen Gengenbach Geplante Revision: 01.06.2018 beachten!!! Seite 1 von 7 Unsere Gedanken zur Pflege sind... Jeder Mensch ist einzigartig und individuell. In seiner Ganzheit strebt er nach
Pflegeheim Am Nollen Gengenbach Geplante Revision: 01.06.2018 beachten!!! Seite 1 von 7 Unsere Gedanken zur Pflege sind... Jeder Mensch ist einzigartig und individuell. In seiner Ganzheit strebt er nach
JProf. Dr. Erik Weber - Universität Koblenz-Landau März 2010
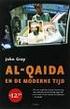 Forschungsprojekt Evaluation der Neugestaltung des Individuellen Hilfeplans (IHP-3) Umsetzung und Wirksamkeit Individueller Hilfeplanung in Einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe im Rheinland
Forschungsprojekt Evaluation der Neugestaltung des Individuellen Hilfeplans (IHP-3) Umsetzung und Wirksamkeit Individueller Hilfeplanung in Einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe im Rheinland
Gesundheit endet nicht am Schultor
 Gesundheit endet nicht am Schultor Eltern und Schule Hand in Hand für die Gesundheit der Kinder von Michael Töpler, M.A. Übersicht Einleitung 1. Eltern Hauptteil 1. Gesundheit in der Schule 2. Schule 3.
Gesundheit endet nicht am Schultor Eltern und Schule Hand in Hand für die Gesundheit der Kinder von Michael Töpler, M.A. Übersicht Einleitung 1. Eltern Hauptteil 1. Gesundheit in der Schule 2. Schule 3.
Arche Fachstelle für Integration. Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags
 Arche Fachstelle für Integration Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags Inhaltsverzeichnis 1 // EINLEITUNG 2 // ZIELGRUPPE 3 // Ziele 4 // Angebote 5 // ORGANISATION, STEUERUNG UND
Arche Fachstelle für Integration Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags Inhaltsverzeichnis 1 // EINLEITUNG 2 // ZIELGRUPPE 3 // Ziele 4 // Angebote 5 // ORGANISATION, STEUERUNG UND
Modul Psychische Gesundheit (Bella-Studie)
 U. Ravens-Sieberer, N. Wille, S. Bettge, M. Erhart Modul Psychische Gesundheit (Bella-Studie) Korrespondenzadresse: Ulrike Ravens-Sieberer Robert Koch - Institut Seestraße 13353 Berlin bella-studie@rki.de
U. Ravens-Sieberer, N. Wille, S. Bettge, M. Erhart Modul Psychische Gesundheit (Bella-Studie) Korrespondenzadresse: Ulrike Ravens-Sieberer Robert Koch - Institut Seestraße 13353 Berlin bella-studie@rki.de
Glücksspielsuchtpräventive Ansätze Projekt für die schulische Arbeit: BlingBling
 Glücksspielsuchtpräventive Ansätze Projekt für die schulische Arbeit: BlingBling MMag. Birgit Wenty, Fachstelle für Suchtprävention NÖ Mag. Margit Bachschwöll, Institut für Suchtprävention Wien Fachtagung
Glücksspielsuchtpräventive Ansätze Projekt für die schulische Arbeit: BlingBling MMag. Birgit Wenty, Fachstelle für Suchtprävention NÖ Mag. Margit Bachschwöll, Institut für Suchtprävention Wien Fachtagung
Evaluation des Gewaltpräventionsprogramms und Zivilcouragetrainings zammgrauft
 Evaluation des Gewaltpräventionsprogramms und Zivilcouragetrainings zammgrauft zammgrauft - das Anti-Gewaltprogramm der Münchener Polizei möchte Kinder und Jugendliche für Gewaltphänomene sensibilisieren
Evaluation des Gewaltpräventionsprogramms und Zivilcouragetrainings zammgrauft zammgrauft - das Anti-Gewaltprogramm der Münchener Polizei möchte Kinder und Jugendliche für Gewaltphänomene sensibilisieren
Qualifizierung als TrainerIn im Wissenschaftsbereich. Weiterbildungsprogramm
 1 ZWM 2016 Weiterbildungsprogramm 2 Hintergrund und Thematik Zielgruppe Konzept /Methodik Die interne Weiterbildung an Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen umfasst vielfältige Aktivitäten
1 ZWM 2016 Weiterbildungsprogramm 2 Hintergrund und Thematik Zielgruppe Konzept /Methodik Die interne Weiterbildung an Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen umfasst vielfältige Aktivitäten
Beratung von Menschen mit Behinderungen im Kreis Olpe
 Beratung von Menschen mit Behinderungen im Kreis Olpe Ein Praxisforschungsprojekt im Masterstudiengang Bildung und Soziale Arbeit unter Leitung von Prof. Dr. Albrecht Rohrmann Praxisforschung 1 Praxisforschung
Beratung von Menschen mit Behinderungen im Kreis Olpe Ein Praxisforschungsprojekt im Masterstudiengang Bildung und Soziale Arbeit unter Leitung von Prof. Dr. Albrecht Rohrmann Praxisforschung 1 Praxisforschung
Ergebnisse der Schülerbefragung im Schuljahr 2013/2014
 PETER-LENNÉ-SCHULE OSZ AGRARWIRTSCHAFT INTERNE EVALUATION Ergebnisse der Schülerbefragung im Schuljahr 2013/2014 Im Dezember 2013 und Januar 2014 nahm die Peter-Lenné-Schule / OSZ Agrarwirtschaft erneut
PETER-LENNÉ-SCHULE OSZ AGRARWIRTSCHAFT INTERNE EVALUATION Ergebnisse der Schülerbefragung im Schuljahr 2013/2014 Im Dezember 2013 und Januar 2014 nahm die Peter-Lenné-Schule / OSZ Agrarwirtschaft erneut
Die Quadratur des Kreises Die Arbeit mit Kindern zwischen äußeren Anforderung und eigenem Wohlbefinden gestalten
 Die Quadratur des Kreises Die Arbeit mit Kindern zwischen äußeren Anforderung und eigenem Wohlbefinden gestalten Die Anforderung von Eltern und Kindern an Menschen, die im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit
Die Quadratur des Kreises Die Arbeit mit Kindern zwischen äußeren Anforderung und eigenem Wohlbefinden gestalten Die Anforderung von Eltern und Kindern an Menschen, die im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit
Tagung Mutterglück und Kindeswohl Graz, 8. April Gesundheitsförderung für schwangere Frauen und Mütter von Babys
 Tagung Mutterglück und Kindeswohl Graz, 8. April 2011 Gesundheitsförderung für schwangere Frauen und Mütter von Babys Ergebnisse des Modellprojektes MIA Mütter in Aktion Dr. in Brigitte Steingruber, Frauengesundheitszentrum
Tagung Mutterglück und Kindeswohl Graz, 8. April 2011 Gesundheitsförderung für schwangere Frauen und Mütter von Babys Ergebnisse des Modellprojektes MIA Mütter in Aktion Dr. in Brigitte Steingruber, Frauengesundheitszentrum
 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort 11 1 Einleitung und Aufbau der Arbeit 13 2 Gesundheit- Begriff und Bedeutung 15 2.1 Begriffliche und konzeptionelle Bestimmung von Gesundheit 15 2.1.1 Gesundheit - ein historisch
INHALTSVERZEICHNIS Vorwort 11 1 Einleitung und Aufbau der Arbeit 13 2 Gesundheit- Begriff und Bedeutung 15 2.1 Begriffliche und konzeptionelle Bestimmung von Gesundheit 15 2.1.1 Gesundheit - ein historisch
Sinnvoll handeln, gemeinsam tun: Erlebnis Garten
 Sinnvoll handeln, gemeinsam tun: Erlebnis Garten Aufbau 1. Rahmenbedingungen 2. Inhalt Projekt 3. Zielsetzungen 4. Umsetzung und Auswertung 5. Netzwerke und Handlungsfelder 1.1 Trägerschaft Netzwerk Gesundheitsfördernder
Sinnvoll handeln, gemeinsam tun: Erlebnis Garten Aufbau 1. Rahmenbedingungen 2. Inhalt Projekt 3. Zielsetzungen 4. Umsetzung und Auswertung 5. Netzwerke und Handlungsfelder 1.1 Trägerschaft Netzwerk Gesundheitsfördernder
