Lesekompetenz. Lesen in allen Fächern Lesestrategie: Fünf und mehr Phasen Schemata
|
|
|
- Silvia Gehrig
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 3.10 Lesestrategie: Fünf und mehr Phasen Schemata Das Fünf Phasen Schema 22 ist eine durchaus erprobte, aber aufwändige und zeitintensive Strategie zur eigenständigen Erarbeitung eines bestimmten Textes. Dabei nähern sich die SchülerInnen dem Text zyklisch, unter immer wieder neuen Blickwinkeln, wobei von Verstehensinseln auszugehen ist und niemals von der Frage: Was verstehst du nicht?. Das Texterschließungsverfahren dient vor allem auch der Vorbereitung einer eigenständigen Textproduktion, da der Text dabei reflektiert und der rote Faden gesucht wird. Verschiedene Einzelstrategien werden kombiniert. 1. Phase: Orientierung (orientierendes Lesen, Skimming, zur Vorbereitung von Verstehendem Lesen, die SchülerInnen erhalten einen ersten Überblick über den Text) 2. Phase: Aufsuchen von Verstehensinseln (durch extensives und selektives Lesen) 3. Phase: Erschließung von inhaltlichen Details (durch intensives Lesen), unter Anwendung bestimmter Lesestrategien, z.b. Farborientiert markieren, Wechsel in eine andere Darstellungsform, Schlüsselwörter suchen, Text zusammenfassen 4. Phase: Reflexion des Textes, Einbindung in das eigene Wissensnetz 5. Phase: Überprüfung Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche, weitere Lesestrategien, wie z.b. das... SQ3R-Modell von Robinson (1946), die... PQ4R-Technik (1972) nach Thomas und Robinson, oder das... MURDER-Schema nach Danserau (1979). 22 Vgl. Leisen, S 23f und 56f 30
2 SQ3R-Modell 23, 24 : Ähnlich wie beim Fünf Phasen Schema sind die LeserInnen auch beim SQ3R-Modell von Francis Robinson zur wiederholten und damit intensiven Auseinandersetzung mit dem Text angehalten. Die Abkürzung SQ3R basiert auf den englischen Begriffen Survey und Question, sowie auf den folgenden drei, jeweils mit R ( 3R ) beginnenden Worten: Read, Recite und Review. Die Begriffe stehen für die wichtigsten Schritte dieses Modells der Texterschließung. 1. Überblick ( Survey ): Die LeserInnen sind zunächst aufgefordert, sich einen Überblick über den zu erarbeitenden Text zu verschaffen. Die erste Orientierung kann dabei anhand von Überschriften, Zwischenüberschriften, des Vorworts, Inhaltsverzeichnisses, (Kurz)zusammenfassungen, Gliederungen, Schlüsselwörtern, Abbildungen etc., unter Bezug zum eigenen Vorwissen erfolgen. 2. Fragen formulieren ( Question ): Zur Steigerung des Interesses am Thema, zur Erhöhung der Motivation, sich mit dem Text aktiv auseinanderzusetzen und zur Verbesserung der Konzentration, Aktivierung bestimmter Schemata, Bewusstmachung von Wissenslücken und Gliederung des Textes sollen die LeserInnen in weiterer Folge, eigenständig und schriftlich, Fragen zum Thema und den einzelnen Textabschnitten formulieren, um anschließend, beim intensiven Studium des Textes, Antworten auf diese zu finden. 3. Lesen ( Read ): Nach diesen vorbereitenden und einstimmenden Arbeiten werden die einzelnen Abschnitte des Textes nun detailliert und intensiv gelesen und die im Text enthaltenen Informationen aufgenommen. Die Lesegeschwindigkeit ist dabei - sinnvollerweise - dem Schwierigkeitsgrad anzupassen. 4. Wiedergeben ( Recite ): Die Inhalte des Lesestoffs sollen nach bestimmten Abschnitten immer wieder - möglichst ohne Vorlage - wiedergegeben, die zuvor gestellten Fragen beantwortet und wichtige Textabschnitte, auch schriftlich, in eigenen Formulierungen zusammengefasst bzw. in andere Darstellungsformen, wie z.b. Mindmaps, übertragen werden. 5. Rückblick ( Review ): Zum Abschluss sollen die LeserInnen das Gelesene in Gedanken nochmals Revue passieren lassen, um die einzelnen Teile zu einem Ganzen zusammenfügen zu können und sich zu fragen, ob auch wirklich alle wichtigen Informationen und Ideen der AutorInnen erfasst und in die eigene Wissens- und Erfahrungswelt eingebettet wurden. 23 Robinson, F.: Effective Study. New York: Harper & Row, vgl. Christmann, U.; Groeben, N.: Psychologie des Lesens. In: B. Franzmann, K. Hasemann, D. Löffler, E. Schön (Hrsg.): Handbuch Lesen. - München: Saur, 1999, S
3 PQ4R-Technik 25 : Die PQ4R-Technik nach Thomas und Robinson (1972) ist dem SQ3R-Modell sehr ähnlich, nur gibt es bei dieser Art von Texterschließungsmethode sechs Einzelschritte. Die Buchstabenfolge PQ4R basiert auf den englischen Wörtern Preview (Vorprüfen), Questions (Fragen formulieren), Read (Lesen), Reflect (Nachdenken), Recite (Wiedergeben) und Review (Rückblicken) abgeleitet. Auch hier empfehlen die Autoren, den Text... zunächst nur zu überfliegen und zu prüfen ( Preview ), um sich einen Überblick zu verschaffen, dann... Fragen ( Questions ) zum Text zu formulieren und... den Text anschließend abschnittsweise genau zu lesen ( Read ). Zwischendurch sollen sich die LeserInnen immer wieder überlegen, ob sie denn auch den Sinn der einzelnen Abschnitte erfasst und verstanden haben, ob ihnen die einzelnen Zusammenhänge klar sind und ob sie die zuvor formulierten Fragen beantworten können (Reflect). Abschließend sollen die gesamten erfassten Informationen und Zusammenhänge in das eigene Wissenssystem eingeordnet und in eigenen Worten wiedergegeben (Recite) sowie - in Gedanken - eine Gesamtrückschau (Review) gehalten werden. 25 Abs, H. J. et al.: PQ4R-Methode. In: Besser Lehren. Methodensammlung, Heft 2 - Weinheim: Deutscher Studienverlag, 2000, S. 80f. 32
4 MURDER-Schema 26,27,28 Das MURDER-Schema nach Danserau ist ebenfalls eine Weiterentwicklung der SQ3R-Technik. Dabei kommen Primär- und Sekundärstrategien zur Anwendung. Die Primärstrategien, bei denen Verstehensstrategien (MURDER 1) sowie Anwendungsund Abrufstrategien (MURDER 2) unterschieden werden, sind auf den Prozess der Informationsaufnahme, das Verarbeiten, Verstehen, Behalten, Transferieren und Abrufen von Informationen gerichtet. Die Sekundärstrategien sind Stützstrategien, metakognitve Strategien, zur Selbststeuerung in Bezug auf Selbstmotivation, Interesse, selbstständiges Planen (Leseziele, Zeitplan), Überwachen des Leseprozesses, des eigenen Handelns, der Förderung der Konzentration etc. Die Abkürzung MURDER hat natürlich nichts mit Mord bzw. Ermordung zu tun, sondern setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der englischen Bezeichnungen der einzelnen Arbeitsschritte zusammen. Mood : Einstimmung auf den Leseprozess, Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für eine gute Lernatmosphäre wie z.b. gute und gleichmäßige Beleuchtung, Vermeidung von Ablenkungen, Einnahme einer richtigen Leseposition, Bereitstellung von Hilfsmitteln, Lernmaterialien etc. Understanding : Verstehend Lesen, Beseitigung von Unklarheiten, Trennung von Wichtigem und Unwichtigem Recalling : Wiedergabe des Lesestoffs, der Hauptinhalte, ohne Vorlage, in eigenen Worten, Wechsel in eine andere Darstellungsform Digesting/Detailing : Verarbeitung des Textes und Einordnung in das eigene Wissensnetz, Umstrukturierung, Differenzierung Expanding : Erweiterung, Vervollständigung der Inhalte durch Nachfragen bzw. unter Nutzung weiterer Informationsquellen Reviewing : Überprüfung des Textverständnisses bzw. Lernergebnisses 26 Dansereau, D. et al: Development and evaluation of a learning strategy training program. On: Journal of Educational Psychology 71, 1(1979), S Vgl. Schöffl, Susan: Fördert der Einsatz von Lernstrategien das Verstehen epischer Texte? Eine Trainingsstudie am Beispiel von Kurzgeschichten. Dissertation. Erziehungswissenschaftliche Fakultät der Universität Erfurt - Erfurt: 2005, S Vgl. Poser, Sascha: Der PISA-Lesekompetenztest und die Folgen für den Deutschunterricht. Wissenschaftliche Arbeit, Universität Leipzig - Leipzig 2004, S
5 Anwendungsbeispiel aus dem Unterrichtsgegenstand Chemie zur Lesestrategie: Fünf und mehr Phasen Schemata 1. Einleitung Im schulischen Lesealltag, also in der Praxis, werden SchülerInnen mit einer Vielzahl an Texten, die sich im Sprachniveau, dem Umfang, der didaktisch-informativen Absicht, der künstlerischen Gestaltung und damit in der Lesbarkeit, dem Lesekomfort unterscheiden. Die Kenntnis um Lesestrategien, deren Auswahl - dem Lesezweck angepasst - und deren Anwendung erleichtert das Erschließen und vor allem auch Behalten der Inhalte wesentlich. Insbesondere beim selbstständigen Erarbeiten längerer, anspruchsvoller Texte sind Kombinationen verschiedener Lesestrategien, die mitunter zwar aufwändig und zeitintensiv, aber eben auch sehr effektiv und effizient im Hinblick auf Sinnerfassung und Behaltensleistung sein können, empfehlenswert. So z.b. die folgende Mehrstufenstrategie, die exemplarisch an einem Übungstext zur Entwicklung von Medikamenten, umgesetzt werden soll. 2. Material Die Basis der folgenden Übung bildet eine Broschüre mit Informationen zur Entwicklung von Medikamenten, die durchgearbeitet und verinnerlicht werden soll. Die Unterrichtsmaterialien finden Sie unter folgendem Link: 3. Vorgangsweise Folgen Sie dem oben genannten Link und drucken Sie den Text aus. 29 Arbeiten Sie konzentriert, reflektieren und analysieren Sie Ihr Denken und Handeln immer wieder. Erhöhen Sie zunächst Ihr Interesse an dem Thema und analysieren Sie anschließend die formale Struktur des Artikels. Bei einem Buch würden Sie sich, um mehr zu erfahren, zunächst der Titelseite widmen, dann eventuell den Klappentext durchlesen, und sich schließlich die Rückseite näher anschauen, um kurze Informationen über den Inhalt, die AutorInnen und ihr Wollen, die Zielgruppe, etc. zu erhalten. In diesem speziellen Fall, der Broschüre zur Entwicklung von Medikamenten, wenden Sie folgende Vorgangsweise an: 1. Betrachten Sie das Titelblatt und lesen Sie dann das Vorwort : Forschung aktuell, ein Service für den Unterricht, es gibt Ihnen wichtige Informationen der AutorInnen zu ihrer Broschüre. Orientieren Sie sich und finden Sie die Antworten auf folgende Fragen: 29 Vgl. Schoenbach et. al, 2006, S 72 34
6 Wer hat die Broschüre herausgegeben? Wie ist die Informationsquelle zu bewerten? Welche Absicht wird mit der Bereitstellung der Unterrichtsmaterialien verfolgt? Sollen Informationen übermittelt werden, will man Sie von etwas überzeugen oder Sie zum Nachdenken anregen? An welchen Personenkreis richten sich die Artikel? In welcher Auflage erscheint das Magazin? 2. Schauen Sie sich anschließend das Inhaltsverzeichnis und seine Gliederung näher an. 3. Spätestens jetzt ist es Zeit Ihre eigene Wissens- und Erfahrungswelt einzubringen, Ihr Wissen zu aktivieren. Bauen Sie neues Wissen grundsätzlich auf bereits verfügbarem auf. Nützen Sie auf diese Weise die bereits bestehenden Verknüpfungen im Gehirn, Sie behalten das Gelesene dann besser. Fragen Sie sich also, was Sie bereits zu diesem Thema wissen und welche Ansichten Sie vertreten. Sprechen Sie mit Ihren KollegInnen über dieses Thema. Was können Sie in Erfahrung bringen? Beflügeln Sie sich gegenseitig. 4. Erarbeiten Sie nun die Grundlagen und formulieren Sie in weiterer Folge Fragen zum Text. Fragen Sie sich aber zunächst beispielsweise einmal 30,... Welches Interesse habe ich den Text zu lesen? Muss ich ihn lesen, ist es eine Pflichtlektüre, oder will ich ihn lesen? Welche Erwartungen habe ich an den Text? In welchem Umfang will ich den Text lesen, im Überblick, im Detail? Welche Inhalte könnte der Text vermitteln? Was könnte für mich besonders wichtig und interessant sein? Was könnte eventuell unwichtig sein? 5. Überfliegen Sie in der Folge die Broschüre, damit Sie einen besseren Überblick erhalten und machen sich mit dem Aufbau des Textes vertraut. Fragen Sie sich: Woran sind die Haupt- und Zwischenüberschriften erkennbar? Sind Schlüsselworte hervorgehoben? Gibt es einen 10 Sekunden-Text, Zusammenfassungen? Gibt es Tabellen, Beispiele, Übungen etc. und wie sind sie gestaltet? Gibt es weiterführende, ergänzende Texte? Sind Illustrationen vorhanden, gibt es detaillierte Bildbeschreibungen, wenn ja, wo und wie sind sie dargestellt? Lassen Sie nun den Blick in großen S-Kurven schnell über die einzelnen Seiten gleiten und orientieren Sie sich an Überschriften, grafischen Besonderheiten, am Abstract, der Zusammenfassung etc. Betrachten Sie die graphischen Darstellungen. Lesen Sie den ersten Abschnitt jedes Kapitels, er gibt einen Überblick über das Kapitel und den letzten Abschnitt, der das Wichtigste zusammenfasst ( Skimming ). Lesen Sie bei wichtigen Stellen zusätzlich noch die jeweils ersten Sätze der Absätze. Überlesen Sie Mehrdeutigkeiten und Unklarheiten zunächst. 30 Vgl. Schoenbach et. al, 2006, S 65 35
7 6. Definieren Sie nun Ihr Leseziel. In welchen und wie vielen Etappen wollen Sie den Text bearbeiten? Nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Erstellen Sie sich einen Zeitplan ( Leseplan mit folgenden Angaben: Datum/Zeit, Seitenzahlen, Kapitel, Inhalt, Seitensumme) und halten Sie diesen ein. Verfolgen Sie Ihr Leseziel in den einzelnen Abschnitten immer wieder durch Überfliegen des Textes. 7. Ist es Ihnen nun gelungen, Ihr Interesse an dem Text zu steigern und den formalen Aufbau zu analysieren, so gehen Sie nun weiter strukturiert und kontrolliert an den Artikel heran, damit Sie den Inhalt schnell, einfach und genau erfassen können. Untersuchen und veranschaulichen Sie als nächstes die inhaltliche Struktur des Textes. Jeder Sachtext hat eine fachtypische Sprache. Lesen Sie sich ein. Gehen Sie grundsätzlich von den Inhalten aus, die Sie bereits verstanden haben ( Verstehensinseln ) 31. Orientieren Sie sich an Wörtern, die Ihnen vertraut sind. Schlagen Sie Wörter, die Ihnen nicht bekannt sind, nach. Erfassen Sie das Bildmaterial genauer, was stellt es dar? Worüber gibt es Auskunft? Äußern Sie Vermutungen dazu, stellen Sie, und das eventuell schriftlich, Hypothesen auf. Markieren Sie wichtige Stellen am Textrand und gewichten Sie diese beim erneuten Durcharbeiten, z.b. durch die Anzahl der Striche. Heben Sie Schlüsselwörter im Text mit einem Marker hervor oder unterstreichen Sie diese mit einem Bleistift. Fügen Sie am Rand Zwischenbemerkungen ein oder notieren Sie diese auf einem Zettel / Post it, falls Sie die Materialen nicht verändern wollen bzw. dürfen. Markieren Sie schwierige Stellen zunächst nur und lesen Sie weiter. Lassen Sie sich vorerst nicht aufhalten, kommen Sie später wieder auf diese Stellen zurück. Viele Unklarheiten ergeben sich aus dem Kontext. Entscheiden Sie nun, welche Textstellen Sie genauer lesen werden. Formulieren Sie selbstständig weitere Fragen an den Text, ordnen Sie diese in die unten genannten Kategorien, behalten Sie die Fragen beim Lesen immer im Gedächtnis, erarbeiten und notieren Sie sich die Antworten (Tabelle). Sie erhalten auf diese Weise einen besseren Überblick, werden sich Ihrer Wissenslücken bewusst und behalten die Inhalte schließlich auch besser. 31 Vgl. Leisen, Josef:. In: Bertschi-Kaufmann, Andrea (Hrsg.): Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien. - Zug: Klett und Balmer Verlag, 2. Auflage, 2008, S ISBN D:
8 Nach Taffy Raphael 32 werden vier Fragentypen unterschieden: Fragentyp Fragen zum Erhalt von Informationen: Fragen / Antworten Beispiel: Wie viele Jahre vergehen von der Findung des Wirkstoffs bis zur Zulassung? Die Antworten finden Sie direkt im Text ( right there ), sie werden von den AutorInnen geliefert ( W-Fragen : Wer?, Was?, Wann?, Wo?, Warum?) Fragen zum umfassenden Textverständnis: Beispiel: Was kann man tun, um einer Thrombose vorzubeugen? Zur Beantwortung müssen Sie verschiedene Textstellen kombinieren ( think and search ). Fragen zur Reflexion und Bewertung: Beispiel: Wie gefährlich sind Thrombosen? Zur Beantwortung müssen Sie das Textwissen mit Ihrem (Vor)wissen verknüpfen ( author / text and me ). Fragen zur Auslegung (Interpretation) eines Textes: Beispiel: Hat jemand in meiner Familie schon einmal eine Thrombose gehabt? Die Beantwortung beruht vor allem auf Ihrem Wissen ( on my own ). 32 Vgl. Raphael, Taffy E.; Highfield, Kathy; Au, Kathryn H.: QAR Now. Question Answer Relationship. A Powerful and Practical Framework That Develops Comprehension and Higher-Level Thinking in All Students (Theory and Practice). - Teaching Resources, ISBN-10:
9 Überwachen Sie Ihr Leseverständnis und prüfen Sie, welche Fortschritte Sie diesbezüglich machen. Machen Sie sich nach jedem Abschnitt die wesentlichen Inhalte des Textes bewusst. Schreiben Sie eine Zusammenfassung unter Verwendung eigener Worte ( paraphrasieren ). Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung und stellen Sie diese in Bezug zur Meinung der AutorInnen. Kategorisieren und organisieren Sie die Informationen in Haupt- und Unterpunkte. Stellen Sie vielschichtige Inhalte auch in graphischer Form (hierarchischen Darstellungen, z.b. Begriffsbäumen, Flussdiagrammen, Lernplakaten, bzw. Mind Maps) dar. Suchen Sie nach eigenen Beispielen zur Darstellung der Inhalte. Machen Sie Vorhersagen über die nächsten Textinhalte ( Ich glaube, im nächsten Teil, Im nächsten Abschnitt wird nun dies bzw. jenes besprochen, erklärt ). Bringen Sie den Text immer wieder in Bezug zu Ihrem eigenen Wissen und Ihrer persönlichen Erfahrung ( Darüber habe ich schon in gelesen., Das habe ich schon in gelernt., etc., Ich weiß bereits, dass ). Stellen Sie sich das Gelesene vor allem auch bildhaft vor, indem Sie in Ihrem Kopf eine Art inneren Film ablaufen lassen. Aktivieren Sie dabei alle Sinne 33. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit Ihrem Leseziel. Werden Sie sich bewusst, was Sie nicht verstanden haben und wenden Sie Problemlösungsstrategien 34, wie zum Beispiel die folgenden, an, um den Text bestmöglich zu erfassen. Lesen Sie die unklaren Stellen erneut und suchen Sie im Textumfeld nach Anhaltspunkten, die zur Klärung beitragen könnten. Zerlegen Sie unübersichtliche Textstellen in kleinere, verständliche Einheiten. Machen Sie aus unübersichtlichen, schwer verständlichen Sätzen mehrere einzelne, kürzere Sätze. Versuchen Sie auch an Stellen, wo es keine Kommas und Punkte im Satz vorsehen, Denkpausen einzulegen. Versuchen Sie unklare Inhalte mit Ihrer Wissenswelt in Zusammenhang zu bringen, lassen Sie kleine Unsicherheiten zu. Lesen Sie andere Texte zum gleichen Thema, und falls Ihnen diese Vorschläge nicht helfen sollten, bitten Sie KollegInnen, Fach-LehrerInnen etc. um Hilfe. 33 Vgl. Christian Grüning, 2007, S Vgl. Schoenbach et. al, 2006, S 73ff 38
10 8. Überprüfen Sie Ihr Wissen anhand des folgenden Fragenkatalogs, reflexieren und evaluieren Sie den Arbeitsprozesses. Bestimmung des Textverständnisses: Beantworten Sie die folgenden Fragen schriftlich und, wenn möglich, aus dem Gedächtnis: Was versteht man unter einer Thrombose? Wodurch kann eine Thrombose entstehen? Welches Gerinnungsenzym wird bei Bildung einer Thrombose zunächst aktiv? Welches wichtige Enzym wird in weiterer Folge freigesetzt und welchen Vorgang löst es aus? Wovon werden die Venen im Fall einer Thrombose schließlich verschlossen? Welche gefährlichen Folgen können Thrombosen haben? Wie heißen die zur Therapie oder zur Vorsorge von Thrombosen üblicherweise verabreichten Medikamente? Wie wirken diese Arzneimittel? Durch welche Maßnahmen kann einer Thrombose vorgebeugt werden? 10. Worauf können PharmaforscherInnen bei der Entwicklung neuer Medikamente heutzutage nicht mehr verzichten? 11. Was interessiert die ForscherInnen bei der Suche nach dem geeigneten Wirkstoff gegen bestimmte Krankheiten vor allem? 12. Enzyme und Rezeptoren stehen meistens im Mittelpunkt des Interesses von Pharmaforschern. Woraus bestehen diese häufig und welche Aufgaben haben sie im Körper? 13. Was versteht man unter einem Target? 14. Wie soll der Wirkstoff zum Target passen? 15. Was versteht man unter einer Substanzbibliothek? 16. Welche Methode setzen die ForscherInnen zur Suche nach den richtigen Wirkstoffen ein, wieviele Tests können die Maschinen pro Tag durchführen und worauf basiert die Methode? 17. Was verstehen die WissenschaftlerInnen unter einem Hit? 39
11 18. Aus mehreren hundert Hits muss zur weiteren Optimierung ein Rohling, eine geeignete Leitstruktur ( Schlüssel ) ausgewählt werden. Auf welche Weise und zu welchem Zweck muss diese anschließend verändert werden? 19. Neue Arzneimittel müssen vor ihrem Einsatz in zahlreichen Studien (präklinischen, klinischen Tests) untersucht werden. Was wird in präklinischen Tests abgeklärt? 20. An welchen Organismen werden präklinische Tests durchgeführt? 21. Wodurch wird den ForscherInnen der Pharmafirmen ihre Arbeit bei der Vorhersage des Verhaltens von bestimmten Substanzen erleichtert? 22. Wie lange dauert die Präklinische Phase? 23. In den klinischen Phasen I, II, III prüfen die Pharmakologen, wie sich das neue Medikament beim Menschen auswirkt. Welche Art von Testpersonen dürfen in der Phase I an den Tests teilnehmen? 24. Für Medikamente gibt es unterschiedliche Anwendungsformen. Nenne einige davon! 25. Was versteht man unter Galenik? 26. Worauf hat die Art der Darreichung eines Arzneimittels einen ganz entscheidenden Einfluss? 27. Kapseln, Dragees oder Tabletten enthalten viele zusätzliche Hilfsstoffe. Welche Zwecke erfüllen sie? 28. Zu welchem Zweck werden Tabletten mit Überzügen versehen? 29. Wie nennen Fachleute das gezielte Verzögern der Wirkstofffreisetzung im Körper? 30. Welche Vorteile haben Tropfen bzw. Säfte? 31. Welche Darreichungsformen bieten sich an, wenn auf der Haut hohe Konzentrationen eines Wirkstoffs notwendig sind und welchen Vorteil haben diese Produkte? 32. Unter welchen Bedingungen funktioniert die Resorption besonders gut? 33. Welchen Vorteil haben wirkstoffbeladene Pflaster? 34. Warum werden Medikamente mittels Spritzen bzw. als Sprays verabreicht? 35. Unter welchen Umständen sind Zäpfchen eine optimale Darreichungsform? 40
12 II. Fragen allgemeiner Natur: Lesekompetenz Hat Sie das Thema interessiert? Wissen Sie nun Wie Blutgerinsel enstehen, Wo und warum sie auftreten, Welche Risiken sie bergen, Wie man Thrombosen behandelt und welche vorbeugenden Maßnahmen es gibt, Wie innovative Wirkstoffe gefunden werden, Welcher Weg vom Wirkstoff zur Apotheke führt, Warum Tabletten, Spritzen oder Sprays verabreicht werden? Wie viele von den 35 Fragen konnten Sie beantworten? Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Haben Sie den Eindruck etwas gelernt zu haben? Erscheinen Ihnen diese Lesetipps als nützlich? 5. Werden Sie diese Vorgangsweise wieder anwenden? 41
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Erwachsen werden, erwachsen sein. Texte mit der 5-Schritt- Lesemethode erarbeiten (Klasse 8/9) Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Erwachsen werden, erwachsen sein. Texte mit der 5-Schritt- Lesemethode erarbeiten (Klasse 8/9) Das komplette Material finden Sie hier:
5-Schritt-Lesemethode nach H. Klippert 1994 (SQ3R-Lesemethode nach F. P. Robinson 1946)
 5-Schritt-Lesemethode nach H. Klippert 1994 (SQ3R-Lesemethode nach F. P. Robinson 1946) Schülerinnen und Schüler verfügen oft nicht über die Fähigkeit, Sachtexte effizient zu lesen; sie haben Schwierigkeiten
5-Schritt-Lesemethode nach H. Klippert 1994 (SQ3R-Lesemethode nach F. P. Robinson 1946) Schülerinnen und Schüler verfügen oft nicht über die Fähigkeit, Sachtexte effizient zu lesen; sie haben Schwierigkeiten
Studienseminar Koblenz
 Studienseminar Koblenz Teildienststelle Altenkirchen Sachtexte im Unterricht einsetzen Tobias Merkel-Piontek Aufgabe 1 - Think - Reflektieren Sie: Welchen Sachtext habe ich zuletzt im Unterricht eingesetzt?
Studienseminar Koblenz Teildienststelle Altenkirchen Sachtexte im Unterricht einsetzen Tobias Merkel-Piontek Aufgabe 1 - Think - Reflektieren Sie: Welchen Sachtext habe ich zuletzt im Unterricht eingesetzt?
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Inhalte erschließen und wiedergeben - Lesen mit der 5-Schritt- Methode
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Inhalte erschließen und wiedergeben - Lesen mit der 5-Schritt- Methode Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Inhalte erschließen und wiedergeben - Lesen mit der 5-Schritt- Methode Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von
Studienseminar Koblenz
 Studienseminar Koblenz Ein Beispiel zum Fünf-Phasen-Schema: Der Otto-Motor (erschienen in: Naturwissenschaften im Unterricht Physik, 5(2006), S. 28-31) Josef Leisen Was ist das Fünf-Phasen-Schema? Stand:
Studienseminar Koblenz Ein Beispiel zum Fünf-Phasen-Schema: Der Otto-Motor (erschienen in: Naturwissenschaften im Unterricht Physik, 5(2006), S. 28-31) Josef Leisen Was ist das Fünf-Phasen-Schema? Stand:
Trainingsteil Aktives Lesen
 Trainingsteil Aktives Lesen TRAININGSTEIL AKTIVES LESEN... 1 WILLKOMMEN BEIM TRAININGSTEIL FÜR DAS AKTIVE LESEN!... 2 SURVEY... 3 QUESTION... 4 READ... 5 PAUSE... 6 RECITE... 7 REVIEW... 8 HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH...
Trainingsteil Aktives Lesen TRAININGSTEIL AKTIVES LESEN... 1 WILLKOMMEN BEIM TRAININGSTEIL FÜR DAS AKTIVE LESEN!... 2 SURVEY... 3 QUESTION... 4 READ... 5 PAUSE... 6 RECITE... 7 REVIEW... 8 HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH...
1 Begegnen. 2 Bearbeiten. 3 Verarbeiten. 4 Überprüfen. Vier Schritte beim Lesen von Sachtexten
 Vier Schritte beim Lesen von Sachtexten Grundsätzliches Ziel: Relevante Information aus Texten gewinnen Ziel 1: Sich im Textangebot orientieren, Textangebot situieren 1 Begegnen Text(e) überfliegen, Überblick
Vier Schritte beim Lesen von Sachtexten Grundsätzliches Ziel: Relevante Information aus Texten gewinnen Ziel 1: Sich im Textangebot orientieren, Textangebot situieren 1 Begegnen Text(e) überfliegen, Überblick
INF 3611 Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens
 INF 3611 Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens Andreas Kämper Winter 2010/2011 11. Lesen und Lernen 3 Wiederholung Umgang mit wiss. Literatur Elaboration Aktive Auseinandersetzung mit Text: Wechsel von
INF 3611 Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens Andreas Kämper Winter 2010/2011 11. Lesen und Lernen 3 Wiederholung Umgang mit wiss. Literatur Elaboration Aktive Auseinandersetzung mit Text: Wechsel von
Proseminar Informationsmanagement SS Übersicht. Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. 6. Mai 2014
 6. Mai 2014 Proseminar Informationsmanagement SS 2014 Dipl. Kff. Jutta Rottenwallner, MBA Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1 Organisatorisches 2 Wissenschaftliche Texte lesen, verstehen, verarbeiten
6. Mai 2014 Proseminar Informationsmanagement SS 2014 Dipl. Kff. Jutta Rottenwallner, MBA Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1 Organisatorisches 2 Wissenschaftliche Texte lesen, verstehen, verarbeiten
Wähle interessante Texte oder Textteile aus. Ich wähle interessant erscheinende Texte (Textteile) aus.
 Beobachtungsfächer: Leseschritt 1 Ziel: Sich im Text orientieren Begegnen 1 Formuliere eigene Fragen an den Text (die Texte). Ich stelle Fragen an den Text. Was interessiert mich an diesem Thema? Welche
Beobachtungsfächer: Leseschritt 1 Ziel: Sich im Text orientieren Begegnen 1 Formuliere eigene Fragen an den Text (die Texte). Ich stelle Fragen an den Text. Was interessiert mich an diesem Thema? Welche
TYPISCHE MERKMALE VON FACHTEXTEN 10. Was macht das Verstehen von Fachtexten so schwierig? 10 Was ist für Lernende an dieser Aufgabe schwierig?
 Inhaltsverzeichnis 1 TYPISCHE MERKMALE VON FACHTEXTEN 10 Was macht das Verstehen von Fachtexten so schwierig? 10 Was ist für Lernende an dieser Aufgabe schwierig? 10 Stolpersteine auf der Wortebene 11
Inhaltsverzeichnis 1 TYPISCHE MERKMALE VON FACHTEXTEN 10 Was macht das Verstehen von Fachtexten so schwierig? 10 Was ist für Lernende an dieser Aufgabe schwierig? 10 Stolpersteine auf der Wortebene 11
12 Leseverstehen I. Gliederung
 Studienseminar Koblenz 12 Leseverstehen I Wie fördere ich den Umgang mit informativen Sachtexten? Gliederung 1. Einzelarbeit: Lesen eines Textes aus einer Lehrprobe im eigenen Fach 2. Plenum: Austausch
Studienseminar Koblenz 12 Leseverstehen I Wie fördere ich den Umgang mit informativen Sachtexten? Gliederung 1. Einzelarbeit: Lesen eines Textes aus einer Lehrprobe im eigenen Fach 2. Plenum: Austausch
INF 3611. Grundlagen wissenschaftlichen. 11. Lesen und Lernen 3. Winter 2010/2011
 INF 3611 Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens Andreas Kämper Winter 2010/2011 11. Lesen und Lernen 3 Wiederholung Umgang mit wiss. Literatur Elaboration Aktive ki Auseinandersetzung mit Text: Wechsel
INF 3611 Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens Andreas Kämper Winter 2010/2011 11. Lesen und Lernen 3 Wiederholung Umgang mit wiss. Literatur Elaboration Aktive ki Auseinandersetzung mit Text: Wechsel
Voransicht. Inhalte erschließen und wiedergeben Lesen mit der 5-Schritt-Methode
 Sachtexte und Medien Beitrag 14 5-Schritt-(Lese-)Methode 1 von 24 Inhalte erschließen und wiedergeben Lesen mit der 5-Schritt-Methode Von Uli Nater, München Vielen Schülern fällt es schwer, Texte zu verstehen
Sachtexte und Medien Beitrag 14 5-Schritt-(Lese-)Methode 1 von 24 Inhalte erschließen und wiedergeben Lesen mit der 5-Schritt-Methode Von Uli Nater, München Vielen Schülern fällt es schwer, Texte zu verstehen
ProLesen in NRW. 1 Lesestrategien. 1. Merkmale eines Textes erkennen 2. Gedanken zum Thema machen
 1 Lesestrategien I Auf den Text blicken 1. Merkmale eines Textes erkennen 2. Gedanken zum Thema machen II Verstehen und Bearbeiten 3. Textprobleme erkennen 4. Abschnitte einteilen und benennen 5. Wichtiges
1 Lesestrategien I Auf den Text blicken 1. Merkmale eines Textes erkennen 2. Gedanken zum Thema machen II Verstehen und Bearbeiten 3. Textprobleme erkennen 4. Abschnitte einteilen und benennen 5. Wichtiges
Lesekompetenz. Lesen in allen Fächern. 1. Einleitung
 1. Einleitung Als Lehrer / Lehrerin eines naturwissenschaftlichen Faches gehe ich eigentlich davon aus, dass meine SchülerInnen, zumindest in der Sekundarstufe II, lesen können, in dem Sinn, dass sie in
1. Einleitung Als Lehrer / Lehrerin eines naturwissenschaftlichen Faches gehe ich eigentlich davon aus, dass meine SchülerInnen, zumindest in der Sekundarstufe II, lesen können, in dem Sinn, dass sie in
Fonds für Unterrichts- und Schulentwicklung (IMST-Fonds)
 Fonds für Unterrichts- und Schulentwicklung (IMST-Fonds) S8 Deutsch MÖGLICHKEITEN DER BETREUUNG UND FÖRDERUNG LEGASTHENER SCHÜLER/INNEN IM DEUTSCHUNTERRICHT IM RAHMEN DER WIENER MITTELSCHULE UNTER BESONDERER
Fonds für Unterrichts- und Schulentwicklung (IMST-Fonds) S8 Deutsch MÖGLICHKEITEN DER BETREUUNG UND FÖRDERUNG LEGASTHENER SCHÜLER/INNEN IM DEUTSCHUNTERRICHT IM RAHMEN DER WIENER MITTELSCHULE UNTER BESONDERER
Studienseminar Koblenz. Leseverstehen: Lesestrategien - Zum Umgang mit Sachtexten im Unterricht.
 Studienseminar Koblenz Leseverstehen: Lesestrategien - Zum Umgang mit Sachtexten im Unterricht www.leseverstehen.de Lesestrategien für Sachtexte Eine Lesestrategie ist ein Handlungsplan, um einen Text
Studienseminar Koblenz Leseverstehen: Lesestrategien - Zum Umgang mit Sachtexten im Unterricht www.leseverstehen.de Lesestrategien für Sachtexte Eine Lesestrategie ist ein Handlungsplan, um einen Text
Entdecke deine Stadt! Sachtexte mit Lesestrategien erschließen (Klasse 5/6) Reihe 37 S 1. Verlauf Material LEK Glossar Mediothek.
 Reihe 37 S 1 Verlauf Material LEK Glossar Mediothek Entdecke deine Stadt! Sachtexte mit Lesestrategien erschließen Hansjörg Droll, Freiburg Illustrationen: Oliver Wetterauer, Stuttgart Voransicht Entdecke
Reihe 37 S 1 Verlauf Material LEK Glossar Mediothek Entdecke deine Stadt! Sachtexte mit Lesestrategien erschließen Hansjörg Droll, Freiburg Illustrationen: Oliver Wetterauer, Stuttgart Voransicht Entdecke
Lesestrategien an der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
 Lesestrategien an der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Das Trainingsprogramm Wir werden Lesedetektive von Katja Rühl und Elmar Souvignier Bearbeitet von Naile Hanoglu 1. Auflage 2015. Taschenbuch.
Lesestrategien an der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Das Trainingsprogramm Wir werden Lesedetektive von Katja Rühl und Elmar Souvignier Bearbeitet von Naile Hanoglu 1. Auflage 2015. Taschenbuch.
Kl von. Klasse: Schule:
 Kl. 57 von Klasse: Schule: Seite 1 Liebe Schülerin, lieber Schüler, dies ist dein persönliches Lesetagebuch. Es eignet sich gut für die Arbeit mit Sachtexten. Du entscheidest selbst, welchen Sachtext du
Kl. 57 von Klasse: Schule: Seite 1 Liebe Schülerin, lieber Schüler, dies ist dein persönliches Lesetagebuch. Es eignet sich gut für die Arbeit mit Sachtexten. Du entscheidest selbst, welchen Sachtext du
ANLEITUNGEN. für die Bearbeitung der Aufgaben der Sprachprüfung (DSH) LEKTORAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE Georg-August-Universität Göttingen
 LEKTORAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE Georg-August-Universität Göttingen ANLEITUNGEN für die Bearbeitung der Aufgaben der Sprachprüfung (DSH) (September 2013) Hörverständnis Verstehen und Verarbeiten eines
LEKTORAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE Georg-August-Universität Göttingen ANLEITUNGEN für die Bearbeitung der Aufgaben der Sprachprüfung (DSH) (September 2013) Hörverständnis Verstehen und Verarbeiten eines
LERNSTRATEGIEN & ARBEITSTECHNIKEN IM STUDIUM. Dipl. Päd. Felix Wagner Ulm, 06. September 2017
 LERNSTRATEGIEN & ARBEITSTECHNIKEN IM STUDIUM Dipl. Päd. Felix Wagner Ulm, 06. September 2017 HERAUSFORDERUNGEN IM STUDIUM Neue und komplexe Inhalte Kurze Zeit zum Lernen Selbstverantwortung für das Lernen
LERNSTRATEGIEN & ARBEITSTECHNIKEN IM STUDIUM Dipl. Päd. Felix Wagner Ulm, 06. September 2017 HERAUSFORDERUNGEN IM STUDIUM Neue und komplexe Inhalte Kurze Zeit zum Lernen Selbstverantwortung für das Lernen
Lerntipps für den Start ins Studium
 Dipl.-Päd. Thorsten Junge LG Bildungstheorie & Medienpädagogik Themen des Vortrags: - Arbeitsumfeld - Zeitplanung - Arbeitsschritte - Verständnisprobleme bewältigen - Motivation Arbeitsumfeld Schaffen
Dipl.-Päd. Thorsten Junge LG Bildungstheorie & Medienpädagogik Themen des Vortrags: - Arbeitsumfeld - Zeitplanung - Arbeitsschritte - Verständnisprobleme bewältigen - Motivation Arbeitsumfeld Schaffen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: "Tschick" von Wolfgang Herrndorf - Lesetagebuch für die Klassen 7-10
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Tschick" von Wolfgang Herrndorf - Lesetagebuch für die Klassen 7-10 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Tschick" von Wolfgang Herrndorf - Lesetagebuch für die Klassen 7-10 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel:
ANLEITUNGEN. für die Bearbeitung der Aufgaben der Sprachprüfung (DSH) LEKTORAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE Georg-August-Universität Göttingen
 LEKTORAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE Georg-August-Universität Göttingen ANLEITUNGEN für die Bearbeitung der Aufgaben der Sprachprüfung (DSH) (Februar 2017) Hörverstehen Verstehen und Verarbeiten eines Hörtextes
LEKTORAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE Georg-August-Universität Göttingen ANLEITUNGEN für die Bearbeitung der Aufgaben der Sprachprüfung (DSH) (Februar 2017) Hörverstehen Verstehen und Verarbeiten eines Hörtextes
DIE DIR SOFORT MEHR ZEIT BRINGEN!
 MEINE 3 LESETIPPS, DIE DIR SOFORT MEHR ZEIT BRINGEN! 1. Ziele & Motivation beim Lesen Studien haben gezeigt, dass das persönliche Engagement beim Lesen direkt mit der Leseleistung korreliert. Eigeninitiative
MEINE 3 LESETIPPS, DIE DIR SOFORT MEHR ZEIT BRINGEN! 1. Ziele & Motivation beim Lesen Studien haben gezeigt, dass das persönliche Engagement beim Lesen direkt mit der Leseleistung korreliert. Eigeninitiative
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Sachtextanalyse - Stationenlernen. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Sachtextanalyse - Stationenlernen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Stationenlernen: Sachtexte Bestellnummer:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Sachtextanalyse - Stationenlernen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Stationenlernen: Sachtexte Bestellnummer:
Umgang mit wissenschaftlicher Literatur
 Department of Computer Science, Institute for Software and Multimedia -Technology Umgang mit wissenschaftlicher Literatur von Joachim Stary/Horst Kretschmer Birgit Grammel Dresden, 4.02.2010 Motivation
Department of Computer Science, Institute for Software and Multimedia -Technology Umgang mit wissenschaftlicher Literatur von Joachim Stary/Horst Kretschmer Birgit Grammel Dresden, 4.02.2010 Motivation
Campusweite Schreibwerkstatt. Lesestrategien
 Einstieg Recherche Studie/Analyse Rohfassung Überarbeitung Lesestrategien Campusweite Schreibwerkstatt Lesen als Arbeitsphase wird oft unterschätzt. Ohne strategische Herangehensweisen fällt es jedoch
Einstieg Recherche Studie/Analyse Rohfassung Überarbeitung Lesestrategien Campusweite Schreibwerkstatt Lesen als Arbeitsphase wird oft unterschätzt. Ohne strategische Herangehensweisen fällt es jedoch
Hinweise zu schriftlichen Seminar- und Zulassungsarbeiten
 FAKULTÄT FÜR SPRACH-, LITERATUR- UND KULTURWISSENSCHAFTEN Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Prof. Dr. Anita Schilcher Hinweise zu schriftlichen Seminar- und Zulassungsarbeiten
FAKULTÄT FÜR SPRACH-, LITERATUR- UND KULTURWISSENSCHAFTEN Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Prof. Dr. Anita Schilcher Hinweise zu schriftlichen Seminar- und Zulassungsarbeiten
LeseNavigator Sachtexte verstehen mit Lesestrategien. Profi-Set für:
 LeseNavigator Sachtexte verstehen mit Lesestrategien Profi-Set für: Vor dem Lesen 1 Erwartungen an den Text formulieren Verschaffe dir einen ersten Überblick über den Text. Sieh dir dazu die Überschrift,
LeseNavigator Sachtexte verstehen mit Lesestrategien Profi-Set für: Vor dem Lesen 1 Erwartungen an den Text formulieren Verschaffe dir einen ersten Überblick über den Text. Sieh dir dazu die Überschrift,
Leitfaden Grundlagenkurs: Lesen und Exzerpieren
 ISEK Ethnologie Leitfaden Grundlagenkurs: Lesen und Exzerpieren Das Lesen und Bearbeiten von wissenschaftlichen Texten ist zentraler Bestandteil des Studiums. Daher gehören Lesetechniken zu den wichtigsten
ISEK Ethnologie Leitfaden Grundlagenkurs: Lesen und Exzerpieren Das Lesen und Bearbeiten von wissenschaftlichen Texten ist zentraler Bestandteil des Studiums. Daher gehören Lesetechniken zu den wichtigsten
Studienseminar Koblenz
 Studienseminar Koblenz Allgemeines Seminar Stand: 29.9.2006 Ein Text Zehn Strategien der Texterschließung Einleitung Der Wunsch nach einer universellen Lesestrategie für alle Texte kann nicht erfüllt werden.
Studienseminar Koblenz Allgemeines Seminar Stand: 29.9.2006 Ein Text Zehn Strategien der Texterschließung Einleitung Der Wunsch nach einer universellen Lesestrategie für alle Texte kann nicht erfüllt werden.
7 So bewältigen Sie die Informationsflut 8 Keine Zeit mehr zum Lesen? 12 Das Ziel des Trainingsprogramms
 4 Inhalt 6 Vorwort 7 So bewältigen Sie die Informationsflut 8 Keine Zeit mehr zum Lesen? 12 Das Ziel des Trainingsprogramms 15 Ermitteln Sie Ihre Lesegeschwindigkeit 16 Wie schnell lesen Sie wie viel behalten
4 Inhalt 6 Vorwort 7 So bewältigen Sie die Informationsflut 8 Keine Zeit mehr zum Lesen? 12 Das Ziel des Trainingsprogramms 15 Ermitteln Sie Ihre Lesegeschwindigkeit 16 Wie schnell lesen Sie wie viel behalten
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Susan Beth Pfeffer "Die Welt, wie wir sie kannten"
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Susan Beth Pfeffer "Die Welt, wie wir sie kannten" Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von 30 Die Welt, wie
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Susan Beth Pfeffer "Die Welt, wie wir sie kannten" Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von 30 Die Welt, wie
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Globalisation - global challenges: Unterrichtsplanung für Grundkurs und Leistungskurs Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Globalisation - global challenges: Unterrichtsplanung für Grundkurs und Leistungskurs Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernen lernen - Gut sein durch richtige Lerntechniken
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernen lernen - Gut sein durch richtige Lerntechniken Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 1. Vorwort Bestimmt
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernen lernen - Gut sein durch richtige Lerntechniken Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 1. Vorwort Bestimmt
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: "Andorra" von Max Frisch - Lesetagebuch Klasse 7-10
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Andorra" von Max Frisch - Lesetagebuch Klasse 7-10 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Lesebegleitende
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Andorra" von Max Frisch - Lesetagebuch Klasse 7-10 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Lesebegleitende
Diplomanten- Konversatorium SS 2004 LV-Leiter: Dr. Marion Rauner b y D o m i n i k P. M a t y k a
 Diplomanten- Konversatorium SS 2004 LV-Leiter: Dr. Marion Rauner Kreatives Schreiben von Lutz von Werder Schaffen von Schreibstimuli für wissenschaftliches Schreiben durch kreative Lese-Techniken: FREEWRITING-Lesen
Diplomanten- Konversatorium SS 2004 LV-Leiter: Dr. Marion Rauner Kreatives Schreiben von Lutz von Werder Schaffen von Schreibstimuli für wissenschaftliches Schreiben durch kreative Lese-Techniken: FREEWRITING-Lesen
Lernen kann man lernen!
 Informationsgeheft für Eltern und Schüler: Lernen kann man lernen! Grundlegendes aus der Wissenschaft: Diese Leistungskurve zeigt, zu welchen Tageszeiten der Körper am leistungsfähigsten und somit auch
Informationsgeheft für Eltern und Schüler: Lernen kann man lernen! Grundlegendes aus der Wissenschaft: Diese Leistungskurve zeigt, zu welchen Tageszeiten der Körper am leistungsfähigsten und somit auch
Aufträge für eine Projektarbeit
 Auftrag 1 Aufträge für eine Projektarbeit Ideensammlung a. Überlege dir 2 4 interessante Themen. Falls du bereits ein Thema hast, machst du bei Punkt c weiter. b. Schreibe jedes Thema auf einen separaten
Auftrag 1 Aufträge für eine Projektarbeit Ideensammlung a. Überlege dir 2 4 interessante Themen. Falls du bereits ein Thema hast, machst du bei Punkt c weiter. b. Schreibe jedes Thema auf einen separaten
(Übersicht) Suchendes Lesen (=selegierendes Lesen, selektives Lesen) Sortierendes Lesen (=orientierendes Lesen)
 DIDAKTIK DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE UNTERLAGEN ZUM SEMINAR THEMA: FERTIGKEIT LESEN Seminarleiterin: Ana Margarida Abrantes Universidade Católica Portuguesa Centro Regional das Beiras Inglês/Alemão LESEZIELE
DIDAKTIK DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE UNTERLAGEN ZUM SEMINAR THEMA: FERTIGKEIT LESEN Seminarleiterin: Ana Margarida Abrantes Universidade Católica Portuguesa Centro Regional das Beiras Inglês/Alemão LESEZIELE
Thesen zum Lesen und Einführung des LeseNavigators. Initiative zur Lesekompetenzförderung in der Sekundarstufe I
 Thesen zum Lesen und Einführung des LeseNavigators Initiative zur Lesekompetenzförderung in der Sekundarstufe I Werkstatt-Tage am 5.1. und 11.1.2010 Lesen bedeutet Verstehen Lesekompetenz heißt mehr als
Thesen zum Lesen und Einführung des LeseNavigators Initiative zur Lesekompetenzförderung in der Sekundarstufe I Werkstatt-Tage am 5.1. und 11.1.2010 Lesen bedeutet Verstehen Lesekompetenz heißt mehr als
Die Inhaltsangabe im Deutschunterricht der gymnasialen Mittelstufe in Theorie und Unterrichtspraxis
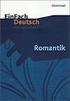 Germanistik Rebecca Mahnkopf Die Inhaltsangabe im Deutschunterricht der gymnasialen Mittelstufe in Theorie und Unterrichtspraxis Formen modernen Aufsatzunterrichts (Sprachdidaktik) Studienarbeit Hauptseminar:
Germanistik Rebecca Mahnkopf Die Inhaltsangabe im Deutschunterricht der gymnasialen Mittelstufe in Theorie und Unterrichtspraxis Formen modernen Aufsatzunterrichts (Sprachdidaktik) Studienarbeit Hauptseminar:
Kommunikation für Beruf und Praxis Zusammenfassung - Management Summary (MS)
 Kontextmodul 2 Kommunikation für Beruf und Praxis Zusammenfassung - Management Summary (MS) Handout «Management Summary» (Apparat) Dr. Othmar Baeriswyl Dozent T direkt +41 41 349 35 44 othmar.baeriswyl@hslu.ch
Kontextmodul 2 Kommunikation für Beruf und Praxis Zusammenfassung - Management Summary (MS) Handout «Management Summary» (Apparat) Dr. Othmar Baeriswyl Dozent T direkt +41 41 349 35 44 othmar.baeriswyl@hslu.ch
Förderung des Lese- und Verstehensprozesses von Texten im Fachunterricht
 Förderung des Lese- und Verstehensprozesses von Texten im Fachunterricht Das Lesen von Texten im Fachunterricht soll das fachliche Lernen unterstützen und fördern. Diese Selbstverständlichkeit für Fachlehrkräfte
Förderung des Lese- und Verstehensprozesses von Texten im Fachunterricht Das Lesen von Texten im Fachunterricht soll das fachliche Lernen unterstützen und fördern. Diese Selbstverständlichkeit für Fachlehrkräfte
Didaktisierte Lesetexte was ist das?
 NW EDK netzwerk sims Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen Didaktisierte Lesetexte was ist das? Claudia Neugebauer Menschen lesen ganz unterschiedlich, je nachdem, was für einen Text sie gerade vor
NW EDK netzwerk sims Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen Didaktisierte Lesetexte was ist das? Claudia Neugebauer Menschen lesen ganz unterschiedlich, je nachdem, was für einen Text sie gerade vor
Die schnelle und sinnvolle Bearbeitung wissenschaftlicher Texte. B. Reysen-Kostudis
 Die schnelle und sinnvolle Bearbeitung wissenschaftlicher Texte Analyse des eigenen Leseverhaltens Wie lese ich? Wie möchte/sollte ich lesen? das 4-Phasen-Modell Ablauf des Leseprozesses Übungen/Training
Die schnelle und sinnvolle Bearbeitung wissenschaftlicher Texte Analyse des eigenen Leseverhaltens Wie lese ich? Wie möchte/sollte ich lesen? das 4-Phasen-Modell Ablauf des Leseprozesses Übungen/Training
VWA-Curriculum: Ziele der 1. Klassen
 VWA-Curriculum: Ziele der 1. Klassen Ich präsentiere mich und meine Interessen. Ich kenne verschiedene Lernmethoden und wende sie an. Ich kann in eine Lernplattform einsteigen und einfache Arbeitsaufträge
VWA-Curriculum: Ziele der 1. Klassen Ich präsentiere mich und meine Interessen. Ich kenne verschiedene Lernmethoden und wende sie an. Ich kann in eine Lernplattform einsteigen und einfache Arbeitsaufträge
Lesetechniken Dr. Z. Shi Wiss. Arbeiten
 Lesetechniken 09.11.2016 Dr. Z. Shi Wiss. Arbeiten Tree of Knowledge 1. Vorbereitung 1. Leseziel bestimmen 2. Überblick verschaffen 3. Fragen 4. Planen 2. Das eigentliche Lesen 1. Kursorisches Lesen 2.
Lesetechniken 09.11.2016 Dr. Z. Shi Wiss. Arbeiten Tree of Knowledge 1. Vorbereitung 1. Leseziel bestimmen 2. Überblick verschaffen 3. Fragen 4. Planen 2. Das eigentliche Lesen 1. Kursorisches Lesen 2.
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Gliedern, verfassen, vortragen (Berufsschule)
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Gliedern, verfassen, vortragen (Berufsschule) Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de II Schriftlich kommunizieren
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Gliedern, verfassen, vortragen (Berufsschule) Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de II Schriftlich kommunizieren
CAMPUSWEITE SCHREIBWERKSTATT
 1 Lesestrategien Lesen als Arbeitsphase wird oft unterschätzt. Ohne strategische Herangehensweisen fällt es jedoch schwer, sich in der Menge gelesener Informationen zu orientieren und diese strukturiert
1 Lesestrategien Lesen als Arbeitsphase wird oft unterschätzt. Ohne strategische Herangehensweisen fällt es jedoch schwer, sich in der Menge gelesener Informationen zu orientieren und diese strukturiert
LERNE LERNEN MIT Verteiltem Lernen LERNE ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM
 Verteiltem Lernen LERNE ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM Fange früh mit der Vorbereitung für Prüfungen an und nimm dir jeden Tag ein wenig Zeit. Fünf Stunden auf zwei Wochen verteilt sind besser als fünf Stunden
Verteiltem Lernen LERNE ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM Fange früh mit der Vorbereitung für Prüfungen an und nimm dir jeden Tag ein wenig Zeit. Fünf Stunden auf zwei Wochen verteilt sind besser als fünf Stunden
I. Hinweise für alle Leseaufgaben
 ZU DEN LESEAUFGABEN / WERKZEUGE ZUM STRATEGISCHEN LESEN I. Hinweise für alle Leseaufgaben Flüssiges Lesen und Textverstehen Erst wenn ein Text flüssig (d. h. automatisiert, genau, ausreichend schnell und
ZU DEN LESEAUFGABEN / WERKZEUGE ZUM STRATEGISCHEN LESEN I. Hinweise für alle Leseaufgaben Flüssiges Lesen und Textverstehen Erst wenn ein Text flüssig (d. h. automatisiert, genau, ausreichend schnell und
Rekursive Folgen. für GeoGebraCAS. 1 Überblick. Zusammenfassung. Kurzinformation. Letzte Änderung: 07. März 2010
 Rekursive Folgen für GeoGebraCAS Letzte Änderung: 07. März 2010 1 Überblick Zusammenfassung Innerhalb von zwei Unterrichtseinheiten sollen die Schüler/innen vier Arbeitsblätter mit GeoGebra erstellen,
Rekursive Folgen für GeoGebraCAS Letzte Änderung: 07. März 2010 1 Überblick Zusammenfassung Innerhalb von zwei Unterrichtseinheiten sollen die Schüler/innen vier Arbeitsblätter mit GeoGebra erstellen,
Verlauf Material LEK Glossar Mediothek. Erwachsen werden, erwachsen sein Texte mit der 5-Schritt-Lesemethode erarbeiten.
 Reihe 30 S 1 Verlauf Material LEK Glossar Mediothek Erwachsen werden, erwachsen sein Texte mit der 5-Schritt-Lesemethode erarbeiten Petra Schappert, Stuttgart Die erste Liebe eine der schönen Seiten des
Reihe 30 S 1 Verlauf Material LEK Glossar Mediothek Erwachsen werden, erwachsen sein Texte mit der 5-Schritt-Lesemethode erarbeiten Petra Schappert, Stuttgart Die erste Liebe eine der schönen Seiten des
Lernplan (Förder-/ Forderplan)
 Lernplan (Förder-/ Forderplan) Ablauf: Vorbereitung 1. Klassenlehrkraft erstellt einen Zeitplan für die Beteiligten. 2. Klassenlehrkraft verteilt Unterlagen (s. Anhang) an die Lehrkräfte, die den Schüler
Lernplan (Förder-/ Forderplan) Ablauf: Vorbereitung 1. Klassenlehrkraft erstellt einen Zeitplan für die Beteiligten. 2. Klassenlehrkraft verteilt Unterlagen (s. Anhang) an die Lehrkräfte, die den Schüler
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Referate halten im Unterricht. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Bestellnummer: 59017 Kurzvorstellung: Ein Referat zu gestalten und
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Bestellnummer: 59017 Kurzvorstellung: Ein Referat zu gestalten und
MEINE 3 DIE DIR SOFORT MEHR ZEIT BRINGEN!
 MEINE 3 LESETIPPS, DIE DIR SOFORT MEHR ZEIT BRINGEN! WWW.PETRALEHNER.COM #1 Ziel & Motivation Studien haben gezeigt, dass das Engagement beim Lesen direkt mit der Leseleistung korreliert. Eigeninitiative
MEINE 3 LESETIPPS, DIE DIR SOFORT MEHR ZEIT BRINGEN! WWW.PETRALEHNER.COM #1 Ziel & Motivation Studien haben gezeigt, dass das Engagement beim Lesen direkt mit der Leseleistung korreliert. Eigeninitiative
Strategisch-operative Werkzeuge im Leseprozess Beispiele für Strategien und Verfahren der Schulung
 Strategisch-operative Werkzeuge im Leseprozess Beispiele für Strategien und Verfahren der Schulung Elaborative Strategien das thematische Wissen auflisten / skizzieren hypothetisieren Beispiele für etwas
Strategisch-operative Werkzeuge im Leseprozess Beispiele für Strategien und Verfahren der Schulung Elaborative Strategien das thematische Wissen auflisten / skizzieren hypothetisieren Beispiele für etwas
Mit argumentierenden Texten arbeiten
 Studienseminar Koblenz Mit argumentierenden Texten arbeiten Wahlmodul 332 Themen des Wahlmoduls Thesen zur Sache und zur Didaktik Info und Übungen: Lernprodukte erstellen Info: Lernprodukte diskursiv abrufen
Studienseminar Koblenz Mit argumentierenden Texten arbeiten Wahlmodul 332 Themen des Wahlmoduls Thesen zur Sache und zur Didaktik Info und Übungen: Lernprodukte erstellen Info: Lernprodukte diskursiv abrufen
Formatvorgaben für die Ausarbeitung
 Formatvorgaben für die Ausarbeitung - Ihre Ausarbeitung sollte 7-10 Seiten (exklusive Titelblatt, Inhaltsverzeichnis und Literaturverzeichnis) umfassen. - Der Rand sollte beidseitig ca. 2,5 cm betragen.
Formatvorgaben für die Ausarbeitung - Ihre Ausarbeitung sollte 7-10 Seiten (exklusive Titelblatt, Inhaltsverzeichnis und Literaturverzeichnis) umfassen. - Der Rand sollte beidseitig ca. 2,5 cm betragen.
Textübernahme aus: Schneller lesen-besserverstehen Autor: Wolfgang Schmitz, rororo
 Textübernahme aus: Schneller lesen-besserverstehen Autor: Wolfgang Schmitz, rororo Überblick: 1. Skimming (Kernaussagen sammeln) 2. Absatzspringen (Kerngedanken erfassen) 3. Scanning (bestimmte Fakten
Textübernahme aus: Schneller lesen-besserverstehen Autor: Wolfgang Schmitz, rororo Überblick: 1. Skimming (Kernaussagen sammeln) 2. Absatzspringen (Kerngedanken erfassen) 3. Scanning (bestimmte Fakten
Rezension zu Helsper/Krüger: Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft
 Pädagogik Christian Hochmuth Rezension zu Helsper/Krüger: Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft Rezension / Literaturbericht Technische Universität Dresden Fakultät Erziehungswissenschaften
Pädagogik Christian Hochmuth Rezension zu Helsper/Krüger: Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft Rezension / Literaturbericht Technische Universität Dresden Fakultät Erziehungswissenschaften
Projekte zur Mediengestaltung
 X.media.press Projekte zur Mediengestaltung Briefing, Projektmanagement, Making of Bearbeitet von Joachim Böhringer, Peter Bühler, Patrick Schlaich 1. Auflage 2003. Buch. xv, 641 S. ISBN 978 3 540 44092
X.media.press Projekte zur Mediengestaltung Briefing, Projektmanagement, Making of Bearbeitet von Joachim Böhringer, Peter Bühler, Patrick Schlaich 1. Auflage 2003. Buch. xv, 641 S. ISBN 978 3 540 44092
weiterdenken. Projekt LiT Lesen im Tandem Kick Off Veranstaltungen - Luzern Sursee Schüpfheim
 1 Projekt LiT Lesen im Tandem Kick Off Veranstaltungen - Luzern 13.03. - Sursee 17.03. - Schüpfheim 18.03. 2 LiT SNF Projekt 2014 bis 2016 17 Schulen/Orte ca. 70 LP 2. Klasse Ziel: ca. 90 Tandems 3 A.
1 Projekt LiT Lesen im Tandem Kick Off Veranstaltungen - Luzern 13.03. - Sursee 17.03. - Schüpfheim 18.03. 2 LiT SNF Projekt 2014 bis 2016 17 Schulen/Orte ca. 70 LP 2. Klasse Ziel: ca. 90 Tandems 3 A.
Vorbereitung einer Reflexion der Testdurchführung. am Beispiel von Lesen der Vergleichsarbeiten 2012 und 2013
 Vorbereitung einer Reflexion der Testdurchführung am Beispiel von Lesen der Vergleichsarbeiten 2012 und 2013 1 Inhalte des Modul 3 Bildungsstandards und Lehrplan Deutsch - NRW Reflexion der Testdurchführung
Vorbereitung einer Reflexion der Testdurchführung am Beispiel von Lesen der Vergleichsarbeiten 2012 und 2013 1 Inhalte des Modul 3 Bildungsstandards und Lehrplan Deutsch - NRW Reflexion der Testdurchführung
Die ASR geht neue Wege in der Vermittlung von Lesekompetenz
 Die ASR geht neue Wege in der Vermittlung von Lesekompetenz Einmal in der Woche kann man an der ASR für 45 Minuten in den Klassenzimmern der Jahrgangsstufe fünf und sechs beinahe die Stecknadel fallen
Die ASR geht neue Wege in der Vermittlung von Lesekompetenz Einmal in der Woche kann man an der ASR für 45 Minuten in den Klassenzimmern der Jahrgangsstufe fünf und sechs beinahe die Stecknadel fallen
Texte rezipieren. Leseverstehen. Lernausgangslage
 Synopse_Leseverstehen_GY_1.doc Seite 1 von 7 Texte rezipieren Texte zu rezipieren verlangt spezifische Strategien der Rezeption. Als Hörer, Zuschauer und Leser kann der Schüler aus gesprochenen und geschriebenen
Synopse_Leseverstehen_GY_1.doc Seite 1 von 7 Texte rezipieren Texte zu rezipieren verlangt spezifische Strategien der Rezeption. Als Hörer, Zuschauer und Leser kann der Schüler aus gesprochenen und geschriebenen
Strukturvorschläge für wissenschaftliche Arbeiten
 Strukturvorschläge für wissenschaftliche Arbeiten Aufbau allgemein Aufbau nach Ausrichtung Quantitative Studie Qualitative Studie Literaturstudie Forschungsgestützte Entwicklungsarbeit Sie verwenden mit
Strukturvorschläge für wissenschaftliche Arbeiten Aufbau allgemein Aufbau nach Ausrichtung Quantitative Studie Qualitative Studie Literaturstudie Forschungsgestützte Entwicklungsarbeit Sie verwenden mit
Auswertung der Zentralen Klassenarbeiten Deutsch im Schuljahrgang 6 am Gymnasium sowie am Gymnasialzweig der KGS des Schuljahres 2007/2008
 Auswertung der Zentralen Klassenarbeiten Deutsch im Schuljahrgang 6 am Gymnasium sowie am Gymnasialzweig der KGS des Schuljahres 2007/2008 0 Vorbemerkungen Mit der Auswertung der ZKA Deutsch Schuljahrgang
Auswertung der Zentralen Klassenarbeiten Deutsch im Schuljahrgang 6 am Gymnasium sowie am Gymnasialzweig der KGS des Schuljahres 2007/2008 0 Vorbemerkungen Mit der Auswertung der ZKA Deutsch Schuljahrgang
Studienseminar Koblenz
 Allgemeines Seminar Studienseminar Koblenz Umgang mit Sachtexten im Unterricht Textkategorien Für den Umgang mit Texten im Unterricht ist folgende Kategorisierung hilfreich:? Umgang mit pragmatischen Texten
Allgemeines Seminar Studienseminar Koblenz Umgang mit Sachtexten im Unterricht Textkategorien Für den Umgang mit Texten im Unterricht ist folgende Kategorisierung hilfreich:? Umgang mit pragmatischen Texten
Zehn Lesestrategien am Beispiel des Textes zum Karpfen
 Prof. Josef Leisen Prof. Josef Leisen Zehn Lesestrategien am Beispiel des Textes zum Karpfen Vortragsfolien zum Handbuch Fortbildung: Sprachbildung im sprachsensiblen Fachunterricht www.download.sprachsensiblerfachunterricht.de
Prof. Josef Leisen Prof. Josef Leisen Zehn Lesestrategien am Beispiel des Textes zum Karpfen Vortragsfolien zum Handbuch Fortbildung: Sprachbildung im sprachsensiblen Fachunterricht www.download.sprachsensiblerfachunterricht.de
Methoden- und Evaluationskonzept
 Methoden- und Evaluationskonzept Grundschule Steindorf-Albshausen 1. Allgemeiner Teil 2. Methoden 3. Evaluation und deren Auswertung 4. Quellenangaben 5. Anhang Stand: Juni 2016 1 1. Allgemeiner Teil Wichtig
Methoden- und Evaluationskonzept Grundschule Steindorf-Albshausen 1. Allgemeiner Teil 2. Methoden 3. Evaluation und deren Auswertung 4. Quellenangaben 5. Anhang Stand: Juni 2016 1 1. Allgemeiner Teil Wichtig
(Modulbild: 2011 Getty Images / Cathy Yeulet Bild-Nr )
 Modulbeschreibung Schulart: Fächer: Zielgruppe: Autor: Zeitumfang: Grundschule Deutsch (GS); Fächerverbund Mensch, Natur und Kultur (GS) 4 (GS) Siegfried Koch Zehn Stunden Die Schülerinnen und Schüler
Modulbeschreibung Schulart: Fächer: Zielgruppe: Autor: Zeitumfang: Grundschule Deutsch (GS); Fächerverbund Mensch, Natur und Kultur (GS) 4 (GS) Siegfried Koch Zehn Stunden Die Schülerinnen und Schüler
KOLLOQUIUM FÜR BACHELORARBEITEN Der Weg zur ersten wissenschaftlichen Arbeit
 KOLLOQUIUM FÜR BACHELORARBEITEN Der Weg zur ersten wissenschaftlichen Arbeit BLOCK 1: THEORIE Teil A Herangehensweise, Aufbau und Inhalte 14. Juni 2013 FAKULTÄT BZW. TITEL Name WIE SOLL ICH DAS NUR SCHAFFEN?
KOLLOQUIUM FÜR BACHELORARBEITEN Der Weg zur ersten wissenschaftlichen Arbeit BLOCK 1: THEORIE Teil A Herangehensweise, Aufbau und Inhalte 14. Juni 2013 FAKULTÄT BZW. TITEL Name WIE SOLL ICH DAS NUR SCHAFFEN?
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Inhaltsangaben, Stellungnahmen, private Geschäftsbriefe - Übungen zur Prüfungsvorbereitung Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Inhaltsangaben, Stellungnahmen, private Geschäftsbriefe - Übungen zur Prüfungsvorbereitung Das komplette Material finden Sie hier:
Die zum Text Warum starben die Dinosaurier aus?
 1 Warum starben die Dinosaurier aus? Unterrichtsfach Deutsch & Biologie (fächerübergreifend) Themenbereich/e Fünf Theorien, warum die Dinosaurier ausstarben. Schulstufe (Klasse) 7 (3. Klasse) Fachliche
1 Warum starben die Dinosaurier aus? Unterrichtsfach Deutsch & Biologie (fächerübergreifend) Themenbereich/e Fünf Theorien, warum die Dinosaurier ausstarben. Schulstufe (Klasse) 7 (3. Klasse) Fachliche
ZEITMANAGEMENT UND BETREUUNG DER ARBEIT
 ZEITMANAGEMENT UND BETREUUNG DER ARBEIT 1 Betreuer als Ansprechpartner KONTAKT BETREUER / STUDENT Besprechung und Einweisung in die Aufgabenstellung Student arbeitet sich ein (Literatur, Kontaktstellen,
ZEITMANAGEMENT UND BETREUUNG DER ARBEIT 1 Betreuer als Ansprechpartner KONTAKT BETREUER / STUDENT Besprechung und Einweisung in die Aufgabenstellung Student arbeitet sich ein (Literatur, Kontaktstellen,
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: "Löcher" von Louis Sachar - Lesetagebuch für die Klassen 7-10
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Löcher" von Louis Sachar - Lesetagebuch für die Klassen 7-10 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Löcher" von Louis Sachar - Lesetagebuch für die Klassen 7-10 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe:
Prozessbegleitung. «Optimierung der Personalressourcen» Praxishandbuch: «Ist-Analyse SWOT-Analyse» Idee. Sie lösen aus.
 Prozessbegleitung «Optimierung der Personalressourcen» Praxishandbuch: «Ist-Analyse SWOT-Analyse» Idee. Sie lösen aus. IdeeTransfer IdeeTransferBox / Optimierung der Personalressourcen Hinweise & Anleitung
Prozessbegleitung «Optimierung der Personalressourcen» Praxishandbuch: «Ist-Analyse SWOT-Analyse» Idee. Sie lösen aus. IdeeTransfer IdeeTransferBox / Optimierung der Personalressourcen Hinweise & Anleitung
Portfolio Aufbau deines Portfolios
 Aufbau deines Portfolios Deckblatt Wie du weißt, ist der erste Eindruck oft der wichtigste. Deshalb solltest du dir schon bei dem Deckblatt deines Portfolios große Mühe geben. Wähle ein passendes Titelmotiv
Aufbau deines Portfolios Deckblatt Wie du weißt, ist der erste Eindruck oft der wichtigste. Deshalb solltest du dir schon bei dem Deckblatt deines Portfolios große Mühe geben. Wähle ein passendes Titelmotiv
Schulinterne Umsetzung des Kernlehrplans Deutsch, Jgst. 7 (G9) am Gymnasium Lohmar
 1 Schulinterne Umsetzung des Kernlehrplans Deutsch, Jgst. 7 (G9) am Gymnasium Lohmar eingeführtes Lehrwerk: Deutschbuch (Cornelsen) Jahrgangsstufe 7 Unterrichtsvorhaben 1 Thema: Balladen Kapitel im Lehrbuch:
1 Schulinterne Umsetzung des Kernlehrplans Deutsch, Jgst. 7 (G9) am Gymnasium Lohmar eingeführtes Lehrwerk: Deutschbuch (Cornelsen) Jahrgangsstufe 7 Unterrichtsvorhaben 1 Thema: Balladen Kapitel im Lehrbuch:
MEINE ABSCHLUSSARBEIT
 MEINE ABSCHLUSSARBEIT Content Guideline Dr. Solmaz Alevifard IMPRESSUM Herausgeber ALEVIFARD COACHING Dr. Solmaz Alevifard www.alevifard.com 6. April 2017 Seite 2! von! 9 INHALT 1. Das Inhaltsverzeichnis
MEINE ABSCHLUSSARBEIT Content Guideline Dr. Solmaz Alevifard IMPRESSUM Herausgeber ALEVIFARD COACHING Dr. Solmaz Alevifard www.alevifard.com 6. April 2017 Seite 2! von! 9 INHALT 1. Das Inhaltsverzeichnis
Richtlinien und Hinweise für. Seminararbeiten
 Richtlinien und Hinweise für Seminararbeiten Lehrstuhl für VWL (Wirtschaftspolitik, insbes. Industrieökonomik) Ökonomie der Informationsgesellschaft Prof. Dr. Peter Welzel Gliederung Die folgenden Richtlinien
Richtlinien und Hinweise für Seminararbeiten Lehrstuhl für VWL (Wirtschaftspolitik, insbes. Industrieökonomik) Ökonomie der Informationsgesellschaft Prof. Dr. Peter Welzel Gliederung Die folgenden Richtlinien
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Sprachverfall durch soziale Medien? Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Materialgestütztes Schreiben (S II) S1 Verlauf Material LEK Glossar Mediothek
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Materialgestütztes Schreiben (S II) S1 Verlauf Material LEK Glossar Mediothek
Lesecurriculum der Erich Kästner Grundschule Cottbus
 Zusammenarbeit mit allen Fächern Grundsätze: Lesecurriculum der Erich Kästner Grundschule Cottbus (Beschluss der Fachkonferenz vom 18.02.2013) 1. Der Deutschunterricht allein kann die heute geforderten
Zusammenarbeit mit allen Fächern Grundsätze: Lesecurriculum der Erich Kästner Grundschule Cottbus (Beschluss der Fachkonferenz vom 18.02.2013) 1. Der Deutschunterricht allein kann die heute geforderten
Vorgehensweise bei der Erstellung. von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten)
 Leuphana Universität Lüneburg Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen Abt. Rechnungswesen und Steuerlehre Vorgehensweise bei der Erstellung von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten) I. Arbeitsschritte
Leuphana Universität Lüneburg Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen Abt. Rechnungswesen und Steuerlehre Vorgehensweise bei der Erstellung von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten) I. Arbeitsschritte
Orientierendes/Überfliegendes/Globales Lesen EXPRESS-Strategie
 Methodik-Didaktik DaF Präsentationsphase - Texterschliessung Leseverstehen Die Fertigkeiten im FSU Das Lernziel Traditionelle Auffassung Alles muss verstanden werden Unbekannte Wörter müssen übersetzt
Methodik-Didaktik DaF Präsentationsphase - Texterschliessung Leseverstehen Die Fertigkeiten im FSU Das Lernziel Traditionelle Auffassung Alles muss verstanden werden Unbekannte Wörter müssen übersetzt
Inhalte von Lernkontrollen: Kognitive Standards
 Allgemeine Didaktik: Prüfen, Beurteilen, Bewerten Frühjahrssemester 2015 Prof. Dr. Franz Eberle Inhalte von Lernkontrollen: Kognitive Standards Ergänzende Materialien zu den Folien der Vorlesung 1 Eine
Allgemeine Didaktik: Prüfen, Beurteilen, Bewerten Frühjahrssemester 2015 Prof. Dr. Franz Eberle Inhalte von Lernkontrollen: Kognitive Standards Ergänzende Materialien zu den Folien der Vorlesung 1 Eine
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Stationenlernen: Die Götter der griechischen Mythologie
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen: Die Götter der griechischen Mythologie Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Bestellnummer:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen: Die Götter der griechischen Mythologie Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Bestellnummer:
Proseminar Wissenschaftliches Arbeiten. Sabrina Strang Florian Zimmermann
 Proseminar Wissenschaftliches Arbeiten Sabrina Strang Florian Zimmermann Überblick Ziel: Selbständig eine wissenschaftliche Arbeit erstellen und präsentieren Aufbau: 1. Einführung in das wissenschaftliche
Proseminar Wissenschaftliches Arbeiten Sabrina Strang Florian Zimmermann Überblick Ziel: Selbständig eine wissenschaftliche Arbeit erstellen und präsentieren Aufbau: 1. Einführung in das wissenschaftliche
Bachelorarbeit. Was ist zu tun?
 Bachelorarbeit Was ist zu tun? Titelseite Zusammenfassung/Summary Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Einleitung Material und Methoden Ergebnisse Diskussion Ausblick Literaturverzeichnis Danksagung
Bachelorarbeit Was ist zu tun? Titelseite Zusammenfassung/Summary Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Einleitung Material und Methoden Ergebnisse Diskussion Ausblick Literaturverzeichnis Danksagung
Selbstgesteuertes Lernen lehren:
 Dr. Dagmar Killus, Gertrud Graf Selbstgesteuertes Lernen lehren: Konzepte, empirische Befunde und Unterrichtsbeispiele 26. Pädagogische Woche (Oldenburg) 23. September 2009 Dagmar.killus@gmx.de Gliederung
Dr. Dagmar Killus, Gertrud Graf Selbstgesteuertes Lernen lehren: Konzepte, empirische Befunde und Unterrichtsbeispiele 26. Pädagogische Woche (Oldenburg) 23. September 2009 Dagmar.killus@gmx.de Gliederung
Wie hole ich mir Information? Warum funktioniert der Nürnberger Trichter eigentlich nicht?
 Warum funktioniert der Nürnberger Trichter eigentlich nicht? weil unser Gehirn ständig zwischen Wichtig und Unwichtig unterscheidet und Informationen filtert. Diese Filterung ist wichtig, um Gestalten,
Warum funktioniert der Nürnberger Trichter eigentlich nicht? weil unser Gehirn ständig zwischen Wichtig und Unwichtig unterscheidet und Informationen filtert. Diese Filterung ist wichtig, um Gestalten,
Studienseminar Koblenz
 Studienseminar Koblenz Zehn Lesestrategien für das intensive Lesen von Sachtexten Eine Lesestrategie ist ein Handlungsplan, der hilft, einen Text gut zu verstehen. Lesestrategien zielen auf einen eigenständigen
Studienseminar Koblenz Zehn Lesestrategien für das intensive Lesen von Sachtexten Eine Lesestrategie ist ein Handlungsplan, der hilft, einen Text gut zu verstehen. Lesestrategien zielen auf einen eigenständigen
Didaktisierte Lesetexte was ist das?
 NW EDK netzwerk sims Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen www.netzwerk-sims.ch Didaktisierte Lesetexte was ist das? Claudia Neugebauer Menschen lesen ganz unterschiedlich, je nachdem, was für einen
NW EDK netzwerk sims Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen www.netzwerk-sims.ch Didaktisierte Lesetexte was ist das? Claudia Neugebauer Menschen lesen ganz unterschiedlich, je nachdem, was für einen
Aufbau der Klausur Controlling 2
 Aufbau der Klausur Controlling 2 Erster Teil der Klausur Bearbeitungsdauer 60 Minuten (d. h. 60 Punkte) Genau ein Thema aus mehreren Themen ist zu beantworten Es sind Zusammenhänge problemorientiert zu
Aufbau der Klausur Controlling 2 Erster Teil der Klausur Bearbeitungsdauer 60 Minuten (d. h. 60 Punkte) Genau ein Thema aus mehreren Themen ist zu beantworten Es sind Zusammenhänge problemorientiert zu
Die Schülerinnen orientieren sich in Zeitungen.
 Schulinternes Curriculum der Ursulinenschule Hersel im Fach Deutsch Jahrgang 8 Übersicht über Unterrichtsvorhaben, Obligatorik und Klassenarbeiten Unterrichtsvorhaben Obligatorik Klassenarbeit Kurzreferate
Schulinternes Curriculum der Ursulinenschule Hersel im Fach Deutsch Jahrgang 8 Übersicht über Unterrichtsvorhaben, Obligatorik und Klassenarbeiten Unterrichtsvorhaben Obligatorik Klassenarbeit Kurzreferate
