Boeger, Annette; Dörfler, Tobias; Schut-Ansteeg, Thomas Erlebnispädagogik mit Jugendlichen: Einflüsse auf Symptombelastung und Selbstwert
|
|
|
- Jasmin Schuster
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Boeger, Annette; Dörfler, Tobias; Schut-Ansteeg, Thomas Erlebnispädagogik mit Jugendlichen: Einflüsse auf Symptombelastung und Selbstwert Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 55 (2006) 3, S urn:nbn:de:0111-opus-9696 Erstveröffentlichung bei: Nutzungsbedingungen pedocs gewährt ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. Die Nutzung stellt keine Übertragung des Eigentumsrechts an diesem Dokument dar und gilt vorbehaltlich der folgenden Einschränkungen: Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder anderweitig nutzen. Mit dem Gebrauch von pedocs und der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an. Kontakt: pedocs Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) Informationszentrum (IZ) Bildung Schloßstr. 29, D Frankfurt am Main Internet:
2 Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie Ergebnisse aus Psychoanalyse, Psychologie und Familientherapie Jahrgang Herausgeberinnen und Herausgeber Manfred Cierpka, Heidelberg Ulrike Lehmkuhl, Berlin Albert Lenz, Paderborn Inge Seiffge-Krenke, Mainz Annette Streeck-Fischer, Göttingen Verantwortliche Herausgeberinnen Ulrike Lehmkuhl, Berlin Annette Streeck-Fischer, Göttingen 30 Redakteur Günter Presting, Göttingen Verlag Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen Verlag: Vandenhoeck & Ruprecht P-Nr.: B Pfad/Job: W:\V- R\PK\2006\Register\PK_55_2006_Register.fm P-Anfang: P-Aktuell: ID: int01; int03 AGB Printjob: , 12:20 Seite I von I
3 Erlebnispädagogik mit Jugendlichen: Einflüsse auf Symptombelastung und Selbstwert Annette Boeger, Tobias Dörfler und Thomas Schut-Ansteeg Summary Project adventure with adolescents: Influence on psychopathology and self-esteem In the following study the influence of project adventure on the sense of self-image and psychosocial state of adolescents of the 7th grade were studied (N = 122). A pre-post study design was chosen involving control group with three time points of evaluation. For the group of intervention school physical education was replaced by project adventure for a period of six months. The control students attended physical education as usual. The intervention group was compared with the control group using two methods of testing (Frankfurter Selbstkonzeptskalen by Deusinger, Fragebogen für Jugendliche by Döpfner). After the project the intervention group reached higher values in some areas of self-esteem. Regarding the psycho-social areas of aggression, depression/fear and social problems these students scored lower than students of the control group. Overall differences related to gender were found in the self-esteem ratings. Genderdifferences on the effect of the intervention were reflected by the scale of psycho-social symptoms. These first observations that youths are positively influenced by participation in project adventure in the areas evaluated should be validated through further comprehensive studies. Key words: project adventure in adolescence psycho-social adjustment self-esteem gender differences Zusammenfassung In vorliegender Studie wurde der Einfluss einer erlebnispädagogischen Intervention auf das Selbstwertgefühl und auf die psycho-soziale Befindlichkeit von Jugendlichen der 7. Klasse (Gesamtstichprobe N = 122) untersucht. Hierzu wurde ein Prä-post- Kontrollgruppendesign mit drei Messzeitpunkten gewählt. Die Interventionsstichprobe nahm an einem sechsmonatigen erlebnispädagogischen Projekt (project adventure) teil, welches anstelle des Sportunterrichts stattfand. Für die Kontrollstichprobe änderte sich nichts, sie hatte wie gewohnt Sportunterricht. Ein Vergleich der Interventionsstichprobe mit der Kontrollstichprobe hinsichtlich zweier Testverfahren (Frankfurter Selbstkonzeptskalen von Deusinger, YSR von Döpfner) ergab, dass die Untersuchungsstichprobe nach der Intervention höhere Werte auf einigen Dimensionen der Selbstwertskala aufwies. Bezüglich der psychosozialen Dimensionen Aggression, Depression/Angst und soziale Probleme gaben sie niedrigere Werte an als die Kontrollstichprobe. Langzeiteffekte konnten festgestellt Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 55: (2006), ISSN Vandenhoeck & Ruprecht 2006
4 182 A. Boeger et al.: Erlebnispädagogik mit Jugendlichen werden. Bezüglich des gemessenen Selbstkonzepts zeigten sich generelle Geschlechtsunterschiede im Sinne eines verminderten Selbstwertgefühls bei den weiblichen Jugendlichen mit Ausnahme der Skala Kontaktfähigkeit, auf der die männlichen Jugendlichen niedrigere Werte aufwiesen. Weiterhin zeigte sich eine geschlechtsspezifisch unterschiedliche Wirkung der Intervention bei der Symptombelastung. Diese ersten Hinweise, dass jugendliche Teilnehmer/innen erlebnispädagogischer Projekte positive Auswirkungen in den untersuchten Bereichen erleben, sollte durch weitere umfassendere Studien validiert werden. Schlagwörter: Erlebnispädagogik mit Jugendlichen Selbstwert Symptombelastung geschlechtsspezifische Unterschiede 1 Einleitung Gegenwärtig existiert eine Vielzahl von überwiegend schulischen Programmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, Kinder und Jugendliche bei der psychischen Bewältigung vielfältiger Belastungen einer komplexen Lebensumwelt zu unterstützen. Die meisten Programme beanspruchen implizit oder explizit einen primärpräventiven Ansatz, indem sie Lebenskompetenzen und interne Ressourcen stärken möchten, welche helfen sollen, durch Krisensituationen hervorgerufene Belastungen abzupuffern. Einen Überblick über präventive Maßnahmen im Kindes- und Jugendalter, welche die Bereiche Stress, Gesundheit, Suchtprävention, Sexualerziehung und Ernährung umfassen, findet sich bei Roth et al. (2003, S. 404 ff.). Insbesondere bei den Maßnahmen zur Verhinderung jugendlichen Problemverhaltens haben sich gegenwärtig Programme durchgesetzt, die weniger substanz- oder gesundheitsspezifisch arbeiten, als vielmehr darauf basieren, neben der Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber sozialem Einfluss die allgemeine Lebenskompetenz zu stärken (Botvin 1998). Als protektive Lebenskompetenz-Merkmale sind der Selbstwert, soziale Kompetenzen, Selbstwirksamkeitserwartungen und eine niedrige psychische Symptombelastung zu nennen (vgl. Schwarzer 1996). Die gegenwärtig verstärkten Bemühungen, diese Programme zu evaluieren, haben bis jetzt zu unterschiedlichen, nicht immer eindeutigen Ergebnissen geführt. 1.1 Erlebnispädagogik als life-skill -Förderung: Definition und Anwendungsgebiete Eine eigenständige, pädagogisch-psychologische Methode einer life-skill -Förderung (Botvin 1998) stellt die aus der Reformpädagogik entstandene Erlebnispädagogik dar, die für sich beansprucht, eine persönlichkeitsbildende Förderung zu initiieren: Selbstvertrauen und Selbststeuerung sollen gesteigert (Koch 1994; Nasser 1994) und personale sowie soziale Ressourcen stimuliert werden (eine ausführliche Darstellung des aus der Reformpädagogik von Kurt Hahn entwickelten Ansatzes findet sich bei Ziegenspeck, 2001). Ziegenspeck (1986, S. 12; 2001) begreift Erlebnispädagogik sehr allgemein im Sinne Kurt Hahns als das sinnliche Erfahren der Umwelt mit körperlicher und emotionaler Beteiligung; insoweit stellt sie eine sinnvolle Ergänzung
5 A. Boeger et al.: Erlebnispädagogik mit Jugendlichen 183 tradierter Erziehungs- und Bildungseinrichtungen dar (Ziegenspeck 2001). Den Aspekt der Methode betonen auch Heckmair und Michl, wenn sie Erlebnispädagogik beschreiben als handlungsorientierte Methode, die durch exemplarische Lernprozesse, in denen junge Menschen vor physische, psychische und soziale Herausforderungen gestellt werden, diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und sie dazu befähigen will, ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten (1998, S. 22). Von diesen breiten Definitionen, die Erlebnispädagogik in erster Linie als Methode ansehen, welche eine Vielzahl von Aktivitäten, Aufgaben und Aktivitäten umfasst, die wiederum zu verhaltensändernden, erzieherischen und persönlichkeitsbildenden Ergebnissen führen (vgl. auch Rehm 1996a), gehen viele Untersuchungen zur Erlebnispädagogik explizit oder implizit aus. Wichtige Kriterien sind die Affektbezogenheit des Erlebnisses, die Ganzheitlichkeit des Lernens, die Auseinandersetzung mit sich selbst und der Umwelt sowie die Aspekte der Selbstüberwindung und Herausforderung. Einen zentralen Stellenwert bei der Theorie der Wirkungsweise von Erlebnispädagogik nimmt das Konzept des Transfers ein. Besonders Heckmair und Michl (1998, S. 24) gehen davon aus, dass die durch Lernprozesse initiierten Erfahrungen durch einen Transferprozess aktiv in den Alltag der Teilnehmer/innen mitgenommen werden müssen, um dort Anwendung zu finden: Die neu gelernten Verhaltensweisen sollen möglichst dauerhaft in das eigene Repertoire aufgenommen und auf Alltagssituationen generalisiert werden (Reiners 1995, S. 599). Während die klassische Erlebnispädagogik in der Natur stattfindet und dort die typischen Anwendungsgebiete alpine Klettertouren, Hochgebirgswanderungen, Skikurse und Kajakfahrten sind (Nikolai 1992; Klawe u. Bräuer 1998b), zeigen neuere Entwicklungen in Deutschland die vermehrte Anwendung von Erlebnispädagogik auch indoor, nämlich z. B. in Turnhallen (z. B. Feierabend et al. 1999; Gilsdorf u. Volkert 1999). Für diesen Bereich hat sich der Begriff des project adventure durchgesetzt. Dieses project adventure findet z. B. im Rahmen des für eine bestimmte Zeit ausgesetzten Sportunterrichts statt. Project adventure wird bereits seit Anfang der 70er Jahre in den USA durchgeführt. Evaluationen, die im Wesentlichen auf Selbstkonzeptänderungen fokussierten, wiesen gute Ergebnisse auf, so dass das project adventure heutzutage ein weit verbreitetes Medium in nordamerikanischen Schulen darstellt (Nasser 1994; Schempp 1998, S. 23). 1.2 Anwendungsfelder der Erlebnispädagogik Während in der Literatur als vier wesentliche Einsatzbereiche der Erlebnispädagogik der Freizeitbereich, die Erziehung, die Entwicklungsförderung und der therapeutische Bereich angegeben werden (Dolatschek 2002, S. 84), liegt nach Koch (1994) der Schwerpunkt der Erlebnispädagogik seit ihrer Wiederentdeckung Anfang der 1970er Jahre eindeutig auf dem therapeutischen Bereich, nämlich im Bereich der Jugendhilfe, wo sie bei der Förderung sozial randständiger Jugendlicher eingesetzt wird. Erlebnispädagogische Maßnahmen können im Rahmen der ambulanten Hilfe zur Erziehung nach 35 KJHG als intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung eingeleitet werden. Hier stellen sie eine Alternative zur geschlossenen Unterbringung so genannter randständiger, schwererziehbarer und/oder delinquenter Jugendlicher dar, bei denen alle Maßnahmen versagt haben.
6 184 A. Boeger et al.: Erlebnispädagogik mit Jugendlichen Wenn auch die Erlebnispädagogik mehr und mehr für normale Schulkinder entdeckt wird (Gilsdorf u. Volkert 1999; Feierabend et al. 1999), so stellt doch die Zielgruppe der delinquenten Jugendlichen nach wie vor die größte Gruppe sowohl generell als auch der Problemjugendlichen dar, bei denen man positive Veränderungen durch Erlebnispädagogik erhofft (z. B. Knorr 2001). Vereinzelt lassen sich jedoch auch Untersuchungen an anderen Zielgruppen finden, wie etwa an jugendlichen Diabetikern (Dolatschek 2002) und adipösen Jugendlichen (Salzmann 1999). 1.3 Welche life skills sollen im Einzelnen mit Erlebnispädagogik erreicht werden? In der Fachliteratur findet sich eine Vielzahl von Zielvorstellungen wie Stärkung des Selbstwertgefühls, Kanalisierung von Aggressionen und Steigerung der Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft (vgl. Eberle 2002, S. 172; Klawe u. Bräuer 1998a, 1998b; Nasser 1994; Schermeir 2001; Schleske 1998; Rothig 2001; Vernooij 1999), die insgesamt als personale und interpersonale Fähigkeiten auch unter dem Begriff emotionale bzw. soziale Kompetenz subsumiert werden können (vgl. v. Salisch 2002, S. 31 ff.). In dem Konzept zur emotionalen bzw. sozialen Kompetenz werden sie als die so genannten Schlüsselkompetenzen der Persönlichkeitsentwicklung bezeichnet (Schleske 1998). Kann Erlebnispädagogik diese anspruchsvollen Ziele und Erwartungen einlösen? 1.4 Evaluation von Erlebnispädagogik Im Gegensatz zum deutschsprachigen Raum werden in den USA und Australien schon seit vielen Jahren Evaluationsstudien zur Erlebnispädagogik ( outdoor ) durchgeführt (vgl. die Übersichten von Rehm 1996b, 1996c, 1999, S. 154 ff.; Nasser 1994). Zahlreiche Evaluationsstudien an delinquenten Jugendlichen zeigen insbesondere Veränderungen im Bereich des Sozialverhaltens, aber auch in Bezug auf die Persönlichkeit: Verringerung der Aggressionsbereitschaft, Steigerung der Frustrationstoleranz und Steigerung der Beziehungsfähigkeit (vgl. Crain 1998; Wolters 1994; Kiehn 1998; Nickolai 1992). Als Kriterium gilt meist die Rückfallquote. Die Ergebnisse sind unterschiedlich, häufig sind positive Kurzzeiteffekte feststellbar, die aber nach Beendigung der Maßnahme und Rückkehr in die alte Umgebung wieder verschwinden (Amesberger 1992). Oft fehlen aber auch Langzeitbeobachtungen. Weiterhin befasst sich eine Reihe von Untersuchungen mit Veränderungen im Selbstkonzept, die ebenfalls positive Effekte ausmachen konnten (z. B. Gillett et al. 1991; Marsh et al. 1984; Marsh et al. 1986; Marsh u. Richards 1988; im deutsprachigen Raum: Eberle 2002). Eine der wenigen Evaluationsstudien an indoor -Projekten (project adventure) führte Schempp (1998, 2000) an Hauptschülern durch. Auch sie konnte positive Veränderungen im Selbstkonzept feststellen. Die überwiegend positiven Ergebnisse sind umso bemerkenswerter, als dass in den verschiedenen Untersuchungen unterschiedliche Messverfahren benutzt wurden, die Dauer der jeweiligen Intervention unterschiedlich war sowie die Interventionen inhaltlich nicht immer vergleichbar waren. Cason und Gillis (1994), die eine Metaanalyse von Effektivitätsuntersuchungen zu outdoor -Maßnahmen vornahmen, kommen zu der Schlussfolgerung, dass die Er-
7 A. Boeger et al.: Erlebnispädagogik mit Jugendlichen 185 gebnisse zu Selbstkonzeptverbesserungen zwar nicht ganz konsistent sind, im Vergleich zu gemessenen Veränderungen in anderen Persönlichkeitsvariablen wie etwa Depression, ausagierendem Verhalten oder Kausalattribution relativ eindeutig sind. 2 Fragestellung und Hypothesen Festgestellt werden kann, dass kaum Evaluationsstudien zur Erlebnispädagogik im schulischen Kontext existieren, obschon diese zunehmend durchgeführt werden (vgl. Gilsdorf u. Volkert 1999; Feierabend et al. 1999). Vorliegende Pilotstudie hat deshalb zum Ziel, mögliche Effekte einer erlebnispädagogischen Maßnahme auf Jugendliche zu untersuchen und zwar in den Bereichen Selbstwert und psychische Symptombelastung, da sich in der Literatur zahlreiche Hinweise finden lassen, dass gerade diese Bereiche änderungssensitiv auf erlebnispädagogische Maßnahmen reagieren. Eine erlebnispädagogische Aktivität schafft eine Lernsituation, in der durch eine handlungs- und erfahrungsorientierte Auseinandersetzung mit einem speziellen Thema neue Handlungsmuster im Wechselspiel von individueller Erfahrung und Rückmeldung der Gruppe ausprobiert werden können. Das Konzept der Erlebnispädagogik geht davon aus, dass das Selbstwertgefühl von Kindern und Jugendlichen besonders dann ansteigt, wenn sie ihre besonderen individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten erfolgreich zum Einsatz bringen können, wenn sie lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen, mit ihnen offen umzugehen und diese angemessen auszudrücken, und wenn sie lernen, selbständig zu entscheiden und für diese Entscheidung die Verantwortung zu übernehmen. Durch die im Anschluss an die Aktivität stattfindende Reflexionsphase setzt der Jugendliche sich mit seinen neu gemachten Erfahrungen, mit sich selbst und der Gruppe auseinander: Er reflektiert seine neu erlebten Kompetenzen in der Auseinandersetzung mit den soeben bewältigten Herausforderungen. Hierdurch festigen sich die gemachten Erfahrungen. Weiterhin interessierte uns, ob es differentielle Geschlechtseffekte gibt, wie manche Autoren vermuten, die davon ausgehen, dass Erlebnispädagogik mit seinen den Mut, die Risikofreudigkeit und den Abenteuersinn ansprechenden Aufgaben eher die Interessen männlicher Jugendlicher erfüllt (Rose 1993; Rose 1998; Dithmar 1992; Fromm 1998) und auch bei diesen größere Effekte erreicht. Das Erleben des Gemeinschaftsgefühls, die Abwesenheit von Konkurrenzdenken und -druck und insbesondere das Meistern physischer, psychischer und sozialer Herausforderungen sollten nicht nur den erlebten Selbstwert stärken, sondern sich auch positiv auf problematische Verhaltens- und Erlebensweisen auswirken, hier operationalisiert als eine verminderte Aggressionsbereitschaft und Depressionsbereitschaft sowie eine verringerte Wahrnehmung sozialer Probleme. 3 Durchführung der Untersuchung Der Untersuchung liegt ein quasi-experimentelles Längsschnittdesign mit drei Messzeitpunkten im schulischen Untersuchungsfeld zugrunde. In zwei 7. Schulklassen zweier Gesamtschulen in Essen erfolgte ein von ausgebildeten Erlebnispädago-
8 186 A. Boeger et al.: Erlebnispädagogik mit Jugendlichen ginnen und -pädagogen durchgeführtes project adventure für die Dauer eines halben Schuljahres ( bis ). Kontrollgruppen waren jeweils eine Parallelklasse an der jeweiligen Schule. Bei den Interventionsklassen wurde die Intervention (project adventure) im Rahmen und anstelle des Sportunterrichts durchgeführt. Es fand also im Untersuchungszeitraum kein Sportunterricht statt. Alle Eltern erklärten ihr Einverständnis. Zusätzlich zu dem zweistündigen project adventure, das in der jeweiligen Turnhalle an insgesamt 21 Terminen stattfand, wurden zwei Projekttage durchgeführt (Klettersteigbegehung in einem Kletterpark). Das Programm bestand aus fünf thematischen Blöcken (1. Block: Übungen und Spiele zum Aufwärmen und Kennenlernen, Übungen zum Körpergefühl; 2. Block: einfache Kooperationsaufgaben, Wettbewerbsspiele; 3. Block: Übungen zur Konzentration, zum Vertrauen in sich und andere, zum Körpergefühl; 4. Block: Klettertage: Grenzerfahrung; 5. Block: komplexe Kooperationsaufgaben). Jeder Block wurde mit einer Reflexionsphase abgeschlossen. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Übungen (Edelhoff 2004) kann bei den Autoren angefordert werden. Die Kontrollgruppe hatte weiterhin ihren gewohnten Sportunterricht. Zum Messzeitpunkt 1 vor Beginn der Intervention wurde die gesamte Stichprobe (Experimentalgruppe und Kontrollgruppe) im Rahmen der summativen Evaluation testpsychologisch untersucht (Prätest). Nach Beendigung der Intervention (Messzeitpunkt 2) fand der Posttest bei der Gesamtstichprobe statt. Messzeitpunkt 3 (Follow-up) wurde sechs Monate nach Beendigung der Intervention durchgeführt. Im Gegensatz zum Posttest, mit dem die kurzzeitige Wirkung der Intervention gemessen werden sollte, wurde die Follow-up-Testung zur Untersuchung von Langzeitwirkungen der Intervention eingesetzt. Während der Zeitdauer der Intervention wurde auch eine formative Evaluation durchgeführt: die Erlebnispädagoginnen und -pädagogen führten Stundenprotokolle über Art und Weise der Durchführung sowie über die Inhalte. Die testpsychologische Untersuchung fand jeweils in Anwesenheit von zwei Untersuchungsleitern und ohne die Lehrerinnen und Lehrern im Klassenverband statt und dauerte jeweils insgesamt zwei Schulstunden (zwei Termine zu jeweils einer Schulstunde). 3.1 Stichprobenbeschreibung Es nahmen insgesamt 122 Schülerinnen und Schüler an der Untersuchung teil. Davon waren 60 männlich und 62 weiblich. 65 Schülerinnen und Schüler nahmen am project adventure teil, 57 machten die Kontrollgruppe aus. Die Drop-out-Quote lag bei 10 % und war krankheits-, umzugs- oder versetzungsbedingt. Das Durchschnittsalter der Gesamtstichprobe betrug 14 Jahre. 74 % der Schüler/innen waren deutscher Herkunft. Die größte Gruppe der Nichtdeutschen waren Türken mit 7 %. Die überwiegende Anzahl der Probanden, nämlich 78 %, lebte mit ihren leiblichen Eltern zusammen. Bei 22 % der Jugendlichen waren die Eltern geschieden, sie lebten entweder bei der Mutter oder in einer neu zusammengesetzten Familie. 80 % der Jugendlichen hatten ein oder mehr Geschwister, 20 % waren Einzelkinder. Die Ein-
9 A. Boeger et al.: Erlebnispädagogik mit Jugendlichen 187 zugsbereiche der Schulen waren Wohngebiete mit hohem Arbeiteranteil. Demzufolge waren 38 % der Väter Handwerker und 12 % arbeitslos und wurden entsprechend der Unterschicht bzw. der unteren Mittelschicht zugerechnet. 24 % gehörten der mittleren und 26 % der oberen Mittelschicht an. Nur 12 % der Mütter waren ausschließlich Hausfrauen. Mittels Chi-Quadrat-Testung zeigte sich, dass sich die Maßnahmenstichprobe und die Kontrollstichprobe hinsichtlich Alter, Geschlecht und soziodemographischer Variablen nicht unterschieden. Die Gruppen wiesen also eine hinreichende Parallelität auf. 3.2 Erhebungsinstrumente Das Schülertestpaket umfasste mehrere Verfahren, die alle Selbstbeurteilungsverfahren sind und von denen folgende vorgestellt werden (vgl. Boeger u. Schut 2005): Schülerfragebogen: Der von uns entwickelte Fragebogen enthielt soziodemographische Fragen. Frankfurter Selbstkonzeptskalen (FSKN) von Deusinger (1986): Der FSKN erhebt den Anspruch, Selbstkonzepte multidimensional zu erfassen. Unter Selbstkonzepte werden Kognitionen, Emotionen und Verhalten des Individuums sich selbst gegenüber verstanden. (Deusinger 1986, S. 11). Als ein dynamisches System ist das Selbstkonzept zwar konsistent, aber durch das Erleben und Verarbeiten neuer Erfahrungen auch änderbar. Das Inventar besteht aus zehn Skalen mit insgesamt 78 Items, für die jeweils drei zustimmende oder drei ablehnende Antworten zur Auswahl stehen. Die zehn Skalen sind jeweils vier Bereichen zugeordnet. Leistungsbereich: Selbstkonzept der allgemeinen Leistungsfähigkeit, Selbstkonzept der allgemeinen Problembewältigung, Selbstkonzept der allgemeinen Verhaltens- und Entscheidungssicherheit; Allgemeine Selbstwertschätzung: Selbstkonzept des allgemeinen Selbstwertes; Stimmung und Sensibilität: Selbstkonzept der eigenen Empfindlichkeit und Gestimmtheit; Psychosozialer Bereich: Selbstkonzept der eigenen Standfestigkeit gegenüber Gruppen und bedeutsamen anderen, Selbstkonzept zur eigenen Kontakt- und Umgangsfähigkeit, Selbstkonzept zur Wertschätzung durch andere, Selbstkonzept zur Irritierbarkeit durch andere, Selbstkonzept über Gefühle und Beziehungen zu anderen. In vorliegender Untersuchung wurden alle Skalen außer der Skala Selbstkonzept des allgemeinen Selbstwertes angewandt. Deusinger hat zahlreiche Untersuchungen an großen Stichproben zur Validität und zur inneren Konsistenz durchgeführt. Je nach Stichprobe liegen die Konsistenzwerte (Cronbachs a) zwischen.94 und.68. Damit sind sie als gut bis zufriedenstellend zu bezeichnen (Deusinger 1986). Der Fragebogen für Jugendliche (YSR) von Döpfner et al. (1998): Der Fragebogen für Jugendliche ist eine deutsche Fassung des Youth-Self-Report der Child Behavior Checklist von Achenbach (Achenbach 1991). Der Test gehört zu den am häufigsten eingesetzten Selbstbeurteilungsverfahren zur Erfassung der psychischen Befindlichkeit
10 188 A. Boeger et al.: Erlebnispädagogik mit Jugendlichen Jugendlicher. Anhand einer dreistufigen Antwortskala (0 = nicht zutreffend, 1 = manchmal zutreffend, 2 = genau zutreffend) sollen insgesamt 103 Problemitems bezogen auf das Auftreten in den letzten drei Monaten beurteilt werden. Er wird im Wesentlichen bei nicht-klinischen Stichproben angewandt (Roth 2000). Der Fragebogen besteht aus acht Syndromskalen, die zu den übergeordneten Skalen Internalisierende Auffälligkeiten (Sozialer Rückzug, Körperliche Beschwerden, Depressiv/ängstlich), Externalisierende Auffälligkeiten (Dissoziales Verhalten, Aggressives Verhalten) und Gemischte Störungen (Soziale Probleme, Schizoid/zwanghaft, Soziale Probleme) zusammengefasst werden. Die Konsistenzen der Mehrzahl der Syndromskalen werden als hinreichend bezeichnet (Döpfner et al. 1998, S. 18). Anhand einer Untersuchung an einer klinischen Stichprobe wurden befriedigende (a =.56.88) bis gute (a =.86.91) Koeffizienten der inneren Konsistenz angegeben (vgl. Döpfner et al. 1994). In unserer Untersuchung wurden die drei Skalen Depressiv/ängstlich, Aggressives Verhalten und Soziale Probleme angewandt. Damit haben wir jeweils eine externalisierende, eine internalisierende und eine Verhaltensauffälligkeit aus dem Bereich der gemischten Störungen erfasst. 3.3 Statistische Verfahren Zur Beantwortung der Fragestellungen wurde ein varianzanalytisches Vorgehen gewählt. Dabei gingen zwei zweifach gestufte (messwiederholte) Subjektfaktoren, erstens project adventure (Interventionsstichprobe vs. Kontrollgruppe) und zweitens Geschlecht (männlich vs. weiblich), in die Berechnungen zu jeweils drei Erhebungszeitpunkten ein. Um die vorhandenen Ausgangsunterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen zu kontrollieren, wurden die Prätestergebnisse als Kovariate in die Analyse aufgenommen. Die Homogenität der Untersuchungsgruppen hinsichtlich demographischer Merkmale wurde durch einen Chi-Quadrat-Test nachgewiesen. Die statistisch bedeutsamen Mittelwertsunterschiede zwischen Kontroll- und Interventionsstichprobe konnten durch kleine bis mittlere Effektstärken (h 2 : 0,01 bis 0,08) untermauert werden. 4 Ergebnisse 4.1 Frankfurter Selbstkonzeptskalen (FSKN) Wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist, bestanden zu Beginn der Untersuchung keine bedeutsamen Unterschiede zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe. Nach Beendigung der project adventure Intervention zeigten sich in allen Skalen des Frankfurter Selbstkonzeptfragebogens signifikante Unterschiede zwischen beiden Gruppen in der Weise, dass die project adventure-stichprobe signifikant höhere Werte aufwies. Die Probanden schätzten also ihre allgemeine Leistungs- und Problemlösefähigkeit sowie ihre Sicherheit im Treffen von Entscheidungen als höher ein. Sie bewerteten sich als weniger irritierbar durch andere und als weniger empfindlich im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Die Probanden beurteilten sich also als weniger verletzlich, empfindlich und sensibel. Auch in der Kontakt- und Umgangsfähigkeit schätzten sie sich höher ein, neh-
11 A. Boeger et al.: Erlebnispädagogik mit Jugendlichen 189 men sich also als geschickter, sicherer und ungezwungener im Sozialkontakt mit anderen wahr. Ebenso waren die Einschätzungen der eigenen Standfestigkeit anderen gegenüber sowie die Standfestigkeit in sozialen Situationen signifikant stärker ausgeprägt. Die erlebte eigene Standfestigkeit nahm sogar nach der Maßnahme noch deutlich zu und unterschied sich auch nach einem halben Jahr noch bedeutsam von der Kontrollgruppe (Abb. 1). Tab. 1: Variablen des FSKN: Mittelwert (M), Standardabweichung (SD) sowie Kennwerte des varianzanalytischen Vergleichs zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe Prätest (1. Messzeitpunkt) Interventionsgruppe Kontrollgruppe Signifikanztest M SD M SD F p Allgemeine Leistungsfähigkeit 41,71 10,94 42,77 7,82 0,33.57 Allgemeine Problembewältigung 41,61 7,82 41,5 8,03 3,61.34 Verhaltens- und Entscheidungssicherheit 23,27 5,65 24,12 4,05 0,78.38 Empfindlichkeit 24,39 5,75 25,04 5,01 0,38.54 Standfestigkeit 49,61 10,97 47,42 9,85 1,18.28 Kontakt- und Umgangsfähigkeit 23,64 5,39 24,92 4,66 1,74.19 Wertschätzung 25,63 5,83 24,87 5,34 0,50.48 Irritierbarkeit durch andere 23,14 6,35 21,6 6,35 1,60.21 Gefühle und Beziehungen zu anderen 24,32 5,02 25,4 5,51 1,14.29 Posttest (2. Messzeitpunkt) Allgemeine Leistungsfähigkeit 34,13 7,24 31,33 7,64 3,82 <.05 Allgemeine Problembewältigung 32,89 7,69 29,94 8,36 3,61 <.05 Verhaltens- und Entscheidungssicherheit 20,25 5,17 17,52 5,05 7,69 <.05 Empfindlichkeit 21,7 5,16 19,31 5,18 5,75 <.05 Standfestigkeit 48,64 11,53 42,48 12,16 7,31 <.05 Kontakt- und Umgangsfähigkeit 19,61 5,20 17,77 5,00 3,49 <.05 Wertschätzung 22,43 5,18 20,29 5,47 4,36 <.05 Irritierbarkeit durch andere 24,88 6,24 21,00 6,73 9,64 <.05 Gefühle und Beziehungen zu anderen 23,73 5,74 21,80 5,84 2,62 <.05 Follow-up (3. Messzeitpunkt) Allgemeine Leistungsfähigkeit 33,87 5,80 33,37 7,84 0,09.77 Allgemeine Problembewältigung 30,77 6,16 30,82 8,21 0,00.98 Verhaltens- und Entscheidungssicherheit 18,19 5,83 19,45 5,49 0,84 <.05 Empfindlichkeit 21,87 5,22 21,68 5,54 0,02.89 Standfestigkeit 53,10 9,01 47,08 12,78 4,89 <.05 Kontakt- und Umgangsfähigkeit 19,35 4,18 19,16 5,38 0,03.87 Wertschätzung 23,26 5,47 22,82 6,21 0,10.76 Irritierbarkeit durch andere 24,81 5,47 22,76 6,17 2,07 <.05 Gefühle und Beziehungen zu anderen 24,39 4,72 22,79 5,43 1,66 <.05
12 190 A. Boeger et al.: Erlebnispädagogik mit Jugendlichen Mittelwerte Messzeitpunkte keine Maßnahme mit Maßnahme Abb. 1: Vergleich der Mittelwerte von Interventions- und Kontrollstichprobe in der Skala Standfestigkeit der FSKN Die vermutete Wertschätzung der eigenen Person durch andere war ebenfalls bedeutsam höher ausgeprägt. Gefühle und Beziehungen zu anderen wurden von der project adventure-gruppe ebenfalls als deutlich höher ausgeprägt empfunden als von der Kontrollgruppe, sowohl direkt nach der Maßnahme als auch ein halbes Jahr später, wenn auch die beiden letztgenannten Unterschiede statistisch nicht bedeutsam waren. 4.2 Fragebogen für Jugendliche (YSR) Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, unterscheiden sich die Probanden der Maßnahmenstichprobe von der Kontrollgruppe durch niedrigere Ausprägungen in den drei Skalen. Die Unterschiede waren direkt nach Abschluss der project adventure-maßnahme tendenziell signifikant, ein halbes Jahr später jedoch signifikant. Die unterschiedliche Entwicklung zwischen Interventionsstichprobe und Kontrollgruppe wird exemplarisch anhand der Abbildung 2 deutlich. Bei der Kontrollgruppe nahm die Einschätzung von Aggression und sozialen Problemen zum zweiten Messzeitpunkt deutlich zu, um dann ein halbes Jahr später zwar wieder leicht abzusinken, aber nicht das Ausgangsniveau zu erreichen. Demgegenüber hielt sich bei der Interventionsstichprobe ein niedriges Ausgangsniveau über den gesamten Untersuchungszeitraum konstant. Depressive Verstimmungen und soziale Probleme nahmen aus der Sicht der Interventionsstichprobe deutlich ab.
13 A. Boeger et al.: Erlebnispädagogik mit Jugendlichen 191 Tab. 2: Variablen des YSR: Mittelwert (M), Standardabweichung (SD) sowie Kennwerte des varianzanalytischen Vergleichs zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe Interventionsgruppe Kontrollgruppe Signifikanztest M SD M SD F p Prätest (1. Messzeitpunkt) Aggressivität 8,74 6,14 9,00 6,85 0,04.84 Soziale Probleme 2,74 2,76 4,65 6,47 4,03 <.05 Depressiv/ängstlich 5,30 5,65 5,11 5,31 0,03.86 Posttest (2. Messzeitpunkt) Aggressivität 8,87 6,52 16,6 33,13 2,87 <.05 Soziale Probleme 3,05 3,79 6,72 14,04 3,47 <.05 Depressiv/ängstlich 5,49 6,51 10,68 24,28 2,33 <.05 Follow-up (3. Messzeitpunkt) Aggressivität 8,80 6,49 12,60 9,85 5,14 <.05 Soziale Probleme 2,02 2,28 3,46 4,94 3,47 <.05 Depressiv/ängstlich 3,24 3,13 5,73 5,63 7,41 < Mittelwerte Messzeitpunkte keine Maßnahme mit Maßnahme Abb. 2: Vergleich der Mittelwerte in der Skala Depressiv/ängstlich des YSR zu allen drei Messzeitpunkten zwischen Interventions- und Kontrollstichprobe
14 192 A. Boeger et al.: Erlebnispädagogik mit Jugendlichen 4.3 Geschlechtsbezogene Unterschiede bei der Gesamtstichprobe In den Frankfurter Selbstkonzeptskalen zeigten sich signifikante Interaktionseffekte zwischen den Faktoren Geschlecht Skala Allgemeine Leistungsfähigkeit (F (2,108) = 3.85, MSE = 56,2, p =.024), Skala Kontakt- und Umgangfähigkeit (F (2,108) = 5.25, MSE = 21,77, p =.007) und Skala Wertschätzung (F (2,108) = 3.37, MSE = 20,33, p =.038) bei der Gesamtstichprobe. Die weiblichen Jugendlichen hatten niedrigere Werte in den Skalen Allgemeine Leistungsfähigkeit und Wertschätzung, die männlichen Jugendlichen hatten niedrigere Werte in der Skala Kontakt- und Umgangsfähigkeit. Im YSR zeigten sich keine geschlechtsbezogenen Unterschiede bei der Gesamtstichprobe. 4.4 Geschlechtsbezogene unterschiedliche Wirkung des project adventure Im YSR zeigte sich bei allen drei Skalen eine geschlechtsbezogen unterschiedliche Wirkung des project adventure (Abb. 3) Mittelwerte Messzeitpunkte männlich, mit Maßnahme weiblich, mit Maßnahme Abb. 3: Vergleich der Mittelwerte in der Skala Depressiv/ängstlich zu allen drei Messzeitpunkten zwischen den weiblichen und männlichen Jugendlichen der Interventionsstichprobe Es zeigten sich Interaktionseffekte Skala Geschlecht Maßnahme bei der Skala Soziale Probleme (F (2,142) = 3.24, MSE = 22,78, p =.042), bei der Skala Depressiv/ängstlich (F (1,72) = 6.02, MSE = 137,38, p =.017) und bei der Skala Aggression (F (1,71) = 4.06, MSE = 282,87, p =.047). Ein Vergleich der Verläufe der weiblichen Jugendlichen der project adventure-intervention mit den männlichen Jugendlichen der project adventure-intervention ergab bei den männlichen Jugendlichen nur schwache Langzeiteffekte, vielmehr veränderten sich die Ausprägungen vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt nicht so stark wie bei den weiblichen Jugendlichen. Bei ihnen verminderten sich die Werte
15 A. Boeger et al.: Erlebnispädagogik mit Jugendlichen 193 und damit die wahrgenommenen Belastungen in allen drei Skalen und zwar insbesondere zum dritten Messzeitpunkt. In den Frankfurter Selbstkonzeptskalen zeigte sich keine geschlechtsbezogene unterschiedliche Wirkung der Intervention. 5 Diskussion Die summative, testpsychologische Evaluation konnte eine positive Wirkung des project adventure auf die hier untersuchten Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse zeigen. Selbstwert: Als eine der wichtigsten Entwicklungsaufgaben im Jugendalter wird der Aufbau einer eigenständigen Identität angesehen. Das Selbstkonzept ist eine Komponente dieser Identität und stellt ein zentrales Persönlichkeitsmerkmal im Jugendalter dar. Die Adoleszenz ist eine Phase der Übergänge und der Neuorientierung und damit unter Umständen auch der Desorientierung (Flammer u. Alsacer 2002, S. 142). Auf diese Übergänge nimmt das Selbstkonzept Einfluss. Als erstes bringt die pubertäre Reifung eine Vielzahl von körperlichen Veränderungen mit sich, die in das Körperbild integriert werden müssen. Weitere wichtige Entwicklungsaufgaben sind die veränderten sozialen Beziehungen zu Erwachsenen und zu den Gleichaltrigen. Erstmals trifft der Jugendliche wichtige Entscheidungen, die zum Beispiel die Schullaufbahn, die Berufswahl, die Aufnahme sexueller Beziehungen und die Aufnahme neuer Verhaltensweisen (Rauchen, Trinken usw.) betreffen. Dem Selbstkonzept kommt aber nicht nur eine bedeutende Rolle bei der Neustrukturierung der Identität zu, sondern es stellt auch eine wichtige internale Ressource bei der Bewältigung von Belastungen dar, indem es die Wucht von Stressoren abpuffert. Wegen dieser bedeutenden Rolle des Selbstwertes im Rahmen des coping-konzepts fokussieren zahlreiche Präventionsprogramme unterschiedlichster Zielsetzungen, die sich an Jugendliche wenden, neben Informationsvermittlung und Vermittlung von Bewältigungsstrategien auch auf eine Stärkung des Selbstwertgefühls. Unsere Ergebnisse zeigen nun deutlich, dass die Probanden des project adventure sich nach erfolgter Intervention als weniger verletzlich, weniger empfindlich und weniger bedrückt einschätzten. Auch in der Kontakt- und Umgangsfähigkeit schätzten sie sich höher ein, nahmen sich also als geschickter, sicherer und ungezwungener im Sozialkontakt mit anderen wahr. Ebenso waren die Einschätzungen der eigenen Standfestigkeit anderen gegenüber sowie die Standfestigkeit in sozialen Situationen signifikant stärker ausgeprägt. Die erlebte eigene Standfestigkeit nahm sogar nach der Intervention noch deutlich zu und unterschied sich im Ausmaß auch nach einem halben Jahr noch bedeutsam von der Kontrollgruppe (Abb. 1). Nach Deusinger lassen Veränderungen der Testwerte der Skala Standfestigkeit nach Testwiederholung im Sinne eines positiveren Selbstkonzepts der eigenen Standfestigkeit auf eine Verbesserung der psychischen Stabilität und eine Verringerung von Ängstlichkeit in der sozialen Interaktion schließen, was gegebenenfalls auf den Erfolg einer Therapie hindeutet (1986, S. 36). Diese Vermutung scheint auch auf unsere Ergebnisse zuzutreffen. Anzumerken ist insbesondere, dass der hier vorliegende Therapieer-
16 194 A. Boeger et al.: Erlebnispädagogik mit Jugendlichen folg einen gewissen Langzeiteffekt vorweist. Weitere Komponenten wie die vermutete Wertschätzung der eigenen Person durch andere und Gefühle und Beziehungen zu anderen waren im Vergleich zur Kontrollgruppe, und zwar direkt nach der Intervention als auch ein halbes Jahr später, ebenfalls höher ausgeprägt. Bei der Kontrollgruppe konnten wir im zeitlichen Verlauf deutliche Einbrüche im Selbstwert erkennen. Diese sind aus entwicklungspsychologischer Sicht als nicht untypisch für das frühe Jugendalter zu bezeichnen. Speziell das frühe Jugendalter, in dem es insbesondere mit einsetzender Pubertät zu massiven Körperveränderungen kommt, ist durch eine erhöhte Selbstunsicherheit gekennzeichnet. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass das hier beschriebene project adventure diese jugendtypischen Einbrüche vermutlich nicht nur verhindert, sondern darüber hinaus auch den Selbstwert stabilisiert und stärkt. Unsere Untersuchungsergebnisse erlauben jedoch nicht, spezielle Wirkungsfaktoren des Programms zu identifizieren, die für diesen Effekt verantwortlich sind. Ob einzelne Übungen wirksamer sind als andere oder ob den Reflexionsphasen die entscheidende Bedeutung zukommt, muss offen bleiben. Dies gilt auch für die im Folgenden beschriebenen Ergebnisse der Symptombelastung. Symptombelastung: Auch hinsichtlich der Symptombelastung der untersuchten Jugendlichen konnten wir Auswirkungen des project adventure feststellen. Während bei der Kontrollgruppe die Einschätzung von Aggression und sozialen Problemen zum zweiten Messzeitpunkt deutlich zunahm, um dann ein halbes Jahr später zwar wieder leicht abzusinken, aber nicht das Ausgangsniveau zu erreichen, gelang es der Interventionsstichprobe, das niedrige Ausgangsniveau über den gesamten Untersuchungszeitraum konstant zu halten. Depressive Verstimmungen und soziale Probleme nahmen aus der Sicht der Jugendlichen sogar noch deutlich ab. Eine geschlechtsbezogen unterschiedliche Wirkung des project adventure konnten wir bei der Symptombelastung zeigen. Ein Vergleich der Verläufe der weiblichen Jugendlichen der project adventure-intervention mit den männlichen Jugendlichen der project adventure-intervention machte bei den weiblichen Jugendlichen deutlich positive Langzeiteffekte insbesondere bei den Skalen Aggression und Depressiv/ ängstlich sichtbar, demgegenüber zeigten sich bei den männlichen Jugendlichen eher Kurzzeiteffekte. Die hier beschriebene erlebnispädagogische Intervention stieß auf eine ausgesprochen positive Resonanz bei den Jugendlichen, die sogar, ganz im Gegensatz zu Befunden der Literatur (vgl. etwa Rose 1998; Fromm 1998), bei den weiblichen Jugendlichen noch ausgeprägter war als bei den männlichen Jugendlichen (vgl. Rohr 2004). Dies erscheint gut nachvollziehbar, da Erlebnispädagogik mit seinen Mut und Risiko erfordernden Aufgaben der jugendtypischen Abenteuerlust, die in einer durchreglementierten, erlebnis- und erfahrungsarmen Welt (Deutscher Bundestag, Achter Jugendbericht 1990, S. 148) häufig nicht ausgelebt werden kann, Rechnung trägt. Die jugendtypischen Risikoverhaltensweisen und Mutproben werden zwar von Raithel (2001, S. 13) als durchaus funktional bezeichnet, da sie die Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz wie etwa die Abgrenzung von elterlichen Normen und die Integration in Peergroups erfüllen helfen. Andererseits sind sie häufig gefährlich und nicht legal. Erlebnispädagogik kann mit seinem Angebot an körper-
17 A. Boeger et al.: Erlebnispädagogik mit Jugendlichen 195 lich und psychisch herausfordernden Aufgaben, die allerdings in einem geschützten und legalen Rahmen stattfinden, diese Bedürfnisse erfüllen und damit identitätsaufbauende Reifungsprozesse im Jugendalter, bei denen Mutproben eine besondere Bedeutung zukommt, unterstützen. Auch wenn unsere Untersuchung aufgrund der relativ geringen Stichprobengröße nur erste Hinweise erlaubt, so ermutigen die Ergebnisse doch dazu, diese Befunde an einer größeren Stichprobe zu validieren. Sollten sich unsere positiven Befunde bestätigen, kann project adventure als eine hilfreiche und wirksame Maßnahme zur Abpufferung von Stress und damit zur Verminderung von Problemverhalten im frühen Jugendalter bezeichnet werden und sollte dann auch entsprechend eingesetzt werden. Danksagung: Wir danken den Studentinnen und Studenten Jens Edelhoff, Barbara Bukes, Carmen Bitdinger und Stephan Lachner sowie Frau Tanja Rohr. Dem Verein Krisenhilfe e. V. (Herrn Lamm) danken wir für die finanzielle Unterstützung. Literatur Achenbach, T. (1991): Manual for the Youth Self-Report and Profile. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry. Amesberger, G. (1992): Benachteiligte Personengruppen- kein Thema für die Sportwissenschaft und Sportpraxis. Spectrum der Sportwissenschaft 4 (1): Boeger, A; Schut, Th. (2005): Erlebnispädagogik in der Schule Methoden und Wirkungen. Berlin: logos. Botvin, G. (1998): Preventing adolscent drug abuse through life skills training: Theory, methods and effectiveness. In: Crane, J. (Hg.): Social programs that really work. New York: Russell Sage Foundation, S Deutscher Bundestag (1990): Achter Jugendbericht. Bericht über Bestrebungen und Leistungen der Jugendhilfe. Drucksache 11/6576. Bonn. Cason, D.; Gillis, H. (1994): A meta-analysis of outdoor adventure programming with adolescents. The Journal of Experiential Education 17: Crain, F. (1998): Zur Bedeutung des Beziehungsaspekts in der Erlebnispädagogik. Zeitschrift für Erlebnispädagogik 7 9: Dithmar, U. (1992): Mädchen in Bewegung. Zeitschrift für Erlebnispädagogik 9/10: Deusinger, I. (1986): Die Frankfurter Selbstkonzeptskalen (FSKN). Handanweisung. Göttingen: Hogrefe. Döpfner, M.; Plück, J.; Bölte, S.; Lenz, K.; Melchers, P.; Heim, K. (1998): Handbuch Fragebogen für Jugendliche. Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist. KJFD, Köln. Döpfner, M.; Berner, W.; Lehmkuhl, G. (1994): Handbuch. Fragebogen für Jugendliche. KJFD, Köln. Dolatschek, M. (2002): Erlebnispädagogische Ansätze. Neue Wege in der Gesundheitsförderung von Typ 2 Diabetikern. Augsburg: Ziel. Edelhoff, J. (2004): Erfahrungsbericht: Erlebnispädagogik mit 7. Klässlern der Gesamtschule. Unveröffentlichtes Manuskript. Universität Duisburg-Essen. Eberle, T. (2002): Empirische Annäherung an die Wirksamkeit von Outdoor-Trainings und die Bedeutung von Reflexionsphasen. In: Paffrath, H.; Altenberger, H. (Hg.): Perspektiven zur Weiterentwicklung der Erlebnispädagogik. Augsburg: Ziel. Feierabend, K.; Gosebirk, M.; Klenzner, P. (1999): Abenteuerpädagogik in der Schule. Freiburg i. Br.: Eigenverlag. Flammer, A.; Alsacer, F. (2002): Entwicklungspsychologie der Adoleszenz. Bern: Huber.
18 196 A. Boeger et al.: Erlebnispädagogik mit Jugendlichen Fromm, A. (1998): Spontaner-lauter-kompromißloser. Jugend und Gesellschaft 1: Gilsdorf, R.; Volkert, K. (Hg.) (1999): Abenteuer Schule. Alling: Sandmann. Gillett, D.; Thomas, P.; Skok, L.; McLaughlin, T. (1991): The effects of wilderness camping and hiking. The journal of Environmental Education 22: Heckmair, B.; Michl, W. (1998): Therapie von Gesellschaft und Individuum Kurt Hahns Begriff der Erlebnistherapie. In: Heckmair, B.; Michl, W. (Hg): Erleben und Lernen. Einstieg in die Erlebnispädagogik. Neuwied: Luchterhand, S Kiehn, E. (1998): Wie jugendliche Teilnehmer erlebnispädagogische Projekte beurteilen. Zeitschrift für Erlebnispädagogik 7 9: Klawe, W.; Bräuer, W. (1998a): Praxis und Praxisprobleme erlebnispädagogischer Maßnahmen in der Hilfe zur Erziehung. Sozialmagazin 23: Klawe, W.; Bräuer, W. (1998b): Erlebnispädagogik zwischen Alltag und Alaska. München: Juventa. Knorr, W. (2001): Erlebnispädagogik- Eine geeignete Alternative zur geschlossenen Unterbringung? Zeitschrift für Erlebnispädagogik 4: Koch, J. (1994): Abenteuer und Risiko als pädagogische Kategorien. Sportpädagogik 5: Marsh, H.; Richards, G.; Barnes, J. (1984): Multidminensional self-concepts: The effect of participation in an outward-bound program. Journal of Personality and Social Psychology 50: Marsh, H.; Richards, G. (1988): The outward-bound bridging course for low-achieving highschool males: Effect on academic achievment and multidimensional self-concepts. Australian Journal of Psychology 40: Marsh, H.; Richards, G.; Barnes, J. (1986): Multidiminensional self-concepts: A long-term followup of the effect of participation in an outward-bound program. Personality and Social Psychology Bulletin 12: Michl, W. (1998): Positionen und Provokationen zur Erlebnispädagogik. Jugend und Gesellschaft 1: 4 7. Nasser, D. (1994): Erlebnispädagogik in Nordamerika. Lüneburg: Verlag Edition Erlebnispädagogik. Nickolai, W. (1992): Erlebnispädagogik mit delinquenten Jugendlichen. Zeitschrift für Erlebnispädagogik 6: Priest, S. (1994): Total employee participation in Corporate Adventure Training as adjunct to altering the motivational climate of organisations. Catinate update, Nr. 5, Ontario: 1 ff. Raithel, J. (2001): Risikoverhaltensweisen Jugendlicher. Ein Überblick. In: Raithel, J. (Hg.): Risikoverhaltensweisen Jugendlicher. Opladen: Leske & Budrich, S Rehm, M. (1996a) : Der erlebnispädagogische Prozess- ein Stufenmodell zur Analyse. Erleben und Lernen 5: Rehm, M. (1996b): Evaluation von Outdoor-Aktivitäten. Teil I. Erleben und Lernen 5. Rehm, M. (1996c): Evaluation von Outdoor-Aktivitäten. Teil II. Erleben und Lernen 6. Rehm, M. (1999): Evaluationen erlebnispädagogischer Programme im englischsprachigen Raum. In: Paffrath, F.; Salzmann, A.; Scholz, M. (Hg.): Wissenschaftliche Forschung in der Erlebnispädagogik. Augsburg: Ziel, S Reiners, A. (1995): Erlebnis und Pädagogik. München: Ziel. Rohr, T. (2004): Die soziale Welt des Jugendlichen. Ergebnisse einer Studie an 7. Klässlern. Unveröffentlichte Diplomarbeit. Universität Duisburg-Essen. Rose, L. (1993): Zur Bedeutung der Abenteuerlust im weiblichen und männlichen Individuationsprozess. In: Homfeldt, H. (Hg): Erlebnispädagogik. Hohengehren, S Rose, L. (1998): Mädchenabenteuer-Jungenabenteuer. Jugend und Gesellschaft 1, Roth, M. (2000): Überprüfung des Youth-Self-Report an einer nicht-klinischen Stichprobe. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie 21: Roth, M.; Rudert, E.; Petermann, H. (2003): Prävention bei Jugendlichen. In: Jerusalem, M.; Weber, H. (Hg.): Psychologische Gesundheitsförderung. Göttingen: Hogrefe, S Rothig, V. (2001): Phantastische Abenteuer. Zeitschrift für Erlebnispädagogik 6 7: Salisch, v. M. (Hg) (2002): Emotionale Kompetenz entwickeln. Stuttgart: Kohlhammer. Salzmann, A.(1999): Zur Wirksamkeit und Integrierbarkeit erlebnispädagogischer Inhalte im Rahmen von Therapiemaßnahmen bei adipösen Jugendlichen. In: Paffrath, F.; Salzmann,
19 A. Boeger et al.: Erlebnispädagogik mit Jugendlichen 197 A.; Scholz, M. (Hg.): Wissenschaftliche Forschung in der Erlebnispädagogik. Augsburg: Ziel, S Schempp, B. (1998): Project adventure. Ein erlebnispädagogisches Modell in der Sozialen Arbeit. Unveröffentlichte Diplomarbeit. Fachhochschule für Sozialarbeit. Freiburg i. Br. Schempp, B. (2000): Auswirkungen von Project Adventure auf das Selbstkonzept von Jugendlichen. Erleben und Lernen 1: Schermeir, F. (2001): Erlebnispädagogisches Training in Schweden. Zeitschrift für Erlebnispädagogik 6 7: Schleske, W. (1998): Abenteuer-Wagnis-Risiko-Sport. Zeitschrift für Erlebnispädagogik 11: Schwarzer, R. (1996): Psychologie des Gesundheitsverhaltens. Göttingen: Hogrefe. Vernooij, M. (1999): Erlebnispädagogik- eine Einführung. Die neue Sonderschule 44: Wolters, J. (1994): Erlebnisorientierter Sport mit gewalttätigen Jugendlichen. Zeitschrift für Erlebnispädagogik 9: Ziegenspeck, J. (1986): Leben für s Leben-Lernen mit Kopf, Herz und Hand ein Vortrag zum 100. Geburtstag von Kurt Hahn. Lüneburg: Neubauer. Ziegenspeck, J. (2001): Erläuterungen zur outward bound Idee. Zeitschrift für Erlebnispädagogik 6 7: 7 9. Korrespondenzadresse: Prof. Dr. Annette Boeger, Fachbereich Bildungswissenschaften, Universität Duisburg-Essen, Essen; annette.boeger@uni-essen.de
Kirchheim, Carola. Nutzungsbedingungen
 Kirchheim, Carola Krowatschek, D. (2002): Überaktive Kinder im Unterricht. Ein Programm zur Förderung der Selbstwahrnehmung, Strukturierung, Sensibilisierung und Selbstakzeptanz von unruhigen Kindern im
Kirchheim, Carola Krowatschek, D. (2002): Überaktive Kinder im Unterricht. Ein Programm zur Förderung der Selbstwahrnehmung, Strukturierung, Sensibilisierung und Selbstakzeptanz von unruhigen Kindern im
Boeger, Annette / Dörfler, Tobias und Schut-Ansteeg, Thomas Erlebnispädagogik mit Jugendlichen: Einflüsse auf Symptombelastung und Selbstwert
 Boeger, Annette / Dörfler, Tobias und Schut-Ansteeg, Thomas Erlebnispädagogik mit Jugendlichen: Einflüsse auf Symptombelastung und Selbstwert Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 55 (2006)
Boeger, Annette / Dörfler, Tobias und Schut-Ansteeg, Thomas Erlebnispädagogik mit Jugendlichen: Einflüsse auf Symptombelastung und Selbstwert Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 55 (2006)
- Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit bei arbeitslosen AkademikerInnen -
 - Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit bei arbeitslosen AkademikerInnen - Eine Evaluierungsstudie zum Einfluss der Trainingsmaßnahme Job-Coaching auf personale Variablen von arbeitssuchenden AkademikerInnen
- Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit bei arbeitslosen AkademikerInnen - Eine Evaluierungsstudie zum Einfluss der Trainingsmaßnahme Job-Coaching auf personale Variablen von arbeitssuchenden AkademikerInnen
Geisteswissenschaft. Sandra Päplow. Werde der Du bist! Die Moderation der Entwicklungsregulation im Jugendalter durch personale Faktoren.
 Geisteswissenschaft Sandra Päplow Werde der Du bist! Die Moderation der Entwicklungsregulation im Jugendalter durch personale Faktoren Diplomarbeit Universität Bremen Fachbereich 11: Human-und Gesundheitswissenschaften
Geisteswissenschaft Sandra Päplow Werde der Du bist! Die Moderation der Entwicklungsregulation im Jugendalter durch personale Faktoren Diplomarbeit Universität Bremen Fachbereich 11: Human-und Gesundheitswissenschaften
The promotion of perceived physical ability via an intervention using internal teacher frame of reference in
 The promotion of perceived physical ability via an intervention using internal teacher frame of reference in physical education Esther Oswald Institut für Sportwissenschaft, Universität Bern SGS-Tagung,
The promotion of perceived physical ability via an intervention using internal teacher frame of reference in physical education Esther Oswald Institut für Sportwissenschaft, Universität Bern SGS-Tagung,
Nutzungsbedingungen. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 53 (2004) 2, S urn:nbn:de:0111-opus-27627
 Waligora, Katja Rauer, W.; Schuck, K.-D. (2003): Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern dritter und vierter Klassen (FEESS 3 4). Göttingen: Hogrefe; 59,.
Waligora, Katja Rauer, W.; Schuck, K.-D. (2003): Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern dritter und vierter Klassen (FEESS 3 4). Göttingen: Hogrefe; 59,.
Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
 Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Fachtagung 17.09.2008, Luzern Alles too much! Stress, Psychische Gesundheit, Früherkennung und Frühintervention in Schulen Barbara Fäh, Hochschule für
Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Fachtagung 17.09.2008, Luzern Alles too much! Stress, Psychische Gesundheit, Früherkennung und Frühintervention in Schulen Barbara Fäh, Hochschule für
Depression bei Kindern und Jugendlichen
 Cecilia A. Essau Depression bei Kindern und Jugendlichen Psychologisches Grundlagenwissen Mit 21 Abbildungen, 41 Tabellen und 139 Übungsfragen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. Cecilia A. Essau,
Cecilia A. Essau Depression bei Kindern und Jugendlichen Psychologisches Grundlagenwissen Mit 21 Abbildungen, 41 Tabellen und 139 Übungsfragen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. Cecilia A. Essau,
Psychische Auffälligkeiten von traumatisierten Kindern. und Jugendlichen in der psychotherapeutischen Praxis
 Psychische Auffälligkeiten von traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der psychotherapeutischen Praxis > Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität
Psychische Auffälligkeiten von traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der psychotherapeutischen Praxis > Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität
Finnie, B., Menke, M. (1999), Training mit HauptschülerInnen zweier Bremer Schulzentren.
 2.8.5 Evaluationsstudien von 1999 bis 2008 Seit der ursprünglichen Evaluationsstudie (Jugert et al., 2000), über die vorstehend berichtet wurde, fanden eine ganze Reihe von größeren und kleineren Evaluationen
2.8.5 Evaluationsstudien von 1999 bis 2008 Seit der ursprünglichen Evaluationsstudie (Jugert et al., 2000), über die vorstehend berichtet wurde, fanden eine ganze Reihe von größeren und kleineren Evaluationen
Trendanalyse zu Burnout bei Studierenden
 Franziska Wörfel, Katrin Lohmann, Burkhard Gusy Trendanalyse zu Burnout bei Studierenden Hintergrund Seit Einführung der neuen Studiengänge mehren sich die Beschwerden über psychische Belastungen bei Studierenden.
Franziska Wörfel, Katrin Lohmann, Burkhard Gusy Trendanalyse zu Burnout bei Studierenden Hintergrund Seit Einführung der neuen Studiengänge mehren sich die Beschwerden über psychische Belastungen bei Studierenden.
Verleihung des BKK Innovationspreises Gesundheit 2016 Armut und Gesundheit am 13. September 2017 in Frankfurt a. M.
 Verleihung des BKK Innovationspreises Gesundheit 2016 Armut und Gesundheit am 13. September 2017 in Frankfurt a. M. 1. Preisträger: Tanja Krause Thema: Gesundheit Behinderung Teilhabe. Soziale Ungleichheit
Verleihung des BKK Innovationspreises Gesundheit 2016 Armut und Gesundheit am 13. September 2017 in Frankfurt a. M. 1. Preisträger: Tanja Krause Thema: Gesundheit Behinderung Teilhabe. Soziale Ungleichheit
Fragebogen zu Gedanken und Gefühlen (FGG)
 Fragebogen zu Gedanken und Gefühlen (FGG) Informationen zum FGG-14, FGG-37 und IWD Stand: 11-2009 Der Fragebogen zu Gedanken und Gefühlen von Renneberg et al. (2005) ist ein aus der Theorie abgeleitetes
Fragebogen zu Gedanken und Gefühlen (FGG) Informationen zum FGG-14, FGG-37 und IWD Stand: 11-2009 Der Fragebogen zu Gedanken und Gefühlen von Renneberg et al. (2005) ist ein aus der Theorie abgeleitetes
Stress als Risiko und Chance
 Heidi Eppel Stress als Risiko und Chance Grundlagen von Belastung, Bewältigung und Ressourcen Verlag W. Kohlhammer Vorwort 9 Teil I Grundlagen: Die Elemente des transaktionalen Stress-Bewältigungs-Modells
Heidi Eppel Stress als Risiko und Chance Grundlagen von Belastung, Bewältigung und Ressourcen Verlag W. Kohlhammer Vorwort 9 Teil I Grundlagen: Die Elemente des transaktionalen Stress-Bewältigungs-Modells
Peter Hess-Basis-Klangmassage als Methode der Stressverarbeitung und ihre Auswirkungen auf das Körperbild
 Peter Hess-Basis-Klangmassage als Methode der Stressverarbeitung und ihre Auswirkungen auf das Körperbild Eine empirische Längsschnittstudie des Europäischen Fachverbandes Klang-Massage-Therapie e.v. in
Peter Hess-Basis-Klangmassage als Methode der Stressverarbeitung und ihre Auswirkungen auf das Körperbild Eine empirische Längsschnittstudie des Europäischen Fachverbandes Klang-Massage-Therapie e.v. in
Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie
 Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels: Bachelor of Science vorgelegt
Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels: Bachelor of Science vorgelegt
Bonner Evaluationsstudie (BEST) Zwischenauswertung PP und KJP Juli 2011
 Bonner Evaluationsstudie (BEST) Zwischenauswertung PP und KJP Juli 2011 Studienergebnisse PP ab 18;00 Jahre (Stand Juli 2011) Wachstum der StudienteilnehmerInnen zum Messzeitpunkt T1 / Erstkontakt im MVZ-Psyche
Bonner Evaluationsstudie (BEST) Zwischenauswertung PP und KJP Juli 2011 Studienergebnisse PP ab 18;00 Jahre (Stand Juli 2011) Wachstum der StudienteilnehmerInnen zum Messzeitpunkt T1 / Erstkontakt im MVZ-Psyche
Kirchheim, Carola Mariacher, H.; Neubauer, A. (2005): PAI 30. Test zur Praktischen Alltagsintelligenz. Göttingen: Hogrefe Verlag ( 59, )
 Kirchheim, Carola Mariacher, H.; Neubauer, A. (2005): PAI 30. Test zur Praktischen Alltagsintelligenz. Göttingen: Hogrefe Verlag ( 59, ) Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 55 (2006) 2,
Kirchheim, Carola Mariacher, H.; Neubauer, A. (2005): PAI 30. Test zur Praktischen Alltagsintelligenz. Göttingen: Hogrefe Verlag ( 59, ) Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 55 (2006) 2,
Kathrin Schack. Liebe zum gleichen Geschlecht Ein Thema für die Schule
 Kathrin Schack Liebe zum gleichen Geschlecht Ein Thema für die Schule Kathrin Schack Liebe zum gleichen Geschlecht Ein Thema für die Schule Aufklärungsarbeit gegen Homophobie Tectum Verlag Kathrin Schack
Kathrin Schack Liebe zum gleichen Geschlecht Ein Thema für die Schule Kathrin Schack Liebe zum gleichen Geschlecht Ein Thema für die Schule Aufklärungsarbeit gegen Homophobie Tectum Verlag Kathrin Schack
Gottesbeziehung und psychische Gesundheit
 Sebastian Murken Gottesbeziehung und psychische Gesundheit Die Entwicklung eines Modells und seine empirische Überprüfung Waxmann Münster / New York München / Berlin Inhaltsverzeichnis Vorwort 9 1 Einleitung
Sebastian Murken Gottesbeziehung und psychische Gesundheit Die Entwicklung eines Modells und seine empirische Überprüfung Waxmann Münster / New York München / Berlin Inhaltsverzeichnis Vorwort 9 1 Einleitung
Evaluation des Gewaltpräventionsprogramms und Zivilcouragetrainings zammgrauft
 Evaluation des Gewaltpräventionsprogramms und Zivilcouragetrainings zammgrauft zammgrauft - das Anti-Gewaltprogramm der Münchener Polizei möchte Kinder und Jugendliche für Gewaltphänomene sensibilisieren
Evaluation des Gewaltpräventionsprogramms und Zivilcouragetrainings zammgrauft zammgrauft - das Anti-Gewaltprogramm der Münchener Polizei möchte Kinder und Jugendliche für Gewaltphänomene sensibilisieren
Schüler in der Klinik
 Schüler in der Klinik Ein wirksames Berliner Tabakpräventionsprojekt Stamm-Balderjahn, S., Jagota, A., Barz, G., Kaufmann, H., Schönfeld, N. 51. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und
Schüler in der Klinik Ein wirksames Berliner Tabakpräventionsprojekt Stamm-Balderjahn, S., Jagota, A., Barz, G., Kaufmann, H., Schönfeld, N. 51. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und
Wer ist wirklich hochsensibel?
 Biological and Experimental Psychology School of Biological and Chemical Sciences Wer ist wirklich hochsensibel? Ein Workshop zur Messung von Sensitivität Michael Pluess, PhD HSP Kongress, Münsingen, Schweiz,
Biological and Experimental Psychology School of Biological and Chemical Sciences Wer ist wirklich hochsensibel? Ein Workshop zur Messung von Sensitivität Michael Pluess, PhD HSP Kongress, Münsingen, Schweiz,
Evaluation Des Sozialtraining in der Schule
 Evaluation Des Sozialtraining in der Schule Die erste Evaluation des vorliegenden Trainings fand im Jahr 1996 an vier Bremer Schulen statt. Es nahmen insgesamt 158 Schüler im Alter von acht bis zwölf Jahren,
Evaluation Des Sozialtraining in der Schule Die erste Evaluation des vorliegenden Trainings fand im Jahr 1996 an vier Bremer Schulen statt. Es nahmen insgesamt 158 Schüler im Alter von acht bis zwölf Jahren,
Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) 9 (2010) 3
 Viehhauser, Martin Sabine Seichter: Pädagogische Liebe, Erfindung, Blütezeit, Verschwinden eines pädagogischen Deutungsmusters, Paderborn: Schöningh 2007 [Rezension] Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR)
Viehhauser, Martin Sabine Seichter: Pädagogische Liebe, Erfindung, Blütezeit, Verschwinden eines pädagogischen Deutungsmusters, Paderborn: Schöningh 2007 [Rezension] Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR)
Forschungsgruppe STEKI Evaluation der stationären Therapie von Eltern-Kind-Interaktionsstörungen
 Forschungsgruppe STEKI Evaluation der stationären Therapie von Eltern-Kind-Interaktionsstörungen Mitglieder der Forschungsgruppe: Sabine Schröder, Dipl.-Psych. (Koordinaton, KLINIK, CDS) Dieter Breuer,
Forschungsgruppe STEKI Evaluation der stationären Therapie von Eltern-Kind-Interaktionsstörungen Mitglieder der Forschungsgruppe: Sabine Schröder, Dipl.-Psych. (Koordinaton, KLINIK, CDS) Dieter Breuer,
eine Hochrisikopopulation: Biographien betroffener Persönlichkeiten
 Kinder psychisch kranker Eltern eine Hochrisikopopulation: p Biographien betroffener Persönlichkeiten Susanne Schlüter-Müller Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Fürstenbergerstr.
Kinder psychisch kranker Eltern eine Hochrisikopopulation: p Biographien betroffener Persönlichkeiten Susanne Schlüter-Müller Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Fürstenbergerstr.
Emotionale Intelligenz
 Christian Menschel - 11487 21.06. 2006 50% Prozent aller Ehen scheitern in Deutschland Tendenz weiter steigend. 4,5 Mio. Arbeitslose in Deutschland Frage: Hoher Intelligenz Quotient = persönlicher und
Christian Menschel - 11487 21.06. 2006 50% Prozent aller Ehen scheitern in Deutschland Tendenz weiter steigend. 4,5 Mio. Arbeitslose in Deutschland Frage: Hoher Intelligenz Quotient = persönlicher und
Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen
 Zeno Kupper Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen PABST SCIENCE PUBLISHERS Lengerich, Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Riga, Scottsdale (USA), Wien, Zagreb Inhaltsverzeichnis Einleitung und
Zeno Kupper Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen PABST SCIENCE PUBLISHERS Lengerich, Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Riga, Scottsdale (USA), Wien, Zagreb Inhaltsverzeichnis Einleitung und
Sexuelle Traumatisierung und ihre Folgen
 Rita Völker Sexuelle Traumatisierung und ihre Folgen Die emotionale Dimension des sexuellen Missbrauchs.' '. T. J -.\.A-:! Leske + Budrich, Opladen 2002 Inhalt Vorwort 13 Christina 15 1. Der sexuelle Missbrauch
Rita Völker Sexuelle Traumatisierung und ihre Folgen Die emotionale Dimension des sexuellen Missbrauchs.' '. T. J -.\.A-:! Leske + Budrich, Opladen 2002 Inhalt Vorwort 13 Christina 15 1. Der sexuelle Missbrauch
Veränderte Kindheit? Wie beeinflusst der aktuelle Lebensstil die psychische Gesundheit von Kindern?
 Tag der Psychologie 2013 Lebensstilerkrankungen 1 Veränderte Kindheit? Wie beeinflusst der aktuelle Lebensstil die psychische Gesundheit von Kindern? 2 Überblick Lebensstilerkrankungen bei Kindern Psychische
Tag der Psychologie 2013 Lebensstilerkrankungen 1 Veränderte Kindheit? Wie beeinflusst der aktuelle Lebensstil die psychische Gesundheit von Kindern? 2 Überblick Lebensstilerkrankungen bei Kindern Psychische
Persönlichkeitsentwicklung verhaltensgestörter Kinder und Jugendlicher
 Christine Ettrich / Klaus Udo Ettrich unter Mitarbeit von Monika Herbst Persönlichkeitsentwicklung verhaltensgestörter Kinder und Jugendlicher Ergebnisse einer prospektiven Längsschnittstudie Verlag Dr.
Christine Ettrich / Klaus Udo Ettrich unter Mitarbeit von Monika Herbst Persönlichkeitsentwicklung verhaltensgestörter Kinder und Jugendlicher Ergebnisse einer prospektiven Längsschnittstudie Verlag Dr.
Therapiebedürftige Kinder und Jugendliche im Schulalter. Erfahrungen aus psychotherapeutischer Sicht und präventive Ansätze
 Therapiebedürftige Kinder und Jugendliche im Schulalter Erfahrungen aus psychotherapeutischer Sicht und präventive Ansätze Übersicht: Psychische Störungen Kinder- und Jugendliche als Patienten Prävention
Therapiebedürftige Kinder und Jugendliche im Schulalter Erfahrungen aus psychotherapeutischer Sicht und präventive Ansätze Übersicht: Psychische Störungen Kinder- und Jugendliche als Patienten Prävention
Achtsamkeit zur Stressbewältigung
 Achtsamkeit zur Stressbewältigung Haarig, F., Winkler, D., Graubner, M., Sipos, L., & Mühlig, S. (2016). Achtsamkeit zur Stressbewältigung. Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie,
Achtsamkeit zur Stressbewältigung Haarig, F., Winkler, D., Graubner, M., Sipos, L., & Mühlig, S. (2016). Achtsamkeit zur Stressbewältigung. Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie,
Jungen in der Heimerziehung und sexuell grenzverletzende Jungen
 Jungen in der Heimerziehung und sexuell grenzverletzende Jungen Geschlechtsbewusste Zugänge in der therapeutisch-pädagogischen Arbeit Jan Schweinsberg 1 Inhalte: 1. Zwei Zugänge zur Arbeit mit Jungen Modellprojekt
Jungen in der Heimerziehung und sexuell grenzverletzende Jungen Geschlechtsbewusste Zugänge in der therapeutisch-pädagogischen Arbeit Jan Schweinsberg 1 Inhalte: 1. Zwei Zugänge zur Arbeit mit Jungen Modellprojekt
Angstbewältigung und Selbstbeobachtung
 Marius Zbinden Angstbewältigung und Selbstbeobachtung Der Einfluss von Bewältigungsdispositionen auf Stimmung, Belastungserleben und dessen Bewältigung unter natürlichen Bedingungen PETER LANG Bern Berlin
Marius Zbinden Angstbewältigung und Selbstbeobachtung Der Einfluss von Bewältigungsdispositionen auf Stimmung, Belastungserleben und dessen Bewältigung unter natürlichen Bedingungen PETER LANG Bern Berlin
Gesundheit und Krankheit. Darlegung der "Sense of Coherence Scale" von Aaron Antonovsky
 Geisteswissenschaft Magdalena Köhler Gesundheit und Krankheit. Darlegung der "Sense of Coherence Scale" von Aaron Antonovsky Studienarbeit Vertiefungsseminar Persönlichkeitspsychologie Angewandte Aspekte
Geisteswissenschaft Magdalena Köhler Gesundheit und Krankheit. Darlegung der "Sense of Coherence Scale" von Aaron Antonovsky Studienarbeit Vertiefungsseminar Persönlichkeitspsychologie Angewandte Aspekte
Heidi Eppel. Stress als. Risiko und Chance. Grundlagen von Belastung, Bewältigung und Ressourcen. Verlag W. Kohlhammer
 Heidi Eppel Stress als Risiko und Chance Grundlagen von Belastung, Bewältigung und Ressourcen Verlag W Kohlhammer Vorwort 9 Teil I Grundlagen: Die Elemente des transaktionalen Stress-Bewältigungs-Modells
Heidi Eppel Stress als Risiko und Chance Grundlagen von Belastung, Bewältigung und Ressourcen Verlag W Kohlhammer Vorwort 9 Teil I Grundlagen: Die Elemente des transaktionalen Stress-Bewältigungs-Modells
gefördert von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
 Neues aus der Resilienzforschung Dipl.-Psych. Lisa Lyssenko Abteilung für Rehabilitationspsychologie und Psychotherapie Institut für Psychologie Universität Freiburg gefördert von der Bundeszentrale für
Neues aus der Resilienzforschung Dipl.-Psych. Lisa Lyssenko Abteilung für Rehabilitationspsychologie und Psychotherapie Institut für Psychologie Universität Freiburg gefördert von der Bundeszentrale für
3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung
 Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
Nutzungsbedingungen. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 51 (2002) 2, S urn:nbn:de:0111-opus-19757
 Unzner, Lothar Rezension [zu: Günder, Richard (2000): Praxis und Methoden der Heimerziehung. Entwicklungen, Veränderungen und Perspektiven der stationären Erziehungshilfe. Freiburg i. Br.: Lambertus] Praxis
Unzner, Lothar Rezension [zu: Günder, Richard (2000): Praxis und Methoden der Heimerziehung. Entwicklungen, Veränderungen und Perspektiven der stationären Erziehungshilfe. Freiburg i. Br.: Lambertus] Praxis
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Instrumente von DISYPS-II:
 Döpfner, Görtz-Dorten & Lehmkuhl (2000): Diagnostik-System für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter nach ICD-10 und DSM- IV (DISYPS-II). Bern: Huber Weitere Informationen und Bezug: http://www.testzentrale.de/programm/diagnostik-system-fur-psychische-storungen-nach-icd-10-
Döpfner, Görtz-Dorten & Lehmkuhl (2000): Diagnostik-System für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter nach ICD-10 und DSM- IV (DISYPS-II). Bern: Huber Weitere Informationen und Bezug: http://www.testzentrale.de/programm/diagnostik-system-fur-psychische-storungen-nach-icd-10-
Stress bei Frauen ist anders bei Führungsfrauen erst recht
 2 Stress bei Frauen ist anders bei Führungsfrauen erst recht Sie werden sicherlich sagen, Stress ist Stress und bei Männern und Frauen gibt es kaum Unterschiede. Tatsache ist, dass es kaum Untersuchungen
2 Stress bei Frauen ist anders bei Führungsfrauen erst recht Sie werden sicherlich sagen, Stress ist Stress und bei Männern und Frauen gibt es kaum Unterschiede. Tatsache ist, dass es kaum Untersuchungen
https://cuvillier.de/de/shop/publications/6368
 Hendrikje Schulze (Autor) Zur Entwicklung von Schreibkompetenz im Kontext der Ausbildung berufsbezogener Selbstkonzepte bei Lernenden im Deutschunterricht der Sekundarstufe I Entwicklung und Erprobung
Hendrikje Schulze (Autor) Zur Entwicklung von Schreibkompetenz im Kontext der Ausbildung berufsbezogener Selbstkonzepte bei Lernenden im Deutschunterricht der Sekundarstufe I Entwicklung und Erprobung
Die Gleichaltrigen. LS Entwicklungs- und Pädagogische Psychologie
 Die Gleichaltrigen 1 Bedeutung der Bedeutung der Gleichaltrigen- Beziehungen für die kindliche Entwicklung Peers = Kinder ungefähr gleichen Alters Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten
Die Gleichaltrigen 1 Bedeutung der Bedeutung der Gleichaltrigen- Beziehungen für die kindliche Entwicklung Peers = Kinder ungefähr gleichen Alters Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten
Auf dem Weg zur Qualitätssicherung in der Musiktherapie
 Auf dem Weg zur Qualitätssicherung in der Musiktherapie am Beispiel des krankheitsspezifischen Coachings für Patienten mit Nierenerkrankungen Alexander F. Wormit 1 1 Deutsches Zentrum für Musiktherapieforschung
Auf dem Weg zur Qualitätssicherung in der Musiktherapie am Beispiel des krankheitsspezifischen Coachings für Patienten mit Nierenerkrankungen Alexander F. Wormit 1 1 Deutsches Zentrum für Musiktherapieforschung
Die tägliche Sportstunde an Grundschulen in NRW
 Die tägliche Sportstunde an Grundschulen in NRW Prof. Dr. Miriam Seyda Juniorprofessorin für das Fach Bewegung, Spiel und Sport im Kindesalter Vortrag auf dem ÖISS-Kongress 2014: Schule-Sport-Sportstätte,
Die tägliche Sportstunde an Grundschulen in NRW Prof. Dr. Miriam Seyda Juniorprofessorin für das Fach Bewegung, Spiel und Sport im Kindesalter Vortrag auf dem ÖISS-Kongress 2014: Schule-Sport-Sportstätte,
Depressive Kinder und Jugendliche
 Depressive Kinder und Jugendliche von Gunter Groen und Franz Petermann Hogrefe Verlag für Psychologie Göttingen Bern Toronto Seattle Vorwort 9 Kapitel 1 1 Zum Phänomen im Wandel der Zeit 11 Kapitel 2 2
Depressive Kinder und Jugendliche von Gunter Groen und Franz Petermann Hogrefe Verlag für Psychologie Göttingen Bern Toronto Seattle Vorwort 9 Kapitel 1 1 Zum Phänomen im Wandel der Zeit 11 Kapitel 2 2
Beratungskompetenz von Lehrern
 Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie 74 Beratungskompetenz von Lehrern Kompetenzdiagnostik, Kompetenzförderung, Kompetenzmodellierung Bearbeitet von Silke Hertel 1. Auflage 2009. Taschenbuch.
Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie 74 Beratungskompetenz von Lehrern Kompetenzdiagnostik, Kompetenzförderung, Kompetenzmodellierung Bearbeitet von Silke Hertel 1. Auflage 2009. Taschenbuch.
Einführung in die Sportpsychologie
 H. Gabler / J. R. Nitsch / R. Singer Einführung in die Sportpsychologie Teil 2: Anwendungsfelder unter Mitarbeit von Dorothee Alfermann, Achim Conzelmann, Dieter Hackfort, Jörg Knobloch, Peter Schwenkmezger,
H. Gabler / J. R. Nitsch / R. Singer Einführung in die Sportpsychologie Teil 2: Anwendungsfelder unter Mitarbeit von Dorothee Alfermann, Achim Conzelmann, Dieter Hackfort, Jörg Knobloch, Peter Schwenkmezger,
Anonymisierung von Daten in der qualitativen Forschung: Probleme und Empfehlungen
 Anonymisierung von Daten in der qualitativen Forschung: Probleme und Empfehlungen Erziehungswissenschaft 17 (2006) 32, S. 33-34 urn:nbn:de:0111-opus-10698 Erstveröffentlichung bei: www.budrich-verlag.de
Anonymisierung von Daten in der qualitativen Forschung: Probleme und Empfehlungen Erziehungswissenschaft 17 (2006) 32, S. 33-34 urn:nbn:de:0111-opus-10698 Erstveröffentlichung bei: www.budrich-verlag.de
"Eigenschaften-Situationen-Verhaltensweisen - ESV" Eine ökonomische Ratingform des 16 PF. Werner Stangl. Zielsetzung
 "Eigenschaften-Situationen-Verhaltensweisen - ESV" Eine ökonomische Ratingform des 16 PF Werner Stangl Zielsetzung In Interpretationen psychologischer Untersuchungen wird häufig auf Persönlichkeitsmerkmale
"Eigenschaften-Situationen-Verhaltensweisen - ESV" Eine ökonomische Ratingform des 16 PF Werner Stangl Zielsetzung In Interpretationen psychologischer Untersuchungen wird häufig auf Persönlichkeitsmerkmale
Wahrnehmungsförderung mit dem FRODI-Frühförderkonzept
 Pilotstudie Wahrnehmungsförderung mit dem FRODI-Frühförderkonzept Theoretischer Hintergrund: Hören, Sehen, richtiges Sprechen, aber auch gute fein- und grobmotorische Fertigkeiten sind grundlegende Voraussetzungen
Pilotstudie Wahrnehmungsförderung mit dem FRODI-Frühförderkonzept Theoretischer Hintergrund: Hören, Sehen, richtiges Sprechen, aber auch gute fein- und grobmotorische Fertigkeiten sind grundlegende Voraussetzungen
Wie bewältigen Kinder den Übergang?
 Wie bewältigen Kinder den Übergang? Andreas Beelmann Universität Jena, Institut für Psychologie Kontakt: Prof. Dr. Andreas Beelmann Universität Jena Institut für Psychologie Humboldtstr. 26 07743 Jena
Wie bewältigen Kinder den Übergang? Andreas Beelmann Universität Jena, Institut für Psychologie Kontakt: Prof. Dr. Andreas Beelmann Universität Jena Institut für Psychologie Humboldtstr. 26 07743 Jena
Wahrnehmung, Einstellung und Verhalten von Menschen in alternden und schrumpfenden Belegschaften
 Wahrnehmung, Einstellung und Verhalten von Menschen in alternden und schrumpfenden Belegschaften Ein empirisches Forschungsprojekt für demographiefeste Personalarbeit in altersdiversen Belegschaften Juristische
Wahrnehmung, Einstellung und Verhalten von Menschen in alternden und schrumpfenden Belegschaften Ein empirisches Forschungsprojekt für demographiefeste Personalarbeit in altersdiversen Belegschaften Juristische
Humor und seine Bedeutung fiir den Lehrerberuf
 Humor und seine Bedeutung fiir den Lehrerberuf Von der gemeinsamen Naturwissenschaftlichen Fakultat der Technischen Universitat Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig zur Erlangung des Grades einer Doktorin
Humor und seine Bedeutung fiir den Lehrerberuf Von der gemeinsamen Naturwissenschaftlichen Fakultat der Technischen Universitat Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig zur Erlangung des Grades einer Doktorin
Inhaltsverzeichnis. Vorwort... 11
 Inhaltsverzeichnis Vorwort.................................................... 11 1 Gegenstand und Aufgaben der Entwicklungspsychologie......................................... 13 1.1 Der Entwicklungsbegriff.................................
Inhaltsverzeichnis Vorwort.................................................... 11 1 Gegenstand und Aufgaben der Entwicklungspsychologie......................................... 13 1.1 Der Entwicklungsbegriff.................................
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Europa
 Melanie Kupsch Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Europa Auswirkungen beruflicher und familiärer Stressoren und Ressourcen in Doppelverdienerhaushalten mit jungen Kindern auf die Konfliktübertragung
Melanie Kupsch Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Europa Auswirkungen beruflicher und familiärer Stressoren und Ressourcen in Doppelverdienerhaushalten mit jungen Kindern auf die Konfliktübertragung
Sportengagement und Entwicklung im Kindesalter
 Zu den Autoren Prof. Dr. Wolf-Dietrich Brettschneider lehrt und forscht an der Universität Paderborn im Department Sport und Gesundheit, Arbeitsbereich Sport und Erziehung. Zuvor war er Professor an der
Zu den Autoren Prof. Dr. Wolf-Dietrich Brettschneider lehrt und forscht an der Universität Paderborn im Department Sport und Gesundheit, Arbeitsbereich Sport und Erziehung. Zuvor war er Professor an der
Bremer Institut für Pädagogik und Psychologie (bipp)
 Bremer Institut für Pädagogik und Psychologie (bipp) www.bipp-bremen.de Schule an der N.N. Str. - Förderzentrum - 28309 Bremen März 2004 Evaluation der Fördermaßnahme zur Senkung der Wiederholerquote sowie
Bremer Institut für Pädagogik und Psychologie (bipp) www.bipp-bremen.de Schule an der N.N. Str. - Förderzentrum - 28309 Bremen März 2004 Evaluation der Fördermaßnahme zur Senkung der Wiederholerquote sowie
DIFFERENTIELLE BENOTUNGEN VON JUNGEN UND MÄDCHEN
 DIFFERENTIELLE BENOTUNGEN VON JUNGEN UND MÄDCHEN Der Einfluss der Einschätzungen von Lehrkräften zur Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen Prof. Dr. Poldi Kuhl PROF. DR. POLDI KUHL» www.leuphana.de Ausgangspunkt
DIFFERENTIELLE BENOTUNGEN VON JUNGEN UND MÄDCHEN Der Einfluss der Einschätzungen von Lehrkräften zur Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen Prof. Dr. Poldi Kuhl PROF. DR. POLDI KUHL» www.leuphana.de Ausgangspunkt
Seelische Gesundheit in der Kindheit und Adoleszenz
 Seelische Gesundheit in der Kindheit und Adoleszenz Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Forschungssektion Child Public Health Auszug aus dem Vortrag in Stade am 09.10.2013 1 Public Health Relevanz In
Seelische Gesundheit in der Kindheit und Adoleszenz Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Forschungssektion Child Public Health Auszug aus dem Vortrag in Stade am 09.10.2013 1 Public Health Relevanz In
Mädchen und Jungen in Europa: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Identität
 Mädchen und Jungen in Europa: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Identität D. Maehler, Universität zu Köln Einführung In diesem Beitrag soll ein Geschlechtervergleich bei Jugendlichen in den zehn
Mädchen und Jungen in Europa: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Identität D. Maehler, Universität zu Köln Einführung In diesem Beitrag soll ein Geschlechtervergleich bei Jugendlichen in den zehn
Lernen mit Alltagsphantasien
 Barbara Born Lernen mit Alltagsphantasien Zur expliziten Reflexion impliziter Vorstellungen im Biologieunterricht VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhalt Abkürzungsverzeichnis 15 Einleitung 17 1 Problemhorizont
Barbara Born Lernen mit Alltagsphantasien Zur expliziten Reflexion impliziter Vorstellungen im Biologieunterricht VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhalt Abkürzungsverzeichnis 15 Einleitung 17 1 Problemhorizont
Kindliches Temperament: unter Berücksichtigung mütterlicher Merkmale
 Kindliches Temperament: Struktur und Zusammenhänge zu Verhaltensauffälligkeiten unter Berücksichtigung mütterlicher Merkmale Von der Fakultät für Lebenswissenschaften der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina
Kindliches Temperament: Struktur und Zusammenhänge zu Verhaltensauffälligkeiten unter Berücksichtigung mütterlicher Merkmale Von der Fakultät für Lebenswissenschaften der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina
I Autismus-Spektrum-Störungen... 15
 Geleitwort der Autorinnen...... 5 Vorwort...... 7 I Autismus-Spektrum-Störungen... 15 1 Erscheinungsbild... 17 1.1 Hauptsymptome... 17 1.2 Klassifikation.... 19 1.3 Komorbide Erkrankungen und häufige Begleitsymptome...
Geleitwort der Autorinnen...... 5 Vorwort...... 7 I Autismus-Spektrum-Störungen... 15 1 Erscheinungsbild... 17 1.1 Hauptsymptome... 17 1.2 Klassifikation.... 19 1.3 Komorbide Erkrankungen und häufige Begleitsymptome...
Subjektive Befindlichkeit und Selbstwertgefühl von Grundschulkindern
 Christina Krause, Ulrich Wiesmann, Hans-Joachim Hannich Subjektive Befindlichkeit und Selbstwertgefühl von Grundschulkindern Pabst Science Publishers Lengerich, Berlin, Bremen, Miami, Riga, Viernheim,
Christina Krause, Ulrich Wiesmann, Hans-Joachim Hannich Subjektive Befindlichkeit und Selbstwertgefühl von Grundschulkindern Pabst Science Publishers Lengerich, Berlin, Bremen, Miami, Riga, Viernheim,
Evaluation zur Wirkung der Ausstellung Dämonen und Neuronen auf die Stigma-Ausprägung
 Evaluation zur Wirkung der Ausstellung Dämonen und Neuronen auf die Stigma-Ausprägung Fundierte und wirksame Anti-Stigma Arbeit ist eines der wichtigsten Ziele der Eckhard Busch Stiftung Köln. Daher bestand
Evaluation zur Wirkung der Ausstellung Dämonen und Neuronen auf die Stigma-Ausprägung Fundierte und wirksame Anti-Stigma Arbeit ist eines der wichtigsten Ziele der Eckhard Busch Stiftung Köln. Daher bestand
Praxis trifft Sportwissenschaft Sport mit Spaß Möglichkeiten & Grenzen von Emotionen im Sport. Dr. Peter Kovar
 Praxis trifft Sportwissenschaft Sport mit Spaß Möglichkeiten & Grenzen von Emotionen im Sport Dr. Peter Kovar Emotionen Sind komplexe Muster von Veränderungen, welche physiologische Erregung Gefühle kognitive
Praxis trifft Sportwissenschaft Sport mit Spaß Möglichkeiten & Grenzen von Emotionen im Sport Dr. Peter Kovar Emotionen Sind komplexe Muster von Veränderungen, welche physiologische Erregung Gefühle kognitive
Unterstützung von Familien mit psychisch kranken Eltern in Basel Erfolgsfaktoren und Stolpersteine
 Unterstützung von Familien mit psychisch kranken Eltern in Basel Erfolgsfaktoren und Stolpersteine Workshop-Tagung Kinder psychisch kranker Eltern 04.02.2016 Alain Di Gallo 1 Risikofaktoren Genetik Krankheits-
Unterstützung von Familien mit psychisch kranken Eltern in Basel Erfolgsfaktoren und Stolpersteine Workshop-Tagung Kinder psychisch kranker Eltern 04.02.2016 Alain Di Gallo 1 Risikofaktoren Genetik Krankheits-
Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen
 Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen Hintergrund Videospiele stellen die in ihnen handelnden Figuren häufig stereotyp
Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen Hintergrund Videospiele stellen die in ihnen handelnden Figuren häufig stereotyp
Der lange Schatten der Kindheit
 KatHO NRW Aachen Köln Münster Paderborn Der lange Schatten der Kindheit Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie mit erwachsenen Kindern psychisch erkrankter Eltern Vortrag auf der Jahrestagung 2017
KatHO NRW Aachen Köln Münster Paderborn Der lange Schatten der Kindheit Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie mit erwachsenen Kindern psychisch erkrankter Eltern Vortrag auf der Jahrestagung 2017
Sportpartizipation & Gewaltbereitschaft. bei Jugendlichen Ein deutsch-israelischer Vergleich
 Zu den Autoren Prof. Dr. Wolf-Dietrich Brettschneider lehrt und forscht an der Universität Paderborn im Department Sport und Gesundheit, Arbeitsbereich Sport und Erziehung. Zuvor war er Professor an der
Zu den Autoren Prof. Dr. Wolf-Dietrich Brettschneider lehrt und forscht an der Universität Paderborn im Department Sport und Gesundheit, Arbeitsbereich Sport und Erziehung. Zuvor war er Professor an der
Warum brauchen wir Prävention im Kindergarten?
 Warum brauchen wir Prävention im Kindergarten? BEA 18.05.2015 Irene Ehmke Suchtprävention mit Kindern und Familien Büro für Suchtprävention der HLS Irene Ehmke Warum schon im Kindergarten? Optimale Bedingungen
Warum brauchen wir Prävention im Kindergarten? BEA 18.05.2015 Irene Ehmke Suchtprävention mit Kindern und Familien Büro für Suchtprävention der HLS Irene Ehmke Warum schon im Kindergarten? Optimale Bedingungen
Workshop 1: Online-Tools und Benchmark zur Diagnose der Resilienz
 Workshop 1: Online-Tools und Benchmark zur Diagnose der Resilienz Dr. Roman Soucek Dr. Nina Pauls Ablauf des Workshops Einstieg ins Thema Zeit zum Testen Fragen und Diskussion Interpretation und Einsatz
Workshop 1: Online-Tools und Benchmark zur Diagnose der Resilienz Dr. Roman Soucek Dr. Nina Pauls Ablauf des Workshops Einstieg ins Thema Zeit zum Testen Fragen und Diskussion Interpretation und Einsatz
Belastung von Pflegekindern und Pflegeeltern DGSF-Tagung. Tania Pérez & Marc Schmid, Freiburg, Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik
 Belastung von Pflegekindern und Pflegeeltern DGSF-Tagung Tania Pérez & Marc Schmid, Freiburg, 04.10.2012 Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik Einleitung Pflegeeltern betreuen meist sehr belastete Kinder
Belastung von Pflegekindern und Pflegeeltern DGSF-Tagung Tania Pérez & Marc Schmid, Freiburg, 04.10.2012 Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik Einleitung Pflegeeltern betreuen meist sehr belastete Kinder
Von der Theorie über das Konstrukt zum Fragebogen
 Von der Theorie über das Konstrukt zum Fragebogen Brennpunkt Jugendalter Schulisches und außerschulisches Selbstkonzept von Jugendlichen. Geschlechts- und Schultypenunterschiede Renate Straßegger-Einfalt
Von der Theorie über das Konstrukt zum Fragebogen Brennpunkt Jugendalter Schulisches und außerschulisches Selbstkonzept von Jugendlichen. Geschlechts- und Schultypenunterschiede Renate Straßegger-Einfalt
The promotion of perceived physical ability via an intervention using internal teacher frame of reference in physical education
 The promotion of perceived physical ability via an intervention using internal teacher frame of reference in physical education Esther Oswald Institut für Sportwissenschaft, Universität Bern SGS-Tagung,
The promotion of perceived physical ability via an intervention using internal teacher frame of reference in physical education Esther Oswald Institut für Sportwissenschaft, Universität Bern SGS-Tagung,
Körperlich-sportliche Aktivität, Gesundheitsressourcen und Befinden Göttinger Studierender: Eine Frage des Geschlechts?
 Dr. des. Daniel Möllenbeck & Dr. Arne Göring Institut für Sportwissenschaft Universität Göttingen Körperlich-sportliche Aktivität, Gesundheitsressourcen und Befinden Göttinger Studierender: Eine Frage
Dr. des. Daniel Möllenbeck & Dr. Arne Göring Institut für Sportwissenschaft Universität Göttingen Körperlich-sportliche Aktivität, Gesundheitsressourcen und Befinden Göttinger Studierender: Eine Frage
Anstand heisst Abstand
 Inhalt Die Beziehung macht s! Soziale Beziehungen und Effekte im Unterricht ein altersunabhängiges Phänomen?. Mai 07 Manfred Pfiffner, Prof. Dr. phil. habil. Die Beziehung macht s! Soziale Beziehungen
Inhalt Die Beziehung macht s! Soziale Beziehungen und Effekte im Unterricht ein altersunabhängiges Phänomen?. Mai 07 Manfred Pfiffner, Prof. Dr. phil. habil. Die Beziehung macht s! Soziale Beziehungen
Therapeutisches Klettern mit Multiple Sklerose (TKMS)
 Lehrstuhl Präventive Pädiatrie 09.05.2015 Multiple Sklerose und Bewegung Therapeutisches Klettern mit Multiple Sklerose (TKMS) Dr. Claudia Kern Bewegung? Der größte Feind des bewegungsbehinderten MS-Kranken
Lehrstuhl Präventive Pädiatrie 09.05.2015 Multiple Sklerose und Bewegung Therapeutisches Klettern mit Multiple Sklerose (TKMS) Dr. Claudia Kern Bewegung? Der größte Feind des bewegungsbehinderten MS-Kranken
SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand. Seminar: Testen und Entscheiden Dozentin: Susanne Jäger Referentin: Julia Plato Datum:
 SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand Seminar: Testen und Entscheiden Dozentin: Susanne Jäger Referentin: Julia Plato Datum: 03.02.2010 Gliederung 1. Überblicksartige Beschreibung 2. Testgrundlage 3.
SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand Seminar: Testen und Entscheiden Dozentin: Susanne Jäger Referentin: Julia Plato Datum: 03.02.2010 Gliederung 1. Überblicksartige Beschreibung 2. Testgrundlage 3.
Quälgeister und ihre Opfer
 Francoise D. Alsaker Quälgeister und ihre Opfer Mobbing unter Kindern - und wie man damit umgeht Verlag Hans Huber Toronto Inhaltsverzeichnis Inhalt Vorwort... 1.Mobbing als besondere Form der Gewalt...
Francoise D. Alsaker Quälgeister und ihre Opfer Mobbing unter Kindern - und wie man damit umgeht Verlag Hans Huber Toronto Inhaltsverzeichnis Inhalt Vorwort... 1.Mobbing als besondere Form der Gewalt...
Psychosoziale Diagnostik in der Jugendhilfe
 Viola Harnach Psychosoziale Diagnostik in der Jugendhilfe Grundlagen und Methoden für Hilfeplan, Bericht und Stellungnahme 5., überarbeitete Auflage 2007 Juventa Verlag Weinheim und München Inhalt 1. Aufgaben
Viola Harnach Psychosoziale Diagnostik in der Jugendhilfe Grundlagen und Methoden für Hilfeplan, Bericht und Stellungnahme 5., überarbeitete Auflage 2007 Juventa Verlag Weinheim und München Inhalt 1. Aufgaben
1 Einleitung Erster Teil: Theoretischer Hintergrund Warum Mathematik? - Bedeutung des Faches Mathematik... 14
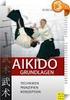 Inhaltsverzeichnis 3 INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung... 11 Erster Teil: Theoretischer Hintergrund... 14 2 Warum Mathematik? - Bedeutung des Faches Mathematik... 14 2.1 Sieben Gründe für den Mathematikunterricht
Inhaltsverzeichnis 3 INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung... 11 Erster Teil: Theoretischer Hintergrund... 14 2 Warum Mathematik? - Bedeutung des Faches Mathematik... 14 2.1 Sieben Gründe für den Mathematikunterricht
Wenn Kinder Jugendliche werden
 Manuela Ullrich 2 Tn- o Wenn Kinder Jugendliche werden Die Bedeutung der Familienkommunikation im Übergang zum Jugendalter Juventa Verlag Weinheim und München 1999 Inhalt /. Betrachtungen zum Prozeß der
Manuela Ullrich 2 Tn- o Wenn Kinder Jugendliche werden Die Bedeutung der Familienkommunikation im Übergang zum Jugendalter Juventa Verlag Weinheim und München 1999 Inhalt /. Betrachtungen zum Prozeß der
0 Vorwort Einleitung...2. Teil I Theoretischer Hintergrund
 Inhaltsverzeichnis 0 Vorwort...1 1 Einleitung...2 Teil I Theoretischer Hintergrund 2 Kriminalität und ihre Gesichter...5 2.1 Kriminologische Ansätze zur Klassifikation von Straftätern...6 2.1.1 Die Einschätzung
Inhaltsverzeichnis 0 Vorwort...1 1 Einleitung...2 Teil I Theoretischer Hintergrund 2 Kriminalität und ihre Gesichter...5 2.1 Kriminologische Ansätze zur Klassifikation von Straftätern...6 2.1.1 Die Einschätzung
Persönliche Ziele junger Erwachsener
 Oliver Lüdtke Persönliche Ziele junger Erwachsener Waxmann Münster / New York München / Berlin Inhalt 1 Einleitung 9 2 Das Zielkonzept: Eine theoretische Einbettung 13 2.1 Zielgerichtetes Verhalten: Ziele,
Oliver Lüdtke Persönliche Ziele junger Erwachsener Waxmann Münster / New York München / Berlin Inhalt 1 Einleitung 9 2 Das Zielkonzept: Eine theoretische Einbettung 13 2.1 Zielgerichtetes Verhalten: Ziele,
Depression bei Kindern und Jugendlichen
 Cecilia A. Essau Depression bei Kindern und Jugendlichen Psychologisches Grundlagenwissen Mit 21 Abbildungen, 41 Tabellen und 139 Übungsfragen 2., überarbeitete Auflage Ernst Reinhardt Verlag München Basel
Cecilia A. Essau Depression bei Kindern und Jugendlichen Psychologisches Grundlagenwissen Mit 21 Abbildungen, 41 Tabellen und 139 Übungsfragen 2., überarbeitete Auflage Ernst Reinhardt Verlag München Basel
Abschlusstagung Ergebnisse bezüglich der Veränderungsmessung und Zielerreichung. Bern, Claudia Dölitzsch, Simon Schlanser, Michael Kölch
 Abschlusstagung Ergebnisse bezüglich der Veränderungsmessung und Zielerreichung Bern, 23.3.2012 Claudia Dölitzsch, Simon Schlanser, Michael Kölch Gliederung Veränderung der psychischen Probleme Achenbachskalen
Abschlusstagung Ergebnisse bezüglich der Veränderungsmessung und Zielerreichung Bern, 23.3.2012 Claudia Dölitzsch, Simon Schlanser, Michael Kölch Gliederung Veränderung der psychischen Probleme Achenbachskalen
Aggression bei Kindern und Jugendlichen
 Cecilia A. Essau Judith Conradt Aggression bei Kindern und Jugendlichen Mit 21 Abbildungen, 11 Tabellen und 88 Übungsfragen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Inhalt Vorwort und Danksagung 11 I Merkmale
Cecilia A. Essau Judith Conradt Aggression bei Kindern und Jugendlichen Mit 21 Abbildungen, 11 Tabellen und 88 Übungsfragen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Inhalt Vorwort und Danksagung 11 I Merkmale
Selbstwertgefühl sehbehinderter und blinder Kinder und Jugendlicher in sozialen Interaktionen
 Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes 1017 Selbstwertgefühl sehbehinderter und blinder Kinder und Jugendlicher in sozialen Interaktionen
Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes 1017 Selbstwertgefühl sehbehinderter und blinder Kinder und Jugendlicher in sozialen Interaktionen
Triple P im Überblick
 Liebend gern erziehen Triple P im Überblick Durch die positiven Strategien haben wir wieder einen liebevollen Kontakt zueinander gefunden, der nichts mit,schlechtem Gewissen zu tun hat und den wir genießen.
Liebend gern erziehen Triple P im Überblick Durch die positiven Strategien haben wir wieder einen liebevollen Kontakt zueinander gefunden, der nichts mit,schlechtem Gewissen zu tun hat und den wir genießen.
Leben nach Krebs. Joachim B. Weis. Belastung und Krankheitsverarbeitung im Verlauf einer Krebserkrankung
 Joachim B. Weis Leben nach Krebs Belastung und Krankheitsverarbeitung im Verlauf einer Krebserkrankung Verlag Hans Huber Bern Göttingen Toronto Seattle Inhaltsverzeichnis VORWORT. 1 KRANKHEITSVERARBEITUNG:
Joachim B. Weis Leben nach Krebs Belastung und Krankheitsverarbeitung im Verlauf einer Krebserkrankung Verlag Hans Huber Bern Göttingen Toronto Seattle Inhaltsverzeichnis VORWORT. 1 KRANKHEITSVERARBEITUNG:
Das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern
 Referat an der Eröffnungstagung des Kantonalen Netzwerkes Gesundheitsfördernder Schulen, 20. Januar 2007, Tagungszentrum Schloss Au / ZH Das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern Tina Hascher (tina.hascher@sbg.ac.at)
Referat an der Eröffnungstagung des Kantonalen Netzwerkes Gesundheitsfördernder Schulen, 20. Januar 2007, Tagungszentrum Schloss Au / ZH Das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern Tina Hascher (tina.hascher@sbg.ac.at)
Computerspiele & Sozialverhalten: Effekte gewalttätiger und prosozialer Computerspiele. Prof. Dr. Tobias Greitemeyer Universität Innsbruck
 Computerspiele & Sozialverhalten: Effekte gewalttätiger und prosozialer Computerspiele Prof. Dr. Tobias Greitemeyer Universität Innsbruck 1 Medienkonsum In der heutigen Zeit sind wir vielfältigem Medienkonsum
Computerspiele & Sozialverhalten: Effekte gewalttätiger und prosozialer Computerspiele Prof. Dr. Tobias Greitemeyer Universität Innsbruck 1 Medienkonsum In der heutigen Zeit sind wir vielfältigem Medienkonsum
Mutabor Therapeutische Tagesstätte am Stemmerhof. Evaluation von Behandlungseffekten
 Dr. Barbara Baur (Dipl.-Psych.) Wissenschaftliche Beratung und Evaluation XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX Tel.: XXX-XXXXXXXX Email: XXXXXX@lXXXXX.XXX Mutabor Therapeutische Tagesstätte am Stemmerhof Evaluation
Dr. Barbara Baur (Dipl.-Psych.) Wissenschaftliche Beratung und Evaluation XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX Tel.: XXX-XXXXXXXX Email: XXXXXX@lXXXXX.XXX Mutabor Therapeutische Tagesstätte am Stemmerhof Evaluation
Prävention posttraumatischer Belastung bei jungen brandverletzten Kindern: Erste Ergebnisse einer randomisiert-kontrollierten Studie
 Prävention posttraumatischer Belastung bei jungen brandverletzten Kindern: Erste Ergebnisse einer randomisiert-kontrollierten Studie M.Sc. Ann-Christin Haag CCMH Symposium 26.01.2017 Einleitung Ca. 80%
Prävention posttraumatischer Belastung bei jungen brandverletzten Kindern: Erste Ergebnisse einer randomisiert-kontrollierten Studie M.Sc. Ann-Christin Haag CCMH Symposium 26.01.2017 Einleitung Ca. 80%
