Entwicklungspolitik als Herrschaftstechnik? Dokumentation des Seminars
|
|
|
- Michael Kohl
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Entwicklungspolitik als Herrschaftstechnik? Dokumentation des Seminars Pullach bei München Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit e. V.
2
3 Dokumentation des Seminars erstellt vom Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit e. V. Pariser Straße 13, München Tel Fax Andrés Schmidt, Detlef von Bismarck, Eberhard Albrecht, Nicola Philipp, Raphael Kiczka Inhaltsverzeichnis: Einführung: Entstehung der Seminaridee und Ziel des Seminars...4 Referat Aram Ziai: Entwicklungspolitik als Herrschaftstechnik ein Beitrag aus diskursanalytischer Perspektive...5 Referat Danuta Sacher: Globale Gerechtigkeit braucht Strukturanpassung im Norden...10 AG 1: Staatliche Entwicklungszusammenarbeit als Türöffner für Privatwirtschaft - Beispiele aus Mittelamerika und Mexiko...12 AG 2: Geostrategische und biopolitische Dimensionen von Entwicklungspolitik...15 AG 3: Untersuchung des Entwicklungsdiskurses an konkreten Beispielen aus der nichtstaatlichen Enwicklungszusammenarbeit...18 Plenum: Diskussion zur Solidaritätsarbeit...22 Geschichte der Solidaritätsarbeit...23 Nicaragua Solidarität...24 Fazit der SeminarteilnehmerInnen...26 Seite 3
4 Einführung: Entstehung der Seminaridee und Ziel des Seminars Das Ökumenische Büro wurde vor 25 Jahren im Rahmen der Nicaragua Solidarität gegründet. Das was wir in den folgenden Jahren gemacht haben, ist in unserem Selbstverständnis immer Solidaritätsarbeit gewesen. Im Zentrum unserer Arbeit stand, und steht heute noch, die Organisation von Solidaritätsbrigaden zuerst nach Nicaragua später auch nach El Salvador. Ob in den 80er Jahren Brigaden die sandinistische Regierung Nicaraguas mit Schulbauprojekten beim Aufbau des Erziehungswesens unterstützt haben, oder ob im vergangenen Jahr eine Brigade in El Salvador der Organisation Oikos bei einem Erosionsschutzprojekt unterstützt hat, für uns war es immer Solidaritätsarbeit. Aber gerade das Brigadenprojekt in El Salvador im Jahr 2007 war ein Anlass, uns intensiver mit der Frage zu beschäftigen: Was unterscheidet eigentlich unsere Arbeit von Entwicklungshilfe? Für das Erosionsschutzprojekt hatte Oikos über eine andere deutsche Organisation Mittel aus dem BMZ-Haushalt bekommen. Sie baten uns, sie bei der Restfinanzierung zu unterstützen. Nach längeren Diskussionen stimmten wir zu und beteiligten uns an dem Projekt, das eben auch Mittel aus der staatlichen deutschen Entwicklungshilfe bezog. Die Beschäftigung mit dem Thema Entwicklungspolitik begann damit, dass die Brigade sich in diesem Jahr neben ihrer praktischen Arbeit in El Salvador schwerpunktmäßig theoretisch mit dem Thema befasste. Bei unseren Besuchen in Zentralamerika waren wir immer wieder Menschen begegnet, die das Engagement unserer Organisation als Entwicklungshilfe wahrnahmen. Bei einigen stellten wir auch fest, dass sie von der deutschen staatlichen Entwicklungspolitik eine recht positive Meinung hatten. Dabei wurden nicht allein die finanziellen Zuwendungen, und die Technik von Projekten geschätzt, sondern es gab auch politische Zustimmung in Kreisen, die man als links bezeichnen kann. Kurz und gut es gab dringenden Bedarf, sich mit dem Thema Entwicklungshilfe etwas intensiver zu beschäftigen. Anfang 2007 bildete sich im Ökumenische Büro ein Arbeitskreis zum Thema Entwicklungshilfe, der sich zuerst großteils mit sehr praktischen Themen beschäftigte. Wir sammelten z. B: Informationen zu den Projekten der deutschen staatlichen Entwicklungshilfe in unserem Interessensgebiet Zentralamerika, und versuchten die unterschiedlichsten politischen Ansätze im Bereich der nichtstaatlichen Entwicklungshilfe einzuordnen. In diesem Arbeitskreis hatten wir aber vor allem das Bedürfnis uns mit dem Begriff Entwicklungshilfe und der Politik, die dieser Begriff transportiert, kritisch auseinander zu setzen. Dabei sind wir auf das Buch Zwischen Global Governance und Post-Deelopment, Entwicklungspolitik aus diskursanalytischer Perspektive von Aram Ziai gestoßen. Die Thesen dieses Buches erweckten in uns den Wunsch, darüber in einem größeren Kreis zu diskutieren. So entstand mit der Zeit die Idee zu dem Seminar: Entwicklungspolitik als Herrschaftstechnik? Was erhoffte sich das Ökumenische Büro nun von diesem Seminar? Wie schon gesagt, hatten wir Lust darauf, unsere Kritik an der Politik der Entwicklungshilfe in einem größeren Kreis zu diskutieren. Unsere Hoffnung war dabei, aus der Kritik am Konzept Entwicklungspolitik/-hilfe eine positive Idee für das Konzept der Solidaritätsarbeit zu entwickeln, an dem wir unsere praktische Arbeit messen können. Seite 4
5 Entwicklungspolitik als Herrschaftstechnik ein Beitrag aus diskursanalytischer Perspektive Aram Ziai (Textfassung der PowerPoint-Präsentation) Gliederung: 1. Einstieg 2. Beispiele 3. Theorie 4. Gegenrede 5. Aktuelle Tendenzen 1. Einstieg Keine Menschenopfer für Entwicklung Slogan der DemonstrantInnen gegen den Sardar Sarovar Staudamm vor der indischen Botschaft in Bonn 1999 So you want our country to remain underdeveloped! Antwort eines hochrangigen Mitarbeiters der indischen Botschaft In Entwicklungsländern ist es notwendig, Menschen hinzurichten, um Stabilität und die Entwicklung der Wirtschaft zu sichern Vorsitzender der Chinesischen Forschungsgesellschaft für Menschenrechte beim deutsch-chinesischen Symposium in Peking Niemand will das Massaker auf dem Tian an men Platz verteidigen, aber wenn das notwendig war, um die politische Desintegration des Landes zu verhindern und wir weiterhin zufrieden sind über die graduellen Fortschritte in der Reduzierung der Armut und in der politischen Öffnung Chinas, dann sollten wir weiter mit China zusammenarbeiten. Mitarbeiter der Weltbank Versprechen auf Entwicklung : Behauptung, dass die 3. Welt in wenigen Jahrzehnten den Lebensstandard der Industrienationen erreichen würde, als Anreiz zum Verbleib im kapitalistischen Weltsystem und zur Aufrechterhaltung der kolonialen internationalen Arbeitsteilung. 2. Beispiele 2.1 Guatemala: Flüchtlingshilfe und Aufstandbekämpfung Modelldörfer/Entwicklungspole und Zivilpatrouillen zur Befriedung der Konfliktgebiete Flüchtlinge: kollektive Rückkehr wird systematisch unterminiert, Spaltung der Bevölkerung (Landvergabe), Einzelfälle als PR-Objekte EG: Repatriierungshilfe, aber tatsächlich Unterstützung für militärische Aufstandsbekämpfung 2.2 Indien: Staudammprojekte und Massenvertreibungen Seite 5
6 Narmada Valley Development Project: allein für Sardar Sarovar (Gujarat) sind geschätzte Menschen umgesiedelt bzw. vertrieben worden Umwelt- und Umsiedlungspläne wurden nicht eingehalten, v.a. Adivasis (Ureinwohner) betroffen, die meisten landeten als Flüchtlinge in den Slums der Städte Heftige Proteste brachten die Weltbank 1993 dazu, sich aus dem Projekt zurückzuziehen, der indische Staat machte weiter 2.3 Peru: Familienplanung und Zwangsterilisation Nationales Programm für reproduktive Gesundheit und Familienplanung als Mittel zur Armutsbekämpfung Sterilisationsfestivals und quoten, Anreize und Druckmittel, Fälle von Operationen ohne Einwilligung der Betroffenen US-AID, Weltbank und UNFPA als wichtige Geldgeber der peruanischen Bevölkerungspolitik, Frauen-NGOs als Partner 2.4 Mexiko: Biodiversität im Konfliktgebiet Projekt zur sozial-integrativen und nachhaltigen Entwicklung in Chiapas Ressourcenschonende Anbaumethoden, vermarktungsfähige Produkte, Tourismus, Erhalt der biologischen Vielfalt EU und mexikanische Regierung als Hauptgeldgeber Keine Partizipation, Konfliktsituation in der Region (zapatistische autonome Gemeinden) wird ignoriert (MR-Verletzungen, Vertreibungen unter dem Vorwand der Umweltzerstörung, Ignorieren indigener Forderungen), Spaltung der Bevölkerung, Ziel: sicherer Ressourcenzugang 2.5 Lesotho: Ländliche Entwicklung als Ausweitung bürokratischer Kontrolle Thaba-Tseka integrated rural development project: Modernisierung in den Bereichen Infrastruktur, Landwirtschaft, Gesundheitspolitik, Verwaltung Aneignung und Instrumentalisierung von Ressourcen durch die Regierungspartei BNP, Nebeneffekt des gescheiterten Entwicklungsprojekts: intensivierte bürokratische (und militärische) Kontrolle Geldgeber: Weltbank und CIDA 3. Theorie Entwicklungspolitik etabliert in diesen Fällen Herrschaftsverhältnisse: 1. zwischen Experten und Betroffenen 2. zugunsten von staatlichen Eliten im Süden 3. zugunsten von Konzernen im Norden These: Bei den Beispielen handelt es sich nicht nur um zufällige Verknüpfungen von Entwicklungspolitik und Herrschaftsverhältnissen bzw. die Instrumentalisierung von eigentlich sinnvollen Projekten. Das Konzept der Entwicklung legitimiert bereits Herrschaftsverhältnisse. Seite 6
7 Wodurch werden diese Herrschaftsverhältnisse in der Entwicklungspolitik legitimiert? 1. Durch die allgemeine Akzeptanz von Entwicklung als normativ positiv aufgeladener Begriff. Er bezeichnet einen wünschenswerten gesellschaftlichen Zustand oder den Weg dorthin, der für jeden EinzelneN vorteilhaft ist. Politische Maßnahmen wurden daher meist im Namen der nationalen Entwicklung gerechtfertigt. 2. Dies erlaubt auch, negative Auswirkungen von Entwicklungsprojekten entweder nicht ernst zu nehmen es handelte sich nicht wirklich um Entwicklung, richtige Entwicklung ist gut für alle oder in Kauf zu nehmen als ein notwendiger Preis des Fortschritts. 3. Durch seine Privilegierung von Expertenwissen. Dies ist universelles, ortsunabhängiges Wissen über diesen wünschenswerten Zustand und den Prozess seiner Erreichung, das EntwicklungsexpertInnen zueigen ist. Es verleiht demnach autoritäre Entscheidungsgewalt über gesellschaftliche Veränderungen. 4. Durch seine Hierarchisierung von Kulturen und Lebensweisen. Das Konzept basiert auf der Annahme einer universellen Entwicklungsbahn der Menschheit, auf der einige Gesellschaften weiter fortgeschritten sind. Kulturelle Unterschiede werden in der vergleichenden Methode verzeitlicht und die Herausbildung des modernen Industriekapitalismus verallgemeinert. Praktisch wird Herkunft aus dem Westen und weiße Hautfarbe oft mit Expertenwissen assoziiert. 5. Durch die Entpolitisierung von Armut als technisches Problem. Soziale Ungleichheit erscheint im traditionellen Entwicklungsdiskurs als Resultat einer historischgesellschaftlichen Rückständigkeit, die durch Modernisierung, Industrialisierung und Kapitalinvestition bzw. durch Interventionen auf der Basis von Expertenwissen aufhebbar ist nicht als Resultat gesellschaftlicher Machtverhältnisse. 6. Durch die Konzeption, dass Investitionen und Technologien aus dem Norden unabdingbar für positiven sozialen Wandel im Süden sind, wird die Tätigkeit von profitorientierten Unternehmen tendenziell verklärt. Entwicklungsdiskurs: Dualismus (entwickelte/weniger entwickelte) Evolutionismus (nicht- westliche Lebensweisen als rückständige Vorstufen) Sozialtechnologie (rationale Umstrukturierung der Gesellschaft) Im Entwicklungsdiskurs dient das Eigene als Norm, anhand derer die Minderwertigkeit des Fremden objektiv nachgewiesen wird. Dies zeigt sich auch in der Messung von Entwicklung. Wissen von der Entwicklung ist Wissen von der Falschheit anderer Lebensweisen und ihrer notwendigen Veränderung, also diagnostisches und therapeutisches Wissen. Dieses Wissen wird meist im Norden verortet, die gesellschaftlichen Probleme im Süden. 4. Gegenrede Aber gibt es nicht einige/viele Entwicklungsprojekte, die den Menschen tatsächlich zu einem besseren Leben auch gemessen an ihren eigenen Vorstellungen verhelfen? Seite 7
8 Beispiel: Indien: Armutsbekämpfung und Ressourcenschutz Durchführung durch indische NRO Partizipation der Bevölkerung Verteilung von Kühen und Ziegen, Kompostierung von Abfällen, Produktionserhöhung durch besseres Saatgut, Produktionsdiversifizierung durch Anpflanzung von Gemüse, Obst- oder Teakbäumen, neues Gewerbe als Einkommensquelle These: Auch ein gutes Entwicklungsprojekt vermittelt den Betroffenen, dass ihre bisherige Lebensweise defizitär ist und der Umgestaltung durch wissende ExpertInnen in Form von Hilfe zur Entwicklung bedarf. Es beinhaltet ein Machtverhältnis und konstituiert sie als Teil einer rückständigen Kultur. Disclaimer: Das heißt nicht, dass auch die guten Projekte deswegen ausnahmslos abzulehnen sind. 5. Aktuelle Tendenzen Transformation des Entwicklungsdiskurses seit den 1980er Jahren: Marktliberalisierung ( staatliche Eingriffe behindern Entwicklung ) Aufgabe des Entwicklungsversprechens Reichtum für Alle zugunsten von Eindämmung der Armut (Millenium Development Goals) Krisenprävention Good Governance Nachhaltige Entwicklung, Eine Welt-Diskurs (Armut als Bedrohung für den Norden) Global Governance Partizipation, Empowerment, Mainstreaming Gender Poverty Reduction Strategy Papers: Erstellung von Armutsbekämpfungstrategien als Vorbedingung für Entschuldung bzw. günstige Kredite. Budget- statt Projekthilfe, institutionalisierter Politikdialog zwischen Gebern und Nehmern. Veränderung staatlicher Herrschaft im PRSP-Prozess: Internationalisierung Informalisierung Gouvernementalisierung: Ideologie der Eigenverantwortlichkeit Seite 8
9 Literatur Aram Ziai: Zwischen Global Governance und Post-Development - Entwicklungspolitik aus diskursanalytischer Perspektive, 2006, Westphälisches Dampfboot Globale Strukturpolitik?, 2007, Westphälisches Dampfboot Seite 9
10 Globale Gerechtigkeit braucht Strukturanpassung im Norden Danuta Sacher Leiterin der Abteilung Politik und Kampagnen bei Brot für die Welt Mitschrift vom Ökumenischen Büro In den Mittelpunkt ihrer Ausführungen stellte Danuta Sacher die Studie Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt. Diese Studie wird im Augenblick vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie im Auftrag von BUND, EED und Brot für die Welt erarbeitet und soll im Herbst dieses Jahres erscheinen. In gewisser Weise ist dies eine Fortsetzung der Arbeit, die 1996 mit der Studie: Zukunftsfähiges Deutschland begonnen wurde. Danuta Sacher gab einen kurzen historischen Überblick über die Geschichte des Entwicklungsgedankens. Diese sieht sie als die Geschichte einer Reihe von gescheiterten Entwicklungsphasen. Mit dem Jahr 1989 kommt das Ende der großen Theorien, seit ungefähr 2000 muss allen klar sein, dass alle Entwicklungsversprechen der vergangenen 40 Jahre nicht funktioniert haben. Geblieben sind im Augenblick nur die Milleniumsziele, die Danuta Sacher als Minimalziele sieht, mit denen man politisch arbeiten kann. Auszüge aus der Studie: Schon, dass es in der Studie um das Industrieland Deutschland geht, dessen Entwicklung untersucht wird, macht deutlich, dass es hier um ein anderes Entwicklungskonzept geht. Seite 10
11 Den Begriff Entwicklung positiv neu füllen: o im Sinne von Empowerment: Die eigene Fähigkeit stärken, Armut zu überwinden o Globalisierung: Spaltung in Arm und Reich vergrößert sich auch in den Ländern des Nordens Der Entwicklungsbegriff muss auch im Norden anwendbar sein. o Angesichts des Klimawandels: Entwicklung als nachhaltiges Gesellschaftsmodell, Länder des Nordens haben auch hier Entwicklungsbedarf. Notwendigkeit von staatlicher Intervention, Ablehnung des neoliberalen Modells, Ablehnung der Orientierung am Wachstum. Kontinuität in der Projektarbeit. Wie werden Projekte ausgewählt? Partnerorganisationen im Süden reichen Projektvorschläge ein. Entwicklung muss immer zusammengedacht werden mit den Begriffen Gerechtigkeit und Ökologie. Die Probleme der Ökologie, wie Klimawandel, Endlichkeit der Ressourcen, machen deutlich, dass die Systemgrenzen erreicht sind. Der Klimawandel fordert einen Zivilisationswandel in der Einen Welt. Diskussion und Kritik: Verkürzende Apelle, die die Themen Kapitalismus und Internationale Herrschaftsverhältnisse vermeiden. Hoffnung auf die Vernunft von Regierungen. Welche Maßnahmen von Brot für die Welt dienen der Erreichung der beschriebenen Ziele? Inwieweit lässt sich vor diesem Hintergrund die Öffentlichkeitsarbeit von Brot für die Welt erklären (Z.B. entpolitisierende Plakate, die suggerieren, dass durch Spenden an Brot für die Welt den Armen geholfen werde) Antwort D.S.: Brot für die Welt mache Arbeit für eine heterogene Masse von Menschen, viele Spender wollten mit den Zusammenhängen nicht konfrontiert werden, die Bildungsmaterialien für z.b. Schulen gingen aber wesentlich tiefer. Seite 11
12 Staatliche Entwicklungszusammenarbeit als Türöffner für Privatwirtschaft - Beispiele aus Mittelamerika und Mexiko Bericht von der AG 1 Das Thema wurde an Hand der beiden Referate Biodiversitätsschutz (Ökumenisches Büro) Wasserprivatisierung (Danuta Sacher) behandelt. Biodiversitätsschutz Den globalen politischen Rahmen bildet die Biodiversitätskonvention (Convention on Biological Diversity, CBD). Sie wurde 1992 in Rio verabschiedet. Ziele und Problematiken erschließen sich sehr gut aus dem Artikel 1 der Konvention: Die Ziele dieses Übereinkommens, die in Übereinstimmung mit seinen maßgeblichen Bestimmungen verfolgt werden, sind die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile, insbesondere durch angemessenen Zugang zu genetischen Ressourcen und angemessene Weitergabe der einschlägigen Technologien unter Berücksichtigung aller Rechte an diesen Ressourcen und Technologien sowie durch angemessene Finanzierung. Die Ziele Erhaltung der biologischen Vielfalt und nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile sind relativ unstrittig. Sie sind die Basis für das deutsche Engagement beim Aufbau und Erhalt von Biosphärenreservaten. Beim dritten Ziel (Vorteilsausgleich und Zugang) gibt es natürlich erhebliche Differenzen zwischen den Ländern, auf deren Territorium sich eine große biologische Vielfalt findet, und den Ländern, die über Pharma- und Agroindustrie verfügen. Erstere denken eher an Vorteilsausgleich letztere an ungehinderten Zugang. Im Mai fand dazu in Bonn die 9. Vertragsstaatenkonferenz der CBD 2008 statt. Gerade das dritte Ziel hat dort eine große Rolle gespielt. Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechter Vorteilsausgleich ist der kritische Verhandlungspunkt, denn bis zum Jahr 2010 sollen dafür völkerrechtlich verbindliche Regeln entwickelt werden. Dass die USA, ein strikter Gegner der Konvention, diese unterzeichnet, aber nicht ratifiziert haben, macht das Vorhaben bestimmt nicht leichter. Die deutsche staatliche Entwicklungshilfe (KfW, GTZ) zeigt einen bemerkenswerten Einsatz beim Biosphärenschutz in der artenreichen Region Mittelamerika. Außer in Biosphärenreservaten in Nicaragua (Bosawas, das Programm läuft seit 1994 bis 2012), in Honduras (Río Platano) und im Süden Mexikos, ist die GTZ auch bei dem sogenannten Biologischen Korridor Mittelamerika beteiligt. In all diesen Naturschutzgebieten gibt es die gleichen Probleme, das Vordringen der Landwirtschaftsgrenze, illegaler Holzeinschlag und (Land-)Konflikte zwischen ansässigen indigenen Gruppen und vordringenden Siedlern. Nirgends wird versucht, die Ursache der Probleme anzufassen: die rasant fortschreitende Umwandlung von Tropenwald in Weidefläche für die Exportlandwirtschaft (Fleisch). Letzteres wird durch die abgeschlossenen (CAFTA) oder gerade verhandelten (Assoziierungsabkommen EU Zentralamerika) Freihandelsverträge immer mehr gefördert. An vielen der genannten Orte ist es in den letzten Jahren zu Vertreibungen gekommen. Seite 12
13 Fazit: Naturschutz wird zu Lasten der Armen gemacht. Das starke Engagement der BRD in dieser Gegend mit ihrer reichen Biodiversität legt den Verdacht nahe, dass es ökonomischen Interessen dient. Wenn die Vertragsstaatenkonferenz der CBD in den nächsten Jahren einmal für die Länder des Nordens, den Sitz der Pharmakonzerne, einen sie zufrieden stellenden Vorteilsausgleich ausgehandelt haben wird, dann ist die GTZ in Mittelamerika vor Ort und hat den deutschen Unternehmen das Feld bereitet. Wasserprivatisierung Bis Anfang dieses Jahrzehnts trat die deutsche Regierung deutlich für Wasserprivatisierungen ein. Es wurde angenommen, dass durch Deregulierungen im Wassermarkt private Investitionen angelockt werden könnten, die Effizienz der Wasserversorgung und der Zugang zu ihr verbessert werden würde und so die Privatisierung der Wasserversorgung entwicklungspolitisch sinnvoll sei. Es fanden Foren mit der Wasserwirtschaft statt, um auf die Wünsche der deutschen Unternehmen besser eingehen und mögliche Investitionsschranken abbauen zu können, denn die Bundesregierung ist an einer leistungsfähigen deutschen Wasserwirtschaft interessiert, die auch eine starke Rolle spielt auf dem Weltmarkt, der erheblich an Bedeutung gewinnt." (Uschi Eid 2001) Die Partnerschaft mit dem Privatsektor sollte das fehlende Geld einbringen, die Synergieeffekte den öffentlichen Haushalt entlasten und die Entwicklungshilfe optimieren. Es wurde angenommen, dass ohne Hilfe der Wirtschaft die Ziele der Entwicklungshilfe, wie die MDGs oder im Wassersektor z.b. Armutsbekämpfung, nachhaltige Ressourcennutzung und Konfliktprävention, nicht erreicht werden können. Die Bundesregierung förderte Private-Public-Partnerships (PPPs) und verlangte bei ihren Projekten häufig mit enormen Druck die Einbeziehung des Privatsektors. Es wurde das deutsche Modell promoviert, was sich durch eine autonome Unternehmensverfassung und Anbindung an kommunale EntscheidungsträgerInnen auszeichnet. So wird als Forderung meist Dezentralisierung und die Bildung von kommerziell operierenden autonomen Betrieben gefordert. Von einer Forderung nach völliger Privatisierung wird allerdings Abstand genommen. Dies hat verschiedene Gründe: Aufgrund zu hoher Risiken in Entwicklungsländern und geringer Gewinnerwartung wird von den Unternehmen eine full-scale Privatisierung meist nicht mehr gewünscht. Große Wasserunternehmen wie Suez, Veolia, Saur und RWE zogen sich aus den Entwicklungsländern zurück. Eine staatliche Risikoabsicherung und Teilung der Verantwortung durch die PPPs ist besonders für deutsche Unternehmen wertvoll. Können sie auf großer Ebene nicht mit französischen und englischen Unternehmen mithalten so sind Seite 13
14 sie doch im Bereich von Management and Consulting sehr konkurrenzfähig, haben schon Erfahrung in dezentraler Wasserbewirtschaftung und profitieren so stark von Teilprivatisierungen, die die Regierung durchsetzte. Spätestens nach der durchaus selbstkritischen Evaluation der Weltbank und ihrer Privatisierungsprogramme 2004 und vielen negativen Erfahrungen hat sich die Rhetorik allerdings auch auf deutscher Seite geändert. In Sektorkonzepten und Stellungnahmen des BMZ oder der KfW ist nunmehr selten explizit von Privatisierung die Rede. Vielmehr von undogmatischen Einzelentscheidungen, die den Fokus auf einen besseren Zugang für die arme Bevölkerung legen. Die Wasserversorgung soll dezentral und kostendeckend arbeiten. Inwiefern eine kostendeckende Wasserversorgung, die keine staatlichen Subventionen erhält und wohl bei dezentraler Betreibung nur eine sehr eingeschränkte Möglichkeit von Quersubventionierung hat, wirklich armutsorientiert sein kann, bleibt ungewiss. Durch die erfolgte Sensibilisierung der Bevölkerung scheint die deutsche Entwicklungshilfe nicht mehr so vehement Privatisierungen vorantreiben zu können. Die Privatisierungsdynamik im Wassersektor scheint fürs erste zumindestens gebremst. Ausgebremst ist sie aber sicherlich noch nicht. So schreibt die KfW immer noch auf ihrer Homepage: Vielfach ebnet die KfW Entwicklungsbank den Weg zur Privatisierung und deren positive Effekte und so ist es notwendig wachsam zu bleiben und außerdem die Rekommunalisierungen der privatisierten Wasserversorgung weiter zu forcieren. Seite 14
15 Geostrategische und biopolitische Dimensionen von Entwicklungspolitik Referentin: Susanne Schultz Bericht von der AG 2 Internationale Entwicklungshilfe konstituierte sich nach dem 2. Weltkrieg nicht nur in engem Zusammenhang mit weltwirtschaftlichen, sondern auch mit militärisch-geostrategischen und bevölkerungspolitischen Rationalitäten und Interessen. In diesem Workshop wollten wir einerseits der Geschichte zivil-militärischer Kooperation, also der Einbindung von Entwicklungspolitik in Strategien der Militarisierung und Aufstandsbekämpfung nachgehen, andererseits der Geschichte der Einbindung von Entwicklungspolitik in neomalthusianische Strategien zur Begrenzung des Bevölkerungswachstums. Konkrete historische Beispiele sind die Integration entwicklungspolitischer Programme in die Aufstandsbekämpfung in Guatemala, andererseits das Bevölkerungsprogramm unter Präsident Fujimori Ende der 1990er Jahre in Peru. Über die historische Rekonstruktion dieser Dimensionen von Entwicklungspolitik im Kontext von Counterinsurgency und Population Policies diskutierten wir aktuelle Kontinuitäten und Veränderungen dieser Dimensionen von Entwicklungspolitik anhand weiterer Beispiele. Ziel der AG II war, zwei Themen genauer unter die Lupe zu nehmen: 1. Entwicklungspolitik und zivilmilitärische Kooperation 2. Entwicklungspolitik im Zuge der Bevölkerungspolitik Dies geschah anhand von historischen Beispielen. Zu 1. Counterinsurgency und Entwicklungspolitik in Guatemala Beispiel: Wie waren Food for Work Projekte (hauptsächlich WFP der UN, aber auch GtZ- Projekte) in die Aufstandsbekämpfungs- und Wiederansiedlungspolitik der Militärregierungen integriert? Einrichtung von paramilitärischer Verwaltung Modelldörfer Food for Work Zerstörung der soz. Netzwerke durch militärische Eingriffe Kontrollaspekt, Trennung Aufständische und Zivilbevölkerung Die Arbeit des Militärs bestand oft in sinnentleerten Infrastrukturreformen Misstrauen durch nicht eingehaltene Entwicklungsversprechen Wir fragten uns, ob es auch aktuelle Beispiele aus andern Ländern dafür gibt und erarbeiteten folgende Stichpunkte: Beispiele Heute: Afghanistan, Tschad, Kosovo Protektorat (Kosovo) Übernahme ziviler Aufgaben durch das Militär Kooperation zw. NGO s und Militär (Finanzen, Sicherheitspolitik, Polizeiausbildung) Seite 15
16 UNHCR-Lager (zur Kontrolle) Afghanistan-GmbH Legitimation durch humanitäre Hilfe und Menschenrechtsschutz Zu 2. Bevölkerungspolitik und Frauengesundheitsbewegungen Bei diesem Themenkomplex ging es darum, wie sich das internationale bevölkerungspolitische Projekt im Sinne reproduktiver Rechte und Gesundheit reformierte und um die Frage, wie diese Entwicklungen aus einer antirassistischen und feministischen staatskritischen Perspektive einzuschätzen sind. Beispiel: Das Sterilisationsprogramm unter Fujimori in Peru und die Politik der lateinamerikanischen Frauengesundheitsnetzwerke. In der AG II erarbeiteten wir dazu folgende Stichpunkte: Bevölkerungspolitik im Rahmen von Entwicklungspolitik als Herrschaftspolitik Rassismus-Klassismus-Sexismus als konstituierende Merkmale Internationalisiertes Feld (Thema des Global Governments) Kairo (1994) als Paradigmenwechsel und Befriedung Staatlicher Eingriff auf Körper Katholische Hetze gegen Verhütung vs. Staatliches Programm der Geburtenkontrolle Als Ergebnis der AG II könnte man festhalten, dass es sich lohnt, genau hinzuschauen, wenn es um die Beurteilung von entwicklungspolitischen Projekten geht: Wer sind die Geldgeber der sog. Entwicklungsmaßnahmen Wer sind die ausführenden Akteure, was gibt es für Kooperationen und warum (Stichwort: zunehmende Verschmelzung von Entwicklungspolitik und Sicherheitspolitik) Seite 16
17 Führt das Projekt de facto zur Verbesserung der Lage der betroffenen Bevölkerung, was verändert sich durch das Projekt für die Bevölkerung Seite 17
18 Untersuchung des Entwicklungsdiskurses an konkreten Beispielen aus der nichtstaatlichen Enwicklungszusammenarbeit Referent: Aram Ziai Bericht von der AG 3 Idee: Die Thesen aus Aram Ziais Eingangsreferat sollten an konkreten Beispielen aus der Praxis verschiedener Organisationen der Entwicklungshilfe nachvollzogen werden. Neben vorbereiteten Präsentationen der Organisationen UNICEF, YA BASTA, Ökumenisches Büro und medico international waren die TeilnehmerInnen eingeladen, Beispiele aus eigener Erfahrung einzubringen. Ablauf I. Kurzer Film zum 60jährigen Jubiläum der Organisation UNICEF (=Selbstdarstellung) der die Themen Schulbildung, Katastrophenhilfe und AIDS behandelte. Was fiel auf? Stimme permanent aus dem Off, Ausnahme: Redner bei Preisverleihung. AdressatInnen der Hilfe werden überwiegend gezeigt, ohne zu Wort zu kommen. Politische Kontexte werden ignoriert, eigenes Selbstverständnis politisch neutral, Ursachen der jeweiligen Notlagen, ob Katastrophen, Kriege oder politische Verhältnisse, sind für die Arbeit von UNICEF unerheblich. Kritik/Diskussion: Ist der Aufbau von Schulen in Afrika nicht positiv zu bewerten? - Ja, aber: die Übernahme von Staatsaufgaben entlässt die eigene Regierung aus der Verantwortung; von UNICEF betriebene Schulkonzepte orientieren sich am Bildungsverständnis des Nordens (Schulbücher, Methoden etc.), wodurch das Eigene als defizitär und die Realität des Nordens als Norm erlebt wird. Katastrophenhilfe: Negativer Aspekt: Hilfslieferungen ruinieren die lokale Landwirtschaftsproduktion, da die Lebensmittelspenden für die Bevölkerung gratis sind. Zugang zum Nord-Wissen müsste den Menschen im Süden ermöglicht werden, statt dass ExpertInnen aus dem Norden Konzepte für den Süden machen, die sich an den Interessen des Nordens orientieren. Die Logik des geregelten Mittelabflusses ist dem Konzept der NGO-Hilfe genauso eigen wie das häufige Scheitern der Projekte selbst an den eigenen Zielvorgaben. Typisch für NGO-Ansatz ist das Livelihood-Konzept, das auf das verbesserte Nutzen der lokalen Begebenheiten setzt, aber die Möglichkeit politischer Veränderung ausschließt. Der im Selbstverständnis der NGOs verbreitete Anspruch auf Partizipation der AdressatInnen wird bei der Durchführung der Projekte meist umgangen. Bei allen Punkten ergibt sich die Feststellung, dass die genannten Mängel im Ergebnis den Herrschaftsinteressen des Nordens dienen. -> Ist dieser Effekt strategisch so beabsichtigt oder eine Folge der Ignoranz der Durchführenden? (Beispielsweise betreibt UNICEF ein eigenes Institut zur Ursachenforschung, auf dessen Studien aber in der Praxis kaum zugegriffen wird.) II. Seite 18
19 Begriffsklärungen, die von der Gruppe zum Thema gewünscht wurden. 1. Welt-Einteilung Ergebnis: Keine der gebräuchlichen Gegensatzpaare: Metropole Peripherie 1.Welt 3. Welt Norden Süden OECD Trikont ist uneingeschränkt gültig und bedenkenlos anwendbar. 2. Solidaritätsarbeit Was macht Solidaritätsarbeit aus? Antrieb ist nicht barmherzige Hilfe, sondern die Suche nach Befreiung. Gemeinsamkeit der Situation, in der sich die (weltweit) Solidarischen befinden (?). Gemeinsamkeit der Zielvorstellungen, an deren Verwirklichung sie arbeiten. Gegenseitiger Austausch, beidseitige Möglichkeit, zu lernen, zu kritisieren, zu unterstützen. Beispiele: Subcomandante Marcos spendet sein Interview-Honorar an streikende ArbeiterInnen in Turin Salvadorianische und nicaraguanische Menschenrechtsorganisationen schreiben Protestbriefe gegen das Demonstrationsverbot bei der Sicherheitskonferenz 2003 in München Fallstricke: Vieles, was sich hierzulande als Solidaritätsarbeit ausgibt, ist doch nur Etikettenschwindel, weil im Mittelpunkt für beide Seiten der Geldtransfer von Nord nach Süd steht. Machtgefälle Nord-Süd muss klar benannt werden: Wir haben als Privilegierte die besseren Möglichkeiten, überhaupt über die Sicherung unseres eigenen Überlebens hinaus mit anderen solidarisch zu sein. Darüber hinaus können wir entscheiden, mit wem wir solidarisch sein wollen und so quasi in anderen Gesellschaften Einfluss auf die politische Entwicklung nehmen. 3. Menschenrechte In wie weit kann der Bezug auf die Menschenrechte als Bezugspunkt für eine politische Solidaritätsarbeit dienen? Die Frage wurde nur andiskutiert: Kritik an der Menschenrechtscharta (Erbe der Französischen Revolution) als eurozentristische, universalistische Konzeption: Konsequenz: Neue Charta schreiben? Um den Herrschaftsaspekt der europäischen Menschenrechtscharta auszuschließen, müssten alle Gesellschaften aushandeln, auf welche Menschenrechte sie sich einigen. Wie ist dies in einer globalisierten Welt zu realisieren? Welche Rechte sollen weltweit Gültigkeit besitzen? Konsequenz: Kontinentale MR-Konventionen, die die lokalen kulturellen Bezüge besser berücksichtigen? Kritik am entpolitisierenden Charakter der Menschenrechtscharta: Konsequenz: Erweiterung der Menschenrechte um wirtschaftliche, soziale, kulturelle und Umweltrechte (WSKU). Seite 19
20 Konsequenz: Forderung nach Globalen Sozialen Rechten (z.b. attac). Konsequenz: Forderung nach Ernährungssouveränität (z.b. Via Campesina). Beispiel: Mitglieder von amnesty international, die deren politisch neutralen Standpunkt kritisierten, traten aus und gründeten FIAN, eine NGO, die für das Recht auf Ernährungssicherheit eintritt und politische Zusammenhänge wie die Exportorientierung der Landwirtschaft in den Ländern des Südens thematisiert. III. Beispiele aus der Runde Beispiel von Joschka: Japanische, christlich geprägte NGO, finanziert mit US-Geld, lädt lokale MultiplikatorInnen aus dem ländlichen Raum in bspw. Haiti, Sierra Leone nach Japan zu einer Art internationalem Studiengang ein. Alle wohnen gemeinsam auf dem Campus. Inhalte der Ausbildung sind Agronomie-Ausbildung, Mikrofinanz-Kreditsystem, Community-Building. Gesprochen wird Englisch. Reflektion: Positiv wird bewertet, dass die Organisation nicht selbst Projekte für den Süden entwirft. Die TeilnehmerInnen können selbst entscheiden, wieviel und was sie von der Kultur und den Lerninhalten mitnehmen und anwenden wollen. Eher negativ: Bereits privilegierte Personen erhalten durch die Einladung noch einen bedeutenden Status-Zuwachs. Ausgeblendet wird der politische Kontext. Diagnose und Therapie zur Bekämpfung von Armut werden durch die NGO gestellt, die die Lerninhalte festlegt. Die Therapie beschränkt sich auf die Nutzung der Möglichkeiten unter den gegebenen Bedingungen. Das zugrunde liegende Herrschaftsverhältnis und die eigenen Interessen an dessen Erhaltung bleiben außen vor. Beispiel von Karsten: Basis-NGO in Nordafrika, finanziert von Brot für die Welt und anderen kirchlichen Gebern. Betätigt sich im Brunnenbau und in der Förderung der Landwirtschaft....Beispiel wurde nicht eingehender besprochen. IV. Beispiele für Organisationen mit einem Selbstverständnis von Solidaritätsarbeit Seite 20
21 1. YA BASTA-Netzwerk Entwicklungspolitik als Herrschaftstechnik? Bundesweiter Zusammenschluss von Gruppen und Einzelpersonen in Solidarität mit dem zapatistischen Aufstand in Chiapas/Mexiko kein eigener Haushalt, kein Büro, keine Projekte in Chiapas, finanziert von Spenden der Mitglieder. Netzwerk von Gruppen, die an unterschiedlichen Themen mit unterschiedlichen Praxen arbeiten können. betreibt Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Zapatismus in Chiapas und hierzulande. Politik als Prozess von unten, Bezug auf Staat wird abgelehnt. Begriffe Autonomie, Würde, Solidarität als Handlungsmaxime auch für das eigene Leben. Selbstverständnis, Teil einer weltweiten Widerstandsbewegung zu sein, die auch die ZapatistInnen in Chiapas und viele andere umfasst. Bezug auch auf die Geschichte linken Widerstandes bei uns. 2. Ökumenisches Büro Münchner Verein für Solidaritätsarbeit mit sozialen Bewegungen in Mittelamerika und Mexiko Gegründet zur Organisation von Solidaritätsbrigaden in das sandinistische Nicaragua 1983 finanziert durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und Förderung von kirchlichen, staatlichen und parteipolitischen Institutionen. Bildungs-, Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit zu Nord-Süd-Themen in München und bundesweit, mit dem Ziel, sozialen Bewegungen aus den Schwerpunktländern hierzulande eine Stimme zu geben. Betonung des Zusammenhangs zwischen Dort und Hier über politische und wirtschaftliche Machtverhältnisse. Menschenrechtsarbeit zur Unterstützung sozialer Bewegungen in Mittelamerika und Mexiko. Projektarbeit im Rahmen von Solidaritätsbrigaden nach El Salvador und Nicaragua zur Förderung von Selbstorganisation und politischer Bildung in ländlichen Gebieten. 3. medico international Deutsche Hilfs- und Solidaritätsorganisation im medizinischen Bereich mit Sitz in Frankfurt finanziert durch Spenden und Mittel vom BMZ. finanziert weltweit zahlreiche Projekte, die von ortsansässigen Partnerorganisationen geplant und durchgeführt werden. betreibt Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland im Kontext der geförderten Projekte, z.b. Kampagnen gegen Produktion von Landminen. kontextorientierte Hilfe, die mit den Partnerorganisationen gemeinsame politische Ziele ( Verwirklichung des Rechts auf Gesundheit, Demokratie, soziale Gerechtigkeit) zum Ausgangspunkt hat und sich daher nicht nur auf die Durchführung von konkreten Projekten, sondern auch auf die Veränderung der Umstände richtet. An diesen drei Beispielen wurde das Spektrum der Praxen von internationaler Solidaritätsarbeit veranschaulicht. Seite 21
22 Plenum: Diskussion zur Solidaritätsarbeit Als Konsequenz aus der Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit ergibt sich die Frage, ob und wie sich diese sinnvoll reformieren ließe. Daneben besteht die Möglichkeit, sich auf die Tradition einer internationalistischen Solidaritätsarbeit zu beziehen. Hierzu hörten wir die folgenden Beiträge: Geschichte der Solidaritätsarbeit (S. 22) Nicaragua-Solidarität (S. 23) Im Anschluss an die Referate wurde anhand einer Gegenüberstellung von politischer Solidarität und Entwicklungshilfe diskutiert, inwieweit die Solidaritätsarbeit wirklich einen essentiellen Unterschied zur Entwicklungshilfe darstellt oder ob sie nicht in den gleichen Strukturen gefangen ist und im Endeffekt ähnliche Arbeit macht. Folgende Tendenzen wurden benannt: politisch motivierte Solidarität bekämpft Ursache eigentliche Arbeit findet daheim statt Herstellung von Gegenöffentlichkeit Projektarbeit Entwicklungshilfe bekämpft Symptome bzw. stabilisiert für Armut und Ungerechtigkeit ursächliche Strukturen Export von Finanzen und know-how häufig unpolitische Information über Armut Projektarbeit Auch im Rahmen der Solidaritätsarbeit bewegt man sich nicht automatisch außerhalb von Herrschaftsverhältnissen. Susanne Schultz erwähnte in diesem Zusammenhang einige Dilemmata politischer Geberinstitutionen : Bei einer Nord-Süd-Solidaritätsarbeit ist es kaum möglich und auch wenig sinnvoll, den Transfer von Geld ganz zu vermeiden, ist dies doch eine Ressource, auf die wir grundsätzlich leichter zugreifen können als unsere PartnerInnen. Wie aber soll Geld vergeben werden? Wenn Nord-Organisationen selber entscheiden, wer wie viel Geld wofür bekommt, üben sie eine starke Kontrolle auf das aus, was die PartnerInnen tun. Alternativ müsste man Geld willkürlich austeilen, mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass dann Dinge damit gemacht werden, mit denen man sich nicht solidarisch erklären könnte. Die Organisationen im Süden orientieren sich in der Folge an der Antragskonjunktur im Norden (z.b. Frauenförderung, Ownership, Partizipation) Spendenkonjunktur: Nord-NGOs, die für ihr eigenes Bestehen auf Spenden angewiesen sind, sind dadurch abhängig von der Spendenkonjunktur in ihren Ländern. Wofür gespendet wird, das muss auch als Projekt durchgeführt werden. Politisch sinnvolle Arbeit wird unmöglich, wenn sie von antizyklischen Spenden abhängt. Generell ist für zupackende, konkret greifbare und einfache Lösungen ein höheres Spendenaufkommen zu erwarten als bspw. für Öffentlichkeitsarbeit hierzulande. Geregelter Mittelabfluss: Geld, das zweckgebunden gespendet wurde, muss auch fristgerecht ausgegeben werden, das zwingt zu einer Praxis, die die Maßnahmen stärker auf die internen Notwendigkeiten der NGO zuschneidet als auf die vor Ort gegebenen. Wo Geld ist, ist Macht. Viele Organisationen mit starkem politischem Anspruch versuchen dies zu vermeiden, indem sie sich statt auf Mitteltransfer und Projekte auf Öffentlichkeits- und Menschenrechtsarbeit hier konzentrieren und den Kontakt zu den PartnerInnen zum Zweck des Informationsaustauschs halten. Seite 22
23 Geschichte der Solidaritätsarbeit Inputreferat vom Ökumenischen Büro Als ein Anfangspunkt der internationalen Solidaritätsarbeit kann der Ausspruch Proletarier aller Länder vereinigt euch in Marx und Engels Kommunistischem Manifest angesehen werden. Das Kampfprinzip Klassensolidarität fand in der Bildung der I. Internationalen 1864 seinen praktischen Ausdruck. Das Erkennen der gemeinsamen (Zwangs-)Lage führte zu Austausch und Zusammenarbeit revolutionärer Kräfte über Grenzen hinweg. Auch wenn es schon früh Richtungsstreitigkeiten und Spaltungen bis hin zu offenen Feindschaften untereinander gab, verband der Glaube an den gemeinsamen Kampf und an die Notwendigkeit von weltweiter Befreiung die revolutionären Kräfte gegen Kaiser bzw. Zar und später gegen den Faschismus. So unterstützten Internationale Brigaden mit der Waffe in der Hand die soziale Revolution in Spanien 1936 und den republikanischen Kampf gegen den Faschismus. In den 1950er/60er Jahren äußerte sich die internationale Solidarität vor allem in Unterstützung der Befreiungskämpfe in (ehemaligen) Kolonialgebieten wie z.b. Algerien. Im Anschluss an die APO/ Student_innenbewegung bildete sich in den 1970er Jahren aus antiimperialistischen Zusammenhängen 3. Welt/Eine Welt Gruppen. Lose assoziiert organisieren sie sich in der BRD seit 1977 in der Bundeskoordination Internationalismus (BUKO). Im Zentrum der Arbeit stand der Nord-Süd Konflikt und die Kritik einer ungerechten Weltwirtschaftsordnung. Die Bewegung war jedoch keinesfalls homogen wie z.b. die Einstellung zur Entwicklungshilfe zeigt: Kämpften einige Gruppen für eine pauschale Erhöhung, kritisierten andere vor allem die Prioritätensetzung und die Struktur der Entwicklungshilfe, andere Organisationen wie der SDS lehnten sie komplett ab, da sie als ein Mittel zur Stabilisierung und Festigung der Unterdrückungsverhältnisse angesehen wurde. Die unterschiedliche Radikalität der Kritik lässt sich nicht nur zwischen den Gruppen ausmachen, sondern auch in dem Prozess der Politisierung, den viele Gruppen durchmachten, wie beispielhaft der Freiburger Zusammenhang, der heute mit der IZ3W assoziiert wird: Mit einem christlich-humanitären Ansatz stand zuerst die Forderung nach einer Erhöhung der Entwicklungshilfe im Vordergrund, danach die Verbesserung ihrer Instrumentarien. Es wurde eine Stabilisierung der Rohstoffpreise und Gewährung einseitiger Exportpräferenzen für Entwicklungsländer verlangt. Den geringen Erfolg ihres Engagements führten sie auf eine zu geringe Lobby zurück. Mit einer stetigen Politisierung der Gruppe wurde aber auch die Entwicklungshilfe generell kritisiert und der Fokus auf heimische Verhältnisse gerichtet. Das Verständnis wuchs, Teil der bundesdeutschen Linken zu sein. Bewusstseins- und Informationsarbeit in der BRD und Solidarität mit den Befreiungsbewegungen ersetzte das Konzept Lobby für die 3. Welt. Die bundesdeutsche Bewegung setzte sich verstärkt mit der Rolle der USA, von Geheimdiensten und den Verstrickungen von Konzernen in den Diktaturen (Lateinamerikas) auseinander. Die Solidarität mit Allendes Chile und später mit den revolutionären Projekten/Kräften in Argentinien, Südafrika, Nicaragua und El Salvador bildete den Schwerpunkt der internationalen Solidaritätsarbeit in der BRD der 1970er/80er Jahre. Herausragend war die Nicaragua Solidarität. Zu dieser breiten und heterogenen Bewegung, die zeitweise aus bis zu 400 Gruppen bestand, sei auf den folgenden Beitrag verwiesen. Seite 23
24 In den 1990er Jahren war nur noch ein Bruchteil in der internationalen Solidaritätsbewegung aktiv, da in Nicaragua und El Salvador die Hoffnungen auf ein erfolgreiches revolutionäres Projekt vergangen waren. Aber schon vorher verkümmerte die politische Solidarität immer mehr und die Bewegung professionalisierte sich in der Verwaltung von Solidaritätsprojekten. Mit der herrschaftskritischen und globalisierungskritischen Bewegung der Zapatistas in Mexiko und ihrem Aufstand 1994 bildete sich ein neuer Bezugspunkt für internationale Solidaritätsarbeit. Die positive Bezugnahme auf bestimmte Projekte und Organisationen wird natürlich von der eigenen Zielsetzung bestimmt. Waren in El Salvador verstärkt christliche Gruppen aktiv, so ist die Solidarität mit den Zapatistas vor allem von herrschaftskritischen Zusammenhängen geprägt. Kontrovers wurden in den letzten Jahrzehnten vor allem die Gewaltfrage in der Solidaritätsbewegung diskutiert und die Unterstützung nationalistischer Gruppen. Quellen: Balsen, Werner; Rössel, Karl (1986): Hoch die Internationale Solidarität Zur Geschichte der Dritte Welt-Bewegung in der Bundesrepublik, Kölner Volksblatt Nicaragua Solidarität Inputreferat vom Ökumenischen Büro Wenn man sich Gedanken zur Solidaritätsarbeit macht, ist ein kurzer Blick auf die Geschichte der Nicaragua-Solidarität bestimmt hilfreich. Sie zeichnet sich durch zweierlei aus: Durch ihre relative Stärke in den 80er Jahren und dadurch, dass sie in der komfortablen Lage war, eine siegreiche Revolution unterstützen zu können. Um das Jahr 1985 herum gab es sicherlich mehrere hundert Gruppen allein in Deutschland, die sich selbst zur Nicaragua- Solidarität zählten. Zu den jährlichen Bundestreffen kamen 300 bis 500 Teilnehmer. Über Menschen reisten in den 80er Jahren nach Nicaragua um die sandinistische Revolution zu unterstützen. Viele derjenigen, die damals nach Nicaragua reisten, taten dies als BrigadistInnen, zum Einsatz in der Kaffeeernte, zu Bauprojekten oder, mit entsprechenden Fachkenntnissen, in Medizinbrigaden. Man leistete materielle Solidarität mit Geld und der eigenen Arbeitskraft. Einiges von den damaligen Aktivitäten hat sich bis heute erhalten. Z. B. schickt das Ökumenische Büro immer noch Brigaden nach Nicaragua. Dies sind aber nicht mehr 50 bis 80 Menschen pro Jahr, wie Mitte der 80er Jahre, sondern alle zwei Jahre etwa zehn TeinehmerInnen. Außerdem gibt es in der Bundesrepublik noch fast 30 Städtepartnerschaften, von denen viele aus der damaligen Zeit stammen. Wie gesagt: Man leistete materielle Solidarität. Damit stellte sich automatisch die Frage, wo denn die Unterschiede zur Entwicklungshilfe lagen. Besonders intensiv hat sich diese Frage Rosemarie Karges in ihrem Buch: Solidarität oder Entwicklungshilfe? gestellt (erschienen im Waxmann Verlag, 1995). Das Selbstverständnis der Nicaragua-Solidaritätsbewegung war es, politische Solidarität zu leisten. Damit grenzte man sich bewusst von karitativer, humanitärer oder professioneller Unterstützung ab. Denn anders als die zuletzt genannten Aktivitäten beansprucht politische Solidarität, die Ursachen und nicht die Symptome zu bekämpfen. Konsequenterweise wurde innerhalb der Nicaragua-Solidarität und in der Vorbereitung der Brigaden immer wieder betont, dass die eigentliche Arbeit in der BRD, in der Ersten Welt stattzufinden habe. Es sollten ja die Ursachen bekämpft werden. Dies war aber gar nicht so einfach. Damit sollen die vielen politischen Aktionen, Kongresse und Demonstrationen, häufig mit mehreren Tausend Teilnehmern nicht klein geredet werden. Aber für die Einzelnen war es doch attraktiver, in Nicaragua eine Schule zu bauen und sie mit den Kindern einzuweihen, denen Seite 24
25 man eine wichtige Voraussetzung geschaffen hatte, dass sie in ihrem Leben Lesen und Schreiben lernen würden. Unternehmungen wie solch ein Schulbau erfordern eine ganze Menge Engagement. So ergab es sich, dass mit den Jahren, in denen die politische Situation Nicaraguas immer schwieriger wurde und die Erfolge politischer Aktionen in der BRD unklar blieben, die Projektarbeit für die Nicaragua-Solidaritätsbewegung immer wichtiger wurde. Diese sollte aber unter dem Dach der politischen Solidarität stattfinden. Im Dialog mit den Begünstigten und auf der Grundlage einer gleichberechtigten Beziehung. Rosemarie Karges hat eine ganze Reihe dieser Projekte hinsichtlich dieser Ziele untersucht. Dabei interessierte sie vor allem, wie die BrigadistInnen von den NicaraguanerInnen wahrgenommen wurden. Sie kam zu dem Ergebnis, dass die Ziele der BrigadistInnen nicht verstanden wurden. Sie wurden von den NicaraguanerInnen wegen ihrer uneigennützigen Hilfe geschätzt und nicht wegen ihrer politischen Solidarität. Als gleichberechtigt haben sie sich nicht empfunden, denn die Projektarbeit reproduziert die Ungleichheit zwischen Gebenden und Nehmenden. Rosemarie Karges konnte an den Projekten der Nicaragua-Solidarität keinen fundamentalen Unterschied zu Projekten der üblichen nichtstaatlichen Entwicklungshilfe feststellen. Die Brigadearbeit des Ökumenischen Büros bemüht sich seither, die Ungleichheit in den Beziehungen zu den Partnerorganisationen mitzudenken und trotz der strukturellen Unterschiede einen Raum für Austausch auf Augenhöhe zu öffnen. Seite 25
26 Fazit der SeminarteilnehmerInnen In der Schlussdiskussion am Sonntagvormittag zeigte sich, dass das Referat von Aram Ziai bei den SeminarteilnehmerInnen einen tiefen Eindruck hinterlassen hatte. Niemand widersprach den zentralen Thesen: Entwicklungspolitik zementiert die existierenden Herrschaftsverhältnisse denn das Konzept der Entwicklung legitimiert bereits Herrschaftsverhältnisse Wie ein Leitmotiv hatte sich das Wort Bauchschmerzen durch die Diskussionen des Seminars gezogen. Viele hatten schon zu Beginn bekundet, dass ihnen die Idee der Entwicklung und die Folgerungen daraus - Entwicklungspolitik oder Entwicklungszusammenarbeit Bauchschmerzen bereiteten. Die verschiedenen Aspekte dieser Bauchschmerzen prägten auch die Schlussdiskussion. Ausgehend von der Überzeugung, dass gerade aufgrund der Ungleichverteilung des weltweiten Reichtums ein Transfer von Nord nach Süd notwendig sei, enstand die Forderung nach einem neuen Begriff für Entwicklung, der die im Seminar erarbeitete Kritik am Entwicklungs-Konzept berücksichtigt. Eine andere Position bestand in der Ablehnung des Entwicklungsdiskurses als Bezugspunkt und einem eindeutigen Bezug auf die Solidaritätsarbeit: Wenn Entwicklungshilfe die im Seminar geäußerte Kritik umsetzen würde, müsste sie sich selbst abschaffen Solidarität mit emanzipatorischen Projekten und Bewegungen weltweit Der Position, dass bei den Anstrengungen gegen die weltweite Ungerechtigkeit der Streit um Begriffe zweitrangig sei, wurde entgegengehalten, dass gerade die Verwendung von Begriffen entscheidend sei für den Aufbau von Herrschaftsdiskursen wie dem Entwicklungsdiskurs und daher eine politische Notwendigkeit bestehe, die Begriffe und die Herrschaftsverhältnisse zu verändern. Es kam zu einer Grundsatzdiskussion über Theorie und Praxis, in der es zu keinem Konsens kam, wie die folgenden Thesen zeigen: Pragmatismus vor ideologischer Genauigkeit vs. Ideologische Genauigkeit vor Pragmatismus Auch bei einer politisch begründeten Praxis der Solidaritätsarbeit treten Dilemmata auf, da sie nicht im herrschaftsfreien Raum stattfindet: Es bleiben unterschiedliche Interessen zwischen Nord und Süd sowie Machtverhältnisse zwischen GeberInnen und NehmerInnen, was zu folgenden Forderungen führte: Reflexion jeder Praxis auf Herrschaftsverhältnisse Die Reflexion der Dilemmata darf nicht zur Passivität führen Eigene Interessen (bspw. Abenteuerlust, Weiterbildung, Arbeitsplatz) benennen, statt verdrängen Die Schlussdiskussion spiegelte die Dynamik des Seminars deutlich wider: Wahrscheinlich hat keiner der TeilnehmerInnen die Patentlösung für seine Bauchschmerzen mit dem Begriff Entwicklung gefunden. Aber die Kritik am Entwicklungsdiskurs als Herrschaftstechnik und der strategischen Eigeninteressen, die Akteure der Entwicklungspolitik verfolgen, dürfte den meisten fruchtbare Impulse gegeben haben. Wir hoffen, dass damit den TeilnehmerInnen der Sinn des Konzepts der Solidaritätsarbeit als Möglichkeit einer praktischen Betätigung gegen Herrschaftsverhältnisse näher gekommen ist. Seite 26
verfügen. Unser Glaube an Gottes Schöpfung zeigt uns Wege auf, die Erde mit andern zu teilen und ihr Sorge zu tragen.
 Leitbild Brot für alle setzt sich dafür ein, dass alle Menschen über Fähigkeiten und Möglichkeiten für ein gutes und menschenwürdiges Leben in einer lebenswerten Umwelt verfügen. Unser Glaube an Gottes
Leitbild Brot für alle setzt sich dafür ein, dass alle Menschen über Fähigkeiten und Möglichkeiten für ein gutes und menschenwürdiges Leben in einer lebenswerten Umwelt verfügen. Unser Glaube an Gottes
Globale Strukturpolitik?
 A 2007/9568 Aram Ziai Globale Strukturpolitik? Die Nord-Süd-Politik der BRD und das Dispositiv der Entwicklung im Zeitalter von neoliberaler Globalisierung und neuer Weltordnung WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT
A 2007/9568 Aram Ziai Globale Strukturpolitik? Die Nord-Süd-Politik der BRD und das Dispositiv der Entwicklung im Zeitalter von neoliberaler Globalisierung und neuer Weltordnung WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT
Entwicklungszusammenarbeit mit Schwellenländern strategisch neu ausrichten
 Entwicklungszusammenarbeit mit Schwellenländern strategisch neu ausrichten Beschluss des CDU-Bundesfachausschusses Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte unter der Leitung von Arnold Vaatz MdB,
Entwicklungszusammenarbeit mit Schwellenländern strategisch neu ausrichten Beschluss des CDU-Bundesfachausschusses Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte unter der Leitung von Arnold Vaatz MdB,
ENTWICKLUNGSLAND DEUTSCHLAND?
 ENTWICKLUNGSLAND DEUTSCHLAND? Wendepunkte in der Entwicklungszusammenarbeit im 21. Jahrhundert am Beispiel der 2-Euro Kampagne von Misereor Philipp Noack 3.11.2016 in Heidelberg Ablauf Der Entwicklungs
ENTWICKLUNGSLAND DEUTSCHLAND? Wendepunkte in der Entwicklungszusammenarbeit im 21. Jahrhundert am Beispiel der 2-Euro Kampagne von Misereor Philipp Noack 3.11.2016 in Heidelberg Ablauf Der Entwicklungs
Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig)
 Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig) Inhalte Kompetenzen Hinweise Themenbereich: 1. Prozesse der Modernisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit dem 18.
Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig) Inhalte Kompetenzen Hinweise Themenbereich: 1. Prozesse der Modernisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit dem 18.
Von der Agenda 21 zu Agenda 2030 und. Sustainable Development Goals (SDG)
 Von der Agenda 21 zu Agenda 2030 und Sustainable Development Goals (SDG) Gerd Oelsner, Agenda-Verein Karlsruhe, Nachhaltigkeitsbüro der LUBW Workshop Karlsruhe 3. Juni 2016 Agenda 2030 & Sustainable Development
Von der Agenda 21 zu Agenda 2030 und Sustainable Development Goals (SDG) Gerd Oelsner, Agenda-Verein Karlsruhe, Nachhaltigkeitsbüro der LUBW Workshop Karlsruhe 3. Juni 2016 Agenda 2030 & Sustainable Development
Entwicklungspolitik als globale Herausforderung
 Johannes Müller Entwicklungspolitik als globale Herausforderung Methodische und ethische Grundlegung Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Vorwort 10 Abkürzungsverzeichnis ll 1 Armut als weltweite
Johannes Müller Entwicklungspolitik als globale Herausforderung Methodische und ethische Grundlegung Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Vorwort 10 Abkürzungsverzeichnis ll 1 Armut als weltweite
Empfehlungen zur Förderung von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
 Empfehlungen zur Förderung von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit Eine Stellungnahme der VENRO-Arbeitsgruppe Behindertenarbeit in Entwicklungsländern für den Ausschuss
Empfehlungen zur Förderung von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit Eine Stellungnahme der VENRO-Arbeitsgruppe Behindertenarbeit in Entwicklungsländern für den Ausschuss
Europas Werte von innen und außen : Die EU als normative power?
 Anne Faber Europas Werte von innen und außen : Die EU als normative power? Entwicklungspolitik 31.01.2012 Organisation Begrüßung TN-Liste Fragen? Sitzungsaufbau Einstieg: Diskussionsleitfrage Referat Fr.
Anne Faber Europas Werte von innen und außen : Die EU als normative power? Entwicklungspolitik 31.01.2012 Organisation Begrüßung TN-Liste Fragen? Sitzungsaufbau Einstieg: Diskussionsleitfrage Referat Fr.
WEGE AUS DER ARMUT. "Dein Hunger wird nie gestillt, dein Durst nie gelöscht, du kannst nie schlafen, bis du irgendwann nicht mehr müde bist"
 WEGE AUS DER ARMUT "Dein Hunger wird nie gestillt, dein Durst nie gelöscht, du kannst nie schlafen, bis du irgendwann nicht mehr müde bist" Wer hungern muss, wer kein Geld für die nötigsten Dinge hat,
WEGE AUS DER ARMUT "Dein Hunger wird nie gestillt, dein Durst nie gelöscht, du kannst nie schlafen, bis du irgendwann nicht mehr müde bist" Wer hungern muss, wer kein Geld für die nötigsten Dinge hat,
Von Greenpeace & CO Wie arbeiten die internationalen Umweltorganisationen
 Von Greenpeace & CO Wie arbeiten die internationalen Umweltorganisationen Dr. Achim Brunnengräber Freie Universität Berlin priklima@zedat.fu-berlin.de Die neuen Sterne am Firmament globaler Politik! Spiegel
Von Greenpeace & CO Wie arbeiten die internationalen Umweltorganisationen Dr. Achim Brunnengräber Freie Universität Berlin priklima@zedat.fu-berlin.de Die neuen Sterne am Firmament globaler Politik! Spiegel
Die TEEB Scoping-Studie in Georgien Prozess und aktueller Stand. Deutsch-Russischer Workshop zu Ökosystemleistungen,
 Die TEEB Scoping-Studie in Georgien Prozess und aktueller Stand Deutsch-Russischer Workshop zu Ökosystemleistungen, 20.-21.06.2013 Warum TEEB im Kaukasus? Kaukasus Ökoregion einer von 34 globalen Hotspots
Die TEEB Scoping-Studie in Georgien Prozess und aktueller Stand Deutsch-Russischer Workshop zu Ökosystemleistungen, 20.-21.06.2013 Warum TEEB im Kaukasus? Kaukasus Ökoregion einer von 34 globalen Hotspots
Evaluation von Entwicklungszusammenarbeit und von Wiederaufbaumaßnahmen nach Katastrophen
 Evaluation von Entwicklungszusammenarbeit und von Wiederaufbaumaßnahmen nach Katastrophen Erfahrungen und Einschätzungen von Misereor Dorothee Mack Arbeitsbereich Evaluierung und Qualitätsmanagement (EQM)
Evaluation von Entwicklungszusammenarbeit und von Wiederaufbaumaßnahmen nach Katastrophen Erfahrungen und Einschätzungen von Misereor Dorothee Mack Arbeitsbereich Evaluierung und Qualitätsmanagement (EQM)
Zur Menschenrechtsproblematik an EU- und US- Außengrenzen. Dr. Ulrike Borchardt
 Beitrag zur Ringvorlesung Friedensbildung Grundlagen und Fallbeispiele WS 2013/2014 Zur Menschenrechtsproblematik an EU- und US- Außengrenzen Dr. Ulrike Borchardt Dr. Ulrike Borchardt 1 Gliederung Aktualität
Beitrag zur Ringvorlesung Friedensbildung Grundlagen und Fallbeispiele WS 2013/2014 Zur Menschenrechtsproblematik an EU- und US- Außengrenzen Dr. Ulrike Borchardt Dr. Ulrike Borchardt 1 Gliederung Aktualität
Zur öffentlichen und gesellschaftlichen Wahrnehmung und Bewältigung von Gewalterlebnissen Trauma und Politik
 Zur öffentlichen und gesellschaftlichen Wahrnehmung und Bewältigung von Gewalterlebnissen Trauma und Politik Usche Merk medico international Psychiatrie-Jahrestagung 20.4.2016 Bonn Gewalt und Trauma Trauma
Zur öffentlichen und gesellschaftlichen Wahrnehmung und Bewältigung von Gewalterlebnissen Trauma und Politik Usche Merk medico international Psychiatrie-Jahrestagung 20.4.2016 Bonn Gewalt und Trauma Trauma
Internationale Politik und Internationale Beziehungen: Einführung
 Anne Faber Internationale Politik und Internationale Beziehungen: Einführung Die Bundesrepublik Deutschland als außenpolitischer Akteur 06.02.2012 Organisation Begrüßung TN-Liste Fragen? Veranstaltungsplan
Anne Faber Internationale Politik und Internationale Beziehungen: Einführung Die Bundesrepublik Deutschland als außenpolitischer Akteur 06.02.2012 Organisation Begrüßung TN-Liste Fragen? Veranstaltungsplan
SOLIDARISCHE ARBEITSVERHÄLTNISSE. Stephan Lessenich, Frank Engster und Ute Kalbitzer
 WORKSHOP #4 SOLIDARISCHE ARBEITSVERHÄLTNISSE Stephan Lessenich, Frank Engster und Ute Kalbitzer Die Gesellschaft befindet sich weltweit in einer eigentümlichen Situation. Als das Institut Solidarische
WORKSHOP #4 SOLIDARISCHE ARBEITSVERHÄLTNISSE Stephan Lessenich, Frank Engster und Ute Kalbitzer Die Gesellschaft befindet sich weltweit in einer eigentümlichen Situation. Als das Institut Solidarische
Planungszellen zur Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz
 Planungszellen zur Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz Dr. Birgit Böhm 26.09.2009 Tagung Akteure verstehen, stärken und gewinnen! der Stiftung Mitarbeit in der Evangelischen Akademie Loccum
Planungszellen zur Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz Dr. Birgit Böhm 26.09.2009 Tagung Akteure verstehen, stärken und gewinnen! der Stiftung Mitarbeit in der Evangelischen Akademie Loccum
Partnerschaft auf Augenhöhe? Wirtschaftsbeziehungen China - Afrika
 Partnerschaft auf Augenhöhe? Wirtschaftsbeziehungen China - Afrika SÜDWIND Irene Knoke Handel Exporte und Importe nach und aus Afrika In Mrd. US$ Quellen: GTIS 2013, US Department of Commerce Handel Weitere
Partnerschaft auf Augenhöhe? Wirtschaftsbeziehungen China - Afrika SÜDWIND Irene Knoke Handel Exporte und Importe nach und aus Afrika In Mrd. US$ Quellen: GTIS 2013, US Department of Commerce Handel Weitere
Voraussetzungen wirksamer Präventionsprojekte
 Voraussetzungen wirksamer Präventionsprojekte Vortrag im Rahmen der wissenschaftliche Fachtagung des Thüringer Landesbeirates Gewaltprävention in Zusammenarbeit mit der Landestelle Gewaltprävention zur
Voraussetzungen wirksamer Präventionsprojekte Vortrag im Rahmen der wissenschaftliche Fachtagung des Thüringer Landesbeirates Gewaltprävention in Zusammenarbeit mit der Landestelle Gewaltprävention zur
Poverty Reduction Strategies (PRS)
 Poverty Reduction Strategies (PRS) PRS: Langfristige Perspektive UN-Millenniumsziele Nationale langfristige Visionen Finanzplanung Sektorprogramme (z.b. Bildung, Landwirtschaft) UN 2015 Poverty Reduction
Poverty Reduction Strategies (PRS) PRS: Langfristige Perspektive UN-Millenniumsziele Nationale langfristige Visionen Finanzplanung Sektorprogramme (z.b. Bildung, Landwirtschaft) UN 2015 Poverty Reduction
Kritische Theorie (u.a. Horkheimer, Marcuse, Adorno..., Habermas)
 Kritische Theorie (u.a. Horkheimer, Marcuse, Adorno..., Habermas) Anlehnung an Marxismus, insbesondere Geschichtsinterpretation. Theorie ist Form gesellschaftlicher Praxis. Historische Analyse Grundlage
Kritische Theorie (u.a. Horkheimer, Marcuse, Adorno..., Habermas) Anlehnung an Marxismus, insbesondere Geschichtsinterpretation. Theorie ist Form gesellschaftlicher Praxis. Historische Analyse Grundlage
Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre
 6 Wie eine Volkswirtschaft funktioniert Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre Die Volkswirtschaftlehre (VWL) beschäftigt sich mit den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen eines Staates: der Volkswirtschaft.
6 Wie eine Volkswirtschaft funktioniert Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre Die Volkswirtschaftlehre (VWL) beschäftigt sich mit den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen eines Staates: der Volkswirtschaft.
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die Herausforderungen an Unterstützung für Menschen mit Behinderungen
 Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die Herausforderungen an Unterstützung für Menschen mit Behinderungen --------------------------------------------------------------------------
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die Herausforderungen an Unterstützung für Menschen mit Behinderungen --------------------------------------------------------------------------
Klimawandel und Gerechtigkeit
 Klimawandel und Gerechtigkeit Klimapolitik als Baustein einer gerechten Globalisierung und nachhaltigen Armutsbekämpfung Johannes Müller (IGP) Vier Partner vier Expertisen Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR
Klimawandel und Gerechtigkeit Klimapolitik als Baustein einer gerechten Globalisierung und nachhaltigen Armutsbekämpfung Johannes Müller (IGP) Vier Partner vier Expertisen Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR
Emanzipation und Kontrolle? Zum Verhältnis von Demokratie und Sozialer Arbeit
 Emanzipation und Kontrolle? Zum Verhältnis von Demokratie und Sozialer Arbeit Thomas Geisen Übersicht Demokratie und Moderne Soziale Arbeit und Demokratie Vier Fragen zum Verhältnis von Sozialer Arbeit
Emanzipation und Kontrolle? Zum Verhältnis von Demokratie und Sozialer Arbeit Thomas Geisen Übersicht Demokratie und Moderne Soziale Arbeit und Demokratie Vier Fragen zum Verhältnis von Sozialer Arbeit
Europäische Entwicklungspolitik zwischen gemeinschaftlicher Handelspolitik, intergouvernementaler Außenpolitik und ökonomischer Effizienz
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Ralf Müller Europäische Entwicklungspolitik zwischen gemeinschaftlicher
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Ralf Müller Europäische Entwicklungspolitik zwischen gemeinschaftlicher
Europas Werte von innen und außen : Die EU als normative power?
 Anne Faber Europas Werte von innen und außen : Die EU als normative power? Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik und Schlussfolgerungen 07.02.2012 Organisation Begrüßung TN-Liste Fragen? Sitzungsaufbau
Anne Faber Europas Werte von innen und außen : Die EU als normative power? Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik und Schlussfolgerungen 07.02.2012 Organisation Begrüßung TN-Liste Fragen? Sitzungsaufbau
Hungerbekämpfung und Bäuerliche Landwirtschaft - Hand in Hand für mehr Entwicklung
 Hungerbekämpfung und Bäuerliche Landwirtschaft - Hand in Hand für mehr Entwicklung 24.02.15 Eschborn Stig Tanzmann, Referent Landwirtschaft, Brot für die Welt Seite 1/34 Den Armen Gerechtigkeit Seite 2/34
Hungerbekämpfung und Bäuerliche Landwirtschaft - Hand in Hand für mehr Entwicklung 24.02.15 Eschborn Stig Tanzmann, Referent Landwirtschaft, Brot für die Welt Seite 1/34 Den Armen Gerechtigkeit Seite 2/34
Arme Frauen - Reiche Frauen Armutsbekämpfung, Verteilungsgerechtigkeit und ein gutes Leben für alle
 Arme Frauen - Reiche Frauen Armutsbekämpfung, Verteilungsgerechtigkeit und ein gutes Leben für alle Dr.in Michaela Moser Ilse Arlt Institut für Soziale Inklusionsforschung / FH St Pölten DIE ARMUTSKONFERENZ.
Arme Frauen - Reiche Frauen Armutsbekämpfung, Verteilungsgerechtigkeit und ein gutes Leben für alle Dr.in Michaela Moser Ilse Arlt Institut für Soziale Inklusionsforschung / FH St Pölten DIE ARMUTSKONFERENZ.
UNSERE WERTE UND GRUNDÜBER- ZEUGUNGEN
 UNSERE WERTE UND GRUNDÜBER- ZEUGUNGEN Wir sind das Hilfswerk der evangelischen Kirchen der Schweiz. Unsere Verankerung in den Kirchen prägt die Grundüberzeugungen, welche für unser Handeln von zentraler
UNSERE WERTE UND GRUNDÜBER- ZEUGUNGEN Wir sind das Hilfswerk der evangelischen Kirchen der Schweiz. Unsere Verankerung in den Kirchen prägt die Grundüberzeugungen, welche für unser Handeln von zentraler
Gemeinsam für eine gerechte Welt!
 Das Leitbild von INKOTA verabschiedet von der INKOTA-Mitgliederversammlung bei ihrer Jahresversammlung am 14. September 2013 in Leipzig; erarbeitet von zahlreichen UnterstützerInnen aus allen relevanten
Das Leitbild von INKOTA verabschiedet von der INKOTA-Mitgliederversammlung bei ihrer Jahresversammlung am 14. September 2013 in Leipzig; erarbeitet von zahlreichen UnterstützerInnen aus allen relevanten
Bundesrat Moritz Leuenberger
 Rede von Bundesrat Moritz Leuenberger Vorsteher des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation anlässlich der Eröffnung der dritten Vorbereitungskonferenz (PrepCom 3)
Rede von Bundesrat Moritz Leuenberger Vorsteher des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation anlässlich der Eröffnung der dritten Vorbereitungskonferenz (PrepCom 3)
Adenauers Außenpolitik
 Haidar Mahmoud Abdelhadi Adenauers Außenpolitik Diplomica Verlag Haidar Mahmoud Abdelhadi Adenauers Außenpolitik ISBN: 978-3-8428-1980-1 Herstellung: Diplomica Verlag GmbH, Hamburg, 2012 Dieses Werk ist
Haidar Mahmoud Abdelhadi Adenauers Außenpolitik Diplomica Verlag Haidar Mahmoud Abdelhadi Adenauers Außenpolitik ISBN: 978-3-8428-1980-1 Herstellung: Diplomica Verlag GmbH, Hamburg, 2012 Dieses Werk ist
V O N : P R O F. D R. D I E R K B O R S T E L F A C H H O C H S C H U L E D O R T M U N D D I E R K. B O R S T E F H - D O R T M U N D.
 MEHR ALS SPORT! V O N : P R O F. D R. D I E R K B O R S T E L F A C H H O C H S C H U L E D O R T M U N D D I E R K. B O R S T E L @ F H - D O R T M U N D. D E Drei Prämissen vorweg IM SPORT GEHT ES ZUNÄCHST
MEHR ALS SPORT! V O N : P R O F. D R. D I E R K B O R S T E L F A C H H O C H S C H U L E D O R T M U N D D I E R K. B O R S T E L @ F H - D O R T M U N D. D E Drei Prämissen vorweg IM SPORT GEHT ES ZUNÄCHST
Sauberes Wasser für alle
 Presse-Information München, 22. September 2015 Sauberes Wasser für alle Interview mit Jon Rose, Preisträger des ECKART 2014 für Kreative Verantwortung und Genuss Im Juni 2015 reisten Theresa Geisel und
Presse-Information München, 22. September 2015 Sauberes Wasser für alle Interview mit Jon Rose, Preisträger des ECKART 2014 für Kreative Verantwortung und Genuss Im Juni 2015 reisten Theresa Geisel und
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Politik verstehen - Segen und Fluch der Globalisierung
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: - Segen und Fluch der Globalisierung Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Inhalt Seite Vorwort 5 1
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: - Segen und Fluch der Globalisierung Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Inhalt Seite Vorwort 5 1
Bundesamt für Naturschutz
 Bundesamt für Naturschutz Dialogforum Ehrenamtliche Aktivitäten zur Erfassung der biologischen Vielfalt Ehrenamt und Staatsaufgabe Zusammenfassung MR a.d. Dipl. Ing. Heinz-Werner Persiel Bundesverband
Bundesamt für Naturschutz Dialogforum Ehrenamtliche Aktivitäten zur Erfassung der biologischen Vielfalt Ehrenamt und Staatsaufgabe Zusammenfassung MR a.d. Dipl. Ing. Heinz-Werner Persiel Bundesverband
IV. Globalisierung Globalización aus Sicht der Fächer Gemeinschaftskunde, Spanisch und Religion
 IV. Globalisierung Globalización aus Sicht der Fächer Gemeinschaftskunde, Spanisch und Religion Vermittlung orientierender und gestaltender Teilhabe in Studium, Beruf und Gesellschaft auf der Basis heterogener
IV. Globalisierung Globalización aus Sicht der Fächer Gemeinschaftskunde, Spanisch und Religion Vermittlung orientierender und gestaltender Teilhabe in Studium, Beruf und Gesellschaft auf der Basis heterogener
Manifest. für eine. Muslimische Akademie in Deutschland
 Manifest für eine Muslimische Akademie in Deutschland 1. Ausgangssituation In der Bundesrepublik Deutschland gibt es ein breit gefächertes, differenziertes Netz von Institutionen der Erwachsenen- und Jugendbildung,
Manifest für eine Muslimische Akademie in Deutschland 1. Ausgangssituation In der Bundesrepublik Deutschland gibt es ein breit gefächertes, differenziertes Netz von Institutionen der Erwachsenen- und Jugendbildung,
Humanitäre Interventionen - Die Friedenssicherung der Vereinten Nationen
 Politik Danilo Schmidt Humanitäre Interventionen - Die Friedenssicherung der Vereinten Nationen Studienarbeit FREIE UNIVERSITÄT BERLIN Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft Wintersemester 2006/2007
Politik Danilo Schmidt Humanitäre Interventionen - Die Friedenssicherung der Vereinten Nationen Studienarbeit FREIE UNIVERSITÄT BERLIN Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft Wintersemester 2006/2007
Migration, Asyl, Armut: Worüber reden wir (nicht)?
 Migration, Asyl, Armut: Worüber reden wir (nicht)? Jochen Oltmer www.imis.uni-osnabrueck.de Flüchtlinge weltweit 40 Flüchtlinge IDPs 38,2 35 30 25 20 15 10 16,5 17,2 21,3 22,5 25,0 27,5 28,0 22,0 19,7
Migration, Asyl, Armut: Worüber reden wir (nicht)? Jochen Oltmer www.imis.uni-osnabrueck.de Flüchtlinge weltweit 40 Flüchtlinge IDPs 38,2 35 30 25 20 15 10 16,5 17,2 21,3 22,5 25,0 27,5 28,0 22,0 19,7
Das Netzwerk FUgE, Johann Grabenmeier Vorlauf des FUgE-Netzwerks ab Mitte der 90er Jahre
 Das Netzwerk FUgE, Johann Grabenmeier Vorlauf des FUgE-Netzwerks ab Mitte der 90er Jahre 1. Nord-Süd-Forum an der VHS 2. Kirchliche Gruppierungen und Kirchengemeinden 3. Jährlicher Eine-Welt- und Umwelttag
Das Netzwerk FUgE, Johann Grabenmeier Vorlauf des FUgE-Netzwerks ab Mitte der 90er Jahre 1. Nord-Süd-Forum an der VHS 2. Kirchliche Gruppierungen und Kirchengemeinden 3. Jährlicher Eine-Welt- und Umwelttag
LANDESVERSAMMLUNG DER FRAUEN- UNION DER CSU AM 15. OKTOBER 2016 IN AUGSBURG LEITANTRAG
 LANDESVERSAMMLUNG DER FRAUEN- UNION DER CSU AM 15. OKTOBER 2016 IN AUGSBURG LEITANTRAG Landesversammlung der Frauen-Union 15. Oktober 2016 Antrag: Die Rolle der Frauen in Entwicklungsländern stärken Beschluss:
LANDESVERSAMMLUNG DER FRAUEN- UNION DER CSU AM 15. OKTOBER 2016 IN AUGSBURG LEITANTRAG Landesversammlung der Frauen-Union 15. Oktober 2016 Antrag: Die Rolle der Frauen in Entwicklungsländern stärken Beschluss:
Machtpolitik und Wohlfahrtsdenken in den internationalen Beziehungen des 21. Jahrhunderts
 Wendelin Ettmayer A 367878 Eine geteilte Welt - Machtpolitik und Wohlfahrtsdenken in den internationalen Beziehungen des 21. Jahrhunderts Trauner Verlag 2003 Inhaltsverzeichnis I. Teil: Machtpolitik als
Wendelin Ettmayer A 367878 Eine geteilte Welt - Machtpolitik und Wohlfahrtsdenken in den internationalen Beziehungen des 21. Jahrhunderts Trauner Verlag 2003 Inhaltsverzeichnis I. Teil: Machtpolitik als
Theorien der Europäischen Integration. LEKT. DR. CHRISTIAN SCHUSTER Internationale Beziehungen und Europastudien
 Theorien der Europäischen Integration LEKT. DR. CHRISTIAN SCHUSTER Internationale Beziehungen und Europastudien FAKULTÄT FÜR EUROPASTUDIEN WINTERSEMESTER 2016 Phasen der Integrationstheorie Phase Zeit
Theorien der Europäischen Integration LEKT. DR. CHRISTIAN SCHUSTER Internationale Beziehungen und Europastudien FAKULTÄT FÜR EUROPASTUDIEN WINTERSEMESTER 2016 Phasen der Integrationstheorie Phase Zeit
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1)
 Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
Migration zwischen Mexiko und den USA: Das Beispiel der indigenen Gemeinschaft El Alberto in Zentralmexiko.
 Migration zwischen Mexiko und den USA: Das Beispiel der indigenen Gemeinschaft El Alberto in Zentralmexiko. María Guadalupe Rivera Garay Universität Bielefeld Hintergrund des Vortrags Basiert auf der Forschung
Migration zwischen Mexiko und den USA: Das Beispiel der indigenen Gemeinschaft El Alberto in Zentralmexiko. María Guadalupe Rivera Garay Universität Bielefeld Hintergrund des Vortrags Basiert auf der Forschung
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Mag.a Samira Bouslama
 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Mag.a Samira Bouslama Die Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologische Dimension Gesellschaftliche Dimension Schutz von Natur und Umwelt Erhalt der natürlichen Ressourcen
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Mag.a Samira Bouslama Die Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologische Dimension Gesellschaftliche Dimension Schutz von Natur und Umwelt Erhalt der natürlichen Ressourcen
6. Einheit Wachstum und Verteilung
 6. Einheit Wachstum und Verteilung Wirtschaftswachstum und Wohlstand (1) Wachstum: Wirtschaftswachstum = Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts real = zu konstanten Preisen Beispiele (2006): Österreich:
6. Einheit Wachstum und Verteilung Wirtschaftswachstum und Wohlstand (1) Wachstum: Wirtschaftswachstum = Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts real = zu konstanten Preisen Beispiele (2006): Österreich:
Francis Fukuyama: Staaten bauen. Die neue Herausforderung internationaler Politik, Berlin 2004
 Staaten zu bauen bedeutet, neue Regierungsinstitutionen zu schaffen und bestehende zu stärken. In diesem Buch behaupte ich, dass der Staatenaufbau eine der wichtigsten Aufgaben der Weltgemeinschaft werden
Staaten zu bauen bedeutet, neue Regierungsinstitutionen zu schaffen und bestehende zu stärken. In diesem Buch behaupte ich, dass der Staatenaufbau eine der wichtigsten Aufgaben der Weltgemeinschaft werden
02a / Globalisierung. Was ist das?
 Was ist das? http://beamer.wikia.com/wiki/datei:weltkugel.png Was ist das? die Erde die Welt eine Kugel die Weltkugel ein Planet... der Globus! global (Adjektiv) von lateinisch: globus Kugel, Erdkugel,
Was ist das? http://beamer.wikia.com/wiki/datei:weltkugel.png Was ist das? die Erde die Welt eine Kugel die Weltkugel ein Planet... der Globus! global (Adjektiv) von lateinisch: globus Kugel, Erdkugel,
Gesellschaftslehre Jahrgang 8
 Gesellschaftslehre Jahrgang 8 Industrielle Revolution und Strukturwandel SchülerInnen... Warum begann die Industrialisierung in England? beschreiben Schlüsselereignisse, epochale Errungenschaften und wesentliche
Gesellschaftslehre Jahrgang 8 Industrielle Revolution und Strukturwandel SchülerInnen... Warum begann die Industrialisierung in England? beschreiben Schlüsselereignisse, epochale Errungenschaften und wesentliche
dieindigenen,undeswerdenoftnurgeringeodergarkeineabfindungengezahlt.vielefamilienleidenimmermehrunterderverschmutzungderflüsse
 Deutscher Bundestag Drucksache 17/7588 17. Wahlperiode 04. 11. 2011 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Volker Beck (Köln), Tom Koenigs, Ingrid Hönlinger, weiterer Abgeordneter
Deutscher Bundestag Drucksache 17/7588 17. Wahlperiode 04. 11. 2011 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Volker Beck (Köln), Tom Koenigs, Ingrid Hönlinger, weiterer Abgeordneter
Wem gehört das Wasser?
 Herausforderung Wasser brauchen wir eine blaue Revolution? von Ulrike Höfken MdB (Bündnis 90/Die Grünen) Wem gehört das Wasser? BÖLW-Herbsttagung Über 90 % der Versorgung noch in öffentlicher Hand Wasser
Herausforderung Wasser brauchen wir eine blaue Revolution? von Ulrike Höfken MdB (Bündnis 90/Die Grünen) Wem gehört das Wasser? BÖLW-Herbsttagung Über 90 % der Versorgung noch in öffentlicher Hand Wasser
Die Energiewende im ländlichen Verteilnetz. Uelzen, 28. Mai 2013 Thorsten Gross, E.ON Avacon AG
 Die Energiewende im ländlichen Verteilnetz Uelzen, 28. Mai 2013 Thorsten Gross, E.ON Avacon AG Inhalt 1. E.ON Avacon Ein ländlicher Verteilnetzbetreiber 2. Das Großprojekt Energiewende Ziele, Maßnahmen,
Die Energiewende im ländlichen Verteilnetz Uelzen, 28. Mai 2013 Thorsten Gross, E.ON Avacon AG Inhalt 1. E.ON Avacon Ein ländlicher Verteilnetzbetreiber 2. Das Großprojekt Energiewende Ziele, Maßnahmen,
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Weltdekade der Vereinten Nationen 2005-2014 Hossam Gamil, Programmleiter für Erneuerbare Energien & Umwelt GERMAN ACADEMY FOR RENEWABLE ENERGY AND ENVIRONMENTAL
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Weltdekade der Vereinten Nationen 2005-2014 Hossam Gamil, Programmleiter für Erneuerbare Energien & Umwelt GERMAN ACADEMY FOR RENEWABLE ENERGY AND ENVIRONMENTAL
EINE WELT FÜR KINDER WORLD VISION SCHWEIZ. World Vision Schweiz / Eine Welt für Kinder /
 WORLD VISION SCHWEIZ EINE WELT FÜR KINDER World Vision Schweiz / Eine Welt für Kinder / 2016 1 Eine Welt voller Hoffnung. Eine Welt mit Zukunft. Eine fürsorgliche Welt mit Raum für Entwicklung. Mit geschützten
WORLD VISION SCHWEIZ EINE WELT FÜR KINDER World Vision Schweiz / Eine Welt für Kinder / 2016 1 Eine Welt voller Hoffnung. Eine Welt mit Zukunft. Eine fürsorgliche Welt mit Raum für Entwicklung. Mit geschützten
Zivile Konfliktbearbeitung
 Zivile Konfliktbearbeitung Vorlesung Gdfkgsd#älfeüroktg#üpflgsdhfkgsfkhsäedlrfäd#ögs#dög#sdöfg#ödfg#ö Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2007/08 Marburg, 29. Januar 2008 Zivile
Zivile Konfliktbearbeitung Vorlesung Gdfkgsd#älfeüroktg#üpflgsdhfkgsfkhsäedlrfäd#ögs#dög#sdöfg#ödfg#ö Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2007/08 Marburg, 29. Januar 2008 Zivile
Es gilt das gesprochene Wort!
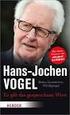 Rede von Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich des gemeinsamen Treffens der StadtAGs, des Integrationsrates und des AK Kölner Frauenvereinigungen am 15. April 2016, 13:30 Uhr, Dienststelle
Rede von Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich des gemeinsamen Treffens der StadtAGs, des Integrationsrates und des AK Kölner Frauenvereinigungen am 15. April 2016, 13:30 Uhr, Dienststelle
Kräfte bündeln Zukunft gestalten
 Kräfte bündeln Zukunft gestalten Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung Mit einer Stimme gegen die Armut Wer sich neuen Herausforderungen stellt, muss Neuland betreten. Mit der Gründung des
Kräfte bündeln Zukunft gestalten Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung Mit einer Stimme gegen die Armut Wer sich neuen Herausforderungen stellt, muss Neuland betreten. Mit der Gründung des
Sonderprogramm Biosphärenreservat Yasuní Deutsch-ecuadorianische Zusammenarbeit
 Sonderprogramm Biosphärenreservat Yasuní Deutsch-ecuadorianische Zusammenarbeit Durchgeführt von: Der Regenwald zählt zu den artenreichsten Gebieten unseres Planeten. Die deutsch-ecuadorianische Zusammenarbeit
Sonderprogramm Biosphärenreservat Yasuní Deutsch-ecuadorianische Zusammenarbeit Durchgeführt von: Der Regenwald zählt zu den artenreichsten Gebieten unseres Planeten. Die deutsch-ecuadorianische Zusammenarbeit
Imperialismus und Erster Weltkrieg Hauptschule Realschule Gesamtschule Gymnasium Inhaltsfeld 8: Imperialismus und Erster Weltkrieg
 Imperialismus Hauptschule Realschule Gesamtschule Gymnasium Inhaltsfeld 8: Imperialismus Inhaltsfeld 6: Imperialismus Inhaltsfeld 8: Imperialismus 8. Inhaltsfeld: Imperialismus Inhaltliche Schwerpunkte
Imperialismus Hauptschule Realschule Gesamtschule Gymnasium Inhaltsfeld 8: Imperialismus Inhaltsfeld 6: Imperialismus Inhaltsfeld 8: Imperialismus 8. Inhaltsfeld: Imperialismus Inhaltliche Schwerpunkte
LEITBILD. Internationale Projekte
 LEITBILD Internationale Projekte Caritas Caritas (lateinisch für Hochachtung und Liebe) ist das engagierte und uneigennützige Handeln der Christen für Menschen in Not. Die Caritas Österreich ist als Teil
LEITBILD Internationale Projekte Caritas Caritas (lateinisch für Hochachtung und Liebe) ist das engagierte und uneigennützige Handeln der Christen für Menschen in Not. Die Caritas Österreich ist als Teil
ARF - Erfahrungsaustausch
 Modernisierung des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens Schuldenkrise - Konsolidierung. Warum liefert die bisherige Modernisierung bisher noch keinen entscheidenden Beitrag? - 10 Thesen - Prof.
Modernisierung des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens Schuldenkrise - Konsolidierung. Warum liefert die bisherige Modernisierung bisher noch keinen entscheidenden Beitrag? - 10 Thesen - Prof.
Gemeinsam gegen HIV/AIDS in Entwicklungsländern kämpfen
 Gemeinsam gegen HIV/AIDS in Entwicklungsländern kämpfen Beschluss des Bundesvorstandes der Jungen Union Deutschlands vom 16. März 2002 Die HIV Epidemie hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einer humanitären
Gemeinsam gegen HIV/AIDS in Entwicklungsländern kämpfen Beschluss des Bundesvorstandes der Jungen Union Deutschlands vom 16. März 2002 Die HIV Epidemie hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einer humanitären
(Materielles) Wachstum eine Grundbedingung für Wirtschaft und Wohlstand? Mag. Karin Steigenberger, BA Wirtschaftskammer Österreich
 (Materielles) Wachstum eine Grundbedingung für Wirtschaft und Wohlstand? Mag. Karin Steigenberger, BA Wirtschaftskammer Österreich Dienstag, 4. März 2014 Umwelt Management Austria Wohlstand ohne Wachstum?
(Materielles) Wachstum eine Grundbedingung für Wirtschaft und Wohlstand? Mag. Karin Steigenberger, BA Wirtschaftskammer Österreich Dienstag, 4. März 2014 Umwelt Management Austria Wohlstand ohne Wachstum?
Rede zur Bewerbung um die Kandidatur zum 16. Deutschen Bundestag im Wahlkreis 292 (Ulm/Alb-Donau-Kreis) bei der Mitgliederversammlung am 18.
 Annette Schavan Rede zur Bewerbung um die Kandidatur zum 16. Deutschen Bundestag im Wahlkreis 292 (Ulm/Alb-Donau-Kreis) bei der Mitgliederversammlung am 18. Juni 2005 I. Politik braucht Vertrauen. Ich
Annette Schavan Rede zur Bewerbung um die Kandidatur zum 16. Deutschen Bundestag im Wahlkreis 292 (Ulm/Alb-Donau-Kreis) bei der Mitgliederversammlung am 18. Juni 2005 I. Politik braucht Vertrauen. Ich
Degrowth Ziele, Visionen und Herausforderungen
 Degrowth Ziele, Visionen und Herausforderungen Judith Kleibs Oikos Germany Meeting 30. Mai 2015 Inhalt 1. Definition Degrowth 2. Geschichte der Degrowth-Bewegung 3. Visionen und Ziele 4. Herausforderungen
Degrowth Ziele, Visionen und Herausforderungen Judith Kleibs Oikos Germany Meeting 30. Mai 2015 Inhalt 1. Definition Degrowth 2. Geschichte der Degrowth-Bewegung 3. Visionen und Ziele 4. Herausforderungen
Bedeutungen und Sinnzusammenhänge von Teilhabe
 15 Bedeutungen und Sinnzusammenhänge von Teilhabe Im Jahr 2001 wurde im Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) der Begriff Teilhabe eingeführt. Wie in Gesetzen üblich, wurde der neue Begriff Teilhabe nicht
15 Bedeutungen und Sinnzusammenhänge von Teilhabe Im Jahr 2001 wurde im Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) der Begriff Teilhabe eingeführt. Wie in Gesetzen üblich, wurde der neue Begriff Teilhabe nicht
Die Rolle der Nichtregierungsorganisationen (NGO) in der Erhaltungsarbeit
 Die Rolle der Nichtregierungsorganisationen (NGO) in der Erhaltungsarbeit Waltraud Kugler SAVE-Monitoring Institute St. Gallen Was sind NGOs? NGO (NRO) = nichtstaatliche Organisation, nicht auf Gewinn
Die Rolle der Nichtregierungsorganisationen (NGO) in der Erhaltungsarbeit Waltraud Kugler SAVE-Monitoring Institute St. Gallen Was sind NGOs? NGO (NRO) = nichtstaatliche Organisation, nicht auf Gewinn
Menschenrechte- Seite1
 Menschenrechte- Seite1 00:00 Länge Text 00:07 23 Die Welt ist voller unterschiedlicher Kulturen, Länder und Menschen. Bei allen Unterschieden gibt es aber eine wichtige Gemeinsamkeit: Alle Menschen sind
Menschenrechte- Seite1 00:00 Länge Text 00:07 23 Die Welt ist voller unterschiedlicher Kulturen, Länder und Menschen. Bei allen Unterschieden gibt es aber eine wichtige Gemeinsamkeit: Alle Menschen sind
Globale Herausforderungen meistern! Hunger verringern und Fortentwicklung über stabile Entwicklungsländer schaffen
 Globale Herausforderungen meistern! Hunger verringern und Fortentwicklung über stabile Entwicklungsländer schaffen >> Sichtweisen des bayerischen Berufstands
Globale Herausforderungen meistern! Hunger verringern und Fortentwicklung über stabile Entwicklungsländer schaffen >> Sichtweisen des bayerischen Berufstands
Arbeitsblatt Individueller Wasserverbrauch Lösungsvorschläge
 Arbeitsblatt Individueller Wasserverbrauch Lösungsvorschläge Überlege, welche Rolle Wasser in deinem Leben spielt. Gehe dabei deinen persönlichen Tagesablauf durch und trage ein, wann du Wasser benutzt.
Arbeitsblatt Individueller Wasserverbrauch Lösungsvorschläge Überlege, welche Rolle Wasser in deinem Leben spielt. Gehe dabei deinen persönlichen Tagesablauf durch und trage ein, wann du Wasser benutzt.
Lean Management. Unterschiede zu anderen Unternehmensführungskonzepten
 Wirtschaft Turhan Yazici Lean Management. Unterschiede zu anderen Unternehmensführungskonzepten Studienarbeit Hochschule für Wirtschaft Hausarbeit im Fach Sozialwissenschaften Thema : Lean Management
Wirtschaft Turhan Yazici Lean Management. Unterschiede zu anderen Unternehmensführungskonzepten Studienarbeit Hochschule für Wirtschaft Hausarbeit im Fach Sozialwissenschaften Thema : Lean Management
Ökonomie für die Gegenwart, Ökologie für die Zukunft?
 Zusammenfassung der Befragungsergebnisse der 3. Umfrage Ökonomie für die Gegenwart, Ökologie für die Zukunft? Während für den Erhalt eines sicheren Lebensumfeldes und des sozialen Friedens besonders ökonomische
Zusammenfassung der Befragungsergebnisse der 3. Umfrage Ökonomie für die Gegenwart, Ökologie für die Zukunft? Während für den Erhalt eines sicheren Lebensumfeldes und des sozialen Friedens besonders ökonomische
Das UNESCO MAB-Programm und das Biosphärenreservats-Konzept
 Das UNESCO MAB-Programm und das Biosphärenreservats-Konzept Workshop Biosphärenreservate in Afrika Instrument für nachhaltige Entwicklung Bonn, 03.12.2012 Gliederung 1. Was sind Biosphärenreservate? 2.
Das UNESCO MAB-Programm und das Biosphärenreservats-Konzept Workshop Biosphärenreservate in Afrika Instrument für nachhaltige Entwicklung Bonn, 03.12.2012 Gliederung 1. Was sind Biosphärenreservate? 2.
Seite 1. Grußwort PSt in Marks
 Seite 1 Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Herr Lehrieder, sehr geehrter Herr Corsa, ich freue
Seite 1 Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Herr Lehrieder, sehr geehrter Herr Corsa, ich freue
Europäische. Geschichte im zwanzigsten Jahrhundert
 Europäische Geschichte im zwanzigsten Jahrhundert Überblick Krieg und Frieden Europa und die Welt Exklusion und Inklusion Demokratie, Partizipation, Zivilgesellschaft Organisatorisches Anwesenheit Sprechstunde:
Europäische Geschichte im zwanzigsten Jahrhundert Überblick Krieg und Frieden Europa und die Welt Exklusion und Inklusion Demokratie, Partizipation, Zivilgesellschaft Organisatorisches Anwesenheit Sprechstunde:
Leitlinie Gesundheit
 Leitlinie Gesundheit als Teil des strategischen Stadtentwicklungskonzeptes München - Inhalte, Konzepte und Umsetzungsmöglichkeiten Gabriele Spies Referat für Gesundheit und Umwelt, München Strategische
Leitlinie Gesundheit als Teil des strategischen Stadtentwicklungskonzeptes München - Inhalte, Konzepte und Umsetzungsmöglichkeiten Gabriele Spies Referat für Gesundheit und Umwelt, München Strategische
Die Vertreibung der Sudetendeutschen
 Geschichte Daniela Hendel Die Vertreibung der Sudetendeutschen Studienarbeit 1 Inhaltsverzeichnis Einführung 2-4 1. Vorgeschichte bis zum 2. Weltkrieg 1.1. Der tschechoslowakische Staat und die Sudetendeutschen
Geschichte Daniela Hendel Die Vertreibung der Sudetendeutschen Studienarbeit 1 Inhaltsverzeichnis Einführung 2-4 1. Vorgeschichte bis zum 2. Weltkrieg 1.1. Der tschechoslowakische Staat und die Sudetendeutschen
NGOs - normatives und utilitaristisches Potenzial für das Legitimitätsdefizit transnationaler Politik?
 Politik Sandra Markert NGOs - normatives und utilitaristisches Potenzial für das Legitimitätsdefizit transnationaler Politik? Studienarbeit Universität Stuttgart Institut für Sozialwissenschaften Abteilung
Politik Sandra Markert NGOs - normatives und utilitaristisches Potenzial für das Legitimitätsdefizit transnationaler Politik? Studienarbeit Universität Stuttgart Institut für Sozialwissenschaften Abteilung
Kulturelle Vielfalt als Auftrag der Auswärtigen Kulturpolitik
 Medien Caroline Schließmann Kulturelle Vielfalt als Auftrag der Auswärtigen Kulturpolitik Die UNESCO-Konvention. Ein Konzept? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Kulturelle Vielfalt: Herausforderung unserer
Medien Caroline Schließmann Kulturelle Vielfalt als Auftrag der Auswärtigen Kulturpolitik Die UNESCO-Konvention. Ein Konzept? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Kulturelle Vielfalt: Herausforderung unserer
Bevölkerungsdynamik und Entwicklungszusammenarbeit
 Bevölkerungsdynamik und Entwicklungszusammenarbeit Chancen der demografischen Entwicklung nutzen Bevölkerungsdynamik: Aktuelle demografische Trends Die Weltbevölkerung wächst Zurzeit leben mehr als sieben
Bevölkerungsdynamik und Entwicklungszusammenarbeit Chancen der demografischen Entwicklung nutzen Bevölkerungsdynamik: Aktuelle demografische Trends Die Weltbevölkerung wächst Zurzeit leben mehr als sieben
am 27. August 2009 in Bonn
 Rede des Ministers für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen Herrn Armin Laschet anlässlich der Eröffnung der 2. Bonner Konferenz für Entwicklungspolitik am 27. August
Rede des Ministers für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen Herrn Armin Laschet anlässlich der Eröffnung der 2. Bonner Konferenz für Entwicklungspolitik am 27. August
Erklärung von Hermann Gröhe, Gesundheitsminister Mitglied des Deutschen Bundestags
 Erklärung von Hermann Gröhe, Gesundheitsminister Mitglied des Deutschen Bundestags anlässlich des Hochrangigen Ministertreffens auf VN-Ebene zu HIV/AIDS vom 8. 10. Juni 2016 in New York - 2 - - 2 - Sehr
Erklärung von Hermann Gröhe, Gesundheitsminister Mitglied des Deutschen Bundestags anlässlich des Hochrangigen Ministertreffens auf VN-Ebene zu HIV/AIDS vom 8. 10. Juni 2016 in New York - 2 - - 2 - Sehr
Herzlich Willkommen zum. Informationstreff des Helferkreis Asyl Moosinning. Sonntag, 24. Januar Helferkreis Asyl Moosinning
 Herzlich Willkommen zum 1 Informationstreff des Helferkreis Asyl Moosinning Sonntag, 24. Januar 2016 2 Begrüßung und Einführung Manfred Böhm, Sprecher Helferkreis Asyl Moosinning 3 Was erwartet Sie heute?
Herzlich Willkommen zum 1 Informationstreff des Helferkreis Asyl Moosinning Sonntag, 24. Januar 2016 2 Begrüßung und Einführung Manfred Böhm, Sprecher Helferkreis Asyl Moosinning 3 Was erwartet Sie heute?
TTIP Worum geht es? Eine-Welt-Verein/ WELTLADEN E.Frasch
 T T I? P Transatlantic Trade and Investment Partnership Transatlantic Trade and Investment Partnership Freihandelsabkommen USA - EU Bilaterales Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA Verhandlungen
T T I? P Transatlantic Trade and Investment Partnership Transatlantic Trade and Investment Partnership Freihandelsabkommen USA - EU Bilaterales Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA Verhandlungen
Dr. Frank Gesemann Zum Stand der kommunalen Integrations- und Diversitätspolitik in Deutschland
 Dr. Frank Gesemann Zum Stand der kommunalen Integrations- und Diversitätspolitik in Deutschland Rethinking Migration: Diversity Policies in Immigration Societies International Conference 8 9 December 2011
Dr. Frank Gesemann Zum Stand der kommunalen Integrations- und Diversitätspolitik in Deutschland Rethinking Migration: Diversity Policies in Immigration Societies International Conference 8 9 December 2011
Soziale Arbeit am Limit - Über konzeptionelle Begrenzungen einer Profession
 Soziale Arbeit am Limit - Über konzeptionelle Begrenzungen einer Profession Prof. Dr. phil. habil. Carmen Kaminsky FH Köln 1. Berufskongress des DBSH, 14.11.2008 Soziale Arbeit am Limit? an Grenzen stossen
Soziale Arbeit am Limit - Über konzeptionelle Begrenzungen einer Profession Prof. Dr. phil. habil. Carmen Kaminsky FH Köln 1. Berufskongress des DBSH, 14.11.2008 Soziale Arbeit am Limit? an Grenzen stossen
Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und Lokale Agenda 21
 Laudationes Kategorie Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und Lokale Agenda 21 Laudator: Dr. Herbert O. Zinell Oberbürgermeister der Stadt Schramberg Vorsitzender des Kuratoriums der SEZ (Ablauf: Nennung
Laudationes Kategorie Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und Lokale Agenda 21 Laudator: Dr. Herbert O. Zinell Oberbürgermeister der Stadt Schramberg Vorsitzender des Kuratoriums der SEZ (Ablauf: Nennung
Semester: Kürzel Titel CP SWS Form P/WP Turnus Sem. A Politikwissenschaft und Forschungsmethoden 4 2 S P WS 1.
 Politikwissenschaft, Staat und Forschungsmethoden BAS-1Pol-FW-1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. - kennen die Gliederung der Politikwissenschaft sowie ihre Erkenntnisinteressen und zentralen theoretischen
Politikwissenschaft, Staat und Forschungsmethoden BAS-1Pol-FW-1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. - kennen die Gliederung der Politikwissenschaft sowie ihre Erkenntnisinteressen und zentralen theoretischen
Kompetenzerwartungen im Fach Politik-Wirtschaft. Klasse 5. Sachkompetenz. Handlungskompetenz. Urteilskompetenz. Methodenkompetenz
 Kompetenzerwartungen im Fach PolitikWirtschaft Klasse 5 Die menschlichen Grundbedürfnisse und Güterarten beschreiben. Die Rolle des Geldes als Tauschmittel erläutern. Möglichkeiten der Mitgestaltung der
Kompetenzerwartungen im Fach PolitikWirtschaft Klasse 5 Die menschlichen Grundbedürfnisse und Güterarten beschreiben. Die Rolle des Geldes als Tauschmittel erläutern. Möglichkeiten der Mitgestaltung der
Was ist Mikroökonomie? Kapitel 1. Was ist Mikroökonomie? Was ist Mikroökonomie? Themen der Mikroökonomie
 Was ist Mikroökonomie? Mikroökonomie handelt von begrenzten Ressourcen. Kapitel 1 Themen der Mikroökonomie Beschränkte Budgets, beschränkte Zeit, beschränkte Produktionsmöglichkeiten. Welches ist die optimale
Was ist Mikroökonomie? Mikroökonomie handelt von begrenzten Ressourcen. Kapitel 1 Themen der Mikroökonomie Beschränkte Budgets, beschränkte Zeit, beschränkte Produktionsmöglichkeiten. Welches ist die optimale
Nicht-Diskriminierung. Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria
 Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache,
Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache,
3) Faktoren der Frühindustrialisierung 3.1. Pionier und Nachzügler/Industrialisierung der Regionen
 3) Faktoren der Frühindustrialisierung 3.1. Pionier und Nachzügler/Industrialisierung der Regionen Hinsichtlich des technologischen Entwicklungsstandes, der Mechanisierung, der Maschinenausstattung, der
3) Faktoren der Frühindustrialisierung 3.1. Pionier und Nachzügler/Industrialisierung der Regionen Hinsichtlich des technologischen Entwicklungsstandes, der Mechanisierung, der Maschinenausstattung, der
Lehrstoffverteilung Band 2 AHS
 Vorbemerkung: Die hier vorgenommene Einteilung des Lehrstoffes in Kern- und Erweiterungsstoff versteht sich als Vorschlag und kann von den Lehrpersonen je nach schulautonomen Gesichtspunkten und individuellen
Vorbemerkung: Die hier vorgenommene Einteilung des Lehrstoffes in Kern- und Erweiterungsstoff versteht sich als Vorschlag und kann von den Lehrpersonen je nach schulautonomen Gesichtspunkten und individuellen
3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II
 3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II Evangelischer Religionsunterricht erschließt die religiöse Dimension der Wirklichkeit und des Lebens und trägt damit zur religiösen Bildung der Schüler/innen
3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II Evangelischer Religionsunterricht erschließt die religiöse Dimension der Wirklichkeit und des Lebens und trägt damit zur religiösen Bildung der Schüler/innen
Die Bedeutung der Kategorie Geschlecht in der Sozialen Arbeit
 Prof. Dr. Birgit Meyer Die Bedeutung der Kategorie Geschlecht in der Sozialen Arbeit Vortrag auf der Tagung der BAG Wohnungslosenhilfe zum Thema: Menschenrechte und Frauenrechte in der Wohnungslosenhilfe
Prof. Dr. Birgit Meyer Die Bedeutung der Kategorie Geschlecht in der Sozialen Arbeit Vortrag auf der Tagung der BAG Wohnungslosenhilfe zum Thema: Menschenrechte und Frauenrechte in der Wohnungslosenhilfe
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
 Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss Grundsätze wirksamer und verlässlicher Sozialleistungssysteme (2015/SOC 520) Berichterstatter: Prof. Dr. Bernd Schlüter - EU auch als Wertegemeinschaft gegründet
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss Grundsätze wirksamer und verlässlicher Sozialleistungssysteme (2015/SOC 520) Berichterstatter: Prof. Dr. Bernd Schlüter - EU auch als Wertegemeinschaft gegründet
