Ethische Bewertung von Public-Health-Maßnahmen: Methodische Grundlagen und praktische Anwendung
|
|
|
- Karsten Frei
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Georg Marckmann Ethische Bewertung von Public-Health-Maßnahmen: Methodische Grundlagen und praktische Anwendung Münchner Public Health Forum
2 Public Health: Ethische Besonderheiten PH-Perspektive geht über das Individuum hinaus ð Konflikte mit Wohlergehen und Selbstbestimmung des Einzelnen möglich PH: Nicht nur Deskription, sondern bevölkerungsbezogene Interventionen ð Legitimation erforderlich! Nicht Krankheitsbekämpfung, sondern Gesundheitsförderung und Prävention ð PH-Maßnahmen müssen bei Gesunden ansetzen (mit Belastungen & Risiken!) Populationsbezug ð Abwägung zwischen populationsbezogenem Nutzen und individuellen Belastungen/ Risiken Gerechte Verteilung des Nutzens darf bei Orientierung an populationsbezogenen Durchschnittswerten nicht verloren gehen! Georg Marckmann # 2
3 Public Health Ethik: Ausgangspunkte Zielsetzungen einer Public Health Ethik (1) Identifikation ethischer Fragen im Bereich von Public Health (2) Ethische Evaluation von Public Health-Maßnahmen ethisch (3) Erarbeitung ethisch begründeter Empfehlungen für die Entwicklung und Implementierung von PH-Maßnahmen Voraussetzungen (1) (Umfassendes & flexibles) normatives Framework ð explizite ethische Begründung (2) Systematisches methodisches Vorgehen ð transparente Evaluation, Sicherung der Prozess-Qualität, Ausbildung & Leitlinie für Public Health Professionals Georg Marckmann # 3
4 Kass N 2001 Childress JF, Faden RR et al Roberts MJ & Reich MR 2002 Upshur REG 2002 Jennings B, Kahn J et al An Ethics Framework for Public Health 1. What are the public health goals of the proposed program? 2. How effective is the program in achieving its stated goals? 3. What are the known or potential burdens of the program? 4. Can burdens be minimized? Are there alternative approaches? 5. Is the program implemented fairly? 6. How can the benefits and burdens of a program be fairly balanced? General Moral Considerations for Public Health Ethics 1. Producing benefits 2. Avoiding, preventing, and removing harms 3. Producing the maximal balance of benefits over harms and other costs (utility) 4. Distributing benefits and burdens fairly (distributive justice) and ensuring public participation including the participation of affected parties (procedural justice) 5. respecting autonomous choices and actions, including liberty of action 6. protecting privacy and confidentiality 7. keeping promises and commitments 8. disclosing information as well as speaking honestly and truthfully (transparency) 9. building and maintaining trust Framework for Ethical Analysis in Public Health 1. Consequences 2. Rights 3. Community (such as appropriate social order and virtues that will maintain such an order in a particular community. Principles for the Justification of Public Health Intervention 1. Prevent Harm 2. Use Least Restrictive Means 3. Reciprocity 4. Transparency A Strategy for Discussing Ethical Issues in Public Health 1. Identify the ethical problem(s) germane to the decision. 2. Assess the factual information available to the decision maker(s). 3. Identify the stakeholders in the decision 4. Identify the values at stake in the decision. 5. Identify the options available to the decision maker. 6. Consider the process for making the decision and the values that pertain to the process. Methodological steps A) Specifying and weighting B) Resolving conflicts (by taking into account five justificatory conditions: Effectiveness, Proportionality, Necessity, Least infringement, and Public justification Georg Marckmann Strech & Marckmann # 4
5 Der Ansatz im Überblick Ethische Theorie Zielsetzung Allgemeine Maßstäbe für moralisch richtig/ falsch begründen Umsetzung PHE Kohärentistisches Begründungsverfahren Normatives Framework Normative Orientierung für bestimmte Anwendungsbereiche Normatives Framework für den Bereich Public Health Praktische Methodologie Normative Beurteilung einzelner Handlungen bzw. Praxisfelder Methodisches Vorgehen einer Public Health Ethik Georg Marckmann # 5
6 Der Ansatz im Überblick Ethische Theorie Zielsetzung Allgemeine Maßstäbe für moralisch richtig/ falsch begründen Umsetzung PHE Kohärentistisches Begründungsverfahren Normatives Framework Normative Orientierung für bestimmte Anwendungsbereiche Normatives Framework für den Bereich Public Health Praktische Methodologie Normative Beurteilung einzelner Handlungen bzw. Praxisfelder Methodisches Vorgehen einer Public Health Ethik Georg Marckmann # 6
7 Ethische Theorie Normative (bewertende) Ethik ð Begründung ð ethische Theorie Beispiele Utilitarismus: Prinzip der Nutzenmaximierung Kantische Ethik: Kategorischer Imperativ Trilemma der angewandten Ethik: (1) Pluralismus ethischer Theorien (2) Abstraktionsgrad ethischer Theorien (3) Berücksichtigung verschiedener moralischer Aspekte erforderlich: Verpflichtungen, Handlungsfolgen, Haltungen Alternativmodell: Kohärentistische Ethikbegründung Bedeutender Vertreter: Prinzipienorientierte Medizinethik Tom L. Beauchamp & James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (1979, 6. Aufl. 2009)
8 Kohärentistische Ethikbegründung Keine umfassende Moraltheorie, kein oberstes Moralprinzip Ausgangspunkt: weithin geteilte moralische Überzeugungen à Rekonstruktion sog. mittleren Prinzipien als moralische Grundorientierung à Prüfung auf Kohärenz: bei der Anwendung im Einzelfall à Kohärentistische oder rekonstruktive Ethikbegründung Mittlere Prinzipien: prima facie verbindlich à Fallbezogene Interpretation & Gewichtung à Beurteilungsspielraum im Einzelfall Beispiel: 4 medizinethische Prinzipien Wohltun/Nutzen Nichtschaden Respekt der (Patienten-)Autonomie Gerechtigkeit
9 Der Ansatz im Überblick Ethische Theorie Zielsetzung Allgemeine Maßstäbe für moralisch richtig/ falsch begründen Umsetzung PHE Kohärentistisches Begründungsverfahren Normatives Framework Normative Orientierung für bestimmte Anwendungsbereiche Normatives Framework für den Bereich Public Health Praktische Methodologie Normative Beurteilung einzelner Handlungen bzw. Praxisfelder Methodisches Vorgehen einer Public Health Ethik Georg Marckmann # 9
10 Public Health Ethik: Normatives Framework Bewertungskriterien Ethische Begründung 1. Nutzenpotenzial Prinzip des Wohltuns, Nutzenmaximierung 2. Schadenspotenzial Prinzip des Nichtschadens 3. Selbstbestimmung Prinzip Respekt der Autonomie, Prinzip des Wohltuns 4. Gerechtigkeit Prinzip der Gerechtigkeit 5. Effizienz Prinzip der Nutzenmaximierung; Prinzip der Gerechtigkeit 6. Legitimität Prinzip der Gerechtigkeit, Respekt der Autonomie Georg Marckmann
11 1 2 Normatives Bewertungskriterium Nutzenpotential für Zielpopulation Bestimmung der Interventionsziele Grad der Zielerreichung Relevanz für Morbidität, Lebensqualität & Mortalität Validität (Evidenzgrad) des Nutzennachweises Schadenspotential für die Teilnehmer Belastungen (individuell und gruppenbezogen) Gesundheitliche Risiken Validität (Evidenzgrad) 3 Selbstbestimmung Förderung der Gesundheitskompetenz des Einzelnen (Empowerment) Möglichkeit zur informierten Einwilligung Auswirkungen auf die Entscheidungsfreiheit Schutz der Privatsphäre (personelle Integrität, Vertraulichkeit, Datenschutz) 4 Gerechtigkeit (Nicht-diskriminierender) Zugang zur PH Maßnahme Verteilung der gesundheitlichen Nutzen- und Schadenspotentiale Ausgleich bestehender Ungleichheiten in den Gesundheitschancen Bedarf an Kompensation 5 Effizienz Kosten-Nutzen-Verhältnis Validität der Effizienzmessung Ethische Begründung Prinzip des Wohltuns, Prinzip der Nutzenmaximierung Prinzip des Nichtschadens Prinzip Respekt der Autonomie, Prinzip des Wohltuns Prinzip der Gerechtigkeit Prinzip der Nutzenmaximierung; Prinzip der Gerechtigkeit 6 Legitimität Legitimierte Entscheidungsinstanz Fairer Entscheidungsprozess (Transparenz, Partizipation, rationale Begründung, Möglichkeit der Revision, Regulierung) Georg Marckmann Prinzip der Gerechtigkeit, Respekt der Autonomie Marckmann & Strech # 11
12 Kriterien eines faireren Entscheidungsprozesses Kriterium Transparenz Konsistenz Begründung Partizipation Minimierung von Interessenkonflikten Offenheit für Revision Regulierung Erläuterung Der Entscheidungsprozess einschließlich der zugrundeliegenden normativen Argumente und empirischen Daten sollten transparent und öffentlich zugänglich sein. Entscheidungen zur Implementierung von Public Health-Maßnahmen sollten den gleichen Regeln und Kriterien folgen, sodass unterschiedliche Populationen und Subpopulationen in vergleichbaren Situationen auch gleich behandelt werden. Die Entscheidung sollte auf einer nachvollziehbaren, relevanten Begründung beruhen. Relevante Gründe sind in diesem Zusammenhang diejenigen, die sich auf die in Tabelle 1 genannten Bewertungskriterien beziehen. Da sich die unvermeidlichen Abwägungen nicht hinreichend konkret aus einer ethischen Theorie ableiten lassen, sollte es bei Entscheidungen über die Etablierung von PH- Maßnahmen für die betroffenen Populationen Möglichkeiten zur Partizipation geben. Entscheidungen über PH-Maßnahmen sollten so geregelt sein, dass sie Interessenkonflikte möglichst vermeiden, d.h. die Entscheidungsträger sollten z.b. keinen direkten finanziellen Vorteil von der Durchführung der PH-Maßnahmen haben. Jede Entscheidung sollte offen für eine Revision sein, sofern sich zum Beispiel die Datengrundlage ändert oder bestimmte Aspekte bislang nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Eine freiwillige oder staatliche Regulierung sollte sicherstellen, dass die formalen Bedingungen eines fairen Entscheidungsprozesses eingehalten werden. Georg Marckmann # 12
13 Der Ansatz im Überblick Ethische Theorie Zielsetzung Allgemeine Maßstäbe für moralisch richtig/ falsch begründen Umsetzung PHE Kohärentistisches Begründungsverfahren Normatives Framework Normative Orientierung für bestimmte Anwendungsbereiche Normatives Framework für den Bereich Public Health Praktische Methodologie Normative Beurteilung einzelner Handlungen bzw. Praxisfelder Methodisches Vorgehen einer Public Health Ethik Georg Marckmann # 13
14 Public Health Ethik: Praktische Methodologie Arbeitsschritte einer ethischen Bewertung von Public Health Maßnahmen 1 Beschreibung Möglichst genaue Charakterisierung der zu untersuchenden Public Health Maßnahme: Zielsetzung, Methodik, Zielpopulation, etc. 2 Spezifizierung Spezifizierung der Bewertungskriterien (Tabelle 1) für die vorliegende Public Health Maßnahme 3 Einzelbewertung Bewertung der Public Health Maßnahme anhand der einzelnen, in Schritt 2 spezifizierten Kriterien im Vergleich zu alternativen Optionen 4 Synthese Übergreifende Beurteilung der Public Health Maßnahme durch Synthese, Gewichtung und Abwägung der Einzelbewertungen aus Schritt 3 5 Empfehlungen Entwicklung von Empfehlungen für die Entwicklung und Implementierung der Public Health Maßnahme Georg Marckmann # 14
15 Empfehlungs-Stufen Stufe Empfehlung Von der Public Health-Maßnahme abraten, keine Kostenübernahme durch die GKV. Public Health-Maßnahme anbieten, keine explizite Empfehlung, eventuell Kostenübernahme durch die GKV. In diesem Fall obliegt es wesentlich der Entscheidung des Einzelnen, ob die Präventionsmaßnahme durchgeführt werden soll oder nicht. Public Health-Maßnahme anbieten und empfehlen, evtl. proaktive Maßnahmen (z.b. Informationskampagnen) zum Erreichung einer höheren Teilnahmerate, Kostenübernahme durch GKV Public Health-Maßnahme anbieten, empfehlen und mit (monetären & nicht-monetären) Anreizen (für Versicherte oder Ärzte) versehen, um eine höhere Teilnahmerate zu erreichen, selbstverständlich Kostenübernahme durch die GKV. Public Health-Maßnahme ist gesetzlich vorgeschrieben, Nichtbefolgung ggf. unter Strafe, Kostenübernahme durch GKV oder Steuerfinanzierung. Georg Marckmann # 15
16 Anwendung des methodischen Vorgehens Beispiel: Impfung des Gesundheitspersonals gegen saisonale Influenza A Ethische Kernfrage: Welche Beeinflussung der Entscheidungsfreiheit des Einzelnen ist ethisch gerechtfertigt, um eine ausreichende Impfrate zu erreichen? Georg Marckmann # 16
17 Public Health Ethik: Praktische Methodologie Arbeitsschritte einer ethischen Bewertung von Public Health Maßnahmen 1 Beschreibung Möglichst genaue Charakterisierung der zu untersuchenden Public Health Maßnahme: Zielsetzung, Methodik, Zielpopulation, etc. 2 Spezifizierung Spezifizierung der Bewertungskriterien (Tabelle 1) für die vorliegende Public Health Maßnahme 3 Einzelbewertung Bewertung der Public Health Maßnahme anhand der einzelnen, in Schritt 2 spezifizierten Kriterien im Vergleich zu alternativen Optionen 4 Synthese Übergreifende Beurteilung der Public Health Maßnahme durch Synthese, Gewichtung und Abwägung der Einzelbewertungen aus Schritt 3 5 Empfehlungen Entwicklung von Empfehlungen für die Entwicklung und Implementierung der Public Health Maßnahme Georg Marckmann # 17
18 Hintergrund Saisonale Influenza-Epidemien: bis Todesfälle weltweit (WHO 2009) Deutschland: 1-5 Mill. zusätzliche Arztbesuche, zusätzliche Hospitalisierungen, bis zu zus. Todesfälle (1995/1996) (RKI 2011) 90% der Todesfälle aufgrund saisonaler Influenza: Alter über 65 Jahre (RKI 2011) Ältere Menschen: reduzierte Funktion des Immunsystems => eingeschränkte Effektivität von Impfungen Infiziertes Gesundheitspersonal (HCW) => nosokomiale Influenza- Ausbrüche, v.a. bei älteren Patienten und Bewohnern Impfung der HCW (90% Effektivität) => reduziert die Exposition, Mortalität und Morbidität in älteren Populationen Ethische Kernfrage: Welche Strategien sind akzeptabel, um die Impfraten von HCW zu erhöhen?
19 Impfung Gesundheitspersonal: Vorgaben Keine gesetzliche Impfpflicht Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut (STIKO) 17 Mitglieder (Virologie, Mikorbiologie, Immunologie, Infektiologie, Pädiatrie, etc.) Empfehlungen zu Impfprogrammen I.d.R. jedes Jahr: Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut (Epidemiologisches Bulletin) Einschließlich Impfkalender mit empfohlenen Impfungen Empfehlung zur Influenza-Impfung (seit1988) Personen über 60 Jahren Personen mit einem erhöhten Risiko durch eine Grunderkrankung (e.g. chronische Atemwegs oder Herzerkrankungen) Personen mit einem erhöhten berufsbedingten Risiko wie Gesundheitspersonal, Personen die Influenza auf Personen mit einem erhöhten Risiko übertragen
20 Public Health Ethik: Praktische Methodologie Arbeitsschritte einer ethischen Bewertung von Public Health Maßnahmen 1 Beschreibung Möglichst genaue Charakterisierung der zu untersuchenden Public Health Maßnahme: Zielsetzung, Methodik, Zielpopulation, etc. 2 Spezifizierung Spezifizierung der Bewertungskriterien (Tabelle 1) für die vorliegende Public Health Maßnahme 3 Einzelbewertung Bewertung der Public Health Maßnahme anhand der einzelnen, in Schritt 2 spezifizierten Kriterien im Vergleich zu alternativen Optionen 4 Synthese Übergreifende Beurteilung der Public Health Maßnahme durch Synthese, Gewichtung und Abwägung der Einzelbewertungen aus Schritt 3 5 Empfehlungen Entwicklung von Empfehlungen für die Entwicklung und Implementierung der Public Health Maßnahme Georg Marckmann # 20
21 Spezifizierte Bewertungskriterien Bewertungskriterien 1. Nutzenpotenzial 2. Schadenspotenzial 3. Selbstbestimmung 4. Gerechtigkeit 5. Effizienz 6. Legitimität Spezifizierung Nutzen für ältere Patienten / Bewohner: reduzierte Morbidität & Mortalität; (Nutzen für HCW) Belastung / Risiken für geimpfte HCW Möglichst wenig restriktive Strategien zur Erhöhung der Impfraten Kompensation bei Impfschäden für geimpfte HCW Kosten-Nutzen-Verhältnis der HCW-Impfung Fairer Entscheidungsprozess zur Einführung eines Impfprogramms für HCW Georg Marckmann
22 Public Health Ethik: Praktische Methodologie Arbeitsschritte einer ethischen Bewertung von Public Health Maßnahmen 1 Beschreibung Möglichst genaue Charakterisierung der zu untersuchenden Public Health Maßnahme: Zielsetzung, Methodik, Zielpopulation, etc. 2 Spezifizierung Spezifizierung der Bewertungskriterien (Tabelle 1) für die vorliegende Public Health Maßnahme 3 Einzelbewertung Bewertung der Public Health Maßnahme anhand der einzelnen, in Schritt 2 spezifizierten Kriterien im Vergleich zu alternativen Optionen 4 Synthese Übergreifende Beurteilung der Public Health Maßnahme durch Synthese, Gewichtung und Abwägung der Einzelbewertungen aus Schritt 3 5 Empfehlungen Entwicklung von Empfehlungen für die Entwicklung und Implementierung der Public Health Maßnahme Georg Marckmann # 22
23 Spezifizierte Bewertungskriterien Bewertungskriterien 1. Nutzenpotenzial 2. Schadenspotenzial 3. Selbstbestimmung 4. Gerechtigkeit 5. Effizienz 6. Legitimität Spezifizierung Nutzen für ältere Patienten / Bewohner: reduzierte Morbidität & Mortalität; (Nutzen für HCW) Belastung / Risiken für geimpfte HCW Möglichst wenig restriktive Strategien zur Erhöhung der Impfraten Kompensation bei Impfschäden für geimpfte HCW Kosten-Nutzen-Verhältnis der HCW-Impfung Fairer Entscheidungsprozess zur Einführung eines Impfprogramms für HCW Georg Marckmann
24 Nutzen der HCW Influenza Impfung Wilde et al. 1999: effectiveness of influenza vaccination in HCW Incidence of influenza: 13.9% (unvaccinated) vs. 1.7% (vaccinated) Potter et al (long-term care) Reduction of overall mortality: 17 to 10% (vaccination rate: 61%) Vaccination of residents ð no significant reduction of mortality! Carman et al (cluster randomized controlled trial in long-term care) Mortality w/ vaccination program: 13.6% (vaccination rate: 50.9%) Mortality in control hospitals: 22.4% (vaccination rate: 4.9%) However: No significant difference in laboratory proven influenza infection! Risk of bias? Vaccination rate of patients: 48% in intervention hospitals vs. 33% in control hospitals Patients in vaccination hospitals had higher Barthel indices (better health status)
25 Nutzen der HCW Influenza Impfung Hayward et al (cluster-randomized controlled trial) Vaccination rate of 48.2% (vs. 5.9%) ð incidence of flue, allcause mortality reduced: minus 5/100 residents Smaller effect in seasons with lower influenza activity Lemaitre et al. 2009: pair-matched cluster randomized controlled trial in French nursing homes Vaccination rates: 69.9 % (intervention) vs. 31.8% (control) Univariate analysis: no significant difference in mortality rate Multivariate analysis: significant 20% decrease in all-cause mortality in intervention homes Statistically significant correlation (-0.42, p=0.007) between staff vaccination coverage and residents all-cause mortality Significantly lower (31%) rates of influenza-like illnesses Risk of performance bias: staff vaccination rates varied: intervention: 48.4% to 89.5%, control: 0% to 69% High variability in mortality rate for given vaccination rate!
26 Nutzen der HCW Influenza Impfung Cochrane Review von Thomas et al RCTs und non-rcts der Influenza Impfung von HCW, die Personen > 60 in Langzeit-Pflegeinrichtungen betreuen, und Effekte untersuchen auf laborchemisch nachgewiesene Influenza, Komplikationen oder ILI (Influenza like illness) Gepoolte Daten von 3 RCTs: kein Effekt auf spezifisches Outcome Nicht-spezifische Outcomes: reduzierte ILI & reduzierte Gesamtmortalität bei Personen >60 Studien haben hohes Risiko einer Verzerrung (bias) Keine Information über die Effektivität von Begleitmaßnahmen (Handwäsche, Gesichtsmasken, Quarantäne, Aufforderung an HCWs mit ILI nicht zur Arbeit zu gehen, ) Schlussfolgerung: There is no evidence that vaccinating HCWs prevents influenza in elderly residents in LTCF Quantitative Beziehung zwischen Impfraten und reduzierte Morbidität/Mortalität erfordert weitere Untersuchungen
27 Spezifizierte Bewertungskriterien Bewertungskriterien 1. Nutzenpotenzial 2. Schadenspotenzial 3. Selbstbestimmung 4. Gerechtigkeit 5. Effizienz 6. Legitimität Spezifizierung Nutzen für ältere Patienten / Bewohner: reduzierte Morbidität & Mortalität; (Nutzen für HCW) Belastung / Risiken für geimpfte HCW Möglichst wenig restriktive Strategien zur Erhöhung der Impfraten Kompensation bei Impfschäden für geimpfte HCW Kosten-Nutzen-Verhältnis der HCW-Impfung Fairer Entscheidungsprozess zu Einführung eines Impfprogramms für HCW Georg Marckmann
28 Risiken der Influenza- Impfung Umfrage-Studie am Universitätsklinikum Frankfurt 1.6% der geimpften HCWs: subfebrile Temperaturen (<38.5 ), keine hatte Fieber (>38.5 ) 8.5% berichteten Kopf- und Gliederschmerzen (aber kein Nachweis einer kausalen Beziehung) Keine ernsteren Nebenwirkungen Sehr seltene Fälle: schwerwiegendere Komplikationen wie Vasculitis, Encephalomyelitis oder Guillain-Baree- Syndrome (Juurlink et al. 2006; Kara et al. 2007) GBS: 1 Fall/1 Million Impfungen
29 Spezifizierte Bewertungskriterien Bewertungskriterien 1. Nutzenpotenzial 2. Schadenspotenzial 3. Selbstbestimmung 4. Gerechtigkeit 5. Effizienz 6. Legitimität Spezifizierung Nutzen für ältere Patienten / Bewohner: reduzierte Morbidität & Mortalität; (Nutzen für HCW) Belastung / Risiken für geimpfte HCW Möglichst wenig restriktive Strategien zur Erhöhung der Impfraten Kompensation bei Impfschäden für geimpfte HCW Kosten-Nutzen-Verhältnis der HCW-Impfung Fairer Entscheidungsprozess zu Einführung eines Impfprogramms für HCW Georg Marckmann
30 Nationale Impfkampagnen: Effektivität Impfraten von HCWs bleiben niedrig Vor 1999/2000: 7-10% (mehr als 50% der Risikogruppen sind nicht geimpft) Nationale Impfkampagne 2002 & 2003 (Leitung: Robert-Koch- Institute) Aussendung von Information- und Fortbildungsmaterial an arbeitsmedizinische Dienste der Krankenhäuser Informations-Flyer, Poster, Vorschläge für Kampagnen, Textvorschläge für Mitarbeiter-Schreiben, ppt-präsentation Publikationen über die Kampagne Unterstützt von wichtigen Stakeholdern, z.b. Bundesärztekammer Deutsche Krankenhaus-Gesellschaft Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung
31
32 Nationale Impfkampagnen: Effektivität Evaluation in 2003/2004 (Leitmeyer et al. /Vaccine 2006;24: ) Impfrate bei HCWs stieg von 21% (2001/2002) auf 26% (2003/2004) Ärzte: 21% 31% Pflegende: 20% 22% Wahrnehmung eines erhöhten Risiko für Influenza: Ärzte 61%, Pflegende 37% Überzeugung, dass die Impfung effektiv ist: Ärzte 59%, Pflegende 33% à HCW sind zu motivieren und Impfraten können steigen aber nur in geringem Ausmaß! à Begrenzte Effektivität der Kampagne!
33 Lokale Impfkampagnen: Bspl.: Uniklinik Frankfurt Lokale Impfkampagne an der Frankfurter Uniklinik (seit ) [Wicker et al. DMW 2007;132: ] Influenza-Impfrate stieg an: 3,5% (2001/2002) 25,8% (2006/2007) Ärzte: 36,5 %, Pflegende: 16,5% Gründe für die Impfung Selbstschutz (92,3%) Schutz von Familie und Freunde (66,8%) Schutz der Patienten (54,5%) Gründe für Nichtteilnahme Kein spezifisches Risiko (77,8%) Grippe ist keine schwere Erkrankung (24%) Angst vor Nebenwirkungen (18,5%) Influenza-Impfung kann eine Grippe auslösen (12,6%) Nicht von Wirksamkeit der Influenza-Impfung überzeugt (11,3%)
34 Spezifizierte Bewertungskriterien Bewertungskriterien 1. Nutzenpotenzial 2. Schadenspotenzial 3. Selbstbestimmung 4. Gerechtigkeit 5. Effizienz 6. Legitimität Spezifizierung Nutzen für ältere Patienten / Bewohner: reduzierte Morbidität & Mortalität; (Nutzen für HCW) Belastung / Risiken für geimpfte HCW Möglichst wenig restriktive Strategien zur Erhöhung der Impfraten Kompensation bei Impfschäden für geimpfte HCW Kosten-Nutzen-Verhältnis der HCW-Impfung Fairer Entscheidungsprozess zu Einführung eines Impfprogramms für HCW Georg Marckmann
35 Spezifizierte Bewertungskriterien Bewertungskriterien 1. Nutzenpotenzial 2. Schadenspotenzial 3. Selbstbestimmung 4. Gerechtigkeit 5. Effizienz 6. Legitimität Spezifizierung Nutzen für ältere Patienten / Bewohner: reduzierte Morbidität & Mortalität; (Nutzen für HCW) Belastung / Risiken für geimpfte HCW Möglichst wenig restriktive Strategien zur Erhöhung der Impfraten Kompensation bei Impfschäden für geimpfte HCW Kosten-Nutzen-Verhältnis der HCW-Impfung Fairer Entscheidungsprozess zu Einführung eines Impfprogramms für HCW Georg Marckmann
36 Kosten-Nutzen-Verhältnis Nichol et al Geimpfte (im Vergleich zu nicht geimpften) HCW ð 25% weniger Infektionen der oberen Atemwege, 44% weniger Arztbesuche, 43% weniger Fehltage (0,5 pro Arbeitnehmer) Geschätzte Einsparungen: $46,85 pro geimpften Arbeitnehmer (Aber: nur eine Saison analysiert) Bridges et al Influenza Impfung für arbeitende Erwachsene ð ILI, Fehltage & Arztbesuche reduziert Kosten: zwischen $11,17 und $65,59 pro Person Ökonomische Evaluation von Burls et al Basisfall: Einsparungen von 12 / geimpftem HCW Ungünstige Annahmen: 405 /LYS Abhängig von der saisonalen Aktivität der Influenza
37 Spezifizierte Bewertungskriterien Bewertungskriterien 1. Nutzenpotenzial 2. Schadenspotenzial 3. Selbstbestimmung 4. Gerechtigkeit 5. Effizienz 6. Legitimität Spezifizierung Nutzen für ältere Patienten / Bewohner: reduzierte Morbidität & Mortalität; (Nutzen für HCW) Belastung / Risiken für geimpfte HCW Möglichst wenig restriktive Strategien zur Erhöhung der Impfraten Kompensation bei Impfschäden für geimpfte HCW Kosten-Nutzen-Verhältnis der HCW-Impfung Fairer Entscheidungsprozess zu Einführung eines Impfprogramms für HCW Georg Marckmann
38 Fairer Entscheidungsprozess Zu prüfen: Höhere Impfraten durch Beteiligung der MitarbeiterInnen am Design und der Implementierung des Impfprogramm in der Einrichtung? Umfrage von Wicker et al ,4% der HCW fanden verpflichtende Impfungen akzeptabel! (Ärzte 78,1%, Pflege 63,1%) Zustimmung abhängig von Erkrankung: 86% HBV, 43,5% Influenza-Impfung 24,8% lehnten verpflichtende Influenza-Impfung ab paternalistischer Schutz der Selbstbestimmung? Alternative: freiwillige Selbstverpflichtung? Georg Marckmann, LMU Graz,
39 Public Health Ethik: Praktische Methodologie Arbeitsschritte einer ethischen Bewertung von Public Health Maßnahmen 1 Beschreibung Möglichst genaue Charakterisierung der zu untersuchenden Public Health Maßnahme: Zielsetzung, Methodik, Zielpopulation, etc. 2 Spezifizierung Spezifizierung der Bewertungskriterien (Tabelle 1) für die vorliegende Public Health Maßnahme 3 Einzelbewertung Bewertung der Public Health Maßnahme anhand der einzelnen, in Schritt 2 spezifizierten Kriterien im Vergleich zu alternativen Optionen 4 Synthese Übergreifende Beurteilung der Public Health Maßnahme durch Synthese, Gewichtung und Abwägung der Einzelbewertungen aus Schritt 3 5 Empfehlungen Entwicklung von Empfehlungen für die Entwicklung und Implementierung der Public Health Maßnahme Georg Marckmann # 39
40 Spezifizierte Bewertungskriterien Bewertungskriterien 1. Nutzenpotenzial 2. Schadenspotenzial 3. Selbstbestimmung 4. Gerechtigkeit 5. Effizienz 6. Legitimität Spezifizierung Evidenz für Senkung der Gesamt-, nicht aber der spezifischen Mortalität => ausreichend?? Relativ geringe Belastung & Risiken für HCW Begrenzte Effektivität von Impfkampagnen => alles ausgereizt? Erforderliche Impfrate? Kompensation bei Impfschäden für geimpfte HCW Kosten-Nutzen-Verhältnis sehr günstig: Kostensparend oder sehr kosteneffektiv Einbeziehung der Mitarbeiter in Entscheidungsfindung zu prüfen! Georg Marckmann
41 Public Health Ethik: Praktische Methodologie Arbeitsschritte einer ethischen Bewertung von Public Health Maßnahmen 1 Beschreibung Möglichst genaue Charakterisierung der zu untersuchenden Public Health Maßnahme: Zielsetzung, Methodik, Zielpopulation, etc. 2 Spezifizierung Spezifizierung der Bewertungskriterien (Tabelle 1) für die vorliegende Public Health Maßnahme 3 Einzelbewertung Bewertung der Public Health Maßnahme anhand der einzelnen, in Schritt 2 spezifizierten Kriterien im Vergleich zu alternativen Optionen 4 Synthese Übergreifende Beurteilung der Public Health Maßnahme durch Synthese, Gewichtung und Abwägung der Einzelbewertungen aus Schritt 3 5 Empfehlungen Entwicklung von Empfehlungen für die Entwicklung und Implementierung der Public Health Maßnahme Georg Marckmann # 41
42 Empfehlungs-Stufen Stufe Empfehlung Von der Public Health-Maßnahme abraten, keine Kostenübernahme durch die GKV. Public Health-Maßnahme anbieten, keine explizite Empfehlung, eventuell Kostenübernahme durch die GKV. In diesem Fall obliegt es wesentlich der Entscheidung des Einzelnen, ob die Präventionsmaßnahme durchgeführt werden soll oder nicht. Public Health-Maßnahme anbieten und empfehlen, evtl. proaktive Maßnahmen (z.b. Informationskampagnen) zum Erreichung einer höheren Teilnahmerate, Kostenübernahme durch GKV Public Health-Maßnahme anbieten, empfehlen und mit (monetären & nicht-monetären) Anreizen (für Versicherte oder Ärzte) versehen, um eine höhere Teilnahmerate zu erreichen, selbstverständlich Kostenübernahme durch die GKV. Public Health-Maßnahme ist gesetzlich vorgeschrieben, Nichtbefolgung ggf. unter Strafe, Kostenübernahme durch GKV oder Steuerfinanzierung. Georg Marckmann # 42
43 Empfehlungs-Stufen Stufe Empfehlung Von der Public Health-Maßnahme abraten, keine Kostenübernahme durch die GKV. Public Health-Maßnahme anbieten, keine explizite Empfehlung, eventuell Kostenübernahme durch die GKV. In diesem Fall obliegt es wesentlich der Entscheidung des Einzelnen, ob die Präventionsmaßnahme durchgeführt werden soll oder nicht. Public Health-Maßnahme anbieten und empfehlen, evtl. proaktive Maßnahmen (z.b. Informationskampagnen) zum Erreichung einer höheren Teilnahmerate, Kostenübernahme durch GKV Public Health-Maßnahme anbieten, empfehlen und mit (monetären & nicht-monetären) Anreizen (für Versicherte oder Ärzte) versehen, um eine höhere Teilnahmerate zu erreichen, selbstverständlich Kostenübernahme durch die GKV. Public Health-Maßnahme ist gesetzlich vorgeschrieben, Nichtbefolgung ggf. unter Strafe, Kostenübernahme durch GKV oder Steuerfinanzierung. Georg Marckmann # 43
44 Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Weiterführende Literatur: Methodisches Vorgehen in der Medizinethik: Meine Antrittsvorlesung am Montag, , 17:00 Uhr Hörsaal Kinderklinik Bitte um Anmeldung an: (Sekretariat Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin) Folien: 44 Georg Marckmann
Impfen eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung: Ethische Aspekte
 Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Impfen eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung: Ethische Aspekte 3. Nationale Impfkonferenz München, 15. Mai 2013 Ein altes Problem. 1902 in den
Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Impfen eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung: Ethische Aspekte 3. Nationale Impfkonferenz München, 15. Mai 2013 Ein altes Problem. 1902 in den
Ethische Bewertung von Medizintechnik: Eine kohärentistisch begründete Methodologie
 Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Ethische Bewertung von Medizintechnik: Eine kohärentistisch begründete Methodologie Jahrestagung der Akademie für Ethik in der Medizin Technisierung
Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Ethische Bewertung von Medizintechnik: Eine kohärentistisch begründete Methodologie Jahrestagung der Akademie für Ethik in der Medizin Technisierung
Prinzipienorientierte Falldiskussion: Ein Modell zur inhaltlichen Strukturierung ethischer Fallbesprechungen
 Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Prinzipienorientierte Falldiskussion: Ein Modell zur inhaltlichen Strukturierung ethischer Fallbesprechungen Netzwerk der klinischen Ethikkomitees
Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Prinzipienorientierte Falldiskussion: Ein Modell zur inhaltlichen Strukturierung ethischer Fallbesprechungen Netzwerk der klinischen Ethikkomitees
Ethisch gut begründet entscheiden: Einführung in die kohärentistische Medizinethik
 Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Ethisch gut begründet entscheiden: Einführung in die kohärentistische Medizinethik Ethik in der Klinik Fachtag Medizinethik Evangelische
Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Ethisch gut begründet entscheiden: Einführung in die kohärentistische Medizinethik Ethik in der Klinik Fachtag Medizinethik Evangelische
Impfen Eine gesamtgesellschaftliche Verpflichtung? Ethische Aspekte
 Impfen Eine gesamtgesellschaftliche Verpflichtung? Ethische Aspekte Dr. Lukas Kaelin Institut für Ethik und Recht in der Medizin Universität Wien lukas.kaelin@univie.ac.at Zum Einstieg Ein historisches
Impfen Eine gesamtgesellschaftliche Verpflichtung? Ethische Aspekte Dr. Lukas Kaelin Institut für Ethik und Recht in der Medizin Universität Wien lukas.kaelin@univie.ac.at Zum Einstieg Ein historisches
Wie können wir in der Medizin ethisch gut begründete Entscheidungen treffen?
 Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Wie können wir in der Medizin ethisch gut begründete Entscheidungen treffen? Vortragszyklus Spektrum der Wissenschaften Ethik in der
Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Wie können wir in der Medizin ethisch gut begründete Entscheidungen treffen? Vortragszyklus Spektrum der Wissenschaften Ethik in der
Arzneimittelforschung mit Kindern: Ethische Herausforderungen
 Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Arzneimittelforschung mit Kindern: Ethische Herausforderungen Forum Bioethik des Deutschen Ethikrats Arzneimittelforschung mit Kindern:
Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Arzneimittelforschung mit Kindern: Ethische Herausforderungen Forum Bioethik des Deutschen Ethikrats Arzneimittelforschung mit Kindern:
Der Anspruch der Ethik und seine Bedeutung für die Medizin
 Der Anspruch der Ethik und seine Bedeutung für die Georg Marckmann Universität Tübingen Institut für Ethik und Geschichte der Tagung, Recht, Ethik zwischen Konflikt und Kooperation Evangelische Akademie
Der Anspruch der Ethik und seine Bedeutung für die Georg Marckmann Universität Tübingen Institut für Ethik und Geschichte der Tagung, Recht, Ethik zwischen Konflikt und Kooperation Evangelische Akademie
Ethische Fragen der Ressourcenallokation in der Prävention
 Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Ethische Fragen der Ressourcenallokation in der Prävention Arbeitstagung Philosophie der Prävention Tübingen, 21.12.12 Gliederung Rahmenbedingungen
Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Ethische Fragen der Ressourcenallokation in der Prävention Arbeitstagung Philosophie der Prävention Tübingen, 21.12.12 Gliederung Rahmenbedingungen
Grundlagen der ethischen Falldiskussion: Wie gelangen wir zu einer ethisch gut begründeten Entscheidung?
 Grundlagen der ethischen Falldiskussion: Wie gelangen wir zu einer ethisch gut begründeten Entscheidung? Georg Marckmann Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Ethik, Geschichte und Theorie
Grundlagen der ethischen Falldiskussion: Wie gelangen wir zu einer ethisch gut begründeten Entscheidung? Georg Marckmann Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Ethik, Geschichte und Theorie
Kosten-Nutzen Bewertung als Weg von der Rationierung zur Rationalisierung? Chance und Risiken für den Patienten
 Eberhard Karls Universität Tübingen Institut für Ethik und Geschichte Medizin Kosten-Nutzen Bewertung als Weg von Rationierung zur Rationalisierung? Chance und Risiken für den Patienten Dr. Dr. Daniel
Eberhard Karls Universität Tübingen Institut für Ethik und Geschichte Medizin Kosten-Nutzen Bewertung als Weg von Rationierung zur Rationalisierung? Chance und Risiken für den Patienten Dr. Dr. Daniel
Einführung in die (Medizin-)Ethik
 Wintersemester 2017/18 Vorlesung Ethik in der Medizin Einführung in die (Medizin-)Ethik Prof. Dr. Alfred Simon Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Fallbeispiel: Sterbefasten Ein 90-jähriger
Wintersemester 2017/18 Vorlesung Ethik in der Medizin Einführung in die (Medizin-)Ethik Prof. Dr. Alfred Simon Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Fallbeispiel: Sterbefasten Ein 90-jähriger
Szenarien einer zukünftigen Gesundheitsversorgung Faktoren der Bedarfsänderung und Folgen für das Angebot an Versorgungsleistungen: Ethische Sicht
 Szenarien einer zukünftigen Gesundheitsversorgung Faktoren der Bedarfsänderung und Folgen für das Angebot an Versorgungsleistungen: Ethische Sicht Georg Marckmann Universität Tübingen Institut für Ethik
Szenarien einer zukünftigen Gesundheitsversorgung Faktoren der Bedarfsänderung und Folgen für das Angebot an Versorgungsleistungen: Ethische Sicht Georg Marckmann Universität Tübingen Institut für Ethik
Umgang mit knappen Mitteln im Gesundheitswesen
 Wintersemester 2017/18 Vorlesung Ethik in der Medizin Umgang mit knappen Mitteln im Gesundheitswesen Prof. Dr. Alfred Simon Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Gliederung Ursachen der
Wintersemester 2017/18 Vorlesung Ethik in der Medizin Umgang mit knappen Mitteln im Gesundheitswesen Prof. Dr. Alfred Simon Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Gliederung Ursachen der
How does the Institute for quality and efficiency in health care work?
 Health Care for all Creating Effective and Dynamic Structures How does the Institute for quality and efficiency in health care work? Peter T. Sawicki; Institute for Quality and Efficiency in Health Care.
Health Care for all Creating Effective and Dynamic Structures How does the Institute for quality and efficiency in health care work? Peter T. Sawicki; Institute for Quality and Efficiency in Health Care.
Ethische Standards für die Physiotherapieforschung
 Ethische Standards für die Physiotherapieforschung Dr. rer. medic. Sandra Apelt, MSc. Phys. Dietmar Blohm, MSc. Phys. Philipps-Universität Marburg Fachbereich Medizin Studiengang Physiotherapie Ethik (k)ein
Ethische Standards für die Physiotherapieforschung Dr. rer. medic. Sandra Apelt, MSc. Phys. Dietmar Blohm, MSc. Phys. Philipps-Universität Marburg Fachbereich Medizin Studiengang Physiotherapie Ethik (k)ein
pandemische Grippe (H1N1) 2009 Verhaltensweisen des Spitalpersonals Eine grosse Querschnittsstudie
 Impfung gegen die saisonale Grippe und die pandemische Grippe (H1N1) 2009 Kenntnisse, Einstellungen und Verhaltensweisen des Spitalpersonals des Kantons Luzern Eine grosse Querschnittsstudie Michael Flück,
Impfung gegen die saisonale Grippe und die pandemische Grippe (H1N1) 2009 Kenntnisse, Einstellungen und Verhaltensweisen des Spitalpersonals des Kantons Luzern Eine grosse Querschnittsstudie Michael Flück,
Influenza Was bedeutet das für Arzt und Patient?
 Influenza Was bedeutet das für Arzt und Patient? Prof. Dr. Joachim Szecsenyi Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirates Pressekonferenz der AGI 2007 Ein Hausarzt im Wochenenddienst an einem kalten Februarsonntag...
Influenza Was bedeutet das für Arzt und Patient? Prof. Dr. Joachim Szecsenyi Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirates Pressekonferenz der AGI 2007 Ein Hausarzt im Wochenenddienst an einem kalten Februarsonntag...
VORLESUNG ALLGEMEINMEDIZIN. Auswahl Folien Impfungen
 VORLESUNG ALLGEMEINMEDIZIN Auswahl Folien Impfungen einige Argumente von Impfskeptikern Impfungen sind nicht notwendig epidemischer Verlauf von Infektionserkrankungen ist selbst begrenzend allein Verbesserung
VORLESUNG ALLGEMEINMEDIZIN Auswahl Folien Impfungen einige Argumente von Impfskeptikern Impfungen sind nicht notwendig epidemischer Verlauf von Infektionserkrankungen ist selbst begrenzend allein Verbesserung
Ethik in der Medizin: Normative Orientierung im Spannungsfeld zwischen philosophischer Grundlegung und medizinischer Praxis
 Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Ethik in der Medizin: Normative Orientierung im Spannungsfeld zwischen philosophischer Grundlegung und medizinischer Praxis Akademische Antrittsvorlesung
Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Ethik in der Medizin: Normative Orientierung im Spannungsfeld zwischen philosophischer Grundlegung und medizinischer Praxis Akademische Antrittsvorlesung
Allokationsethische Herausforderungen der individualisierten Medizin
 Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Allokationsethische Herausforderungen der individualisierten Medizin BioM-Forum Gesundheitsökonomie der individualisierten Medizin:
Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Allokationsethische Herausforderungen der individualisierten Medizin BioM-Forum Gesundheitsökonomie der individualisierten Medizin:
1. Bundesdeutscher Malteser Versorgungskongress Demenz 2014
 Workshop Ethik und Demenz 1 Ethik und Demenz 1. Bundesdeutscher Malteser Versorgungskongress Demenz 2014 Workshop Ethik und Demenz 2 Was ist Ethik? Werte Überzeugungen davon, was gut ist Norm Wertmaßstab
Workshop Ethik und Demenz 1 Ethik und Demenz 1. Bundesdeutscher Malteser Versorgungskongress Demenz 2014 Workshop Ethik und Demenz 2 Was ist Ethik? Werte Überzeugungen davon, was gut ist Norm Wertmaßstab
Nationale Impfkampagnen : Wie kommen sie zustande und wem dienen sie? Zu den Aufgaben der STIKO und zur Praxis ihrer Arbeit
 Nationale Impfkampagnen : Wie kommen sie zustande und wem dienen sie? Zu den Aufgaben der STIKO und zur Praxis ihrer Arbeit J. Leidel Erste Nationale Konferenz für differenziertes Impfen 01. -02. Oktober
Nationale Impfkampagnen : Wie kommen sie zustande und wem dienen sie? Zu den Aufgaben der STIKO und zur Praxis ihrer Arbeit J. Leidel Erste Nationale Konferenz für differenziertes Impfen 01. -02. Oktober
Ethik, Recht Entscheidungsfindung
 Ethik, Recht Entscheidungsfindung Dr. med. Birgitt van Oorschot Stellvertr. Sprecherin KEK Würzburg Oberärztin Interdisziplinäres Zentrum Palliativmedizin Uniklinik Würzburg Moral - Ethik - Recht Moral
Ethik, Recht Entscheidungsfindung Dr. med. Birgitt van Oorschot Stellvertr. Sprecherin KEK Würzburg Oberärztin Interdisziplinäres Zentrum Palliativmedizin Uniklinik Würzburg Moral - Ethik - Recht Moral
Die vier Prinzipien von Beauchamp und Childress (principlism)
 Medizinethik Sommersemester 2010 Thomas Schramme 6.4.2010 Allgemeine Einführung (1) Prinzipien der Medizinethik (2) Gliederung Der Begriff 'Medizinethik' kurze Geschichte der Medizinethik Medizinethik
Medizinethik Sommersemester 2010 Thomas Schramme 6.4.2010 Allgemeine Einführung (1) Prinzipien der Medizinethik (2) Gliederung Der Begriff 'Medizinethik' kurze Geschichte der Medizinethik Medizinethik
Die ökonomische Evaluation von Gesundheitsförderung und Prävention
 Die ökonomische Evaluation von Gesundheitsförderung und Prävention 17. Kongress Armut und Gesundheit Prävention wirkt! 9.3.2012 Tina Salomon, ZeS/SFB 597, Universität Bremen An ounce of prevention is worth
Die ökonomische Evaluation von Gesundheitsförderung und Prävention 17. Kongress Armut und Gesundheit Prävention wirkt! 9.3.2012 Tina Salomon, ZeS/SFB 597, Universität Bremen An ounce of prevention is worth
BMBF-Verbundprojekt Individualisierte Gesundheitsversorgung: Ethische, ökonomische und rechtliche Implikationen für das deutsche Gesundheitswesen
 Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin BMBF-Verbundprojekt Individualisierte Gesundheitsversorgung: Ethische, ökonomische und rechtliche Implikationen für das deutsche Gesundheitswesen
Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin BMBF-Verbundprojekt Individualisierte Gesundheitsversorgung: Ethische, ökonomische und rechtliche Implikationen für das deutsche Gesundheitswesen
Normative Evidenz. Ein Problemaufriss. Prof. Dr. Dr. Daniel Strech. EBM-Kongress 2009, Berlin
 Normative Evidenz. Ein Problemaufriss Prof. Dr. Dr. Daniel Strech Juniorprofessor für Medizinethik Schwerpunkt: Ethik in Gesundheitspolitik & Public Health Institut für Geschichte, Ethik & Philosophie
Normative Evidenz. Ein Problemaufriss Prof. Dr. Dr. Daniel Strech Juniorprofessor für Medizinethik Schwerpunkt: Ethik in Gesundheitspolitik & Public Health Institut für Geschichte, Ethik & Philosophie
Digitalisierte Medizin - Wie ist die Evidenz und die Akzeptanz bei den Nutzern?
 Digitalisierte Medizin - Wie ist die Evidenz und die Akzeptanz bei den Nutzern? Dr. Christoph Dockweiler, M.Sc. PH Universität Bielefeld School of Public Health Gesundheitswesen goes Digital, 29. März
Digitalisierte Medizin - Wie ist die Evidenz und die Akzeptanz bei den Nutzern? Dr. Christoph Dockweiler, M.Sc. PH Universität Bielefeld School of Public Health Gesundheitswesen goes Digital, 29. März
Werturteile in der Nutzenbewertung der personalisierten Onkologie
 Wien 20.Oktober 2013 Personalisierte Onkologie und Nutzenbewertung Werturteile in der Nutzenbewertung der personalisierten Onkologie Eva Winkler Programm Ethik und Patientenorientierung in der Onkologie
Wien 20.Oktober 2013 Personalisierte Onkologie und Nutzenbewertung Werturteile in der Nutzenbewertung der personalisierten Onkologie Eva Winkler Programm Ethik und Patientenorientierung in der Onkologie
Bewertungskriterien und methoden nach dem SGB V. Kommentar aus der Sicht der forschenden Arzneimittelindustrie
 Bewertungskriterien und methoden nach dem SGB V Kommentar aus der Sicht der forschenden Arzneimittelindustrie Die Rechtsverfassung der Bewertung von Leistungen durch den G-BA und das IQWiG, Tagung am 26.
Bewertungskriterien und methoden nach dem SGB V Kommentar aus der Sicht der forschenden Arzneimittelindustrie Die Rechtsverfassung der Bewertung von Leistungen durch den G-BA und das IQWiG, Tagung am 26.
Wohltun / Schaden vermeiden
 Wohltun / Schaden vermeiden - Kompetenz Ethik Kooperation Caritas-Akademie Hohenlindund Abt. Seelsorge im Sozial- und Gesundheitswesen im Erzbistum Köln Regina Bannert Ulrich Fink Diözesanbeauftragte für
Wohltun / Schaden vermeiden - Kompetenz Ethik Kooperation Caritas-Akademie Hohenlindund Abt. Seelsorge im Sozial- und Gesundheitswesen im Erzbistum Köln Regina Bannert Ulrich Fink Diözesanbeauftragte für
Vaccines: A success story with failures. Aims of vaccination
 Vaccines: A success story with failures Ursula Wiedermann Institute of Specific Prophylaxis and Tropical Medicine, Medical University Vienna www.meduniwien.ac.at/tropenmedizin Aims of vaccination Individual
Vaccines: A success story with failures Ursula Wiedermann Institute of Specific Prophylaxis and Tropical Medicine, Medical University Vienna www.meduniwien.ac.at/tropenmedizin Aims of vaccination Individual
From Evidence to Policy
 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit From Evidence to Policy Munich, November 2010 Prof. Manfred Wildner, MPH LGL Dept. Health + PSPH, LMU Munich Life Expectancy PH > 50%! Bayerisches
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit From Evidence to Policy Munich, November 2010 Prof. Manfred Wildner, MPH LGL Dept. Health + PSPH, LMU Munich Life Expectancy PH > 50%! Bayerisches
Auf Leben und Tod Schwierige ethische Fragen im Krankenhaus und Wege zu guten Entscheidungen
 Auf Leben und Tod Schwierige ethische Fragen im Krankenhaus und Wege zu guten Entscheidungen Georg Marckmann Ludwig-Maximilians Universität München Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin
Auf Leben und Tod Schwierige ethische Fragen im Krankenhaus und Wege zu guten Entscheidungen Georg Marckmann Ludwig-Maximilians Universität München Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin
Regulierung von Interessenkonflikten bei der AWMF
 Medizinische Leitlinien Qualität und Unabhängigkeit sichern! Berlin, 01. Juli 2017 Regulierung von Interessenkonflikten bei der AWMF Ina Kopp AWMF-Institut für Medizinisches Wissensmanagement Erklärung
Medizinische Leitlinien Qualität und Unabhängigkeit sichern! Berlin, 01. Juli 2017 Regulierung von Interessenkonflikten bei der AWMF Ina Kopp AWMF-Institut für Medizinisches Wissensmanagement Erklärung
Gesundheitsökonomische Evaluationen neuer Impfungen in DEU - Chancen und Herausforderungen aus Sicht der Industrie
 Gesundheitsökonomische Evaluationen neuer Impfungen in DEU - Chancen und Herausforderungen aus Sicht der Industrie Dr. Markus Frick vfa-geschäftsführer Markt und Erstattung RKI-Symposium, 21. Januar 2015,
Gesundheitsökonomische Evaluationen neuer Impfungen in DEU - Chancen und Herausforderungen aus Sicht der Industrie Dr. Markus Frick vfa-geschäftsführer Markt und Erstattung RKI-Symposium, 21. Januar 2015,
Ethikgremien im Sanitätsdienst der Bundeswehr ist die Einrichtung einer zentralen Ethikkommission sinnvoll? - aus zivilfachlicher Sicht
 Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Ethikgremien im Sanitätsdienst der Bundeswehr ist die Einrichtung einer zentralen Ethikkommission sinnvoll? - aus zivilfachlicher Sicht 1. Ausschuss-Sitzung
Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Ethikgremien im Sanitätsdienst der Bundeswehr ist die Einrichtung einer zentralen Ethikkommission sinnvoll? - aus zivilfachlicher Sicht 1. Ausschuss-Sitzung
Ethik in der Anwendung: Die ethische Fallbesprechung
 Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Ethik in der Anwendung: Die ethische Fallbesprechung Ethik in der Klinik Fachtag Medizinethik Evangelische Akademie Tutzing München,
Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Ethik in der Anwendung: Die ethische Fallbesprechung Ethik in der Klinik Fachtag Medizinethik Evangelische Akademie Tutzing München,
Ethik und Medizinprodukte
 Dritte Ebene Ethik und Medizinprodukte Dipl.Sozialpäd. in (FH) Dr. in Iris Kohlfürst Iris.kohlfuerst@fh-linz.at Definition von Ethik.. die philosophische Reflexion über das, was aus moralischen Gründen
Dritte Ebene Ethik und Medizinprodukte Dipl.Sozialpäd. in (FH) Dr. in Iris Kohlfürst Iris.kohlfuerst@fh-linz.at Definition von Ethik.. die philosophische Reflexion über das, was aus moralischen Gründen
Wissenschaft und Forschung
 Wissenschaft und Forschung Zertifikatsmodul für Berufstätige aus Gesundheitsfachberufen Teil II 2. Ethik in der Medizin und den Gesundheitsfachberufen 12.08.2014 Dr. Angelica Ensel Ethik heute Pluralität
Wissenschaft und Forschung Zertifikatsmodul für Berufstätige aus Gesundheitsfachberufen Teil II 2. Ethik in der Medizin und den Gesundheitsfachberufen 12.08.2014 Dr. Angelica Ensel Ethik heute Pluralität
deso: Mammographie Screening 2015 Mammographie Screening: PRO
 Mammographie Screening: PRO Prof. Dr. Beat Thürlimann 2 Mammography Screening: yes or no?...ist eine Scheindebatte Sollen wir screenen oder nicht? Diese Frage ist längst beantwortet! Realität ist dass
Mammographie Screening: PRO Prof. Dr. Beat Thürlimann 2 Mammography Screening: yes or no?...ist eine Scheindebatte Sollen wir screenen oder nicht? Diese Frage ist längst beantwortet! Realität ist dass
Einführung in die Ethik und prinzipienorientierte Medizinethik
 Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Einführung in die Ethik und prinzipienorientierte Medizinethik Seminar Grundprinzipien der Bioethik für den Allgemeinmediziner Bozen,
Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Einführung in die Ethik und prinzipienorientierte Medizinethik Seminar Grundprinzipien der Bioethik für den Allgemeinmediziner Bozen,
Individuum, Psychiatrie, Gesellschaft: Die fürsorgerische Unterbringung (FU) aus drei Perspektiven
 Individuum, Psychiatrie, Gesellschaft: Die fürsorgerische Unterbringung (FU) aus drei Perspektiven Paul Hoff Symposium der Regionalen Psychiatriekommission Zürich 16. September 2015 Agenda Das betroffene
Individuum, Psychiatrie, Gesellschaft: Die fürsorgerische Unterbringung (FU) aus drei Perspektiven Paul Hoff Symposium der Regionalen Psychiatriekommission Zürich 16. September 2015 Agenda Das betroffene
Ethische Orientierungspunkte Oder: Wie gelangt man zu einer ethisch gut begründeten Entscheidung?
 Ethische Orientierungspunkte Oder: Wie gelangt man zu einer ethisch gut begründeten Entscheidung? Georg Marckmann Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin
Ethische Orientierungspunkte Oder: Wie gelangt man zu einer ethisch gut begründeten Entscheidung? Georg Marckmann Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin
Zertifikate: Nutzen für wen?
 Zertifikate: Nutzen für wen? Zertifikate = Bessere Qualität? Hans Ulrich Rothen, Vorsitzender Qualitätskommission Inselspital Zertifizierungen Überprüfung von Prozessen (Arbeitsabläufen) und deren Ergebnisse
Zertifikate: Nutzen für wen? Zertifikate = Bessere Qualität? Hans Ulrich Rothen, Vorsitzender Qualitätskommission Inselspital Zertifizierungen Überprüfung von Prozessen (Arbeitsabläufen) und deren Ergebnisse
VORLESUNG ALLGEMEINMEDIZIN. Auswahl Folien Komplementärmedizin
 VORLESUNG ALLGEMEINMEDIZIN Auswahl Folien Komplementärmedizin Schulmedizin? umgangssprachliche Bezeichnung der Medizin, die an Universitäten gelehrt wird suggeriert feste, unflexible Denkstrukturen und
VORLESUNG ALLGEMEINMEDIZIN Auswahl Folien Komplementärmedizin Schulmedizin? umgangssprachliche Bezeichnung der Medizin, die an Universitäten gelehrt wird suggeriert feste, unflexible Denkstrukturen und
Wege zur guten ethischen Entscheidung im Krankenhaus
 Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Wege zur guten ethischen Entscheidung im Krankenhaus Fortbildungsveranstaltung im Klinikum Karlsruhe Karlsruhe, 30. Januar 2014 Gliederung
Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Wege zur guten ethischen Entscheidung im Krankenhaus Fortbildungsveranstaltung im Klinikum Karlsruhe Karlsruhe, 30. Januar 2014 Gliederung
Die Prinzipienethik neu denken
 Die Prinzipienethik neu denken SGBE 20 April 2012 Rouven Porz, Leiter Ethikstelle, Inselspital Projektleitung Ethik in der Geriatrie, Medizinische Fakultät, Universität Bern Andreas Stuck, Chefarzt Geriatrie
Die Prinzipienethik neu denken SGBE 20 April 2012 Rouven Porz, Leiter Ethikstelle, Inselspital Projektleitung Ethik in der Geriatrie, Medizinische Fakultät, Universität Bern Andreas Stuck, Chefarzt Geriatrie
Ethische Aspekte der Transplantationsmedizin. Prof. Dr. Ludwig Siep Philosophisches Seminar
 Ethische Aspekte der Transplantationsmedizin Prof. Dr. Ludwig Siep Philosophisches Seminar Übersicht: 1. Was ist Ethik? 2. Kriterien medizinischer Ethik 3. Probleme der Organentnahme von toten Spendern
Ethische Aspekte der Transplantationsmedizin Prof. Dr. Ludwig Siep Philosophisches Seminar Übersicht: 1. Was ist Ethik? 2. Kriterien medizinischer Ethik 3. Probleme der Organentnahme von toten Spendern
Chancen und Risiken der digitalen Gesundheitsversorgung: Diagnose vor Therapie und Abwägung vor Versand
 Chancen und Risiken der digitalen Gesundheitsversorgung: Diagnose vor Therapie und Abwägung vor Versand Prof. Dr. Franz Porzsolt Versorgungsforschung an der Klinik für Allgemein-und Viszeralchirurgie,
Chancen und Risiken der digitalen Gesundheitsversorgung: Diagnose vor Therapie und Abwägung vor Versand Prof. Dr. Franz Porzsolt Versorgungsforschung an der Klinik für Allgemein-und Viszeralchirurgie,
Prof. Dr. Dr. Martin HärterH
 Effekte von Shared Decision-Making Forschungsstand zur Adherence Prof. Dr. Dr. Martin HärterH Fachtagung Adherence Berlin 11.12.2009 Definition Adherence ist definiert als das Ausmaß, in welchem das Verhalten
Effekte von Shared Decision-Making Forschungsstand zur Adherence Prof. Dr. Dr. Martin HärterH Fachtagung Adherence Berlin 11.12.2009 Definition Adherence ist definiert als das Ausmaß, in welchem das Verhalten
Krankenhaus-Hygiene Über das Richtige berichten - Anforderungen an die Datenerfassung und das Reporting
 Krankenhaus-Hygiene Über das Richtige berichten - Anforderungen an die Datenerfassung und das Reporting Ingo Pfenning Stationäre Versorgung Techniker Krankenkasse Vortrag am 15.Mai 2012 in Berlin Hygienesymposium
Krankenhaus-Hygiene Über das Richtige berichten - Anforderungen an die Datenerfassung und das Reporting Ingo Pfenning Stationäre Versorgung Techniker Krankenkasse Vortrag am 15.Mai 2012 in Berlin Hygienesymposium
Implementierung innovativer Interventionen in Pflegeheimen
 Implementierung innovativer Interventionen in Pflegeheimen PROF. DR. GABRIELE MEYER MEDIZINISCHE FAKULTÄT INSTITUT FÜR GESUNDHEITS- UND PFLEGEWISSENSCHAFT Praxisvariation Hinweis auf Routinen, die fachlich
Implementierung innovativer Interventionen in Pflegeheimen PROF. DR. GABRIELE MEYER MEDIZINISCHE FAKULTÄT INSTITUT FÜR GESUNDHEITS- UND PFLEGEWISSENSCHAFT Praxisvariation Hinweis auf Routinen, die fachlich
Citizen Science in der Biomedizin. Empirische, gesellschaftliche und ethische Aspekte
 Citizen Science in der Biomedizin. Empirische, gesellschaftliche und ethische Aspekte BMBF-gefördertes Projekt Citizen Science in der biomedizinischen Praxis und Forschung: Lorenzo Del Savio (CAU), Barbara
Citizen Science in der Biomedizin. Empirische, gesellschaftliche und ethische Aspekte BMBF-gefördertes Projekt Citizen Science in der biomedizinischen Praxis und Forschung: Lorenzo Del Savio (CAU), Barbara
Qualitätssicherung und Evaluation von Ethikberatung
 Qualitätssicherung und Evaluation von Ethikberatung PD Dr. Alfred Simon Akademie für Ethik in der Medizin e.v. Ethikberatung als Qualitätskriterium Empfehlungen zur Implementierung von Ethikberatung: KKVD,
Qualitätssicherung und Evaluation von Ethikberatung PD Dr. Alfred Simon Akademie für Ethik in der Medizin e.v. Ethikberatung als Qualitätskriterium Empfehlungen zur Implementierung von Ethikberatung: KKVD,
Priorisierung und Rationierung am Krankenbett. Ergebnisse empirischer Studien
 Priorisierung und Rationierung am Krankenbett. Ergebnisse empirischer Studien Prof. Dr. med. Dr. phil. Daniel Strech Juniorprofessor für Medizinethik Institut für Geschichte, Ethik & Philosophie der Medizin
Priorisierung und Rationierung am Krankenbett. Ergebnisse empirischer Studien Prof. Dr. med. Dr. phil. Daniel Strech Juniorprofessor für Medizinethik Institut für Geschichte, Ethik & Philosophie der Medizin
Ethische Bewertung einer impliziten und expliziten Ressourcenallokation
 Ethische Bewertung einer impliziten und expliziten Ressourcenallokation Dr. med. Irene Hirschberg Institut für Geschichte, Ethik & Philosophie der Medizin EBM-Kongress 2009, Berlin Ausgangsfragen einer
Ethische Bewertung einer impliziten und expliziten Ressourcenallokation Dr. med. Irene Hirschberg Institut für Geschichte, Ethik & Philosophie der Medizin EBM-Kongress 2009, Berlin Ausgangsfragen einer
Evaluation und Optimierung der Biobank Governance
 Evaluation und Optimierung der Biobank Governance Prof. Dr. Daniel Strech 5. Nationales Biobanken-Symposium 2016 TMF/GBN, Berlin, 8.12.2016 Agenda 1. Was meint/umfasst Biobank-Governance? In Abgrenzung
Evaluation und Optimierung der Biobank Governance Prof. Dr. Daniel Strech 5. Nationales Biobanken-Symposium 2016 TMF/GBN, Berlin, 8.12.2016 Agenda 1. Was meint/umfasst Biobank-Governance? In Abgrenzung
Ethische Konflikte in der Praxis: Grundlagen der Entscheidungsfindung
 Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Ethische Konflikte in der Praxis: Grundlagen der Entscheidungsfindung Ethische Konflikte in der Praxis wie können wir eine gute begründete
Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Ethische Konflikte in der Praxis: Grundlagen der Entscheidungsfindung Ethische Konflikte in der Praxis wie können wir eine gute begründete
Arbeitsgruppe Ethik des Klinikums Kempten-Oberallgäu
 Ethik in der Klinik III Arbeitsgruppe Ethik des Klinikums Kempten-Oberallgäu 20.06.2007: PD Dr. Rupert Scheule, Dr. Gerd Kellner Worum geht es heute? Prinzipienorientierte Medizinethik der derzeit einflussreichste
Ethik in der Klinik III Arbeitsgruppe Ethik des Klinikums Kempten-Oberallgäu 20.06.2007: PD Dr. Rupert Scheule, Dr. Gerd Kellner Worum geht es heute? Prinzipienorientierte Medizinethik der derzeit einflussreichste
Ethik- Grenzen und Möglichkeiten der Autonomie
 Ethik- Grenzen und Möglichkeiten der Autonomie Neonatologische und pädiatrische Intensivpflege Carola Fromm M.A. Angewandte Ethik im Sozial- und Gesundheitswesen Ein Überblick Autonomie in der Pädiatrie
Ethik- Grenzen und Möglichkeiten der Autonomie Neonatologische und pädiatrische Intensivpflege Carola Fromm M.A. Angewandte Ethik im Sozial- und Gesundheitswesen Ein Überblick Autonomie in der Pädiatrie
Gesundheitsförderung im frühen Kindesalter im Spannungsfeld zwischen Freiwilligkeit und Eingreifen
 Gesundheitsförderung im frühen Kindesalter im Spannungsfeld zwischen Freiwilligkeit und Eingreifen Prof. Felix Wettstein lic. phil. Susanne Anliker FH Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit 5.
Gesundheitsförderung im frühen Kindesalter im Spannungsfeld zwischen Freiwilligkeit und Eingreifen Prof. Felix Wettstein lic. phil. Susanne Anliker FH Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit 5.
Auf dem Weg zu einem evidenzbasierten. auch in der Onkologie
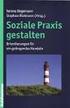 Auf dem Weg zu einem evidenzbasierten Gesundheitssystem auch in der Onkologie Reinhard Busse, Prof. Dr. med. MPH FFPH FG Management im Gesundheitswesen, Technische Universität Berlin (WHO Collaborating
Auf dem Weg zu einem evidenzbasierten Gesundheitssystem auch in der Onkologie Reinhard Busse, Prof. Dr. med. MPH FFPH FG Management im Gesundheitswesen, Technische Universität Berlin (WHO Collaborating
Strategien für eine ausreichende Ernährung beim alten Patienten
 Strategien für eine ausreichende Ernährung beim alten Patienten Rainer Wirth Klinik für Geriatrie, St. Marien-Hospital Borken Arbeitsgruppe Ernährung der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie Lehrstuhl
Strategien für eine ausreichende Ernährung beim alten Patienten Rainer Wirth Klinik für Geriatrie, St. Marien-Hospital Borken Arbeitsgruppe Ernährung der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie Lehrstuhl
Interventionsstudien
 Interventionsstudien Univ.-Prof. DI Dr. Andrea Berghold Institut für Med. Informatik, Statistik und Dokumentation Medizinische Universität Graz Vorgangsweise der EBM 1. Formulierung der relevanten und
Interventionsstudien Univ.-Prof. DI Dr. Andrea Berghold Institut für Med. Informatik, Statistik und Dokumentation Medizinische Universität Graz Vorgangsweise der EBM 1. Formulierung der relevanten und
Künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr: Ethische Grundlagen der Entscheidungsfindung
 Künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr: Ethische Grundlagen der Entscheidungsfindung Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Ludwig-Maximilians-Universität München Vizepräsident
Künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr: Ethische Grundlagen der Entscheidungsfindung Georg Marckmann Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Ludwig-Maximilians-Universität München Vizepräsident
EbM in Qualitätsmanagement und operativer Medizin
 1/7 EbM in Qualitätsmanagement und operativer Medizin 8. Jahrestagung Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.v. Vom 22. bis 24. März 2007 in Berlin Projekte in der Versorgungsforschung Ärztliches
1/7 EbM in Qualitätsmanagement und operativer Medizin 8. Jahrestagung Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.v. Vom 22. bis 24. März 2007 in Berlin Projekte in der Versorgungsforschung Ärztliches
Erfahrungen mit wissenschaftlichen. Leitlinien aus Sicht der. Bundesanstalt für Arbeitsschutz. und Arbeitsmedizin
 Erfahrungen mit wissenschaftlichen Leitlinien aus Sicht der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Ulrike Euler S 3 Leitlinie Arbeitsmedizinische Vorsorge der chronischen Berylliose Ziel dieses
Erfahrungen mit wissenschaftlichen Leitlinien aus Sicht der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Ulrike Euler S 3 Leitlinie Arbeitsmedizinische Vorsorge der chronischen Berylliose Ziel dieses
Bevölkerungswachstum und Armutsminderung in. Entwicklungsländern. Das Fallbeispiel Philippinen
 Bevölkerungswachstum und Armutsminderung in Entwicklungsländern. Das Fallbeispiel Philippinen DISSERTATION am Fachbereich Politische Wissenschaft der Freien Universität Berlin Verfasser: Christian H. Jahn
Bevölkerungswachstum und Armutsminderung in Entwicklungsländern. Das Fallbeispiel Philippinen DISSERTATION am Fachbereich Politische Wissenschaft der Freien Universität Berlin Verfasser: Christian H. Jahn
Workshop zur Ethik der Kosten-Nutzen- Bewertung medizinischer Maßnahmen
 Workshop zur Ethik der Kosten-Nutzen- Bewertung medizinischer Maßnahmen Chancen und Risiken einer indikationsübergreifenden Kosten-Nutzen- Bewertung Prof. Dr. Jürgen Wasem Alfried Krupp von Bohlen und
Workshop zur Ethik der Kosten-Nutzen- Bewertung medizinischer Maßnahmen Chancen und Risiken einer indikationsübergreifenden Kosten-Nutzen- Bewertung Prof. Dr. Jürgen Wasem Alfried Krupp von Bohlen und
Knospe-ABA GmbH. Die Bedeutung des Eltern-Trainings in ABA
 .. Die Bedeutung des Eltern-Trainings in ABA Es wurden einige Studien durchgeführt, um den Stellenwert des Eltern-Trainings in den Prinzipien und Handlungsempfehlungen von ABA näher zu betrachten. Alle
.. Die Bedeutung des Eltern-Trainings in ABA Es wurden einige Studien durchgeführt, um den Stellenwert des Eltern-Trainings in den Prinzipien und Handlungsempfehlungen von ABA näher zu betrachten. Alle
Workshop der Deutschen Krankenhausgesellschaft 16. Juli 2015 Johann Fontaine Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg
 Europäische Referenznetzwerke in Deutschland Workshop der Deutschen Krankenhausgesellschaft 16. Juli 2015 Johann Fontaine Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg ERN vor 15 Jahren Dezember
Europäische Referenznetzwerke in Deutschland Workshop der Deutschen Krankenhausgesellschaft 16. Juli 2015 Johann Fontaine Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg ERN vor 15 Jahren Dezember
Kurzdefinition. Ethik ist die philosophische Theorie vom richtigen Leben und Handeln:
 Ethik Kurzdefinition Ethik ist die philosophische Theorie vom richtigen Leben und Handeln: Die Erfassung und Begründung von richtigen Verhaltens- und Handlungsweisen, Normen und Zielen oder guten Eigenschaften
Ethik Kurzdefinition Ethik ist die philosophische Theorie vom richtigen Leben und Handeln: Die Erfassung und Begründung von richtigen Verhaltens- und Handlungsweisen, Normen und Zielen oder guten Eigenschaften
POST MARKET CLINICAL FOLLOW UP
 POST MARKET CLINICAL FOLLOW UP (MEDDEV 2.12-2 May 2004) Dr. med. Christian Schübel 2007/47/EG Änderungen Klin. Bewertung Historie: CETF Report (2000) Qualität der klinischen Daten zu schlecht Zu wenige
POST MARKET CLINICAL FOLLOW UP (MEDDEV 2.12-2 May 2004) Dr. med. Christian Schübel 2007/47/EG Änderungen Klin. Bewertung Historie: CETF Report (2000) Qualität der klinischen Daten zu schlecht Zu wenige
III. Der Gemeinsame Bundesausschuss als Promotor für fortschrittliche Methoden
 Der Gemeinsame Nadelöhr oder Motor für Innovationen? Beitrag zur Sitzung Der Weg für Innovationen in die GKV-Versorgung beim Kongress Evaluation 2006 am 08.03.2006 von Dr. Dominik Roters, Justiziar des
Der Gemeinsame Nadelöhr oder Motor für Innovationen? Beitrag zur Sitzung Der Weg für Innovationen in die GKV-Versorgung beim Kongress Evaluation 2006 am 08.03.2006 von Dr. Dominik Roters, Justiziar des
Versorgungsforschung und gesundheitliche Ungleichheit
 Versorgungsforschung und gesundheitliche Ungleichheit Olaf v.d. Knesebeck, Jens Klein Institut für Medizinische Soziologie Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf 1. Sozialepidemiologie und Versorgungsforschung
Versorgungsforschung und gesundheitliche Ungleichheit Olaf v.d. Knesebeck, Jens Klein Institut für Medizinische Soziologie Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf 1. Sozialepidemiologie und Versorgungsforschung
Impulsreferat: Nutzenbewertung in der Onkologie
 Lilly Jahressymposium 2009 zur Versorgung von Krebspatienten Onkologie, quo vadis Krebsbekämpfung durch Gesetze? Berlin, 6./7. Februar 2009 Impulsreferat: Nutzenbewertung in der Onkologie Prof. Dr. Franz
Lilly Jahressymposium 2009 zur Versorgung von Krebspatienten Onkologie, quo vadis Krebsbekämpfung durch Gesetze? Berlin, 6./7. Februar 2009 Impulsreferat: Nutzenbewertung in der Onkologie Prof. Dr. Franz
Evidenzbasierte Physiotherapie aktueller Stand und Perspektiven
 In Zeiten der evidenzbasierten Medizin muss eine Versorgung, die auf empirischer Grundlage steht, kritisch hinterfragt werden NVL - (A = starke Empfehlung, B = Empfehlung, 0 = Option) Akuter nichtspezifischer
In Zeiten der evidenzbasierten Medizin muss eine Versorgung, die auf empirischer Grundlage steht, kritisch hinterfragt werden NVL - (A = starke Empfehlung, B = Empfehlung, 0 = Option) Akuter nichtspezifischer
Und wo bleibt da die Ethik?
 Und wo bleibt da die Ethik? Dipl.-Psych. M. Schröer Psycholog. Psychotherapeutin Psychoonkologin, Medizinethikerin 9.4.2014 1. Düsseldorfer multidisziplinäres Palliativkolloquium Entscheidungen am Lebensende
Und wo bleibt da die Ethik? Dipl.-Psych. M. Schröer Psycholog. Psychotherapeutin Psychoonkologin, Medizinethikerin 9.4.2014 1. Düsseldorfer multidisziplinäres Palliativkolloquium Entscheidungen am Lebensende
Ökonomie und Gerechtigkeit. Ernst Basler + Partner, , Mühlebachstrasse 11, 8032 Zürich
 Ökonomie und Gerechtigkeit Ernst Basler + Partner, 10.05.2011, Mühlebachstrasse 11, 8032 Zürich Ökonomie Bezeichnet die Gesamtheit der Institutionen und Handlungen zum Zweck der Produktion und Verteilung
Ökonomie und Gerechtigkeit Ernst Basler + Partner, 10.05.2011, Mühlebachstrasse 11, 8032 Zürich Ökonomie Bezeichnet die Gesamtheit der Institutionen und Handlungen zum Zweck der Produktion und Verteilung
Wie hättest Du entschieden?
 Wie hättest Du entschieden? Medizinethik in Theorie und Praxis eine Einführung mit Fallbesprechung Robert Bozsak Überblick gemeinsamer Einstieg brainstorming Theoretische Hintergründe zur Medizinethik
Wie hättest Du entschieden? Medizinethik in Theorie und Praxis eine Einführung mit Fallbesprechung Robert Bozsak Überblick gemeinsamer Einstieg brainstorming Theoretische Hintergründe zur Medizinethik
Prävention als Prävention
 Prävention als Prävention Ziele, Strategien und Handlungsrahmen Astrid Leicht Fixpunkt e. V. Berlin www.fixpunkt.org UNAIDS Oktober 2014 Im Jahr 2020 wissen 90% von ihrer HIV-Infektion sind 90% der HIV-Infizierten
Prävention als Prävention Ziele, Strategien und Handlungsrahmen Astrid Leicht Fixpunkt e. V. Berlin www.fixpunkt.org UNAIDS Oktober 2014 Im Jahr 2020 wissen 90% von ihrer HIV-Infektion sind 90% der HIV-Infizierten
Die Arbeit des KEK im Katharinenhospital
 Die Arbeit des KEK im Katharinenhospital Iris Schmid Beate Vacano Klinische Sozialarbeit im Katharinenhospital Treff Sozialarbeit 21. Juni 2007 1 Gründung Satzung Sozialarbeit: Probleme und Chancen Ethische
Die Arbeit des KEK im Katharinenhospital Iris Schmid Beate Vacano Klinische Sozialarbeit im Katharinenhospital Treff Sozialarbeit 21. Juni 2007 1 Gründung Satzung Sozialarbeit: Probleme und Chancen Ethische
Angemessenheit als ethisches Grundprinzip der Gesundheitsversorgung
 , Vizepräsident Landesethikkomitee Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Angemessenheit als ethisches Grundprinzip der Gesundheitsversorgung Tagung Angemessenheit in der Gesundheitsversorgung:
, Vizepräsident Landesethikkomitee Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Angemessenheit als ethisches Grundprinzip der Gesundheitsversorgung Tagung Angemessenheit in der Gesundheitsversorgung:
Soziale Arbeit am Limit - Über konzeptionelle Begrenzungen einer Profession
 Soziale Arbeit am Limit - Über konzeptionelle Begrenzungen einer Profession Prof. Dr. phil. habil. Carmen Kaminsky FH Köln 1. Berufskongress des DBSH, 14.11.2008 Soziale Arbeit am Limit? an Grenzen stossen
Soziale Arbeit am Limit - Über konzeptionelle Begrenzungen einer Profession Prof. Dr. phil. habil. Carmen Kaminsky FH Köln 1. Berufskongress des DBSH, 14.11.2008 Soziale Arbeit am Limit? an Grenzen stossen
Isolated patellofemoral osteoarthritis A systematic review of treatment options using the GRADE approach
 Isolated patellofemoral osteoarthritis A systematic review of treatment options using the GRADE approach Interpretiert von: Sophie Narath, Birgit Reihs Inhalt Hintergrund & Thema Material & Methods Results
Isolated patellofemoral osteoarthritis A systematic review of treatment options using the GRADE approach Interpretiert von: Sophie Narath, Birgit Reihs Inhalt Hintergrund & Thema Material & Methods Results
Klinische Forschung. Klinische Forschung. Effectiveness Gap. Versorgungsforschung und evidenzbasierte Medizin. Conclusion
 Versorgungsforschung und evidenzbasierte Medizin Klinische Forschung 00qm\univkli\klifo2a.cdr DFG Denkschrift 1999 Aktuelles Konzept 2006 Workshop der PaulMartiniStiftung Methoden der Versorgungsforschung
Versorgungsforschung und evidenzbasierte Medizin Klinische Forschung 00qm\univkli\klifo2a.cdr DFG Denkschrift 1999 Aktuelles Konzept 2006 Workshop der PaulMartiniStiftung Methoden der Versorgungsforschung
Evidencebasierung als Bezugsrahmen für die Pflegeforschung. Prof. Dr. Johann Behrens
 Evidencebasierung als Bezugsrahmen für die Pflegeforschung Prof. Dr. Johann Behrens johann.behrens@medizin.uni-halle.de 1. "Evidencebasierung" ist eine nicht nur für chronische Erkrankungen angemessene,
Evidencebasierung als Bezugsrahmen für die Pflegeforschung Prof. Dr. Johann Behrens johann.behrens@medizin.uni-halle.de 1. "Evidencebasierung" ist eine nicht nur für chronische Erkrankungen angemessene,
Gesundheitsökonomie vs. Sozialmedizin Perspektive Gesundheitsökonomie
 Universität Bielefeld Fakultät für Gesundheitswissenschaften Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement Gesundheitsökonomie vs. Sozialmedizin Perspektive Gesundheitsökonomie Vortrag am 12.09.2012 DGSMP-Jahrestagung
Universität Bielefeld Fakultät für Gesundheitswissenschaften Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement Gesundheitsökonomie vs. Sozialmedizin Perspektive Gesundheitsökonomie Vortrag am 12.09.2012 DGSMP-Jahrestagung
U N D E R S T A N D I N G P E N S I O N A N D E M P L O Y E E B E N E F I T S I N T R A N S A C T I O N S
 H E A L T H W E A L T H C A R E E R U N D E R S T A N D I N G P E N S I O N A N D E M P L O Y E E B E N E F I T S I N T R A N S A C T I O N S G E R M A N M & A A N D P R I V A T E E Q U I T Y F O R U M
H E A L T H W E A L T H C A R E E R U N D E R S T A N D I N G P E N S I O N A N D E M P L O Y E E B E N E F I T S I N T R A N S A C T I O N S G E R M A N M & A A N D P R I V A T E E Q U I T Y F O R U M
Maßnahmen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und des Robert Koch- Instituts zur Erhöhung der saisonalen Influenza- Durchimpfung
 Maßnahmen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und des Robert Koch- Instituts zur Erhöhung der saisonalen Influenza- Durchimpfung Dietmar Walter, Robert Koch-Institut Silja Wortberg, Bundeszentrale
Maßnahmen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und des Robert Koch- Instituts zur Erhöhung der saisonalen Influenza- Durchimpfung Dietmar Walter, Robert Koch-Institut Silja Wortberg, Bundeszentrale
Evidenzbasierte Empfehlungen für Impfprogramme
 5. EUFEP Kongress: Kinder-und Jugendgesundheit 21. Juni 2017 Evidenzbasierte Empfehlungen für Impfprogramme Leiterin des & Titel der Präsentation ODER des Vortragenden Spezialambulanz für Impfungen der
5. EUFEP Kongress: Kinder-und Jugendgesundheit 21. Juni 2017 Evidenzbasierte Empfehlungen für Impfprogramme Leiterin des & Titel der Präsentation ODER des Vortragenden Spezialambulanz für Impfungen der
Partizipative Forschung mit alten Menschen (Wie) kann das gehen?
 Partizipative Forschung mit alten Menschen (Wie) kann das gehen? Prof. Dr. Hella von Unger Institut für Soziologie LMU München Email: unger@lmu.de Sorgekultur im Alter 8. Internationales IFF-ÖRK Symposium
Partizipative Forschung mit alten Menschen (Wie) kann das gehen? Prof. Dr. Hella von Unger Institut für Soziologie LMU München Email: unger@lmu.de Sorgekultur im Alter 8. Internationales IFF-ÖRK Symposium
Voraussetzungen für die Implementierung
 Rolf Kreienberg AGENDA Hintergrund Voraussetzungen für die Implementierung von Leitlinien Implementierung technische und soziale Innovationen berücksichtigen Evaluation von Leitlinien woran messen wir
Rolf Kreienberg AGENDA Hintergrund Voraussetzungen für die Implementierung von Leitlinien Implementierung technische und soziale Innovationen berücksichtigen Evaluation von Leitlinien woran messen wir
Innere Qualität im Krankenhaus Medizinethische Perspektiven
 Innere Qualität im Krankenhaus Medizinethische Perspektiven Georg Marckmann Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin CGIFOS Konferenz 2012 Universität
Innere Qualität im Krankenhaus Medizinethische Perspektiven Georg Marckmann Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin CGIFOS Konferenz 2012 Universität
Gesundheitssystem: Patienten, Ärzte, Kassen, Interessenkonflikte Das unausgeschöpfte Potenzial von Prävention und Gesundheitsförderung
 Gesundheitssystem: Patienten, Ärzte, Kassen, Interessenkonflikte Das unausgeschöpfte Potenzial von Prävention und Gesundheitsförderung Zukunftswerkstatt der LZG 7.5.2014 München David Klemperer Gesundheitsprobleme
Gesundheitssystem: Patienten, Ärzte, Kassen, Interessenkonflikte Das unausgeschöpfte Potenzial von Prävention und Gesundheitsförderung Zukunftswerkstatt der LZG 7.5.2014 München David Klemperer Gesundheitsprobleme
Ethische Fragen der maternalen und fetalen CMV- HIG- Gabe
 Ethische Fragen der maternalen und fetalen CMV- HIG- Gabe Prof. Dr. med. Georg Marckmann, MPH InsAtut für Ethik, Geschichte & Theorie der Medizin Ludwig- Maximilians- Universität München Lunchsymposium
Ethische Fragen der maternalen und fetalen CMV- HIG- Gabe Prof. Dr. med. Georg Marckmann, MPH InsAtut für Ethik, Geschichte & Theorie der Medizin Ludwig- Maximilians- Universität München Lunchsymposium
Wie ist die Datenlage zur Früherkennung des Prostatakarzinoms
 Wie ist die Datenlage zur Früherkennung des Prostatakarzinoms mittels PSA-Test? Marcel Zwahlen Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern zwahlen@ispm.unibe.ch Beurteilungskriterien für
Wie ist die Datenlage zur Früherkennung des Prostatakarzinoms mittels PSA-Test? Marcel Zwahlen Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern zwahlen@ispm.unibe.ch Beurteilungskriterien für
Gesundheitsförderung im frühen Kindesalter im Spannungsfeld zwischen Freiwilligkeit und Eingreifen
 Gesundheitsförderung im frühen Kindesalter im Spannungsfeld zwischen Freiwilligkeit und Eingreifen Prof. Felix Wettstein lic. phil. Susanne Anliker FH Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit 5.
Gesundheitsförderung im frühen Kindesalter im Spannungsfeld zwischen Freiwilligkeit und Eingreifen Prof. Felix Wettstein lic. phil. Susanne Anliker FH Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit 5.
