Risikopotential Fangvorrichtung Prüfungen mit Testgewichten sind nicht aussagekräftig genug!
|
|
|
- Jesko Hochberg
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Risikopotential angvorrichtung Prüfungen mit Testgewichten sind nicht aussagekräftig genug! Tim beling 1) Die nahezu weltweit gängige Praxis, die angvorrichtung von Aufzügen beim Inverkehrbringen mit Gewichten zu prüfen, hat eine einleuchtende Berechtigung: Während dieser Tests werden alle Bauteile einem mechanischen Stresstest unterzogen und somit können Montagefehler und strukturelle Unzulänglichkeiten aufgedeckt werden. Dieser Test kann jedoch die Wirksamkeit der angvorrichtung im worst case dem Nothalt aus dem freien all mit voller Zuladung nur sehr bedingt bzw. nicht nachweisen. Das Gleiche gilt für etwaige wiederkehrende Prüfungen in den geforderten Zeitintervallen. Diese These lässt sich nicht nur mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis nachweisen, sondern ist auch physikalisch leicht nachvollziehbar. Inzwischen existieren auch Alternativen zur althergebrachten Prüfung, die ohne den insatz von Gewichten eine deutlich sicherere und aussagekräftigere Prüfung von angvorrichtungen erlauben. 1. Ausgangssituation 1.1 Anforderungen an angvorrichtungen für Aufzüge In nahezu allen heutzutage existierenden Sicherheitsstandards für Aufzüge wird gefordert, dass eine angvorrichtung in der Lage sein muss eine voll beladene Kabine aus dem freien all sicher zu einem vollständigen Halt zu verzögern. Je nach Standard werden verschiedene Verzögerungsgrenzwerte gefordert, die dabei nicht unter- bzw. überschritten werden dürfen. In vielen Ländern werden statt der Verzögerungsgrenzwerte sogenannte minimale und maximale sliding-distances gefordert. Dabei wird die Länge der Bremsspur der angvorrichtung auf den Schienen gemessen, die physikalisch natürlich der erreichten Verzögerung entspricht. In der Regel ist dies bei der Inbetriebnahme und bei wiederkehrenden Prüfungen (beispielsweise in Teilen uropas alle 2 Jahre, in Nordamerika alle 5 Jahre) nachzuweisen. 1.2 Die Prüfung von angvorrichtungen mit Testgewichten Seitdem lisha Graves Otis 1854 auf der Weltausstellung in New York seine revolutionäre Sicherheitsbremse für Aufzüge vorstellte, werden die Tragseile von Aufzügen in der Regel nicht mehr absichtlich durchtrennt, um die Wirksamkeit der angvorrichtung nachzuweisen. Stattdessen wird die Kabine mit ihrer Nennlast beladen, in Abwärtsrichtung beschleunigt und dann bei Nenngeschwindigkeit bzw. Auslösegeschwindigkeit die angvorrichtung ausgelöst. Die dabei entstehenden Verzögerungen werden entweder während des Vorgangs gemessen oder in orm der sliding-distances anschließend von den ührungsschienen abgenommen. Wenn die gemessenen rgebnisse den Anforderungen des jeweiligen Sicherheitsstandards entsprechen und die Mechanik des Aufzuges keinen erkennbaren Schaden genommen hat, gilt der Sicherheitstest als bestanden. 1.3 Die Prüfung von angvorrichtungen ohne Testgewichte Während des Inverkehrbringens von neu errichteten Aufzugsanlagen werden die angvorrichtungen fast überall auf der Welt mit Testgewichten geprüft. In den letzten Jahren bildete nur Österreich eine Ausnahme. Hier durfte aufgrund eines demnächst geschlossenen Schlupflochs in der europäischen Norm mit rsatzmaßnahmen in orm von spezialisierten elektronischen Prüfsystemen nachgewiesen werden. Die wiederkehrende Prüfung von angvorrichtungen wird in Deutschland seit über 20 Jahren meist ohne den insatz von Testgewichten durchgeführt. Stattdessen werden elektronische Prüfsysteme zum insatz gebracht, die die Kräfte der angvorrichtungen messen und daraus deren Wirksamkeit für die betreffende Aufzugsanlage bestimmen können. Mit der 2013 dition der A17.1 (USA) bzw. B 44 (Kanada) dürfen diese Prüfsysteme seit dem letzten Jahr nun auch in Nordamerika für die wiederkehrende Prüfung eingesetzt werden. 2. Physikalische Zusammenhänge während der Prüfung der angvorrichtung Betrachtet man die weit verbreitete Praxis der angvorrichtungsprüfung bei der die Kabine mit Nennlast beladen aus der Über- bzw. Nenngeschwindigkeit gestoppt wird, fällt sofort auf, dass eine wichtige Anforderung an angvorrichtungen dabei gar nicht überprüft wird: Die Wirksamkeit der angvorrichtung zur Verzögerung der voll beladenen Kabine bis zum vollständigen Halt aus dem freien all! Diese Bedingung soll gewährleisten, dass selbst in dem unwahrscheinlichen all, dass alle Tragseile versagen, kein ahrgast zu Schaden oder gar zu Tode kommt. Der Unterschied zwischen der Anforderung und der praktischen Prüfung ist auch physikalisch erheblich, da dadurch alle Kräfte, die bei vorhandenen Tragseilen aus dem Gegengewicht resultieren, nicht beachtet werden. Anteile der Gewichtskraft des Gegengewichts ( CW) wirken über die Tragseile auf die Kabine, in gleicher Richtung wie auch die Bremskraft der angvorrichtung ( S). In anderen Worten: Das Gegengewicht unterstützt die angvorrichtung, die Gewichtskraft der voll beladenen Kabine ( ) zu kompensieren. Diese Unterstützung ist im worst case (nicht mehr vorhandenen Tragseilen) nicht vorhanden. Die nachfolgenden Abbildungen eines stark vereinfachten Modells zeigen die Kräfte im Moment des Notstopps an einer Kabine während der praktischen Prüfung mit Testgewichten und für den Stopp aus freiem all. Man könnte annehmen, dass sich im Moment des angvorgangs die Kräfte 1) Henning GmbH & Co. KG, Deutschland 32 LIT-RPORT 40. Jahrg. (2014) Heft 6
2 orces during a practical test with test weights orces during a stop in a free-fall situation, the force CW doesn t support the anymore traction sheave traction sheave counter weight counter weight W W W x S x S Abbildung 1: Kräfte am stark vereinfachten Aufzugsmodell im Moment des Notstopps W: resultierende Kräfte aus dem Gegengewicht S: Bremskraft der angvorrichtung : Gewichtskraft der voll beladenen Kabine x: Bremsweg CW des Gegengewichtes auf nahezu Null belaufen, da das nach oben beschleunigte Gegengewicht aufgrund seiner Trägheit seine Aufwärtsbewegung fortsetzt und somit für einen kurzen Moment die Seile zwischen Gegengewicht und Kabine erschlaffen. Genau dann wäre die praktische Prüfung gleichwertig mit der eigentlichen Anforderung des Stopps aus freiem all. Dies ist aber mitnichten der all, wie zahlreiche praktische Messungen bewiesen haben. in maßgeblicher aktor, der dies verhindert, sind die Seile, die wie lange edern wirken und abhängig von ihrer ederkonstante erst einmal wieder Arbeit verrichten müssen, um ihre gespeicherte nergie abzugeben. Da der eigentliche Verzögerungsvorgang nur wenige Millisekunden andauert, tritt der all der erschlafften Seile äußerst selten ein. Deutlich ist in Abbildung 2 zu erkennen, dass sich während des gesamten angvorganges (T1-T3) die Kraft in den Tragseilen kontinuierlich verringert (gestrichelte Kurve). Zu Beginn des angvorganges beträgt die Kraft 28 kn. Zum Zeitpunkt T2, zu dem die Kabine bereits auf die Hälfte der Auslösegeschwindigkeit herunter gebremst wurde, noch 11 kn und selbst am nde des angvorganges immerhin noch 2 kn. Würde man diese Kraft vernachlässigen, so würde sich rechnerisch eine Verzögerung der voll beladenen Kabine im freien all von 12 m/s² (~ 1,2 g) ergeben. Dieses rgebnis wäre aber falsch! Tatsächlich ergibt sich im freien all lediglich noch eine Verzögerung von 3 m/s² (~ 0,3 g), die bei dieser Aufzugsanlage ernsthafte Personenschäden verhindern würde. mpirische Versuche haben gezeigt, dass diese inflüsse aus dem Gegengewicht bei angversuchen mit leerer Kabine, gemittelt über die Dauer des eigentlichen angvorgangs, in etwa 50 % der Gewichtskraft der voll beladenen Kabine entsprechen. Bei einer voll beladenen Kabine ist der influss sogar höher, da die auftretenden Verzögerungen an der Kabine und damit die Verzögerungsdifferenz zwischen Gegengewicht und Kabine erheblich kleiner sind. Die Bewegungsgleichung für das in Abbildung 2 vorgestellte Modell lautet: m x ( t ) = m g + ( t ) ( t ), (1) CW + worin Beschleunigung und Kräfte von der Zeit abhängen. Im olgenden werden vereinfacht Mittelwerte während des angs im Intervall t zwischen t start und t end betrachtet und dafür dieselben Bezeichnungen benutzt, also z.b. S LIT-RPORT 40. Jahrg. (2014) Heft 6
3 acceleration angmessung :15:55 rope load [m/sec 2 ] Tower 1 fahrt 647 tend 1 x = x ( t ) d t t tstart, usw. Nunmehr ergibt sich eine mittlere angkraft bei leerer Kabine zu:, = m ( x + g ) S CW, (2) Den effektiven Bremsweg während der Phase des optimalen Bremsens berechnet man aus der gemittelten Bremsverzögerung und der Geschwindigkeit v bei Bremsbeginn durch zweifache Integration zu: x down 1 2 v 2 / x = (3) Die angkraft bei der mit Nennlast m RL beladenen Kabine beträgt dann mit m = m + m : S RL T1, = m ( x + g ) CW, (4) Geht man davon aus, dass die angkraft bei Abwärtsfahrt mit gering belasteter oder leerer Kabine zumindest nicht kleiner als die mit voller Kabine ist, dann kann man diese beiden Kräfte gleichsetzen S, = S, und daraus die angverzögerung bei Nennlast berechnen. Dieser Schritt ist erlaubt, da die theoretische Bremskraft der angvorrichtung weder von der Anfangsge- Time [sec] Abbildung 2: Kraft- und Beschleunigungsmessung im Moment des angvorganges (T1 bis T3), die Kräfte aus dem Gegengewicht (gestrichelt) haben deutlichen influss auf den angvorgang (solid: Beschleunigung, gestrichelt: Last in den Tragseilen, gepunktet: Geschwindigkeit) Zeitpunkt T1: Beschleunigung: 0,0 m/s² Kraft: 28 kn Geschwindigkeit: 1,3 m/s Zeitpunkt T2: Beschleunigung: 2,3 m/s² Kraft: 11 kn Geschwindigkeit: 0,7 m/s Zeitpunkt T3: Beschleunigung: 0,7 m/s² Kraft: 2 kn Geschwindigkeit: 0,0 m/s T2 speed [m/sec] 1 Grid = 0.3 m/sec acceleration [m/sec 2 ] 1 Grid = 3.0 m/sec 2 load [kg] 1 Grid = kg schwindigkeit noch von der Beladung der Kabine abhängig ist. Lediglich der resultierende Bremsweg und die Verzögerung werden durch diese Parameter beeinflusst. Zur übersichtlicheren Darstellung seien die aus dem Gegengewicht resultierenden Kräfte als Vielfache a der Kabinenlast dargestellt: CW, = a m g und CW, = a m g Dann erhält man nach einigen Umformungen die angverzögerung bei Nennlast zu m m x = x + g ( ( 1 α ) ( 1 α ) ) (5) m m T3 [kg] Aus diesen Gleichungen lassen sich zwei interessante Schlüsse ziehen: 1. Die Verzögerung der Kabine ist in hohem Maße von den aus dem Gegengewicht resultierenden Kräften abhängig. Wie bereits erwähnt entsprechen die mittleren, aus dem Gegengewicht resultierenden Kräfte oftmals der halben Gewichtskraft der voll beladenen Kabine. Benutzt man diesen Umstand in ormel (4) wird schnell deutlich, dass davon die Verzögerungen bzw. die Länge der sliding-distance erheblich beeinflusst werden. Die rgebnisse dieser Kenngrößen werden durch die inflüsse des Gegengewichtes deutlich besser, als sie es im worst-case bei gerissenen Seilen sein werden. 2. Aus ormel (5) wird deutlich, dass es möglich ist, aus der Verzögerung während des angversuchs bei leerer Kabine die Verzögerung und damit auch die sliding-distance bei voll beladener Kabine im freien all zu ermitteln, wenn die Masse und die Nennlast der Kabine bekannt sind und außerdem die Kräfte des Gegengewichtes vorliegen. Dieser Umstand wird von den bereits erwähnten elektronischen Prüfsystemen genutzt, worauf an späterer Stelle noch einmal eingegangen werden soll. 3 Auswirkungen des Gegengewichtes auf die Prüfaussage Interessant ist es nun, diese Überlegungen auf die momentan gängige Praxis der Prüfung von angvorrichtungen mit Testgewichten zu übertragen. Dabei müssen die Prüfungen vor dem Inverkehrbringen und die wiederkehrenden Prüfungen unterschieden werden. 3.1 Prüfung der angvorrichtung vor dem Inverkehrbringen Beim Inverkehrbringen kann hoffentlich davon ausgegangen werden, dass die realen Massen des Gegengewichts und der Kabine den Auslegekriterien entsprechen, nach denen die angvorrichtung ausgewählt wurde. Weiterhin muss davon ausgegangen werden, dass die Anlage korrekt installiert wurde und beispielsweise die ührungen des Gegengewichtes oder der Kabine nicht klemmen, was die angvorrichtung unzulässig bei der Verzögerung unterstützen könnte. erner wurde im Allgemeinen die ausgewählte angvorrichtung einer Baumusterprüfung unterzogen und hat somit bewiesen, dass sie in der Lage ist, die angesetzten Lasten auch im freien all bis zum vollständigen Halt zu verzögern, ohne dass dabei bestimmte Verzögerungsschwellen überschritten werden. Betrachtet man aber nun die beiden grundsätzlichen Prüfkriterien, die in den weltweiten Sicherheitsstandards Anwendung finden, so ergeben sich zusammen mit dem Wissen um den influss des Gegengewichts deutliche Schwachstellen Prüfkriterium Messung der slidingdistance in Überprüfungsprinzip, wie es beispielsweise die nordamerikanische 34 LIT-RPORT 40. Jahrg. (2014) Heft 6
4 ASM A /CSA B44-10 fordert, ist die voll beladene Kabine bei Übergeschwindigkeit durch die angvorrichtung zum vollständigen Halt zu verzögern und anschließend die sliding-distance anhand der Abdrücke auf den ührungsschienen zu messen. In der AS- M A /CSA B44-10 wird in Tabelle Maximum and Minimum Stopping Distances for Type B Car Safeties With Rated Load and Type B Counterweight Safeties ein minimal bzw. maximal zu erreichender Grenzwert genannt. Dort wird beispielsweise für Kabinen mit einer Nenngeschwindigkeit von 1,25 m/s eine Auslösegeschwindigkeit von 1,7 m/s und eine minimale Stopping Distance von 150 mm und eine maximale von 675 mm gefordert. Berechnet man nun nach ormel (4) die mittlere Kraft der angvorrichtung, die bei Auslösegeschwindigkeit und maximaler Stopping Distance letztendlich nachgewie sen wird, ergeben sich für eine Kabine mit einem Leer gewicht von 2300 kg und einer Zuladung von 1100 kg S, = 40633N CW,. Dem gegenüber steht im freien all eine Kraft von N, die diese Kabine abstürzen lässt. Ganz eindeutig darf die durch das Gegengewicht verursachte Kraft CW, nicht größer werden als 7279 N, ansonsten könnte die angvorrichtung die Kabine nicht verzögern. Das entspricht gerade einmal 22 % der Gewichtskraft der voll beladenen Kabine. Bei dieser, in Nordamerika real existierenden Anlage, entspricht der influss des Gegengewichtes fast 50 %. Daraus resultiert das erschreckende rgebnis, dass die Wirksamkeit dieser angvorrichtung nach gültigem Standard über rmittlung der slide-distance theoretisch gegeben ist, aber bei intritt des freien alls diese Kabine bei voller Beladung nicht zum Halt gebracht werden könnte Prüfkriterium Messung der Verzögerung Das andere Prüfkriterium, wie es beispielsweise in der europäischen DIN N 81-1: im Kapitel für Bremsfangvorrichtungen gefordert ist, sind Grenzwerte für die Verzögerung aus dem freien all (unabhängig von der aktuellen Beladung) von mindestens 0,2 g und maximal 1,0 g. Geprüft wird dies, indem die mit 125 % der Nennlast beladene Kabine zum Halt gebracht wird. Auch hier ergibt sich das Problem, dass der Versuch niemals mit durchtrennten Tragmitteln vollzogen wird und die inflüsse des Gegengewichts nicht bekannt sind. Damit kann auch mit diesem Prüfkriterium keine Aussage über im freien all getroffen werden. Daraus ergeben sich die gleichen unter Umständen desaströsen Bedingungen wie beim Prüfkriterium sliding-distance. Die Ausführungen zur Prüfung mit Gewichten vor dem Inverkehrbringen machen deutlich, dass letztendlich nicht umfassend geprüft wird, da die inflüsse des Gegengewichts nicht bekannt sind. Letztendlich muss an dieser Stelle auf die Montagequalität der ausführenden irma, die Baumusterprüfung der angvorrichtung und vor allen Dingen auf die Korrektheit der angesetzten Massen für Gegengewicht und Kabinengewicht vertraut werden. 3.2 Wiederkehrende Prüfung der angvorrichtung Bei der wiederkehrenden Prüfung von angvorrichtungen gelten grundsätzlich die gleichen Gegebenheiten wie sie bereits für die Prüfung vor dem Inverkehrbringen ausgeführt wurden. Allerdings kommt nun der gewichtige aktor Zeit hinzu. In der Zwischenzeit kann die Aufzugsanlage modernisiert worden sein, oftmals mit dem rgebnis, dass das Kabinengewicht zugenommen hat. Die ausführende irma hat in der Regel den Gegengewichtsausgleich wieder hergestellt, das Gegengewicht also aufgelastet. Das bedeutet, dass die resultierenden Kräfte aus dem Gegengewicht während der Prüfung der angvorrichtung zugenommen haben LIT-RPORT 40. Jahrg. (2014) Heft 6 35
5 können und mit dem Prüfergebnis somit noch weniger bestätigt werden kann. Die inzwischen erfolgte Betriebszeit des Aufzuges kann, je nach Wartungszustand, natürlich auch Verschleiß an der angvorrichtung, den ührungen etc. verursachen. Unter Umständen ein aktor, der weiter dazu beiträgt, dass die aus dem Gegengewicht resultierenden Kräfte gegenüber der Bremskraft der angvorrichtung zunehmen. 4. Prüfung der angvorrichtung mit elektronischen Prüfsystemen Wie in den ormeln dargelegt ist es möglich, aus der Verzögerung der angvorrichtung bei einem Test mit leerer Kabine die Verzögerung einer voll beladenen Kabine im freien all zu bestimmen, wenn die inflüsse des Gegengewichtes bekannt sind. Dieses Prinzip beruht darauf, dass die Kraft einer Bremse, und somit auch der angvorrichtung, sich unabhängig von der zu bremsenden Masse oder deren Geschwindigkeit entfaltet. Bei angvorrichtungen für Aufzüge bedeutet dies, dass die angvorrichtung komplett eingerückt sein muss, und in diesem Zustand immer die gleiche Bremskraft ausübt. Diese Bremskraft kann bestimmt werden, indem die Verzögerungen an der Kabine und die aus dem Gegengewicht resultierenden Kräfte während des angvorgangs gemessen werden. Ist diese Bremskraft bestimmt, ist es ein infaches für jede beliebige Beladung und Anfangsgeschwindigkeit die mittlere Verzögerung des Aufzuges im freien all zu errechnen. Moderne elektronische Prüfsysteme bestehen daher aus zwei wesentlichen Komponenten: einem Beschleunigungssensor, der auf der Kabine angebracht wird, und Kraftsensoren, die die Kräfte in den Tragseilen direkt über der Kabine während des angvorganges messen. Anschließend wird anhand der bereits genannten ormeln die Berechnung durchgeführt, deren rgebnis ein Maß für die Wirksamkeit der angvorrichtung ist. Seit dem insatz solcher Systeme in Deutschland und in jüngster Zeit auch in Nordamerika konnten zahlreiche Aufzugsanlagen identifiziert werden, bei denen die Wirksamkeit der angvorrichtung nicht gegeben war, obwohl sie in der Vergangenheit in wiederkehrenden Intervallen geprüft wurde, allerdings mit Testgewichten und ohne Wissen um die inflüsse des Gegengewichts. Die physikalische Überlegenheit dieses Messprinzips in Bezug auf eine Aussagefähigkeit über die Wirksamkeit der angvorrichtung ist offensichtlich. Hinzu kommt ein weiterer oft unbeachteter aktor: in gewichtiges Argument für die Prüfung mit Testgewichten ist der gleichzeitige Test der Montageund Materialqualität in orm eines mechanischen Stresstests für die Aufzugsanlage. Mängel werden durch visuelle Kontrolle nach dem angtest in orm von verformten Kabinen, zerstörten Innenverkleidungen etc. offensichtlich. Dies gilt für den Test ohne Testgewichte allerdings noch in viel höherem Maße. Da die Bremskraft der angvorrichtung bei diesem Test die gleiche ist wie bei dem Test mit Gewichten, sind die Verzögerungen aber umso höher bzw. der Bremsweg umso kürzer. Die deutlich höhere und abruptere Verzögerung verursacht somit einen deutlich höheren mechanischen Stress für die Aufzugsanlage. inen Stress, der aber auch im rnstfall mit beispielsweise nur einem ahrgast ausgehalten werden muss. 5. Zusammenfassung olgt man den Ausführungen dieses Artikels wird deutlich, dass ein Test der angvorrichtungen mit Testgewichten bzw. ohne die gleichzeitige Bestimmung der inflüsse aus dem Gegengewicht keine Aussage über die Wirksamkeit der angvorrichtung ermöglicht, weder vor der Inbetriebnahme noch bei etwaigen wiederkehrenden Prüfungen. Somit wird beispielsweise in uropa die Anforderung der N 81 in Bezug auf Verzögerungsgrenzwerte im freien all gar nicht überprüft. Bestimmt war die rhöhung der Sicherheit einer der Gründe, warum in der aktuellen dition 2013 der nordamerikanischen Aufzugsnorm A17/ B44 die reigabe der elektronischen Prüfsysteme erfolgte. Allerdings nur als Option, die Prüfung mit Testgewichten ist weiterhin möglich bzw. bei der Prüfung vor Inverkehrbringen sogar obligatorisch. Da die Prüfung ohne Testgewichte noch dazu einen erheblichen mechanischen Stresstest für die Aufzugsanlage bedeutet, wird an dieser Stelle deutlich, dass die Prüfung von angvorrichtungen mit Testgewichten deutliche Schwachpunkte aufweist und der alternative insatz von elektronischen Prüfsystemen ein weit höheres Maß an Verlässlichkeit und Sicherheit herstellen kann. Info Tim beling ist seit 2003 als Leiter der ntwicklung bei der irma Henning GmbH & Co. KG beschäftigt. In dieser unktion gründete er die R&D- Abteilung in Braunschweig (Deutschland). in Mitarbeiterteam arbeitet dort seitdem an der ntwicklung und Produktion von elektronischen und messtechnischen Komponenten für Aufzüge. Seit 2012 ist der Autor auch Geschäftsführer. iner seiner Schwerpunkte ist nach wie vor die Messtechnik. Gerade in diesem Bereich hat der Autor viele Jahre rfahrung in der ntwicklung von Beschleunigungs- und Seillastmesssystemen. Das berufliche Ziel des Autors ist es, den Aufzugsmarkt mit innovativen Komponenten zu bereichern, um dem erhöhten Kostendruck durch die ntwicklung von nachhaltigen, effizienten und arbeitszeitsparenden Komponenten zu begegnen. Dieser Vortrag wurde anlässlich der Paris 2014, dem internationalen Kongress für vertikale Transporttechnologien, gehalten und erstmals im IA-Buch levator Technology 20, herausgegeben von A. Lustig, veröffentlicht. s handelt sich um einen Nachdruck mit Genehmigung der The international Association of levator ngineers. 36 LIT-RPORT 40. Jahrg. (2014) Heft 6
Transatlantische Annäherung in der Aufzugsprüfung
 Transatlantische Annäherung in der Aufzugsprüfung Neue Standards und Messgeräte für die wiederkehrende Prüfung ohne Gewichte in den USA und Kanada T. Ebeling, Henning GmbH & Co. KG Aufzugprüfung in den
Transatlantische Annäherung in der Aufzugsprüfung Neue Standards und Messgeräte für die wiederkehrende Prüfung ohne Gewichte in den USA und Kanada T. Ebeling, Henning GmbH & Co. KG Aufzugprüfung in den
Fehler- und Ausgleichsrechnung
 Fehler- und Ausgleichsrechnung Daniel Gerth Daniel Gerth (JKU) Fehler- und Ausgleichsrechnung 1 / 12 Überblick Fehler- und Ausgleichsrechnung Dieses Kapitel erklärt: Wie man Ausgleichsrechnung betreibt
Fehler- und Ausgleichsrechnung Daniel Gerth Daniel Gerth (JKU) Fehler- und Ausgleichsrechnung 1 / 12 Überblick Fehler- und Ausgleichsrechnung Dieses Kapitel erklärt: Wie man Ausgleichsrechnung betreibt
Gymnasium Koblenzer Straße, Grundkurs EF Physik 1. Halbjahr 2012/13
 Aufgaben für Dienstag, 23.10.2012: Physik im Straßenverkehr Für die Sicherheit im Straßenverkehr spielen die Bedingungen bei Beschleunigungsund Bremsvorgängen eine herausragende Rolle. In der Straßenverkehrsordnung
Aufgaben für Dienstag, 23.10.2012: Physik im Straßenverkehr Für die Sicherheit im Straßenverkehr spielen die Bedingungen bei Beschleunigungsund Bremsvorgängen eine herausragende Rolle. In der Straßenverkehrsordnung
gibb / BMS Physik Berufsmatur 2008 Seite 1
 gibb / BMS Physik Berufsmatur 008 Seite 1 Aufgabe 1 Kreuzen Sie alle korrekten Lösungen direkt auf dem Blatt an. Es können mehrere Antworten richtig sein. Alle 4 Teile dieser Aufgabe werden mit je einem
gibb / BMS Physik Berufsmatur 008 Seite 1 Aufgabe 1 Kreuzen Sie alle korrekten Lösungen direkt auf dem Blatt an. Es können mehrere Antworten richtig sein. Alle 4 Teile dieser Aufgabe werden mit je einem
Gemessen wird die Zeit, die der Wagen bei einer beschleunigten Bewegung für die Messtrecke 1m braucht.
 R. Brinkmann http://brinkmann-du.de Seite 1 26.11.2013 Beschleunigungsmessung an der Fahrbahn Protokoll und Auswertung einer Versuchsdurchführung. Gemessen wird die Zeit, die der Wagen bei einer beschleunigten
R. Brinkmann http://brinkmann-du.de Seite 1 26.11.2013 Beschleunigungsmessung an der Fahrbahn Protokoll und Auswertung einer Versuchsdurchführung. Gemessen wird die Zeit, die der Wagen bei einer beschleunigten
Berechnung der nominellen Lebensdauer
 50G Auswahlkriterien Die Lebensdauer von gleichen Linearführungssystemen ist oftmals unterschiedlich, obwohl sie unter gleichen Bedingungen hergestellt und auch betrieben werden. Als Richtlinie wird die
50G Auswahlkriterien Die Lebensdauer von gleichen Linearführungssystemen ist oftmals unterschiedlich, obwohl sie unter gleichen Bedingungen hergestellt und auch betrieben werden. Als Richtlinie wird die
Anwendung der Infinitesimalrechnung in der Physik (besonders geeignet für Kernfach Physik Kurshalbjahr Mechanik Anforderung auf Leistungskursniveau)
 Anwendung der Infinitesimalrechnung in der Physik (besonders geeignet für Kernfach Physik Kurshalbjahr Mechanik Anforderung auf Leistungskursniveau) Vorbemerkung Die nachfolgenden Darstellungen dienen
Anwendung der Infinitesimalrechnung in der Physik (besonders geeignet für Kernfach Physik Kurshalbjahr Mechanik Anforderung auf Leistungskursniveau) Vorbemerkung Die nachfolgenden Darstellungen dienen
Verkehrsdynamik und -simulation SS 2017, Lösungsvorschläge zu Übung Nr. 8
 Verkehrsdynamik und -simulation SS 2017, Lösungsorschläge zu Übung Nr. 8 Lösungsorschlag zu Aufgabe 8.1: Faustregeln für Abstand und Bremsweg (a) Zunächst mal wächst der Abstand gemäß der Regel Abstand
Verkehrsdynamik und -simulation SS 2017, Lösungsorschläge zu Übung Nr. 8 Lösungsorschlag zu Aufgabe 8.1: Faustregeln für Abstand und Bremsweg (a) Zunächst mal wächst der Abstand gemäß der Regel Abstand
Ergänzung zur Betriebsanleitung
 Ergänzung zur 300.000.126 300.000.166 I Version 01.2012 Erweiterung der beidseitig wirkenden Bremsfangvorrichtungen BF2D-1 BF2D-2 BF2D-1/ BF1D-1 BF2D-2/BF1D-2 und BF2D-2/BF2D-2/BF1D-2 als Teilsystem der
Ergänzung zur 300.000.126 300.000.166 I Version 01.2012 Erweiterung der beidseitig wirkenden Bremsfangvorrichtungen BF2D-1 BF2D-2 BF2D-1/ BF1D-1 BF2D-2/BF1D-2 und BF2D-2/BF2D-2/BF1D-2 als Teilsystem der
Not-Halt-Prüfungen von Wickelantrieben mit DSD
 Not-Halt-Prüfungen von Wickelantrieben mit DSD Die vollständige Berechnung aller auftretenden Not-Halt-Szenarien ist für Wickelantriebe von besonderer Wichtigkeit, da bei diesen Anwendungen oftmals große
Not-Halt-Prüfungen von Wickelantrieben mit DSD Die vollständige Berechnung aller auftretenden Not-Halt-Szenarien ist für Wickelantriebe von besonderer Wichtigkeit, da bei diesen Anwendungen oftmals große
2.4 Kinetische Gastheorie - Druck und Temperatur im Teilchenmodell
 2.4 Kinetische Gastheorie - Druck und Temperatur im Teilchenmodell Mit den drei Zustandsgrößen Druck, Temperatur und Volumen konnte der Zustand von Gasen makroskopisch beschrieben werden. So kann zum Beispiel
2.4 Kinetische Gastheorie - Druck und Temperatur im Teilchenmodell Mit den drei Zustandsgrößen Druck, Temperatur und Volumen konnte der Zustand von Gasen makroskopisch beschrieben werden. So kann zum Beispiel
Die Kraft. Mechanik. Kräfteaddition. Die Kraft. F F res = F 1 -F 2
 Die Kraft Mechanik Newton sche Gesetze und ihre Anwendung (6 h) Physik Leistungskurs physikalische Bedeutung: Die Kraft gibt an, wie stark ein Körper auf einen anderen einwirkt. FZ: Einheit: N Gleichung:
Die Kraft Mechanik Newton sche Gesetze und ihre Anwendung (6 h) Physik Leistungskurs physikalische Bedeutung: Die Kraft gibt an, wie stark ein Körper auf einen anderen einwirkt. FZ: Einheit: N Gleichung:
Neue Aufzugsnorm: Schindler setzt sie bereits um
 Betreff Schindler AG & Co. KG Brand & Communication Medienmitteilung Seite 1 Neue Aufzugsnorm: Schindler setzt sie bereits um Aufzugsnorm EN 81-20/50 ab 1. September 2017 verbindlich / Schindler übernimmt
Betreff Schindler AG & Co. KG Brand & Communication Medienmitteilung Seite 1 Neue Aufzugsnorm: Schindler setzt sie bereits um Aufzugsnorm EN 81-20/50 ab 1. September 2017 verbindlich / Schindler übernimmt
Fehlerrechnung. Einführung. Jede Messung ist fehlerbehaftet! Ursachen:
 Fehlerrechnung Einführung Jede Messung ist fehlerbehaftet! Ursachen: Ablesefehler (Parallaxe, Reaktionszeit) begrenzte Genauigkeit der Messgeräte falsche Kalibrierung/Eichung der Messgeräte Digitalisierungs-Fehler
Fehlerrechnung Einführung Jede Messung ist fehlerbehaftet! Ursachen: Ablesefehler (Parallaxe, Reaktionszeit) begrenzte Genauigkeit der Messgeräte falsche Kalibrierung/Eichung der Messgeräte Digitalisierungs-Fehler
Unabhängigkeit KAPITEL 4
 KAPITEL 4 Unabhängigkeit 4.1. Unabhängigkeit von Ereignissen Wir stellen uns vor, dass zwei Personen jeweils eine Münze werfen. In vielen Fällen kann man annehmen, dass die eine Münze die andere nicht
KAPITEL 4 Unabhängigkeit 4.1. Unabhängigkeit von Ereignissen Wir stellen uns vor, dass zwei Personen jeweils eine Münze werfen. In vielen Fällen kann man annehmen, dass die eine Münze die andere nicht
Beurteilungskriterien für Seilaufzugantriebe. Schwelmer Symposium 2012
 Schwelmer Symposium 2012 Ludwig Semmler Dipl. Ing. (FH) Geneickenerstrasse 190 41238 Mönchengladbach Tel.: 00 49 21 66 13 94 22 Fax.: 00 49 21 66 13 94 33 Mobil: 00 49 160 7 42 36 31 Mail: ludwig.semmler@ziehl-abegg.de
Schwelmer Symposium 2012 Ludwig Semmler Dipl. Ing. (FH) Geneickenerstrasse 190 41238 Mönchengladbach Tel.: 00 49 21 66 13 94 22 Fax.: 00 49 21 66 13 94 33 Mobil: 00 49 160 7 42 36 31 Mail: ludwig.semmler@ziehl-abegg.de
Lernstation I. Abstrakte Formulierungen die drei Größen in der Kraftformel. 4. Zum Ausprobieren: Auf dem Tisch liegen verschieden
 Lernstation I Abstrakte Formulierungen die drei Größen in der Kraftformel 1. Welche Kraft wird benötigt, um einen Körper der Masse m = 1 kg mit a = 1 m s 2 zu beschleunigen? Schreiben sie einen Antwortsatz!
Lernstation I Abstrakte Formulierungen die drei Größen in der Kraftformel 1. Welche Kraft wird benötigt, um einen Körper der Masse m = 1 kg mit a = 1 m s 2 zu beschleunigen? Schreiben sie einen Antwortsatz!
Lösung II Veröffentlicht:
 1 Momentane Bewegung I Die Position eines Teilchens auf der x-achse, ist gegeben durch x = 3m 30(m/s)t + 2(m/s 3 )t 3, wobei x in Metern und t in Sekunden angeben wird (a) Die Position des Teilchens bei
1 Momentane Bewegung I Die Position eines Teilchens auf der x-achse, ist gegeben durch x = 3m 30(m/s)t + 2(m/s 3 )t 3, wobei x in Metern und t in Sekunden angeben wird (a) Die Position des Teilchens bei
VHS Floridsdorf elopa Manfred Gurtner Was ist der Differentialquotient in der Physik?
 Was ist der Differentialquotient in der Physik? Ein Auto fährt auf der A1 von Wien nach Salzburg. Wir können diese Fahrt durch eine Funktion s(t) beschreiben, die zu jedem Zeitpunkt t (Stunden oder Sekunden)
Was ist der Differentialquotient in der Physik? Ein Auto fährt auf der A1 von Wien nach Salzburg. Wir können diese Fahrt durch eine Funktion s(t) beschreiben, die zu jedem Zeitpunkt t (Stunden oder Sekunden)
Ein Trommelaufzug ist altmodisch und braucht viel Energie. Betrachtung zu einer fast in Vergessenheit geratenen Antriebstechnik
 Ein Trommelaufzug ist altmodisch und braucht viel Energie Betrachtung zu einer fast in Vergessenheit geratenen Antriebstechnik zumtrommelaufzug Stimmt das System Trommelaufzug ist wirklich altmodisch 2
Ein Trommelaufzug ist altmodisch und braucht viel Energie Betrachtung zu einer fast in Vergessenheit geratenen Antriebstechnik zumtrommelaufzug Stimmt das System Trommelaufzug ist wirklich altmodisch 2
Fig. 1 zeigt drei gekoppelte Wagen eines Zuges und die an Ihnen angreifenden Kräfte. Fig. 1
 Anwendung von N3 Fig. 1 zeigt drei gekoppelte Wagen eines Zuges und die an Ihnen angreifenden Kräfte. Die Beschleunigung a des Zuges Massen zusammen. Die Antwort Fig. 1 sei konstant, die Frage ist, wie
Anwendung von N3 Fig. 1 zeigt drei gekoppelte Wagen eines Zuges und die an Ihnen angreifenden Kräfte. Die Beschleunigung a des Zuges Massen zusammen. Die Antwort Fig. 1 sei konstant, die Frage ist, wie
Exemplar für Prüfer/innen
 Exemplar für Prüfer/innen Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Oktober 2015 Mathematik Kompensationsprüfung Angabe für Prüfer/innen Hinweise zur
Exemplar für Prüfer/innen Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Oktober 2015 Mathematik Kompensationsprüfung Angabe für Prüfer/innen Hinweise zur
Masse, Kraft und Beschleunigung Masse:
 Masse, Kraft und Beschleunigung Masse: Seit 1889 ist die Einheit der Masse wie folgt festgelegt: Das Kilogramm ist die Einheit der Masse; es ist gleich der Masse des Internationalen Kilogrammprototyps.
Masse, Kraft und Beschleunigung Masse: Seit 1889 ist die Einheit der Masse wie folgt festgelegt: Das Kilogramm ist die Einheit der Masse; es ist gleich der Masse des Internationalen Kilogrammprototyps.
Pi über den Kreisumfang berechnen
 Pi über den Kreisumfang berechnen Die Babylonier wussten schon vor über 4000 Jahren, dass das Verhältnis von Kreisumfang zum Durchmesser konstant sein muss. Tatsächlich beschreibt die Zahl das Verhältnis
Pi über den Kreisumfang berechnen Die Babylonier wussten schon vor über 4000 Jahren, dass das Verhältnis von Kreisumfang zum Durchmesser konstant sein muss. Tatsächlich beschreibt die Zahl das Verhältnis
Sales Info 06/2013. BT Bremsprüfrichtlinien in Deutschland. Juni Bremsen prüfen Marktsituation in Deutschland... 2
 Juni 2013 Sales Info 06/2013 BT Bremsprüfrichtlinien in Deutschland Bremsen prüfen Marktsituation in Deutschland... 2 Gesetzliche Grundlage in Deutschland... 2 Zu 1. Die Bremsprüfstandsrichtlinie beschreibt
Juni 2013 Sales Info 06/2013 BT Bremsprüfrichtlinien in Deutschland Bremsen prüfen Marktsituation in Deutschland... 2 Gesetzliche Grundlage in Deutschland... 2 Zu 1. Die Bremsprüfstandsrichtlinie beschreibt
Praxiserfahrung bei der Prüfung von Komponenten nach DIN EN 81-1/2 A3 Werner Rau VFA-Forum interlift 2011, 19. Oktober, Messe Augsburg
 Praxiserfahrung bei der Prüfung von Komponenten nach DIN EN 81-1/2 A3 Werner Rau VFA-Forum interlift 2011, 19. Oktober, Messe Augsburg TÜV SÜD Industrie Service GmbH Praxiserfahrung DIN EN 81-1/2 A3 /
Praxiserfahrung bei der Prüfung von Komponenten nach DIN EN 81-1/2 A3 Werner Rau VFA-Forum interlift 2011, 19. Oktober, Messe Augsburg TÜV SÜD Industrie Service GmbH Praxiserfahrung DIN EN 81-1/2 A3 /
Nur wer messen kann, kann einfach einstellen
 Nur wer messen kann, kann einfach einstellen T. Ebeling, Henning GmbH Schwelmer Symposium 2011 1 mobile Diagnose Fahrleistung und Qualität nach ISO 18738 Messwerte Beschleunigung in X,Y,Z-Richtung, Schalldruck
Nur wer messen kann, kann einfach einstellen T. Ebeling, Henning GmbH Schwelmer Symposium 2011 1 mobile Diagnose Fahrleistung und Qualität nach ISO 18738 Messwerte Beschleunigung in X,Y,Z-Richtung, Schalldruck
Name, Vorname:... Klasse:...
 Berufsmaturitätsschule BMS Physik Berufsmatur 2013 Name, Vorname:... Klasse:... Zeit: 120 Minuten Hilfsmittel: Hinweise: Taschenrechner, Formelsammlung nach eigener Wahl. Die Formelsammlung darf mit persönlichen
Berufsmaturitätsschule BMS Physik Berufsmatur 2013 Name, Vorname:... Klasse:... Zeit: 120 Minuten Hilfsmittel: Hinweise: Taschenrechner, Formelsammlung nach eigener Wahl. Die Formelsammlung darf mit persönlichen
Aufgaben. zu Inhalten der 5. Klasse
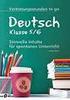 Aufgaben zu Inhalten der 5. Klasse Universität Klagenfurt, Institut für Didaktik der Mathematik (AECC-M) September 2010 Zahlbereiche Es gibt Gleichungen, die (1) in Z, nicht aber in N, (2) in Q, nicht
Aufgaben zu Inhalten der 5. Klasse Universität Klagenfurt, Institut für Didaktik der Mathematik (AECC-M) September 2010 Zahlbereiche Es gibt Gleichungen, die (1) in Z, nicht aber in N, (2) in Q, nicht
Schwelmer Symposium Wartung und Instandhaltung optimieren Sinkende Kosten durch intelligente Sensoren am Aufzug
 Schwelmer Symposium 2012 Wartung und Instandhaltung optimieren Sinkende Kosten durch intelligente Sensoren am Aufzug 18.06.2012 Tim Ebeling, Henning GmbH & Co. KG 1 Allgemeine Instandhaltungsstrategien
Schwelmer Symposium 2012 Wartung und Instandhaltung optimieren Sinkende Kosten durch intelligente Sensoren am Aufzug 18.06.2012 Tim Ebeling, Henning GmbH & Co. KG 1 Allgemeine Instandhaltungsstrategien
Anpassungstests VORGEHENSWEISE
 Anpassungstests Anpassungstests prüfen, wie sehr sich ein bestimmter Datensatz einer erwarteten Verteilung anpasst bzw. von dieser abweicht. Nach der Erläuterung der Funktionsweise sind je ein Beispiel
Anpassungstests Anpassungstests prüfen, wie sehr sich ein bestimmter Datensatz einer erwarteten Verteilung anpasst bzw. von dieser abweicht. Nach der Erläuterung der Funktionsweise sind je ein Beispiel
Fachgespräch Emissionsüberwachung Merkblatt
 Merkblatt zur Kalibrierung von automatischen Messeinrichtungen für Stickoxide (NO x ) und Kohlenmonoxid (CO) nach EN 14181 Die DIN EN 14181 Qualitätssicherung für automatische Messeinrichtungen fordert
Merkblatt zur Kalibrierung von automatischen Messeinrichtungen für Stickoxide (NO x ) und Kohlenmonoxid (CO) nach EN 14181 Die DIN EN 14181 Qualitätssicherung für automatische Messeinrichtungen fordert
Auswertung und Lösung
 Dieses Quiz soll Ihnen helfen, Kapitel 4.7 und 4.8 besser zu verstehen. Auswertung und Lösung Abgaben: 71 / 265 Maximal erreichte Punktzahl: 8 Minimal erreichte Punktzahl: 0 Durchschnitt: 5.65 Frage 1
Dieses Quiz soll Ihnen helfen, Kapitel 4.7 und 4.8 besser zu verstehen. Auswertung und Lösung Abgaben: 71 / 265 Maximal erreichte Punktzahl: 8 Minimal erreichte Punktzahl: 0 Durchschnitt: 5.65 Frage 1
6 Vertiefende Themen aus des Mechanik
 6 Vertiefende Themen aus des Mechanik 6.1 Diagramme 6.1.1 Steigung einer Gerade; Änderungsrate Im ersten Kapitel haben wir gelernt, was uns die Steigung (oft mit k bezeichnet) in einem s-t Diagramm ( k=
6 Vertiefende Themen aus des Mechanik 6.1 Diagramme 6.1.1 Steigung einer Gerade; Änderungsrate Im ersten Kapitel haben wir gelernt, was uns die Steigung (oft mit k bezeichnet) in einem s-t Diagramm ( k=
M M (max) + MS MS (max) 189Nm nominal km. 639Nm nominal km
 HepcoMotion Berechnung der SBD-Lebensdauer Die Einsatzzeit eines SBD-Systems wird auf der Basis der Anzahl der Kilometer errechnet, die das System fahren kann, bevor die Linearführung mit Kugeln ihre L0-Nutzungsdauer
HepcoMotion Berechnung der SBD-Lebensdauer Die Einsatzzeit eines SBD-Systems wird auf der Basis der Anzahl der Kilometer errechnet, die das System fahren kann, bevor die Linearführung mit Kugeln ihre L0-Nutzungsdauer
Schwelmer Symposium 2015 Moderne Technik im Aufzug. VDMA Berechnungs-Tool für die A3 Bremswegbestimmung
 Schwelmer Symposium 2015 Moderne Technik im Aufzug VDMA Berechnungs-Tool für die A3 Bremswegbestimmung Dr.-Ing. Holger König Leiter Vertrieb Emerson Industrial Automation VDMA Fachverband Aufzüge und Fahrtreppen
Schwelmer Symposium 2015 Moderne Technik im Aufzug VDMA Berechnungs-Tool für die A3 Bremswegbestimmung Dr.-Ing. Holger König Leiter Vertrieb Emerson Industrial Automation VDMA Fachverband Aufzüge und Fahrtreppen
Aufgabensammlung zum Üben Blatt 1
 Aufgabensammlung zum Üben Blatt 1 Seite 1 Lineare Funktionen ohne Parameter: 1. Die Gerade g ist durch die Punkte A ( 3 4 ) und B( 2 1 ) festgelegt, die Gerade h durch die Punkte C ( 5 3 ) und D ( -2-2
Aufgabensammlung zum Üben Blatt 1 Seite 1 Lineare Funktionen ohne Parameter: 1. Die Gerade g ist durch die Punkte A ( 3 4 ) und B( 2 1 ) festgelegt, die Gerade h durch die Punkte C ( 5 3 ) und D ( -2-2
Kapitel 2. Mittelwerte
 Kapitel 2. Mittelwerte Im Zusammenhang mit dem Begriff der Verteilung, der im ersten Kapitel eingeführt wurde, taucht häufig die Frage auf, wie man die vorliegenden Daten durch eine geeignete Größe repräsentieren
Kapitel 2. Mittelwerte Im Zusammenhang mit dem Begriff der Verteilung, der im ersten Kapitel eingeführt wurde, taucht häufig die Frage auf, wie man die vorliegenden Daten durch eine geeignete Größe repräsentieren
MATHEMATIK I für Bauingenieure (Fernstudium)
 TU DRESDEN Dresden, 2. Februar 2004 Fachrichtung Mathematik / Institut für Analysis Doz.Dr.rer.nat.habil. N. Koksch Prüfungs-Klausur MATHEMATIK I für Bauingenieure (Fernstudium) Name: Vorname: Matrikel-Nr.:
TU DRESDEN Dresden, 2. Februar 2004 Fachrichtung Mathematik / Institut für Analysis Doz.Dr.rer.nat.habil. N. Koksch Prüfungs-Klausur MATHEMATIK I für Bauingenieure (Fernstudium) Name: Vorname: Matrikel-Nr.:
Aufgabe des Monats Januar 2012
 Aufgabe des Monats Januar 2012 Ein Unternehmen stellt Kaffeemaschinen her, für die es jeweils einen Preis von 100 Euro (p = 100) verlangt. Die damit verbundene Kostenfunktion ist gegeben durch: C = 5q
Aufgabe des Monats Januar 2012 Ein Unternehmen stellt Kaffeemaschinen her, für die es jeweils einen Preis von 100 Euro (p = 100) verlangt. Die damit verbundene Kostenfunktion ist gegeben durch: C = 5q
HIT-Schulung: Mehr-Verbrauch
 HIT-Schulung: Mehr-Verbrauch Zweck: Diese Schulung soll klarmachen, dass nicht der Verbrauch von Öl + Sprit möglich ist, sondern der Mehr-Verbrauch derselben. Viele verwechseln den Soll-Verbrauch mit dem
HIT-Schulung: Mehr-Verbrauch Zweck: Diese Schulung soll klarmachen, dass nicht der Verbrauch von Öl + Sprit möglich ist, sondern der Mehr-Verbrauch derselben. Viele verwechseln den Soll-Verbrauch mit dem
12GE1 - Wiederholung - Verbesserung Praktikum 01
 12GE1 - Wiederholung - Verbesserung Praktikum 01 Raymond KNEIP, LYCÉE DES ARTS ET MÉTIERS September 2015 1 Die gleichförmige Bewegung Dritte Reihe der Tabelle: s/t (m/s) (F.I.) 0.5 0.5 0.5 0.5 a. Der Quotient
12GE1 - Wiederholung - Verbesserung Praktikum 01 Raymond KNEIP, LYCÉE DES ARTS ET MÉTIERS September 2015 1 Die gleichförmige Bewegung Dritte Reihe der Tabelle: s/t (m/s) (F.I.) 0.5 0.5 0.5 0.5 a. Der Quotient
Baumuster geprüfte Lösungen für A3 Hydraulikventile gegen unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs (UCM) abwärts (EN 81-2:2010)
 Baumuster geprüfte Lösungen für A3 Hydraulikventile gegen unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs (UCM) abwärts (EN 81-2:2010) Dr.-Ing. M. Reichert Baumustergeprüfte Lösungen für A3 Schwelmer Symposium
Baumuster geprüfte Lösungen für A3 Hydraulikventile gegen unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs (UCM) abwärts (EN 81-2:2010) Dr.-Ing. M. Reichert Baumustergeprüfte Lösungen für A3 Schwelmer Symposium
Berechnung von W für die Elementarereignisse einer Zufallsgröße
 R. Albers, M. Yanik Skript zur Vorlesung Stochastik (lementarmathematik) 5. Zufallsvariablen Bei Zufallsvariablen geht es darum, ein xperiment durchzuführen und dem entstandenen rgebnis eine Zahl zuzuordnen.
R. Albers, M. Yanik Skript zur Vorlesung Stochastik (lementarmathematik) 5. Zufallsvariablen Bei Zufallsvariablen geht es darum, ein xperiment durchzuführen und dem entstandenen rgebnis eine Zahl zuzuordnen.
Übungsscheinklausur,
 Mathematik IV für Maschinenbau und Informatik (Stochastik) Universität Rostock, Institut für Mathematik Sommersemester 27 Prof. Dr. F. Liese Übungsscheinklausur, 3.7.27 Dipl.-Math. M. Helwich Name:...
Mathematik IV für Maschinenbau und Informatik (Stochastik) Universität Rostock, Institut für Mathematik Sommersemester 27 Prof. Dr. F. Liese Übungsscheinklausur, 3.7.27 Dipl.-Math. M. Helwich Name:...
Übung zur Vorlesung Berechenbarkeit und Komplexität
 RWTH Aachen Lehrgebiet Theoretische Informatik Reidl Ries Rossmanith Sanchez Tönnis WS 2012/13 Übungsblatt 7 26.11.2012 Übung zur Vorlesung Berechenbarkeit und Komplexität Aufgabe T15 Entwickeln Sie ein
RWTH Aachen Lehrgebiet Theoretische Informatik Reidl Ries Rossmanith Sanchez Tönnis WS 2012/13 Übungsblatt 7 26.11.2012 Übung zur Vorlesung Berechenbarkeit und Komplexität Aufgabe T15 Entwickeln Sie ein
Novellierung der Betriebssicherheitsverordnung aus Sicht einer ZÜS. Dieter Roas TÜV SÜD Industrie Service GmbH Leiter ZÜS
 Novellierung der Betriebssicherheitsverordnung aus Sicht einer ZÜS Dieter Roas TÜV SÜD Industrie Service GmbH Leiter ZÜS TÜV SÜD Industrie Service GmbH 14.10.2014 Überwachungsbedürftige Anlagen Aufzugsanlagen
Novellierung der Betriebssicherheitsverordnung aus Sicht einer ZÜS Dieter Roas TÜV SÜD Industrie Service GmbH Leiter ZÜS TÜV SÜD Industrie Service GmbH 14.10.2014 Überwachungsbedürftige Anlagen Aufzugsanlagen
Rotation. Versuch: Inhaltsverzeichnis. Fachrichtung Physik. Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010. Physikalisches Grundpraktikum
 Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Versuch: RO Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010 Rotation Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung 2 2 Allgemeine Grundlagen 2 2.1
Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Versuch: RO Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010 Rotation Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung 2 2 Allgemeine Grundlagen 2 2.1
Aufgabe 7: Stochastik (WTR)
 Abitur Mathematik: Nordrhein-Westfalen 2013 Aufgabe 7 a) SITUATION MODELLIEREN Annahmen: Es werden 100 Personen unabhängig voneinander befragt. Auf die Frage, ob mindestens einmal im Monat ein Fahrrad
Abitur Mathematik: Nordrhein-Westfalen 2013 Aufgabe 7 a) SITUATION MODELLIEREN Annahmen: Es werden 100 Personen unabhängig voneinander befragt. Auf die Frage, ob mindestens einmal im Monat ein Fahrrad
Mathematische Grundlagen der dynamischen Simulation
 Mathematische Grundlagen der dynamischen Simulation Dynamische Systeme sind Systeme, die sich verändern. Es geht dabei um eine zeitliche Entwicklung und wie immer in der Informatik betrachten wir dabei
Mathematische Grundlagen der dynamischen Simulation Dynamische Systeme sind Systeme, die sich verändern. Es geht dabei um eine zeitliche Entwicklung und wie immer in der Informatik betrachten wir dabei
 Prüfanleitung UCM Version 100712 Diese Prüfanleitung dient zur Prüfung der Schutzeinrichtung zur Verhinderung einer unbeabsichtigten Bewegung von der Haltestelle weg, wenn die Schachttür nicht verriegelt
Prüfanleitung UCM Version 100712 Diese Prüfanleitung dient zur Prüfung der Schutzeinrichtung zur Verhinderung einer unbeabsichtigten Bewegung von der Haltestelle weg, wenn die Schachttür nicht verriegelt
Tutorium Physik 1. Kinematik, Dynamik
 1 Tutorium Physik 1. Kinematik, Dynamik WS 15/16 1.Semester BSc. Oec. und BSc. CH 56 KINEMATIK, DYNAMIK (II) 2.16 Bungee-Sprung von der Brücke: Aufgabe (***) 57 Beim Sprung von der Europabrücke wird nach
1 Tutorium Physik 1. Kinematik, Dynamik WS 15/16 1.Semester BSc. Oec. und BSc. CH 56 KINEMATIK, DYNAMIK (II) 2.16 Bungee-Sprung von der Brücke: Aufgabe (***) 57 Beim Sprung von der Europabrücke wird nach
SQL. Datendefinition
 SQL Datendefinition Die Organisation einer Datenbank basiert auf einer Anzahl verschiedener Objekte. Diese können physikalischer oder logischer Natur sein. Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der
SQL Datendefinition Die Organisation einer Datenbank basiert auf einer Anzahl verschiedener Objekte. Diese können physikalischer oder logischer Natur sein. Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der
zu 2.1 / I. Wiederholungsaufgaben zur beschleunigten Bewegung
 Fach: Physik/ L. Wenzl Datum: zu 2.1 / I. Wiederholungsaufgaben zur beschleunigten Bewegung Aufgabe 1: Ein Auto beschleunigt gleichmäßig in 12,0 s von 0 auf 100 kmh -1. Welchen Weg hat es in dieser Zeit
Fach: Physik/ L. Wenzl Datum: zu 2.1 / I. Wiederholungsaufgaben zur beschleunigten Bewegung Aufgabe 1: Ein Auto beschleunigt gleichmäßig in 12,0 s von 0 auf 100 kmh -1. Welchen Weg hat es in dieser Zeit
Übung zur Vorlesung Grundlagen der Fahrzeugtechnik I. Übung
 Institut für Fahrzeugsystemtechnik Teilinstitut Fahrzeugtechnik Leiter: Prof. Dr. rer. nat. Frank Gauterin Rintheimer Querallee 2 76131 Karlsruhe Übung zur Vorlesung Grundlagen der Fahrzeugtechnik I Übung
Institut für Fahrzeugsystemtechnik Teilinstitut Fahrzeugtechnik Leiter: Prof. Dr. rer. nat. Frank Gauterin Rintheimer Querallee 2 76131 Karlsruhe Übung zur Vorlesung Grundlagen der Fahrzeugtechnik I Übung
Schiefe Ebene / Energieerhaltung
 GP_A0093 Nr. 5: 1. Eine Stahlkugel der Masse 2,5 kg wird in der gezeichneten Lage von einem ortsfesten Elektromagneten gehalten. Der Strom wird nun abgeschaltet und die Kugel rollt den Abhang hinunter.
GP_A0093 Nr. 5: 1. Eine Stahlkugel der Masse 2,5 kg wird in der gezeichneten Lage von einem ortsfesten Elektromagneten gehalten. Der Strom wird nun abgeschaltet und die Kugel rollt den Abhang hinunter.
ETH-Aufnahmeprüfung Herbst Physik U 1. Aufgabe 1 [4 pt + 4 pt]: zwei unabhängige Teilaufgaben
![ETH-Aufnahmeprüfung Herbst Physik U 1. Aufgabe 1 [4 pt + 4 pt]: zwei unabhängige Teilaufgaben ETH-Aufnahmeprüfung Herbst Physik U 1. Aufgabe 1 [4 pt + 4 pt]: zwei unabhängige Teilaufgaben](/thumbs/64/51931310.jpg) ETH-Aufnahmeprüfung Herbst 2015 Physik Aufgabe 1 [4 pt + 4 pt]: zwei unabhängige Teilaufgaben U 1 V a) Betrachten Sie den angegebenen Stromkreis: berechnen Sie die Werte, die von den Messgeräten (Ampere-
ETH-Aufnahmeprüfung Herbst 2015 Physik Aufgabe 1 [4 pt + 4 pt]: zwei unabhängige Teilaufgaben U 1 V a) Betrachten Sie den angegebenen Stromkreis: berechnen Sie die Werte, die von den Messgeräten (Ampere-
Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung AHS. 15. Jänner Mathematik. Teil-2-Aufgaben. Korrekturheft
 Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung AHS 15. Jänner 2016 Mathematik Teil-2-Aufgaben Korrekturheft Aufgabe 1 Quadratische Gleichungen und ihre Lösungen p = ( 1 z + z ) q = 1 z
Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung AHS 15. Jänner 2016 Mathematik Teil-2-Aufgaben Korrekturheft Aufgabe 1 Quadratische Gleichungen und ihre Lösungen p = ( 1 z + z ) q = 1 z
Was versteht man unter Bewegung?
 Bewegungen Was versteht man unter Bewegung? Beobachten: Beschreiben: Ortsveränderung in einer bestimmten Zeit Messen: Objektivierte Darstellung durch Vergleiche mit allgemein gültigen Standards: Längenmaß,
Bewegungen Was versteht man unter Bewegung? Beobachten: Beschreiben: Ortsveränderung in einer bestimmten Zeit Messen: Objektivierte Darstellung durch Vergleiche mit allgemein gültigen Standards: Längenmaß,
3 Einspeisemodule 3.6 Kondensatormodul mit 4,1 mf oder 20 mf Beschreibung
 02.01 3 Einspeisemodule Beschreibung Die Kondensatormodule dienen zur Erhöhung der Zwischenkreiskapazität. Es kann damit zum einen ein kurzzeitiger Netzausfall überbrückt werden und zum anderen ist eine
02.01 3 Einspeisemodule Beschreibung Die Kondensatormodule dienen zur Erhöhung der Zwischenkreiskapazität. Es kann damit zum einen ein kurzzeitiger Netzausfall überbrückt werden und zum anderen ist eine
PP Physikalisches Pendel
 PP Physikalisches Pendel Blockpraktikum Frühjahr 2007 (Gruppe 2) 25. April 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 2 Theoretische Grundlagen 2 2.1 Ungedämpftes physikalisches Pendel.......... 2 2.2 Dämpfung
PP Physikalisches Pendel Blockpraktikum Frühjahr 2007 (Gruppe 2) 25. April 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 2 Theoretische Grundlagen 2 2.1 Ungedämpftes physikalisches Pendel.......... 2 2.2 Dämpfung
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung
 Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Dr. Jochen Köhler 1 Inhalt der heutigen Vorlesung Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Zusammenfassung der vorherigen Vorlesung Übersicht über Schätzung und
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Dr. Jochen Köhler 1 Inhalt der heutigen Vorlesung Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Zusammenfassung der vorherigen Vorlesung Übersicht über Schätzung und
Erstellung von Aufzugenergiezertifikaten nach VDI 4707
 E t ll A f i tifik t h Erstellung von Aufzugenergiezertifikaten nach VDI 4707 Ausstellung des Aufzugs-Energiezertifikats Wofür ist das Aufzugsenergiezertifikat gedacht? Wie ist das Aufzugs-Energiezertifikat
E t ll A f i tifik t h Erstellung von Aufzugenergiezertifikaten nach VDI 4707 Ausstellung des Aufzugs-Energiezertifikats Wofür ist das Aufzugsenergiezertifikat gedacht? Wie ist das Aufzugs-Energiezertifikat
1.1 Eindimensionale Bewegung. Aufgaben
 1.1 Eindimensionale Bewegung Aufgaben Aufgabe 1: Fahrzeug B fährt mit der Geschwindigkeit v B am Punkt Q vorbei und fährt anschließend mit konstanter Geschwindigkeit weiter. Eine Zeitspanne Δt später fährt
1.1 Eindimensionale Bewegung Aufgaben Aufgabe 1: Fahrzeug B fährt mit der Geschwindigkeit v B am Punkt Q vorbei und fährt anschließend mit konstanter Geschwindigkeit weiter. Eine Zeitspanne Δt später fährt
Neues zum Blitzschutz (Teil 1)
 Neues zum Blitzschutz (Teil 1) Im Oktober 2006 ist die neue Normenreihe DIN EN 62305 (DIN VDE 0185-305) erschienen mit der die bisherigen Vornormen der Reihe DIN V VDE 0185 vom November 2002 ersetzt werden.
Neues zum Blitzschutz (Teil 1) Im Oktober 2006 ist die neue Normenreihe DIN EN 62305 (DIN VDE 0185-305) erschienen mit der die bisherigen Vornormen der Reihe DIN V VDE 0185 vom November 2002 ersetzt werden.
Rotationsgerät. Wir können 4 Parameter variieren, die die Beschleunigung des Systems beeinflussen:
 Rotationsgerät Übersicht Mit diesem Gerät wird der Einfluss eines Moments auf einen rotierenden Körper untersucht. Das Gerät besteht aus einer auf Kugellagern in einem stabilen Rahmen gelagerten Vertikalachse.
Rotationsgerät Übersicht Mit diesem Gerät wird der Einfluss eines Moments auf einen rotierenden Körper untersucht. Das Gerät besteht aus einer auf Kugellagern in einem stabilen Rahmen gelagerten Vertikalachse.
Frequenzumrichter Baureihe MFC Quick Check
 Inhalt und Schnellübersicht 1. Überprüfung der anlagespezifischen Daten am Umrichter 2. Mögliche Fehler und ihre Behebung 3. Hinweise auf weitere Kontrollmöglichkeiten 4. Fehlermeldungen im Fehlerstapel
Inhalt und Schnellübersicht 1. Überprüfung der anlagespezifischen Daten am Umrichter 2. Mögliche Fehler und ihre Behebung 3. Hinweise auf weitere Kontrollmöglichkeiten 4. Fehlermeldungen im Fehlerstapel
Zweidimensionale Normalverteilung
 Theorie Zweidimensionale Normalverteilung Ein Beispiel aus dem Mercedes-Benz Leitfaden LF1236 Fallbeispiel Abnahme einer Wuchtmaschine In Wuchtmaschine sem Abschnitt beschrieben. beispielhaft Abnahme einer
Theorie Zweidimensionale Normalverteilung Ein Beispiel aus dem Mercedes-Benz Leitfaden LF1236 Fallbeispiel Abnahme einer Wuchtmaschine In Wuchtmaschine sem Abschnitt beschrieben. beispielhaft Abnahme einer
M1 Maxwellsches Rad. 1. Grundlagen
 M1 Maxwellsches Rad Stoffgebiet: Translations- und Rotationsbewegung, Massenträgheitsmoment, physikalisches Pendel. Versuchsziel: Es ist das Massenträgheitsmoment eines Maxwellschen Rades auf zwei Arten
M1 Maxwellsches Rad Stoffgebiet: Translations- und Rotationsbewegung, Massenträgheitsmoment, physikalisches Pendel. Versuchsziel: Es ist das Massenträgheitsmoment eines Maxwellschen Rades auf zwei Arten
3. Impuls und Drall. Prof. Dr. Wandinger 2. Kinetik des Massenpunkts Dynamik 2.3-1
 3. Impuls und Drall Die Integration der Bewegungsgleichung entlang der Bahn führte auf die Begriffe Arbeit und Energie. Die Integration der Bewegungsgleichung bezüglich der Zeit führt auf die Begriffe
3. Impuls und Drall Die Integration der Bewegungsgleichung entlang der Bahn führte auf die Begriffe Arbeit und Energie. Die Integration der Bewegungsgleichung bezüglich der Zeit führt auf die Begriffe
Zusammenfassung zur Konvergenz von Folgen
 Zusammenfassung zur Konvergenz von Folgen. Definition des Konvergenzbegriffs Eine Folge reeller Zahlen a n n heißt konvergent gegen a in Zeichen a n = a, falls gilt > 0 n 0 n n 0 : an a < Hinweise: Bei
Zusammenfassung zur Konvergenz von Folgen. Definition des Konvergenzbegriffs Eine Folge reeller Zahlen a n n heißt konvergent gegen a in Zeichen a n = a, falls gilt > 0 n 0 n n 0 : an a < Hinweise: Bei
Lösung 10 Punkte Teil a) Auch bei Fortsetzung der Folge der Quadratzahlen liefert die zweite Differenzenfolge
 0 Mathematik-Olympiade Stufe (Schulstufe) Klasse 9 0 Lösungen c 00 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden ev wwwmathematik-olympiadende Alle Rechte vorbehalten 00 Lösung 0 Punkte Teil a) Auch bei
0 Mathematik-Olympiade Stufe (Schulstufe) Klasse 9 0 Lösungen c 00 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden ev wwwmathematik-olympiadende Alle Rechte vorbehalten 00 Lösung 0 Punkte Teil a) Auch bei
Service & Support. Motorprojektierung mit SIZER und Berücksichtigung der Auslastung des eingesetzten Fremdmotors. Retrofit Ersetzen eines Fremdmotors
 Deckblatt Motorprojektierung mit SIZER und Berücksichtigung der Auslastung des eingesetzten Fremdmotors Retrofit Ersetzen eines Fremdmotors FAQ Januar 2012 Service & Support Answers for industry. Fragestellung
Deckblatt Motorprojektierung mit SIZER und Berücksichtigung der Auslastung des eingesetzten Fremdmotors Retrofit Ersetzen eines Fremdmotors FAQ Januar 2012 Service & Support Answers for industry. Fragestellung
Trägheitsmoment - Steinerscher Satz
 Trägheitsmoment - Steinerscher Satz Gruppe 4: Daniela Poppinga, Jan Christoph Bernack Betreuerin: Natalia Podlaszewski 13. Januar 2009 1 Inhaltsverzeichnis 1 Theorieteil 3 1.1 Frage 2................................
Trägheitsmoment - Steinerscher Satz Gruppe 4: Daniela Poppinga, Jan Christoph Bernack Betreuerin: Natalia Podlaszewski 13. Januar 2009 1 Inhaltsverzeichnis 1 Theorieteil 3 1.1 Frage 2................................
Energieeffizienz und Fahrqualität. Ulrich Nees 1
 Energieeffizienz und Fahrqualität 1 Vorwort: Thema des Vortrages ist es, das Zusammenspiel zwischen Fahrqualität und Leistungsbedarf von Aufzuganlagen unter Berücksichtigung der Konstruktion, eingesetzter
Energieeffizienz und Fahrqualität 1 Vorwort: Thema des Vortrages ist es, das Zusammenspiel zwischen Fahrqualität und Leistungsbedarf von Aufzuganlagen unter Berücksichtigung der Konstruktion, eingesetzter
Einführung. Ablesen von einander zugeordneten Werten
 Einführung Zusammenhänge zwischen Größen wie Temperatur, Geschwindigkeit, Lautstärke, Fahrstrecke, Preis, Einkommen, Steuer etc. werden mit beschrieben. Eine Zuordnung f, die jedem x A genau ein y B zuweist,
Einführung Zusammenhänge zwischen Größen wie Temperatur, Geschwindigkeit, Lautstärke, Fahrstrecke, Preis, Einkommen, Steuer etc. werden mit beschrieben. Eine Zuordnung f, die jedem x A genau ein y B zuweist,
Einführung in die linearen Funktionen. Autor: Benedikt Menne
 Einführung in die linearen Funktionen Autor: Benedikt Menne Inhaltsverzeichnis Vorwort... 3 Allgemeine Definition... 3 3 Bestimmung der Steigung einer linearen Funktion... 4 3. Bestimmung der Steigung
Einführung in die linearen Funktionen Autor: Benedikt Menne Inhaltsverzeichnis Vorwort... 3 Allgemeine Definition... 3 3 Bestimmung der Steigung einer linearen Funktion... 4 3. Bestimmung der Steigung
Übung zu Mechanik 3 Seite 36
 Übung zu Mechanik 3 Seite 36 Aufgabe 61 Ein Faden, an dem eine Masse m C hängt, wird über eine Rolle mit der Masse m B geführt und auf eine Scheibe A (Masse m A, Radius R A ) gewickelt. Diese Scheibe rollt
Übung zu Mechanik 3 Seite 36 Aufgabe 61 Ein Faden, an dem eine Masse m C hängt, wird über eine Rolle mit der Masse m B geführt und auf eine Scheibe A (Masse m A, Radius R A ) gewickelt. Diese Scheibe rollt
Auswahl und sicherer Einsatz von Atemschutzgeräten Infoblatt 6: Einsatzgrenzen bei thermischer Belastung
 Auswahl und sicherer Einsatz von Atemschutzgeräten Infoblatt 6: Atemschutzgeräte sind für Umgebungstemperaturen von - 30 C bis + 60 C geprüft und zugelassen. Atemschutzgeräte, die speziell für Temperaturen
Auswahl und sicherer Einsatz von Atemschutzgeräten Infoblatt 6: Atemschutzgeräte sind für Umgebungstemperaturen von - 30 C bis + 60 C geprüft und zugelassen. Atemschutzgeräte, die speziell für Temperaturen
Mathematischer Vorkurs Lösungen zum Übungsblatt 5
 Mathematischer Vorkurs Lösungen zum Übungsblatt 5 Prof. Dr. Norbert Pietralla/Sommersemester 2012 c.v.meister@skmail.ikp.physik.tu-darmstadt.de Aufgabe 1: Berechnen Sie den Abstand d der Punkte P 1 und
Mathematischer Vorkurs Lösungen zum Übungsblatt 5 Prof. Dr. Norbert Pietralla/Sommersemester 2012 c.v.meister@skmail.ikp.physik.tu-darmstadt.de Aufgabe 1: Berechnen Sie den Abstand d der Punkte P 1 und
Seminar Landtechnik 09. Juli 2009
 Seminar Landtechnik 09. Juli 2009 Anforderungen und Entwicklung der Bremsentechnologie für Traktoren und Anhänger EG-Vorschriften für Traktoren und Anhänger Regelwerke für Bremsanlagen an Traktoren, Anhängern
Seminar Landtechnik 09. Juli 2009 Anforderungen und Entwicklung der Bremsentechnologie für Traktoren und Anhänger EG-Vorschriften für Traktoren und Anhänger Regelwerke für Bremsanlagen an Traktoren, Anhängern
Mathematik 2 Probeprüfung 1
 WWZ Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Basel Dr. Thomas Zehrt Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen: Name Vorname Mathematik 2 Probeprüfung 1 Zeit: 90 Minuten, Maximale Punktzahl: 72 Zur
WWZ Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Basel Dr. Thomas Zehrt Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen: Name Vorname Mathematik 2 Probeprüfung 1 Zeit: 90 Minuten, Maximale Punktzahl: 72 Zur
Selbst-Test zur Vorab-Einschätzung zum Vorkurs Physik für Mediziner
 Liebe Studierende der Human- und Zahnmedizin, mithilfe dieses Tests können Sie selbst einschätzen, ob Sie den Vorkurs besuchen sollten. Die kleine Auswahl an Aufgaben spiegelt in etwa das Niveau des Vorkurses
Liebe Studierende der Human- und Zahnmedizin, mithilfe dieses Tests können Sie selbst einschätzen, ob Sie den Vorkurs besuchen sollten. Die kleine Auswahl an Aufgaben spiegelt in etwa das Niveau des Vorkurses
Exemplar für Prüfer/innen
 Exemplar für Prüfer/innen Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Juni 2015 Mathematik Kompensationsprüfung Angabe für Prüfer/innen Hinweise zur Kompensationsprüfung
Exemplar für Prüfer/innen Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Juni 2015 Mathematik Kompensationsprüfung Angabe für Prüfer/innen Hinweise zur Kompensationsprüfung
und damit wieder eine rationale Zahl.
 4 Aufgabenlösungen 41 Lösungen zu den Typ-1-Aufgaben Inhaltsbereich Algebra und Geometrie 211 Die Menge der natürlichen Zahlen N = {, 1, 2, 3, } Die Menge der natürlichen Zahlen ohne die Zahl Null N* =
4 Aufgabenlösungen 41 Lösungen zu den Typ-1-Aufgaben Inhaltsbereich Algebra und Geometrie 211 Die Menge der natürlichen Zahlen N = {, 1, 2, 3, } Die Menge der natürlichen Zahlen ohne die Zahl Null N* =
Club Apollo Wettbewerb Musterlösung zu Aufgabe 3. Diese Musterlösung beinhaltet Schülerlösungen aus dem 11. Wettbewerb (2011/2012).
 Club Apollo 13-14. Wettbewerb Musterlösung zu Aufgabe 3 Diese Musterlösung beinhaltet Schülerlösungen aus dem 11. Wettbewerb (2011/2012). Aufgabe a) 1) 70000,0000 Temperatur 60000,0000 50000,0000 40000,0000
Club Apollo 13-14. Wettbewerb Musterlösung zu Aufgabe 3 Diese Musterlösung beinhaltet Schülerlösungen aus dem 11. Wettbewerb (2011/2012). Aufgabe a) 1) 70000,0000 Temperatur 60000,0000 50000,0000 40000,0000
Protokoll zum Versuch: Atwood'sche Fallmaschine
 Protokoll zum Versuch: Atwood'sche Fallmaschine Fabian Schmid-Michels Nils Brüdigam Universität Bielefeld Wintersemester 2006/2007 Grundpraktikum I 11.01.2007 Inhaltsverzeichnis 1 Ziel 2 2 Theorie 2 3
Protokoll zum Versuch: Atwood'sche Fallmaschine Fabian Schmid-Michels Nils Brüdigam Universität Bielefeld Wintersemester 2006/2007 Grundpraktikum I 11.01.2007 Inhaltsverzeichnis 1 Ziel 2 2 Theorie 2 3
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung
 Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Übung 7 1 Inhalt der heutigen Übung Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Vorrechnen der Hausübung D.9 Gemeinsames Lösen der Übungsaufgaben D.10: Poissonprozess
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Übung 7 1 Inhalt der heutigen Übung Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Vorrechnen der Hausübung D.9 Gemeinsames Lösen der Übungsaufgaben D.10: Poissonprozess
1 Messfehler. 1.1 Systematischer Fehler. 1.2 Statistische Fehler
 1 Messfehler Jede Messung ist ungenau, hat einen Fehler. Wenn Sie zum Beispiel die Schwingungsdauer eines Pendels messen, werden Sie - trotz gleicher experimenteller Anordnungen - unterschiedliche Messwerte
1 Messfehler Jede Messung ist ungenau, hat einen Fehler. Wenn Sie zum Beispiel die Schwingungsdauer eines Pendels messen, werden Sie - trotz gleicher experimenteller Anordnungen - unterschiedliche Messwerte
Länge der Feder (unbelastet): l 0 = 15 cm; Aus dem hookeschen Gesetz errechnet man die Ausdehnung s:
 Die Federkonstante ist für jede Feder eine charakteristische Größe und beschreibt den Härtegrad der Feder. Je größer bzw. kleiner die Federkonstante ist, desto härter bzw. weicher ist die Feder. RECHENBEISPIEL:
Die Federkonstante ist für jede Feder eine charakteristische Größe und beschreibt den Härtegrad der Feder. Je größer bzw. kleiner die Federkonstante ist, desto härter bzw. weicher ist die Feder. RECHENBEISPIEL:
Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung. Mathematik. Korrekturheft zur Probeklausur März 2014.
 Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung Mathematik Korrekturheft zur Probeklausur März 2014 Teil-2-Aufgaben Aufgabe 1 Radfahrerin a) Lösungserwartung: v'(t) = 2 9 t + 4 3 v'(2) =
Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung Mathematik Korrekturheft zur Probeklausur März 2014 Teil-2-Aufgaben Aufgabe 1 Radfahrerin a) Lösungserwartung: v'(t) = 2 9 t + 4 3 v'(2) =
Modellschularbeit. Mathematik. März Teil-2-Aufgaben. Korrekturheft
 Modellschularbeit Mathematik März 2014 Teil-2-Aufgaben Korrekturheft Aufgabe 1 Druckmessung in einem Behälter a) Lösungserwartung: Momentane Änderungsrate zum Zeitpunkt t = 12: p(t) = 1 64 t 3 3 16 t 2
Modellschularbeit Mathematik März 2014 Teil-2-Aufgaben Korrekturheft Aufgabe 1 Druckmessung in einem Behälter a) Lösungserwartung: Momentane Änderungsrate zum Zeitpunkt t = 12: p(t) = 1 64 t 3 3 16 t 2
Abbildung 4-9-1: Die Sound-Machine-Tastatur und der Arduino
 Projekt 4-9: Sound-Machine 4 9 Was hältst du davon, wenn wir Scratch in diesem Kapitel dazu bewegen, etwas Musik zu spielen? Natürlich nicht von alleine, sondern über eine kleine selbstgebaute Tastatur.
Projekt 4-9: Sound-Machine 4 9 Was hältst du davon, wenn wir Scratch in diesem Kapitel dazu bewegen, etwas Musik zu spielen? Natürlich nicht von alleine, sondern über eine kleine selbstgebaute Tastatur.
Satz über implizite Funktionen und seine Anwendungen
 Satz über implizite Funktionen und seine Anwendungen Gegeben sei eine stetig differenzierbare Funktion f : R 2 R, die von zwei Variablen und abhängt. Wir betrachten im Folgenden die Gleichung f(,) = 0.
Satz über implizite Funktionen und seine Anwendungen Gegeben sei eine stetig differenzierbare Funktion f : R 2 R, die von zwei Variablen und abhängt. Wir betrachten im Folgenden die Gleichung f(,) = 0.
8. Statistik Beispiel Noten. Informationsbestände analysieren Statistik
 Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
In den letzten zwei Abschnitten wurde die tatsächliche Häufigkeitsverteilung bzw. prozentuale Häufigkeitsverteilung abgehandelt.
 .3.3 Theoretisch-prozentuale Häufigkeitsverteilung In den letzten zwei Abschnitten wurde die tatsächliche Häufigkeitsverteilung bzw. prozentuale Häufigkeitsverteilung abgehandelt. Charakteristisch für
.3.3 Theoretisch-prozentuale Häufigkeitsverteilung In den letzten zwei Abschnitten wurde die tatsächliche Häufigkeitsverteilung bzw. prozentuale Häufigkeitsverteilung abgehandelt. Charakteristisch für
Übungsblatt IX Veröffentlicht:
 Pendel Eine Kugel der Masse m und Geschwindigkeit v durchschlägt eine Pendelscheibe der Masse M. Hinter der Scheibe hat die Kugel die Geschwindigkeit v/2. Die Pendelscheibe hängt an einem steifen Stab
Pendel Eine Kugel der Masse m und Geschwindigkeit v durchschlägt eine Pendelscheibe der Masse M. Hinter der Scheibe hat die Kugel die Geschwindigkeit v/2. Die Pendelscheibe hängt an einem steifen Stab
Wie lange wird unsere Warmzeit, das Holozän, noch dauern?
 Wie lange wird unsere Warmzeit, das Holozän, noch dauern? Das Klima der vergangenen vielen Hunderttausend Jahre ist gekennzeichnet durch die Abwechslung von Warmzeiten und Eiszeiten, wie Bild 1 zeigt.
Wie lange wird unsere Warmzeit, das Holozän, noch dauern? Das Klima der vergangenen vielen Hunderttausend Jahre ist gekennzeichnet durch die Abwechslung von Warmzeiten und Eiszeiten, wie Bild 1 zeigt.
PW2 Grundlagen Vertiefung. Kinematik und Stoÿprozesse Version
 PW2 Grundlagen Vertiefung Kinematik und Stoÿprozesse Version 2007-09-03 Inhaltsverzeichnis 1 Vertiefende Grundlagen zu den Experimenten mit dem Luftkissentisch 1 1.1 Begrie.....................................
PW2 Grundlagen Vertiefung Kinematik und Stoÿprozesse Version 2007-09-03 Inhaltsverzeichnis 1 Vertiefende Grundlagen zu den Experimenten mit dem Luftkissentisch 1 1.1 Begrie.....................................
Gutachterliche Empfehlung für Pressverbindungen in Seilgärten
 Siebert Consulting Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Outdoor-Trainings/Erlebnispädagogik und Ropes Courses TEL.: (+43) 664 102 8487 FAX: (+43) - 1 545 32 00 32 http://www.siebert.at
Siebert Consulting Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Outdoor-Trainings/Erlebnispädagogik und Ropes Courses TEL.: (+43) 664 102 8487 FAX: (+43) - 1 545 32 00 32 http://www.siebert.at
