Hauptseminar zu Turbulenz in Plasmen Numerische Simulation
|
|
|
- Eike Lenz
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Hauptseminar zu Turbulenz in Plasmen Numerische Simulation Felix Spanier 14. Juni 2001
2 Allg. Form der t u + (u )u ν u = p (1) u = 0 Inkompressibilität (2) Nimmt man nun die Divergenz dieser Gleichung und nutzt dabei aus, daß u = 0 (Inkompressibilität) und u = 0, so erhält man: p = (u )u (3) p = 1 ( (u )u) (4) P = 1 (5) Man erhält p durch Anwenden dieses Operators auf die Inhomogenität. t u + (u )u ν u = P ( (u )u) (6) Interessant ist noch die Formulierung in Tensornotation: t u i ν u i = 1 2 P ijm( )(u j u m ) (7) P ijm ( ) = P ij ( ) + P im ( ) (8) x m x j P ij ( ) = δ ij 1 2 x i x j (9)
3 1.2. Fouriertransformation Die Fouriertransformation hilft an dieser Stelle weiter, da sie Differentiationen in Multiplikationen überführt. Anwenden der FT liefert: ( t νk 2 )u i (k) = M ijm (k) k=p+q u j (p)u m (q) (10) mit M ijm = i 2 P ijm(k) (11) P ijm (k) = k m P ij (k) + k j P im (k) (12) P ij (k) = δ ij k ik j k 2 (13) Die Summe muß die Dreiecksbedingung k = p + q erfüllen. Durch die Gleichung wird nur Energie vernichtet (durch Viskosität), daher kann keine stationäre Turbulenz entstehen. Da in realen Systemen auf großen Skalen Energie zugeführt wird, wird zu Gleichung 10 ein hypothetischer Kraftterm hinzugefügt, der homogen und isotrop sein soll: ( t νk 2 )u i (k) = M ijm (k) u j (p)u m (q) + f i (k) (14) k=p+q
4 1.3. Korrelationstensor Das turbulente Feld kann durch Korrelationen vollständig beschrieben werden: u i (x) u i (x)u j (x ) u i (x)u j (x )u m (x ) mittlere Geschwindigkeit Zweierkorrelation Dreierkorrelation Für isotrope Turbulenz u i (x) = 0 Um Aussagen über die Energie zu machen, benötigen wir die Fouriertransformierte der Zweierkorrelation: u i (k)u j (k ) = δ(k + k )P ij (k)q(k) (15) Wählen wir nun x = x : u i (x)u j (x) = q ij (0) = = = Zusammenhang mit der Energie: = 8π 3 δ ij d 3 k d 3 k u i (k)u j (k ) exp(i(k + k ) x) (16) d 3 kp ij (k)q(k) (17) d 3 k(δ ij k ik j )q(k) (18) k2 1 2 u i(x)u i (x) = 0 k 2 q(k)dk (19) 0 E(k)dk (20) E(k) = 4πk 2 q(k) (21)
5 1.4. Zeitabhängigkeit Erweiterung der Zweier-Korrelation um zeitabhängige Terme: u i (k, t)u j (k, t ) = δ(k + k )Q ij (k, t, t ) (22) Zur Lösung des Problems folgende Schritte: multipliziere mit u n ( k, t) addiere mit derselben Gleichung, i und n vertauscht ( t 2νk 2 ) u i (k, t)u n ( k, t) = (23) ( t 2νk 2 )E(k, t) = T (k, t) + Kraftterme (24) T ist ein Transportterm, der in Bereichen mit zu vernachlässigender Viskosität zum Tragen kommt. Energie vernichtet wir nur durchden Term 2νk 2 E(k, t), daher ist die gesamte Dissipationsrate: ɛ = 0 dk2νk 2 E(k) (25)
6 2. Unterscheidung dreier Energiebereiche: Produktionsbereich liegt bei kleinen Wellenzahlen (großen Skalen) vor. Energie wird zugeführt Inertialbereich mittlere Wellenzahlen, der Transportterm T bewirkt den Energietransport von kleinen zu großen Wellenzahlen Dissipationsbereich große Wellenzahlen, Energie wird vernichtet. Energiespektrum
7 2.1. Längenskalen k D = k = ( ɛ ) 1 4 ν 3 Dissipationslänge (26) 1 L = Gefäßlänge (27) L E 3 2 k I = ɛ Integrallänge (28) k I < k Inertia < k D Inertialbereich (29) k 2 u 2 T = ( u) 2 Taylor-Mikroskala (30) u = ω Vortizität (31) Die Dissipationslänge k D hängt nur von Dissipation ɛ und Viskosität ν ab. Die Integrallänge k I hingegen nur von Energie E und Produktionsrate (Energietransfer) ɛ. Aus den Längenskalen läßt sich die Kenngröße für Strömungen, die Reynolds-Zahl bestimmen: Re = v l ν = 2 ( kd k I ) 4 3 (32) v = 2E (33) Re T = vλ T v = Re (34) ν νk T
8 2.2. Hypothese von Kolmogorov Aussagen über das Energiespektrum mit Hilfe der Hypothesn von Kolmogorov: 1. Inertial- und Dissipationsbereich sind unabhängig davon, wie Energie im Produktionsbereich zugeführt wird. Es existiert ein stationärer Zustand mit von großen zu kleinen Skalen Produktionsrate = Dissipationsrate 2. Die ist lokal bzgl. der Wellenzahl, d.h. der Energiefluß ist gleich der Dissipationsrate Da nun E(k) = E(k, ν, Π = ɛ), kann man aus der Dimensionsanalyse erhalten: E(k) = g(ν 3 4 ɛ 1 4 k)ɛ 2 3 k 5 3 (35) Im Inertialbereich ist das Spektrum unabhängig von ν, damit wird g zu einer Konstanten: Ko = 1.44, die Kolmogorov-Konstante Skalensymetrie Betrachet man den Übergang r λr und die weiteren Übergänge: r λr u λ h u t λ 1 h t p λ 2h p ν λ 1+h ν für λ > 0 Unter Ausnutzung der Hypothese von Kolmogorov (ɛ ist lokal) folgt: ɛ = 2ν u 2 dω = λ 1+h λ 2(h 1) ɛ (36) h = 1 3 (37)
9 Führen wir nun mit dieser Skalierung die Strukturfunktion ein: (u(r + l) u(r)) p l ξp (38) Skalierung: (u(r + l) u(r)) p = (u (λr + λl) u (λr)) p (39) l ξp = λ ph (λ l) ξp (40) ξ p = ph = p 3 (41) p = 2 entpsricht der Energie, mit Hilfe der Fouriertransformation erhalten wir: E(k) k (2h+1) = k 5 3 (42) Man kann h auch über die Dimensionsbetrachtung vo ɛ gewinnen: Gesetz ɛ T = E t = u3 l u l 1 3 h = 1 3 Mit der Strukturfunktion 2. Ordnung läßt sich folgende Aussage treffen: (43) (44) u(r + l) 2 = u(r) 2 Homogenität (45) (δu(l)) 2 = 2( u 2 u(r + l)u(r) ) (46) Einsetzen der Fouriertransformierten liefert: (δu(l)) 2 0 (1 sin(kl) )E(k)dk (47) kl
10 Von Bedeutung ist auch das 4 5 -Gesetz: Ansatz: E k τ (48) (δu(l)) 2 l 2 3 (49) (δu(l)) 3 = 4 ɛl (50) Enstrophie In 2D-Systemen ist neben der Energie die Enstrophie eine Erhaltungsgröße. V = dω( u) z Enstrophie (51) = dω ω 2 (52) = 0 dk k 2 E(k) (53) Enstrophie führt zu einer umgekehrten Kaskade und zu dem Spektrum E(k) η 2 3 k 3 (54) η = Ck 2 ɛ Enstrophietransferrate (55) Die Einführung der Enstrophietransferrate führt auch zu neuen Definitionen der Längenskalen: k D = k D (η, ν) = ( η ν 3 ) 1 6 (56)
11 k I = k I (η, E) = η 1 3 E 1 2 (57) Re = 2 ( kd k I ) 2 (58)
12 3. Die u t + u u x = ν 2 u x 2 (59) ist erst einmal kein Beispiel für ein System mit Kolmogorov-Turbulenz: nur lokale Interaktion keine Turbulenz ohne äußere Kraft Um das Kolmogorov-Verhalten zu erhalten werden zwei Änderungen vorgenommen: u t + u u x = ν( 1)p+1 2p u + f allg. Form (60) x2p f(k, t) = A f t k 1 2 σk (61) f k ist eine zufällige gaußverteilte Kraft, die der Bedingung f(k, t)f(k, t ) = 2(2π) 2 Dk 1 δ(k + k )δ(t t ) (62) genügt. Die Darstellung erfolgte im Fourierraum.
13 4. EMHD beschreibt die Elektronenbewegung im Plasma vor statischem Ionenhintergrund mit Hilfe der Fluiddynamik. Im Gegensatz zu einem normalen Fluid müssen durch die Elektronenbewegung generierte Magnetfelder berücksichtigt werden Obwohl hier ein 2D-System betrachtet wird, ergibt sich ein Kolmogorov-Skalenverhalten. Eine Enstrophie-Kaskade ist nicht vorhanden. Darstellung von Magnet- und Geschwindigkeitsfeld durch B = e z ϕ und v = e z ψ. Daraus folgt in der Simulation (die hier 2D betrieben wird) t (ϕ d 2 eω) d 2 ev ω + B j = µ( ) ν ϕ (63) t (ψ d 2 ej) + d 2 ev (ψ d 2 ej) = µ( ) ν ψ (64) ω = ϕ (65) j = ψ (66) c d e ist die Electron Inertia Length ω pe L Ähnlich der wird hier Hyperdissipation benutzt. Die Enstrophie-Kaskade wird durch den Einfluß von ψ zerstört.
14 der Integration im Fourier-Raum Leapfrog-Crank-Nicholson Schema u n+1 k u n 1 k 2dt = i k 2 (u u)n k k 2 ν un+1 k u n 1 k 2 f n k (67) for (int i = 1; i < mx/2; i++) { double ki=2.*m_pi*i/(mx*dx); double ki2=pow(ki,4); tmp1(i)=((1.-dt*nu*ki2)*unm1(i) +2.*dt*(ki*tmp2(mx-i) + f(i)))/(1.+dt*nu*ki2); //Realteil tmp1(mx-i)=((1.-dt*nu*ki2)*unm1(mx-i) +2.*dt*(-ki*tmp2(i) + f(mx-i)))/(1.+dt*nu*ki2); //Imaginärteil } tmp1(0)=0; //0-Komponente von Hand auf 0 gesetzt Leapfrog-Stabilisierung durch Einführung des Schritts u n = 1 2 (un + u n 1 ) (68)
15 nach mehreren Integrationsschritten if (ic%leapfrogsteps) { un = tmp1; //un und tmp1 im k-raum un += unm1; un *= 0.5; } Einführen der zufälligen Kraft double lam=1./2000.*8192./mx; for (int i = 1; i <= mx/2; i++) { double ki=2.*m_pi*i/(mx*dx); double ranphase = 2.*M_PI*drand48(); f(i)=amp/sqrt(ki*dt)*cos(ranphase) *exp(-sqr(lam*ki)); f(mx-i)=amp/sqrt(ki*dt)*sin(ranphase) *exp(-sqr(lam*ki)); } f(0)=0; De-Aliasing der Fourier-Transformation durch 2/3-Regel
16 Die Null-Komponente von Geschwindigkeit und Kraft sind Null um die Isotropie zu gewährleisten Gesamtenergie des Systems Die Gesamtenergie des Systems ist nicht konstant, da die zufällige Kraft wirkt.
17 Energiespektrum
18 der EMHD Ablauf ähnlich der Integration im Fourierraum Berechnung über Hilfsfelder ϕ und ψ Änlicher Ablauf für die Imaginär-Anteile for (j = 0; j < my/3; j++) { ky = j; for (i = 0; i < mx/3; i++) { kx = i; k2 = sqr(kx)+sqr(ky); phi = omn.cmplx(i,j)/(1.+de2*k2); psi = jn.cmplx(i,j)/(1.+de2*k2); v_x.cmplx(i, j) =-iu*ky*phi; v_y.cmplx(i, j) = iu*kx*phi; b_x.cmplx(i, j) =-iu*ky*psi; b_y.cmplx(i, j) = iu*kx*psi; omtilde_x.cmplx(i, j)= iu*kx*omn.cmplx(i, j); omtilde_y.cmplx(i, j)= iu*ky*omn.cmplx(i, j); jtilde_x.cmplx(i, j) = iu*kx*jn.cmplx(i, j); jtilde_y.cmplx(i, j) = iu*ky*jn.cmplx(i, j); } }
19 for (j = 0; j < my; j++) { for (i = 0; i < mx; i++) { cfl = max(cfl, sqrt(sqr(v_x.real(i,j))+sqr(v_y.real(i,j)))*dt/twopi*mx); non_j.real(i,j) = v_x.real(i,j)*jtilde_x.real(i,j) + v_y.real(i,j)*jtilde_y.real(i,j); non_om.real(i,j) = v_x.real(i,j)*omtilde_x.real(i,j) + v_y.real(i,j)*omtilde_y.real(i,j) -(b_x.real(i,j)*jtilde_x.real(i,j) +b_y.real(i,j)*jtilde_y.real(i,j))/de2; } } Nichtlinearität wir im Realraum betrachtet Leapfrog wird auf beide Felder angewandt optimale Zeiteinteilung durch Bedingung 0.2 < max(v) dt dx < 0.4
20 if (ic_leap_frog = leap_frog) { // leapfrog leap_frog = 0; omn = omnp1; omn += omnm1; omn *= 0.5; jn = jnp1; jn += jnm1; jn *= 0.5; singlestep(); }
21 Energiespektrum Erwartetes Kolmogorov-Skalenverhalten entwickelt sich Dissipationsrate ɛ
22 Enstrophietransferrate η
6. Erzwungene Schwingungen
 6. Erzwungene Schwingungen Ein durch zeitveränderliche äußere Einwirkung zum Schwingen angeregtes (gezwungenes) System führt erzwungene Schwingungen durch. Bedeutsam sind vor allem periodische Erregungen
6. Erzwungene Schwingungen Ein durch zeitveränderliche äußere Einwirkung zum Schwingen angeregtes (gezwungenes) System führt erzwungene Schwingungen durch. Bedeutsam sind vor allem periodische Erregungen
WELLEN im VAKUUM. Kapitel 10. B t E = 0 E = B = 0 B. E = 1 c 2 2 E. B = 1 c 2 2 B
 Kapitel 0 WELLE im VAKUUM In den Maxwell-Gleichungen erscheint eine Asymmetrie durch Ladungen, die Quellen des E-Feldes sind und durch freie Ströme, die Ursache für das B-Feld sind. Im Vakuum ist ρ und
Kapitel 0 WELLE im VAKUUM In den Maxwell-Gleichungen erscheint eine Asymmetrie durch Ladungen, die Quellen des E-Feldes sind und durch freie Ströme, die Ursache für das B-Feld sind. Im Vakuum ist ρ und
Nachrichtentechnik [NAT] Kapitel 4: Fourier-Transformation. Dipl.-Ing. Udo Ahlvers HAW Hamburg, FB Medientechnik
![Nachrichtentechnik [NAT] Kapitel 4: Fourier-Transformation. Dipl.-Ing. Udo Ahlvers HAW Hamburg, FB Medientechnik Nachrichtentechnik [NAT] Kapitel 4: Fourier-Transformation. Dipl.-Ing. Udo Ahlvers HAW Hamburg, FB Medientechnik](/thumbs/48/24765147.jpg) Nachrichtentechnik [NAT] Kapitel 4: Fourier-Transformation Dipl.-Ing. Udo Ahlvers HAW Hamburg, FB Medientechnik Sommersemester 25 Inhaltsverzeichnis Inhalt Inhaltsverzeichnis 4 Fourier-Transformation 3
Nachrichtentechnik [NAT] Kapitel 4: Fourier-Transformation Dipl.-Ing. Udo Ahlvers HAW Hamburg, FB Medientechnik Sommersemester 25 Inhaltsverzeichnis Inhalt Inhaltsverzeichnis 4 Fourier-Transformation 3
Lösung zu den Testaufgaben zur Mathematik für Chemiker II (Analysis)
 Universität D U I S B U R G E S S E N Campus Essen, Mathematik PD Dr. L. Strüngmann Informationen zur Veranstaltung unter: http://www.uni-due.de/algebra-logic/struengmann.shtml SS 7 Lösung zu den Testaufgaben
Universität D U I S B U R G E S S E N Campus Essen, Mathematik PD Dr. L. Strüngmann Informationen zur Veranstaltung unter: http://www.uni-due.de/algebra-logic/struengmann.shtml SS 7 Lösung zu den Testaufgaben
Einführung in die Physik I. Schwingungen und Wellen 1
 Einführung in die Physik I Schwingungen und Wellen O. von der Lühe und U. Landgraf Schwingungen Periodische Vorgänge spielen in eine große Rolle in vielen Gebieten der Physik E pot Schwingungen treten
Einführung in die Physik I Schwingungen und Wellen O. von der Lühe und U. Landgraf Schwingungen Periodische Vorgänge spielen in eine große Rolle in vielen Gebieten der Physik E pot Schwingungen treten
9. Vorlesung Wintersemester
 9. Vorlesung Wintersemester 1 Die Phase der angeregten Schwingung Wertebereich: bei der oben abgeleiteten Formel tan φ = β ω ω ω0. (1) ist noch zu sehen, in welchem Bereich der Winkel liegt. Aus der ursprünglichen
9. Vorlesung Wintersemester 1 Die Phase der angeregten Schwingung Wertebereich: bei der oben abgeleiteten Formel tan φ = β ω ω ω0. (1) ist noch zu sehen, in welchem Bereich der Winkel liegt. Aus der ursprünglichen
Behandlung der komplexen Darstellung von Wellen: Negative Frequenzen und komplexe Felder
 Behandlung der komplexen Darstellung von Wellen: Negative Frequenzen und komplexe Felder Bei der Behandlung reeller elektromagnetischer Felder im Fourierraum ist man mit der Tatsache konfrontiert, dass
Behandlung der komplexen Darstellung von Wellen: Negative Frequenzen und komplexe Felder Bei der Behandlung reeller elektromagnetischer Felder im Fourierraum ist man mit der Tatsache konfrontiert, dass
Grundlagen der Physik 2 Schwingungen und Wärmelehre
 (c) Ulm University p. 1/ Grundlagen der Physik Schwingungen und Wärmelehre 3. 04. 006 Othmar Marti othmar.marti@uni-ulm.de Experimentelle Physik Universität Ulm (c) Ulm University p. / Physikalisches Pendel
(c) Ulm University p. 1/ Grundlagen der Physik Schwingungen und Wärmelehre 3. 04. 006 Othmar Marti othmar.marti@uni-ulm.de Experimentelle Physik Universität Ulm (c) Ulm University p. / Physikalisches Pendel
Kinematik des starren Körpers
 Technische Mechanik II Kinematik des starren Körpers Prof. Dr.-Ing. Ulrike Zwiers, M.Sc. Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau Hochschule Bochum WS 2009/2010 Übersicht 1. Kinematik des Massenpunktes
Technische Mechanik II Kinematik des starren Körpers Prof. Dr.-Ing. Ulrike Zwiers, M.Sc. Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau Hochschule Bochum WS 2009/2010 Übersicht 1. Kinematik des Massenpunktes
Die komplexen Zahlen und Skalarprodukte Kurze Wiederholung des Körpers der komplexen Zahlen C.
 Die omplexen Zahlen und Salarprodute Kurze Wiederholung des Körpers der omplexen Zahlen C. Erinnerung an die Definition von exp, sin, cos als Potenzreihen C C Herleitung der Euler Formel Definition eines
Die omplexen Zahlen und Salarprodute Kurze Wiederholung des Körpers der omplexen Zahlen C. Erinnerung an die Definition von exp, sin, cos als Potenzreihen C C Herleitung der Euler Formel Definition eines
Technik der Fourier-Transformation
 Was ist Fourier-Transformation? Fourier- Transformation Zeitabhängiges Signal in s Frequenzabhängiges Signal in 1/s Wozu braucht man das? Wie macht man das? k = 0 Fourier- Reihe f ( t) = Ak cos( ωkt) +
Was ist Fourier-Transformation? Fourier- Transformation Zeitabhängiges Signal in s Frequenzabhängiges Signal in 1/s Wozu braucht man das? Wie macht man das? k = 0 Fourier- Reihe f ( t) = Ak cos( ωkt) +
00. Einiges zum Vektorraum R n
 00. Einiges zum Vektorraum R n In diesem einleitenden Kapitel werden die in der LV Einführung in die mathematischen Methoden erwähnten Konzepte über Vektoren (im R 2 und R 3 ) im Rahmen des n-dimensionalen
00. Einiges zum Vektorraum R n In diesem einleitenden Kapitel werden die in der LV Einführung in die mathematischen Methoden erwähnten Konzepte über Vektoren (im R 2 und R 3 ) im Rahmen des n-dimensionalen
Mathematik-Tutorium für Maschinenbauer II: Differentialgleichungen und Vektorfelder
 DGL Schwingung Physikalische Felder Mathematik-Tutorium für Maschinenbauer II: Differentialgleichungen und Vektorfelder Johannes Wiedersich 23. April 2008 http://www.e13.physik.tu-muenchen.de/wiedersich/
DGL Schwingung Physikalische Felder Mathematik-Tutorium für Maschinenbauer II: Differentialgleichungen und Vektorfelder Johannes Wiedersich 23. April 2008 http://www.e13.physik.tu-muenchen.de/wiedersich/
Einführung in die Physik
 Einführung in die Physik für Pharmazeuten und Biologen (PPh) Mechanik, Elektrizitätslehre, Optik Übung : Vorlesung: Tutorials: Montags 13:15 bis 14 Uhr, Liebig-HS Montags 14:15 bis 15:45, Liebig HS Montags
Einführung in die Physik für Pharmazeuten und Biologen (PPh) Mechanik, Elektrizitätslehre, Optik Übung : Vorlesung: Tutorials: Montags 13:15 bis 14 Uhr, Liebig-HS Montags 14:15 bis 15:45, Liebig HS Montags
Adaptive Systeme. Sommersemester Prof. Dr. -Ing. Heinz-Georg Fehn. Prof. Dr. rer. nat. Nikolaus Wulff
 Adaptive Systeme Sommersemester 2015 Prof. Dr. -Ing. Heinz-Georg Fehn Prof. Dr. rer. nat. Nikolaus Wulff Prof. Dr. H.-G. Fehn und Prof. Dr. N. Wulff 1 Adaptive Systeme Adaptives System: ein System, das
Adaptive Systeme Sommersemester 2015 Prof. Dr. -Ing. Heinz-Georg Fehn Prof. Dr. rer. nat. Nikolaus Wulff Prof. Dr. H.-G. Fehn und Prof. Dr. N. Wulff 1 Adaptive Systeme Adaptives System: ein System, das
Punktprozesse. Andreas Frommknecht Seminar Zufällige Felder Universität Ulm
 Einführung in Beispiele für Andreas Seminar Zufällige Felder Universität Ulm 20.01.2009 Inhalt Einführung in Beispiele für Definition Markierte 1 Einführung in Definition Markierte 2 Beispiele für Homogener
Einführung in Beispiele für Andreas Seminar Zufällige Felder Universität Ulm 20.01.2009 Inhalt Einführung in Beispiele für Definition Markierte 1 Einführung in Definition Markierte 2 Beispiele für Homogener
Elemente von S n = Aut([1, n]) heißen Permutationen. Spezielle Permutationen sind Transpositionen und Zyklen. (Vergl. Skript S
![Elemente von S n = Aut([1, n]) heißen Permutationen. Spezielle Permutationen sind Transpositionen und Zyklen. (Vergl. Skript S Elemente von S n = Aut([1, n]) heißen Permutationen. Spezielle Permutationen sind Transpositionen und Zyklen. (Vergl. Skript S](/thumbs/48/24062974.jpg) Begriffe Faser: Es sei f : M N eine Abbildung von Mengen. Es sei n N. Die Menge f 1 ({n}) M nennt man die Faser in n. (Skript Seite 119). Parallel: Zwei Vektoren v und w heißen parallel, wenn für einen
Begriffe Faser: Es sei f : M N eine Abbildung von Mengen. Es sei n N. Die Menge f 1 ({n}) M nennt man die Faser in n. (Skript Seite 119). Parallel: Zwei Vektoren v und w heißen parallel, wenn für einen
6 Elektromagnetische Schwingungen und Wellen
 6 Elektroagnetische Schwingungen und Wellen Elektroagnetischer Schwingkreis Schaltung it Kondensator C und Induktivität L. Kondensator wird periodisch aufgeladen und entladen. Tabelle 6.1: Vergleich elektroagnetischer
6 Elektroagnetische Schwingungen und Wellen Elektroagnetischer Schwingkreis Schaltung it Kondensator C und Induktivität L. Kondensator wird periodisch aufgeladen und entladen. Tabelle 6.1: Vergleich elektroagnetischer
Differentialgleichungen
 Kapitel Differentialgleichungen Josef Leydold Mathematik für VW WS 05/6 Differentialgleichungen / Ein einfaches Modell (Domar) Im Domar Wachstumsmodell treffen wir die folgenden Annahmen: () Erhöhung der
Kapitel Differentialgleichungen Josef Leydold Mathematik für VW WS 05/6 Differentialgleichungen / Ein einfaches Modell (Domar) Im Domar Wachstumsmodell treffen wir die folgenden Annahmen: () Erhöhung der
Ferienkurs Theoretische Physik 3: Elektrodynamik. Ausbreitung elektromagnetischer Wellen
 Ferienkurs Theoretische Physik 3: Elektrodynamik Ausbreitung elektromagnetischer Wellen Autor: Isabell Groß Stand: 21. März 2012 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Homogene Maxwell-Gleichungen
Ferienkurs Theoretische Physik 3: Elektrodynamik Ausbreitung elektromagnetischer Wellen Autor: Isabell Groß Stand: 21. März 2012 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Homogene Maxwell-Gleichungen
Vergleich von experimentellen Ergebnissen mit realen Konfigurationen
 Ähnlichkeitstheorie Vergleich von experimentellen Ergebnissen mit realen Konfigurationen Verringerung der Anzahl der physikalischen Größen ( Anzahl der Experimente) Experimentelle Ergebnisse sind unabhängig
Ähnlichkeitstheorie Vergleich von experimentellen Ergebnissen mit realen Konfigurationen Verringerung der Anzahl der physikalischen Größen ( Anzahl der Experimente) Experimentelle Ergebnisse sind unabhängig
Elektronen in Metallen. Seminar: Nanostrukturphysik 1 Fakultät: 7 Dozent: Dr. M. Kobliscka Referent: Daniel Gillo Datum:
 Elektronen in Metallen Seminar: Nanostrukturphysik 1 Fakultät: 7 Dozent: Dr. M. Kobliscka Referent: Datum: 1.01.14 Gliederung 1. Einleitung 1.1 Elektronen 1. Metalle. Drude-Modell.1 Ohm'sches Gesetz. Grenzen
Elektronen in Metallen Seminar: Nanostrukturphysik 1 Fakultät: 7 Dozent: Dr. M. Kobliscka Referent: Datum: 1.01.14 Gliederung 1. Einleitung 1.1 Elektronen 1. Metalle. Drude-Modell.1 Ohm'sches Gesetz. Grenzen
Iterative Verfahren, Splittingmethoden
 Iterative Verfahren, Splittingmethoden Theodor Müller 19. April 2005 Sei ein lineares Gleichungssystem der Form Ax = b b C n, A C n n ( ) gegeben. Es sind direkte Verfahren bekannt, die ein solches Gleichungssystem
Iterative Verfahren, Splittingmethoden Theodor Müller 19. April 2005 Sei ein lineares Gleichungssystem der Form Ax = b b C n, A C n n ( ) gegeben. Es sind direkte Verfahren bekannt, die ein solches Gleichungssystem
18 Höhere Ableitungen und Taylorformel
 8 HÖHERE ABLEITUNGEN UND TAYLORFORMEL 98 8 Höhere Ableitungen und Taylorformel Definition. Sei f : D R eine Funktion, a D. Falls f in einer Umgebung von a (geschnitten mit D) differenzierbar und f in a
8 HÖHERE ABLEITUNGEN UND TAYLORFORMEL 98 8 Höhere Ableitungen und Taylorformel Definition. Sei f : D R eine Funktion, a D. Falls f in einer Umgebung von a (geschnitten mit D) differenzierbar und f in a
19.3 Oberflächenintegrale
 19.3 Oberflächenintegrale Definition: Sei D R 2 ein Gebiet und p : D R 3 eine C 1 -Abbildung x = p(u) mit x R 3 und u = (u 1, u 2 ) T D R 2 Sind für alle u D die beiden Vektoren und u 1 linear unabhängig,
19.3 Oberflächenintegrale Definition: Sei D R 2 ein Gebiet und p : D R 3 eine C 1 -Abbildung x = p(u) mit x R 3 und u = (u 1, u 2 ) T D R 2 Sind für alle u D die beiden Vektoren und u 1 linear unabhängig,
(Fast) Fourier Transformation und ihre Anwendungen
 (Fast) Fourier Transformation und ihre Anwendungen Johannes Lülff Universität Münster 14.01.2009 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 FFT 3 Anwendungen 4 Beschränkungen 5 Zusammenfassung Definition Fouriertransformation
(Fast) Fourier Transformation und ihre Anwendungen Johannes Lülff Universität Münster 14.01.2009 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 FFT 3 Anwendungen 4 Beschränkungen 5 Zusammenfassung Definition Fouriertransformation
Faktorenanalysen höherer Ordnung
 Faktorenanalysen höherer Ordnung 1 Ausgangssituation Übliche Faktorenanalysen (erster Ordnung) gehen von Zusammenhängen zwischen manifesten, beobachteten Variablen aus und führen diese Zusammenhänge auf
Faktorenanalysen höherer Ordnung 1 Ausgangssituation Übliche Faktorenanalysen (erster Ordnung) gehen von Zusammenhängen zwischen manifesten, beobachteten Variablen aus und führen diese Zusammenhänge auf
Lokale Frequenzanalyse
 Lokale Frequenzanalyse Fourieranalyse bzw. Powerspektrum liefern globale Maße für einen Datensatz (mittleres Verhalten über die gesamte Länge des Datensatzes) Wiederkehrdiagramme zeigten, dass Periodizitäten
Lokale Frequenzanalyse Fourieranalyse bzw. Powerspektrum liefern globale Maße für einen Datensatz (mittleres Verhalten über die gesamte Länge des Datensatzes) Wiederkehrdiagramme zeigten, dass Periodizitäten
Klassifikation von partiellen Differentialgleichungen
 Kapitel 2 Klassifikation von partiellen Differentialgleichungen Die meisten partiellen Differentialgleichungen sind von 3 Grundtypen: elliptisch, hyperbolisch, parabolisch. Betrachte die allgemeine Dgl.
Kapitel 2 Klassifikation von partiellen Differentialgleichungen Die meisten partiellen Differentialgleichungen sind von 3 Grundtypen: elliptisch, hyperbolisch, parabolisch. Betrachte die allgemeine Dgl.
Mathematik II Frühlingsemester 2015 Kap. 9: Funktionen von mehreren Variablen 9.2 Partielle Differentiation
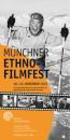 Mathematik II Frühlingsemester 2015 Kap. 9: Funktionen von mehreren Variablen 9.2 Partielle Differentiation www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/fs2015/other/mathematik2 biol Prof. Dr. Erich Walter
Mathematik II Frühlingsemester 2015 Kap. 9: Funktionen von mehreren Variablen 9.2 Partielle Differentiation www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/fs2015/other/mathematik2 biol Prof. Dr. Erich Walter
Dieses Quiz soll Ihnen helfen, Kapitel besser zu verstehen.
 Dieses Quiz soll Ihnen helfen, Kapitel 2.5-2. besser zu verstehen. Frage Wir betrachten ein Würfelspiel. Man wirft einen fairen, sechsseitigen Würfel. Wenn eine oder eine 2 oben liegt, muss man 2 SFr zahlen.
Dieses Quiz soll Ihnen helfen, Kapitel 2.5-2. besser zu verstehen. Frage Wir betrachten ein Würfelspiel. Man wirft einen fairen, sechsseitigen Würfel. Wenn eine oder eine 2 oben liegt, muss man 2 SFr zahlen.
Thema 10 Gewöhnliche Differentialgleichungen
 Thema 10 Gewöhnliche Differentialgleichungen Viele Naturgesetze stellen eine Beziehung zwischen einer physikalischen Größe und ihren Ableitungen (etwa als Funktion der Zeit dar: 1. ẍ = g (freier Fall;
Thema 10 Gewöhnliche Differentialgleichungen Viele Naturgesetze stellen eine Beziehung zwischen einer physikalischen Größe und ihren Ableitungen (etwa als Funktion der Zeit dar: 1. ẍ = g (freier Fall;
Übungen zur Vorlesung MATHEMATIK II
 Fachbereich Mathematik und Informatik der Philipps-Universität Marburg Übungen zur Vorlesung MATHEMATIK II Prof. Dr. C. Portenier unter Mitarbeit von Michael Koch Marburg, Sommersemester 2005 Fassung vom
Fachbereich Mathematik und Informatik der Philipps-Universität Marburg Übungen zur Vorlesung MATHEMATIK II Prof. Dr. C. Portenier unter Mitarbeit von Michael Koch Marburg, Sommersemester 2005 Fassung vom
Datenanalyse. (PHY231) Herbstsemester Olaf Steinkamp
 Datenanalyse (PHY31) Herbstsemester 015 Olaf Steinkamp 36-J- olafs@physik.uzh.ch 044 63 55763 Einführung, Messunsicherheiten, Darstellung von Messdaten Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung und
Datenanalyse (PHY31) Herbstsemester 015 Olaf Steinkamp 36-J- olafs@physik.uzh.ch 044 63 55763 Einführung, Messunsicherheiten, Darstellung von Messdaten Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung und
Grundwissen. Physik. Jahrgangsstufe 8
 Grundwissen Physik Jahrgangsstufe 8 Grundwissen Physik Jahrgangsstufe 8 Seite 1 1. Energie; E [E] = 1Nm = 1J (Joule) 1.1 Energieerhaltungssatz Formulierung I: Energie kann nicht erzeugt oder vernichtet
Grundwissen Physik Jahrgangsstufe 8 Grundwissen Physik Jahrgangsstufe 8 Seite 1 1. Energie; E [E] = 1Nm = 1J (Joule) 1.1 Energieerhaltungssatz Formulierung I: Energie kann nicht erzeugt oder vernichtet
Vorlesung Physik für Pharmazeuten und Biologen
 Vorlesung Physik für Pharmazeuten und Biologen Schwingungen Mechanische Wellen Akustik Freier harmonischer Oszillator Beispiel: Das mathematische Pendel Bewegungsgleichung : d s mg sinϕ = m dt Näherung
Vorlesung Physik für Pharmazeuten und Biologen Schwingungen Mechanische Wellen Akustik Freier harmonischer Oszillator Beispiel: Das mathematische Pendel Bewegungsgleichung : d s mg sinϕ = m dt Näherung
Vakuum und Gastheorie
 Vakuum und Gastheorie Jan Krieger 9. März 2005 1 INHALTSVERZEICHNIS 0.1 Formelsammlung.................................... 2 0.1.1 mittlere freie Weglänge in idealen Gasen................... 3 0.1.2 Strömungsleitwerte
Vakuum und Gastheorie Jan Krieger 9. März 2005 1 INHALTSVERZEICHNIS 0.1 Formelsammlung.................................... 2 0.1.1 mittlere freie Weglänge in idealen Gasen................... 3 0.1.2 Strömungsleitwerte
Mathematische Methoden in den Ingenieurwissenschaften 1. Übungsblatt
 Prof Dr M Gerdts Dr A Dreves J Michael Wintertrimester 216 Mathematische Methoden in den Ingenieurwissenschaften 1 Übungsblatt Aufgabe 1 : (Schwimmer Ein Schwimmer möchte einen Fluss der Breite b > überqueren,
Prof Dr M Gerdts Dr A Dreves J Michael Wintertrimester 216 Mathematische Methoden in den Ingenieurwissenschaften 1 Übungsblatt Aufgabe 1 : (Schwimmer Ein Schwimmer möchte einen Fluss der Breite b > überqueren,
Korrelationsmatrix. Statistische Bindungen zwischen den N Zufallsgrößen werden durch die Korrelationsmatrix vollständig beschrieben:
 Korrelationsmatrix Bisher wurden nur statistische Bindungen zwischen zwei (skalaren) Zufallsgrößen betrachtet. Für den allgemeineren Fall einer Zufallsgröße mit N Dimensionen bietet sich zweckmäßiger Weise
Korrelationsmatrix Bisher wurden nur statistische Bindungen zwischen zwei (skalaren) Zufallsgrößen betrachtet. Für den allgemeineren Fall einer Zufallsgröße mit N Dimensionen bietet sich zweckmäßiger Weise
Repetition Carnot-Prozess
 Wärmelehre II Die Wärmelehre (bzw. die Thermodynamik) leidet etwas unter den verschiedensten Begriffen, die in ihr auftauchen. Diese sind soweit noch nicht alle aufgetreten - Vorhang auf! Die neu auftretenden
Wärmelehre II Die Wärmelehre (bzw. die Thermodynamik) leidet etwas unter den verschiedensten Begriffen, die in ihr auftauchen. Diese sind soweit noch nicht alle aufgetreten - Vorhang auf! Die neu auftretenden
Simulation von Zufallsvariablen und Punktprozessen
 Simulation von Zufallsvariablen und Punktprozessen 09.11.2009 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 Pseudozufallszahlen 3 Punktprozesse Zufallszahlen Definition (Duden): Eine Zufallszahl ist eine Zahl, die
Simulation von Zufallsvariablen und Punktprozessen 09.11.2009 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 Pseudozufallszahlen 3 Punktprozesse Zufallszahlen Definition (Duden): Eine Zufallszahl ist eine Zahl, die
Technische Universität Kaiserslautern Lehrstuhl Entwurf Mikroelektronischer Systeme Prof. Dr.-Ing. N. Wehn. Probeklausur
 Technische Universität Kaiserslautern Lehrstuhl Entwurf Mikroelektronischer Systeme Prof. Dr.-Ing. N. Wehn 22.02.200 Probeklausur Elektrotechnik I für Maschinenbauer Name: Vorname: Matr.-Nr.: Fachrichtung:
Technische Universität Kaiserslautern Lehrstuhl Entwurf Mikroelektronischer Systeme Prof. Dr.-Ing. N. Wehn 22.02.200 Probeklausur Elektrotechnik I für Maschinenbauer Name: Vorname: Matr.-Nr.: Fachrichtung:
Lösungsvorschlag zu den Hausaufgaben der 8. Übung
 FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Prof Dr Patrizio Ne Frank Osterbrink Johannes Lankeit 9503 Lösungsvorschlag zu den Hausaufgaben der 8 Übung Hausaufgabe : Beweise den Satz über die Parallelogrammgleichung Sei H
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Prof Dr Patrizio Ne Frank Osterbrink Johannes Lankeit 9503 Lösungsvorschlag zu den Hausaufgaben der 8 Übung Hausaufgabe : Beweise den Satz über die Parallelogrammgleichung Sei H
Eine Erweiterung des Lê-Saito-Theorems
 s Eine s Oklahoma State University Kaiserslautern, 6. Januar 2012 Definition Ein Polynom f C[x 1,..., x n ] ist homogen vom Grad d, wenn f (λ x 1,..., λ x n ) = λ d f (x 1,..., x n ) für alle λ C. Ableiten
s Eine s Oklahoma State University Kaiserslautern, 6. Januar 2012 Definition Ein Polynom f C[x 1,..., x n ] ist homogen vom Grad d, wenn f (λ x 1,..., λ x n ) = λ d f (x 1,..., x n ) für alle λ C. Ableiten
Dierentialgleichungen 2. Ordnung
 Dierentialgleichungen 2. Ordnung haben die allgemeine Form x = F (x, x, t. Wir beschränken uns hier auf zwei Spezialfälle, in denen sich eine Lösung analytisch bestimmen lässt: 1. reduzible Dierentialgleichungen:
Dierentialgleichungen 2. Ordnung haben die allgemeine Form x = F (x, x, t. Wir beschränken uns hier auf zwei Spezialfälle, in denen sich eine Lösung analytisch bestimmen lässt: 1. reduzible Dierentialgleichungen:
Vorkurs Mathematik für Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsinformatiker
 Vorkurs Mathematik für Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsinformatiker Übungsblatt Musterlösung Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften Wintersemester 06/7 Aufgabe (Definitionsbereiche) Bestimme
Vorkurs Mathematik für Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsinformatiker Übungsblatt Musterlösung Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften Wintersemester 06/7 Aufgabe (Definitionsbereiche) Bestimme
1 Lineare Algebra. 1.1 Matrizen und Vektoren. Slide 3. Matrizen. Eine Matrix ist ein rechteckiges Zahlenschema
 1 Lineare Algebra 1.1 Matrizen und Vektoren Slide 3 Matrizen Eine Matrix ist ein rechteckiges Zahlenschema eine n m-matrix A besteht aus n Zeilen und m Spalten mit den Matrixelementen a ij, i=1...n und
1 Lineare Algebra 1.1 Matrizen und Vektoren Slide 3 Matrizen Eine Matrix ist ein rechteckiges Zahlenschema eine n m-matrix A besteht aus n Zeilen und m Spalten mit den Matrixelementen a ij, i=1...n und
Einführung Seite 28. Zahlenebene C. Vorlesung bzw. 24. Oktober 2013
 Einführung Seite 8 Vorlesung 1 3. bzw. 4. Oktober 013 Komplexe Zahlen Seite 9 Lösung von x + 1 = 0, pq-formel liefert x 1/ = ± 1 ; }{{} verboten Definition Imaginäre Einheit i := 1 Dann x 1/ = ±i; i =
Einführung Seite 8 Vorlesung 1 3. bzw. 4. Oktober 013 Komplexe Zahlen Seite 9 Lösung von x + 1 = 0, pq-formel liefert x 1/ = ± 1 ; }{{} verboten Definition Imaginäre Einheit i := 1 Dann x 1/ = ±i; i =
ν und λ ausgedrückt in Energie E und Impuls p
 phys4.011 Page 1 8.3 Die Schrödinger-Gleichung die grundlegende Gleichung der Quantenmechanik (in den bis jetzt diskutierten Fällen) eine Wellengleichung für Materiewellen (gilt aber auch allgemeiner)
phys4.011 Page 1 8.3 Die Schrödinger-Gleichung die grundlegende Gleichung der Quantenmechanik (in den bis jetzt diskutierten Fällen) eine Wellengleichung für Materiewellen (gilt aber auch allgemeiner)
2. VEKTORANALYSIS 2.1 Kurven Definition: Ein Weg ist eine stetige Abbildung aus einem Intervall I = [a; b] R in den R n : f : I R n
![2. VEKTORANALYSIS 2.1 Kurven Definition: Ein Weg ist eine stetige Abbildung aus einem Intervall I = [a; b] R in den R n : f : I R n 2. VEKTORANALYSIS 2.1 Kurven Definition: Ein Weg ist eine stetige Abbildung aus einem Intervall I = [a; b] R in den R n : f : I R n](/thumbs/49/25862272.jpg) 2. VEKTORANALYSIS 2.1 Kurven Definition: Ein Weg ist eine stetige Abbildung aus einem Intervall I = [a; b] R in den R n : f : I R n f ist in dem Fall ein Weg in R n. Das Bild f(t) des Weges wird als Kurve
2. VEKTORANALYSIS 2.1 Kurven Definition: Ein Weg ist eine stetige Abbildung aus einem Intervall I = [a; b] R in den R n : f : I R n f ist in dem Fall ein Weg in R n. Das Bild f(t) des Weges wird als Kurve
Zahlen und Gleichungen
 Kapitel 2 Zahlen und Gleichungen 21 Reelle Zahlen Die Menge R der reellen Zahlen setzt sich zusammen aus den rationalen und den irrationalen Zahlen Die Mengen der natürlichen Zahlen N, der ganzen Zahlen
Kapitel 2 Zahlen und Gleichungen 21 Reelle Zahlen Die Menge R der reellen Zahlen setzt sich zusammen aus den rationalen und den irrationalen Zahlen Die Mengen der natürlichen Zahlen N, der ganzen Zahlen
Berechenbare Funktionalanalysis und kompakte Operatoren
 Berechenbare Funktionalanalysis und kompakte Operatoren Volker Bosserhoff Oberseminar der Fakultät für Informatik, 22. Juli 2008 Typ-2-Berechenbarkeit Rechnen mit endlichen Objekten Σ := {0, 1}. f : Σ
Berechenbare Funktionalanalysis und kompakte Operatoren Volker Bosserhoff Oberseminar der Fakultät für Informatik, 22. Juli 2008 Typ-2-Berechenbarkeit Rechnen mit endlichen Objekten Σ := {0, 1}. f : Σ
Insertion Devices. Wavelength-Shifter Das Wiggler/Undulator Feld Bewegungsgleichung Undulator Strahlung Eigenschaften Polarisation
 Wavelength-Shifter Das Wiggler/Undulator Feld Bewegungsgleichung Undulator Strahlung Eigenschaften Polarisation Wellenlängenschieber R R In einem Speicherring gilt für die kritische Energie E c 1/R R:
Wavelength-Shifter Das Wiggler/Undulator Feld Bewegungsgleichung Undulator Strahlung Eigenschaften Polarisation Wellenlängenschieber R R In einem Speicherring gilt für die kritische Energie E c 1/R R:
Theoretische Physik I: Lösungen Blatt Michael Czopnik
 Theoretische Physik I: Lösungen Blatt 2 15.10.2012 Michael Czopnik Aufgabe 1: Scheinkräfte Nutze Zylinderkoordinaten: x = r cos ϕ y = r sin ϕ z = z Zweimaliges differenzieren ergibt: ẍ = r cos ϕ 2ṙ ϕ sin
Theoretische Physik I: Lösungen Blatt 2 15.10.2012 Michael Czopnik Aufgabe 1: Scheinkräfte Nutze Zylinderkoordinaten: x = r cos ϕ y = r sin ϕ z = z Zweimaliges differenzieren ergibt: ẍ = r cos ϕ 2ṙ ϕ sin
3. Erhaltungsgrößen und die Newton schen Axiome
 Übungen zur T1: Theoretische Mechanik, SoSe13 Prof. Dr. Dieter Lüst Theresienstr. 37, Zi. 45 Dr. James Gray James.Gray@physik.uni-muenchen.de 3. Erhaltungsgrößen und die Newton schen Axiome Übung 3.1:
Übungen zur T1: Theoretische Mechanik, SoSe13 Prof. Dr. Dieter Lüst Theresienstr. 37, Zi. 45 Dr. James Gray James.Gray@physik.uni-muenchen.de 3. Erhaltungsgrößen und die Newton schen Axiome Übung 3.1:
Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung
 Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung Prof. S. Grimme OC [TC] 13.10.2009 Prof. S. Grimme (OC [TC]) Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung 13.10.2009 1 / 25 Teil I Einführung Prof. S. Grimme
Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung Prof. S. Grimme OC [TC] 13.10.2009 Prof. S. Grimme (OC [TC]) Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung 13.10.2009 1 / 25 Teil I Einführung Prof. S. Grimme
Longitudinale und transversale Relaxationszeit
 Longitudinale und transversale Relaxationszeit Longitudinale Relaxationszeit T 1 (Zeit, die das System benötigt, um nach dem rf- Puls zurück ins Gleichgewicht zu kommen) Transversale Relaxationszeit T
Longitudinale und transversale Relaxationszeit Longitudinale Relaxationszeit T 1 (Zeit, die das System benötigt, um nach dem rf- Puls zurück ins Gleichgewicht zu kommen) Transversale Relaxationszeit T
Die Varianz (Streuung) Definition
 Die (Streuung) Definition Diskrete Stetige Ang., die betrachteten e existieren. var(x) = E(X EX) 2 heißt der Zufallsvariable X. σ = Var(X) heißt Standardabweichung der X. Bez.: var(x), Var(X), varx, σ
Die (Streuung) Definition Diskrete Stetige Ang., die betrachteten e existieren. var(x) = E(X EX) 2 heißt der Zufallsvariable X. σ = Var(X) heißt Standardabweichung der X. Bez.: var(x), Var(X), varx, σ
Messung der Viskosität von Hochtemperatur-Metallschmelzen
 Messung der Viskosität von Hochtemperatur-Metallschmelzen G. Lohöfer Institut für Materialphysik im Weltraum, DLR, Köln AK Thermophysik, Graz, 03.-04.05.01 1 Probleme beim Prozessieren von Metallschmelzen
Messung der Viskosität von Hochtemperatur-Metallschmelzen G. Lohöfer Institut für Materialphysik im Weltraum, DLR, Köln AK Thermophysik, Graz, 03.-04.05.01 1 Probleme beim Prozessieren von Metallschmelzen
Lösung zur Übung 19 SS 2012
 Lösung zur Übung 19 SS 01 69) Beim radioaktiven Zerfall ist die Anzahl der pro Zeiteinheit zerfallenden Kerne dn/dt direkt proportional zur momentanen Anzahl der Kerne N(t). a) Formulieren Sie dazu die
Lösung zur Übung 19 SS 01 69) Beim radioaktiven Zerfall ist die Anzahl der pro Zeiteinheit zerfallenden Kerne dn/dt direkt proportional zur momentanen Anzahl der Kerne N(t). a) Formulieren Sie dazu die
27 Taylor-Formel und Taylor-Entwicklungen
 136 IV. Unendliche Reihen und Taylor-Formel 27 Taylor-Formel und Taylor-Entwicklungen Lernziele: Konzepte: klein o - und groß O -Bedingungen Resultate: Taylor-Formel Kompetenzen: Bestimmung von Taylor-Reihen
136 IV. Unendliche Reihen und Taylor-Formel 27 Taylor-Formel und Taylor-Entwicklungen Lernziele: Konzepte: klein o - und groß O -Bedingungen Resultate: Taylor-Formel Kompetenzen: Bestimmung von Taylor-Reihen
inoffizieller Lösungsvorschlag zu Übungsblatt 5 Markus Muhr 1
 Vorlesung Differentialformen [MA5016] Sommersemester 2015 PD Dr Peter Massopust Fakultät für Mathematik TU München 24 Juni 2015 inoffizieller Lösungsvorschlag zu Übungsblatt 5 Markus Muhr 1 Disclaimer
Vorlesung Differentialformen [MA5016] Sommersemester 2015 PD Dr Peter Massopust Fakultät für Mathematik TU München 24 Juni 2015 inoffizieller Lösungsvorschlag zu Übungsblatt 5 Markus Muhr 1 Disclaimer
Universität des Saarlandes Seminar der Fachrichtung Mathematik Rudolf Umla
 Universität des Saarlandes Seminar der Fachrichtung Mathematik Rudolf Umla Sätze über Konvexität von Kapitel 4.7 bis 4.10 Theorem 4.7-1. Sei U ein konvexer Unterraum eines normierten Vektorraums. Dann
Universität des Saarlandes Seminar der Fachrichtung Mathematik Rudolf Umla Sätze über Konvexität von Kapitel 4.7 bis 4.10 Theorem 4.7-1. Sei U ein konvexer Unterraum eines normierten Vektorraums. Dann
Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems
 THEORETISCHE AUFGABE Nr. 1 Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems Wissenschaftler können den Abstand Erde-Mond mit großer Genauigkeit bestimmen. Sie erreichen dies, indem sie einen Laserstrahl an einem
THEORETISCHE AUFGABE Nr. 1 Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems Wissenschaftler können den Abstand Erde-Mond mit großer Genauigkeit bestimmen. Sie erreichen dies, indem sie einen Laserstrahl an einem
Vektoren und Matrizen
 Vektoren und Matrizen Einführung: Wie wir gesehen haben, trägt der R 2, also die Menge aller Zahlenpaare, eine Körperstruktur mit der Multiplikation (a + bi(c + di ac bd + (ad + bci Man kann jedoch zeigen,
Vektoren und Matrizen Einführung: Wie wir gesehen haben, trägt der R 2, also die Menge aller Zahlenpaare, eine Körperstruktur mit der Multiplikation (a + bi(c + di ac bd + (ad + bci Man kann jedoch zeigen,
Lösungen zu Aufgabenblatt 7P
 Analysis Prof. Dr. Peter Becker Fachbereich Informatik Sommersemester 205 9. Mai 205 Lösungen zu Aufgabenblatt 7P Aufgabe (Stetigkeit) (a) Für welche a, b R sind die folgenden Funktionen stetig in x 0
Analysis Prof. Dr. Peter Becker Fachbereich Informatik Sommersemester 205 9. Mai 205 Lösungen zu Aufgabenblatt 7P Aufgabe (Stetigkeit) (a) Für welche a, b R sind die folgenden Funktionen stetig in x 0
Partitionen II. 1 Geometrische Repräsentation von Partitionen
 Partitionen II Vortrag zum Seminar zur Höheren Funktionentheorie, 09.07.2008 Oliver Delpy In diesem Vortrag geht es um Partitionen, also um Aufteilung von natürlichen Zahlen in Summen. Er setzt den Vortrag
Partitionen II Vortrag zum Seminar zur Höheren Funktionentheorie, 09.07.2008 Oliver Delpy In diesem Vortrag geht es um Partitionen, also um Aufteilung von natürlichen Zahlen in Summen. Er setzt den Vortrag
Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie - Probeklausur
 Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie - robeklausur Sommersemester 2007 - Lösung Name: Vorname: Matrikelnr.: Studiengang: Hinweise Sie sollten insgesamt Blätter erhalten haben. Tragen Sie bitte Ihre Antworten
Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie - robeklausur Sommersemester 2007 - Lösung Name: Vorname: Matrikelnr.: Studiengang: Hinweise Sie sollten insgesamt Blätter erhalten haben. Tragen Sie bitte Ihre Antworten
3 Moleküle. X = (R 1,R 2,...R M ) und x = (r 1,s 1,r 2,s 2,...r N,s N ).
 3 Moleküle Bei M gebundenen Atomen werden die gleichen Näherungen wie bei den Atomen zugrunde gelegt, wobei aber die Koordinaten R J der Atomkerne, ihre Massen M J und Ladungen Z J e 0 mit J = 1,2,...M
3 Moleküle Bei M gebundenen Atomen werden die gleichen Näherungen wie bei den Atomen zugrunde gelegt, wobei aber die Koordinaten R J der Atomkerne, ihre Massen M J und Ladungen Z J e 0 mit J = 1,2,...M
Lösungsvorschläge zum 14. Übungsblatt.
 Übung zur Analysis III WS / Lösungsvorschläge zum 4. Übungsblatt. Aufgabe 54 Sei a R\{}. Ziel ist die Berechnung des Reihenwertes k a + k. Definiere dazu f : [ π, π] R, x coshax. Wir entwickeln f in eine
Übung zur Analysis III WS / Lösungsvorschläge zum 4. Übungsblatt. Aufgabe 54 Sei a R\{}. Ziel ist die Berechnung des Reihenwertes k a + k. Definiere dazu f : [ π, π] R, x coshax. Wir entwickeln f in eine
ATZ: Die Zahl π ist transzendent.
 ATZ: Die Zahl π ist transzendent. SATZ Die Transzendenz von π Es ist das Verdienst von Ferdinand Lindemann, erkannt zu haben, da auf Grund eines lange bekannten Zusammenhanges der Zahlen e und π der Hermite
ATZ: Die Zahl π ist transzendent. SATZ Die Transzendenz von π Es ist das Verdienst von Ferdinand Lindemann, erkannt zu haben, da auf Grund eines lange bekannten Zusammenhanges der Zahlen e und π der Hermite
0 + #! % ( ) % )1, !,
 ! #! % ( ) % +!,../ 0 + #! % ( ) % )1,233 3 4!, 5 2 6 7 2 6 ( (% 6 2 58.9../ : 2../ ! # % & # ( ) + +, % ( ( + +., / (! & 0 + 1 2 3 4! 5! 6! ( 7 ) + 8 9! + : +, 5 & ; + 9 0 < 5 3 & 9 ; + 9 0 < 5 3 %!
! #! % ( ) % +!,../ 0 + #! % ( ) % )1,233 3 4!, 5 2 6 7 2 6 ( (% 6 2 58.9../ : 2../ ! # % & # ( ) + +, % ( ( + +., / (! & 0 + 1 2 3 4! 5! 6! ( 7 ) + 8 9! + : +, 5 & ; + 9 0 < 5 3 & 9 ; + 9 0 < 5 3 %!
4.7 Der Taylorsche Satz
 288 4 Differenziation 4.7 Der Taylorsche Satz Die Differenzierbarkeit, also die Existenz der ersten Ableitung einer Funktion, erlaubt bekanntlich, diese Funktion lokal durch eine affine Funktion näherungsweise
288 4 Differenziation 4.7 Der Taylorsche Satz Die Differenzierbarkeit, also die Existenz der ersten Ableitung einer Funktion, erlaubt bekanntlich, diese Funktion lokal durch eine affine Funktion näherungsweise
Dynamische Systeme eine Einführung
 Dynamische Systeme eine Einführung Seminar für Lehramtstudierende: Mathematische Modelle Wintersemester 2010/11 Dynamische Systeme eine Einführung 1. Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen 2. Flüsse,
Dynamische Systeme eine Einführung Seminar für Lehramtstudierende: Mathematische Modelle Wintersemester 2010/11 Dynamische Systeme eine Einführung 1. Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen 2. Flüsse,
Martinovsky Nicole. Schwarzmann Tobias. Thaler Michael
 Themen: Unbestimmtheitsrelationen, Materiewellen, Materieteilchen als Welle, Wellenfunktion, Dispersionsrelation, Wellenpaket, Wahrscheinlichkeitsinterpretation, Materie-Quanteninterferenz Martinovsky
Themen: Unbestimmtheitsrelationen, Materiewellen, Materieteilchen als Welle, Wellenfunktion, Dispersionsrelation, Wellenpaket, Wahrscheinlichkeitsinterpretation, Materie-Quanteninterferenz Martinovsky
Musterlösung zu Übungen der Physik PHY 117, Serie 6, HS 2009
 Musterlösung zu Übungen der Physik PHY 117, Serie 6, HS 2009 Abgabe: Gruppen 4-6: 07.12.09, Gruppen 1-3: 14.12.09 Lösungen zu den Aufgaben 1. [1P] Kind und Luftballons Ein Kind (m = 30 kg) will so viele
Musterlösung zu Übungen der Physik PHY 117, Serie 6, HS 2009 Abgabe: Gruppen 4-6: 07.12.09, Gruppen 1-3: 14.12.09 Lösungen zu den Aufgaben 1. [1P] Kind und Luftballons Ein Kind (m = 30 kg) will so viele
Angewandte Strömungssimulation
 Angewandte Strömungssimulation 2. Vorlesung Stefan Hickel Numerische Strömungsberechnung CFD vereinfacht das Design: einfache aber langwierige Experimente können ersetzt werden es können Lösungen zu Problemen
Angewandte Strömungssimulation 2. Vorlesung Stefan Hickel Numerische Strömungsberechnung CFD vereinfacht das Design: einfache aber langwierige Experimente können ersetzt werden es können Lösungen zu Problemen
13. Klasse TOP 10 Grundwissen 13 Geradengleichungen 01
 . Klasse TOP 0 Grundwissen Geradengleichungen 0 Punkt-Richtungs-Form Geraden sind gegeben durch einen Aufpunkt A (mit Ortsvektor a) auf der Geraden und einen Richtungsvektor u: x = a + λ u, λ IR. (Interpretation:
. Klasse TOP 0 Grundwissen Geradengleichungen 0 Punkt-Richtungs-Form Geraden sind gegeben durch einen Aufpunkt A (mit Ortsvektor a) auf der Geraden und einen Richtungsvektor u: x = a + λ u, λ IR. (Interpretation:
Kapitel VI. Euklidische Geometrie
 Kapitel VI. Euklidische Geometrie 1 Abstände und Lote Wiederholung aus Kapitel IV. Wir versehen R n mit dem Standard Skalarprodukt x 1 y 1.,. := x 1 y 1 +... + x n y n x n y n Es gilt für u, v, w R n und
Kapitel VI. Euklidische Geometrie 1 Abstände und Lote Wiederholung aus Kapitel IV. Wir versehen R n mit dem Standard Skalarprodukt x 1 y 1.,. := x 1 y 1 +... + x n y n x n y n Es gilt für u, v, w R n und
9. Turbulenz in Flüssigkeiten
 9. Turbulenz in Flüssigkeiten Experimentelle Beobachtungen bei strömungen in Rohren (Osborne, Reynolds 1883) Laminare Strömung laminare Strömung bei geringer Strömungsgeschwindigkeit Durchfluss j ist proportional
9. Turbulenz in Flüssigkeiten Experimentelle Beobachtungen bei strömungen in Rohren (Osborne, Reynolds 1883) Laminare Strömung laminare Strömung bei geringer Strömungsgeschwindigkeit Durchfluss j ist proportional
Mathematik 1, Teil B. Inhalt:
 FH Emden-Leer Fachb. Technik, Abt. Elektrotechnik u. Informatik Prof. Dr. J. Wiebe www.et-inf.fho-emden.de/~wiebe Mathematik 1, Teil B Inhalt: 1.) Grundbegriffe der Mengenlehre 2.) Matrizen, Determinanten
FH Emden-Leer Fachb. Technik, Abt. Elektrotechnik u. Informatik Prof. Dr. J. Wiebe www.et-inf.fho-emden.de/~wiebe Mathematik 1, Teil B Inhalt: 1.) Grundbegriffe der Mengenlehre 2.) Matrizen, Determinanten
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler im WS 2013/14 Lösungen zu den Übungsaufgaben (Vortragsübung) Blatt 7
 Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler im WS 203/4 Lösungen zu den Übungsaufgaben (Vortragsübung) Blatt 7 Aufgabe 27 Sei eine lineare Abbildung f : R 4 R 3 gegeben durch f(x, x 2, x 3 ) = (2 x 3 x 2
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler im WS 203/4 Lösungen zu den Übungsaufgaben (Vortragsübung) Blatt 7 Aufgabe 27 Sei eine lineare Abbildung f : R 4 R 3 gegeben durch f(x, x 2, x 3 ) = (2 x 3 x 2
Elektrische Schwingungen und Wellen
 Einführung in die Physik II für Studierende der Naturwissenschaften und Zahnheilkunde Sommersemester 2007 VL #4 am 0.07.2007 Vladimir Dyakonov Elektrische Schwingungen und Wellen Wechselströme Wechselstromgrößen
Einführung in die Physik II für Studierende der Naturwissenschaften und Zahnheilkunde Sommersemester 2007 VL #4 am 0.07.2007 Vladimir Dyakonov Elektrische Schwingungen und Wellen Wechselströme Wechselstromgrößen
Spezialfall: Die Gleichung ax = b mit einer Unbekannten x kann mit Hilfe des Kehrwerts 1 a = a 1 gelöst werden:
 Inverse Matritzen Spezialfall: Die Gleichung ax b mit einer Unbekannten x kann mit Hilfe des Kehrwerts 1 a a 1 gelöst werden: ax b x b a a 1 b. Verallgemeinerung auf Ax b mit einer n nmatrix A: Wenn es
Inverse Matritzen Spezialfall: Die Gleichung ax b mit einer Unbekannten x kann mit Hilfe des Kehrwerts 1 a a 1 gelöst werden: ax b x b a a 1 b. Verallgemeinerung auf Ax b mit einer n nmatrix A: Wenn es
Hydrodynamik Kontinuitätsgleichung. Massenerhaltung: ρ. Massenfluss. inkompressibles Fluid: (ρ 1 = ρ 2 = konst) Erhaltung des Volumenstroms : v
 Hydrodynamik Kontinuitätsgleichung A2, rho2, v2 A1, rho1, v1 Stromröhre Massenerhaltung: ρ } 1 v {{ 1 A } 1 = ρ } 2 v {{ 2 A } 2 m 1 inkompressibles Fluid: (ρ 1 = ρ 2 = konst) Erhaltung des Volumenstroms
Hydrodynamik Kontinuitätsgleichung A2, rho2, v2 A1, rho1, v1 Stromröhre Massenerhaltung: ρ } 1 v {{ 1 A } 1 = ρ } 2 v {{ 2 A } 2 m 1 inkompressibles Fluid: (ρ 1 = ρ 2 = konst) Erhaltung des Volumenstroms
Formelzusammenstellung
 Übung zu Mechanik 4 - ormelsammlung Seite 4 ormelzusammenstellung. Grundbegriffe Harmonische Schwingung Sinusschwingung: (t) sin ( t + ϕ) Schwingungsamplitude: Kreisfrequenz: Phasenwinkel: requenz: f Schwingungsdauer,
Übung zu Mechanik 4 - ormelsammlung Seite 4 ormelzusammenstellung. Grundbegriffe Harmonische Schwingung Sinusschwingung: (t) sin ( t + ϕ) Schwingungsamplitude: Kreisfrequenz: Phasenwinkel: requenz: f Schwingungsdauer,
Einführung in die Numerik strukturerhaltender Zeitintegratoren. Leonard Schlag 6. Dezember 2010
 Einführung in die Numerik strukturerhaltender Zeitintegratoren Leonard Schlag 6. Dezember 2010 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung in die Numerik strukturerhaltender Zeitintegratoren 3 1.1 Häuge Problemstellung:
Einführung in die Numerik strukturerhaltender Zeitintegratoren Leonard Schlag 6. Dezember 2010 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung in die Numerik strukturerhaltender Zeitintegratoren 3 1.1 Häuge Problemstellung:
ε δ Definition der Stetigkeit.
 ε δ Definition der Stetigkeit. Beweis a) b): Annahme: ε > 0 : δ > 0 : x δ D : x δ x 0 < δ f (x δ f (x 0 ) ε Die Wahl δ = 1 n (n N) generiert eine Folge (x n) n N, x n D mit x n x 0 < 1 n f (x n ) f (x
ε δ Definition der Stetigkeit. Beweis a) b): Annahme: ε > 0 : δ > 0 : x δ D : x δ x 0 < δ f (x δ f (x 0 ) ε Die Wahl δ = 1 n (n N) generiert eine Folge (x n) n N, x n D mit x n x 0 < 1 n f (x n ) f (x
Simulationsmethoden in der Bayes-Statistik
 Simulationsmethoden in der Bayes-Statistik Hansruedi Künsch Seminar für Statistik, ETH Zürich 6. Juni 2012 Inhalt Warum Simulation? Modellspezifikation Markovketten Monte Carlo Simulation im Raum der Sprungfunktionen
Simulationsmethoden in der Bayes-Statistik Hansruedi Künsch Seminar für Statistik, ETH Zürich 6. Juni 2012 Inhalt Warum Simulation? Modellspezifikation Markovketten Monte Carlo Simulation im Raum der Sprungfunktionen
Trigonometrie. bekannte Zusammenhänge. 4-Streckensatz: groß/klein = groß/klein. Zusammenhänge im allgemeinen Dreieck:
 Trigonometrie bekannte Zusammenhänge 4-Streckensatz: groß/klein = groß/klein Zusammenhänge im allgemeinen Dreieck: Summe zweier Seiten größer als dritte Seitenlänge: a + b > c Innenwinkelsumme: Summe der
Trigonometrie bekannte Zusammenhänge 4-Streckensatz: groß/klein = groß/klein Zusammenhänge im allgemeinen Dreieck: Summe zweier Seiten größer als dritte Seitenlänge: a + b > c Innenwinkelsumme: Summe der
Asymmetrische Spiele. Eric Barré. 13. Dezember 2011
 Asymmetrische Spiele Eric Barré 13. Dezember 2011 Gliederung 1 Einführung Allgemeines Definition Begründung Nash-Gleichgewicht 2 Kampf der Geschlechter Allgemein Auszahlungsmatrix Nash-Gleichgewicht Beispiel
Asymmetrische Spiele Eric Barré 13. Dezember 2011 Gliederung 1 Einführung Allgemeines Definition Begründung Nash-Gleichgewicht 2 Kampf der Geschlechter Allgemein Auszahlungsmatrix Nash-Gleichgewicht Beispiel
Fourier-Zerlegung, Fourier-Synthese
 Fourier-Zerlegung, Fourier-Synthese Periodische Funktionen wiederholen sich nach einer Zeit T, der Periode. Eine periodische Funktion f(t) mit der Periode T genügt der Beziehung: f( t+ n T) = f( t) für
Fourier-Zerlegung, Fourier-Synthese Periodische Funktionen wiederholen sich nach einer Zeit T, der Periode. Eine periodische Funktion f(t) mit der Periode T genügt der Beziehung: f( t+ n T) = f( t) für
9.2 Invertierbare Matrizen
 34 9.2 Invertierbare Matrizen Die Division ist als Umkehroperation der Multiplikation definiert. Das heisst, für reelle Zahlen a 0 und b gilt b = a genau dann, wenn a b =. Übertragen wir dies von den reellen
34 9.2 Invertierbare Matrizen Die Division ist als Umkehroperation der Multiplikation definiert. Das heisst, für reelle Zahlen a 0 und b gilt b = a genau dann, wenn a b =. Übertragen wir dies von den reellen
Flüsse, Fixpunkte, Stabilität
 1 Flüsse, Fixpunkte, Stabilität Proseminar: Theoretische Physik Yannic Borchard 7. Mai 2014 2 Motivation Die hier entwickelten Formalismen erlauben es, Aussagen über das Verhalten von Lösungen gewöhnlicher
1 Flüsse, Fixpunkte, Stabilität Proseminar: Theoretische Physik Yannic Borchard 7. Mai 2014 2 Motivation Die hier entwickelten Formalismen erlauben es, Aussagen über das Verhalten von Lösungen gewöhnlicher
9 Die Normalverteilung
 9 Die Normalverteilung Dichte: f(x) = 1 2πσ e (x µ)2 /2σ 2, µ R,σ > 0 9.1 Standard-Normalverteilung µ = 0, σ 2 = 1 ϕ(x) = 1 2π e x2 /2 Dichte Φ(x) = 1 x 2π e t2 /2 dt Verteilungsfunktion 331 W.Kössler,
9 Die Normalverteilung Dichte: f(x) = 1 2πσ e (x µ)2 /2σ 2, µ R,σ > 0 9.1 Standard-Normalverteilung µ = 0, σ 2 = 1 ϕ(x) = 1 2π e x2 /2 Dichte Φ(x) = 1 x 2π e t2 /2 dt Verteilungsfunktion 331 W.Kössler,
I. Mechanik. I.4 Fluid-Dynamik: Strömungen in Flüssigkeiten und Gasen. Physik für Mediziner 1
 I. Mechanik I.4 Fluid-Dynamik: Strömungen in Flüssigkeiten und Gasen Physik für Mediziner Stromdichte Stromstärke = durch einen Querschnitt (senkrecht zur Flussrichtung) fließende Menge pro Zeit ( Menge
I. Mechanik I.4 Fluid-Dynamik: Strömungen in Flüssigkeiten und Gasen Physik für Mediziner Stromdichte Stromstärke = durch einen Querschnitt (senkrecht zur Flussrichtung) fließende Menge pro Zeit ( Menge
3.1.3 Newtonsche Interpolationsformel / Dividierte Differenzen
 KAPITEL 3 INTERPOLATION UND APPROXIMATION 4 33 Newtonsche Interpolationsformel / Dividierte Differenzen Das Verfahren von Neville ist unpraktisch, wenn man das Polynom selbst sucht oder das Polynom an
KAPITEL 3 INTERPOLATION UND APPROXIMATION 4 33 Newtonsche Interpolationsformel / Dividierte Differenzen Das Verfahren von Neville ist unpraktisch, wenn man das Polynom selbst sucht oder das Polynom an
Stellen Sie für die folgenden Reaktionen die Gleichgewichtskonstante K p auf: 1/2O 2 + 1/2H 2 OH H 2 + 1/2O 2 H 2 O
 Klausur H2004 (Grundlagen der motorischen Verbrennung) 2 Aufgabe 1.) Stellen Sie für die folgenden Reaktionen die Gleichgewichtskonstante K p auf: 1/2O 2 + 1/2H 2 OH H 2 + 1/2O 2 H 2 O Wie wirkt sich eine
Klausur H2004 (Grundlagen der motorischen Verbrennung) 2 Aufgabe 1.) Stellen Sie für die folgenden Reaktionen die Gleichgewichtskonstante K p auf: 1/2O 2 + 1/2H 2 OH H 2 + 1/2O 2 H 2 O Wie wirkt sich eine


