Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht Didaktik und Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache
|
|
|
- Klaus Burgstaller
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht Didaktik und Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache ISSN Jahrgang 19, Nummer 1 (April 2014) Interkomprehension im schulischen Russischunterricht? Ein Experiment mit sächsischen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8 Grit Mehlhorn 1 Universität Leipzig Institut für Slavistik Beethovenstr Leipzig Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) mehlhorn@rz.uni-leipzig.de Abstract: Die attraktive Idee der Interkomprehension, formal nicht erlernte Sprachen zu verstehen, hat vor allem innerhalb der romanischen Sprachen beeindruckende Ergebnisse in der Umsetzung gezeigt. Auch im schulischen Kontext konnten gute Resultate in den rezeptiven Kompetenzen von z.b. Spanisch- und Italienischlernenden mit guten Französischkenntnissen nachgewiesen werden. Für das Russische ist das in dieser Form leider nicht übertragbar, da die SchülerInnen maximal eine slawische Sprache in der Schule lernen. Will man dennoch zumindest Elemente der Interkomprehension auch für die slawischen Schulfremdsprachen nutzen, bleibt nur die sprachfamilienübergreifende Interkomprehension. In diesem Artikel werden Ergebnisse eines Interkomprehensionsexperiments vorgestellt, das mit 123 SchülerInnen der 8. Klasse an acht sächsischen Gymnasien durchgeführt wurde, die Russisch als dritte Fremdsprache begonnen und zum Zeitpunkt der Erhebung wenige Wochen nach Schuljahresbeginn gerade die kyrillische Schrift gelernt hatten. The attractive idea that intercomprehension permits a person to understand languages that s/he has not learned formally has yielded impressive results in its implementation, above all with the Romance languages. In the school context, too, good results have also been obtained for the receptive competencies, for example, of Spanish and Italian learners with a sound background in French. Unfortunately, this approach is not transferable in this form for Russian since pupils are learning at most one Slavic language in school. If it is nevertheless desirable to make use of at least some intercomprehension elements for learning Slavic languages in school this is only possible by making use of intercomprehension across language families. This article presents the results of an intercomprehension experiment involving 123 eighth-grade pupils at eight high schools in Saxony who started Russian as their third foreign language and who at the time of the survey a few weeks after the start of the school year had only just learned the Cyrillic alphabet. Schlagwörter: Interkomprehension, Russisch, slawische Sprachen, sprachfamilienübergreifend, kyrillische Schrift, Tertiärsprache 1. Einleitung Im schulischen Fremdsprachenunterricht wird der Grundstein für weiteres Sprachenlernen gelegt. Deshalb ist die Umsetzung von Konzepten der Mehrsprachigkeitsdidaktik gerade für den schulischen Kontext von besonderer Relevanz. In diesem Sinne plädiert Beier (2000) dafür, dass die Schüler vor dem Hintergrund ihres eigenen Wissens und ihrer Vorkenntnisse aus anderen Sprachen ermutigt werden [sollen], Hypothesen aufzustellen, bei denen sie erfahren, dass sie mehr in der neuen Sprache verstehen, als sie glauben. Gerade in dieser bewussten Nutzung des Vorwissens und des bereits stärker entwickelten Sprachbewusstseins liegt die Chance für eine Neugestaltung des Tertiärsprachenunterrichts (Beier 2000: 63). Hierfür kann auf die inzwischen vorliegenden Arbeiten zur Tertiärsprachendidaktik und zu mehrsprachigkeitsorientierten Ansätzen zurückgegriffen werden, insbesondere auf das Konzept des Gesamtsprachencurriculums von
2 Hufeisen & Lutjeharms (2005) sowie Hufeisen (2011). Modelle zur wissenschaftlichen Beschreibung multiplen Sprachenlernens (für einen Überblick vgl. Hufeisen 2003), aus denen Lehrparadigmen bzw. didaktische Ansätze hervorgegangen sind, liefern z.b. die Interkomprehensionsdidaktik (vgl. u.a. Meißner 2004, 2010), das Gesamtsprachencurriculum (vgl. Hufeisen 2005) und das sprachenübergreifende Lehren und Lernen (vgl. Behr 2010, 2011). Im vorliegenden Artikel werden zunächst Überlegungen zur sprachfamilienübergreifenden Interkomprehension mit Russisch als Zielsprache angestellt, bevor die Erkenntnisinteressen der hier vorgestellten Untersuchung erläutert und das methodische Vorgehen der Studie skizziert werden. An die Präsentation der Ergebnisse schließt sich eine Diskussion der Daten an, die auch die verwendete Forschungsmethodologie reflektiert und Überlegungen zum Transfer der Ergebnisse in die Praxis des Russischunterrichts anstellt Interkomprehension in der Mehrsprachigkeitsforschung Mit Interkomprehension ist Bär (2009) zufolge das partielle Verstehen von Sprachen gemeint, die weder formal erlernt noch natürlich erworben wurden. Der Begriff wird in Deutschland vorwiegend im Zusammenhang mit nahverwandten Sprachen verwendet. Insbesondere innerhalb der romanischen Sprachen sind hier beeindruckende Ergebnisse für den schulischen Kontext belegt. In Bezug auf die Erforschung der Interkomprehension für slawische Sprachen besteht dagegen noch Nachholbedarf Interkomprehension innerhalb von Sprachfamilien Die interkomprehensive Erschließung von Texten einer noch nicht gelernten Sprache funktioniert aufgrund der optimalen Nutzung interlingualer Transferbasen lexikalischer und morphosyntaktischer Art innerhalb derselben Sprachfamilie, der sogenannten sieben Siebe in der EuroCom-Methode. Demzufolge muss ein zu verstehender Text in einer neuen Sprache durch mehrere mentale Siebe verarbeitet werden, die das schon Bekannte herausfiltern und zu einem Textverstehen zusammenfügen. Diese sieben Siebe umfassen Sieb 1: Internationalen Wortschatz Sieb 2: Panslawischen Wortschatz Sieb 3: Lautentsprechungen Sieb 4: Graphien und Aussprachen Sieb 5: Morphosyntax Sieb 6: Slawische Kernsatztypen Sieb 7: Präfixe und Suffixe (vgl. u.a. Zybatow & Zybatow 2006: sowie die Webseite zu EuroComSlav). Bei der europäischen Interkomprehension geht es um das Lese- und Hörverstehen der jeweiligen Zielsprachen. Mögliche Umsetzungen hierfür zeigen die Publikationen zu EuroComRom (Klein & Stegmann 2000), EuroCom- Germ (Hufeisen & Marx 2007) und zur slawischen Interkomprehension (Tafel, Durić, Lemmen, Olshevska & Przyborowska-Stolz 2009). Interkomprehensiven Verfahren wird ein positiver Einfluss auf die Sprachbewusstheit, Autonomie und Motivation der Lernenden zugeschrieben Sprachfamilienübergreifende Interkomprehension Unter bestimmten Voraussetzungen ist Interkomprehension auch zwischen typologisch weiter entfernten Sprachen über die Grenzen von Sprachfamilien hinweg möglich. Filomena Capucho (2002, zitiert nach Doyé 2008: 218) sieht Interkomprehension not only as the result of linguistic transfer between languages of the same family, but as the result of the transfer of strategies in the framework of a general interpretative process which underlies all communicative activity. Da es Verwandtschaftsbeziehungen verschiedenen Grades zwischen den Sprachen gibt, ist die Zugehörigkeit zur gleichen Sprachfamilie nicht die einzig relevante Form von Verwandtschaft. Doyé (2008: 230) plädiert daher für eine differenzierte Sichtweise in Bezug auf Sprachverwandtschaft. Klein & Reissner (2006) sowie Ollivier (2007) haben gezeigt, dass Interkomprehension auch zwischen Sprachfamilien möglich ist. Dabei kann der geringere Grad an sprachlicher Ähnlichkeit durch verstärkte Nutzung von außersprachlichen Wissensquellen wie Weltwissen und dem situationalen Kontext sowie durch zielgerichteten Einsatz von Strategien kompensiert werden. Die sprachliche Nähe zwischen den zuvor gelernten Sprachen und der Zielsprache bestimmt den Schwierigkeitsgrad Grit Mehlhorn (2014), Interkomprehension im schulischen Russischunterricht? Ein Experiment mit sächsischen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 19: 1, Abrufbar unter
3 150 interkomprehensiver Kommunikation. Doyé (2008: 216) benennt eine Reihe von Gelingensfaktoren für erfolgreiche Interkomprehension, u.a. die Allgemeinbildung der KommunikationspartnerInnen, ihr Fachwissen auf dem jeweils behandelten Gebiet, ihre verbale Intelligenz, ihre Motivation, weitere Persönlichkeitsmerkmale wie Mut und Selbstvertrauen vs. Ängstlichkeit und Selbstzweifel, die grammatische Struktur der Zielsprache, den Wortreichtum der Zielsprache, das verwendete Schriftsystem, das phonologische System sowie die Verwandtschaft der Zielsprache mit der Ausgangssprache der Kommunikanten. Meines Erachtens muss sprachfamilienübergreifende Interkomprehension zumindest in Bezug auf die slawischen Sprachen eine etwas andere Zielsetzung als Interkomprehension innerhalb einer Sprachfamilie haben. Ich sehe sprachfamilienübergreifende Interkomprehension im Kontext des sprachenübergreifenden und entdeckenden Lernens und als Mittel zur Bewusstmachung von Ähnlichkeiten zwischen Sprachen. Bei interkomprehensiven Verfahren geht es um das Zwischen-Sprachen-Verstehen, d.h. um rein rezeptive Fertigkeiten. Auf dieser Grundlage können produktive Kompetenzen entwickelt werden. Mit sprachfamilienübergreifender Interkomprehension kann v.a. beim Einstieg in die erste slawische Sprache gearbeitet werden. Bei fortgeschritteneren Russischlernenden ergeben sich zudem Möglichkeiten der Interkomprehension beim Verstehen von Fachtexten. Doyé (2008) berichtet von sprachfamilienübergreifenden Interkomprehensionsexperimenten mit mehreren Zielsprachen, darunter auch Tschechisch (Leseverstehen) und Russisch (Hörverstehen) mit Studierenden sowie SchülerInnen mit recht niederschmetternden Ergebnissen: Von 14 relevanten Aussagen wurden durchschnittlich 1,2 im Text Prag verstanden und 0,7 in der russischen Geschichte (Doyé 2008: ). Die Schwierigkeiten mit dem Hörverstehen hängen sicher auch damit zusammen, dass im Russischen alle unbetonten Vokale stark quantitativ und qualitativ reduziert werden, so dass Personen, die kein Russisch gelernt haben, auch Wörter, die sie in geschriebener Form verstehen würden, oft perzeptiv nicht wiedererkennen. Hier würden slawische Sprachen ohne Vokalreduktion wie Polnisch und Tschechisch möglicherweise bessere Ergebnisse liefern. Leider wurden die verwendeten Texte der Experimente nicht abgedruckt, so dass nicht nachvollziehbar ist, ob sie für alle getesteten Sprachen in etwa gleich schwer waren. Vermutlich hatten die meisten Testpersonen weniger Vorwissen über eine tschechische als eine spanische oder belgische Stadt, was durchaus eine Rolle für das Verstehen der Texte spielen könnte. Russisch ist eine typische Tertiärsprache, die an deutschen Schulen als zweite, dritte oder vierte Fremdsprache gelernt wird. Das Russische gilt allgemein als schwierige Sprache, was zum Teil auf die kyrillische Schrift und v.a. auf subjektive Überzeugungen und eine große wahrgenommene Sprachdistanz slawischer Sprachen zum Deutschen zurückzuführen ist, die aus linguistischer Sicht nicht haltbar ist (vgl. Mehlhorn im Druck). Als ostslawische Sprache gehört das Russische wie die germanischen und romanischen Sprachen auch zu den indoeuropäischen Sprachen. Es ist eine flektierende Sprache mit sechs Kasus, Verbkonjugation, der Kategorie des Verbalaspekts, Kongruenz zwischen Subjekt und Verb sowie zwischen Adjektiven und Substantiven innerhalb von Nominalgruppen. Durch die reiche Morphologie ist eine relativ freie Wortstellung möglich, die weniger Beschränkungen als das Deutsche unterliegt. Während der panslawische Wortschatz sehr umfangreich ist, teilen Russisch und die germanischen Sprachen wesentlich weniger internationalen Wortschatz als die romanischen und germanischen Sprachen; dennoch gibt es durch Sprachkontakte bedingte Lehnwörter aus dem Französischen, Italienischen, Deutschen und Englischen (vgl. Mehlhorn 2013). Die relativ enge Verbundenheit mit dem Lateinischen ist für Interkomprehension zwischen romanischen und germanischen Sprachen ausgesprochen hilfreich. In den slawischen Sprachen ist die Zahl von Wörtern lateinischen Ursprungs wesentlich kleiner, so dass die Interkomprehension hier mehr Schwierigkeiten mit sich bringt (vgl. Otwinowska-Kasztelanic 2009). Morkötter (2010: 238) verweist darauf, dass es in einer sprachfamilienübergreifenden Perspektive mit weniger interlingualen Transferbasen v.a. um die Förderung von multilingual language awareness geht. Im schulischen Tertiärsprachenunterricht sollten daher Ähnlichkeiten zwischen den bereits gelernten Sprachen der SchülerInnen und der Zielsprache bewusst gemacht und auch gezielt für die Vermittlung des Russischen genutzt werden (vgl. Mehlhorn 2008, 2011a). Grit Mehlhorn (2014), Interkomprehension im schulischen Russischunterricht? Ein Experiment mit sächsischen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 19: 1, Abrufbar unter
4 Erkenntnisinteresse und Forschungsdesign Das Interkomprehensionsexperiment wurde im Rahmen eines Projekts zur Mehrsprachigkeit in der Schule durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Forschungsvorhaben der Leipziger Fachdidaktiken für slawische und romanische Schulfremdsprachen (geleitet von Grit Mehlhorn und Christiane Neveling), das durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert wurde. Ziel war es herauszufinden, inwiefern SchülerInnen, die Russisch (bzw. auch Spanisch) als dritte Fremdsprache lernen, zuvor gelernte Sprachen beim Fremdsprachenerwerb nutzen. 2 Die Erkenntnisinteressen bezogen sich insbesondere auf die von den Lernenden wahrgenommenen Ähnlichkeiten zwischen der dritten Fremdsprache und zuvor bzw. parallel gelernten Sprachen, subjektiv empfundene Lernerleichterungen sowie auf tatsächlich stattfindenden Transfer. Insbesondere durch die Interkomprehensionsaufgaben sollte untersucht werden, wie das vorhandene Transferpotential tatsächlich genutzt wird. Im Rahmen des Projekts wurden zunächst Russisch- und Spanischlehrende bundesweit schriftlich befragt und in Sachsen Experteninterviews mit Unterrichtenden der dritten Fremdsprachen durchgeführt (ausführlicher vgl. Mehlhorn & Neveling 2012; Mehlhorn & Wahlicht 2011 sowie Neveling 2012). Im vorliegenden Artikel steht der Teil des Projekts im Vordergrund, der sich mit der Untersuchung von sächsischen SchülerInnen beschäftigt, die Russisch als dritte Fremdsprache ab Klasse 8 lernen. Von November 2010 bis Januar 2011 wurden mit dieser Zielgruppe schriftliche Befragungen durchgeführt und denselben Lernenden wurde ein authentischer Text in der Zielsprache mit Aufgaben zur Textbearbeitung vorgelegt. Die Datenerhebung wurde von Madlen Wahlicht durchgeführt (vgl. auch Lippold 2013). Bei den Lernenden handelt es sich um die Klassen der befragten sächsischen Lehrkräfte (s.o.). Im Folgenden werden die Ergebnisse dargestellt, die sich mit Interkomprehension in Bezug auf einen russischsprachigen Text beschäftigen. 4. Datenerhebung Die befragten SchülerInnen lernen Russisch als dritte Fremdsprache an sächsischen Gymnasien im sprachlichen Profil ab Klasse 8. 3 Sprachliches Profil bedeutet jedoch nicht, dass dem Sprachunterricht mehr Wochenstunden zur Verfügung stehen würden: Im 8. Schuljahr sind es lediglich drei. Bis zur Oberstufe sollen die Lernenden laut dem sächsischen Lehrplan für das Gymnasium (SMK 2011: 4) sprachlich dasselbe Niveau erreichen wie SchülerInnen, die Russisch als zweite Fremdsprache lernen (in Sachsen ab Klasse 6), also bereits zwei Jahre früher damit begonnen haben und weiterhin Russisch lernen: B2 im Grundkurs und B2 +, in Teilbereichen C1 im Leistungskurs. 4 Die untersuchten 8. Klassen hatten zum Zeitpunkt der Erhebung erst wenige Wochen Russischunterricht hinter sich und gerade die kyrillischen Buchstaben gelernt. Sie wurden zunächst schriftlich zu ihrem Sprachenlernen befragt und lösten direkt im Anschluss Aufgaben 5 zur Interkomprehension. Dazu erhielten die Lernenden einen russischsprachigen Originaltext, der weit über ihrem sprachlichen Niveau lag, aber durch Bildunterstützung und das gehäufte Vorkommen von Internationalismen gewisse Verstehenshilfen bot (vgl. Anhang). Die Ergebnisse der schriftlichen Schülerbefragung werden hier kurz zusammengefasst (ausführlicher Mehlhorn im Druck), um die Daten des Interkomprehensionsexperiments besser einordnen zu können. Datengrundlage für die Erhebung sind 123 ausgefüllte Fragebögen von AchtklässlerInnen aus acht sächsischen Gymnasien mit Russisch als dritter Fremdsprache, die über ihre Lernbiographien, Motive zum Russischlernen, ihre Einschätzung des Nutzens zuvor gelernter Sprachen, einfache und schwierige Phänomene in den gelernten Fremdsprachen, zum außerunterrichtlichen Gebrauch der Sprachen und zu wahrgenommenen Ähnlichkeiten zwischen ihren Sprachen Auskunft erteilt haben. Fast alle Befragten (n=121) geben Deutsch als L1 an, 9 SchülerInnen erwähnen zusätzlich Russisch als Erstsprache; jeweils eine Schülerin hat Russisch bzw. Litauisch als alleinige L1. 6 Die Daten dieser Lernenden wurden separat betrachtet, weil bei ihnen nicht die Voraussetzungen für Interkomprehension gegeben sind. Dennoch sind ihre Ergebnisse interessant für den Vergleich mit den MitschülerInnen. Nur für ca. ein Zehntel der Befragten gehört Russisch zum Alltag; das entspricht der Anzahl der Lernenden mit russischsprachigem Hintergrund. Drei Viertel der Befragten sind Mädchen was weniger an der Fremdsprache Russisch als an dem sprachlichen Profil zu liegen scheint. Alle Befragten haben Englisch als erste Fremdsprache gelernt, in der Regel ab Klasse 3. Die zweiten gelernten Fremdsprachen sind Französisch (58%), Latein (33%) und Spanisch (9%). Knapp zwei Drittel der befragten SchülerInnen sind der Meinung, dass ihnen bereits gelernte Sprachen das Russischlernen erleichtern. Die Befragung hat eindeutig ergeben, dass Englisch von den Lernenden als leichter im Ver- Grit Mehlhorn (2014), Interkomprehension im schulischen Russischunterricht? Ein Experiment mit sächsischen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 19: 1, Abrufbar unter
5 152 gleich zu den anderen Fremdsprachen empfunden wird. 109 SchülerInnen können Beispiele für Gemeinsamkeiten zwischen Russisch und Deutsch nennen, 86 zwischen Russisch und Englisch. Die vorwiegend positive Einstellung der SchülerInnen gegenüber dem Einfluss zuvor gelernter Sprachen ist sicher teilweise auf die Verwendung vieler Internationalismen im Anfangsunterricht (u.a. im verwendeten Russischlehrwerk) und auf Sprachvergleiche der Unterrichtenden zurückzuführen, von denen einige gleichzeitig auch Englisch- oder Deutschlehrende sind. Der von den Lernenden zu bearbeitende Text wird hier im Unterschied zur Situation im Interkomprehensionsexperiment (vgl. Anhang) nicht in kyrillischen Buchstaben, sondern in der transliterierten Form und ohne Bilder wiedergegeben. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die theoretisch erschließbaren Kognaten unterstrichen. MUZ-ТV pervyj rossijskij muzykal nyj telekanal. V ėfire s sentjabrja 1995 goda. Osnovnoj konkurent na rossijskom rynke MTV Rossija. Ofis telekanala raspolagaetsja na tret em ėtaže ofisnogo centra na Varšavskom šоsse v Moskve. Ėfir kanala sostoit iz muzykal nogo i razvlekatel nogo kontenta. Muzykal nyj format MUZ-TV rossijskaja i zapadnaja pop-muzyka (Quelle: abgerufen am ). 7 Ins Deutsche könnte der Text folgendermaßen übersetzt werden: MUZ-TV ist der erste russische Musik-Fernsehsender. Er ist seit September 1995 auf Sendung. Hauptkonkurrent auf dem russischen Markt ist MTV Russland. Das Büro des Fernsehsenders befindet sich in der dritten Etage des Bürogebäudes auf der Warschauer Chaussee in Moskau. Das Programm des Senders besteht aus Musik- und Unterhaltungsinhalten. Das musikalische Format von MUZ-TV sind russische und westliche Popmusik ( GM). Der Text wurde aufgrund folgender Überlegungen ausgewählt: Thematik (Interesse von Lernenden dieses Alters für Musik), angenommenes Weltwissen (die Lernenden kennen den Musiksender MTV und wissen möglicherweise auch, dass MTV nicht nur in Deutschland ausgestrahlt wird), Kürze des Textes (46 Wörter), relativ hohe Anzahl theoretisch erschließbarer Wörter, die in ähnlicher Form im Deutschen als Fremdund/oder Lehnwörter vorkommen, davon o Substantive: 17 Tokens von 21 (bzw. 14 Types), o Adjektive: 8 Tokens von 13 (bzw. 4 Types), Wiederholung theoretisch erschließbarer Wörter: muzykal nyj, MUZ-TV. Die SchülerInnen hatten bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung kaum Verben gelernt. Das hängt u.a. damit zusammen, dass die Kopula von sein im russischen Präsens nicht ausgedrückt wird, z.b. Ja studentka (wörtlich ich Studentin, bedeutet Ich bin Studentin ). Im ausgewählten Interkomprehensionstext kommen nur zwei overte Verben vor. Vier Sätze enthalten eine Nullkopula, die im ersten, dritten und sechsten Satz durch einen Gedankenstrich verdeutlicht wird. Da der Anfangsunterricht mit einfachen Aussagen über die eigene Person und Personen in ihrem Umfeld beginnt, spielen Verben in den ersten Wochen des Russischunterrichts kaum eine Rolle. Man kann also nicht davon ausgehen, dass die SchülerInnen in dem vorliegenden Text Konjugationsendungen erkennen und somit zumindest auf die Wortart Verb schließen konnten. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass das Subjekt im zweiten Satz (logisch wäre die pronominale Wiederaufnahme von russischer Musiksender mit on er ) in diesem Text ausgelassen wurde. An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass der Text keine Betonungszeichen enthielt, wie sie normalerweise in russischen Lehrbuchtexten der ersten Lernjahre üblich sind. Die Wortakzentposition im Russischen ist für die Lernenden anfangs wenig vorhersehbar, aber für die Lautform besonders relevant, da alle nicht betonten Vokale im Russischen stark reduziert werden und so falsch betonte Wörter stark verfremdet werden können. Die Betonungszeichen wären für die Erschließung durch die SchülerInnen eine große Hilfe gewesen, fehlen aber auch in russischen Originaltexten. Statt kohärenter Fließtexte wie der hier verwendete hatten die Lernenden vor dem Test im Russischunterricht v.a. kurze Mini-Dialoge gelesen. Authentische Texte bezogen sich im Lehrwerk bisher v.a. auf russischsprachige Aufschriften. Grit Mehlhorn (2014), Interkomprehension im schulischen Russischunterricht? Ein Experiment mit sächsischen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 19: 1, Abrufbar unter
6 Für die Bearbeitung des schriftlichen Fragebogens und der Interkomprehensionstexte stand eine Doppelstunde im Russischunterricht zur Verfügung. Am Ende erfolgte gemeinsam mit den Lernenden eine Besprechung des Interkomprehensionstextes und der Lösungen durch die Versuchsleiterin. Die SchülerInnen sollten den Text lesen, nach einem ersten globalen Lesen Vermutungen über den Inhalt anstellen, dann alle Wörter übersetzen, die sie zu verstehen glaubten, dazuschreiben, aus welcher Sprache sie das jeweilige Wort kennen, eine Zusammenfassung anfertigen und zu ausgewählten Wörtern aus dem Text die Wortart bestimmen und erläutern, woran sie diese erkannt haben Darstellung der Ergebnisse und Datenauswertung Bei der Bearbeitung der Textaufgabe wurden die Lernenden gebeten, sich den Text МUZ-ТV zunächst einmal durchzulesen, sich die Bilder anzuschauen und Vermutungen anzustellen, worum es im Text geht. Die antizipierte Inhaltsangabe sollte einen Satz umfassen. Im Folgenden werden exemplarisch einige Antworten der SchülerInnen angeführt, wobei es sich bei den Antworten der Lernenden 001, 011, 047 und 053 um falsche Vermutungen handelt. Es könnte um einen Musikkanal gehen (002). Es geht um MUS-TV, wann und wo er gegründet wurde, wo er jetzt ist und was er macht (003). Um einen Musiksender wie MTV oder VIVA (006). Es geht um die Entwicklung eines russischen Musiksenders (031). Um einen russischen Musiksender, der Pop-Musik spielt (050). Es könnte um einen russischen Musiksender gehen, der aus Moskau gesendet wird und ein Konkurrent von MTV-Rossia ist (078). Es könnte um einen Fernsehauftritt gehen (001). Um ein Musical im Telekanal (011). Es geht um ein Konzert in Moskau (047). Hierbei könnte es sich um ein Musikduell handeln, was in der Nacht stattfindet (053). Von den zehn Lernenden, die sich als russische MuttersprachlerInnen bezeichnen und die in diesem Diagramm nicht erfasst sind, haben sieben eine richtige und zwei eine teilweise korrekte Vermutung über den Textinhalt angestellt. Ein Schüler hat nichts geschrieben. Die falsche Vermutung von Schüler (053), dass es um ein Ereignis in der Nacht geht, wurde offensichtlich durch das erste Bild zu dem Text hervorgerufen. Im Text selbst gibt es keinerlei Anhaltspunkte für eine solche Interpretation. 31 % 11 % 22 % 36 % richtige Vermutung teilweise richtig falsche Vermutung keine Angabe Abb. 1: Inhaltsangabe zum Interkomprehensionstext nach dem ersten globalen Lesen (n=113) Als nächstes sollten die Lernenden versuchen, eine Interlinearübersetzung des gelesenen Textes anzufertigen (vgl. auch Bär 2009). Dazu wurden sie aufgefordert, den Text nochmals zu lesen, sich die Wörter genau anzusehen und Grit Mehlhorn (2014), Interkomprehension im schulischen Russischunterricht? Ein Experiment mit sächsischen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 19: 1, Abrufbar unter
7 154 sie mithilfe ihrer Kenntnisse aus anderen Sprachen (z.b. Deutsch, Englisch, Französisch, Latein) und aus dem Russischen selbst zu übersetzen. Außerdem sollten sie angeben, aus welchen Sprachen sie die übersetzten Wörter kennen (vgl. Anhang). Bei der Datenauswertung wurde für jedes korrekt erschlossene Wort ein Punkt berechnet. Wurde das Wort nur zum Teil richtig übersetzt, aber der Wortstamm erkannt, z.b. Musiker oder Musical statt musikalisch / Musik-, wurde ein halber Punkt vergeben. 8 In Tabelle 1 sind die Wörter aufgeführt, die von den meisten SchülerInnen erschlossen wurden. Nur das Substantiv Moskve steht hier in der deklinierten Form (Nominativ: Moskva). Tabelle 1: Meist richtig erkannte Wörter russisches Wort richtige Nennungen Prozent n=113 format Format ,5 % telekanal Fernsehsender, Telekanal 99 87,6 % konkurent Konkurrent 93 82,3 % 1995 goda (im Jahr) ,5 81,9 % MTV MTV 92 81,4 % pop-muzyka Pop-Musik 88,5 78,3 % Rossija Russland 85 75,2 % Moskve Moskau 85 75,2 % Die in Tabelle 2 genannten Wörter wurden von weniger Lernenden erkannt. Hier erscheinen ėtaže (Nominativ: ėtaž), centra (Nominativ: centr), tret em (Nominativ: tret ij) und kontenta (Nominativ: kontent) im abhängigen Kasus. Bei der Form ėtaže (Präpositiv/6. Fall von ėtaž) kommt erleichternd hinzu, dass die deklinierte Form dem aus dem Französischen auch ins Deutschen entlehnten Etage ähnelt. Die SchülerInnen, die dieses Wort korrekt identifiziert haben, gaben übereinstimmend an, es aus dem Deutschen zu kennen. Überhaupt wurde Deutsch bis auf wenige Ausnahmen (z.b. Englisch für ofis, centra) bei allen erschlossenen Wörtern als Transfersprache genannt. Selten wurden Deutsch und Englisch gemeinsam für ein Wort angegeben. Tabelle 2: Seltener richtig erkannte Wörter russisches Wort richtige Nennungen Prozent n=113 ėtaže Etage, Stock(werk) 67 59,3 % rossijskij Russisch 62 54,9 % MUZ-TV MUS(ik)-TV 61 54,0 % muzykal nyj musikalisch, Musik ,7 % centra Zentrum 54 47,8 % ofis Office, Büro 33 29,2 % tret em (in der) dritten 19 16,8 % kontenta content Inhalt 6 5,3 % Adjektive wurden insgesamt sehr viel seltener korrekt identifiziert. Das Wort tret em ( dritte ) erkannten nur diejenigen SchülerInnen, die auch das Wort Etage verstanden hatten. Offensichtlich konnten sie hier einen logischen Zusammenhang herstellen. Zusätzlich übersetzten 70 SchülerInnen (61,9 %) noch die Konjunktion i ( und ), die sie Grit Mehlhorn (2014), Interkomprehension im schulischen Russischunterricht? Ein Experiment mit sächsischen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 19: 1, Abrufbar unter
8 bereits im Russischunterricht gelernt hatten. Andere Wörter aus diesem Text waren den Lernenden ohne russischsprachigen Hintergrund noch nicht aus dem Unterricht bekannt. Nach der Bearbeitung der Interlinearübersetzung erfolgte die Bitte, den Text zusammenzufassen. Knapp die Hälfte der SchülerInnen war in der Lage, den Text zumindest teilweise richtig wiederzugeben, wobei 24,5 % tatsächlich eine korrekte Zusammenfassung lieferten. Ein reichliches Drittel der Lernenden hat es jedoch gar nicht erst versucht. Das kann teilweise mit der knappen Zeit zum Ende der Aufgabenbearbeitung zusammenhängen (andererseits wurde die darauffolgende Aufgabe noch gelöst), aber auch damit, dass diese SchülerInnen einfach nicht in der Lage waren, aufgrund der wenig erschlossenen Wörter eine Zusammenfassung zu schreiben % 17% 24.50% 24.50% richtige ZF teilweise richtig falsche ZF keine Angabe Abb. 2: Textzusammenfassung zum Interkomprehensionstext (n=113) Die folgenden Zitate sind Beispiele für Zusammenfassungen der Lernenden. Bei (073) handelt es sich um eine inhaltlich korrekte und fast vollständige Zusammenfassung, bei (075) um eine teilweise korrekte Zusammenfassung mit einigen geratenen Wörtern, die Angaben in (082) sind falsch und Schüler (106) hat keine Zusammenfassung geschrieben. MUZ-TV ist ein russischer Musiksender. Es gibt ihn seit Der Konkurrent dieses Senders ist MTV- Russland. Das Studio befindet sich in Moskau, in der Warschauer Chaussee irgendwo in der dritten Etage. Das Programm besteht aus Musik und MUZ-TV russische und Pop-Musik (073). MUZ-TV ist der perfekte Musiksender auf Russisch. Es gibt MUZ-TV seit Es ist ein neuer Konkurrent im Quotenkampf. Das Büro von MUZ-TV ist in der 3. Etage der Zentrale in Moskau. Der Sender bringt musikalisch Zufriedenheit. Es wird auch russische Pop-Musik gezeigt (075). Es geht um ein Event mit Sängern und Sängerinnen und nachmittags eine Premiere mit einem Topmodel (082). Entschuldigung, aber so gut kann ich Russisch noch nicht (106). Die von kontenta ( Inhalt, Genitiv Singular) mit Zufriedenheit (vgl. Schüler (075)) oder zufrieden, die mehrfach vorkam, ist nachvollziehbar, aber in diesem Kontext nicht passend. Der Anglizismus wurde lediglich in der Bedeutung Inhalt ins Russische entlehnt. Schließlich sollten die Lernenden den Text noch ein letztes Mal lesen und in einer Tabelle ankreuzen, zu welcher Wortart die ausgewählten Wörter gehören. 9 Hier waren zehn theoretisch erschließbare und drei nicht erschließbare Wörter angegeben. Bei den nicht erschließbaren Wörtern ist die Trefferquote erwartungsgemäß sehr gering (vgl. Tabelle 3). Hier wurde viel geraten. Ein Großteil der Lernenden (59 bis 64 %) hat jedoch an dieser Stelle auch keine Grit Mehlhorn (2014), Interkomprehension im schulischen Russischunterricht? Ein Experiment mit sächsischen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 19: 1, Abrufbar unter
9 156 Angaben (k.a.) gemacht, so dass man davon ausgehen kann, dass einige SchülerInnen nur dann ein Kreuz in eine Spalte gesetzt haben, wenn sie sich ihrer Antwort sicher waren. Die von den meisten Lernenden erschlossenen Wörter (format, konkurent, pop-muzyka) wurden auch am häufigsten richtig der Wortart Substantiv zugeordnet. Das von einigen Lernenden falsch übersetzte Wort muzykal nyj ( Musikkanal statt musikalisch ) wurde dementsprechend häufig falsch als Substantiv eingeordnet. Bedenklich erscheint, dass mehrere SchülerInnen, die die Wörter inhaltlich richtig erschlossen hatten, dann eine falsche Wortart zugeordnet haben (z.b. Popmusik als Adjektiv, Format als Verb, Office als Adjektiv und Verb). Auch hier kommen als Erklärung mangelnde Aufmerksamkeit zum Ende der Bearbeitungszeit, aber auch Defizite im metasprachlichen Wissen in Frage. Tatsächlich gibt es bei dieser Aufgabe deutliche Unterschiede zwischen den getesteten Klassen. Einige Schulklassen können die Wortarten insgesamt wesentlich besser zuordnen als andere. Tabelle 3: Zuordnung der Wortarten ausgewählter Wörter durch die SchülerInnen (n=113) Substantiv Verb Adjektiv k.a. richtig falsch richtig falsch richtig falsch rossijskij osnovnoj konkurent ofis telekanala raspolagaetsja ėtaže centra Moskve sostoit muzykal nyj format pop-muzyka In der Tabelle sollte auch noch kurz erläutert werden, woran die Lernenden erkannt haben, dass es sich um ein Substantiv, Verb oder Adjektiv handelt. Hier nennen 61 SchülerInnen die aus dem Deutschen, immerhin 30 Lernende schreiben, dass sie einige Wortarten an der Endung erkannt hätten. Bei dem Item Moskve wird von 23 Lernenden auf die Großschreibung von Moskau verwiesen; 12 weitere SchülerInnen geben Eigenname, Ortsbezeichnung bzw. Stadtname an, was darauf hindeutet, dass vielen bewusst ist, dass Eigennamen im Russischen im Gegensatz zu anderen Substantiven groß geschrieben werden. Diese Regel kennen sie vermutlich bereits aus dem Englischen und ihren zweiten Fremdsprachen. 5 Lernende geben ehrlich zu, dass sie bei der Wortartenzuordnung geraten haben. 2 Schülerinnen nennen den Satzzusammenhang als Erklärung. Zu einem richtig erkannten Adjektiv schreibt eine Schülerin: Dahinter steht ein Substantiv (030). Ein Schüler mit russischsprachigem Hintergrund hat jeweils die entsprechenden Fragewörter dazugeschrieben und kommentiert: An der Endung erkannt: [bei den richtig erkannten Adjektiven, GM] an dem i am Ende; [bei den Substantiven, GM] f. [feminin, GM] mit a/я, m. mit konsonantischer Endung (015). 32 Lernende haben hier keine Angaben gemacht. Ein Schüler kommentiert das so: Keine Ahnung! Ich kann das nicht! (119). Die Ergebnisse derjenigen SchülerInnen, die Russisch als Erstsprache angegeben haben (n=10), sind sehr heterogen und reichen von komplett richtigen Lösungen über gute Ergebnisse mit einigen falschen Rateversuchen bis hin zu Grit Mehlhorn (2014), Interkomprehension im schulischen Russischunterricht? Ein Experiment mit sächsischen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 19: 1, Abrufbar unter
10 völlig fehlenden Antworten. Nur 3 SchülerInnen mit russischsprachigem Hintergrund haben die Aufgaben deutlich besser bearbeitet als ihre Mitlernenden Diskussion der Ergebnisse und Ausblick Während die befragten SchülerInnen in den Fragebögen angegeben haben, dass ihnen auch ihre Englischkenntnisse das Russischlernen erleichtern, scheinen sie beim Transfer wesentlich häufiger auf ihre Muttersprache zurückzugreifen. Ein empirisch relevantes Ergebnis besteht darin, dass ein doch relativ großer Teil der SchülerInnen den Text, der weit über ihrem sprachlichen Niveau liegt, im Großen und Ganzen oder zumindest teilweise richtig verstanden hat. Das konnte für das Russische bisher nicht gezeigt werden. Vorkenntnisse aus zuvor gelernten Sprachen sind durchaus hilfreich beim Erschließen russischsprachiger Texte. Sicherlich stammt das metasprachliche Wissen der SchülerInnen nur zum Teil aus dem derzeitigen Russischunterricht, sondern v.a. auch aus dem muttersprachlichen Deutschunterricht und dem Unterricht der ersten und zweiten Fremdsprache. Möglicherweise ist das fehlende Grundlagenwissen aus dem muttersprachlichen Deutschunterricht und dem Unterricht der ersten Fremdsprache Englisch, das mehrere der im Rahmen dieses Projekts befragte Russischlehrkräfte beklagt hatten (vgl. Mehlhorn 2011b; Mehlhorn & Wahlicht 2011), mit verantwortlich für die Unsicherheiten bei der Wortartenzuordnung von Wörtern, die die SchülerInnen korrekt erschlossen und übersetzt haben. Viele Internationalismen und Fremdwörter sind den Lernenden aus dem Deutschen bekannt. Die kyrillische Schrift ist vermutlich nur zu einem geringen Teil verantwortlich für nicht erschlossene Wörter. Im Gegenteil, die untersuchten SchülerInnen haben eine Reihe von Wörtern, denen sie im Russischen noch nie begegnet sind, über diese Schrift erschlossen. Lediglich bei Wörtern, in denen die Graphem-Phonem-Beziehung zwischen der bekannten Wortform aus einer bisher gelernten Sprache und dem Russischen stark abweicht, kann vermutet werden, dass die Identifizierung erschwert wurde. Das könnte beispielsweise beim Wort šosse ( Chaussee ) der Fall sein. 10 Insgesamt erscheint die Interkomprehension v.a. durch die komplexe (den Lernenden noch nicht bekannte) Morphologie erschwert. Es ist sehr viel einfacher, bekannte Wörter in der Grundform (d.h. Substantive im Nominativ) zu erkennen; die deklinierte Form dagegen ist wesentlich schwerer identifizierbar, da den Lernenden die entsprechenden Endungen noch nicht bekannt sind und die Endungen das Wortbild verfremden können. Hinzu kommt die geringere Anzahl interkomprehensibler Lexeme als beispielsweise in einem vergleichbaren spanisch- oder französischsprachigen Text. Den zuvor ausgefüllten Fragebögen einiger SchülerInnen kann man Hinweise auf subjektive Einstellungen entnehmen, die einer erfolgreichen Texterschließung entgegenstehen. Etwa 10 % von ihnen empfinden eine große Sprachdistanz zwischen dem Russischen und ihrer Muttersprache Deutsch, auch wenn diese im Widerspruch zur sprachtypologischen Nähe der beiden Sprachen steht. Ringbom (2007) zufolge haben die von den Lernenden vermuteten Gemeinsamkeiten zwischen Sprachen (sog. Psychotypologie) einen größeren Einfluss auf das Sprachenlernen als die tatsächlich vorhandenen Ähnlichkeiten. So kann eine zu große wahrgenommene Distanz zwischen Sprachen Transfer verhindern (vgl. Mehlhorn 2012: 205; Ringbom & Jarvis 2009: 108f). Dem könnte im Russischunterricht durch bewusst vorgenommene Sprachvergleiche zwischen dem Russischen und den zuvor gelernten Sprachen der SchülerInnen entgegengewirkt werden. Während bei der schriftlichen Befragung der SchülerInnen eine Tendenz zur sozialen Erwünschtheit bei der Beantwortung einiger Fragen nicht ausgeschlossen werden kann, zeigen die Ergebnisse der Textaufgaben recht deutlich, wie viel die Lernenden tatsächlich verstehen und dass die zuvor gelernten Sprachen ihnen in unterschiedlichem Maße dabei helfen. Andererseits gestattet diese Untersuchung keine Einblicke in die Hypothesenbildung der Lernenden. Wie die Lernenden auf bestimmte Ergebnisse kommen, warum sie sich für und gegen bestimmte Antworten entscheiden oder lieber gar nichts antworten, könnte durch den Einsatz von Laut-Denk-Protokollen (vgl. Knorr & Schramm 2012) erhoben werden. Aufgrund der relativ hohen Probandenzahl (ca. 80 % der Grundgesamtheit der sächsischen SchülerInnen, die Russisch als dritte Fremdsprache ab Klasse 8 lernen) war dies jedoch im Rahmen dieser Studie nicht möglich. Künftige Untersuchungen sollten aber hier ansetzen. Als Transferbasen kamen fast ausschließlich internationaler Wortschatz bzw. aus den bisher gelernten Sprachen bekannte Wörter in Frage (also lediglich Sieb 1 bei EuroCom), während ein systematischer Zugriff auf morphosyntaktische Transferbasen aufgrund des fehlenden Wissens der SchülerInnen in Bezug auf das Russische oder Grit Mehlhorn (2014), Interkomprehension im schulischen Russischunterricht? Ein Experiment mit sächsischen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 19: 1, Abrufbar unter
11 158 andere slawische Sprachen von vornherein nicht gegeben war. Zieht man dann noch in Betracht, dass der gemeinsame Wortschatz zwischen den slawischen Sprachen und den zuvor gelernten Sprachen (in erster Linie Deutsch und Englisch) wesentlich kleiner ist als der gemeinsame Wortschatz zwischen den romanischen und germanischen Sprachen, so ist es bemerkenswert, dass es doch einen Teil von Lernenden gab, die den russischen Originaltext global verstehen konnten. Der Text für die sprachfamilienübergreifende Interkomprehension hätte möglicherweise noch besser ausgesucht werden können, v.a. im Hinblick auf erschließbare Verben und den Lernenden bekannte Inhalte. Denkbar wäre auch, den zu erschließenden Text mit Betonungszeichen zu versehen oder ihn beim Lesen auch auditiv zu präsentieren. Bei der Auswahl von Bildern zu Texten für Interkomprehensionszwecke sollte darauf geachtet werden, dass die Illustrationen tatsächlich das Verständnis unterstützen und die Lernenden nicht auf eine falsche Fährte locken. Dieses Interkomprehensionsexperiment wurde bewusst wenige Wochen nach Lernbeginn durchgeführt zu dem Zeitpunkt, als die SchülerInnen gerade das kyrillische Alphabet lesen gelernt hatten. Wollte man Vorwissen in der russischen Sprache komplett ausschließen, wären auch Texte in der transliterierten Version (s.o.) denkbar. Schließlich muss man berücksichtigen, dass die Interkomprehensionsaufgabe sehr ungewohnt für die Lernenden war. Sie sind aus dem Fremdsprachenunterricht ein anderes Vorgehen gewohnt und konnten sich vermutlich unterschiedlich gut auf dieses Experiment einlassen. Hildenbrandt & Reutter (2011), die an ihrer Schule eine Projektstunde Mehrsprachigkeit für Lernende der 8. Klasse eingerichtet haben, in denen sie sprachenübergreifend vorgehen, ziehen folgenden Schluss: Im Rückblick kann festgestellt werden, dass Achtklässler nur bedingt in der Lage sind, ihr fremdsprachliches Vorwissen zu aktivieren. Ihre Kenntnisse in den zuvor gelernten Fremdsprachen sind weder lückenlos noch felsenfest, sondern weisen ihrerseits eher Züge von Hypothesengrammatiken auf und können daher nur eingeschränkt als Transferbasen fungieren (Hildenbrandt & Reuter 2011: 61). Diese Beobachtung deckt sich mit den Erfahrungen der interviewten Russischlehrenden der befragten SchülerInnen, die darauf hinweisen, dass das Wissen aus der ersten und zweiten Fremdsprache bei manchen Lernenden noch nicht gefestigt ist. Genauso, wie die sieben Siebe Voraussetzung für die Interkomprehension innerhalb von Sprachfamilien sind, sind für eine erfolgreiche Interkomprehension zwischen Sprachfamilien Grundkenntnisse der morphologisch-syntaktischen Struktur der Zielsprache notwendig. Die Kenntnis grammatischer Termini und der mit ihnen verbundenen Konzepte (z.b. Wortarten), die bereits aus dem Muttersprachenunterricht bekannt sein sollten, sind außerordentlich hilfreich für das Verständnis grammatischer Strukturen der Zielsprache. Schließlich erfordert erfolgreiche Interkomprehension in einer ersten slawischen Fremdsprache den Einsatz entsprechender Transferstrategien. Nicht alle SchülerInnen waren gleichermaßen motiviert, sich auf das Experiment mit dem eigentlich nicht verstehbaren russischen Text einzulassen. Mehr Erfolgserlebnisse hätten die Lernenden sicher bei einem konstruierten Text mit gezielt ausgewählten Internationalismen und hervorsagbarem Inhalt gehabt, wie man sie zum Teil in Lehrwerken findet. Da auch bei adaptierten Texten Aha-Erlebnisse und entdeckendes Lernen stattfinden können, wäre eine Möglichkeit der Umsetzung in die Unterrichtspraxis, mit leicht bearbeiteten Texten in die sprachfamilienübergreifende Interkomprehension einzusteigen, daran Entschlüsselungsstrategien zu trainieren und somit einen sanfteren Einstieg in die Arbeit mit Originaltexten zu wählen. Andererseits zeigt das Ergebnis, dass fast die Hälfte der SchülerInnen den Text verstanden hat, dass man auch schon früh im Tertiärsprachenunterricht mit Originaltexten arbeiten kann und sollte (vgl. auch Seidel & Wächter-Springer 1997). Sinnvoll ist es, das Vorgehen bei der Textbearbeitung und die Ergebnisse zu reflektieren und mit den Lernenden zu besprechen. Im Bereich des sprachenübergreifenden und entdeckenden Lernens sind v.a. dann Fortschritte möglich, wenn die Lehrkräfte das Neben- und Miteinander von gelernten Sprachen als Reichtum und Lehr- und Lernhilfe begreifen, Bereitschaft zur Veränderung zeigen, ihre Fachkonferenzen öffnen und sich zwischen den Sprachen abstimmen (vgl. Behr 2010). In Fortbildungen sollten die Fremdsprachenlehrkräfte daher selbst Erfahrungen mit dem entdeckenden Lernen durch Interkomprehension machen und sich darüber austauschen, wie in den Lehrwerken enthaltene Sprachund Kulturvergleiche im Unterricht umgesetzt und SchülerInnen zur Auseinandersetzung mit sprachlichen und kulturellen Phänomenen angeregt werden können. Arbeiten mit konkreten Unterrichtsvorschlägen zum sprachenübergreifenden Lehren und Lernen existieren bereits (vgl. u.a. Behr 2005, 2010; ThILLM 2006). Behr (2012) zeigt am Beispiel der Thüringer Lehrpläne, wie sprachen- Grit Mehlhorn (2014), Interkomprehension im schulischen Russischunterricht? Ein Experiment mit sächsischen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 19: 1, Abrufbar unter
12 spezifische und sprachenübergreifende Zielstellungen die Entwicklung von Sprach- und Sprachlernbewusstheit unterstützen können und wie die Rolle der Reflexion in den Lehrplanzielen abgebildet werden kann. Erste Vorschläge zur sprachenübergreifenden Textarbeit im Sinne eines Gesamtsprachencurriculums finden sich u.a. in Neuner, Hufeisen, Kursiša, Marx, Koithan & Erlenwein (2009). 159 Literaturverzeichnis Bär, Marcus (2009), Förderung von Mehrsprachigkeit und Lernkompetenz. Fallstudien zu Interkomprehensionsunterricht mit Schülern der Klassen 8 bis 10. Tübingen: Narr. Behr, Ursula (Hrsg.) (2005), Sprachen entdecken Sprachen vergleichen. Kopiervorlagen zum sprachenübergreifenden Lernen Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Latein. Berlin: Cornelsen. Behr, Ursula (2007), Sprachenübergreifendes Lernen und Lehren in der Sekundarstufe I. Ergebnisse eines Kooperationsprojekts der drei Phasen der Lehrerbildung. Tübingen: Narr. Behr, Ursula (2010), Zur Typologie von Übungen zum sprachenübergreifenden Lernen in der Sekundarstufe I. In: Doyé, Peter & Meißner, Franz-Joseph (Hrsg.), Lernerautonomie durch Interkomprehension. Promoting Learner Autonomy through Intercomprehension. L autonomisation de l apprenant par l intercompréhension. Tübingen: Narr, Behr, Ursula (2011), Sprachenübergreifendes Lernen aus der Sicht des muttersprachlichen Deutschunterrichts in der Sekundarstufe I. In: Rothstein, Björn (Hrsg.), Sprachvergleich in der Schule. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, Behr, Ursula (2012), Wie Lehrpläne sprachenübergreifendes Lehren und Lernen unterstützen können. In: Bär, Marcus; Bonnet, Andreas; Decke-Cornill, Helene; Grünewald, Andreas & Hu, Adelheid (Hrsg.), Globalisierung Migration Fremdsprachenunterricht. Dokumentation zum 24. Kongress für Fremdsprachendidaktik der Deutschen Gesellschaft für Fremdsprachenforschung (DGFF), Hamburg, Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, (= Beiträge für Fremdsprachenforschung 12). Beier, Karl-Heinz (2000), Skizzierung eines Kompaktkurses Russisch für die Schule ein Beitrag zur rezeptiven Mehrsprachigkeit. In: Helbig, Beate; Kleppin, Karin & Königs, Frank G. (Hrsg.), Sprachlehrforschung im Wandel. Beiträge zur Erforschung des Lehrens und Lernens von Fremdsprachen. Tübingen: Stauffenburg, Doyé, Peter (2008), Der Faktor Sprachverwandtschaft in der Interkomprehension. In: Doyé, Peter (Hrsg.), Interkulturelles und mehrsprachiges Lehren und Lernen. Zwölf Beiträge zur Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr, Eurocomslav (ohne Jahr), EuroComSlav Basiskurs [Online unter April 2013]. Hildenbrandt, Elke & Reutter, Ursula (2011), Mehrsprachigkeit als einstündiges Unterrichtsfach in Klasse 8: Ein Erfahrungsbericht. Die Neueren Sprachen 2, Hufeisen, Britta (2003), L1, L2, L3, L4, Lx alle gleich? Linguistische, lernerinterne und lernerexterne Faktoren in Modellen zum multiplen Spracherwerb. Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht 8: 2/3, Hufeisen, Britta (2005), Gesamtsprachencurriculum: Einflussfaktoren und Bedingungsgefüge. In: Hufeisen & Lutjeharms (Hrsg.), Hufeisen, Britta (2011), Gesamtsprachencurriculum: Weitere Überlegungen zu einem prototypischen Modell. In: Baur, Rupprecht S. & Hufeisen, Britta (Hrsg.), Vieles ist sehr ähnlich. Individuelle und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit als bildungspolitische Aufgabe. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, Hufeisen, Britta & Lutjeharms, Madeline (Hrsg.) (2005), Gesamtsprachencurriculum. Integrierte Sprachendidaktik Common Curriculum. Tübingen: Narr. Hufeisen, Britta & Marx, Nicole (Hrsg.) (2007), EuroComGerm Die sieben Siebe: Germanische Sprachen lesen lernen. Aachen: Shaker. Grit Mehlhorn (2014), Interkomprehension im schulischen Russischunterricht? Ein Experiment mit sächsischen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 19: 1, Abrufbar unter
13 160 Klein, Horst & Reissner, Christina (2006), Basismodul Englisch. Englisch als Brückensprache in der romanischen Interkomprehension. Aachen: Shaker. Klein, Horst & Stegmann, Tilbert (Hrsg.) (2000), EuroComRom die sieben Siebe: romanische Sprachen sofort lesen können. Aachen: Shaker. Knorr, Petra & Schramm, Karen (2012), Datenerhebung durch Lautes Denken und Lautes Erinnern in der fremdsprachendidaktischen Empirie. In: Doff, Sabine (Hrsg.), Fremdsprachenunterricht empirisch erforschen. Grundlagen Methoden Anwendung. Tübingen: Narr, Lippold, Madlen (2013), Weil Russisch eine Sprache für sich ist! Eine Untersuchung zum Einfluss zwischensprachlicher Ähnlichkeiten (cross-linguistic similarities) aus den vorgelernten Sprachen im Tertiärsprachenunterricht Russisch. Universität Leipzig: Masterarbeit. Marx, Nicole (2005), Hörverstehensleistungen im Deutschen als Tertiärsprache. Zum Nutzen eines Sensibilisierungsunterrichts in DaFnE. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren. Mehlhorn, Grit (2008), Russisch nach Englisch, Polnisch nach Russisch. Überlegungen zu einer Mehrsprachigkeitsdidaktik der slavischen Sprachen aus phonetischer Sicht. In: Geist, Ljudmila & Mehlhorn, Grit (Hrsg.), XIV. JungslavistInnentreffen in Stuttgart September München: Kubon & Sagner, Mehlhorn, Grit (2011a), Slawische Sprachen als Tertiärsprachen Potenziale für den Sprachvergleich im Fremdsprachenunterricht. In: Rothstein, Björn (Hrsg.), Sprachvergleich in der Schule. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, Mehlhorn, Grit (2011b), Russisch und Mehrsprachigkeit. Implikationen für den Fremdsprachenunterricht. In: Mehlhorn & Heyer (Hrsg.), Mehlhorn, Grit (2012), Phonetik/Phonologie in der L3 Neuere Erkenntnisse aus der Psycholinguistik. Deutsch als Fremdsprache 4, Mehlhorn, Grit (2013), Projekt: Wörter mit Migrationshintergrund. Praxis Fremdsprachenunterricht Russisch 2, 12. Mehlhorn, Grit (im Druck),... weil Russisch ganz andere Buchstaben hat Mögliche Gründe für wahrgenommene Sprachdistanz aus der Sicht von Lernenden. In: Morys, Nancy; de Saint-Georges, Ingrid; Gretsch, Gérard & Kirsch, Claudine (Hrsg.), Mehrsprachigkeit als Chance. Frankfurt am Main: Peter Lang. Mehlhorn, Grit & Heyer, Christine (Hrsg.) (2011), Russisch und Mehrsprachigkeit. Lehren und Lernen von Russisch an deutschen Schulen in einem vereinten Europa. Stauffenburg: Tübingen. Mehlhorn, Grit & Neveling, Christiane (2012), Sprachenübergreifendes Lehren und Lernen in der Schule: Ergebnisse einer Befragung von Russisch- und Spanischlehrenden. In: Bär, Marcus; Bonnet, Andreas; Decke-Cornill, Helene; Grünewald, Andreas & Hu, Adelheid (Hrsg.), Globalisierung Migration Fremdsprachenunterricht. Dokumentation zum 24. Kongress für Fremdsprachendidaktik der Deutschen Gesellschaft für Fremdsprachenforschung (DGFF), Hamburg, Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, Mehlhorn, Grit & Wahlicht, Madlen (2011), Mehrsprachigkeit im Russischunterricht aus Sicht der Lehrenden. In: Mehlhorn & Heyer (Hrsg.), Meißner, Franz-Joseph (2004), EuroComprehension und Mehrsprachigkeitsdidaktik. Zwei einander ergänzende Konzepte und ihre Terminologie. In: Rutke, Dorothea & Weber, Peter J. (Hrsg.), Mehrsprachigkeit und ihre Didaktik. Multimediale Perspektiven für Europa. St. Augustin: Asgard, Meißner, Franz-Joseph (2010), Grundlagen der Tertiärsprachendidaktik: inferentielles Sprachenlernen. In: Meißner, Franz-Joseph & Tesch, Bernd (Hrsg.), Spanisch kompetenzorientiert unterrichten. Didaktische Grundlagen für die Aufgabenkonstruktion. Stuttgart: Klett, Mißler, Bettina (1999), Fremdsprachenlernerfahrungen und Lernstrategien. Eine empirische Untersuchung. Tübingen: Stauffenburg. Morkötter, Steffi (2010), Interkomprehension in der Jahrgangsstufe 7 erste Erfahrungen mit dem Zwischen- Sprachen-Lernen. In: Doyé, Peter & Meißner, Franz-Joseph (Hrsg.), Lernerautonomie durch Interkomprehension. Promoting Learner Autonomy through Intercomprehension. L autonomisation de l apprenant par l intercompréhension. Tübingen: Narr, Grit Mehlhorn (2014), Interkomprehension im schulischen Russischunterricht? Ein Experiment mit sächsischen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 19: 1, Abrufbar unter
14 Müller-Lancé, Johannes (2003), Der Wortschatz romanischer Sprachen im Tertiärsprachenerwerb. Lernstrategien am Beispiel des Spanischen, Italienischen und Katalanischen. Tübingen: Stauffenburg. Neveling, Christiane (2012), Sprachenübergreifendes Lernen im Spanischunterricht aus der Perspektive von Lehrerinnen und Lehrern: eine Fragebogen-Studie. In: Leitzke-Ungerer, Eva; Blell, Gabriele & Vences, Ursula (Hrsg.), English-Español: Vernetzung im kompetenzorientierten Spanischunterricht. Stuttgart: ibidem, Neuner, Gerhard; Hufeisen, Britta; Kursiša, Anta; Marx, Nicole; Koithan, Ute & Erlenwein, Sabine (2009), Deutsch im Kontext anderer Sprachen. Berlin: Langenscheidt. Ollivier, Christian (2007), Dimensions linguistique et extralinguistique de l intercompréhension. Pour une didactique de l intercompréhension au-delà des familles de langues. In: Capucho, Filomena; Martins, Adriana; Degache, Christian & Tost, Manuel (Hrsg.), Diálogos em Intercompreensão. Lisbonne: Universidade Católica Potuguesa, Otwinowska-Kasztelanic, Agnieszka (2009), Raising awareness of cognate vocabulary as a strategy in teaching English to Polish adults. Innovation in Language Learning and Teaching 3: 2, Reissner, Christina (2010), Europäische Interkomprehension in und zwischen Sprachfamilien. In: Hinrichs, Uwe (Hrsg.), Handbuch der Eurolinguistik. Wiesbaden: Harrassowitz, Ringbom, Håkan (2007), Cross-linguistic Similarity in Foreign Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters. Ringbom, Håkan & Jarvis, Scott (2009), The importance of cross-linguistic similarity in foreign language learning. In: Long, Michael H. & Doughty, Catherine J. (Hrsg.), The Handbook of Language Teaching. San Francisco: Blackwell Publishing, Seidel, Astrid & Wächter-Springer, Lydia (1997), Wenn Anfänger keine Anfänger sind Sprachgeschichte und originale Texte (2). Empfehlenswertes für den Russischunterricht in den Klassen 9 und 11 erlebbarer Lernfortschritt durch frühzeitige Arbeit an Originaltexten. Fremdsprachenunterricht 41/50:6, [SMK] Sächsisches Ministerium für Kultus (2011), Lehrplan Gymnasium Russisch [Online unter April 2013]. Steinhauer, Britta (2006), Transfer im Fremdsprachenerwerb. Ein Forschungsüberblick und eine empirische Untersuchung des individuellen Transferverhaltens. Frankfurt am Main: Peter Lang. Tafel, Karin; Durić, Rašid; Lemmen, Radka; Olshevska, Anna & Przyborowska-Stolz, Agata (2009), Slavische Interkomprehension. Eine Einführung. Tübingen: Narr. [ThILLM] Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (2006), Anregungen zum sprachenübergreifenden Lernen in der Sekundarstufe I: Deutsch Englisch Französisch Russisch Latein. Bad Berka: Thillm. Zawadzka, Agnieszka (2011a), Transfer aus vorgelernten Sprachen als Lernerleichterung im schulischen Unterricht Polnisch als dritte Fremdsprache? Zum (möglichen) Umgang mit sprachlichem Vorwissen. In: Baur, Rupprecht S. & Hufeisen, Britta (Hrsg.), Vieles ist sehr ähnlich. Individuelle und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit als bildungspolitische Aufgabe. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, Zawadzka, Agnieszka (2011b), Zur Spezifik des Russischunterrichts als dritte bzw. weitere Fremdsprache in der Schule. Implikationen für den Fremdsprachenunterricht. In: Mehlhorn & Heyer (Hrsg.), Zybatow, Lew N. & Zybatow, Gerhild (2006), EuroComDidact und EuroComSlav/EuroComTranslat mögliche Synergien. In: Martinez, Hélène & Reinfried, Marcus (Hrsg.), Mehrsprachigkeitsdidaktik gestern, heute und morgen. Festschrift für Franz-Joseph Meißner zum 60. Geburtstag. Tübingen: Narr, Grit Mehlhorn (2014), Interkomprehension im schulischen Russischunterricht? Ein Experiment mit sächsischen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 19: 1, Abrufbar unter
15 162 Text 1 ANHANG МУЗ-ТВ первый российский музыкальный телеканал. В эфире с сентября 1995 года. Основной конкурент на российском рынке MTV Россия. Офис телеканала располагается на третьем этаже офисного центра на Варшавском шоссе в Москве. Эфир канала состоит из музыкального и развлекательного контента. Музыкальный формат МУЗ- ТВ российская и западная поп-музыка. Text: (aufgerufen am ) Text 2 Tелеканал МУЗ-ТВ телевизионная программа 20 августа 2010 года 05:00 МУЗ-ТВ ХИТ Cамые горячие хиты. Только лидеры мировых и российских чартов. 09:50 Стилистика Новости мировой и российской индустрии моды репортажи с fashion-мероприятий и эксклюзивные интервью с модельерами и продюсерами. 13:00 ПРЕМЬЕРА! Топ модель по-американски Реалити-шоу Новый сезон самого ожидаемого реалити- Шоу про моделей с Тайрой Бэнкс и Дженис Диккенсон в звездном жюри. Text: (aufgerufen am ) Grit Mehlhorn (2014), Interkomprehension im schulischen Russischunterricht? Ein Experiment mit sächsischen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 19: 1, Abrufbar unter
Sprachpraxis Französisch IV
 Modulbeschreibungsformular Fachwissenschaft für das Lehramtsfach Französisch (Master) Sprachpraxis Französisch IV 537145000 180 h 6 LP Modulbeauftragter Véronique Barth-Lemoine WS oder SS des Moduls Master
Modulbeschreibungsformular Fachwissenschaft für das Lehramtsfach Französisch (Master) Sprachpraxis Französisch IV 537145000 180 h 6 LP Modulbeauftragter Véronique Barth-Lemoine WS oder SS des Moduls Master
Sprachpraxis Französisch IV
 Modulbeschreibungsformular Fachwissenschaft für das Lehramtsfach Französisch (Master) Sprachpraxis Französisch IV 537145000 180 h 6 LP Modulbeauftragter Véronique Barth-Lemoine WS oder SS des Moduls Master
Modulbeschreibungsformular Fachwissenschaft für das Lehramtsfach Französisch (Master) Sprachpraxis Französisch IV 537145000 180 h 6 LP Modulbeauftragter Véronique Barth-Lemoine WS oder SS des Moduls Master
Spanisch durch EuroComprehension:
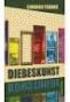 Jochen Strathmann Spanisch durch EuroComprehension: Multimediale Spracherwerbsprozesse im Fremdsprachenunterricht Shaker Verlag Aachen 2010 Spanisch durch EuroComprehension: Multimediale Spracherwerbsprozesse
Jochen Strathmann Spanisch durch EuroComprehension: Multimediale Spracherwerbsprozesse im Fremdsprachenunterricht Shaker Verlag Aachen 2010 Spanisch durch EuroComprehension: Multimediale Spracherwerbsprozesse
EuroComGerm Die sieben Siebe: Germanische Sprachen lesen lernen
 EuroComGerm Die sieben Siebe: Germanische Sprachen lesen lernen Editiones EuroCom herausgegeben von Horst Günter Klein, Franz-Joseph Meißner, Tilbert Dídac Stegmann, Lew Zybatow Reihe EuroComGerm herausgegeben
EuroComGerm Die sieben Siebe: Germanische Sprachen lesen lernen Editiones EuroCom herausgegeben von Horst Günter Klein, Franz-Joseph Meißner, Tilbert Dídac Stegmann, Lew Zybatow Reihe EuroComGerm herausgegeben
Lernerfahrungen über Sprachfamilien hinaus
 Anna Schröder-Sura, Steffi Morkötter Lernerfahrungen über Sprachfamilien hinaus Ein Beitrag zur Förderung von Lehr- und Lernkompetenz 1. Einführung Spätestens mit dem Erlernen einer zweiten Fremdsprache
Anna Schröder-Sura, Steffi Morkötter Lernerfahrungen über Sprachfamilien hinaus Ein Beitrag zur Förderung von Lehr- und Lernkompetenz 1. Einführung Spätestens mit dem Erlernen einer zweiten Fremdsprache
Potsdam ; Dr. Ursula Behr (ThILLM) Sprachenübergreifendes Lehren und Lernen und die Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts
 Potsdam 18.09.2015; Dr. Ursula Behr (ThILLM) Sprachenübergreifendes Lehren und Lernen und die Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts Begründungszusammenhänge sprachenpolitisch spracherwerbstheoretisch
Potsdam 18.09.2015; Dr. Ursula Behr (ThILLM) Sprachenübergreifendes Lehren und Lernen und die Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts Begründungszusammenhänge sprachenpolitisch spracherwerbstheoretisch
Projektwoche Italienisch interkomprehensiv
 Projektwoche Italienisch interkomprehensiv Editiones EuroCom herausgegeben von Horst Günter Klein, Franz-Joseph Meißner, Tilbert Dídac Stegmann und Lew N. Zybatow Vol. 28 Jochen Strathmann Projektwoche
Projektwoche Italienisch interkomprehensiv Editiones EuroCom herausgegeben von Horst Günter Klein, Franz-Joseph Meißner, Tilbert Dídac Stegmann und Lew N. Zybatow Vol. 28 Jochen Strathmann Projektwoche
Latein Lehrplan für das Grundlagenfach (mit Basissprache)
 Kantonsschule Zug l Gymnasium Latein mit Basissprache Grundlagenfach Latein Lehrplan für das Grundlagenfach (mit Basissprache) A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 0 0 3 3 3 3 B. Didaktische
Kantonsschule Zug l Gymnasium Latein mit Basissprache Grundlagenfach Latein Lehrplan für das Grundlagenfach (mit Basissprache) A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 0 0 3 3 3 3 B. Didaktische
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS. Wir vergleichen Sprachen
 Wir vergleichen Sprachen Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch Sprache untersuchen und reflektieren Film (youtube) und Arbeitsblätter in unterschiedlichen Sprachen Kompetenzerwartungen D
Wir vergleichen Sprachen Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch Sprache untersuchen und reflektieren Film (youtube) und Arbeitsblätter in unterschiedlichen Sprachen Kompetenzerwartungen D
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017)
 Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Schulinternes Curriculum im Fach Latein. auf der Grundlage des Bildungsplans 2016 Gymnasium für die Klasse 6
 Schulinternes Curriculum im Fach Latein auf der Grundlage des Bildungsplans 2016 Gymnasium für die Klasse 6 Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung Curriculum für das Fach Latein Klasse 6 Sprachkompetenz Textkompetenz
Schulinternes Curriculum im Fach Latein auf der Grundlage des Bildungsplans 2016 Gymnasium für die Klasse 6 Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung Curriculum für das Fach Latein Klasse 6 Sprachkompetenz Textkompetenz
Schulcurriculum Gymnasium Korntal-Münchingen
 Klasse: 10 Seite 1 Minimalanforderungskatalog; Themen des Schuljahres gegliedert nach Arbeitsbereichen Übergreifende Themen, die dem Motto der jeweiligen Klassenstufe entsprechen und den Stoff des s vertiefen,
Klasse: 10 Seite 1 Minimalanforderungskatalog; Themen des Schuljahres gegliedert nach Arbeitsbereichen Übergreifende Themen, die dem Motto der jeweiligen Klassenstufe entsprechen und den Stoff des s vertiefen,
Mehrsprachigkeit und Englischunterricht
 Fremdsprachendidaktik inhalts- und lernerorientiert / Foreign Language Pedagogy - content- and learneroriented 31 Mehrsprachigkeit und Englischunterricht Bearbeitet von Jenny Jakisch 1. Auflage 2015. Buch.
Fremdsprachendidaktik inhalts- und lernerorientiert / Foreign Language Pedagogy - content- and learneroriented 31 Mehrsprachigkeit und Englischunterricht Bearbeitet von Jenny Jakisch 1. Auflage 2015. Buch.
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium
 Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Schwerpunktübersicht: 1. Zweitspracherwerbsforschung / Hypothesen / Neurolinguistik 2. Fehler
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Schwerpunktübersicht: 1. Zweitspracherwerbsforschung / Hypothesen / Neurolinguistik 2. Fehler
BP S600 Schlusspraktikum Diagnoseaufgaben Fremdsprachen. Nikola Mayer Clément Zürn
 BP S600 Schlusspraktikum Diagnoseaufgaben Fremdsprachen Nikola Mayer Clément Zürn Auftrag Fremdsprachen In den Modulen zur Fremdsprachendidaktik und zum Fachdidaktischen Coaching haben Sie bereits intensiv
BP S600 Schlusspraktikum Diagnoseaufgaben Fremdsprachen Nikola Mayer Clément Zürn Auftrag Fremdsprachen In den Modulen zur Fremdsprachendidaktik und zum Fachdidaktischen Coaching haben Sie bereits intensiv
LEHRPLAN FÜR DAS AKZENTFACH LATEIN
 LEHRPLAN FÜR DAS AKZENTFACH LATEIN A. STUNDENDOTATION Klasse 1. 2. 3. 4. Wochenstunden 3 3 x x B. DIDAKTISCHE KONZEPTION Das Akzentfach Latein schliesst an den Lateinlehrgang der Bezirksschule an und führt
LEHRPLAN FÜR DAS AKZENTFACH LATEIN A. STUNDENDOTATION Klasse 1. 2. 3. 4. Wochenstunden 3 3 x x B. DIDAKTISCHE KONZEPTION Das Akzentfach Latein schliesst an den Lateinlehrgang der Bezirksschule an und führt
LEHRPLAN FÜR DAS FREIFACH RUSSISCH
 LEHRPLAN FÜR DAS FREIFACH RUSSISCH A. STUNDENDOTATION Klasse 2M 3M 4M Gymnasium Wochenstunden 2 2 2 B. LEHRPLAN 2. Maturitätsklasse: Kurzzeitgymnasium Niveau A1 (nach RKI: Russkij kak inostrannyj) Lerninhalte
LEHRPLAN FÜR DAS FREIFACH RUSSISCH A. STUNDENDOTATION Klasse 2M 3M 4M Gymnasium Wochenstunden 2 2 2 B. LEHRPLAN 2. Maturitätsklasse: Kurzzeitgymnasium Niveau A1 (nach RKI: Russkij kak inostrannyj) Lerninhalte
Haben Personen mit Migrationshintergrund interkulturelle Kompetenz?
 Haben Personen mit Migrationshintergrund interkulturelle Kompetenz? Mehrsprachigkeit, spezifische interkulturelle Kompetenzen und mitgebrachte Abschlüsse aus dem Ausland bilden ein spezielles Qualifikationsbündel.
Haben Personen mit Migrationshintergrund interkulturelle Kompetenz? Mehrsprachigkeit, spezifische interkulturelle Kompetenzen und mitgebrachte Abschlüsse aus dem Ausland bilden ein spezielles Qualifikationsbündel.
Mehrsprachigkeitsdidaktik
 Mehrsprachigkeitsdidaktik Einleitende Bemerkungen Assoc. Prof. Dr. R. Steinar Nyböle Hochschule Östfold, Norwegen www.hiof.no Sprache oder Dialekt? manchmal ist es schwierig, zwischen Einzelsprache und
Mehrsprachigkeitsdidaktik Einleitende Bemerkungen Assoc. Prof. Dr. R. Steinar Nyböle Hochschule Östfold, Norwegen www.hiof.no Sprache oder Dialekt? manchmal ist es schwierig, zwischen Einzelsprache und
Ankreuzen oder Ausformulieren? Unterschiedliche Leseverständnisaufgaben im Vergleich
 www.ifs.tu-dortmund.de Office.mcelvany@fk12.tu-dortmund.de Ankreuzen oder Ausformulieren? Unterschiedliche Leseverständnisaufgaben im Vergleich Hintergrund Lesekompetenzen von Schülerinnen und Schülern
www.ifs.tu-dortmund.de Office.mcelvany@fk12.tu-dortmund.de Ankreuzen oder Ausformulieren? Unterschiedliche Leseverständnisaufgaben im Vergleich Hintergrund Lesekompetenzen von Schülerinnen und Schülern
Dank... XI Einleitung... 1
 Inhaltsverzeichnis Dank... XI Einleitung... 1 1. Lernende und Lehrende... 5 1.1 Die Lernenden... 5 1.1.1 Die Vielfalt der Einflussfaktoren... 6 1.1.2 Biologische Grundausstattung... 7 1.1.3 Sprachlerneignung...
Inhaltsverzeichnis Dank... XI Einleitung... 1 1. Lernende und Lehrende... 5 1.1 Die Lernenden... 5 1.1.1 Die Vielfalt der Einflussfaktoren... 6 1.1.2 Biologische Grundausstattung... 7 1.1.3 Sprachlerneignung...
Die Schülerinnen und Schüler kennen die sprachhistorische Bedeutung des Lateins für viele europäische Sprachen.
 2 Fachbereichslehrplan Latein Kompetenzaufbau LAT. Sprache(n) im Fokus A Bewusstheit für Sprache 1. LAT..A.1 Die Schülerinnen und Schüler kennen die sprachhistorische Bedeutung des Lateins für viele europäische
2 Fachbereichslehrplan Latein Kompetenzaufbau LAT. Sprache(n) im Fokus A Bewusstheit für Sprache 1. LAT..A.1 Die Schülerinnen und Schüler kennen die sprachhistorische Bedeutung des Lateins für viele europäische
Evaluation Bilingualer Politik/Wirtschaft-Unterricht am FRG 1
 Evaluation Bilingualer Politik/Wirtschaft-Unterricht am FRG 1 Zusammenfassung der Ergebnisse In einem anonymen Fragebogen wurden die zehn Schülerinnen und Schüler des bilingualen Politik/Wirtschaft-Unterrichtes
Evaluation Bilingualer Politik/Wirtschaft-Unterricht am FRG 1 Zusammenfassung der Ergebnisse In einem anonymen Fragebogen wurden die zehn Schülerinnen und Schüler des bilingualen Politik/Wirtschaft-Unterrichtes
Miriam Schmuhl. Leitfaden zur Erstellung von Hausarbeiten
 Miriam Schmuhl Leitfaden zur Erstellung von Hausarbeiten 1 Was ist eine Hausarbeit und welches Ziel verfolgt sie? Bei einer Hausarbeit handelt es sich um eine wissenschaftliche Ausarbeitung, die die Beantwortung
Miriam Schmuhl Leitfaden zur Erstellung von Hausarbeiten 1 Was ist eine Hausarbeit und welches Ziel verfolgt sie? Bei einer Hausarbeit handelt es sich um eine wissenschaftliche Ausarbeitung, die die Beantwortung
Herbert und Ingeborg Christ-Stiftung Lehren und Lernen fremder Sprachen
 Stifter Prof. Dr. Herbert Christ, Düsseldorf Dr. Ingeborg Christ, Düsseldorf Stiftungsgründung 1999 Stiftungszweck Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Didaktik der romanischen Sprachen
Stifter Prof. Dr. Herbert Christ, Düsseldorf Dr. Ingeborg Christ, Düsseldorf Stiftungsgründung 1999 Stiftungszweck Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Didaktik der romanischen Sprachen
Bilingualer Sachfachunterricht. Chancen und Herausforderungen Ein Einblick in theoretische Hintergründe
 Bilingualer Sachfachunterricht Chancen und Herausforderungen Ein Einblick in theoretische Hintergründe Bilingualer Sachfachunterricht 1. Begriffe und Definitionen 2. Rahmenbedingungen des bilingualen Sachfachunterrichts
Bilingualer Sachfachunterricht Chancen und Herausforderungen Ein Einblick in theoretische Hintergründe Bilingualer Sachfachunterricht 1. Begriffe und Definitionen 2. Rahmenbedingungen des bilingualen Sachfachunterrichts
Narrative Kompetenz in der Fremdsprache Englisch
 Fremdsprachendidaktik inhalts- und lernerorientiert / Foreign Language Pedagogy - content- and learneroriented 27 Narrative Kompetenz in der Fremdsprache Englisch Eine empirische Studie zur Ausprägung
Fremdsprachendidaktik inhalts- und lernerorientiert / Foreign Language Pedagogy - content- and learneroriented 27 Narrative Kompetenz in der Fremdsprache Englisch Eine empirische Studie zur Ausprägung
Mille feuilles Information für Eltern
 Mille feuilles Information für Eltern Inhalte Spracherwerb Materialien von Mille feuilles Grundlage von Mille feuilles Aufbau eines parcours (Lerneinheit) 3 Kompetenzbereiche Umgang mit Fehlern Als Eltern
Mille feuilles Information für Eltern Inhalte Spracherwerb Materialien von Mille feuilles Grundlage von Mille feuilles Aufbau eines parcours (Lerneinheit) 3 Kompetenzbereiche Umgang mit Fehlern Als Eltern
forum schule Magazin für Lehrerinnen und Lehrer, 1/2007
 forum schule Magazin für Lehrerinnen und Lehrer, 1/2007 www.forum-schule.de Listening and Reading Comprehension Erste Ergebnisse einer Studie zu Englisch ab Klasse 3 an nordrhein-westfälischen Grundschulen
forum schule Magazin für Lehrerinnen und Lehrer, 1/2007 www.forum-schule.de Listening and Reading Comprehension Erste Ergebnisse einer Studie zu Englisch ab Klasse 3 an nordrhein-westfälischen Grundschulen
Mehrsprachigkeit in Österreich und Europa- Anspruch und Wirklichkeit
 Mehrsprachigkeit in Österreich und Europa- Anspruch und Wirklichkeit Dr. Alexandra Wojnesitz, Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum (Graz) und Universität Wien Wer ist mehrsprachig? Aussagen eines
Mehrsprachigkeit in Österreich und Europa- Anspruch und Wirklichkeit Dr. Alexandra Wojnesitz, Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum (Graz) und Universität Wien Wer ist mehrsprachig? Aussagen eines
EINFÜHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK DES FRANZÖSISCHEN KLAUSUR
 Name: Matrikel-Nr. SS 2014 EINFÜHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK DES FRANZÖSISCHEN KLAUSUR 7.Juli 2014 Note: (Bearbeitungszeit: 60 min.) / 92 BE Die folgenden Fragen sollten Sie in der Regel stichpunktartig beantworten.
Name: Matrikel-Nr. SS 2014 EINFÜHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK DES FRANZÖSISCHEN KLAUSUR 7.Juli 2014 Note: (Bearbeitungszeit: 60 min.) / 92 BE Die folgenden Fragen sollten Sie in der Regel stichpunktartig beantworten.
Illlllllllllllllllllllll
 Band 6 Kunst auf Englisch? Ein Plädoyer für die Erweiterung des bilingualen Sachfachkanons Jutta Rymarczyk ULB Darmstadt Illlllllllllllllllllllll 16070408 Langenscheidt- Longman Inhalt INHALTSVERZEICHNIS
Band 6 Kunst auf Englisch? Ein Plädoyer für die Erweiterung des bilingualen Sachfachkanons Jutta Rymarczyk ULB Darmstadt Illlllllllllllllllllllll 16070408 Langenscheidt- Longman Inhalt INHALTSVERZEICHNIS
Eurocomprehension: Der romanistische Beitrag für eine europäische Mehrsprachigkeit
 Eurocomprehension: Der romanistische Beitrag für eine europäische Mehrsprachigkeit Editiones EuroCom herausgegeben von: Horst Günter Klein und Tilbert Dídac Stegmann Vol. 2 Sabine Stoye Eurocomprehension:
Eurocomprehension: Der romanistische Beitrag für eine europäische Mehrsprachigkeit Editiones EuroCom herausgegeben von: Horst Günter Klein und Tilbert Dídac Stegmann Vol. 2 Sabine Stoye Eurocomprehension:
EINFÜHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK DES FRANZÖSISCHEN KLAUSUR
 Name: Matrikel-Nr. SS 2015 EINFÜHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK DES FRANZÖSISCHEN KLAUSUR 13.Juli 2015 Note: (Bearbeitungszeit: 60 min.) / 100 BE Die folgenden Fragen sind in der Regel stichpunktartig zu beantworten.
Name: Matrikel-Nr. SS 2015 EINFÜHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK DES FRANZÖSISCHEN KLAUSUR 13.Juli 2015 Note: (Bearbeitungszeit: 60 min.) / 100 BE Die folgenden Fragen sind in der Regel stichpunktartig zu beantworten.
Germanistik. Nika Ragua. Wortschatz üben. Studienarbeit
 Germanistik Nika Ragua Wortschatz üben Studienarbeit FAKULTÄT III SPRACH- UND KULTURWISSENSCHAFTEN INSTITUT FÜR GERMANISTIK WINTERSEMESTER 2009/2010 Modul: Deutsch als Fremdsprache Seminar: Methoden der
Germanistik Nika Ragua Wortschatz üben Studienarbeit FAKULTÄT III SPRACH- UND KULTURWISSENSCHAFTEN INSTITUT FÜR GERMANISTIK WINTERSEMESTER 2009/2010 Modul: Deutsch als Fremdsprache Seminar: Methoden der
Deutsch als Fremdsprache
 Deutsch als Fremdsprache Eine Einführung Bearbeitet von Dietmar Rösler 1. Auflage 2012. Buch. XI, 301 S. Softcover ISBN 978 3 476 02300 1 Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm Gewicht: 481 g Weitere Fachgebiete
Deutsch als Fremdsprache Eine Einführung Bearbeitet von Dietmar Rösler 1. Auflage 2012. Buch. XI, 301 S. Softcover ISBN 978 3 476 02300 1 Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm Gewicht: 481 g Weitere Fachgebiete
Inhalt. 1. Das Schiller-Gymnasium Bautzen. 2. Welche Voraussetzungen sollte Ihr Kind für einen guten Start mitbringen?
 Inhalt 1. Das Schiller-Gymnasium Bautzen 2. Welche Voraussetzungen sollte Ihr Kind für einen guten Start mitbringen? 3. Der Wechsel an das Schiller-Gymnasium Anmeldetermine Anmeldezeiten 4. Was erwartet
Inhalt 1. Das Schiller-Gymnasium Bautzen 2. Welche Voraussetzungen sollte Ihr Kind für einen guten Start mitbringen? 3. Der Wechsel an das Schiller-Gymnasium Anmeldetermine Anmeldezeiten 4. Was erwartet
FERTIGKEITEN UND PROZEDURALES WISSEN
 FERTIGKEITEN UND PROZEDURALES WISSEN S-1.+ Sprachliche Elemente / kulturelle Phänomene in mehr oder weniger vertrauten Sprachen / Kulturen beobachten / analysieren können S-2 + Sprachliche Elemente / kulturelle
FERTIGKEITEN UND PROZEDURALES WISSEN S-1.+ Sprachliche Elemente / kulturelle Phänomene in mehr oder weniger vertrauten Sprachen / Kulturen beobachten / analysieren können S-2 + Sprachliche Elemente / kulturelle
Modul 7: Forschungspraxis. Autorenkollektiv
 Modul 7: Forschungspraxis Autorenkollektiv 1 Modul 7: Forschungspraxis Zu Modul 7: Forschungspraxis gehören folgende Online-Lernmodule: 1. Einführung in die Sprachlehr- und Mehrsprachigkeitsforschung 2.
Modul 7: Forschungspraxis Autorenkollektiv 1 Modul 7: Forschungspraxis Zu Modul 7: Forschungspraxis gehören folgende Online-Lernmodule: 1. Einführung in die Sprachlehr- und Mehrsprachigkeitsforschung 2.
DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten
 Germanistik Mohamed Chaabani DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Wissenschaftlicher Aufsatz 1 DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Chaabani Mohamed Abstract Die
Germanistik Mohamed Chaabani DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Wissenschaftlicher Aufsatz 1 DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Chaabani Mohamed Abstract Die
ENTDECKEN SIE IHRE LERNSTRATEGIEN!
 ENTDECKEN SIE IHRE LERNSTRATEGIEN! Beantworten Sie folgenden Fragen ausgehend vom dem, was Sie zur Zeit wirklich machen, und nicht vom dem, was Sie machen würden, wenn Sie mehr Zeit hätten oder wenn Sie
ENTDECKEN SIE IHRE LERNSTRATEGIEN! Beantworten Sie folgenden Fragen ausgehend vom dem, was Sie zur Zeit wirklich machen, und nicht vom dem, was Sie machen würden, wenn Sie mehr Zeit hätten oder wenn Sie
Schulinterner Lehrplan für das Fach Latein, Sekundarstufe I Latein ab der Jahrgangsstufe 6
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Latein, Sekundarstufe I Latein ab der Jahrgangsstufe 6 Verbindliche Absprachen der Fachkonferenz Latein für den Unterricht in der Jahrgangsstufe 6 Schiller-Gymnasium
Schulinterner Lehrplan für das Fach Latein, Sekundarstufe I Latein ab der Jahrgangsstufe 6 Verbindliche Absprachen der Fachkonferenz Latein für den Unterricht in der Jahrgangsstufe 6 Schiller-Gymnasium
Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen
 Sylwia Adamczak-Krysztofowicz Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen Eine Studie zur Kultur- und Landeskundevermittlung im DaF-Studium in Polen Verlag Dr. Kovac Inhaltsverzeichnis VORWORT
Sylwia Adamczak-Krysztofowicz Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen Eine Studie zur Kultur- und Landeskundevermittlung im DaF-Studium in Polen Verlag Dr. Kovac Inhaltsverzeichnis VORWORT
Schulinternes Curriculum Latein. Jahrgangsstufe 9. Methodisch- didaktische Absprachen. Die Schülerinnen und Schüler können.. Unterricht Beispielsätze:
 Schulinternes Curriculum Latein Jahrgangsstufe 9 Inhalt Unterrichtsvorhaben II Thema Liebe, Reise, Abenteuer im antiken Roman anhand der Historia Apollonii Themenfelder gem. KLP Römische Alltagskultur/
Schulinternes Curriculum Latein Jahrgangsstufe 9 Inhalt Unterrichtsvorhaben II Thema Liebe, Reise, Abenteuer im antiken Roman anhand der Historia Apollonii Themenfelder gem. KLP Römische Alltagskultur/
Nataša Ćorić Gymnasium Mostar Bosnien und Herzegowina
 Nataša Ćorić Gymnasium Mostar Bosnien und Herzegowina n Inhalt Der passive und der aktive Wortschatz Das vernetzte Lernen Die Einführung von neuem Wortschatz Phasen der Wortschatzvermittlung Techniken
Nataša Ćorić Gymnasium Mostar Bosnien und Herzegowina n Inhalt Der passive und der aktive Wortschatz Das vernetzte Lernen Die Einführung von neuem Wortschatz Phasen der Wortschatzvermittlung Techniken
LehrplanPLUS Mittelschule Englisch Klasse 5. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. 1. Aufbau des Lehrplans
 Mittelschule Englisch Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der Englischunterricht an der Mittelschule ist wie schon bisher - kommunikativ ausgerichtet. Die grundlegenden Voraussetzungen
Mittelschule Englisch Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der Englischunterricht an der Mittelschule ist wie schon bisher - kommunikativ ausgerichtet. Die grundlegenden Voraussetzungen
Mehrsprachigkeit mit dem Ziel einer funktionalen Fremdsprachenkompetenz. Interkulturelle Kompetenz
 Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt auf der Basis des europäischen Aktionsplans 2004 2006 (http:/www.europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_de.pdf) Mehrsprachigkeit
Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt auf der Basis des europäischen Aktionsplans 2004 2006 (http:/www.europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_de.pdf) Mehrsprachigkeit
Präsentation von Susanne Flükiger, Stabsstelle Pädagogik, Kanton Solothurn. PP Medienanlass
 Präsentation von Susanne Flükiger, Stabsstelle Pädagogik, Kanton Solothurn (Didaktische) Grundgedanken Was ist das Ziel des Fremdsprachenunterrichts? Wie erwerben wir neues Wissen? Wie lernen wir die erste
Präsentation von Susanne Flükiger, Stabsstelle Pädagogik, Kanton Solothurn (Didaktische) Grundgedanken Was ist das Ziel des Fremdsprachenunterrichts? Wie erwerben wir neues Wissen? Wie lernen wir die erste
Vorstellung der Fächer Latein, Französisch und Spanisch als 2. Fremdsprache. Für die Fachschaften: Rika Rimpel
 Vorstellung der Fächer Latein, Französisch und Spanisch als 2. Fremdsprache Für die Fachschaften: Rika Rimpel Inhaltsübersicht - Warum sollte man Latein, Französisch oder Spanisch lernen? - Warum als 2.
Vorstellung der Fächer Latein, Französisch und Spanisch als 2. Fremdsprache Für die Fachschaften: Rika Rimpel Inhaltsübersicht - Warum sollte man Latein, Französisch oder Spanisch lernen? - Warum als 2.
Leitfaden für Schülerinnen und Schüler zur CertiLingua Projektdokumentation
 Leitfaden für Schülerinnen und Schüler zur CertiLingua Projektdokumentation Die CertiLingua Projektdokumentation liefert den Nachweis für die Entwicklung interkultureller Kompetenzen im Rahmen eines face-to-face
Leitfaden für Schülerinnen und Schüler zur CertiLingua Projektdokumentation Die CertiLingua Projektdokumentation liefert den Nachweis für die Entwicklung interkultureller Kompetenzen im Rahmen eines face-to-face
Ausspracheschwierigkeiten arabischer Deutschlernender aus dem Irak und didaktische Überlegungen zum Ausspracheunterricht
 Hallesche Schriften zur Sprechwissenschaft und Phonetik 49 Ausspracheschwierigkeiten arabischer Deutschlernender aus dem Irak und didaktische Überlegungen zum Ausspracheunterricht 1. Auflage 2014. Buch.
Hallesche Schriften zur Sprechwissenschaft und Phonetik 49 Ausspracheschwierigkeiten arabischer Deutschlernender aus dem Irak und didaktische Überlegungen zum Ausspracheunterricht 1. Auflage 2014. Buch.
Wortschatzarbeit im Englischunterricht: Strategien zum Vokabellernen (5. Klasse Hauptschule)
 Pädagogik Jens Goldschmidt Wortschatzarbeit im Englischunterricht: Strategien zum Vokabellernen (5. Klasse Hauptschule) Laut Kompetenz 1.2.1 der APVO-Lehr Examensarbeit Jens Goldschmidt (LiVD) Anwärter
Pädagogik Jens Goldschmidt Wortschatzarbeit im Englischunterricht: Strategien zum Vokabellernen (5. Klasse Hauptschule) Laut Kompetenz 1.2.1 der APVO-Lehr Examensarbeit Jens Goldschmidt (LiVD) Anwärter
Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht
 Germanistik Mohamed Chaabani Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Forschungsarbeit 1 Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Chaabani Mohamed Abstract Gegenstand dieser Arbeit
Germanistik Mohamed Chaabani Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Forschungsarbeit 1 Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Chaabani Mohamed Abstract Gegenstand dieser Arbeit
SCHÜLER_INNEN ANALYSIEREN SPRACHE MEHRSPRACHIGE RESSOURCEN BEIM GRAMMATIKLERNEN
 SCHÜLER_INNEN ANALYSIEREN SPRACHE MEHRSPRACHIGE RESSOURCEN BEIM GRAMMATIKLERNEN Zum Hintergrund des Projekts Fallstudie 1 Das Projekt wurde im Finnischunterricht (Finnisch als Erstsprache) mit 13-jährigen
SCHÜLER_INNEN ANALYSIEREN SPRACHE MEHRSPRACHIGE RESSOURCEN BEIM GRAMMATIKLERNEN Zum Hintergrund des Projekts Fallstudie 1 Das Projekt wurde im Finnischunterricht (Finnisch als Erstsprache) mit 13-jährigen
Schulinternes Curriculum SII Fach Russisch (neu einsetzend)
 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben: Unterrichtsvorhaben I in EF Soziokulturelles Orientierungswissen erste Informationen zu Russland Hörverstehen Grundlagen der russischen Phonetik kennenlernen; Unterrichtsgespräche
Konkretisierte Unterrichtsvorhaben: Unterrichtsvorhaben I in EF Soziokulturelles Orientierungswissen erste Informationen zu Russland Hörverstehen Grundlagen der russischen Phonetik kennenlernen; Unterrichtsgespräche
New World. Englisch lernen mit New World. Informationen für die Eltern. English as a second foreign language Pupil s Book Units 1
 Englisch lernen mit New World Informationen für die Eltern New World English as a second foreign language Pupil s Book Units 1 Klett und Balmer Verlag Liebe Eltern Seit zwei Jahren lernt Ihr Kind Französisch
Englisch lernen mit New World Informationen für die Eltern New World English as a second foreign language Pupil s Book Units 1 Klett und Balmer Verlag Liebe Eltern Seit zwei Jahren lernt Ihr Kind Französisch
Schuleigener Arbeitsplan im Fach Französisch für die Jahrgangsstufen 6-10
 Schuleigener Arbeitsplan im Fach Französisch für die Jahrgangsstufen 6-10 Gymnasium Marianum Meppen (Stand: August 2016) Einleitende Bemerkungen Der niedersächsische Bildungsserver (NiBis) hält zu den
Schuleigener Arbeitsplan im Fach Französisch für die Jahrgangsstufen 6-10 Gymnasium Marianum Meppen (Stand: August 2016) Einleitende Bemerkungen Der niedersächsische Bildungsserver (NiBis) hält zu den
Sprachenlernen Zwei- und Mehrsprachigkeitsdidaktik
 Sprachenlernen Zwei- und Mehrsprachigkeitsdidaktik Diskussionsbeitrag zur Entscheidungsfindung über die Sprachenfolge 1. Zwei und Mehrsprachigkeit als gesellschaftliche Wirklichkeit Mehrsprachigkeit ist
Sprachenlernen Zwei- und Mehrsprachigkeitsdidaktik Diskussionsbeitrag zur Entscheidungsfindung über die Sprachenfolge 1. Zwei und Mehrsprachigkeit als gesellschaftliche Wirklichkeit Mehrsprachigkeit ist
Deutsch und andere Sprachen Deutsch als Zweitsprache
 Deutsch und andere Sprachen Deutsch als Zweitsprache Karin Kleppin Zur Situation im Deutschunterricht Für den Unterricht DaM gilt Folgendes: unterschiedliche Erstsprachen mit diesen Erstsprachen verbundene
Deutsch und andere Sprachen Deutsch als Zweitsprache Karin Kleppin Zur Situation im Deutschunterricht Für den Unterricht DaM gilt Folgendes: unterschiedliche Erstsprachen mit diesen Erstsprachen verbundene
IT Fragebogen für Sprachlehrer-Trainer - Datenanalyse
 IT Fragebogen für Sprachlehrer-Trainer - Datenanalyse Über die Teilnehmer 1. Sieben Sprachlehrer-Trainer haben den Fragebogen ausgefüllt. 2. Sechs Lehrer-Trainer sprechen Englisch, sechs Französisch, drei
IT Fragebogen für Sprachlehrer-Trainer - Datenanalyse Über die Teilnehmer 1. Sieben Sprachlehrer-Trainer haben den Fragebogen ausgefüllt. 2. Sechs Lehrer-Trainer sprechen Englisch, sechs Französisch, drei
2 Entstehungsgeschichte und Verlauf der Studie Interkulturelle Kompetenz zwischen Theorie und Praxis...35
 Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis...19 Abbildungsverzeichnis...21 1 Einleitung...25 1.1 Problem- und Zielstellungen...26 1.2 Aufbau der vorliegenden Arbeit...28 2 Entstehungsgeschichte und Verlauf
Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis...19 Abbildungsverzeichnis...21 1 Einleitung...25 1.1 Problem- und Zielstellungen...26 1.2 Aufbau der vorliegenden Arbeit...28 2 Entstehungsgeschichte und Verlauf
Orientierungshilfen. Lernstandserhebung. Englischunterricht der Grundschule
 Orientierungshilfen für die Lernstandserhebung im Englischunterricht der Grundschule Seite 56 Englisch in der Grundschule Orientierungshilfen für die Lernstandserhebung im Englischunterricht der Grundschule
Orientierungshilfen für die Lernstandserhebung im Englischunterricht der Grundschule Seite 56 Englisch in der Grundschule Orientierungshilfen für die Lernstandserhebung im Englischunterricht der Grundschule
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Genial! Deutsch DAZ/DAF - Schritt für Schritt zukunftsfit - Schulbuch Deutsch - Serviceteil Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Genial! Deutsch DAZ/DAF - Schritt für Schritt zukunftsfit - Schulbuch Deutsch - Serviceteil Das komplette Material finden Sie hier:
Internationalismen bei den Elementen der Chemie
 Internationalismen bei den Elementen der Chemie Takako Yoneyama 1. Einleitung Die Abkürzungszeichen der chemischen Elemente, z.b. Cu oder H, sind auf der ganzen Welt gleich. Aber sind auch die Bezeichnungen
Internationalismen bei den Elementen der Chemie Takako Yoneyama 1. Einleitung Die Abkürzungszeichen der chemischen Elemente, z.b. Cu oder H, sind auf der ganzen Welt gleich. Aber sind auch die Bezeichnungen
Curriculum für das Fach Latein in den Jgst. 6 und 7
 Curriculum für das Fach Latein in den Jgst. 6 und 7 Kompetenzbereiche Inhalte Lektionen Pontes Methoden Kompetenzbereich 1: Kl. 6: Wortschatz Lektion 1-13 in der Lage sein - grundl. Regeln zur Zusammensetzung
Curriculum für das Fach Latein in den Jgst. 6 und 7 Kompetenzbereiche Inhalte Lektionen Pontes Methoden Kompetenzbereich 1: Kl. 6: Wortschatz Lektion 1-13 in der Lage sein - grundl. Regeln zur Zusammensetzung
Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Englisch
 Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Englisch Gültig ab 10.03.2014 auf Beschluss der Fachkonferenz Englisch vom 06.03.2014 Klasse 1/2 Vorrangige Kriterien für die Einschätzung der Leistungen sind die
Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Englisch Gültig ab 10.03.2014 auf Beschluss der Fachkonferenz Englisch vom 06.03.2014 Klasse 1/2 Vorrangige Kriterien für die Einschätzung der Leistungen sind die
Projekt Pädagogische Schulentwicklung in Berlin
 Projekt Pädagogische Schulentwicklung in Berlin Evaluation des Sockeltraining zum Methodentraining der Modellschulen II Auswertung der Befragung von Schülerinnen und Schülern S. 2 Auswertung Zusammenfassung
Projekt Pädagogische Schulentwicklung in Berlin Evaluation des Sockeltraining zum Methodentraining der Modellschulen II Auswertung der Befragung von Schülerinnen und Schülern S. 2 Auswertung Zusammenfassung
Kerncurriculum Französisch, 3. Lernjahr (Découvertes Band III)
 Kerncurriculum Französisch, 3. Lernjahr (Découvertes Band III) Die vorliegenden Raster sind ein Beispiel für ein Kerncurriculum Französisch (3. Lernjahr) auf der Grundlage des Lehrwerks Découvertes III.
Kerncurriculum Französisch, 3. Lernjahr (Découvertes Band III) Die vorliegenden Raster sind ein Beispiel für ein Kerncurriculum Französisch (3. Lernjahr) auf der Grundlage des Lehrwerks Découvertes III.
Leistungsnachweise und Klassenarbeiten im Fach Französisch (2. Fremdsprache) in der Mittelstufe. 1. Übersicht
 e und Klassenarbeiten im Fach Französisch (2. Fremdsprache) in der Mittelstufe 1. Übersicht Klassenstufe Anzahl der Klassenarbeiten / e 6. Klasse (1. 7. Klasse (2. Art der e (LN) Der LN setzt sich sammen
e und Klassenarbeiten im Fach Französisch (2. Fremdsprache) in der Mittelstufe 1. Übersicht Klassenstufe Anzahl der Klassenarbeiten / e 6. Klasse (1. 7. Klasse (2. Art der e (LN) Der LN setzt sich sammen
Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife. Einführung, Überblick und Ausblick
 Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife Einführung, Überblick und Ausblick 1 Gliederung Verwandtschaft! Standortbestimmung: Diskursfähigkeit!
Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife Einführung, Überblick und Ausblick 1 Gliederung Verwandtschaft! Standortbestimmung: Diskursfähigkeit!
Kern- und Schulcurriculum für das Fach Latein Klasse 5/6. Stand Schuljahr 2016/17
 Kern- und Schulcurriculum für das Fach Latein Klasse 5/6 Stand Schuljahr 2016/17 Themen zugeordnete Bildungsstandards / Inhalte Empfehlungen, Projekte, Strategien und Methoden Wortschatz Satzlehre > lateinische
Kern- und Schulcurriculum für das Fach Latein Klasse 5/6 Stand Schuljahr 2016/17 Themen zugeordnete Bildungsstandards / Inhalte Empfehlungen, Projekte, Strategien und Methoden Wortschatz Satzlehre > lateinische
Language Awareness und bilingualer Unterricht
 Sylvia Fehling Language Awareness und bilingualer Unterricht Eine komparative Studie 2., überarbeitete Auflage PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften INHALTSVERZEICHNIS Einleitung 17 TEIL
Sylvia Fehling Language Awareness und bilingualer Unterricht Eine komparative Studie 2., überarbeitete Auflage PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften INHALTSVERZEICHNIS Einleitung 17 TEIL
Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Latein. 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen
 Grundsätze zur Leistungsbewertung im Latein 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen Das Leistungskonzept orientiert sich an den Vorgaben des Kernlehrplans NRW. Die rechtlich verbindlichen Grundsätze
Grundsätze zur Leistungsbewertung im Latein 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen Das Leistungskonzept orientiert sich an den Vorgaben des Kernlehrplans NRW. Die rechtlich verbindlichen Grundsätze
3. Schulkonzept. Empfohlener Stundenumfang
 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen 1. Sprachkompetenz 1.1. Wortschatz 1.2. Satzlehre Kerncurriculum mit Operator (3/4) Grundwortschatz: ca. 150 Wörter übersetzen - Wortbildungslehre: Wortbausteine
Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen 1. Sprachkompetenz 1.1. Wortschatz 1.2. Satzlehre Kerncurriculum mit Operator (3/4) Grundwortschatz: ca. 150 Wörter übersetzen - Wortbildungslehre: Wortbausteine
Das Fach Französisch im Zeichen von Kontinuität und Veränderung... 13
 Vorwort... 11 A Das Fach Französisch im Zeichen von Kontinuität und Veränderung... 13 1 Französisch: die Sprache des Nachbarn... 14 1.1 Französisch: eine fremde Sprache?... 14 1.2 Wirtschaftliche Beziehungen...
Vorwort... 11 A Das Fach Französisch im Zeichen von Kontinuität und Veränderung... 13 1 Französisch: die Sprache des Nachbarn... 14 1.1 Französisch: eine fremde Sprache?... 14 1.2 Wirtschaftliche Beziehungen...
Sind Lehrkräfte für den Unterricht mit migrationsbedingt mehrsprachigen Schüler_innen (gut) vorbereitet? Wie werden die bisherigen Bemühungen von
 1. Einleitung Die Sprachenvielfalt im heutigen Deutschland wird immer größer. Eine hohe Anzahl an migrationsbedingt mehrsprachigen Schüler_innen an deutschen Schulen ist nicht nur in der gegenwärtigen
1. Einleitung Die Sprachenvielfalt im heutigen Deutschland wird immer größer. Eine hohe Anzahl an migrationsbedingt mehrsprachigen Schüler_innen an deutschen Schulen ist nicht nur in der gegenwärtigen
- Theoretischer Bezugsrahmen -
 Inhaltsverzeichnis 1. Leserführung 1 1.1. Teil 1: Der theoretische Bezugsrahmen... 1 1.2. Teil 2: Das Produkt... 1 1.3. Teil 3: Das Produkt in der Praxis... 2 1.4. Teil 4: Schlussfolgerungen... 2 2. Einleitung
Inhaltsverzeichnis 1. Leserführung 1 1.1. Teil 1: Der theoretische Bezugsrahmen... 1 1.2. Teil 2: Das Produkt... 1 1.3. Teil 3: Das Produkt in der Praxis... 2 1.4. Teil 4: Schlussfolgerungen... 2 2. Einleitung
Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz
 Kolloquium Fremdsprachenunterricht 56 Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz Ein Beitrag zur Theoriebildung Bearbeitet von Nadine Stahlberg 1. Auflage 2016. Buch. 434 S. Hardcover ISBN 978 3 631 67479
Kolloquium Fremdsprachenunterricht 56 Rekonstruktionen interkultureller Kompetenz Ein Beitrag zur Theoriebildung Bearbeitet von Nadine Stahlberg 1. Auflage 2016. Buch. 434 S. Hardcover ISBN 978 3 631 67479
Azubi statt ungelernt in Aalen. Elternbefragung
 Azubi statt ungelernt in Aalen Elternbefragung Ergebnisse der Erhebung bei Eltern mit Migrationshintergrund in Aalen Petra Bonnet M.A. Büro für Kommunikationsberatung Stuttgart Azubi statt ungelernt Aalen
Azubi statt ungelernt in Aalen Elternbefragung Ergebnisse der Erhebung bei Eltern mit Migrationshintergrund in Aalen Petra Bonnet M.A. Büro für Kommunikationsberatung Stuttgart Azubi statt ungelernt Aalen
Aufgabenbeispiele für Klassen der Flexiblen Grundschule
 Aufgabenbeispiele für Klassen der Flexiblen Grundschule Zentrales Kernelement der Flexiblen Grundschule ist es, die vorhandene Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in der Klasse als Chance zu sehen
Aufgabenbeispiele für Klassen der Flexiblen Grundschule Zentrales Kernelement der Flexiblen Grundschule ist es, die vorhandene Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in der Klasse als Chance zu sehen
Latein - Klasse 5 (2. Hj.) - Version 2 (Juni 2005) S. 1 von 5
 Latein - Klasse 5 (2. Hj.) - Version 2 (Juni 2005) S. 1 von 5 Kerncurriculum
Latein - Klasse 5 (2. Hj.) - Version 2 (Juni 2005) S. 1 von 5 Kerncurriculum
Rezeptive und produktive Grammatik im Lehrwerk Berliner Platz. 2. Entwicklung und Progression in Lehrwerken
 Rezeptive und produktive Grammatik im Lehrwerk Berliner Platz Adrian Kissmann 1. Rezeptive und produktive Grammatik Obwohl die Begriffe rezeptive und produktive Grammatik modern klingen, wurden sie schon
Rezeptive und produktive Grammatik im Lehrwerk Berliner Platz Adrian Kissmann 1. Rezeptive und produktive Grammatik Obwohl die Begriffe rezeptive und produktive Grammatik modern klingen, wurden sie schon
Metakognition und der DaF-Unterricht für asiatische Lerner
 Internationale Hochschulschriften 327 Metakognition und der DaF-Unterricht für asiatische Lerner Möglichkeiten und Grenzen Bearbeitet von Wai-Meng Chan 1. Auflage 2000. Taschenbuch. 388 S. Paperback ISBN
Internationale Hochschulschriften 327 Metakognition und der DaF-Unterricht für asiatische Lerner Möglichkeiten und Grenzen Bearbeitet von Wai-Meng Chan 1. Auflage 2000. Taschenbuch. 388 S. Paperback ISBN
Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. (Ludwig Wittgenstein, ) Detlefsengymnasium Glückstadt März 2015
 Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. (Ludwig Wittgenstein, 1889-1951) Detlefsengymnasium Glückstadt März 2015 Sprachen als Schlüssel - zu globaler Zusammenarbeit und - zu interkulturellem
Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. (Ludwig Wittgenstein, 1889-1951) Detlefsengymnasium Glückstadt März 2015 Sprachen als Schlüssel - zu globaler Zusammenarbeit und - zu interkulturellem
Kern- und Schulcurriculum Englisch Klasse 5/6. Stand Schuljahr 2009/10
 Kern- und Schulcurriculum Englisch Klasse 5/6 Stand Schuljahr 2009/10 Englisch Curriculum Klasse 5/6 Das eingeführte Englischlehrwerk English G 21 ist auf den Bildungsplan für allgemeinbildende Gymnasien
Kern- und Schulcurriculum Englisch Klasse 5/6 Stand Schuljahr 2009/10 Englisch Curriculum Klasse 5/6 Das eingeführte Englischlehrwerk English G 21 ist auf den Bildungsplan für allgemeinbildende Gymnasien
Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Studiensemester. Leistungs -punkte 8 LP
 Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEd EHRGeM 1 Workload 240 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur
Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEd EHRGeM 1 Workload 240 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur
Konzeption der Seminarfolge: Curriculum: Voraussetzungen: Über Sprachkönnen und Fachwissen verfügen
 Konzeption der Seminarfolge: - Modulare Anlage - Semesterübergreifende Teilnahme - Einführungssitzungen: o Hinweis auf Rahmenrichtlinien und Curricula, die EPAS, den europäischen Referenzrahmen für Fremdsprachen
Konzeption der Seminarfolge: - Modulare Anlage - Semesterübergreifende Teilnahme - Einführungssitzungen: o Hinweis auf Rahmenrichtlinien und Curricula, die EPAS, den europäischen Referenzrahmen für Fremdsprachen
Entwurfsmuster Theoretische und praktische Implikationen zur Unterrichtsvorbereitung
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial No Derivative Works 3.0 Unported License. Didaktische Entwurfsmuster Theoretische und praktische Implikationen zur Unterrichtsvorbereitung
This work is licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial No Derivative Works 3.0 Unported License. Didaktische Entwurfsmuster Theoretische und praktische Implikationen zur Unterrichtsvorbereitung
Fachlehrplan Fremdsprache
 Pharma-Assistentin EFZ/ Pharma-Assistent EFZ Fachlehrplan Fremdsprache Version März 2008 Der Lehrplan ist ein Dokument, welches im Verlauf der Umsetzung von den Lehrkräften kritisch überprüft werden muss.
Pharma-Assistentin EFZ/ Pharma-Assistent EFZ Fachlehrplan Fremdsprache Version März 2008 Der Lehrplan ist ein Dokument, welches im Verlauf der Umsetzung von den Lehrkräften kritisch überprüft werden muss.
Erinnern Sie sich, wie Ihr Kind seine erste Sprache gelernt hat?
 Erinnern Sie sich, wie Ihr Kind seine erste Sprache gelernt hat? Sie haben mit Ihrem Kind viel gesprochen Geschichten vorgelesen, Bilderbücher erzählt, Verse vorgesagt, Lieder gesungen... sich nicht dem
Erinnern Sie sich, wie Ihr Kind seine erste Sprache gelernt hat? Sie haben mit Ihrem Kind viel gesprochen Geschichten vorgelesen, Bilderbücher erzählt, Verse vorgesagt, Lieder gesungen... sich nicht dem
Modulhandbuch Lehramt Englisch an Gymnasien und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer. Studiensemester bzw
 Modulhandbuch Lehramt Englisch an Gymnasien und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEdE GYMGeM1 Workload 330 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur 1.2 Vertiefung Ling 2: Sprachgebrauch
Modulhandbuch Lehramt Englisch an Gymnasien und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEdE GYMGeM1 Workload 330 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur 1.2 Vertiefung Ling 2: Sprachgebrauch
Gertraude Heyd. Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Verlag Moritz Diesterweg Frankfurt am Main
 Gertraude Heyd Deutsch lehren Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache Verlag Moritz Diesterweg Frankfurt am Main Inhaltsverzeichnis Vorwort 7 Begriffsbestimmung: Didaktik und Methodik
Gertraude Heyd Deutsch lehren Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache Verlag Moritz Diesterweg Frankfurt am Main Inhaltsverzeichnis Vorwort 7 Begriffsbestimmung: Didaktik und Methodik
Biologische Inhalte, die nach dem Abitur für Basiswissen gehalten werden
 Naturwissenschaft Johanna Sandvoss Biologische Inhalte, die nach dem Abitur für Basiswissen gehalten werden Eine Umfrage unter Studienanfängern Examensarbeit Biologische Inhalte, die nach dem Abitur für
Naturwissenschaft Johanna Sandvoss Biologische Inhalte, die nach dem Abitur für Basiswissen gehalten werden Eine Umfrage unter Studienanfängern Examensarbeit Biologische Inhalte, die nach dem Abitur für
Susanne Kollmann Ines Zwanger
 Susanne Kollmann Ines Zwanger 1. Übersetzung Englisch-Deutsch als Teil eines Studiums der Englischen Philologie 2. Untersuchung zu den Anwendungsmöglichkeiten des GER im Bereich der Übersetzung 3. Probleme
Susanne Kollmann Ines Zwanger 1. Übersetzung Englisch-Deutsch als Teil eines Studiums der Englischen Philologie 2. Untersuchung zu den Anwendungsmöglichkeiten des GER im Bereich der Übersetzung 3. Probleme
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Kein leichter Fall - das deutsche Kasussystem
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kein leichter Fall - das deutsche Kasussystem Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von 28 Kasus Grammatik und
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kein leichter Fall - das deutsche Kasussystem Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von 28 Kasus Grammatik und
Arbeitsblatt zur Schreibung von das und dass. Ca. 3 Seiten, Größe ca. 215 KB
 Arbeitsblatt zur Schreibung von das und dass TMD 200 Arbeitsblatt mit Übungen zu das und dass Das Material eignet sich besonders für Schüler der Klasse 6-7 Im ersten Abschnitt wird der Unterschied zwischen
Arbeitsblatt zur Schreibung von das und dass TMD 200 Arbeitsblatt mit Übungen zu das und dass Das Material eignet sich besonders für Schüler der Klasse 6-7 Im ersten Abschnitt wird der Unterschied zwischen
Kompetenzen und Aufgabenbeispiele Englisch Schreiben (6. Klasse)
 Institut für Bildungsevaluation Assoziiertes Institut der Universität Zürich Kompetenzen und Aufgabenbeispiele Englisch Schreiben (6. Klasse) Informationen für Lehrpersonen und Eltern 1. Wie sind die Ergebnisse
Institut für Bildungsevaluation Assoziiertes Institut der Universität Zürich Kompetenzen und Aufgabenbeispiele Englisch Schreiben (6. Klasse) Informationen für Lehrpersonen und Eltern 1. Wie sind die Ergebnisse
Unterschiede in der Lesemotivation bei Jungen und Mädchen in der Grundschule
 Pädagogik Larissa Drewa Unterschiede in der Lesemotivation bei Jungen und Mädchen in der Grundschule Examensarbeit Unterschiede in der Lesemotivation bei Jungen und Mädchen in der Grundschule Schriftliche
Pädagogik Larissa Drewa Unterschiede in der Lesemotivation bei Jungen und Mädchen in der Grundschule Examensarbeit Unterschiede in der Lesemotivation bei Jungen und Mädchen in der Grundschule Schriftliche
Generatives Schreiben anhand des Bilderbuchs: Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte (M.Baltscheit)
 Janina Cyrener und Linn Haselei (September 2016) Generatives Schreiben anhand des Bilderbuchs: Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte (M.Baltscheit) 1. Vorbemerkungen Für die Konzeption der
Janina Cyrener und Linn Haselei (September 2016) Generatives Schreiben anhand des Bilderbuchs: Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte (M.Baltscheit) 1. Vorbemerkungen Für die Konzeption der
