Die neue Wohnungsfrage
|
|
|
- Renate Lorentz
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 theorie + entwerfen magazin N 3/4 Die neue Wohnungsfrage 14,00
2 IMPRESSUM Stefan Rettich und Studierende des Ausstellungsprojekts Die Neue Wohnungsfrage / von Lehrgebiet theorie+entwerfen School of Architecture Bremen (SoAB) Hochschule Bremen HERAUSGEBER - VERLAG Stefan Rettich - School of Architecture Bremen (SoAB) Hochschule Bremen, Bremen 2013 ISBN ISSN GESTALTUNG Florian Lamm SATZ Anna-Lena Morisse BEZUGSADRESSE Hochschule Bremen School of Architecture Bremen (SoAB) Lehrgebiet theorie+entwerfen Neustadtswall Bremen URL Mit freundlicher Unterschützung von
3 dokumente Die neue N 1 : hoher Wohnungsfrage standard [MA 3.3_SS12] Editorial Stefan Rettich 3 Projekte Sozialer Wohnungsbau 5 Maxi Elen Kochskämper, Anna-Lena Morisse, Mareike Zabel Die Haushaltsfrage 8 Pawel Kubish, Ishan Tunc, Christian Wilm Milieuforschung 11 Saskia Hellbusch, Frederike Just, Laura Kempf, Olga Sosnovski Lebensstilgruppen 16 Isabel Carrera, Ema Sauramo Vom Leben in Bremen 22 Sheila Frederichs, Christina Freese, Sebastian Meier, Ilknur Rustemeyer, Holger Schoefer Wohnraum als Ware 27 Jens Foth, Stephan Hartman, Pablo Peters Recht auf Wohnen 34 Birthe Keller, Anna-Maria Schulte Regionale Polarisierung 43 Thies Hogrefe, Danielle Kettelhage, Mirjam Teberatz
4 2
5 3 Die neue Wohnungsfrage Editorial Stefan Rettich Deutschland steht vor einer neuen Wohnungsfrage: Die Menschen drängen aus den ländlichen Gebieten und aus den Stadtregionen in die Kernbereiche der Großstädte und dort steigen die Mieten. Es fehlen rund Wohnungen. Längst hat das Thema den Fachdiskurs verlassen und der totgesagte Soziale Wohnungsbau erlebt eine Renaissance, als Titelthema in den Leitmedien und als politisches Handlungsfeld: Wohnungsbau wird wieder Wahlkampfthema. Rein quantitativ wird sich diese neue Wohnungsfrage aber nicht lösen lassen, dafür sind die Gründe und gesellschaftlichen Mechanismen, die hinter dieser Entwicklung stehen zu komplex. Dieser erste Teil der aktuellen Doppelausgabe von theorie+entwerfen, mit Beiträgen von Studierenden der School of Architecture Bremen, zeigt einen Überblick zur Geschichte des Sozialen Wohnungsbaus in Deutschland. Daneben werden die Hintergründe von Themen wie der regionalen Polarisierung untersucht, denn nicht überall fehlen Wohnungen: Von den etwa Städten in Deutschland wachsen nur noch etwa 10%. Die übrigen Kommunen sind von Einwohnerverlusten geprägt und geplagt. Ohnehin erscheint nicht die Einwohnerentwicklung die entscheidende Größe bei der Bewältigung dieser neuen Tendenz zu sein, sondern die Haushaltsentwicklung. Schon im Jahr 2011 gab es in Deutschland 40% Einpersonenhaushalte und in den Stadtstaaten war sogar schon jede zweite Wohnung ein Singlehaushalt. Hinzukommt die Flucht der Anleger ins Betongold und damit der Einfluss der anhaltenden Finanzkrise auf Mieten und Immobilienpreise. Auch die Ausdifferenzierung der Gesellschaft in Milieus und Lebensstilgruppen sowie deren Wechselwirkung mit Wohnlage und Wohnformen sind wesentliche Themen dieser neuen Wohnungsbaudebatte. Hinter all dem steht eine qualitative Frage: Für wen und in welchen Lagen sollten die fehlenden Wohnungen heute errichtet werden?
6 4
7 5 Sozialer Wohnungsbau Wohnungsnot ist kein neues Phänomen. Sie geht einher mit der Sozialen Frage, die sich im Zuge der Industrialisierung und dem rasanten Bevölkerungswachstum in den Großstädten stellte. In Reaktion darauf entstanden Wohnungsgenossenschaften, die erschwinglichen Wohnraum und ein Mindestmaß an Hygiene anboten. Staatliches Anliegen wird der soziale Wohnungsbau in Deutschland erst in der Weimarer Republik. Hier manifestiert sich der politische Wille, der Wohnungsnot mit staatlichen bzw. öffentlichen Mitteln entgegenzuwirken. Selbst im Nationalsozialismus wurden Ansätze für einen sozialen Wohnungsbau entwickelt, um das Volk an das diktatorische Regime zu binden. Wegen der Kriegsereignisse wurde dies letztlich nicht realisiert. In der Nachkriegszeit setzte die DDR auf Planwirtschaft und auf das städtebauliche Modell von Trabantenstädten auf der grünen Wiese. In der Bundesrepublik bildete das erste und zweite Wohnungsbaugesetz (1950/ 1994) die Rahmenbedingungen für den sozialen Wohnungsbau, in den auch private Investoren involviert waren: Für den Bau und für das zeitlich beschränkte Vorhalten von Sozialwohnungen erhielten diese staatliche Unterstützung. Im Zuge von Korruptionsaffären und der Herausbildung von sozialen Brennpunkten kam das Modell ab den 1970er Jahren in Verruf und spielte in der politischen Diskussion nur noch eine untergeordnete Rolle. Seit der Föderalismusreform von 2007 ist die Förderung von Sozialwohnungen Ländersache. Zudem gibt es heute rund ein Drittel weniger Sozialwohnungen als Das liegt an den zeitlich befristeten Belegrechtsbindungen, die ausgelaufen sind und in nächster Zeit weiter auslaufen werden. Es zeigt sich, dass sozialer Wohnungsbau stark von politischen Interessen und - Schwerpunkten einer Periode abhängt. Hinzukommen gesellschaftliche Megatrends und ökonomische Belange, die sich auf die Wohnungsfrage auswirken. Die nachfolgende Grafik führt die verschiedenen Einzelaspekte und Entwicklungslinien zusammen und bietet einen Überblick über die Geschichte des Sozialen Wohnungsbaus. Dass dieses bereits abgeschriebene Modell heute eine Neubetrachtung erfährt, ist eine interessante Entwicklung, die in dieser Form kaum vorherzusehen war. Die Wohnraumfrage M E Kochskämper, A-L Morisse, M Zabel
8 Wohnhäuser in der Hederstraße 6 POLITIK 1848: Die Bürgerrevolution erreichte ihren Höhepunkt. In der Märzrevolution wurde die Verabschiedung einer Verfassung gefordert. Es wurde eine Abgeordnetenversammlung einberufen. Im Mai 1848 fanden in allen deutschen Staaten Wahlen zu deutschen Nationalversammlung statt. 1870/1871: Deutsches Kaiserreich wird gegründet. Mit dem Deutsch Französischen Krieg endete die Zeit des Norddeutschen Bundes und das deutsche Kaiserreich wird gegründet. Im Verlauf machte sich die sozialistisch, kommunistische Arbeiterbewegung stark. 1919: Die Weimarer Verfassung tritt in Kraft. Durch diese wurde das Deutsche Reich zur Republik, repräsentativen parlamentarischen Demokratie und zum Rechtsstaat. Die SPD ging aus den Wahlen zur Nationalversammlung als stärkste Partei hervor. Außerdem wurde 1919 der Friedensvertrag, der Versailler Vertrag, unterschrieben. GESETZE 1848: Bürgerrevolution Durch die Bürgerrevolution wurden eine Presse-und Versammlungsfreiheit liberalisiert. Die Städteordnung von 1853 bestimmte, dass die Hälfte der Stadtverordneten, Hausbesitzer sein mussten. 1867: Die Verfassung führte das allgemeine Wahlrecht für Männer ein wurde auch das 1. Genossenschaftsgesetz verabschiedet, das eine unbegrenzte Haftung vorsah. 1875: Das Fluchtliniengesetz vom regelte die Anordnung von Straßen und Plätzen, um die Ausbreitung von Feuer und Seuchen zu verhindern. 1889: Das Genossenschaftsgesetz wurde zu gunsten der beschränkten Haftung am 1.Mai 1889 verändert. 1890: Das Sozialistengesetz wurde verabschiedet. Die Weimarer Verfassung reformierte das Wahlrecht. Sie legte fest, dass die Abgeordneten nur durch allgemeine und geheimer Wahl von den über zwanzig Jahre alten Männern und Frauen gewählt werden sollten. Somit erhielten auch die Frauen ihr Wahlrecht. Im März wurde das Preußische Wohnungsgesetz erlassen. WIRTSCHAFT Reales jährliches prozentuales Wirtschftswachtum 4% 2% 0% 1750 und 1850 Industrielle Revolution 1850: Es bildete sich mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise in der Industrie ein gemeinsames Wirtschaftsleben innerhalb des deutschen Zollvereins. 1860: In der Zeit des Norddeutschen Bundes entwickelte sich die Wirtschaft sprunghaft. Vor allem Maschinenfabriken und auch der Handel wuchs durch den Ausbau der Eisenbahnlinien. 1880:Die Folgen der rasanten Urbanisierung waren unübersehbar: In den schnell wachsenden Metropolen wurden die ersten Kraftwerke errichtet, Straßenbahnen und Straßenbeleuchtung wurden elektrifiziert, Eisenbahnen transportierten in großer Menge Fisch und Getreide in die Städte, Großmärkte und Kaufhäuser übernahmen die Versorgung mit frischen Lebensmitteln. Die ersten Automobile kündigten eine neue Form von Mobilität an. 1910: Der Versailler Vertrag verpflichtet zu hohen Reparaturzahlungen, die eine Weltwirtschaftskrise bedingte. Zudem musste Deutschland Elsaß Lothringen an die Franzosen abtreten und somit 70 % der gesamten deutschen Erzförderung. Firmen gingen bankrott und somit herrschte am Ende der Weimarer Republik eine hohe Arbeitslosigkeit. WOHNEN Obernstraße Neue Bremer Börse Am Geeren Nr Marktplatz Böttcherstraße Arbeiterwohnungen "Am Syndikushof" Privates Wohnhaus Wohnhäuser in Bremen GENOSSENSCHAFTEN GESELLSCHAFT Land- Stadt- Wanderung Folge Industrialisierung Erste Wohnungsgenosse nschaften Reaktion auf zunehmende Wohnungsnot Anzahl Genossenschaft: 1 1. Wohnungsgenossenschaft "Häuserbau- Genossenschaft zu Hamburg" Genossenschaftsgesetz zentrales Ziel das Förderprinzip im Mittelpunkt des genosssenschaftlich en Handelns - unbegrenzte Haftung :Wilhelm Haas und Friedrich Wilhelm Raiffeisen gelten als Begründer der Genossenschaftsbewegung. Die ersten selbsthilfegestützden Genossenschaften gab es schon vor Hochurbanisierung und der stark dahinter bleibende Bau von preiswerten Kleinwohnungen führte zu einer hohen Wohnraumnot. Um dieser entgegen zu wirken, wurde der Bautypus des dreigliedrigen Berliner Mietshauses entworfen. Aufgestellt wurden die Mietskasernen um einen Hof, in dicht bebauten Quartieren. Zu dieser Zeit gab es 1400 Baugenossenschaften. Erst in der Weimarer Republik wurde die Wohnraumfrage sozial. Auch die Regierung machte es sich zur Aufgabe diese zu lösen. Bis 1928 stieg die Anzahl der Wohnungsbaugenossenschaften auf 4000 Stück. Anzahl Genossenschaft: 3 "Häuderbau- Genossenschaft zu Hamburg" "Flensburger Arbeiter- Bauverein" "Spar- und Bauverein" in Hannover Durch die Industrialisierung ergaben sich Veränderungen in der Bevölkerung. Der soziale Wandel zerstörte Verhaltens- und Denkweisen. Mit dem Begriff der Sozialen Frage wurden Arbeits-, Lebens- und Versorgungansprüche der Menschen diskutiert. Novellierung 1890 Reichsgesetze Einführung einer beschränkten Haftung der Mitglieder Das städtisches Leben bedeutete die Trennung von Wohnen und Arbeiten. Die Auswirkungen des Arbeiterschutzes und der Sozialgesetzgebung führten zu einem Anstieg der Lebensqualität. Die Arbeiterbewegung und der Sozialismus wurden zu zentralen Begriffen. Mit der Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) 1863 nahm dieser Wunsch konkrete Gestalt an. Darauf folgte 1869 die Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP). Anzahl Genossenschaft: 1400 Wohungsraumversorg ung nach Weltkrieg auch durch freie Träger realisiert Neues Bauen - Neues Wohnen sind zwei Schlagwörter dieser Zeit und beziehen sich vor allem auf die neuen Wohnanlagen. In den 1920er- Jahren entstanden neue Siedlungen, die insbesondere Bevölkerungsgruppen mit kleinem Einkommen ein gesundes Wohnumfeld bieten sollten. Ein berühmtes Beispiel findt sich in Berlin, etwa die Hufeisensiedlung im Stadtteil Britz. Quellen Literatur: Die Deutsche Bibliothek, Drei Wege deutscher Sozialstaatlichkeit - NS Diktatur, Bundesrepublik und DDR im Vergleich, Oldenbourg Verlag GmbH, München, Axel Schildt, Wohnungspolitik, 1998; Prof. Dr. Andreas Tönnesmann, Politische Intention und städtebauliche Entwicklung städtischer Wohnungspolitik in der Weimarer Republik dargestellt an den Bespielen Berlin, Frankfurt am Main und Köln, Kunsthistorisches Institut, Universität Bonn, 2000; Prof. Dr. Hans-Joachim Gutjahr, Geschichte - Basiswissen Schule, Paetec Verlag für Bildungsmedien Berlin, Dudenverlag Mannheim, 2003; Schneider, Dieter, Selbsthilfe Staatshilfe Selbstverwaltung - Ein Streifzug durch Theorie und Praxis der Wohnungspolitik, Nassauischen Heimstätte, Frankfurt am Main, 1973 Statistisches Bundesamt (Statist. Jahrbücher ); Wohnungswirtschaftliches Jahrbuch 1975/76 Monatsberichte der deutschen Bundesbank Landeshaushaltsplan Bremen Mitt. des Senats zum Wohnungsbau im Lande Bremen vom (Landtagsdrucksache 10/453). Wolfgang Voigt: Nach der Demontage des sozialen Wohnungsbaus - Drückt sich der Staat um die Nachsubvention? in: ARCH+ 42, 1979, S. 7tt.Telegraf (Berlin) Die Wohnraumfrage M E Kochskämper, A-L Morisse, M Zabel
9 1933: Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, Machtergreifung der NSDAP. 1938: Reichsprogromnacht, Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben 1939: Beginn 2. Weltkrieg 1945: Hitler begeht Selbstmord im Bunker der Reichskanzlei 1949: Ende 2. Weltkrieg Gründung BRD/ DDR 1955: Pariser Verträge / Warschauer Pakt DDR 1963: Adenauer tritt ab Adenauers Politik steht für Westintegration, man kann seine fast auf eine Fromel bringen: Westintegration + Aufrüstung = Sicherheit + Wiedervereinigung 1989: Mauerfall In der Nacht vom zum fiel die Mauer in Berlin. Die Vorbereitung eines kontrollierten Mauerfalls begann bereits im Oktober. 1990: Wiedervereinigung Nach 45 Jahren Teilung geht ein Wunschtraum vieler Ost- und Westbürger in Erfüllung, die deutsche Einheit : Die Regierung Hitler erhält für vier Jahre das Gesetzbefugnis In diesem Jahr werden noch etliche Gesetze erlassen, gegen das Wohl der Bevölkerung 1965: 1.Wohngeldgesetz In den 1960er Jahren hatten steigende Mieten zur Liberalisierung des Wohnungsmarktes geführt. 1973: Gastarbeiterstopp Es wurde ein Anwerber- Stopp für Gastarbeiter beschlossen der formal immernoch in Kraft ist. 2001: Gesetz zur Reform des Wohnungsbaurechts. Dieses Gesetz löste das ll. Wohnungsbaugesetz ab. 2005: Hartz lv Die Hartz lv Reform wird eingeführt und führt die Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammen Börsencrash Dow Jones Index stieg in den Jahren 1920 bis 1926 an. 1926/1927 kam es zum Crash und einem jahrelangen Rückgang auf unter 15 % Kubakrise Die eigentliche Kubakrise dauert 13 Tage an, mit ihr erreicht der Kalte Krieg eine neue Bedeutung. Massenanwerbung südeuropäischer Arbeitskräfte- Der Bedarf an Arbeitskräften ist so groß, dass er durch die einheimische Bevölkerung nicht gedeckt werden kann Ölkrise Die Exportländer verknappen das Öl um die ölkaufenden Länder unter Druck zu setzen Schwarzer Montag Am war der erste Börsenkrach nach dem zweiten Weltkrieg. Alter Postweg Hamburger Straße Neue Vahr Bremer Häuser Vegesack Stephaniviertel Bremer Häuser Scharnhornstr Vionvillestraße : Ehestandsdarlehn Das Wohnungsdefiziet wirkt sich auf die gesamte Wirtschaft aus. 1940: Fortsetzung der Planung Führerstädte Einen Monat vor Kriegsbeginn erfolgt ein befristeter Stop für alle neuen Projekte, im Februar der absolute Baustop für die Dauer des Krieges. DDR 1972: Das staatliche Wohnprogramm Jedem eine eigene Wohnung lautet das ergeizige Programm um die Wohnungsnot bis 1990 zu beseitigen 1982: Neue Heimat Skandal 2009: Novellierung des Wohngeldes Das Wohngeld wurde ab von durschnittlich 90 auf 140 Euro monatlich erhöht. Der Spiegel veröffentlichte am einen Artikel in dem aufgedeckt wurde, dass mehrere Vorstandsmitglieder sich an den Mieten bereichtert hatten. 1988: Abschaffung von Privilegien und Bindungen der Wohnungsgemein-nützigkeit. Anzahl Genossenschaft: Gleichschaltung der nationalsozialistischen Führungsebenen durch nationalsozialistische Personen ersetzt Fusionen Zwangsfusionen von Genossenschafte n Wohnungsbaugesetz 1950 Wohnungen für breite Schicht der Bevölkerung zur Zeit des Wiederaufbaus 1933: Erste Konzentrationslager entstehen. 1940: Einführung des Judensterns im Deutschen Reich. BRD - DDR staatlicher Massenwohnung sbau in der DDR, massenhaften Plattenbau in Neubaugebieten Wohnungsbaugesetz 1973 soziale Wohnungsbau der Bundesrepublik als Lückenschließung von Kriegsbrachen, später aus Neubau auf der Grünen Wiese 1961: Fluchbewegung Flüchtlinge pro Jahr, vor allem Fachkräfte. Länderprogramme zunehmend für private Investoren geöffnet - 80-er Jahre 1968: Studentenbewegung Diese Zeit war von Umbrüchen geprägt, die jungen Leuten strebten nach Idealen über das Materielle hinaus. BRD - DDR Sozialer Wohnungsbau - Ersatzneubau in Stadterneuerungsge bieten durchgeführt - 70-er Jahre Subvent ionen Einführung Eigenheimzulage1996 Sozialer Wohnungsbau durch Fördermittel des Bundes und der Länder abgelöst : Protestbewegung: Fluchtbewegung über Ungarn, im September 1989 wird die Ungarische Grenze geöffnet, gleichzeitig Montagsdemonstration in Leipzig, immer mehr Menschen demonstrieren Novellierung 2006 Abschaffung der Eigenheimzulage durch Missbrauch,, g ( ) Internet: Quelle: Graph Wirtschaftswachstum haus-metallischen-schl-ssel-konzept-von-immobilien.jpg; Die Wohnraumfrage M E Kochskämper, A-L Morisse, M Zabel
10 8 Die Haushaltsfrage Deutschland und Bremen von 1950 bis heute Bremen hatte vor 40 Jahren fast Einwohner mehr als heute. Dennoch fehlen aktuell rund Wohnungen, woran liegt das? Neben der Einwohnerentwicklung spielt die Entwicklung der Haushalte, ihre Größe und ihre Zusammensetzung eine zentrale Rolle. Der Megatrend geht dabei seit mehreren Dekaden zu kleineren Haushalten mit 1-2 Personen. Dies führt als Nebeneffekt zu einem kontinuierlichen Anstieg des Wohnflächenverbrauchs pro Kopf. Die Hintergründe dieser stetigen Teilung von Mehrpersonenhaushalten bilden komplexe ökonomische, gesellschaftliche und demografische Veränderungen wie Binnenmigration durch Arbeitssuchende, Trennung von Lebensgemeinschaften oder die Zunahme von alleinlebenden Senioren im Zuge steigender Lebenserwartungen. In Stadtstaaten wie Bremen bildet sich dieser Trend überproportional ab. Lag die Zahl der Einpersonenhaushalte 2011 im Bundesdurchschnitt bei etwa 40%, waren es in den Stadtstaaten bereits 53 %. Das Projekt zeigt einen Vergleich von Bremen mit dem gesamten Bundesgebiet in Bezug auf Einwohnerentwicklung, Anzahl der Haushalte, Haushaltsgrößen sowie des Wohnflächenverbrauchs und versucht an Hand einer Bildgeschichte die dahinterliegenden gesellschaftlichen Veränderungen begreifbar zu machen. Die Haushaltsfrage P Kubisch, I Tunk, C Wilm
11 Einwohnerentwicklung ,346 Mio. Einwohner ,537 Mio. Einwohner ,844 Mio. Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner Haushaltsgröße Deutschland Bremen 2,25 2,22 2,16 2,11 2,02 2,01 1,98 1,86 1,87 1, xx,x Mio. Anzahl der privaten Haushalte Deutschland Bremen 28,175 Mio. 36,938 Mio. 38,124 Mio. 39,178 Mio. 40,439 Mio. 274,2 Tsd. 276,1 Tsd. 290,0 Tsd. 292,4 Tsd. 301,3 Tsd m² Wohnfläche pro Kopf Deutschland Bremen 34,8m² 36,7m² 39,5m² 41,2m² 43,0m² 35,7m² 37,2m² 39,2m² 39,7m² 40,4m² Die Haushaltsfrage P Kubisch, I Tunk, C Wilm
12 10 Justin und Nicole: Eine Geschichte über die Haushaltsentwicklung Justin und Nicole lernen sich in einer Discothek kennen und verlieben sich ineinander. Justin lebt zusammen mit seinen Eltern. Nicole lebt mit ihrer allein erziehenden Mutter. Personen pro Haushalt: 2,5 Privathaushalte: 2 Justin und Nicole ziehen in eine gemeinsame Wohnung. Nach 14 Monaten trennen sie sich... Personen pro Haushalt: 1,67 Privathaushalte: 3... und ziehen beide in eine eigene Wohnung. Personen pro Haushalt: 1,25 Privathaushalte: 4 Pro Kopf Wohnfläche: 28 qm Pro Kopf Wohnfläche: 38 qm Pro Kopf Wohnfläche: 48 qm Nach 2 Jahren stirbt Justins Vater Quellen Personen pro Haushalt: 1,0 Privathaushalte: 4 Pro Kopf Wohnfläche: 60 qm Die Haushaltsfrage P Kubisch, I Tunk, C Wilm
13 11 Milieuforschung Die Milieuforschung untersucht den Einfluss, den die Umwelt und die Umgebung eines Menschen auf dessen Entwicklung haben. Darunter fallen ethische Normen und Gesetze ebenso wie das wirtschaftliche und politische Umfeld. Auch die soziale Lage des Einzelnen, dessen Lebensziele und Wertorientierungen sind wichtige Faktoren, auf deren Basis eine Milieuzuordnung erfolgen kann. Im Gegensatz zur herkömmlichen Gesellschaftsanalyse, die sich auf ein einziges oder wenige Merkmale, wie zum Beispiel die Schichtzugehörigkeit, fokussiert, zielt die Milieuforschung auf den ganzen Menschen ab. Sie versucht alle Merkmale empirischer Analyse, sowohl die subjektiven als auch die objektiven, zusammenzuführen und so die soziokulturelle Identität des Einzelnen zu klären und in Milieus typisierend zu verdichten. Heute findet das Konzept der sozialen Milieus vor allem in der Wahlforschung oder in der Marktforschung Anwendung, um Wahlverhalten oder Konsumorientierungen einschätzen - und darauf reagieren zu können. Zu diesem Zweck haben sich Einrichtungen, wie das Sinus-Institut, auf jenes Feld spezialisiert und bieten auf den jeweiligen Kunden zugeschnittene Studien an. Auch für Architekten und Städteplaner ist die Milieuforschung ein interessantes Feld, da sie als Planer für den Menschen idealerweise auf dessen Lebensorientierung eingehen. Milieuforschung S Hellbusch, F Just, L Kempf, O Sosnovski
14 12 Die soziale Ungleichheitsforschung Milieuforschung ist die ganzheitliche Erfassung des Alltagslebens. Diese ergibt sich für den Einzelnen aus dem Zusammenspiel der subjektiven Wahrnehmung seines Umfeldes und seinen individuellen Deutungsmustern in tagtäglichen Handlungen, die sowohl durch eine bestimmte Werteorientierung als auch durch eine grundlegende Lebensmaxime gelenkt werden können. Daraus leiten sich Prinzipien der Lebensführung ab, die in der Wissenschaft als Milieus bezeichnet werden. Diese stellen einen Zusammenhang von Einstellungen und Verhaltensweisen her. Neben Bourdieu und der Sinus Milieuforschung gab es bereits im 16. Jahrhundert erste Theorien zur sozialen Ungleichheit. Auch Marx und Weber versuchten die Gesellschaft in Gruppen zu unterteilen und diesen charakteristische Eigenschaften zuzuweisen. Dies geschah allerdings auf rein kapitalistischer Grundlage. Die Milieuforschung, die sich auf dieser Basis entwickelt hat, versucht die vielfältigen Einflüsse auf soziologische Grundfragen und auf die Alltagswelt miteinzubeziehen. GESELLSCHAFT ERFASSUNG DES ALLTAGSLEBENS MILIEUZUGEHÖRIGKEIT Das Klassenmodell von Karl Marx Karl Marx ( ) begründete Mitte des 19. Jahrhunderts die Theorie des Klassenmodells. Die kapitalistische Gesellschaft besteht nach Marx Lehre aus zwei Klassen, die zueinander in einem Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnis stehen. Diese Spaltung der Gesellschaft rührt von einer ungleichen Verteilung des Kapitals her. Der Bourgeoisie, die über Kapital und Produktionsmittel verfügt, steht das Proletariat gegenüber, das zur Sicherung des Lebensunterhalts seine Arbeitskraft einsetzt. Durch die Ausbeutung der Arbeiter wächst das Kapital und damit die ökonomische und gesellschaftliche Macht der Bourgeoisie. Arbeit und Kapital stehen also in einem wechselseitigen Verhältnis, welches zu sozialer, materieller und politischer Unterdrückung führt. Karl Marx beschreibt damit die kapitalistische Gesellschaft zur Zeit des 19. Jahrhunderts. Die nachfolgenden Entwicklungen sind mit seiner Theorie aber nicht mehr zu erklären, da sich eine Mittelklasse herausgebildet hat. Das Klassenmodell von Max Weber Im Unterschied zu Marx ist die Theorie von Max Weber ( ) differenzierter und vielschichtiger. Zur Charakterisierung der Sozialstruktur und MILIEUGESELLSCHAFT Machtverteilung erweitert er das Zwei-Klassenmodell um zusätzliche Klassen und Stände, die er rein ökonomisch betrachtet: Er unterscheidet in Besitz-, Erwerbs- und Sozialklasse, die die Grundlage gemeinschaftlichen Handelns bilden. Die Besitzklasse klärt die Besitzunterschiede und die Klassenlage. Dazu gehören Menschen die ihren Lebensunterhalt ausschließlich durch ihren Besitz erwirtschaften, z.b. durch Vermietung von Häusern, Verpachtung von Boden, etc.. In der Erwerbsklasse wird zwischen den besten Gütern und Leistungen differenziert. Es wird nach Klassen von Handwerkern, Unternehmern, aber auch Bauern und Arbeiter unterschieden. Bei Weber ergibt die Erwerbs- und die Besitzklasse aber noch keine soziale Einheit. Deshalb gibt es eine weitere Unterscheidung, die der sozialen Klasse. Diese beschäftigt sich mit der Gesamtheit der Lebensbedingungen. Dabei ist ein Wechsel des sozialen Standes einer Person und dem ihrer Nachkommen relativ leicht und häufig möglich. Es kommt zur sozialen Mobilität, d.h. der Beruf kann den sozialen Beziehungsraum verändern. Es wird unterschieden in Arbeiterschaft, Kleinbürgertum, Ungebildete und Fachgeschulte. Auf Grund desselben sozialen Standes können charakteristische Gemeinsamkeiten des Denkens und Handelns vorhanden sein. Milieuforschung S Hellbusch, F Just, L Kempf, O Sosnovski
15 Pierre Félix Bourdieu 13 FELD DER WIRTSCHAFT FELD DER KULTUR FELD DER BILDUNG DAS SOZIALE FELD HABITUS HABITUS FELD DER POLITIK FELD DER KUNST KAPITAL KAPITAL EXTERNE PRAXISFORMEN ÖKONOMISCHES KAPITAL SOZIALES KAPITAL KULTURELLES KAPITAL SYMBOLISCHES KAPITAL Der französische Soziologe Pierre Félix Bourdieu ( ) entwickelte aufbauend auf empirischen Studien über das Berbervolk der Kabylen in Algerien eine kultursoziologische Theorie. Er konnte dabei den Einfluss von objektiven, sozial ungleichen Strukturen, wie zum Beispiel Bildung oder familiäre Herkunft, auf subjektive Denk- und Handlungsmuster belegen. Durch die unbewusste Verinnerlichung strukturell vorgegebener Grenzen, entwickelt demnach jede Person einen individuellen Habitus, der klassenspezifisch ist und ihr Handeln beeinflusst. Der Habitus ist sozialstrukturell bedingt, d.h. durch die spezifische Stellung, die ein Akteur - und die soziale Klasse, der man ihn zurechnen kann - innerhalb der Struktur gesellschaftlicher Relationen innehat; er formt sich im Zuge der Verinnerlichung der äußeren gesellschaftlichen [ ] Bedingungen des Daseins. Diese Bedingungen sind, zumindest in modernen, differenzierten Gesellschaften, ungleich, nämlich klassenspezifisch verteilt. (1) Jeder Mensch ist also ein gesellschaftlich geprägter Akteur, der durch die unbewusste Präsenz früherer Erfahrungen seine Umwelt durch einen Filter von Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata sieht. Auf diese Weise entwickelt er Klassifikationsmuster und ethische Normen, die seinen Handlungsspielraum eingrenzen. Dem subjektiven, internen Aspekt des Habitus wird nun das objektive, externe Pendant des sozialen Feldes gegenübergestellt, aus deren Zusammenspiel die externe Praxis resultiert. Die Gesellschaft setzt sich nach Bourdieu aus zahlreichen, differenzierten Feldern (z.b. Politik, Wirtschaft, Militär oder Kunst) zusammen, in denen Akteure um Kapital und die feldspezifischen Regeln streiten. Das soziale Feld ist einem permanenten Wandel ausgesetzt, da sich die Akteure in einem ständigen Kampf um die Definitionsmacht des Feldes befinden. Die Verfügungsgewalt über das vorherrschende Kapital, welches vom jeweiligen Feld vorgeschrieben wird, entscheidet über die Handlungs- und Profitchancen des Einzelnen. Man unterscheidet vier Kapitalsorten: das ökonomische Kapital, das kulturelle Kapital, das soziale Kapital und das symbolische Kapital. Materieller Reichtum ist mit dem ökonomischen Kapital gleichzustellen. Das kulturelle Kapital kann drei verschiedene Formen haben. In objektiviertem Zustand können es zum Beispiel Bücher oder Gemälde sein, in inkorporiertem Zustand können es kulturelle Fähigkeiten sein, wie zum Beispiel das Beherrschen eines Instruments und in institutionalisierter Form kann es beispielsweise ein Bildungstitel sein. Das soziale Kapital spiegelt sich in Beziehungen zu anderen Akteuren oder in der Zugehörigkeit zu einer Gruppe wieder. Anerkennung, Ansehen oder Prestige wird als symbolisches Kapital bezeichnet. Es spielt eine übergeordnete Rolle: Soziales Kapital und institutionalisiertes kulturelles Kapital können immer auch als symbolisches Kapital gesehen werden, da sie von der Anerkennung einer anderen Person abhängig sind. Milieuforschung S Hellbusch, F Just, L Kempf, O Sosnovski
16 14 Milieuforschung des Sinus Instituts Sinus-Milieus sind das Ergebnis von über 30 Jahren sozialwissenschaftlicher Forschung des Instituts Sinus Sociovision. Mit den Sinus-Milieus werden Menschen, die sich in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise ähneln, gruppiert. Grundlegende Wertorientierungen gehen dabei ebenso in die Analyse ein, wie Alltagseinstellungen zu Arbeit, Familie, Freizeit, Geld und Konsum. Für die Bestimmung der Gruppen unternimmt das Institut zweimal jährlich eine Lebensweltanalyse unserer Gesellschaft. In dem jeweils 3-5 monatigen Untersuchungszeitraum werden mehr als Personen ab dem Alter von 14 Jahren befragt. Die Methodik ist dabei ein persönliches, mündliches Interview. Sinus Milieus werden heute in der Marktforschung eingesetzt und von führenden Markenartikelhersteller für die Optimierung ihrer Produkte verwendet. Sinus-Milieus 2013 Die aktuellen Sinus-Milieus umfassen zehn soziale Gruppen, die auf einem Koordinatensystem angeordnet sind. Die x-achse bildet dabei die Werteachse und ordnet die Milieus hinsichtlich ihrer Wertvorstellungen. Je weiter links ein Milieu angesiedelt ist, desto traditioneller ist dessen Grundorientierung. Die y-achse gibt Auskunft über den Status von Bildung und Einkommen einer Milieugruppe. Je weiter unten ein Milieu angesiedelt ist, desto schlechter ist dessen soziale Lage. Die Grenzen zwischen den Milieus sind fließend. Sinus-Milieus in Bremen Folgt die Definition von Milieus einer rein abstrakten, soziologischen Betrachtungsweise oder lassen sich Milieus auch räumlich kartieren? Basierend auf dieser Frage wurde der Versuch unternommen die Sinus-Milieus 2013 auf Bremen zu übertragen und jedem Stadtteil ein vorherrschendes Basis-Milieu zuzuordnen. Die Darstellungsweise orientiert sich an der Kartoffel-Grafik des Sinus Institutes, ist allerdings nicht auf deren Achsen zurückführbar und bietet daher keinen Rückschluss auf soziale Lage oder individuelle Lebensmaxime. Als Grundlage für die Einordnung der Stadtteile diente eine Studie des GEWOS-Instituts von 2009, in der die Regional- und Stadtentwicklung Bremens im Hinblick auf verschiedene Faktoren wie Einkommen, Mietpreisspiegel, Wohnstiltypen und Haushaltsstruktur untersuchte wurde. Besonders bedeutsam war die Definition von zehn Wohnstiltypen, die den Bremer Wohnungsmarkt prägen sowie deren Nachfrageverhalten in Bezug auf Wohnlage und Wohnformen. In der Studie wurde u.a. nach folgenden Wohnstilgruppen differenziert: Preissensible Mieter, Pragmatische Eigentumsbilder, Junge Urbane, Qualitätsbewusste Eigentumsbilder, die Alternativen, mobile Best Ager oder anspruchsvolle Urbane. Darüber hinaus wurden verschiedene Statistiken über soziale und ökonomische Verhältnisse in den Bremer Stadtteilen berücksichtigt. Durch die Überlagerung aller Komponenten war es möglich, den verschiedenen Stadtteilen ein Basis-Milieu zuzuordnen. Die Grafik basiert demnach auf einer freien Interpretation von lokalen Stadtteil-Statistiken sowie der o.g. GEWOS-Studie. In ihrer radikalen Vereinfachung möchte sie provozieren und zum Nachdenken über die örtliche Verteilung von Milieus in Bremen anregen. Die Grenzen zwischen den Milieus sind fließend, daher kommt es zu Überschneidungsbereichen. OBERSCHICHT 10% 7% 7% 6% 7% 9% MITTELSCHICHT 15% 14% 15%? 9% UNTERSCHICHT TRADITIONELL INDIVIDUALISIERT NEUORIENTIERT Milieuforschung S Hellbusch, F Just, L Kempf, O Sosnovski
17 15 BLUMENTHAL? VEGESACK BURGLESUM BLOCKLAND HÄFEN SEEHAUSEN STROM Bürgerliche Mitte: Leistungs- und anpassungsbereiter Mainstream, bejaht die gesellschaftliche Ordnung, strebt nach beruflicher und sozialer Etablierung sowie nach Sicherheit und Harmonie. Sozialökologisches Milieu: Idealistisch, konsumkritisch, globalisierungsskeptisch, besitzt ausgeprägtes ökologisches und soziales Gewissen. GRÖPELINGEN WALLE FINNDORF HORN-LEHE SCHWACH- WOLTMERS- HAUSEN HAUSEN MITTE ÖSTL.? VORSTADT HUCHTING NEUSTADT?? OBERVIERLAND VAHR BÜRGERLICHE MITTE BORGFELD OBERNEULAND HEMELINGEN OSTERHOLZ SOZIALÖKOLOGISCHES MILIEU? EXPEDITIVES MILIEU BÜRGERLICHE MITTE HEDONISTISCHES MILIEU SOZIALÖKOLOGISCHES MILIEU ADAPTIV - PRAGMATISCHES MILIEU EXPEDITIVES MILIEU BÜRGERLICHE MITTE KONSERVATIV - ETABLIERTES MILIEU HEDONISTISCHES MILIEU SOZIALÖKOLOGISCHES MILIEU PREKÄRES MILIEU ADAPTIV - PRAGMATISCHES MILIEU EXPEDITIVES MILIEU TRADITIONELLES MILIEU KONSERVATIV Traditionelles - ETABLIERTES Milieu: Ordnungsliebende MILIEU HEDONISTISCHES MILIEU Kriegs- LIBERAL und Nachkriegsgeneration, - INTELLEKTUELLES MILIEU kleinbürgerlich oder? PREKÄRES MILIEU der ADAPTIV Arbeiterwelt - PRAGMATISCHES verhaftet. MILIEU MILIEU TRADITIONELLES DER PERFORMER MILIEU KONSERVATIV - ETABLIERTES MILIEU LIBERAL Liberal-Intellektuelles - INTELLEKTUELLES Milieu: MILIEU? PREKÄRES MILIEU Aufgeklärte Bildungselite MILIEU DER mit PERFORMER liberaler Grundhaltung und postmateriellen Wurzeln, hat starken Wunsch nach TRADITIONELLES MILIEU Selbstbestimmung. LIBERAL - INTELLEKTUELLES MILIEU Expeditives Milieu: Unkonventionelle, kreative Avantgarde, individualistisch, sehr mobil, digital vernetzt, sucht nach Grenzen.Gewissen. MILIEU Milieu DER der PERFORMER Performer: Effizienz-orientierte Leistungselite, denkt global, hohe IT-Kompetenz, sieht sich als stilistische Avantgarde. Hedonistisches Milieu: Spaß- und erlebnisorientiert, verweigert sich den Konventionen und Leistungserwartungen der Gesellschaft. Adaptiv-pragmatisches Milieu: Zielstrebige, junge Mitte der Gesellschaft mit ausgeprägtem Lebenspragmatismus und Nutzenkalkül. Konservativ-etabliertes Milieu: Klassisches Establishment mit Exklusivitäts- und Führungsanspruch, zeigt aber auch Tendenz zum Rückzug.? Prekäres Milieu: Um Teilhabe bemühte Unterschicht, Zukunftsangst und Ressentiments. Quellen Fußnoten 1) Schwingel, Markus (2003): Pierre Bourdieu zur Einführung, Aufl. 4, Junius Verlag GmbH, S. 60 Literaturverzeichnis Schwingel, Markus (2003): Pierre Bourdieu zur Einführung, Aufl. 4, Junius Verlag GmbH GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH (2009): Leitbildprozess Bremen - Wohnbaukomponente, Hamburg URL: ( ) URL: ( ) URL: habitus.htm ( ) URL: ( ) URL: ( ) URL: ( ) URL: ( ) URL: jpg ( ) Milieuforschung S Hellbusch, F Just, L Kempf, O Sosnovski
18 16? Lebensstilgruppen Entwicklung und Forschung von Lebensstilgruppen 1922 verwendet Max Weber erstmals den Begriff der Lebensführung unter dem er charakteristische Merkmale eines Standes versammelt. Der heute diskutierte Begriff der Lebensstile basiert darauf und ist der Versuch, soziostrukturelle Kategorien zu definieren, mit denen die erwachsene Bevölkerung in charakteristische Gruppen eingeteilt werden kann. Auslöser für diesen Entwicklungsprozess von der Ständegesellschaft über die Klassengesellschaft bis zu den heutigen Lebensstilgruppen waren vor allem die allgemeine Erhöhung des Bildungsniveaus und - des materiellen Wohlstands sowie die Auflösung industrialisierter Berufsstrukturen und Arbeitsprozesse in der Nachkriegszeit. Die Möglichkeit zur individuellen Wahlfreiheit bezüglich der eigenen Lebensgestaltung weitete sich auf fast alle Gesellschaftsschichten aus. Die neuere Sozialforschung geht deshalb davon aus, dass sich die heutige Gesellschaft nicht mehr in Form von unterschiedlichen Einkommens- und berufsspezifischen Gesellschaftsklassen wie Arbeiter, Unternehmer, Beamte oder Unter-, Mittel- und Oberschicht beschreiben lässt. Denn, diese haben sich seit den 1970er-Jahren in eine Vielzahl von Lebensstil- oder Milieugruppen aufgespaltet: Die zehn dargestellten Lebensstile stehen stellvertretend für das Prinzip, die gesamte Gesellschaft in möglichst wenige, charakteristische Gruppen einzuteilen, die intern möglichst homogen sind, sich aber von den anderen Gruppen möglichst deutlich unterscheiden. Ein Rückblick vom Mittelalter bis zur Gegenwart veranschaulicht diese Entwicklung. So wird der Unterschied zwischen den damaligen Sozialstrukturen und den heutigen Lebensstilgruppen erkennbar. Lebensstilgruppen I Carrera, E Sauramo
19 Die Entstehung der Lebensstilforschung Inspiriert durch Soziologen des frühen 20. Jahrhunderts wie P. Bourdieu, schlugen Forscher wie H.-P. Müller, H.Lüdtke, A.Spellerberg oder G.Schulze in den 1980er Jahren vor, die Sozialstrukturanalyse als Lebensstilforschung zu entfalten. Es sollte ein gewisser Determinismus in der Sozialforschung vermieden werden und die Gesellschaftsmitglieder sollten als Konstrukteure der Gesellschaftsordnung betrachtet werden. Auch der Begriff Milieu gewann im Zusammenhang mit der Lebensstilforschung an Bedeutung. P.Bourdieu war der Meinung, dass der Raum sowohl als Produkt als auch Bedingung menschlichen Handelns zu betrachten ist und somit eine große Rolle in der Entwicklung des Individuums und dessen Lebensstil spielt. Seit dem hat sich die Gesellschaft in eine Vielzahl von Lebensstil- oder Milieugruppen aufgespaltet. Auslöser für diesen Entwicklungsprozess von Ständegesellschaft über Klassengesellschaft zu Lebensstilgruppen waren vor allem die allgemeine Erhöhung des Bildungsniveaus und des materiellen Wohlstands sowie die Auflösung industrialisierter Berufsstrukturen und Arbeitsprozesse in der Nachkriegszeit. Die Möglichkeit zur individuellen Wahlfreiheit bezüglich der eigenen Lebensgestaltung weitete sich auf fast alle Gesellschaftsschichten aus. Das Individuum kann nun eher einen Lebensstil wählen, zumindest in den mittleren und oberen sozialen Lagen, oder bleibt in einem bestimmten sozialen Milieu haften, beispielsweise in den unteren und untersten sozialen Lagen. Die neuen Sozialgruppen Die beiden Zitate der Soziologen Hradil und Müller schildern im groben Umfang, was unter Lebensstil gemeint ist. Hradil sagt: Der Begriff Lebensstil impliziert ein bestimmtes Maß an Wahl- und Gestaltungsfreiheit der eigenen Lebensweise. (1996). Laut Müller sind Lebensstile: Raum-zeitlich strukturierte Muster der Lebensführung, die von materiellen und kulturellen Ressourcen, der Familien- und Haushaltsform und Wertehaltung abhängen. (1992). Es gibt noch zahlreiche andere Soziologen, die sich mit dem Thema befasst haben. Diese haben jeweils verschiedene Kriterien und Anhaltspunkte anhand dessen sie einen Lebensstil bzw. eine Lebensstilgruppe festlegen. Man spricht auch von Bildung verschiedener Lebensstilgruppen durch die Clusteranalyse. Also das Zusammenfassen mehrerer Personen zu möglichst wenigen Gruppen, die intern möglichst ähnlich und gegeneinander möglichst unterschiedlich sind. Die Gründe für unterschiede oder Innovationen bei den diversen empirischen Lebensstilstudien sind unter anderem die Art 17 und Anzahl der gemessenen sozialen Merkmale, die Clusteranzahl (Lebensstilgruppenanzahl), der forschungstechnische Ansatz und die statistischen Merkmale, raumstrukturell bedingte Unterschiede oder die theoretische Voreingenommenheit der Forscher. Charakteristisch für die neuen Sozialgruppen ist, dass individuelle Werthaltungen, Geschmacksrichtung, Freizeitgestaltung und Verhaltensmuster zusätzlich zur sozialen Schichtzugehörigkeit zu mitbestimmenden oder sogar manchmal zu den dominanten Faktoren werden. Es heißt allerdings noch lange nicht, dass sich alle Soziologen und Forscher einig sind über die Lebensstilforschung als neues Paradigma der Sozialstrukturanalyse. So betont zum Beispiel R.Geißler, dass in der Lebensstilanalyse von Lüdtke oder Schulze die kontinuierliche Relevanz der klassischen Variablen, insbesondere des Bildungsniveaus und des Alters, eine weiterhin zu prägnante Rolle spielen würden. Diese Debatte ist bis heute unter den Fachleuten nicht beendet. Lebensstile 2012 Das frühere industrielle Biographiemodell ist in drei Abschnitte zu differenzieren: Kindheit, Erwerbsoder Famielienarbeit und Ruhestand. Das Aktuelle Biographiemodell ist viel kleinteiliger. Es besteht aus einer zeitlich viel kürzeren Fragmentierung. Kindheit, Jugend, Postadolesenz, Bildung, Beruf, Bildung, Beruf, Familie, Beruf, Ruhestand, Weisheit. Mit Hilfe dieser Erkenntnis können neue Megatrends und Lebensstilgruppen entwickelt und erforscht werden. Quellen Literaturverzeichnis van Dülmen,Richard, (2001): Entdeckung des Ich. Die Geschichte der Individualisierung vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Böhlau, Köln/Weimar/Wien Hilpert, Markus/Steinbühl, David (1998): Lebensstile in der Stadt, Eine empirische Studie am Beispiel Augsbutg; Mering: Rainer Hampp Verlag, München Bourdieu, Pierre (1997): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraftl, 9.Auflage, Suhrkamp, Frankfurt am Main Hradil, Stefan (1996): Sozialstruktur und Kultur. Fragen und Antworten zu einem schwierigen Verhältnis.Opladen: Leske + Budrich Spellerberg, Annette (1996): Soziale Differenzierung durch Lebensstile: eine empirische Untersuchung zur Lebensqualität in West- und Ostdeutschland,Ed. Müller, H.-P. (1992): Sozialstruktur und Lebensstile, Der neuere theorethische Diskurs über soziale Ungleichheit.Frankfurt am Main Zweite_Moderne-Homepage_Kompatibilitaetsmodus.pdf Wahrnehmung+sozialen+Wandels+im+Denken+des+Mittelalters+und+das+Pro blem+ihrer+deutung.&source=bl&ots=fx6kzcvpx_&sig=jzkpe5jskv60a3mud ma2cfjm_v8&hl=de&sa=x&ei=o0-auj_dl9hnswben4hqcw&ved=0cciq6a EwAA#v=onepage&q=Die%20Wahrnehmung Jetzkowitz.pdf Lebensstilgruppen I Carrera, E Sauramo
20 18 GRAFISCHE ERGÄNZUNG DER HISTORIE Die Folgenden Erläuterungen und Zitate können als kleine Meilensteine in der Lebensstilforschung verstanden werden. Sie versuchen die Kernaussage der Epochen oder der jeweiligen Soziologen wieder zu geben Jh mittelalter agrargesellschaft soziale frage industrialisierung im mittelalter gab es eine klare trennung der gesellschaft. die so genannte ständegesellschaft Bestehend aus adel, klerus & Bauern. charakteristisch für diese epoche war die klare soziale rangordnung zwischen dienenden und herrschenden. die idee einer sozialen ungleichheit existierte nicht, da die zugehörigkeit zu einer gewissen kategorie von geburt an so dahingenommen wurde. die menschen LeBen hier oft in grossfamilien. freizeit und arbeitszeit verschmelzen oft. das zusammenleben ist häufig von einer gemeinsamen religion, veralteten sitten, Bräuchen, traditionen und gewohnheiten geprägt. die entdeckung und entwick- Lung des ich steht nicht im vordergrund. viel wichtiger ist die zugehörigkeit zu einer gemeinde. der Begriff soziale frage Bezeichnet die sozialen missstände, die mit der industriellen revolution einhergingen, das heisst die sozialen BegLeit- und folgeprobleme des übergangs von der agrar- zur sich urbanisierenden industriegesellschaft. durch die industrialisierung im 19. Jh. verändert sich die gesellschaftliche trennung nach adel, klerus und Bauern und es entsteht eine kapita- Listische gesellschaft auch als klassengesellschaft Bekannt. entscheidend für die einordnung in oberschicht, mittelschicht oder unterschicht ist die stellung im produktionsprozess.begleitet von zahlreichen protest- Bewegungen der arbeitergesellschaft anfang des 20. Jh. entstand der versuch des einzelnen durch LeBensstiL eine identität zu finden. karl marx Je weniger du Bist, Je weniger du dein LeBen äusserst, um so mehr hast du, um so grösser ist dein entäussertes LeBen schulze Bourdieu max weber f.tönnies Le play die existenz alltagsästhetischer schemata Liesse sich durch ein einfaches experiment nachweisen, Bei welchem den versuchspersonen die aufgabe gestellt wird, weit verbreitete angebote unseres erlebnismarktes zu zusammengehörigen gruppen zu sortieren. nehmen wir etwa das folgende ensemble von erlebnisangeboten: ein klavierkonzert von mozart, ein unterhaltungsabend mit den oberkrainern, eine ausstellung von Josef Beuys und ein arztroman aus dem Bastei verlag. was passt wozu? der soziale raum ist so konstruiert, dass die verteilung der akteure oder gruppen in ihm der position entspricht, die sich aus ihrer statistischen verteilung nach zwei unterscheidungsprinzipien ergibt, (...), nämlich das ökonomische kapital und das kulturelle kapital. eine empiristische wissenschaft vermag niemanden zu Lehren, was er soll, sondern nur was er kann und unter umständen was er will. gemeinschaft Beruht darauf, dass die individuen aus ihrem eigenen willen heraus BestandteiL dieser sind und sie als selbstzweck auffassen. sie wird von gefühlsmässigen und innigen sozialen Beziehungen gekennzeichnet. gesellschaft Beruht mehr als gemeinschaft auf einem zweck-mittel-denken, die menschen schliessen sich des eigenen vorteils wegen zusammen. noch weniger glücklich sind die statistiker Bei solchen untersuchungen gewesen, ( ) sie rechnen weder mit der Besonderen natur des individuums, noch mit dem milieu, in dem es LeBt; ( ) die methode der statistiker ist nicht die der BeoBachtung direkter tatsachen geissler spellerberg hilpert de haan hradil welche LeBenschancen menschen haben, wächst ihnen nicht aufgrund ihrer eigenen wahl zu, sondern aufgrund gesellschaftlicher strukturen. Letztere sind fraglos vielfältiger geworden, aufgelöst haben sie sich aber nicht. zum einen wird der zusammenhang zwischen LeBenssti- Len, sozialer schichtung und LeBensquaLität in west- und ostdeutschland untersucht. es stellt sich die frage, in wie weit das gefüge von LeBensstiLgruppen ausdruck von klassenverhältnissen oder aber von individualisierungsvorgängen sind. der schwerpunkt Liegt Bei der verknüpfung mehrerer geistes- und naturwissenschaften, wie die soziologie, sozialgeographie oder die humanistische geographie um einen möglichst interdisziplinären Befund zu erreichen. typologien sind komplexitätsreduzierend und hand- Lungsreduzierend. ein LeBensstiL ist [...] der regelmässig wiederkehrende gesamtzusammenhang der verhaltensweisen, interaktionen, meinungen, wissensbestände und Bewertenden einstellungen eines menschen Lebensstilgruppen I Carrera, E Sauramo
21 GRAFISCHE ERGÄNZUNG DER LEBENSSTILGRUPPEN: 19 Im Hinblick auf die Ergebnisse der Untersuchung der Lebensstilgruppen sind verschiedene Faktoren zusammengefasst worden, die zehn unterschiedliche Lebensstile grafisch darstellen können. Auf den folgenden Seiten werden verschiedene Themengebiete dargestellt wie etwa die Wohnsituation, der finanzielle Hintergrund, das soziale Verhalten oder die Mobilitätsformen. Wohnsituation Finanzieller Hintergrund Soziales Verhalten Freizeitinteressen Mobilitätsformen Konsumverhalten EMPTY NESTER (Soziologischer Begriff) Die Lebensstilgruppe der Empty Nester zeichnet sich damit aus, dass sie eine Menge an Zeit und Geld haben, nach dem der Nachwuchs aus dem Haus gegangen ist. Sie reisen gerne, gönnen sich den einen oder anderen Luxus und organisieren ihr Leben neu. Oft kommt es dazu, dass sie Renovierungsarbeiten im Haus tätigen, da der leerstehende Platz des Kindes nun als Atelier oder Gästezimmer genutzt werden kann. LOVOS (Lifestyles Of Voluntary Simplicity, Soziologischer Begriff) Diese Lebensstilgruppe fordert ein starkes Durchhaltevermögen. Sie verzichten auf jegliche Konsumgüter, Transportmittel und Luxusgüter. Sie leben vom Minimum und im Einklang mit der Natur. Es sind gebildete und auch ungebildete Menschen, die für ihren Lebensstil leben aber dadurch auch finanziell schwach sind. Lebensstilgruppen I Carrera, E Sauramo
22 20 SILKS (Single Income Lots of Kids, Soziologischer Begriff) Diese Lebensstilgruppe steht im Schatten der Gesellschaft, da sie meist Sozialfälle sind. Sie gehören zu einer schwächeren sozialen Schicht und sind finanziell schwach. Man redet hier vielleicht nicht von einem Lebensstil sondern von einer Lebenssituation. Durch die schlechte finanzielle Lage und die Vielzahl an Kindern verzichtet diese Lebensstilgruppe auf Vieles und muss ständig sparen. LOHAS (Lifestyles Of Health and Sustainability, Soziologischer Begriff) Bestehen auf ein gesundes Leben. Bewusster Konsum und gesunde Ernährung sind wesentliche Anlehnungen dieser Lebensstilgruppe. Sport, wie Yoga oder Meditation gehören zu deren täglichen Aktivitäten. Es sind meist gebildete Menschen mit einem starken, finanziellen Hintergrund. YUPPIES (Young Urban Professional, Gesellschaftlicher Begriff) So wie die Beschreibung es schon sagt: Junge profesionelle Menschen, die Erfolg im Leben haben, finanziellen Überschuss verfügen und im Luxus leben. Es sind gebildete Menschen, die Karriere anstreben und im Jet Set leben. Geld spielt in dieser Lebensstilgruppe keine Rolle. Sie konsumieren ohne es bewusst wahrzunehmen. MODS (Modernists, Gesellschaftlicher Begriff / Subkultur) Sie sind ende der 1970er anfang der 1980er in England entstanden. Sie stammen aus der Arbeiterklasse und zeichnen sich durch ihr schlichtes Kleiden und durch ihr exzessives Leben aus. In der Gruppe fuehlen sie sich stark und sind in sogenannten Vespa-Gangs unterwegs. Heute sind sie weltweit verbreitet. Lebensstilgruppen I Carrera, E Sauramo
23 21 PUNKS (Gesellschaftlicher Begriff) Eine Randgruppe, die auf Konsum verzichtet. Es ist die Lebensstilgruppe, die gegen die heutige Gesellschaft steht. Grundsätzlich stehen sie obdachlos da, fühlen sich aber in der Gruppe stark. Sie vereint die gleichnamige Musikrichtung: PUNK. Es sind Menschen die keine Perspektive vom Leben erwarten. Sie befinden sich in einer sehr schlechten finanziellen Lage. BEST AGER (Soziologischer Begriff) Es ist die am häufigsten vorkommende Lebensstilgruppe in unserer Gesellschaft. Sie sind Rentner, die ihr Leben in vollen Zügen genießen wollen. Nach einer langjährigen Arbeitskarriere gönnen sie sich viele Reisen, eine gemütliche Unterkunft und ein bequemes Transportmittel. Sie verfügen über einen finanziellen Rückhalt, der durch die Jahre angespart wurde. KARRIERISTINNEN (Soziologischer Begriff) Es sind ausschließlich Frauen, die sich der Gesellschaft beweisen wollen. Sie streben nach Bildung, Erfolg und Reichtum. Privat stehen sie alleine da. Sie stellen die Karriere vor dem privaten Leben. HIPSTER (Gesellschaftlicher Begriff) Mehr als eine Lebensstilgruppe sind Hipster ein Trend. Es sind junge Menschen, die sich vor allem mit ihrem Äusserlichen hervorheben wollen. Sie versuchen sich auf eine besondere Weise modebewusst zu kleiden und durch einen speziellen musikalischen Geschmack dieses zu unterstreichen. Eine Ideologie steckt nicht hinter dem Hipstertum. Aber ein starker finanzieller Hintergrund von Seiten der Eltern, die diese Modegruppe finanziert. Lebensstilgruppen I Carrera, E Sauramo
24 22 Vom Leben in Bremen Eine Stadt ist ein komplexes und widersprüchliches System aus sozialen,ökonomischen und ökologischen Komponenten. Aber alle brauchen ein Dach über dem Kopf, zum Wohnen. Diese urbane Hardware aus unterschiedlichen Häusern und Siedungstypen bildet das Fundament der Gemeinschaft und auchdieser komplexen Kartierung vom Leben in Bremen: Die Stadt ist dargestellt alsteppich aus vielen kleinen und unterschiedlichen Haustypen, so, wie man sie inden Quartieren und Nachbarschaften vorfindet. In einem zweiten Schritt wurdenfür die Stadtteile wichtige Sozialdaten zusammengetragen, wie demografische Zusammensetzung, Bildungsniveau, Einkommensdurchschnitt sowie der Wohnraumverbrauch pro Kopf. Jetzt sieht man, dass in zum Teil gleichartigen Häusern komplett andere Milieus und sozialräumliche Zusammenhänge vorherrschen. Diese Erkenntnis hat sich das GEWOS-Institut zu eigen gemacht und konnte 2009 nach einer Umfrage unter Haushalten zehn Wohnstilgruppen identifizieren, die den Bremer Wohnungsmarkt mit einem charakteristischen Nachfrageverhalten bestimmen: Von den Anspruchsvollen Urbanen über pragmatische Eigentumsbildner und mobilen Best Agern bis hin zu den preissensiblen Mietern, für die gerade viel Wohnraum fehlt. Diese Ebene zeigt, wer gerne wo wohnen möchte, und auch, wer dann in Zukunft wen verdrängen könnte, selbst wenn dies nicht mit Absicht geschieht. Diese einfache und doch komplexe Karte sagt viel vom Leben in Bremen, und so eignet sie sich gut als Fundament für die Diskussion darüber, für wen und wo in Bremen Wohnungen gebaut werden sollen. Vom Leben in Bremen S Meier, H Schoefer, C Freese, S Frederichs, I Rustemeyer
25 23 Wohntypologie Diese Typologie gibt Aufschluss über die vorherrschende Bebauungsart eines Stadt- bzw. Ortsteils. Es gibt die geschlossene Wohnungs-bauweise, welche man am häufigsten im Stadtkern oder seiner unmittelbaren Nähe findet. Diese wird in vielen Städten als Blockrandbebauung ausgeführt, die einen starken urbanen Charakter aufweist und ist als exzellentes Beispiel in Barcelona zu finden. Die offene Wohnungsbauweise ist in mittlerer bis weiter Entfernung zum Stadtkern angesiedelt und bildet klar definierte Wohnviertel mit Geschosswohnungsbau. Ein gutes Beispiel dafür ist die Bremer Vahr. Ein außerordentlich wichtiger Identi-fikationsfaktor für die Stadt Bremen ist das Bremer Haus, das durch seine Reihenhaustypologie sehr große Auswirkungen auf die Erscheinung eines Stadtteils hat. Sei es das kleine Arbeiterhaus, vorherrschend in Bremen-Gröpelingen zu finden, oder das herrschaftliche Einfamilienhaus für die damaligen Bremer Kaufleute der Mittelschicht zum Beispiel in der Östlichen Vorstadt. Das Reihenhaus findet sich vermehrt in Bremen Nord weißt jedoch keine architekto-nischen Merkmale wie das Bremer Haus auf. Einzelhausbebauung findet man in den Randbereichen Bremens häufig wieder, aber auch nahe am Zentrum in Form von Schrebergärten. Der letzte Typ ist die Industrie- und Gewerbebebauung, die Aufschluss über eine Mischform von wohnen und arbeiten oder aber eine klare Trennung gibt. Das Mercedeswerk oder der Hafen bilden in diesem Fall klar separierte Stadtteile. Historie Die Geschichte Bremens war und ist entscheidend für die Entwicklung des kleinsten Bundesland Deutschlands. Seit dem Mittelalter hat Bremen durch seinen kaufmännischen, hanseatischen Schwerpunkt und die damit verbundene Machtposition, die Möglichkeit genutzt, sich selbstständig zu verwalten. Diese Eigenständigkeit führte zu vielen charakteristischen Entscheidungen die noch heute das Stadtbild prägen. So befand sich die frühere Hafen- und Werftindustrie sehr zentral in der Stadt, die noch heute Bremen- Gröpelingen prägt. Und auch politisch ist durch die vorstehende Stellung des Bremer Rathauses auf dem Marktplatz, und der scheinbar zurücktretende Bremer Dom, deutlich, wie wichtig der Senat für Bremen ist. Religion Durch die wichtige Position des politischen und wirtschaftlichen Handelns in Bremen nimmt die Religion in der Freien Hansestadt eine vergleichsweise untergeordnete Rolle ein. Vor dem Hintergrund einer fast 200 Jahre zurückreichenden Vom Leben in Bremen S Meier, H Schoefer, C Freese, S Frederichs, I Rustemeyer
26 Entwicklung ist der Religionsunterricht in 24 den öffentlichen Schulen ausschließlich Angelegenheit des Staates. Bis heute führt dieser Unterricht den historisch Namen Biblische Geschichte, ab 10. Jahrgang heißt das Fach Religionskunde. Dieser Religions-unterricht in Bremen ist bekenntnismäßig nicht gebunden und wird auf allgemein christlicher Grundlage erteilt. Weder ist die Trias des gleichen Bekenntnisses von Lehrern, Schülern und Unterrichtsinhalt erforderlich, noch wird eine Zugehörigkeit der Lehrkräfte zu einer christlichen Kirche vorausgesetzt. Trotz allem wurden sämtliche Einrichtung der größten Weltreligion verortet um Zeitgeschichtliche aber auch aktuelle Entwicklungen einsehen zu können. Bildungsniveau Dieser Indikator ist wohl einer der wichtigsten, welcher uns Aufschluss über eine gesellschaftliche Positionierung gibt. Noch immer nimmt das Bildungsniveau der Elterngeneration und der finanzielle Rückhalt großen Einfluss auf den möglichen Bildungsstand eines Bürgers ein. Zudem erhält der Migrationshintergrund eine stärker werdende Gewichtung. Finanzielle Situation Der Klassiker unter den Sozialindikatoren spiegelt das Einkommen des Bürgers wieder. Dieses Einkommen gibt jedoch oft nicht Aufschluss über die Qualität, Zeitaufwand und Bildungsniveau, die mit Ausführung der Arbeit und den damit erbrachten Erwerb verbunden sind. Zudem ist es schwer, klare Zusammenhänge auf-zuzeigen. Daher ist es wahrscheinlich, dass in jedem Stadtteil bessere, sowie schlechtere Situationen vorzufinden sind. Demografie Die Demografie gibt Aufschluss über die Altersstruktur eines Stadtteiles. Auch die sie lässt Zusammenhänge erkennen, die in späteren Fallbeispielen genauer erläutert werden. Wohnfläche pro Person Wohntypologie, Bildungsniveau sowie das zur Verfügung stehende Budget finden oft Ausdruck in der Größe der Wohnung, beziehungsweise in der Wahl des Autos, welches wir hier jedoch nicht weiter beleuchten. Da sich der Bürger gerne über diese Statussymbole definiert, findet man in Ober-neuland so gut wie keine kleinen Wohnungen mit niedriger Miete, sondern eher große Wohn-fläche für sehr viel Geld. Obwohl eine ungefähre gesellschaftliche Klassifizierung an Bremer Stadtteilen möglich ist, so weist Bremen in den meisten Stadtteilen eine sehr homogene gesellschaftliche Mischung auf. Ausländeranteil Bremen hat nach Berlin und Hamburg mit 12,46% den dritthöchsten Ausländeranteil in der Bundesrepublik Deutschland. Dieser Wert steht in Relation zu der Gesamtpopulation von Bremen und Bremerhaven, welche in dieser Analyse jedoch nicht mit einbezogen wurde. Daher ist auch dieser Indikator nicht zu überbewerten. Jedoch hat Bremen in einigen Ortsteilen starke Probleme mit interkulturellen Konflikten und Kriminalität in Zusammenhang mit Ausländern. Am derzeitig stärksten betroffen ist davon Bremen Nord in den Stadtteilen Grohn und Blumental. Hier trifft eine junge Migrations-generation auf eine etablierte Altbürger Schicht. Die auf der Karte verorteten Punkte weisen einen Ausländeranteil von 18% bis 30,4% auf. Dies soll nicht auf Problemzonen hinweisen, jedoch Rückschlüsse und Verstehen in Bezug auf vorrangegangene Faktoren ermöglichen. Wohnstiltypen Ein spezifischere Analyse und Darstellung soll sich ab hier in den Wohnstiltypen wiederspiegeln. Dieser Indikator gibt einen tiefer gehenden Eindruck über den Bewohner des Stadtteils wieder und ermöglicht eine Sichtweise aus einer anderen Perspektive. Auch hier wurden unterschiedliche Indikatoren berücksichtigt oder ausgegrenzt um ein klares Bild zu erzeugen. Lebensstile bezeichnen ästhetischexpressive, relativ ganzheitliche Muster der alltäglichen Lebensführung von Personen und Gruppen, die in einem bestimmten Habitus und einem strukturierten Set von Konsumpräferenzen, Verhaltensweisen und Geschmacksurteilen zum Ausdruck kommen. (Band & Müller) -Für welche Lebensstilgruppen sind welche Orte attraktiv? -Welche Wohnbedürfnisse äußern verschiedene Nachfragegruppen? -Welche Wohnformen sind besonders gefragt? Durch Prozesse der Einwanderung, sozialen Schließung und Segregation können bestimmte Lebensstilgruppen einzelne Stadtteile prägen. Die Wahl für einen Wohnstandort erfolgt aber nicht allein nach dem Aspekt des Wohnumfeldes unter Gleichgesinnten, sondern schließt auch Fragen von Mobilität oder Preisstruktur mit ein. Mangelnde Angebote führen deshalb oft zu Kompromissen bei der Wahl von Wohnung und Wohnstandort. Häufig sind es daher siedlungsstrukturelle und ökonomische Gründe, weshalb bestimmte Gruppen in bestimmte Bremer Stadtteile drängen, und nicht nur die gewählte Wohnform oder das soziale Wohnumfeld. Anlässlich der Aktualisierung des gesamtstädtischen Wohnungsbaukonzeptes wurde 2009 durch das GEWOS Institut eine Untersuchung zur Wohnorientierungen verschiedener Lebensstilgruppen in Bremen durchgeführt, für die Vom Leben in Bremen S Meier, H Schoefer, C Freese, S Frederichs, I Rustemeyer
27 rund Bremer Haushalte befragt wurden. Die repräsentative Stichprobe basierte auf folgenden Fragestellungen: -Wo sind welche Lebensstilgruppen aktuell verortet? -Für welche Lebensstilgruppen sind welche Orte attraktiv? -Welche Wohnbedürfnisse äußern verschiedene Nachfragegruppen? Welche Wohnformen sind besonders gefragt? Der pragmatische Eigentumsbildner ist im Umland und Stadtrand von Bremen überrepräsentiert. Sie bevorzugen kostengünstige Einfamilien- und Reihenhäuser. Der traditionelle Familientyp und die Beständigen leben seltener in innerstädtischen Lagen. Ca. 7 von 10 wohnen in Ein- bis Zweifamilienhäusern oder Reihenhäusern und sind zugleich auch Eigentümer. Die anspruchsvollen Urbanen und Best Ager sind eher Großstadtmenschen. Sie leben als gut qualifizierte, einkommensstarke Haushalte häufiger in der Innenstadt oder innenstadtnah in hochpreisigen Mehrfamilienhäusern als der Durchschnitt. Auch für die jungen Urbanen und den Alternativen trifft diese Lage zu. Durch ihr mittleres Einkommen leben sie aber eher in günstigeren Mehrfamilienhäusern. Der qualitätsbewusste Eigentumsbildner lebt seltener in der Innenstadt und häufiger in Reihenhäusern am Stadtrand. Die preissensiblen Mieter und die ortsgebundenen Senioren weisen keine spezifische Verteilung auf. Sie präferieren aufgrund ihres geringen Einkommens günstige Geschosswohnungen. Im Ergebnis der Studie konnten für Bremen 10 Wohnstiltypen definiert sowie eine große Diskrepanz bei vielen Befragten zwischen ihrer aktuellen Wohnsituationen und ihren tatsächlichen Wohnbedürfnissen und Wünschen festgestellt werden. Der aktuelle Wohnungsmangel in Bremen ist demnach weniger eine Frage der Quantität, als ein Problem der Verknappung von bestimmten Wohnformen in bestimmten Lagen. Es zeigte sich auch, dass in Bremen der Trend zum klassischen Eigenheim deutlich rückläufig ist und stattdessen urbanere Lagen mit guten Infrastrukturen nachgefragt werden. Dies erklärt den bekannten Nachfrageüberhang in innerstädtischen Stadtteilen wie in Mitte, in der östlichen Vorstadt, in Findorff und Schwachhausen. Hierhin drängt es beispielsweise Junge Urbane und Best Ager mit ihrem Wunsch nach mittel- bis hochpreisigen Miet- und Eigentumswohnungen und in Lagen mit guter Anbindung und sozialer Infrastruktur. Ein Angebot, das sie in anderen Stadtteilen in dieser Kombination bislang nicht finden. Quellen Literaturverzeichnis 25 Statistisches Landesamt Bremen, Bremer Baublöcke, de/soev/statwizard_step1.cfm?tabelle=03561, Leitbildprozess Bremen - Wohnbaukomponente -, Endbericht Hamburg Mai 2009, Hrsg.: Gewos Institut für Stadt-, Regional und Wohnforschung GmbH 2009 Delitz, Heike Prof. Dr. (2009) Architektursoziologie Bielefeld: transcript Google Inc.: Google maps 2012 (v ). Stand: 10. Juni 2012 Band, H. / Müller, H.-P. (2001): Lebensbedingungen, Lebensformen und Lebensstile. In: B. Schäfers / W. Zapf (Hrsg.) (2001): Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands. Opladen. S.428 Vom Leben in Bremen S Meier, H Schoefer, C Freese, S Frederichs, I Rustemeyer
28 26 Bildungsniveau Bremer Haus Einkommen Einzelhausbebauung Wohnraum pro Person Geschlossener Geschosswohnungsbau Hohes Alter Gewerbe/ Industrie Mittleres Alter Offener Geschosswohnungsbau Junges Alter Reihenhaus Verortung 18% - 30% Ausländeranteil Buddhistische Einrichtung Christliche Kirche Jüdische Synagoge Hinduistischer Tempel Moschee Bildungsniveau Einkommen Wohnraum pro Person Hohes Alter Mittleres Alter 1. Oben links: Demografie, Sozialkarte 3. Mitte: Wohnstilgruppe Anspruchsvolle Urbane Junges Alter 2. Oben rechts: Bebauungsstruktur, Sozialkarte 4. Unten: Wohnstilgruppe Preissensible Mieter
29 27 Wohnraum als Ware Immobilienmarkt und Kapitalmarkt Der Wohnraum in den Zentren der großen deutschen Ballungsräume wird knapp. Aus diesem Grund sind deutsche Wohnimmobilien auf dem Kapitalmarkt derzeit besonders begehrt: Immobiliengesellschaften und private Anleger, z.b. in Form von Rentenfonds, versuchen, ihr Kapital vor Währungsschwankungen, geringen Zinsen und vor Inflation zu schützen. In der Folge sind die Preise und Mieten binnen kürzester Zeit rasant gestiegen. Experten diskutieren jetzt, ob diese künstliche, durch Kapitalinteressen gesteuerte Nachfrage zu einer Immobilienblase führen könnte. Davon spricht man, wenn die Kaufpreise deutlich stärker steigen als die Mieten. Dies war der Anlass für eine Untersuchung der fünf größten Städte Deutschlands und Bremens, in Bezug auf wichtige immobilienwirtschaftliche Faktoren. Die Frage nach einer möglichen Blasenbildung kann danach nicht abschließend beantwortet werden, da jede Stadt in Bezug auf Mietsteigerung, Kaufpreisbildung und Nachfragedruck durch Zuwanderung eine spezifische und individuelle Entwicklungslinie aufweist. Es zeichnet sich aber ab, dass am Bedarf vorbei gebaut wird: Es entsteht nicht der dringend benötigte, kostengünstige Wohnraum. Sondern, renditeträchtige Neubauten für das gehobene Segment ab 8 kalt aufwärts. Die Gründe dafür liegen aber auch an der Senkung des staatlich geförderten Wohnungsbaus und der Privatisierung kommunaler Wohnungsbestände. Am stärksten betroffen davon sind Personen, die auf preisgünstige Mieten angewiesen sind. Häufig müssen diese jetzt in die Randbezirke weichen. Wohnraum als Ware J Foth, S Hartmann, P Peters
30 28 Fahrplan der Mietpreissteigerung Schaubild für die Strecken zur Mietpreissteigerung Kapitalsicherung / Investoren Fahrplan der Mietpreissteigerung Kapitalverlust Rendite Staatliche- und Privateigentümer- Immobilien Privatwirtschaftliche Immobilienunternehmen Immobilienwertsteigerung Inflation Steigende Mieten Investitionsattraktivität Wirtschaftskrise Knappheit an "bezahlbarem Wohnraum" < Erhöhte Wohnungsnachfrage Gefahr einer Immobilienblase Ungleichgewicht Wohnraum als Ware J Foth, S Hartmann, P Peters
31 29 Arbeitsplätze Zuwanderung Strukturschwache Regionen Geringe Wohnungsnachfrage Wirtschaftsstarke Ballungsräume Steigende Rohstoffpreise Wenig Arbeitsplätze Wohnungsleerstand Dieser Fahrplan der steigenden Mieten soll auf vereinfachte und abstrahierte Art die verschieden Faktoren der Mietpreissteigerungen und deren Ursachen und Zusammenhänge zusammenbringen. Wohnraum als Ware J Foth, S Hartmann, P Peters
32 30 Immobilien und Bevölkerung Die fünf größten Städte Deutschlands und Bremen Kaufpreis in % Mietpreis in % Inflation in % Zinsen auf Tagesgeld in % Hamburg Einwohner 755 km Einwohner / km 2 Bremen Einwohner 325 km Einwohner / km 2 Berlin Einwohner 891 km Einwohner /km2 Kauf Wohnungen zur Miete*/ zum Kauf Angebot Nachfrage in je 2% Angebot Nachfrage Angebot Na bis 200 Miete 200 bis bis bis bis bis 750 bis über * Netto-Kaltmiete bei Neuvermietung bis Kaufpreis bis bis bis bis bis Wohnraum als Ware J Foth, S Hartmann, P Peters
33 31 Köln Einwohner 405 km Einwohner/km2 Frankfurt Einwohner 248 km Einwohner / km 2 München Einwohner 310 km Einwohner / km 2 Nachfrage Angebot Nachfrage Angebot Nachfrage Angebot Nachfrage Wohnraum als Ware J Foth, S Hartmann, P Peters
34 32 Wohnungsbau in Ost- und Westdeutschland, = Ost West Diese Grafik zeigt dass der Wohnungsbau in den letzten Jahren extrem vernachlässigt wurde. Dies hatte zur Folge, dass die Nachfrage stieg, was wiederum den Preis in die Höhe steigen lies Wohnraum als Ware J Foth, S Hartmann, P Peters
35 33 Bevölkerungsbewegungen in Deutschland je 200 Einwohner - Stadt und Gemeindetyp gr. Kern- und Großstädte kl. Kern-und Großstädte gr. Mittelstädte kl. Mittelstädte Kleinstädte Landgemeinden - + Diese Grafik verdeutlicht das Migrationssaldo, bezogen auf verschiedene Gebietsgrößen von Städten. Es ist zu erkennen, dass nur die Kern- und Großstädte einen Zuwachs erzielen konnten. Dies ist ein weiterer Faktor für die dortige, erhöhte Nachfrage nach Wohnraum und die damit einhergehende Miet- und Immobilienpreissteigerung. Verkaufte und gekaufte Wohnungen Investoren 1999 bis Mitte 2012 Sonstige Kommunen Privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen Bund Verkauft in Gekauft in Diese Grafik zeigt, dass in den letzten Jahren mehrheitlich Wohnungen von privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen aufgekauft wurden. Diese operieren im Sinne des Allgemeinwohl, sondern um Profite zu erzielen. Das treibt die Mietpreise in die Höhe. Quellen Literaturverzeichnis GDW Bundesverband (2012): Pressefrühstück des GDW Bundesverbandes, Berlin Angelika Slavik und Steffen Uhlmann (2012): Deutschland wohnt immer teurer, Süddeutsche Zeitung Immowelt.de (2012): Deutsche Großstädte: Angebot und Nachfrage nach Immobilien im Überblick web.gdw.de/uploads/praesentation.pdf, Juni deutsche-grossstaedte-angebot-und-nachfrage-nach-immobilien-im-ueberblick.html wohnungsbau-zentren-duerfen-nicht-zu-reichen-ghettos-verkommen ratgeber.immowelt.de/anlage/rendite/immobilienpreise/artikel/artikel/ wohnungsmieten-deutsche-staedte-die-groessten-steigerungen-und-diestaerksten-einbussen.html gentrificationblog.wordpress.com/2011/06/23/berlin-bewegung-im-wohnungssektor/ wikipedia.org/wiki/hamburg/berlin/bremen/köln/münchen/frankfurt maps.google.de Wohnraum als Ware J Foth, S Hartmann, P Peters
36 34 Recht auf Wohnen Protestbewegungen in Deutschland Im Gleichschritt mit der regionalen Polarisierung wachsen die deutschen Großstädte seit einigen Jahren überproportional. Das führt zu erheblichen sozialen Spannungen auf dem Wohnungsmarkt, zumal bezahlbarer Wohnraum in innerstädtischen Lagen ein knappes Gut geworden ist: Seit 2002 ist die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland um rund ein Drittel zurückgegangen. Das liegt daran, dass Sozialwohnungen, die beim Bau staatlich subventioniert wurden nur für einen bestimmten Zeitraum einer sogenannten Belegrechtsbindung unterliegen. Diese Sozialbindungen sind jetzt ausgelaufen oder laufen in nächster Zeit sukzessive aus. Die Mieten steigen und viele sozial schlechter Gestellte waren oder sind zum Umzug in Stadtrandlagen mit preiswerteren Wohnungen gezwungen, selbst eine Zunahme der Obdachlosigkeit ist mit dem abrupten Mietanstieg zu erkennen. In vielen deutschen Großstädten haben sich mittlerweile Protestbewegungen gebildet, die gegen diese Tendenz aufbegehren und bezahlbaren Wohnraum als Grundrecht einfordern. Hauptadressaten sind Kommunen und Länder, denn seit der Föderalismusreform von 2007 ist die Förderung von Sozialwohnungen Ländersache. Die Proteste richten sich aber auch gegen die vielen leerstehenden Büroimmobilien in zentralen Lagen, die gut in Wohnraum umgewandelt werden könnten. In Frankfurt zeichnet sich hier beispielsweise schon eine Gegenbewegung ab. Einige Eigentümer beginnen, ihre leer stehenden Büroflächen mit Bädern und Küchen auszustatten und an Studenten zu vermieten, freilich ohne baurechtliche Genehmigung. Der Artikel bietet Hintergrundinformationen zu drei Protestbewegungen: Komm in die Gänge in Hamburg, Kotti & Co in Berlin und dem Bremer Aktionsbündnis Menschenrecht auf Wohnen. Recht auf Wohnen A-M Schulte, B Keller
37 35 Kiel Schwerin Hamburg Bremen Hannover Potsdam Berlin Magdeburg Düsseldorf Erfurt Dresden Wiesbaden Mainz Saarbrücken Karlsruhe Stuttgart Freiburg München Recht auf Wohnen A-M Schulte, B Keller
38 36 HAMBURG Das Jahr 2009 nimmt in der Protestbewegung Hamburgs eine Schlüsselstellung ein: Im Juni gründet sich das Netzwerk Recht auf Stadt, das sich für bezahlbaren Wohnraum, nichtkommerzielle Freiräume, die Vergesellschaftung von Immobilien, eine neue demokratische Stadtplanung und die Erhaltung von öffentlichen Grünflächen einsetzt. Bekannt wurde das Netzwerk, das heute aus 56 Hamburger Initiativen besteht durch das Manifest Not In Our Name, Marke Hamburg, das am 5. November 2009 vollständig in der ZEIT abgedruckt wurde. Das Manifest, das u.a. von renommierten Künstlern und Musikern wie Daniel Richter und Rocko Schamoni unterzeichnet wurde, wendet sich gegen die Instrumentalisierung der Hamburger Kreativszene durch das Hamburger Stadtmarketing und fordert stattdessen bezahlbare Wohnungen und Räume für Clubs, Ateliers und andere kulturelle Nutzungen. Denn, eine Stadt sei... keine Marke. Eine Stadt ist auch kein Unternehmen. Eine Stadt ist ein Gemeinwesen. In diesem Kontext entstand auch die deutschlandweit wohl bekannteste Protestbewegung Komm in die Gänge. Das Hamburger Gängeviertel ist ein übrig gebliebenes Fragment, eines ehemals sehr dichten, durch schmale Gassen und Gänge erschlossenen Arbeiterquartiers in der Hamburger Innenstadt und - Neustadt. Der überwiegende Teil wurde aus stadthygienischen Gründen bereits im 19. Jahrhundert und später auf Grund von Stadtumbaumaßnahmen in den 1960er Jahren abgerissen. Das verbliebene und unsanierte Reststück schien fast vergessen, als es von der Hamburger Finanzbehörde im Jahr 2002 im Höchstgebotsverfahren verkauft wurde. Der hohe Kaufpreis belastete das Grundstück so sehr, dass der Käufer einen Totalabriss beantragte und, als dieser nicht bewilligt wurde, das Areal 2008 an die niederländische Hanzevast Holding weiterverkaufte. Hanzevast kündigte daraufhin den verbliebenen Mietern und verfolgte ebenfalls den Abriss von etwa 80% der historischen Bausubstanz sowie den Plan im Sommer 2009 mit den Bauarbeiten zu beginnen. In Reaktion darauf wurde am die Protestinitiative Komm in die Gänge ins Leben gerufen, das Areal besetzt und mit Ausstellungen und anderen kulturelle Veranstaltungen bespielt. Daraufhin verpflichtete die Hansestadt die Sprinkenhoff AG und die SAGA die Häuser zu räumen und zu verschließen. Dem widersetzte sich die Initiative und konnte Dank des großen Medieninteresses, das sich mit der Veröffentlichung des Recht auf Stadt Manifests in der ZEIT erheblich gesteigert hatte, die Schließung letztlich verhindern. Auf Grund des wachsenden öffentlichen Drucks sah sich die Stadt im November 2010 schließlich gezwungen, die historischen Häuser für 2,8 Millionen Euro von den niederländischen Investoren zurückzukaufen. Im April 2010 legte die Initiative der Stadt Hamburg ein Nutzungs- und Sanierungskonzept vor. Seit November 2011 steht das Viertel unter Denkmalschutz und soll in den nächsten Jahren für rund 20 Millionen saniert werden. In der alten Bausubstanz sollen dann 73 Wohnungen entstehen, für etwa 200 bis 250 Bewohner. Auf dem Gelände arbeiten momentan etwa 120 Künstler und es werden weiterhin Konzerte, Lesungen und Ausstellungen angeboten, die Gäste aus aller Welt anziehen. Recht auf Wohnen A-M Schulte, B Keller
39 Gängeviertel, ein fast vergessenes Quartier in zentraler Lage 2002 Verkauf des Gängeviertels im Höchstgebotsverfahren 2008 Weiterverkauf an die niederländische Hanzevast Holding KOMM IN DIE GÄNGE 2009 Entmietung Protest: Komm in die Gänge November 2010 HH kauft das Gänge Viertel zurück 2010 HH gibt Häuser zurück Komm in die Genossenschaft!? 2010 Gängeviertel Genossenschaft 2010 eg 2013 Geplanter Sanierungsbeginn Recht auf Wohnen A-M Schulte, B Keller
40 38 BERLIN In Berlin lassen sich die Ursachen für die Proteste nicht ohne die Geschichte und die spezifische Förderpolitik des Sozialen Wohnungsbaus verstehen. Im Zeitraum von 1952 bis 1997 wurden in Berlin etwa Wohnungen durch Förderung im Sozialen Wohnungsbau erstellt. Das entspricht rund einem Drittel des heutigen Wohnungsbestandes, wobei als Fördergrundlage in den meisten Fällen eine Miet- und Belegungsbindung von lediglich 15 Jahren vereinbart wurde. Um die Mietund Belegungsbindungen zu verlängern und um weitere Anreize zu schaffen, wurde vom Land Berlin eine sogenannte Anschlussförderung in Aussicht gestellt. Konkret bedeutete dies, dass das Land Berlin die Differenz von Sozialmiete und Kostenmiete beglich. Darunter versteht man die Übernahme der sogenannten unrentierlichen Kosten, die dem Eigentümer nachweislich durch Bau, Unterhalt, Zinsen und Kredite entstehen. Damit konnten die Mieter auch nach Ablauf der Förderfristen von Sozialmieten profitieren. Da dieses Modell wenig Anreize schuf, die Bauten kostengünstig und mit wenig Unterhaltungsaufwand zu erstellen, explodierten die Kostenmieten, die das Land nach Ablauf der Förderperiode zu tragen hatte. In den 1980er Jahren lag die durchschnittliche Kostenmiete bei etwa 13 Euro/ qm kalt und stieg im Programmjahr 1992 sogar auf 19,80 Euro/ qm kalt und lag damit weit über den Preisen von Luxusimmobilien beschloss die Landesregierung schließlich den Ausstieg aus der Anschlussförderung, die horrende Summen verschlungen hatte. Zeitgleich setzte eine Privatisierung landeseigener Wohnungsbestände ein. In der Summe führte dies zu einem Rückgang der Sozialwohnungen in Berlin auf heute Wohnungen und perspektivisch bis 2018 auf Wohnungen. Ein weiterer, wesentlicher Fakt ist, dass es den Eigentümern von Wohnungen, die aus der Sozialbindung gefallen sind, erlaubt ist, auf dem Markt die Kostenmiete durchzusetzen. D.h. die Wohnungen entsprechen mietrechtlich denen von neu erstellten Wohnungen. Die bestehenden Mietverträge können daher ohne Fristen oder dem Gebot von Vergleichsmieten bis zur Höhe der Kostenmiete angehoben werden. Dies zeichnet sich allmählich in der Praxis ab und Mieter, die dem neuen Mietniveau nicht standhalten können, droht der Zwangsauszug. Von den Berliner Protestbewegungen gegen diese neue Praxis ist Kotti & Co in Kreuzberg die Bekannteste. Die Mietergemeinschaft am südlichen Kottbuser Tor hat im Mai 2012 ein Protest Gecekondu errichtet und befindet sich seither im Dauerprotest. Über sogenannte Lärmdemos macht die Initiative regelmäßig auf ihre Probleme und - Erfahrungen mit der neuen Vermietungspraxis aufmerksam. Die Wohnhochhäuser aus dem ehemaligen geförderten Sozialen Wohnungsbau sind ein prototypisches Beispiel der Berliner Subventionsund Förderpolitik: Eigentümer sind die 2004 privatisierte GSW und die Admiral-Grundstücks GmbH/ Hermes-Hausverwaltung. Die Wohnungen wurden über Förderprogramme bei der Erstellung und über Anschlussförderung mehr als 30 Jahre staatlich subventioniert. Auf Grund von degressiven Subventionen auf die Kostenmiete durch das Land erhöht der private Eigentümer die Mieten jetzt jährlich. Viele Bewohner klagen darüber, dass sie bereits 40-50% ihres Einkommens für die Miete aufbringen müssen. Kritiker bezeichnen die gescheiterte Förderpolitik des Berliner Sozialen Wohnungsbaus mittlerweile als Soziale Zwischennutzung. Recht auf Wohnen A-M Schulte, B Keller
41 Errichtung von Sozialwohnungen durch staatliche Förderungen 2003 Land steigt aus Anschlussförderung aus, Kostenmieten werden auf die Mieter übetragen das Problem wird totgeschwiegen UMZUG unfreiwilliger Auszug aus Sozialwohnunegn Mai Gründung der Initiative Kotti & Co -Errichtung des Protest Gecekondu Lärmdemo offener Brief an Senator Müller Lärmdemo Antwortbrief von Senator Müller- ohne Ergebnis Lärmdemo Recht auf Wohnen A-M Schulte, B Keller
42 Lärmdemo mit anderen Kiezinitiativen Aufruf von Architekten, Stadtplanern, Sozialwissenschaftlern, Künstlern, Journalisten Demo Das Problem heißt Rassismus Konferenz zum sozialen Wohnungsbau? offener Brief an Sozialsenator Czaja Winterlärmdemo Mietsenkung auf 5,50 Euro netto/kalt für Haushalte in 16 Großsiedlungen Recht auf Wohnen A-M Schulte, B Keller
43 41 BREMEN In Bremen ist die Zahl der Sozialwohnungen innerhalb von zwanzig Jahren drastisch gesunken. Von den ehemals rund Sozialwohnungen verfügen nur noch etwa Einheiten über diesen Status. Es wird für viele bedürftige Gruppen daher immer schwieriger bezahlbaren Wohnraum zu finden. Da die Bereitstellung von sozial gefördertem Wohnraum seit der Föderalismusreform von 2007 Ländersache ist, wird dies in Bremen zu einer sehr lokalen Angelegenheit. Dies mag ein Grund dafür gewesen sein, dass der Stadtstaat im Rahmen des Prozesses für sein neues Leitbild schon 2009 eine Wohnraumkomponente durch das GEWOS Institut erarbeiten ließ. Das Ergebnis, ein kleiner Schock: In Bremen fehlen Wohnungen, die jetzt bis zum Jahr 2020 erstellt werden sollen. Um dem Fehlbedarf zügig zu begegnen hat der Bremer Senat im vergangenen August ein Wohnraumförderungsprogramm in Höhe von 40 Millionen Euro beschlossen und ein Bündnis für Wohnen ins Leben gerufen. Eine Wohnungsbauinitiative, an der sich nicht nur Politik und Verwaltung, sondern auch Wohnungswirtschaft und Verbände beteiligen. Dies scheint auch dringend geboten, denn parallel hat sich das Bremer Aktionsbündnis Menschenrecht auf Wohnen gegründet, um denen, die unter dem Wohnungsmangel besonders leiden, eine Stimme zu geben. Am medienwirksamsten war bisher eine Demonstration am 16. Oktober 2012 vor der Bremer Bürgerschaft. Dort wurde eine Mauer aus bemalten Umzugskartons errichtet und Flyer mit der provokativen These Ein Karton ist keine Wohnung!, verteilt. In dem Flyer bezieht sich das Aktionsbündnis auf 14 der Bremer Landesverfassung, in dem es heißt: Jeder Bewohner der Freien Hansestadt Bremen hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung. Es ist Aufgabe des Staates und der Gemeinden, die Verwirklichung dieses Anspruches zu fördern. Quellen Literaturverzeichnis/ Internet: Die ZEIT, Recht auf Wohnen A-M Schulte, B Keller
44 BREBAU Anzahl an Sozialwohnungen sinkt drastisch Sanierungen keine Sozialwohnungen mehr + UMZUG BREMER AKTIONSBÜNDNIS Menschenrecht auf Wohnen UMZUG Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr Freie Hansestadt Bremen G Wohnungsbau - Besser Gestellte drängen in ehemalige Sozialwohnungen - Schwächer Gestellte müssen oftmals umziehen - Zwangsumzüge führen in Einzelfällen in die Obdachlosigkeit BREMER AKTIONSBÜNDNIS Menschenrecht auf Wohnen Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr Freie Hansestadt Bremen GEWOBA? Wohnungsbaugesellschaften BREBAU 2012 Gründung Bündnis für Wohnen Recht auf Wohnen A-M Schulte, B Keller
45 43 Regionale Polarisierung Das 21. Jahrhundert wird als Urban Age bezeichnet. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit leben mehr Menschen in der Stadt als auf dem Land: Weltweit, vor allem aber in Schwellen- und Entwicklungsländern, finden rasante Urbanisierungsprozesse statt, in deren Folge Megacities mit Einwohnerzahlen im zweistelligen Millionenbereich entstanden sind. Was bedeutet dies für Europa, Deutschland und Bremen? Während viele Regionen und Städte in der Welt gerade eine späte Industrialisierung und damit eine Ausbreitung und Suburbanisierung mit heftigem Bevölkerungswachstum erleben, gehören die europäischen Städte zu den sogenannten reifen Städten. Sie haben diese Entwicklung bereits hinter sich. Was hier ansteht ist die Phase einer Re-Urbanisierung: Wichtige Funktionen der Informations- und Dienstleistungsgesellschaft bündeln sich in zentralen Bereichen und führen gepaart durch einen Wandel der Lebens- und Wohnstile zu einer Rückwanderung der Einwohner in die Kernstädte. Insgesamt läuft diese Phase in Europa aber nicht gleichmäßig ab. Je nach geografischer und infrastruktureller Lage, Arbeitsmarktpotential und anderen, weichen Faktoren, entwickeln sich Städte positiv oder sie verlieren Einwohner. In diesem aktuellen Prozess der Regionalen Polarisierung, bei dem von den rund Städten in Deutschland nur noch gut 10% wachsen, gehört Bremen zu den Gewinnern. Das Projekt zeigt eine Überblick über diese ungleiche Entwicklung in der Welt und im europäischen Kontext: Dargestellt sind in separaten Karten die weltweit größten Kernstädte ab 6 Mio. Einwohnern die größten Städte Europas ab 1,5 Mio. Einwohnern sowie die deutschen Großstädte mit mehr als Einwohnern. Das im weltweiten und auch im europäischen Vergleich gemäßigte Wachstum von Bremen speist sich durch Wanderungsgewinne aus der Stadtregion, aus nahe gelegen Bundesländern und vor allem durch Zuwanderung aus dem Ausland. Regionale Polarisierung D Kettelhage, T Hogrefe, M Teberatz
46 44 Urbanisierung weltweit Moskau Peking New York Istanbul Seoul Teheran Karatschi Shanghai Mexiko Dhaka Lagos Jakarta M Rio de Janeiro Urbanisierung Europa Moskau London St. Petersburg Hamburg Berlin Isbanbul Minsk Paris Warschau Wien Budapest Kiew Madrid Bukarest 3.27 Barcelona Rom Regionale Polarisierung D Kettelhage, T Hogrefe, M Teberatz
47 Reurbanisierung Deutschland 45 Hamburg Berlin Bremen M Hannover Leipzig Dresden Essen Dortmund Düsseldorf Köln Frankfurt M Nürnberg Stuttgart München Wachsende Städte Deutschland Migrationssaldo international Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern Hamburg Hamburg BREMEN Bremen + 50 Brandenburg Hannover Braunschweig Berlin Niedersachsen Sachsen-Anhalt Berlin Münster Nordrhein-Westfalen Aachen Düsseldorf Köln Leipzig Dresden + 2 Hessen + 75 Thüringen + 62 Sachsen Bonn Frankfurt + 20 Wiesbaden Rheinland-Pfalz Mannheim Karlsruhe Nürnberg Saarland Bayern Stuttgart Augsburg Baden-Würtemberg München Regionale Polarisierung D Kettelhage, T Hogrefe, M Teberatz
48 46 Ausstellung an der SoAB
49 47
Die neue Wohnungsfrage
 theorie + entwerfen magazin N 3/4 Die neue Wohnungsfrage 14,00 dokumente Die neue N 1 : hoher Wohnungsfrage standard [MA 3.3_SS12] Editorial Stefan Rettich 3 Projekte Sozialer Wohnungsbau 5 Maxi Elen Kochskämper,
theorie + entwerfen magazin N 3/4 Die neue Wohnungsfrage 14,00 dokumente Die neue N 1 : hoher Wohnungsfrage standard [MA 3.3_SS12] Editorial Stefan Rettich 3 Projekte Sozialer Wohnungsbau 5 Maxi Elen Kochskämper,
Übung Betriebswirtschaftslehre I Grundlagen des Marketing. Sinus Milieus
 Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Professur für Marketing und Handelsbetriebslehre Übung Übung Betriebswirtschaftslehre I Sinus Milieus Technische Universität Chemnitz Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Professur für Marketing und Handelsbetriebslehre Übung Übung Betriebswirtschaftslehre I Sinus Milieus Technische Universität Chemnitz Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
KURZBESCHREIBUNG MILIEUS UND LEGENDE MILIEUABKÜRZUNGEN. vhw 2012
 KURZBESCHREIBUNG MILIEUS UND LEGENDE MILIEUABKÜRZUNGEN vhw 2012 2/6 SINUS-MILIEUS Gesellschaftliche Leitmilieus KET Konservativ-Etablierte 10% der Gesamtbevölkerung Das klassische Establishment: Verantwortungs-
KURZBESCHREIBUNG MILIEUS UND LEGENDE MILIEUABKÜRZUNGEN vhw 2012 2/6 SINUS-MILIEUS Gesellschaftliche Leitmilieus KET Konservativ-Etablierte 10% der Gesamtbevölkerung Das klassische Establishment: Verantwortungs-
GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE. Markus Paulus. Radboud University Nijmegen DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A.
 GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE Markus Paulus DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A. Radboud University Nijmegen XIII, GRUNDZÜGE DER MODERNEN GESELLSCHAFT: SOZIALSTRUKTUR UND SOZIALER WANDEL II Begriffe: soziale Ungleichheit
GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE Markus Paulus DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A. Radboud University Nijmegen XIII, GRUNDZÜGE DER MODERNEN GESELLSCHAFT: SOZIALSTRUKTUR UND SOZIALER WANDEL II Begriffe: soziale Ungleichheit
Sinus Milieus Der aktuelle gesellschaftliche Wandel
 Sinus s Der aktuelle gesellschaftliche Wandel Strukturelle Veränderungen: Demografische Verschiebungen, Veränderungen in Sozialstruktur und Arbeitswelt, Auseinanderdriften von oben und unten, von Mitte
Sinus s Der aktuelle gesellschaftliche Wandel Strukturelle Veränderungen: Demografische Verschiebungen, Veränderungen in Sozialstruktur und Arbeitswelt, Auseinanderdriften von oben und unten, von Mitte
Sinus-Milieus. Erstelldatum: / Version: 1. Methoden der Marktsegmentierung
 Erstelldatum: 07.02.13 / Version: 1 Sinus-Milieus Methoden der Marktsegmentierung Oberösterreich Tourismus Mag. Rainer Jelinek Tourismusentwicklung und Marktforschung Freistädter Straße 119, 4041 Linz,
Erstelldatum: 07.02.13 / Version: 1 Sinus-Milieus Methoden der Marktsegmentierung Oberösterreich Tourismus Mag. Rainer Jelinek Tourismusentwicklung und Marktforschung Freistädter Straße 119, 4041 Linz,
Wissen. Deutschlands Gesellschaft "Keiner will mehr Mitte sein"
 Page 1 of 5 Wissen Deutschlands Gesellschaft "Keiner will mehr Mitte sein" 22.09.2010, 14:50 Von Tilman Weigel Zwischen Individualisierung und Überforderung: Wie leben die Deutschen, wen wählen sie und
Page 1 of 5 Wissen Deutschlands Gesellschaft "Keiner will mehr Mitte sein" 22.09.2010, 14:50 Von Tilman Weigel Zwischen Individualisierung und Überforderung: Wie leben die Deutschen, wen wählen sie und
2. Theoretische Grundlagen der Sozialstrukturanalyse
 2. Theoretische Grundlagen der Sozialstrukturanalyse 2.1. Sozialstruktur und soziale Ungleichheit - Soziologie ist eine Wissenschaft, die kollektive (agreggierte) soziale Phänomene beschreiben und erklären
2. Theoretische Grundlagen der Sozialstrukturanalyse 2.1. Sozialstruktur und soziale Ungleichheit - Soziologie ist eine Wissenschaft, die kollektive (agreggierte) soziale Phänomene beschreiben und erklären
Einführung in die Soziologie sozialer Ungleichheit (PS)
 Einführung in die Soziologie sozialer Ungleichheit (PS) Programm der heutigen Sitzung 1. Wiederholung: Marx und Weber 2. Referate zu Geiger und Schelsky Soziale Ungleichheit (PS) - Saša Bosančić, M.A.
Einführung in die Soziologie sozialer Ungleichheit (PS) Programm der heutigen Sitzung 1. Wiederholung: Marx und Weber 2. Referate zu Geiger und Schelsky Soziale Ungleichheit (PS) - Saša Bosančić, M.A.
Karl Marx ( )
 Grundkurs Soziologie (GK I) BA Sozialwissenschaften Karl Marx (1818-1883) Kolossalfigur des 19. Jahrhunderts 1. Historischer Materialismus 2. Arbeit als Basis der Gesellschaft 3. Klassen und Klassenkämpfe
Grundkurs Soziologie (GK I) BA Sozialwissenschaften Karl Marx (1818-1883) Kolossalfigur des 19. Jahrhunderts 1. Historischer Materialismus 2. Arbeit als Basis der Gesellschaft 3. Klassen und Klassenkämpfe
Gliederung. 1. Lebenslauf Max Webers. 2. Hauptwerke. 3. Die Begriffe Klasse Stand Partei 3.1. Klasse 3.2. Stand 3.3. Partei. 4.
 1. Lebenslauf Max Webers 2. Hauptwerke Gliederung 3. Die Begriffe Klasse Stand Partei 3.1. Klasse 3.2. Stand 3.3. Partei 4. Bedeutung Webers Max Weber, Klasse Stand Partei 1. Lebenslauf - am 21.4.1864
1. Lebenslauf Max Webers 2. Hauptwerke Gliederung 3. Die Begriffe Klasse Stand Partei 3.1. Klasse 3.2. Stand 3.3. Partei 4. Bedeutung Webers Max Weber, Klasse Stand Partei 1. Lebenslauf - am 21.4.1864
Naturbewusstsein in Deutschland
 Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Naturbewusstsein in Deutschland Naturbewusstsein 2011: Einführung, grundlegende Befunde und Ergebnisse zum nachhaltigen Konsum Andreas Wilhelm Mues Bundesamt für Naturschutz
Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Naturbewusstsein in Deutschland Naturbewusstsein 2011: Einführung, grundlegende Befunde und Ergebnisse zum nachhaltigen Konsum Andreas Wilhelm Mues Bundesamt für Naturschutz
Die Sinus Milieus Milieubeschreibung & Senderpositionierung. Jahr 2014
 Die Sinus Milieus Milieubeschreibung & Senderpositionierung Jahr 2014 Inhaltsverzeichnis Kurzbeschreibung der einzelnen Sinus-Milieus Senderpositionierung in den Sinus-Milieus Die Sinus-Milieu-Typologie
Die Sinus Milieus Milieubeschreibung & Senderpositionierung Jahr 2014 Inhaltsverzeichnis Kurzbeschreibung der einzelnen Sinus-Milieus Senderpositionierung in den Sinus-Milieus Die Sinus-Milieu-Typologie
Die Sinus-Milieus für ein verändertes Österreich. Statistiktage 2016 der Österreichischen Statistischen Gesellschaft
 Die Sinus-Milieus für ein verändertes Österreich Statistiktage 2016 der Österreichischen Statistischen Gesellschaft 14. September 2016 Soziale Milieus und Wertewandel in Österreich Sinus-Milieus in Österreich
Die Sinus-Milieus für ein verändertes Österreich Statistiktage 2016 der Österreichischen Statistischen Gesellschaft 14. September 2016 Soziale Milieus und Wertewandel in Österreich Sinus-Milieus in Österreich
Vertikales Paradigma: Klassen, Stände und
 Vertikales Paradigma: Klassen, Stände und Schichten VL 5 Sozialstruktur, Geschlechterverhältnisse und räumliche Differenzierung 1 http://www.myvideo.de/watch/6962091/sido_hey_du 2 Ich hatte diesen Traum,
Vertikales Paradigma: Klassen, Stände und Schichten VL 5 Sozialstruktur, Geschlechterverhältnisse und räumliche Differenzierung 1 http://www.myvideo.de/watch/6962091/sido_hey_du 2 Ich hatte diesen Traum,
NATIONALISMUS, NATIONALSTAAT UND DEUTSCHE IDENTITÄT IM 19. JAHRHUNDERT 8
 3 01 NATIONALISMUS, NATIONALSTAAT UND DEUTSCHE IDENTITÄT IM 19. JAHRHUNDERT 8 DIE DEUTSCHE NATIONALBEWEGUNG IN VORMÄRZ UND REVOLUTION (1815 1848) 10 Orientierung: Die deutsche Nationalbewegung in Vormärz
3 01 NATIONALISMUS, NATIONALSTAAT UND DEUTSCHE IDENTITÄT IM 19. JAHRHUNDERT 8 DIE DEUTSCHE NATIONALBEWEGUNG IN VORMÄRZ UND REVOLUTION (1815 1848) 10 Orientierung: Die deutsche Nationalbewegung in Vormärz
Die Rechtsentwicklung der Bundesrepublik Deutschland - Rechtsquellen
 ηηin 頴盝蘟監監監 Übernommen aus: Kroeschell, Karl: Deutsche Rechtsgesch Kern, Bernd-Rüdiger: Skript zur Vorles Deutsche Rec chtsgeschichte Masaryk Universität Brünn; Juristische Fakultät JUDr. Jaromír Tauchen,
ηηin 頴盝蘟監監監 Übernommen aus: Kroeschell, Karl: Deutsche Rechtsgesch Kern, Bernd-Rüdiger: Skript zur Vorles Deutsche Rec chtsgeschichte Masaryk Universität Brünn; Juristische Fakultät JUDr. Jaromír Tauchen,
Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit
 Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit Herzlich Willkommen zum Impulsreferat: Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit im Kontext globalen und gesellschaftlichen Wandels und soziodemographischer
Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit Herzlich Willkommen zum Impulsreferat: Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit im Kontext globalen und gesellschaftlichen Wandels und soziodemographischer
Soziale Ungleichheit in Deutschland
 Stefan Hradil unter Mitarbeit von Jürgen Schiener Soziale Ungleichheit in Deutschland 7. Auflage Leske + Budrich, Opladen 1999 Inhalt 0. Vorwort 9 1. Einleitung-Soziale Ungleichheit und ihre Bedeutung...
Stefan Hradil unter Mitarbeit von Jürgen Schiener Soziale Ungleichheit in Deutschland 7. Auflage Leske + Budrich, Opladen 1999 Inhalt 0. Vorwort 9 1. Einleitung-Soziale Ungleichheit und ihre Bedeutung...
Soziale Ungleichheit und Klassenstrukturen in Deutschland. Lebenslagen, Interessenvermittlung und Wertorientierung von M.
 Soziale Ungleichheit und Klassenstrukturen in Deutschland Lebenslagen, Interessenvermittlung und Wertorientierung von M.Rainer Lepsius Überblick Einleitung Die verschiedenen Klassen Sozialstruktur und
Soziale Ungleichheit und Klassenstrukturen in Deutschland Lebenslagen, Interessenvermittlung und Wertorientierung von M.Rainer Lepsius Überblick Einleitung Die verschiedenen Klassen Sozialstruktur und
nationalismus, nationalstaat und deutsche identität im 19. jahrhundert 8
 3 01 nationalismus, nationalstaat und deutsche identität im 19 jahrhundert 8 Die deutsche nationalbewegung in vormärz und revolution (1815 1848) 10 Orientierung: Die deutsche Nationalbewegung in Vormärz
3 01 nationalismus, nationalstaat und deutsche identität im 19 jahrhundert 8 Die deutsche nationalbewegung in vormärz und revolution (1815 1848) 10 Orientierung: Die deutsche Nationalbewegung in Vormärz
Verteilung der neuen Sinus-Milieus
 Ortsteile in Filderstadt Ergänzende Informationen zur Verteilung der neuen Sinus-Milieus Ha., Juli 2012 Chart 1 Das bisherige Modell: Die Sinus Milieus 2010 Oberschicht/ Obere Mittelschicht 1 Mittlere
Ortsteile in Filderstadt Ergänzende Informationen zur Verteilung der neuen Sinus-Milieus Ha., Juli 2012 Chart 1 Das bisherige Modell: Die Sinus Milieus 2010 Oberschicht/ Obere Mittelschicht 1 Mittlere
Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig)
 Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig) Inhalte Kompetenzen Hinweise Themenbereich: 1. Prozesse der Modernisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit dem 18.
Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig) Inhalte Kompetenzen Hinweise Themenbereich: 1. Prozesse der Modernisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit dem 18.
Die Sinus-Milieus ein sozialwissenschaftliches Instrument für die soziale Arbeit
 Die Sinus-Milieus Die Sinus-Milieus orientieren sich an der Lebensweltanalyse unserer Gesellschaft. Zentrales Ergebnis dieser Forschung ist die Abgrenzung und Beschreibung von sozialen Milieus mit jeweils
Die Sinus-Milieus Die Sinus-Milieus orientieren sich an der Lebensweltanalyse unserer Gesellschaft. Zentrales Ergebnis dieser Forschung ist die Abgrenzung und Beschreibung von sozialen Milieus mit jeweils
Deutschland Die Lebenswelten der Generation 50plus. Dr. Silke Borgstedt
 Sinus-Milieus 50plus Deutschland Die Lebenswelten der Generation 50plus Dr. Silke Borgstedt Ein mögliches Missverständnis 50plus wird oft als Zielgruppenbeschreibung benutzt Diese "Zielgruppe" 50plus ist
Sinus-Milieus 50plus Deutschland Die Lebenswelten der Generation 50plus Dr. Silke Borgstedt Ein mögliches Missverständnis 50plus wird oft als Zielgruppenbeschreibung benutzt Diese "Zielgruppe" 50plus ist
Selbstüberprüfung: Europa und die Welt im 19. Jahrhundert. 184
 3 01 Europa und die Welt im 19 Jahrhundert 8 Orientierung: Vormärz und Revolution (1815 1848) 10 Entstehung, Entwicklung und Unterdrückung der liberal-nationalen Bewegung (1813/15 1848) 12 Training: Interpretation
3 01 Europa und die Welt im 19 Jahrhundert 8 Orientierung: Vormärz und Revolution (1815 1848) 10 Entstehung, Entwicklung und Unterdrückung der liberal-nationalen Bewegung (1813/15 1848) 12 Training: Interpretation
Guten Morgen. Westfälische Hochschule Institut für JPR WS 2014 Visuelle Kommunikation
 Guten Morgen. Westfälische Hochschule Institut für JPR WS 2014 Visuelle Kommunikation Zwischenfazit: Diagramme Grundsätzlich: statischer oder dynamischer Datensatz? Abstandsproportional Balkendiagramm
Guten Morgen. Westfälische Hochschule Institut für JPR WS 2014 Visuelle Kommunikation Zwischenfazit: Diagramme Grundsätzlich: statischer oder dynamischer Datensatz? Abstandsproportional Balkendiagramm
Produktion und Reproduktion sozialer Ungleichheit in Deutschland
 Produktion und Reproduktion sozialer Ungleichheit in Deutschland Komparative Forschung Zuerst Südostasien und Brasilien Vergleich und Theorie Anwendung auf Deutschland: erst Lektüre, dann Revision der
Produktion und Reproduktion sozialer Ungleichheit in Deutschland Komparative Forschung Zuerst Südostasien und Brasilien Vergleich und Theorie Anwendung auf Deutschland: erst Lektüre, dann Revision der
Vorlesung Sozialisation Biografie Lebenslauf. Habitus - Kulturelles Kapital Bildungschancen
 Sommersemester 2007 mittwochs 16.00 bis 18.00 Uhr Blauer Hörsaal Vorlesung Sozialisation Biografie Lebenslauf Habitus - Kulturelles Kapital Bildungschancen Pierre Bourdieu Französischer Soziologe 1.8.1930-23.1.2002
Sommersemester 2007 mittwochs 16.00 bis 18.00 Uhr Blauer Hörsaal Vorlesung Sozialisation Biografie Lebenslauf Habitus - Kulturelles Kapital Bildungschancen Pierre Bourdieu Französischer Soziologe 1.8.1930-23.1.2002
Geisteswissenschaft. Rosa Badaljan. Pierre Bourdieu. Studienarbeit
 Geisteswissenschaft Rosa Badaljan Pierre Bourdieu Studienarbeit Soziologische Theorien der Gegenwart Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg SoSe 2003 Pierre Bourdieu Rosa Badaljan Fachsemester:
Geisteswissenschaft Rosa Badaljan Pierre Bourdieu Studienarbeit Soziologische Theorien der Gegenwart Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg SoSe 2003 Pierre Bourdieu Rosa Badaljan Fachsemester:
Sozialräumliche Quartiersentwicklung aus Sicht der Wohnungswirtschaft
 Sozialräumliche Quartiersentwicklung aus Sicht der Wohnungswirtschaft Dr. Iris Beuerle Referat Genossenschaften und Quartiersentwicklung Sozialraumorientierung Dr. Iris Beuerle 2 Definition Quartier Quartier
Sozialräumliche Quartiersentwicklung aus Sicht der Wohnungswirtschaft Dr. Iris Beuerle Referat Genossenschaften und Quartiersentwicklung Sozialraumorientierung Dr. Iris Beuerle 2 Definition Quartier Quartier
Schichtung und soziale Ungleichheit
 Schichtung und soziale Ungleichheit Universität Augsburg Grundkurs Soziologie B.A. Sozialwissenschaften WS 2007/2008 Dozent Saša Bosančić 30.01.2008 Nina Rockelmann, Johannes Huyer, Johannes Schneider
Schichtung und soziale Ungleichheit Universität Augsburg Grundkurs Soziologie B.A. Sozialwissenschaften WS 2007/2008 Dozent Saša Bosančić 30.01.2008 Nina Rockelmann, Johannes Huyer, Johannes Schneider
Soziale Beziehungen & Gesellschaft -Proseminar Sommersemester 2005 Bourdieu // Ökonomisches, kulturelles & soziales Kapital
 Soziale Beziehungen & Gesellschaft -Proseminar Sommersemester 2005 Bourdieu // Ökonomisches, kulturelles & soziales Kapital Die Kapitalsorten nach Bourdieu Kapital Ökonomisches Kapital (Geld, Besitz) Soziales
Soziale Beziehungen & Gesellschaft -Proseminar Sommersemester 2005 Bourdieu // Ökonomisches, kulturelles & soziales Kapital Die Kapitalsorten nach Bourdieu Kapital Ökonomisches Kapital (Geld, Besitz) Soziales
Sozialstruktur und Wandel der Bundesrepublik Deutschland
 Bernhard Schäfers Sozialstruktur und Wandel der Bundesrepublik Deutschland Ein Studienbuch zu ihrer Soziologie und Sozialgeschichte 3 Abbildungen und &5 Tabellen 6 Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1976
Bernhard Schäfers Sozialstruktur und Wandel der Bundesrepublik Deutschland Ein Studienbuch zu ihrer Soziologie und Sozialgeschichte 3 Abbildungen und &5 Tabellen 6 Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1976
Geschichte Deutschlands
 Geschichte Deutschlands Die Präsentation wurde hergestellt durch: Katia Prokopchuk Oksana Melnychuk Anastasia Bolischuk Olga Bagriy Die Entstehung des Landes Erste Erwähnung über einige germanische Stämme
Geschichte Deutschlands Die Präsentation wurde hergestellt durch: Katia Prokopchuk Oksana Melnychuk Anastasia Bolischuk Olga Bagriy Die Entstehung des Landes Erste Erwähnung über einige germanische Stämme
Karl Martin Bolte/Stefan Hradil Soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik Deutschland
 Karl Martin Bolte/Stefan Hradil Soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik Deutschland Karl Martin Bolte/ Stefan Hradil Soziale U ngleichheit in der Bundesrepublik Deutschland Leske + Budrich, Opladen
Karl Martin Bolte/Stefan Hradil Soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik Deutschland Karl Martin Bolte/ Stefan Hradil Soziale U ngleichheit in der Bundesrepublik Deutschland Leske + Budrich, Opladen
Goffmans Theatermodel und die postmoderne Gesellschaft - soziologische Bedeutung neuer Kommunikationsmedien
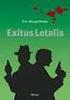 Geisteswissenschaft Nastasia Mohren Goffmans Theatermodel und die postmoderne Gesellschaft - soziologische Bedeutung neuer Kommunikationsmedien Studienarbeit Hausarbeit Nastasia Mohren Einführung in die
Geisteswissenschaft Nastasia Mohren Goffmans Theatermodel und die postmoderne Gesellschaft - soziologische Bedeutung neuer Kommunikationsmedien Studienarbeit Hausarbeit Nastasia Mohren Einführung in die
Geschichte betrifft uns
 Geschichte betrifft uns Allgemeine Themen Geschichte des jüdischen Volkes Seuchen in der Geschichte Sterben und Tod Frauenbewegung in Deutschland Polen und Deutsche Japan Mensch und Umwelt in der Geschichte
Geschichte betrifft uns Allgemeine Themen Geschichte des jüdischen Volkes Seuchen in der Geschichte Sterben und Tod Frauenbewegung in Deutschland Polen und Deutsche Japan Mensch und Umwelt in der Geschichte
Thema: Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 20. Jahrhundert
 Qualifikationsphase 2: Unterrichtsvorhaben IV Thema: Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 20. Jahrhundert I Übergeordnete Kompetenzen en ordnen historische Ereignisse, Personen, Prozesse
Qualifikationsphase 2: Unterrichtsvorhaben IV Thema: Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 20. Jahrhundert I Übergeordnete Kompetenzen en ordnen historische Ereignisse, Personen, Prozesse
Globalisierung und soziale Ungleichheit. Einführung in das Thema
 Globalisierung und soziale Ungleichheit Einführung in das Thema Gliederung 1. Was verbinden Soziologen mit dem Begriff Globalisierung? 2. Gliederung des Seminars 3. Teilnahmevoraussetzungen 4. Leistungsnachweise
Globalisierung und soziale Ungleichheit Einführung in das Thema Gliederung 1. Was verbinden Soziologen mit dem Begriff Globalisierung? 2. Gliederung des Seminars 3. Teilnahmevoraussetzungen 4. Leistungsnachweise
Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren?
 Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Soziale Milieus als Zielgruppen für die Nachhaltigkeitskommunikation
 Soziale Milieus als Zielgruppen für die Nachhaltigkeitskommunikation Dr. Silke Kleinhückelkotten Expertenwerkstatt, Hannover, 30.11. Soziale Milieus (nach Sociovision) Wertorientierungen Lebensziele Lebensauffassung
Soziale Milieus als Zielgruppen für die Nachhaltigkeitskommunikation Dr. Silke Kleinhückelkotten Expertenwerkstatt, Hannover, 30.11. Soziale Milieus (nach Sociovision) Wertorientierungen Lebensziele Lebensauffassung
Prekäre Wahlen. Milieus und soziale Selektivität der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl Stadtbericht Münster
 Prekäre Wahlen s und soziale Selektivität der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2013 Stadtbericht Münster Stadtbericht Münster Kleinräumige Daten aus 28 untersuchten Großstädten und 640 bundesweit
Prekäre Wahlen s und soziale Selektivität der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2013 Stadtbericht Münster Stadtbericht Münster Kleinräumige Daten aus 28 untersuchten Großstädten und 640 bundesweit
Inhaltsverzeichnis. Vom Imperialismus in den Ersten Weltkrieg 10. Nach dem Ersten Weltkrieg: Neue Entwürfe für Staat und Gesellschaft
 Inhaltsverzeichnis Vom Imperialismus in den Ersten Weltkrieg 10 Ein erster Blick: Imperialismus und Erster Weltkrieg 12 Der Imperialismus 14 Vom Kolonialismus zum Imperialismus 15 Warum erobern Großmächte
Inhaltsverzeichnis Vom Imperialismus in den Ersten Weltkrieg 10 Ein erster Blick: Imperialismus und Erster Weltkrieg 12 Der Imperialismus 14 Vom Kolonialismus zum Imperialismus 15 Warum erobern Großmächte
6 THESEN ZUR ZUKUNFT DER ERNÄHRUNG
 6 THESEN ZUR ZUKUNFT DER ERNÄHRUNG 1. Die Herausforderung Der Wunsch von uns allen ist ein gesundes und langes Leben. Dazu bedarf es in der Zukunft grundlegender Veränderungen in der Ernährung: Die gesunde
6 THESEN ZUR ZUKUNFT DER ERNÄHRUNG 1. Die Herausforderung Der Wunsch von uns allen ist ein gesundes und langes Leben. Dazu bedarf es in der Zukunft grundlegender Veränderungen in der Ernährung: Die gesunde
Prekäre Wahlen. Milieus und soziale Selektivität der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl Stadtbericht Bielefeld
 Prekäre Wahlen s und soziale Selektivität der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2013 Stadtbericht Bielefeld Stadtbericht Bielefeld Kleinräumige Daten aus 28 untersuchten Großstädten und 640 bundesweit
Prekäre Wahlen s und soziale Selektivität der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2013 Stadtbericht Bielefeld Stadtbericht Bielefeld Kleinräumige Daten aus 28 untersuchten Großstädten und 640 bundesweit
Gesellschaftslehre Jahrgang 8
 Gesellschaftslehre Jahrgang 8 Industrielle Revolution und Strukturwandel SchülerInnen... Warum begann die Industrialisierung in England? beschreiben Schlüsselereignisse, epochale Errungenschaften und wesentliche
Gesellschaftslehre Jahrgang 8 Industrielle Revolution und Strukturwandel SchülerInnen... Warum begann die Industrialisierung in England? beschreiben Schlüsselereignisse, epochale Errungenschaften und wesentliche
Soziologie im Nebenfach
 Hermann Körte Soziologie im Nebenfach Eine Einführung UVK Verlagsgesellschaft mbh Inhaltsverzeichnis 1. Kapitel: Einleitung 11 Zum Gebrauch dieses Buches 11 Weiterführende Literatur 12 Infoteil 15 2. Kapitel:
Hermann Körte Soziologie im Nebenfach Eine Einführung UVK Verlagsgesellschaft mbh Inhaltsverzeichnis 1. Kapitel: Einleitung 11 Zum Gebrauch dieses Buches 11 Weiterführende Literatur 12 Infoteil 15 2. Kapitel:
Soziale Ungleichheit in Deutschland
 Stefan Hradil unter Mitarbeit von Jurgen Schiener Soziale Ungleichheit in Deutschland 8. Auflage III VS VERLAG FOR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhalt 0. Vorwort 11 1. Einleitung - Soziale Ungleichheit und ihre
Stefan Hradil unter Mitarbeit von Jurgen Schiener Soziale Ungleichheit in Deutschland 8. Auflage III VS VERLAG FOR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhalt 0. Vorwort 11 1. Einleitung - Soziale Ungleichheit und ihre
Die Weimarer Republik (16 Stunden)
 Die Weimarer Republik (16 Stunden) Vom Kaiserreich zur Republik Die Revolution Der Weg zur Nationalversammlung Weimarer Verfassung (1919) und Parteien Verfassungsschema erklären Verfassungs- und grundrechtliche
Die Weimarer Republik (16 Stunden) Vom Kaiserreich zur Republik Die Revolution Der Weg zur Nationalversammlung Weimarer Verfassung (1919) und Parteien Verfassungsschema erklären Verfassungs- und grundrechtliche
Soziologie für die Soziale Arbeit
 Studienkurs Soziale Arbeit Klaus Bendel Soziologie für die Soziale Arbeit Nomos Studienkurs Soziale Arbeit Lehrbuchreihe für Studierende der Sozialen Arbeit an Universitäten und Fachhochschulen. Praxisnah
Studienkurs Soziale Arbeit Klaus Bendel Soziologie für die Soziale Arbeit Nomos Studienkurs Soziale Arbeit Lehrbuchreihe für Studierende der Sozialen Arbeit an Universitäten und Fachhochschulen. Praxisnah
theorie + entwerfen Konfliktraum BRD magazin N 1/2 Editorial Projekte Gentrifizierung 31 Anke Nieman, Marek Statelov Stefan Rettich 3
 theorie + entwerfen magazin N 1/2 Konfliktraum BRD Editorial Stefan Rettich 3 Projekte Bürgerproteste 4 Felix Ebert, Till Ludwig Brennende Autos 13 Yvonne Götzenich, Johanna Kühnke Welt der Bahnhöfe 16
theorie + entwerfen magazin N 1/2 Konfliktraum BRD Editorial Stefan Rettich 3 Projekte Bürgerproteste 4 Felix Ebert, Till Ludwig Brennende Autos 13 Yvonne Götzenich, Johanna Kühnke Welt der Bahnhöfe 16
Haltung zu Gesundheit und Rauchen in den Sinus-Milieus
 Haltung zu Gesundheit und Rauchen in den -Milieus Austrian Online Pool ermöglicht Zielgruppen-Segmentierung Das Thema Gesundheit interessiert jeden von uns. Aber die damit verbundenen, konkreten Meinungen
Haltung zu Gesundheit und Rauchen in den -Milieus Austrian Online Pool ermöglicht Zielgruppen-Segmentierung Das Thema Gesundheit interessiert jeden von uns. Aber die damit verbundenen, konkreten Meinungen
Geschichte - betrifft uns
 1983 9 Weltwirtschaftskrise 1929-1933, Ursachen und Folgen (n.v.) 10 Armut und soziale Fürsorge vor der Industrialisierung 11 Frieden durch Aufrüstung oder Abrüstung 1918-1939 12 Europa zwischen Integration
1983 9 Weltwirtschaftskrise 1929-1933, Ursachen und Folgen (n.v.) 10 Armut und soziale Fürsorge vor der Industrialisierung 11 Frieden durch Aufrüstung oder Abrüstung 1918-1939 12 Europa zwischen Integration
Agrobiodiversität im gesellschaftlichen Bewusstsein
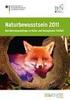 Agrobiodiversität im gesellschaftlichen Bewusstsein Silke Kleinhückelkotten, ECOLOG-Institut Tagung: Agrobiodiversität als Schlüssel für eine nachhaltige Landwirtschaft im 21. Jahrhundert? 20. / 21. Oktober,
Agrobiodiversität im gesellschaftlichen Bewusstsein Silke Kleinhückelkotten, ECOLOG-Institut Tagung: Agrobiodiversität als Schlüssel für eine nachhaltige Landwirtschaft im 21. Jahrhundert? 20. / 21. Oktober,
Der Neorealismus von K.Waltz zur Erklärung der Geschehnisse des Kalten Krieges
 Politik Manuel Stein Der Neorealismus von K.Waltz zur Erklärung der Geschehnisse des Kalten Krieges Studienarbeit Inhalt 1. Einleitung 1 2. Der Neorealismus nach Kenneth Waltz 2 3. Der Kalte Krieg 4 3.1
Politik Manuel Stein Der Neorealismus von K.Waltz zur Erklärung der Geschehnisse des Kalten Krieges Studienarbeit Inhalt 1. Einleitung 1 2. Der Neorealismus nach Kenneth Waltz 2 3. Der Kalte Krieg 4 3.1
Inhalt. Sozialkunde Deutschlands Sozialer Wandel Bevölkerung Migration Familie Kapitel 1. Einleitung Stefan Hradil
 Inhalt Kapitel 1 Sozialkunde Deutschlands... 9 Einleitung Stefan Hradil Kapitel 2 Sozialer Wandel... 17 Wohin geht die Entwicklung? Uwe Schimank Kapitel 3 Bevölkerung... 41 Die Angst vor der demografischen
Inhalt Kapitel 1 Sozialkunde Deutschlands... 9 Einleitung Stefan Hradil Kapitel 2 Sozialer Wandel... 17 Wohin geht die Entwicklung? Uwe Schimank Kapitel 3 Bevölkerung... 41 Die Angst vor der demografischen
Soziale Ungleichheit und Bildungschancen
 Soziale Ungleichheit und Bildungschancen Referat von Sandra Stahl: Bildungskapital Bildung als zentrale Ressource für Lebenschancen Prof. Dr. Rainer Geißler Heike Braun, M.A. Literatur Abels, H. 2004:
Soziale Ungleichheit und Bildungschancen Referat von Sandra Stahl: Bildungskapital Bildung als zentrale Ressource für Lebenschancen Prof. Dr. Rainer Geißler Heike Braun, M.A. Literatur Abels, H. 2004:
Eugène Delacroix: Die Freiheit führt das Volk ( 1830 )
 1815-1850 Eugène Delacroix: Die Freiheit führt das Volk ( 1830 ) Die politischen Verhältnisse könnten mich rasend machen. Das arme Volk schleppt den Karren, worauf die Fürsten und Liberalen ihre Affenkomödie
1815-1850 Eugène Delacroix: Die Freiheit führt das Volk ( 1830 ) Die politischen Verhältnisse könnten mich rasend machen. Das arme Volk schleppt den Karren, worauf die Fürsten und Liberalen ihre Affenkomödie
die Berliner Mauer die Geschichte zwei deutscher Staaten
 die Berliner Mauer die Geschichte zwei deutscher Staaten DEUTSCHLAND NACH 1945 Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Deutschland von den Westalliierten und der Sowjetunion in 4 Zonen eingeteilt und Berlin in
die Berliner Mauer die Geschichte zwei deutscher Staaten DEUTSCHLAND NACH 1945 Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Deutschland von den Westalliierten und der Sowjetunion in 4 Zonen eingeteilt und Berlin in
15. Shell Jugendstudie Jugend 2006
 15. Shell Jugendstudie Jugend 2006 Eine pragmatische Generation unter Druck Die Rahmendaten 1. Shell Jugendstudie1952, seit dem wird alle 4 Jahre die Jugendstudie durchgeführt aktuell 15. Shell Jugendstudie:
15. Shell Jugendstudie Jugend 2006 Eine pragmatische Generation unter Druck Die Rahmendaten 1. Shell Jugendstudie1952, seit dem wird alle 4 Jahre die Jugendstudie durchgeführt aktuell 15. Shell Jugendstudie:
Themenplan WZG. Klasse 9. Kapitel 1 China. Kapitel 2 Weimarer Republik Seite 1. Leitideen, Kompetenzen und Inhalte gemäß Bildungsplan
 Inhalte von Terra 5 Kapitel 1 China - Einen Kurzvortrag vorbereiten und halten - China verstehen - Alles nur Chinesen? - Rechtsstaat gesucht! - Mit einem GIS arbeiten - Vier Chinas - Nur ein Kind?! - Wirtschaftsmacht
Inhalte von Terra 5 Kapitel 1 China - Einen Kurzvortrag vorbereiten und halten - China verstehen - Alles nur Chinesen? - Rechtsstaat gesucht! - Mit einem GIS arbeiten - Vier Chinas - Nur ein Kind?! - Wirtschaftsmacht
Individualisierung bei Max Weber. Steffi Sager und Ulrike Wöhl
 Individualisierung bei Max Weber Steffi Sager und Ulrike Wöhl Gliederung 1. Einleitung 2. Das soziale Handeln 3. Werthaftigkeit und Sinnhaftigkeit des Handelns 4. Die Orientierung am Anderen 5. Zusammenwirken
Individualisierung bei Max Weber Steffi Sager und Ulrike Wöhl Gliederung 1. Einleitung 2. Das soziale Handeln 3. Werthaftigkeit und Sinnhaftigkeit des Handelns 4. Die Orientierung am Anderen 5. Zusammenwirken
Prekäre Wahlen. Milieus und soziale Selektivität der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl Stadtbericht Gelsenkirchen
 Prekäre Wahlen s und soziale Selektivität der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2013 Stadtbericht Gelsenkirchen Stadtbericht Gelsenkirchen Kleinräumige Daten aus 28 untersuchten Großstädten und 640
Prekäre Wahlen s und soziale Selektivität der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2013 Stadtbericht Gelsenkirchen Stadtbericht Gelsenkirchen Kleinräumige Daten aus 28 untersuchten Großstädten und 640
Bio-Käufer sind so vielfältig wie die Gesellschaft
 Untersuchungen zum Produkt- und Markenstatus 5.6 Bio-Käufer sind so vielfältig wie die Gesellschaft DEN Bio-Käufer gibt es heute genauso wenig wie DEN Bio-Laden. Die Bio-Käufer und auch die Leser von Schrot&Korn
Untersuchungen zum Produkt- und Markenstatus 5.6 Bio-Käufer sind so vielfältig wie die Gesellschaft DEN Bio-Käufer gibt es heute genauso wenig wie DEN Bio-Laden. Die Bio-Käufer und auch die Leser von Schrot&Korn
Der Gast zuhause. EINE QUELLMARKTBEFRAGUNG UNTERSUCHT REISEENTSCHEIDUNGEN IM DEUTSCHEN QUELLMARKT UND DIE WAHRNEHMUNG DES ALPENRAUMS ALS URLAUBSZIEL
 Der Gast zuhause. EINE QUELLMARKTBEFRAGUNG UNTERSUCHT REISEENTSCHEIDUNGEN IM DEUTSCHEN QUELLMARKT UND DIE WAHRNEHMUNG DES ALPENRAUMS ALS URLAUBSZIEL PROF. DR. FELIX KOLBECK FAKULTÄT FÜR TOURISMUS, HOCHSCHULE
Der Gast zuhause. EINE QUELLMARKTBEFRAGUNG UNTERSUCHT REISEENTSCHEIDUNGEN IM DEUTSCHEN QUELLMARKT UND DIE WAHRNEHMUNG DES ALPENRAUMS ALS URLAUBSZIEL PROF. DR. FELIX KOLBECK FAKULTÄT FÜR TOURISMUS, HOCHSCHULE
Ausgewählte Ergebnisse der vhw-sinus-trendstudie 2015
 Ausgewählte Ergebnisse der vhw-sinus-trendstudie 2015 Flüchtlinge, Zusammenleben, öffentlicher Raum, lokale Akteure, Partizipation sowie Bildung und Wohnen Auszug Themenfelder Wohnen und Wohnumfeld Bernd
Ausgewählte Ergebnisse der vhw-sinus-trendstudie 2015 Flüchtlinge, Zusammenleben, öffentlicher Raum, lokale Akteure, Partizipation sowie Bildung und Wohnen Auszug Themenfelder Wohnen und Wohnumfeld Bernd
VORLESUNG SOZIOLOGISCHE GRUNDBEGRIFFE SoSe Veranstaltung. SOZIALSTRUKTUR-BEGRIFFE II Lebensstile, soziale Milieus, soziale Mobilität
 VORLESUNG SOZIOLOGISCHE GRUNDBEGRIFFE SoSe 09 10. Veranstaltung SOZIALSTRUKTUR-BEGRIFFE II Lebensstile, soziale Milieus, soziale Mobilität ÜBERBLICK 1. Lebensstil-Konzepte 1. Milieu-Konzepte (Hradil, Sinus)
VORLESUNG SOZIOLOGISCHE GRUNDBEGRIFFE SoSe 09 10. Veranstaltung SOZIALSTRUKTUR-BEGRIFFE II Lebensstile, soziale Milieus, soziale Mobilität ÜBERBLICK 1. Lebensstil-Konzepte 1. Milieu-Konzepte (Hradil, Sinus)
Begriffsdefinitionen zum Thema Soziale Ungleichheit (HRADIL)
 Begriffsdefinitionen zum Thema Soziale Ungleichheit (HRADIL) Soziale Ungleichheit Soziale Ungleichheit liegt dann vor, wenn Menschen aufgrund ihrer Stellung in sozialen Beziehungsgefügen von den wertvollen
Begriffsdefinitionen zum Thema Soziale Ungleichheit (HRADIL) Soziale Ungleichheit Soziale Ungleichheit liegt dann vor, wenn Menschen aufgrund ihrer Stellung in sozialen Beziehungsgefügen von den wertvollen
Anstöße. Gesellschaftslehre mit Geschichte. Didaktische Jahresplanung Berufsfeld Erziehung und Soziales
 Anstöße Gesellschaftslehre mit Geschichte Didaktische Jahresplanung Berufsfeld Erziehung und Soziales Didaktische Jahresplanung Gesellschaftslehre mit Geschichte Berufsfeld Erziehung und Soziales Schule
Anstöße Gesellschaftslehre mit Geschichte Didaktische Jahresplanung Berufsfeld Erziehung und Soziales Didaktische Jahresplanung Gesellschaftslehre mit Geschichte Berufsfeld Erziehung und Soziales Schule
Eine soziale Wohnungspolitik
 Eine soziale Wohnungspolitik Vorschläge für eine Weiterentwicklung Dr. Karl Bronke Anspruch Jeder Bewohner der Freien Hansestadt Bremen hat einen Anspruch auf eine angemessene Wohnung. Es ist Aufgabe des
Eine soziale Wohnungspolitik Vorschläge für eine Weiterentwicklung Dr. Karl Bronke Anspruch Jeder Bewohner der Freien Hansestadt Bremen hat einen Anspruch auf eine angemessene Wohnung. Es ist Aufgabe des
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Deutschland Die deutschen Staaten vertiefen ihre Teilung
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Deutschland 1949-1961 - Die deutschen Staaten vertiefen ihre Teilung Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Deutschland 1949-1961 - Die deutschen Staaten vertiefen ihre Teilung Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Arbeitsmarkt 09.01.2014 Lesezeit 4 Min Vor hundert Jahren war Deutschland ein prosperierendes Land. Zu Zeiten des Kaiserreichs wuchs die Bevölkerung
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Arbeitsmarkt 09.01.2014 Lesezeit 4 Min Vor hundert Jahren war Deutschland ein prosperierendes Land. Zu Zeiten des Kaiserreichs wuchs die Bevölkerung
Industrialisierung Von der Manufaktur zur Massenproduktion
 Industrialisierung Von der Manufaktur zur Massenproduktion Rahmenbedingungen Zielgruppe Gymnasium: 8., 9. und 11. Klasse Realschule: 8. und 9. Klasse Hauptschule: 8. Klasse Dauer: 1,5 Stunden Gruppenteilung:
Industrialisierung Von der Manufaktur zur Massenproduktion Rahmenbedingungen Zielgruppe Gymnasium: 8., 9. und 11. Klasse Realschule: 8. und 9. Klasse Hauptschule: 8. Klasse Dauer: 1,5 Stunden Gruppenteilung:
Die Abhängigen von morgen
 Georges T. Roos, Zukunftsforscher ROOS Büro für Kulturelle Innovation Die Abhängigen von morgen Die Ansprüche der Generation, welche das Wirtschaftswunder geschaffen hat CURAVIVA Fachtagung Abhängigkeit
Georges T. Roos, Zukunftsforscher ROOS Büro für Kulturelle Innovation Die Abhängigen von morgen Die Ansprüche der Generation, welche das Wirtschaftswunder geschaffen hat CURAVIVA Fachtagung Abhängigkeit
Einstellung zu Institutionen in den Sinus-Milieus
 Einstellung zu Institutionen in den -Milieus Austrian Online Pool ermöglicht Zielgruppen-Segmentierung Gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten steht das Vertrauen der Bevölkerung gegenüber öffentlichen
Einstellung zu Institutionen in den -Milieus Austrian Online Pool ermöglicht Zielgruppen-Segmentierung Gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten steht das Vertrauen der Bevölkerung gegenüber öffentlichen
Sachkompetenzen ordnen historische Ereignisse, Personen, Prozesse und Strukturen in einen chronologischen, räumlichen und sachlichthematischen
 Qualifikationsphase 1: Unterrichtsvorhaben II Thema: Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise I Übergeordnete Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler Sachkompetenzen ordnen historische
Qualifikationsphase 1: Unterrichtsvorhaben II Thema: Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise I Übergeordnete Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler Sachkompetenzen ordnen historische
Soziologie. Bildungsverlag EINS a Wolters Kluwer business. Sylvia Betscher-Ott, Wilfried Gotthardt, Hermann Hobmair, Wilhelm Ott, Rosemarie Pöll
 Sylvia Betscher-Ott, Wilfried Gotthardt, Hermann Hobmair, Wilhelm Ott, Rosemarie Pöll Herausgeber: Hermann Hobmair Soziologie 1. Auflage Bestellnummer 05006 Bildungsverlag EINS a Wolters Kluwer business
Sylvia Betscher-Ott, Wilfried Gotthardt, Hermann Hobmair, Wilhelm Ott, Rosemarie Pöll Herausgeber: Hermann Hobmair Soziologie 1. Auflage Bestellnummer 05006 Bildungsverlag EINS a Wolters Kluwer business
Urbanisierung, (Globalisierung,) demografischer Wandel
 , (Globalisierung,) demografischer Wandel Was bedeutet das für den Gartenbau? Detlev Reymann Zierpflanzentag Südwest 2014 Hochschule Geisenheim, 5. November 2014 Beruflicher Werdegang 1976-1979 Ausbildung
, (Globalisierung,) demografischer Wandel Was bedeutet das für den Gartenbau? Detlev Reymann Zierpflanzentag Südwest 2014 Hochschule Geisenheim, 5. November 2014 Beruflicher Werdegang 1976-1979 Ausbildung
und Integration Sozialstruktur SoSe2013
 Migration, Globalisierung und Integration Vorlesung 9 Sozialstruktur SoSe2013 1 Vier verbundene Themen Migration: Geschichte und Fakten der Migration in Deutschland Von Migration zu Integration im Kontext
Migration, Globalisierung und Integration Vorlesung 9 Sozialstruktur SoSe2013 1 Vier verbundene Themen Migration: Geschichte und Fakten der Migration in Deutschland Von Migration zu Integration im Kontext
Segregation und Raumeinheit
 1. Teil: Theoretischer Hintergrund Hartmut Häußermann Professor für Stadt- und Regionalsoziologie an der HU Berlin http://www2.hu-berlin.de/stadtsoz/ Segregation und Raumeinheit Unterschicht Mittelschicht
1. Teil: Theoretischer Hintergrund Hartmut Häußermann Professor für Stadt- und Regionalsoziologie an der HU Berlin http://www2.hu-berlin.de/stadtsoz/ Segregation und Raumeinheit Unterschicht Mittelschicht
Werthaltungen, Lebensstile und Gesundheitsverhalten anhand der Sinus-Milieus
 Werthaltungen, Lebensstile und Gesundheitsverhalten anhand der Sinus-Milieus Luzern, 29. Januar 2015 1 Gesundheitsbereich im Wandel Demografisch & soziokulturell Immer mehr ältere Menschen Mehr Ausgaben
Werthaltungen, Lebensstile und Gesundheitsverhalten anhand der Sinus-Milieus Luzern, 29. Januar 2015 1 Gesundheitsbereich im Wandel Demografisch & soziokulturell Immer mehr ältere Menschen Mehr Ausgaben
Anthony Giddens. Soziologie
 Anthony Giddens Soziologie herausgegeben von Christian Fleck und Hans Georg Zilian übersetzt nach der dritten englischen Auflage 1997 von Hans Georg Zilian N A U S N E R X _ N A U S N E R Graz-Wien 1999
Anthony Giddens Soziologie herausgegeben von Christian Fleck und Hans Georg Zilian übersetzt nach der dritten englischen Auflage 1997 von Hans Georg Zilian N A U S N E R X _ N A U S N E R Graz-Wien 1999
Die Sinus-Milieus in der Schweiz
 Die Sinus-Milieus in der Schweiz Wolfgang Plöger Sinus Sociovision Die Sinus-Milieus Ergebnis von mehr als zwei Jahrzehnten sozialwissenschaftlicher Forschung Abbild der gesellschaftlichen Strukturen und
Die Sinus-Milieus in der Schweiz Wolfgang Plöger Sinus Sociovision Die Sinus-Milieus Ergebnis von mehr als zwei Jahrzehnten sozialwissenschaftlicher Forschung Abbild der gesellschaftlichen Strukturen und
Arm und Reich in Deutschland: Wo bleibt die Mitte?
 Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 89 Judith Niehues / Thilo Schaefer / Christoph Schröder Arm und Reich in Deutschland: Wo bleibt die Mitte? Definition, Mythen und Fakten
Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 89 Judith Niehues / Thilo Schaefer / Christoph Schröder Arm und Reich in Deutschland: Wo bleibt die Mitte? Definition, Mythen und Fakten
Soziologie. ~.Bildungsverlag EINS a WeIters Kluwer business. Sylvia Betscher-Olt, Wilfried Golthardt, Hermann Hobmair, Wilhelm Olt, Rosemarie Pöll
 , ".. -, Sylvia Betscher-Olt, Wilfried Golthardt, Hermann Hobmair, Wilhelm Olt, Rosemarie Pöll Herausgeber: Hermann Hobmair Soziologie 1, Auflage Bestellnummer 05006 ~.Bildungsverlag EINS a WeIters Kluwer
, ".. -, Sylvia Betscher-Olt, Wilfried Golthardt, Hermann Hobmair, Wilhelm Olt, Rosemarie Pöll Herausgeber: Hermann Hobmair Soziologie 1, Auflage Bestellnummer 05006 ~.Bildungsverlag EINS a WeIters Kluwer
Die Hälfte der Deutschen tanzt am tanzfreudigsten sind die Jüngeren und die Älteren
 PRESSEMITTEILUNG, Heidelberg im April 2017 Die Hälfte der Deutschen tanzt am tanzfreudigsten sind die Jüngeren und die Älteren SINUS-Umfrage zum Welttanztag: Beim Tanzen stehen Spaß, Fitness und die Flucht
PRESSEMITTEILUNG, Heidelberg im April 2017 Die Hälfte der Deutschen tanzt am tanzfreudigsten sind die Jüngeren und die Älteren SINUS-Umfrage zum Welttanztag: Beim Tanzen stehen Spaß, Fitness und die Flucht
Fernere Lebenserwartung im Alter von 60 Jahren nach Geschlecht, 1871 bis 2060* 19,1 17,8 16,5
 Fernere Lebenserwartung im Alter von 60 Jahren nach Geschlecht, 1871 bis 2060* Jahre 28 26 24 * Stand bis einschließlich 2008/2010: 2012, Stand Vorausberechnung: Ende 2009. Deutsches Reich Westdeutschland
Fernere Lebenserwartung im Alter von 60 Jahren nach Geschlecht, 1871 bis 2060* Jahre 28 26 24 * Stand bis einschließlich 2008/2010: 2012, Stand Vorausberechnung: Ende 2009. Deutsches Reich Westdeutschland
Kindheit. Vorlesung WS 2006/07. Prof. Dr. Hans-Günther Roßbach. Dreiteilung der Elementar- und Familienpädagogik. Institutionen Familie Kindheit
 Lehrstuhl für Elementar- und Familienpädagogik Vorlesung Kindheit WS 2006/07 Prof. Dr. Hans-Günther Roßbach WS 2006/07 Vorlesung Kindheit 1 Dreiteilung der Elementar- und Familienpädagogik in Bamberg:
Lehrstuhl für Elementar- und Familienpädagogik Vorlesung Kindheit WS 2006/07 Prof. Dr. Hans-Günther Roßbach WS 2006/07 Vorlesung Kindheit 1 Dreiteilung der Elementar- und Familienpädagogik in Bamberg:
Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
 Geisteswissenschaft Marian Berginz Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen Studienarbeit Marian Berginz WS 04/05 Soziologische Theorien Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
Geisteswissenschaft Marian Berginz Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen Studienarbeit Marian Berginz WS 04/05 Soziologische Theorien Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
Volkshochschule Salzburg Strategie-Entwicklung
 Volkshochschule Salzburg Strategie-Entwicklung Themen Struktur der Volkshochschule Salzburg Gibt es die Mittelschicht noch? Wer sind unsere TEilnehmerInnen? Analyse der Fachbereiche, Beispiel: Gesundheit
Volkshochschule Salzburg Strategie-Entwicklung Themen Struktur der Volkshochschule Salzburg Gibt es die Mittelschicht noch? Wer sind unsere TEilnehmerInnen? Analyse der Fachbereiche, Beispiel: Gesundheit
Definition Soziologie / Weber
 Einführung in die Politische Soziologie Prof. Dr. Walter Eberlei Fachhochschule Düsseldorf Definition Soziologie / Weber Max Weber (1864-1920) Soziologie soll heißen: Eine Wissenschaft, welche soziales
Einführung in die Politische Soziologie Prof. Dr. Walter Eberlei Fachhochschule Düsseldorf Definition Soziologie / Weber Max Weber (1864-1920) Soziologie soll heißen: Eine Wissenschaft, welche soziales
Delmenhorst - Migranten und Wohnungsmarktstrategie
 Delmenhorst - Migranten und Wohnungsmarktstrategie Stadt Delmenhorst Geschäftsbereich Wirtschaft Fachdienst Stadtentwicklung und Statistik Niedersachsenforum am 23. September 2010, Veranstaltungszentrum
Delmenhorst - Migranten und Wohnungsmarktstrategie Stadt Delmenhorst Geschäftsbereich Wirtschaft Fachdienst Stadtentwicklung und Statistik Niedersachsenforum am 23. September 2010, Veranstaltungszentrum
Inhalte und Kategorien Grundbegriffe Basiskompetenzen Methodenschwerpunkte / Medien Evaluation Zeitansatz/ Stunde (Vorschlag)
 Klasse 9 Besonderheiten: 1 Längsschnitt Inhalte und Kategorien Grundbegriffe Basiskompetenzen Methodenschwerpunkte / Medien Evaluation Zeitansatz/ Stunde (Vorschlag) Die weltweite Auseinadersetzung um
Klasse 9 Besonderheiten: 1 Längsschnitt Inhalte und Kategorien Grundbegriffe Basiskompetenzen Methodenschwerpunkte / Medien Evaluation Zeitansatz/ Stunde (Vorschlag) Die weltweite Auseinadersetzung um
Je mehr die Selbständigkeit und Eigenständigkeit eingeschränkt sind, desto mehr wird auf Angebote zur Unterstützung zurückgegriffen.
 Einleitung Im Laufe des Lebens wandeln sich die Bedürfnisse des Menschen: Während für die Jugend Freizeitaktivitäten und Bildungsangebote im Vordergrund stehen, interessiert sich die erwerbstätige Bevölkerung
Einleitung Im Laufe des Lebens wandeln sich die Bedürfnisse des Menschen: Während für die Jugend Freizeitaktivitäten und Bildungsangebote im Vordergrund stehen, interessiert sich die erwerbstätige Bevölkerung
Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst
 Politik Frank Hoffmann Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1.Einleitung...S. 2 2.Die Renaissance... S. 3 3. Das Leben
Politik Frank Hoffmann Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1.Einleitung...S. 2 2.Die Renaissance... S. 3 3. Das Leben
Sponsorenunterlagen zur Ausstellung: In der Zukunft leben. Die Prägung der Stadt durch den Nachkriegsstädtebau
 Sponsorenunterlagen zur Ausstellung: In der Zukunft leben Die Prägung der Stadt durch den Nachkriegsstädtebau Halle Bremen Friedrichshafen Suhl Dresden - Darmstadt Eine Ausstellung des Bundes Deutscher
Sponsorenunterlagen zur Ausstellung: In der Zukunft leben Die Prägung der Stadt durch den Nachkriegsstädtebau Halle Bremen Friedrichshafen Suhl Dresden - Darmstadt Eine Ausstellung des Bundes Deutscher
Alleinlebende nach Familienstand
 In absoluten Zahlen und Anteile, 2011 Männer gesamt: 7.420 Tsd. (46,7%) verwitwet: 3.580 Tsd. (22,5%) : 506 Tsd. (3,2%) verwitwet: 829 Tsd. (5,2%) ledig: 3.087 Tsd. (19,4%) geschieden: 1.401 Tsd. (8,8%)
In absoluten Zahlen und Anteile, 2011 Männer gesamt: 7.420 Tsd. (46,7%) verwitwet: 3.580 Tsd. (22,5%) : 506 Tsd. (3,2%) verwitwet: 829 Tsd. (5,2%) ledig: 3.087 Tsd. (19,4%) geschieden: 1.401 Tsd. (8,8%)
6. Einheit Wachstum und Verteilung
 6. Einheit Wachstum und Verteilung Wirtschaftswachstum und Wohlstand (1) Wachstum: Wirtschaftswachstum = Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts real = zu konstanten Preisen Beispiele (2006): Österreich:
6. Einheit Wachstum und Verteilung Wirtschaftswachstum und Wohlstand (1) Wachstum: Wirtschaftswachstum = Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts real = zu konstanten Preisen Beispiele (2006): Österreich:
Einführung in Problematik und Zielsetzung soziologischer Theorien
 Fabian Karsch Lehrstuhl für Soziologie. PS: Einführung in soziologische Theorien, 23.10.2006 Einführung in Problematik und Zielsetzung soziologischer Theorien Was ist eine Theorie? Eine Theorie ist ein
Fabian Karsch Lehrstuhl für Soziologie. PS: Einführung in soziologische Theorien, 23.10.2006 Einführung in Problematik und Zielsetzung soziologischer Theorien Was ist eine Theorie? Eine Theorie ist ein
