Einleitung. Irene Pieper und Dorothee Wieser
|
|
|
- Melanie Adler
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2 Irene Pieper und Dorothee Wieser Einleitung Während die Frage, wie viel und welches grammatische Wissen in der Schule vermittelt werden soll, schon seit geraumer Zeit ein zentrales, wenngleich dauerhaft strittiges Thema der Sprachdidaktik ausmacht, ist für die Literaturdidaktik die Frage nach den zu vermittelnden Wissensbeständen eher randständig gewesen. Zwei kontroverse Themen bilden eine Ausnahme: das Wissen um Epochen und dessen Struktur und Funktion im Literaturunterricht einerseits, der Bereich der textanalytischen Verfahren andererseits. Die Diskussion über zu unterrichtende Wissensaspekte und Werkzeuge der Analyse und Interpretation konzentrierte sich dabei natürlich auch bedingt durch die Vorgaben der Einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur und des Lehrplans auf die Sekundarstufe II, allenfalls noch auf das Ende der Sekundarstufe I, denn irgendwann sollte, so ließe sich die curriculare Orientierung paraphrasieren, die Ausbildung elaborierterer Auslegungspraktiken ja beginnen. Recht eindeutig sind die Curricula, was die Vermittlung von Kenntnissen über Gattungen und ihre Kennzeichen angeht; diese Inhalte spielen ab der Primarstufe eine Rolle, auch hier wird aber erst in jüngerer Zeit eine intensivere Diskussion geführt. Ein Grund für die eher zurückhaltende Auseinandersetzung mit Fragen der Präzisierung dessen, was fachliches Wissen ausmachen sollte und wie es auszubilden wäre, dürfte darin liegen, dass sie einer Lernerorientierung, die die Dimensionen Lesemotivation und Lesefreude ernst nimmt und anzielt, eher fremd gegenüber zu stehen scheint. Handelt es sich bei der literarhistorisch informierten Lektüre nicht eher um eine Expertenpraxis, deren Ideal allzu unvermittelt, noch dazu verkürzt aus dem Wissenschaftsdiskurs übernommen wird (vgl. Brüggemann 2009)? Und sollen Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe I und II wirklich in der Methode des Textverhörs (Abraham 1994: 76) ausgebildet werden? Steht die Orientierung an einer solchen Lektüre, literarhistorisch informiert und formal geschult, der intensiven und subjektiv relevanten Auseinandersetzung mit Literatur nicht eher entgegen, zeichnet sie nicht vielmehr verantwortlich für die Motivationsverluste von Schülern und Schülerinnen der Sekundarstufen? So lautet ein bekannter Einwand der Lesesozialisationsforschung (vgl. Pieper 2011). In letzter Zeit erscheint die Diskussion um die fachliche Seite auch des literarischen Lesens allerdings in neuem Licht. Die gegenwärtig zu beobachtende Belebung der fachdidaktischen Forschung zu Fragen der Wissensvermittlung im Literaturunterricht (vgl. z.b. Winkler 2007, Kämper-van den Boogaart/Pieper
3 8 Irene Pieper und Dorothee Wieser 2008) steht vor allem mit den Bemühungen um die Modellierung literarischer Kompetenz in Zusammenhang. Denn bei der Beschreibung der Teilkompetenzen oder der Aspekte literarischen Lernens (vgl. z.b. Zabka 2006, Spinner 2006, Pieper 2009) eröffnet sich nicht nur das Problem, inwiefern die jeweils beschriebenen Kompetenzen unabhängig von konkreten literarischen Texten gedacht werden können, sondern auch die Wissensbasiertheit der Kompetenzen rückt in den Blick, insbesondere wenn man den Erwerb der entsprechenden Kompetenzen näher betrachtet. Hier ergibt sich ein Zusammenhang mit der lesedidaktischen Einsicht, wonach das Vorwissen, ein freilich sehr unspezifischer Bereich, für die Bedeutungskonstruktion zentral ist. Die kognitionspsychologische Forschung weist beispielsweise auf die Bedeutung von Superstrukturen hin, die den Leseprozess mit steuern, womit mindestens das fachliche Wissen um Genres angesprochen ist. Dass die Frage nach der Spezifik und Bedeutung literaturbezogener Wissensbestände zahlreiche Facetten aufweist und zu sehr ergiebigen Diskussionen führen kann, hat die Sektion Fachliches Wissen und literarisches Verstehen beim Bremer Symposion Deutschdidaktik 2010 mehrfach deutlich werden lassen. Gleichzeitig wurde erkennbar, dass die Auseinandersetzung mit dem fachlichen Wissen unter Einschluss theoretischer und empirischer Perspektiven einer Vertiefung bedarf. Aus diesem Grund erschien es uns sinnvoll, ausgehend von der Sektionsarbeit mit diesem Band eine differenziertere Entfaltung der Thematik anzubieten. In der Zusammenschau der Beiträge werden neben vielen sich gegenseitig erhellenden Befunden einige fruchtbare und deshalb weiterzuführende Kontroversen erkennbar. So stellt sich beispielsweise die Frage, inwiefern literaturwissenschaftliches Wissen und literaturwissenschaftliche Diskurse als Orientierung für literarische Verstehensprozesse in schulischen Kontexten dienen können. Im Zusammenhang der Klärung des Stellenwertes literaturwissenschaftlicher Diskussionen beispielsweise im Kontext von Gattungen, Epochen oder narratologischen Strukturen ist dabei zwischen der literaturdidaktischen Modellierung von anzustrebenden Verstehensleistungen, der Planung von unterrichtlichen Erwerbssituationen und der Analyse von empirisch dokumentierten Verstehensprozessen von Schülerinnen und Schülern zu differenzieren. Denn je nach Kontext werden die Antworten sehr verschieden ausfallen. Kategorien, die für die differenzierte Beschreibung von Schüleräußerungen zu literarischen Texten erhellend sind, können, wenn man versucht, sie den Schülerinnen und Schülern als Verstehenswerkzeuge in die Hand zu geben, hinderlich sein. Die Frage, was verstehensförderliches Wissen ausmacht und wie es erworben werden kann, ist wiederum weder unabhängig von den Wissensbereichen (z.b. literarhistorisches, narratologisches oder Gattungswissen) noch von den
4 Einleitung 9 normativen Erwartungen hinsichtlich der als angemessen erachteten Verstehensleistungen zu beantworten. Strittig scheinen in diesem Zusammenhang bezüglich der Wissensbestände insbesondere die Aspekte Strukturiertheit und Explizitheit. Muss in manchen Bereichen zunächst Wissen strukturiert und damit möglicherweise auch in gewissen Punkten schematisch erworben werden, damit es im nächsten Entwicklungsschritt einer flexiblen Verwendung zugeführt werden kann? Oder sollte nicht viel eher mit einem impliziten literarischen Wissen der Schüler und Schülerinnen gerechnet werden, an das anzuknüpfen wäre? 1 Ist die Annahme berechtigt, dass die Kenntnis spezifischer Wissensbestände etwa im Bereich der narrativen Analyse den Blick für entsprechende Phänomene im Text schärft und auch für dessen Verständnis wirksam wird? Damit verknüpft ist auch die Frage nach der Bewertung von scheinbar rein schematischen Analyseergebnissen, welche die Schülerinnen und Schüler in ihren Interpretationen aufzeigen, deren Ertrag im Sinne von Einsichten in die literarischen Texte aber nicht deutlich wird. Sind diese als ein Ausweis der verfehlten Vermittlungsmethoden zu betrachten oder vielleicht doch eher als eine notwendige Verstehensstufe, vergleichbar mit den Übergeneralisierungen im Orthographie- oder Zweitspracherwerb? Des Weiteren zeigt sich in den Beiträgen aber auch deutlich, dass für die Fortführung der hier aufgezeigten Diskussionsstränge dringend eine explizite konzeptionelle Arbeit geboten scheint. Begriffe wie domänenspezifisches, deklaratives, prozedurales, substantivisches, syntaktisches Wissen oder im Bereich der Lehrerforschung pedagocical content knowledge, practical professional knowledge und epistemologische Überzeugungen sind inzwischen auch in der Literaturdidaktik geläufig, werden aber nur bedingt reflektiert. Es wäre eine vollkommen überzogene Forderung, von der Literaturdidaktik zu erwarten, diese (vielleicht notwendig) unscharfen Begriffe in klare Konstrukte zu überführen. Wichtig erscheint aber eine Explikation der mit diesen Begriffen verbundenen Konzepte aus einer literaturdidaktischen Perspektive. Der vorliegende Band eröffnet vielfältige Sichtweisen auf das Verhältnis von fachlichem Wissen und literarischem Verstehen. Im ersten Teil finden sich Beiträge, die sich aus verschiedenen Perspektiven und mit unterschiedlichen Akzentuierungen zum einen Fragen der Konstitution und Konstruktion von Wissen im Literaturunterricht widmen, zum anderen die Potentiale aktueller literaturwissenschaftlicher Modellierungen für literaturdidaktische Fragestellungen ausloten. Dabei eröffnet der Beitrag von Sandrine Aeby und Bernard Schneuwly Einsichten in das Konzept der didaktischen Transposition, mit welchem in der fran- 1 Vgl. zu diesen Fragen insbesondere den Beitrag von Thomas Zabka in diesem Band.
5 10 Irene Pieper und Dorothee Wieser zösischsprachigen Didaktik der Versuch unternommen wird, den Prozess der Wissenstransformation vom Wissensgegenstand zum unterrichteten Gegenstand zu rekonstruieren. Am Beispiel von Voltaires De l horrible danger de la lecture zeigen sie, welche Veränderungen dieser Text im Rahmen der externen didaktischen Transposition (hier beispielhaft an einem Lehrbuch) und im Kontext der internen didaktischen Transposition in der unterrichtlichen Interaktion erfährt. Thomas Zabka fokussiert gleichfalls die Wissensvermittlungsprozesse im Literaturunterricht. Ausgehend von der Frage, warum trotz der allgegenwärtigen Kritik an funktionslosen Analyseritualen ebendiese weiterhin den Literaturunterricht prägen, erläutert er verschiedene Überzeugungen, welche diese unterrichtlichen Konventionen möglicherweise begründen. Damit eröffnet er zum einen spannende Fragen für nun notwendige empirische Untersuchungen, zum anderen unterbreitet Thomas Zabka aber auch einen Vorschlag, wie im Unterricht Analyse- und Interpretationsprozesse sinnvoll miteinander verknüpft werden können. Dass fachliches Wissen im Literaturunterricht durchaus dem literarischen Verstehen entgegenstehen kann, ist auch der Ausgangspunkt der Überlegungen von Kaspar H. Spinner, der diesen Befund zunächst an den als zentral erachteten Wissensfeldern des Literaturunterrichts veranschaulicht und anschließend Wege aufzeigt, wie Wissenserwerbsprozesse, die beispielsweise auf prototypisches oder episodisches Wissen ausgerichtet sind, konstruktiv im Unterricht gestaltet werden können. Nähert man sich der Frage nach Prozessen der Wissensvermittlung im Literaturunterricht, sind neben der Analyse konkreter unterrichtlicher Interaktionen die Lehrwerke von besonderem Interesse. Daniela A. Frickel untersucht in ihrem Beitrag eine breite Palette von Lehrwerken für die Sekundarstufen I und II im Hinblick auf deren Vermittlung bzw. Nicht-Vermittlung von Gattungswissen im Kontext von Kleiner Prosa. Hier wird also ein Element der externen didaktischen Transposition rekonstruiert und kritisch hinterfragt. Mit der Reflexion aktueller Ansätze in der Narratologie wird von Tatjana Jesch ein anderer zentraler Wissensbereich in den Blick genommen, wobei sie strukturelle und kognitionspsychologische Ansätze aufschlussreich zusammenführt. Am Beispiel der Kurzgeschichte Neapel sehen von Kurt Marti zeigt sie auf, wie die Kategorien zur Klärung der narrativen Perspektive beitragen können, und sie diskutiert, wie diese Teilkompetenz gefördert und in Tests überprüft werden könnte. Eine scheinbar allseits geteilte Position die Notwendigkeit, Wissen im Kontext literarischer Verstehensprozesse zu funktionalisieren ist Gegenstand des Beitrags von Michael Steinmetz. Auf der Basis der Analyse von curricularen
6 Einleitung 11 Vorgaben und Abiturklausuren beleuchtet er die mit dem Funktionalisierungsgebot verbundenen Probleme und Herausforderungen. Dass alle Bemühungen um Verbesserungen in Hinblick auf die Vermittlung fachlicher Wissensbestände im Literaturunterricht auch die Lehrenden und deren Perspektive auf die fachliche Wissensbasis des Literaturunterrichts und Erwerbsprozesse mit berücksichtigen müssen, macht Dorothee Wieser deutlich. Der Beitrag legt aber auch offen, dass sowohl die Operationalisierung der Konstrukte im Kontext professioneller Wissensbestände als auch die empirische Rekonstruktion derselben eine Herausforderung darstellen. Den Herausforderungen, vor allem aber auch den Potentialen, die mit empirischen Untersuchungen von literarischen Verstehensprozessen von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Altersstufen verbunden sind, widmet sich der zweite Teil des Bandes. Wie auch in den meisten anderen Studien, die hier vorgestellt werden, arbeitet Tobias Stark mit der Methode des Lauten Denkens und rekonstruiert eindrücklich an einem Fallbeispiel den Verstehensprozess einer Schülerin, welche sich in der Auseinandersetzung mit der Perspektivierung der vorgelegten Erzählung durchaus richtige Frage stellt und doch fehlgeht. Dieses und andere Beispiele aus der Studie von Tobias Stark lassen erkennen, wo unterrichtliche Lehr- und Lernprozesse ansetzen könnten. Die Methode des Lauten Denkens, die gegenwärtig in einer Vielzahl literaturdidaktischer Untersuchungen zum Einsatz kommt, wirft natürlich die Frage der Auswertung der gewonnenen Daten in besonderer Weise auf. Mit diesem Thema setzen sich zum einen Irene Pieper und Dorothee Wieser in ihrem Beitrag zum Metaphernverstehen im Umgang mit lyrischen Texten auseinander, in dem es neben der Rekonstruktion von Interpretationsoperationen bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I zentral auch um die Diskussion des entwickelten Kodiersystems geht. Zum anderen stellt Jessica Gahn erste Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zu Strategien im Umgang mit literarischen Texten, welche die Kohärenzetablierung erschweren, vor. In dieser Studie wurde das von Grzesik et al. entwickelte Kategoriensystem für literarische Verstehensoperationen in seiner Anwendung auf Lautes-Denken-Protokolle erprobt. Eine gänzlich anders gelagerte Auswertung solcher Protokolle findet sich in dem Beitrag von Almuth Meissner, welche die Dokumentarische Methode zur Rekonstruktion von Strategien im Umgang mit einem Sonett von Durs Grünbein nutzt. Dabei zeigt sie sehr anschaulich, dass die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe in der Konfrontation mit diesem für sie sperrigen literarischen Text auf Strategien der Narrativisierung zurückgreifen. Aber nicht nur im Rahmen von qualitativen Studien wird der Versuch unternommen, Einfluss und Erwerb von domänenspezifischen Wissensbeständen zu
7 12 Irene Pieper und Dorothee Wieser untersuchen. Christel Meier, Sofie Henschel, Thorsten Roick und Volker Frederking zeigen in ihrem Beitrag zunächst die Bemühungen im Kontext der Aufgabenkonstruktion im DFG-Projekt Literarästhetische Urteilskompetenz auf, den Einfluss des Vorwissens zu minimieren. In einem nächsten Schritt diskutieren sie auf der Basis erster Ergebnisse, wie im Rahmen einer experimentell angelegten Studie auch der Aspekt des Vorwissens gezielt untersucht werden kann. Dass die Diskussion um die angemessene und gewinnbringende Vermittlung literarhistorischen Wissens nach wie vor aktuell ist und dass auch hier eine empirische Fundierung und Überprüfung der Thesen zwingend erscheint, machen die beiden Beiträge, die den Band beschließen, deutlich. Ricarda Freudenberg belegt sehr anschaulich in der Auseinandersetzung mit Abiturklausuren zu einem Sonett von Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau die auch im Beitrag von Kaspar H. Spinner geäußerte Beobachtung, dass die von den Schülerinnen und Schülern mühsam erworbenen Wissensbestände dem Verstehensprozess nicht zwingend zuträglich sind, vor allem dann, wenn sie sich mit Texten konfrontiert sehen, die einen flexiblen und damit auch wagnishaften Umgang mit Vorwissen erfordern. Der Beitrag von Jörn Brüggemann wiederum zeigt aber, dass die literaturdidaktische Reaktion auf diese Probleme der Schülerinnen und Schüler sowie auf die literaturwissenschaftlichen Diskussionen um Epochenkonzepte, von einer systematischen Wissensvermittlung Abstand zu nehmen und eher auf Dekonstruktion zu setzen, gleichfalls nicht unhinterfragt bleiben sollte. Wir danken Dr. Silke Kubik, Marie Lessing, Wiebke Stabenow und Jolene Triebel für die aufmerksame Lektüre der Beiträge, die anregenden Gespräche sowie für die Unterstützung bei der Endredaktion. Literatur Abraham, Ulf: Lesarten Schreibarten. Stuttgart: Klett 1994 Brüggemann, Jörn: Literarisches Lesen Historisches Verstehen. Zur Explikation einer unterbewerteten Komponente literarischer Rezeptionskompetenz. In: Didaktik Deutsch 15 (2009), Heft 26, Kämper-van den Boogaart, Michael/Pieper, Irene: Literarisches Lesen. In: Didaktik Deutsch. Sonderheft (2008), S Pieper, Irene: Literarische Kompetenz: Zentrum oder Peripherie der Kompetenzdiskussion? In: Hochreiter, Susanne/Klingenböck, Ursula/Stuck, Elisabeth/Thielking, Sigrid/Wintersteiner, Werner (Hrsg.): Schnittstellen. Aspekte der Literaturlehr- und -lernforschung. Innsbruck: StudienVerl (ide-extra, 14), Pieper, Irene: Lese- und literarische Sozialisation. In: Kämper-van den Boogaart, Michael/ Spinner, Kaspar H. (Hrsg.): Lese- und Literaturunterricht. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren 2010 (Deutschunterricht in Theorie und Praxis: dtp 11/1),
Praxissemester Ein Spiel für Studierende von 23 bis 99 Jahren
 Das Begleitseminar zum Praxissemester Ein Spiel für Studierende von 23 bis 99 Jahren Spielregeln Spielregeln Achtung Baustelle! Spielregeln Achtung Baustelle! Angaben gelten für die Literaturdidaktik Auf
Das Begleitseminar zum Praxissemester Ein Spiel für Studierende von 23 bis 99 Jahren Spielregeln Spielregeln Achtung Baustelle! Spielregeln Achtung Baustelle! Angaben gelten für die Literaturdidaktik Auf
Schreiben in Unterrichtswerken
 Europäische Hochschulschriften 1014 Schreiben in Unterrichtswerken Eine qualitative Studie über die Modellierung der Textsorte Bericht in ausgewählten Unterrichtswerken sowie den Einsatz im Unterricht
Europäische Hochschulschriften 1014 Schreiben in Unterrichtswerken Eine qualitative Studie über die Modellierung der Textsorte Bericht in ausgewählten Unterrichtswerken sowie den Einsatz im Unterricht
Beitrag. Rezensionen
 Rezensionen Taubner, Svenja (2008): Einsicht in Gewalt Reflexive Kompetenz adoleszenter Straftäter beim Täter- Opfer-Ausgleich. Gießen (Psychosozial-Verlag), 349 Seiten, 39,90»Die Integration der Aggression
Rezensionen Taubner, Svenja (2008): Einsicht in Gewalt Reflexive Kompetenz adoleszenter Straftäter beim Täter- Opfer-Ausgleich. Gießen (Psychosozial-Verlag), 349 Seiten, 39,90»Die Integration der Aggression
Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Studiensemester. Leistungs -punkte 8 LP
 Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEd EHRGeM 1 Workload 240 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur
Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEd EHRGeM 1 Workload 240 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur
Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern
 Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern https://cuvillier.de/de/shop/publications/1841 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern https://cuvillier.de/de/shop/publications/1841 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Narrative Computerspiele als Gegenstände literarischen Lernens
 Narrative Computerspiele als Gegenstände literarischen Lernens Jun.-Prof. Dr. Jan M. Boelmann boelmann@ph-ludwigsburg.de PH Ludwigsburg Zum Einstieg Zunehmend lesen Schüler Texte, die sie nicht ausgewählt
Narrative Computerspiele als Gegenstände literarischen Lernens Jun.-Prof. Dr. Jan M. Boelmann boelmann@ph-ludwigsburg.de PH Ludwigsburg Zum Einstieg Zunehmend lesen Schüler Texte, die sie nicht ausgewählt
LehrplanPLUS Gymnasium Geschichte Klasse 6. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. 1. Kompetenzorientierung
 Gymnasium Geschichte Klasse 6 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der neue Lehrplan für das Fach Geschichte ist kompetenzorientiert ausgerichtet. Damit ist die Zielsetzung verbunden, die Lernenden
Gymnasium Geschichte Klasse 6 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der neue Lehrplan für das Fach Geschichte ist kompetenzorientiert ausgerichtet. Damit ist die Zielsetzung verbunden, die Lernenden
Geschichte denken. Zum Umgang mit Geschichte und Vergangenheit von Schüler/innen der Sekundarstufe I am Beispiel "Spielfilm((
 Christoph Kühberger (Hrsg.) Geschichte denken Zum Umgang mit Geschichte und Vergangenheit von Schüler/innen der Sekundarstufe I am Beispiel "Spielfilm(( Empirische Befunde - Diagnostische Tools - Methodische
Christoph Kühberger (Hrsg.) Geschichte denken Zum Umgang mit Geschichte und Vergangenheit von Schüler/innen der Sekundarstufe I am Beispiel "Spielfilm(( Empirische Befunde - Diagnostische Tools - Methodische
Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren?
 Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Studienverlaufsplan Lehramt Bildungswissenschaften Haupt-, Real- und Gesamtschule
 Studienverlaufsplan Lehramt Bildungswissenschaften Haupt-, Real- und Gesamtschule Sem BA-Modul A CP BA-Modul B CP BA-Modul C CP BA-Modul D BA-Modul E CP BA-Modul F CP MA-Modul A CP MA-Modul B C Modul D
Studienverlaufsplan Lehramt Bildungswissenschaften Haupt-, Real- und Gesamtschule Sem BA-Modul A CP BA-Modul B CP BA-Modul C CP BA-Modul D BA-Modul E CP BA-Modul F CP MA-Modul A CP MA-Modul B C Modul D
Deutschunterricht Grundwissen Literatur. Lesegenese in Kindheit und Jugend
 Deutschunterricht Grundwissen Literatur Band 2 Lesegenese in Kindheit und Jugend Einführung in die literarische Sozialisation von Werner Graf Schneider Verlag Hohengehren GmbH Inhaltsverzeichnis V Inhaltsverzeichnis
Deutschunterricht Grundwissen Literatur Band 2 Lesegenese in Kindheit und Jugend Einführung in die literarische Sozialisation von Werner Graf Schneider Verlag Hohengehren GmbH Inhaltsverzeichnis V Inhaltsverzeichnis
Generatives Schreiben anhand des Bilderbuchs: Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte (M.Baltscheit)
 Janina Cyrener und Linn Haselei (September 2016) Generatives Schreiben anhand des Bilderbuchs: Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte (M.Baltscheit) 1. Vorbemerkungen Für die Konzeption der
Janina Cyrener und Linn Haselei (September 2016) Generatives Schreiben anhand des Bilderbuchs: Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte (M.Baltscheit) 1. Vorbemerkungen Für die Konzeption der
Modulverzeichnis Sachunterricht Anlage 3
 1 Modulverzeichnis Sachunterricht Anlage 3 SU-1: Didaktik des Einführung in die grundlegenden Inhalte, Denk- und Arbeitsweisen der Didaktik des Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über den
1 Modulverzeichnis Sachunterricht Anlage 3 SU-1: Didaktik des Einführung in die grundlegenden Inhalte, Denk- und Arbeitsweisen der Didaktik des Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über den
Perspektiven für den Deutschunterricht in der Vorstufe
 Fachtag der Stadtteilschule Feb. 2012 A Perspektiven für den Deutschunterricht in der Vorstufe LI: Renate Schatzmann Klasse 5-10 Klasse 11 Studienstufe Lernstände Ende Kl. 10 Abitur Gliederung 1. Ziele
Fachtag der Stadtteilschule Feb. 2012 A Perspektiven für den Deutschunterricht in der Vorstufe LI: Renate Schatzmann Klasse 5-10 Klasse 11 Studienstufe Lernstände Ende Kl. 10 Abitur Gliederung 1. Ziele
Literarische Kurztexte im DaF-Unterricht des chinesischen Germanistikstudiums
 Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache 84 Literarische Kurztexte im DaF-Unterricht des chinesischen Germanistikstudiums Ein Unterrichtsmodell für interkulturelle Lernziele Bearbeitet von Jingzhu Lü 1.
Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache 84 Literarische Kurztexte im DaF-Unterricht des chinesischen Germanistikstudiums Ein Unterrichtsmodell für interkulturelle Lernziele Bearbeitet von Jingzhu Lü 1.
Weiterbildendes Studienprogramm Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (WBSP DaFZ)
 Modulbeschreibung Weiterbildendes Studienprogramm Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (WBSP DaFZ) Dieser Kurs vermittelt in drei Modulen wesentliche Elemente für einen erfolgreichen fremdsprachlichen Deutschunterricht.
Modulbeschreibung Weiterbildendes Studienprogramm Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (WBSP DaFZ) Dieser Kurs vermittelt in drei Modulen wesentliche Elemente für einen erfolgreichen fremdsprachlichen Deutschunterricht.
Lehrplan Grundlagenfach Französisch
 toto corde, tota anima, tota virtute Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Lehrplan Grundlagenfach Französisch A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 4 3 3 4 B. Didaktische
toto corde, tota anima, tota virtute Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Lehrplan Grundlagenfach Französisch A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 4 3 3 4 B. Didaktische
Einleitung. Was dieses Buch beinhaltet
 LESEPROBE Einleitung Was dieses Buch beinhaltet Dieses Arbeitsbuch nimmt Sprache und Literatur aus der Vermittlungsperspektive in den Blick, d.h. Sprache und Literatur werden sowohl als Medien als auch
LESEPROBE Einleitung Was dieses Buch beinhaltet Dieses Arbeitsbuch nimmt Sprache und Literatur aus der Vermittlungsperspektive in den Blick, d.h. Sprache und Literatur werden sowohl als Medien als auch
Modulhandbuch des Studiengangs Sprachliche Grundbildung im Master of Education - Lehramt an Grundschulen
 Modulhandbuch des Studiengangs Sprachliche Grundbildung im Master of Education Lehramt an Grundschulen 30. August 013 Inhaltsverzeichnis MoEd G: Fachliche Kernkompetenz Sprache...................................
Modulhandbuch des Studiengangs Sprachliche Grundbildung im Master of Education Lehramt an Grundschulen 30. August 013 Inhaltsverzeichnis MoEd G: Fachliche Kernkompetenz Sprache...................................
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
 Ortwin Beisbart/Dieter Marenbach Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Verlag Ludwig Auer Donauwörth Inhalt Vorwort zur 5. Auflage 7 0 Einleitung 9 1 Was ist Didaktik? 11 1.1 Die
Ortwin Beisbart/Dieter Marenbach Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Verlag Ludwig Auer Donauwörth Inhalt Vorwort zur 5. Auflage 7 0 Einleitung 9 1 Was ist Didaktik? 11 1.1 Die
Ergebnis der Gespräche mit den Leitungen der Verlage Klett und Balmer AG, Schulverlag plus AG, Lehrmittelverlag St.Gallen und schulbuchinfo Zürich.
 Informationen aus Lehrmittelverlagen zu geplanten Überarbeitungen und Neuentwicklungen von Lehrmitteln zu den Fachbereichen von NMG auf der Sekundarstufe I und zum Fachbereich Musik Ergebnis der Gespräche
Informationen aus Lehrmittelverlagen zu geplanten Überarbeitungen und Neuentwicklungen von Lehrmitteln zu den Fachbereichen von NMG auf der Sekundarstufe I und zum Fachbereich Musik Ergebnis der Gespräche
2. Sitzung Literatur: Richter, Karin, Hurrelmann Bettina: Kinderliteratur im Unterricht. Theorie und Modelle zur Kinder- und Jugendliteratur im
 2. Sitzung Literatur: Richter, Karin, Hurrelmann Bettina: Kinderliteratur im Unterricht. Theorie und Modelle zur Kinder- und Jugendliteratur im pädagogisch-didaktischen Kontext. München 1998. Lange, G.:
2. Sitzung Literatur: Richter, Karin, Hurrelmann Bettina: Kinderliteratur im Unterricht. Theorie und Modelle zur Kinder- und Jugendliteratur im pädagogisch-didaktischen Kontext. München 1998. Lange, G.:
4 SWS Arbeitsaufwand insgesamt Arbeitsstunden: 180 Anrechnungspunkte: 6 AP Arbeitsaufwand (Std.) Präsenzzeit: bereitung: 60. Vor- u.
 Modul (Modulnr.) SU-1: Didaktik des Sachunterrichts (18010) SU-1.1: Einführung in die Didaktik des Sachunterrichts (18011), Vorlesung, 2 SWS, 2 AP SU-1.2: Entwicklung und Probleme der Didaktik des Sachunterrichts
Modul (Modulnr.) SU-1: Didaktik des Sachunterrichts (18010) SU-1.1: Einführung in die Didaktik des Sachunterrichts (18011), Vorlesung, 2 SWS, 2 AP SU-1.2: Entwicklung und Probleme der Didaktik des Sachunterrichts
Konkretisierung der Ausbildungslinien im Fach Spanisch
 Konkretisierung der slinien im Fach Spanisch Stand: September 2012 slinie Entwicklungsstufen der slinien im VD Gym A: Unterricht konzipieren 1 Den Wortschatz und die Grammatik kommunikationsorientiert
Konkretisierung der slinien im Fach Spanisch Stand: September 2012 slinie Entwicklungsstufen der slinien im VD Gym A: Unterricht konzipieren 1 Den Wortschatz und die Grammatik kommunikationsorientiert
Erste Staatsprüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen. Prüfungsaufgaben Frühjahr 2014
 Fachdidaktik Grundschulen (42317) Differenzierung im Literaturunterricht der Grundschule 1. Stellen Sie zunächst wesentliche Funktionen, Ziele und Organisationsprinzipien der Differenzierung für den Deutschunterricht
Fachdidaktik Grundschulen (42317) Differenzierung im Literaturunterricht der Grundschule 1. Stellen Sie zunächst wesentliche Funktionen, Ziele und Organisationsprinzipien der Differenzierung für den Deutschunterricht
Sachkompetenz: Die Schülerinnen und Schüler erklären komplexe erziehungswissenschaftliche Phänomene (SK 3)
 Konkretisiertes Curriculum swissenschaft in der Q1 1. Halbjahr: Q1 Konkretisiertes Unterrichtsvorhaben I Thema: Lust und Frust Eine pädagogische Sicht auf Modelle psychosexueller und psychosozialer Entwicklung:
Konkretisiertes Curriculum swissenschaft in der Q1 1. Halbjahr: Q1 Konkretisiertes Unterrichtsvorhaben I Thema: Lust und Frust Eine pädagogische Sicht auf Modelle psychosexueller und psychosozialer Entwicklung:
Das Bilanz-und Perspektivgespräch
 Das Bilanz-und Perspektivgespräch Praxissemester: Forum II, 14.02.2014 Workshop Ziele und Programm Austauschphase I Input Erarbeitungsphase Austauschphase II Übergang zur Fachgruppenphase Workshop: Ziele
Das Bilanz-und Perspektivgespräch Praxissemester: Forum II, 14.02.2014 Workshop Ziele und Programm Austauschphase I Input Erarbeitungsphase Austauschphase II Übergang zur Fachgruppenphase Workshop: Ziele
1. Zur Didaktik des Lernbereichs Lesen mit Texten und Medien umgehen
 1. Zur Didaktik des Lernbereichs Lesen mit Texten und Medien umgehen 1.1 Verlaufsmodell der literarischen und Lesesozialisation 1.2 Plateaus der literalen und literarischen Entwicklung 1.3 Aufgaben des
1. Zur Didaktik des Lernbereichs Lesen mit Texten und Medien umgehen 1.1 Verlaufsmodell der literarischen und Lesesozialisation 1.2 Plateaus der literalen und literarischen Entwicklung 1.3 Aufgaben des
Hochschulkonferenz Pädagogische Hochschule FHNW
 Pädagogische Hochschule FHNW Textsorte Brief ist dem Kind bekannt Schreiben ist anstrengend Fehlerhäufung gegen Ende. Doppelkonsonanten: Kernbereich entwickelt Doppelkonsonanten: ab 4. Klasse weiteres
Pädagogische Hochschule FHNW Textsorte Brief ist dem Kind bekannt Schreiben ist anstrengend Fehlerhäufung gegen Ende. Doppelkonsonanten: Kernbereich entwickelt Doppelkonsonanten: ab 4. Klasse weiteres
Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld
 Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
DEU-M Teilnahmevoraussetzungen: a) empfohlene Kenntnisse: b) verpflichtende Nachweise: keine
 DEU-M 420 1. Name des Moduls: Basismodul Fachdidaktik Deutsch (Dritteldidaktik) 2. Fachgebiet / Verantwortlich: Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur / Prof. Dr. Anita Schilcher 3. Inhalte des Moduls:
DEU-M 420 1. Name des Moduls: Basismodul Fachdidaktik Deutsch (Dritteldidaktik) 2. Fachgebiet / Verantwortlich: Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur / Prof. Dr. Anita Schilcher 3. Inhalte des Moduls:
Narrative Kompetenz in der Fremdsprache Englisch
 Fremdsprachendidaktik inhalts- und lernerorientiert / Foreign Language Pedagogy - content- and learneroriented 27 Narrative Kompetenz in der Fremdsprache Englisch Eine empirische Studie zur Ausprägung
Fremdsprachendidaktik inhalts- und lernerorientiert / Foreign Language Pedagogy - content- and learneroriented 27 Narrative Kompetenz in der Fremdsprache Englisch Eine empirische Studie zur Ausprägung
Biografieforschung und arbeit mit ErzieherInnen
 Geisteswissenschaft Katharina Spohn Biografieforschung und arbeit mit ErzieherInnen Examensarbeit Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen, Fachrichtung
Geisteswissenschaft Katharina Spohn Biografieforschung und arbeit mit ErzieherInnen Examensarbeit Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen, Fachrichtung
Die Inhaltsangabe im Deutschunterricht der gymnasialen Mittelstufe in Theorie und Unterrichtspraxis
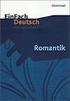 Germanistik Rebecca Mahnkopf Die Inhaltsangabe im Deutschunterricht der gymnasialen Mittelstufe in Theorie und Unterrichtspraxis Formen modernen Aufsatzunterrichts (Sprachdidaktik) Studienarbeit Hauptseminar:
Germanistik Rebecca Mahnkopf Die Inhaltsangabe im Deutschunterricht der gymnasialen Mittelstufe in Theorie und Unterrichtspraxis Formen modernen Aufsatzunterrichts (Sprachdidaktik) Studienarbeit Hauptseminar:
Merkblatt für die mündliche Prüfung
 Universität Bamberg Lehrstuhl Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Professor Dr. Ulf Abraham Merkblatt für die mündliche Prüfung Erstellt durch den Lehrstuhl der Universität Bamberg (Stand: Wintersemester
Universität Bamberg Lehrstuhl Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Professor Dr. Ulf Abraham Merkblatt für die mündliche Prüfung Erstellt durch den Lehrstuhl der Universität Bamberg (Stand: Wintersemester
Inhaltsverzeichnis. Vorwort
 Vorwort V 1 Verhältnis der Sonderpädagogik zur Allgemeinen Pädagogik 1 Martin Sassenroth 1.1 Vorbemerkungen 1 1.2 Entstehungsgeschichte und Definitionen von Heil- und Sonderpädagogik 2 1.2.1 Sonderpädagogik
Vorwort V 1 Verhältnis der Sonderpädagogik zur Allgemeinen Pädagogik 1 Martin Sassenroth 1.1 Vorbemerkungen 1 1.2 Entstehungsgeschichte und Definitionen von Heil- und Sonderpädagogik 2 1.2.1 Sonderpädagogik
Konkretisierte Kompetenzerwartung:
 Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Thema: Ich-Identität: Entwicklung und Verlust von Identität - durch Handlung (J.W. Goethe, Faust I) - durch Sprache Übergeordnete Kompetenzerwartungen: Strategien und
Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Thema: Ich-Identität: Entwicklung und Verlust von Identität - durch Handlung (J.W. Goethe, Faust I) - durch Sprache Übergeordnete Kompetenzerwartungen: Strategien und
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik
 Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Leistungskonzept des Faches Psychologie
 Leistungskonzept des Faches Psychologie Inhalt Kriteriengestützte Korrekturen... 2 Anzahl und Dauer von Klassenarbeiten bzw. Klausuren... 2 Sekundarstufe II... 2 Einführungsphase... 2 Qualifikationsphase...
Leistungskonzept des Faches Psychologie Inhalt Kriteriengestützte Korrekturen... 2 Anzahl und Dauer von Klassenarbeiten bzw. Klausuren... 2 Sekundarstufe II... 2 Einführungsphase... 2 Qualifikationsphase...
Modulhandbuch. für das Fach Sprachliche Grundbildung im Bachelorstudium für das Lehramt an Grundschulen. Universität Siegen Philosophische Fakultät
 Modulhandbuch zur Fachspezifischen Bestimmung (FsB) vom 11. April 2014 (Amtliche Mitteilung Nr. 37/2014) https://www.unisiegen.de/start/news/amtliche_mitteilungen/2014/hp0001.pdf für das Fach Sprachliche
Modulhandbuch zur Fachspezifischen Bestimmung (FsB) vom 11. April 2014 (Amtliche Mitteilung Nr. 37/2014) https://www.unisiegen.de/start/news/amtliche_mitteilungen/2014/hp0001.pdf für das Fach Sprachliche
Inhalt. Abkürzungsverzeichnis 11 Tabellen-und Abbildungsverzeichnis 13
 Inhalt Abkürzungsverzeichnis 11 Tabellen-und Abbildungsverzeichnis 13 1. Einleitung 15 1.1 Hauptschüler und ihre Vorstellungen von Arbeit und Arbeitslosigkeit I 18 1.2 Leitende Thesen der Untersuchung
Inhalt Abkürzungsverzeichnis 11 Tabellen-und Abbildungsverzeichnis 13 1. Einleitung 15 1.1 Hauptschüler und ihre Vorstellungen von Arbeit und Arbeitslosigkeit I 18 1.2 Leitende Thesen der Untersuchung
Dr. Hans Göttler. Hinweisblatt zur Mündlichen Prüfung Fachdidaktik Deutsch (Lehramt Gymnasium)
 Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Dr. Hans Göttler Philosophicum Zi. 385, Innstr. 25, D-94032 Passau Stand: Mai 2009 Tel. 0851/509-2611; Fax 0851/509-2837, E-Mail: Hans.Goettler@uni-passau.de
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Dr. Hans Göttler Philosophicum Zi. 385, Innstr. 25, D-94032 Passau Stand: Mai 2009 Tel. 0851/509-2611; Fax 0851/509-2837, E-Mail: Hans.Goettler@uni-passau.de
Projekt "Geschichte und Politik im Unterricht"
 Projekt "Geschichte und Politik im Unterricht" Kurt Reusser, Monika Waldis, Domenica Fluetsch (Universität Zürich) P. Gautschi (Fachhochschule Aargau) Daniel V. Moser (Institut der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Projekt "Geschichte und Politik im Unterricht" Kurt Reusser, Monika Waldis, Domenica Fluetsch (Universität Zürich) P. Gautschi (Fachhochschule Aargau) Daniel V. Moser (Institut der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Qualifizierung als TrainerIn im Wissenschaftsbereich. Weiterbildungsprogramm
 1 ZWM 2016 Weiterbildungsprogramm 2 Hintergrund und Thematik Zielgruppe Konzept /Methodik Die interne Weiterbildung an Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen umfasst vielfältige Aktivitäten
1 ZWM 2016 Weiterbildungsprogramm 2 Hintergrund und Thematik Zielgruppe Konzept /Methodik Die interne Weiterbildung an Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen umfasst vielfältige Aktivitäten
Bachelor of Arts Sozialwissenschaften und Philosophie (Kernfach Philosophie)
 06-03-101-1 Pflicht Einführung in die Theoretische Philosophie 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und 70 h Seminar "Philosophische
06-03-101-1 Pflicht Einführung in die Theoretische Philosophie 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und 70 h Seminar "Philosophische
PH Ludwigsburg Vorläufige Studienordnung für das Fach Deutsch Grund- und Hauptschule Stand:
 Vorläufige Studienordnung für das Fach Deutsch Grund- und Hauptschule Aufbau und Inhalte des Studiums Das Studium ist in Module gegliedert, die in der Regel aus drei Lehrveranstaltungen (6 SWS) bestehen.
Vorläufige Studienordnung für das Fach Deutsch Grund- und Hauptschule Aufbau und Inhalte des Studiums Das Studium ist in Module gegliedert, die in der Regel aus drei Lehrveranstaltungen (6 SWS) bestehen.
STAATLICHES SEMINAR FÜR DIDAKTIK UND LEHRERBILDUNG (BERUFLICHE SCHULEN) STUTTGART. Entwurf für das Schulpraxissemester 2013
 Entwurf für das Schulpraxissemester 2013 Pädagogik / Pädagogische Psychologie im Schulpraxissemester Im Schulpraxissemester am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen) Stuttgart
Entwurf für das Schulpraxissemester 2013 Pädagogik / Pädagogische Psychologie im Schulpraxissemester Im Schulpraxissemester am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen) Stuttgart
Fachrichtung 4.1 Germanistik
 Fachrichtung 4.1 Germanistik Bereich Fachdidaktik Merkblatt zum fachdidaktischen Prüfungsteil der modularisierten 1. Staatsprüfung im Fach Deutsch (Schwerpunkt: Literaturdidaktik) für Studierende der Lehrämter
Fachrichtung 4.1 Germanistik Bereich Fachdidaktik Merkblatt zum fachdidaktischen Prüfungsteil der modularisierten 1. Staatsprüfung im Fach Deutsch (Schwerpunkt: Literaturdidaktik) für Studierende der Lehrämter
Pädagogik. Wiebke Vieljans
 Pädagogik Wiebke Vieljans Die allgemeindidaktischen Modelle "Informationstheoretisch-kybernetische Didaktk", "Lernzielorientierte Didaktik" und "Kritisch-kommunikative Didaktik" Studienarbeit Westfälische
Pädagogik Wiebke Vieljans Die allgemeindidaktischen Modelle "Informationstheoretisch-kybernetische Didaktk", "Lernzielorientierte Didaktik" und "Kritisch-kommunikative Didaktik" Studienarbeit Westfälische
"Der Richter und sein Henker" - Überlegung zum Einsatz im Schulunterricht
 Germanistik Haris Imamovic "Der Richter und sein Henker" - Überlegung zum Einsatz im Schulunterricht Studienarbeit 1. Einleitung... 1 2. Vorüberlegung zum Einsatz des Romans im Deutschunterricht... 2
Germanistik Haris Imamovic "Der Richter und sein Henker" - Überlegung zum Einsatz im Schulunterricht Studienarbeit 1. Einleitung... 1 2. Vorüberlegung zum Einsatz des Romans im Deutschunterricht... 2
Gymnasium der Stadt Frechen FK Spanisch
 Gymnasium der Stadt Frechen FK Spanisch Vereinbarungen zur Leistungsbewertung Die Vereinbarungen zur Leistungsbewertung für das Fach Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache beruhen auf den Vorgaben der
Gymnasium der Stadt Frechen FK Spanisch Vereinbarungen zur Leistungsbewertung Die Vereinbarungen zur Leistungsbewertung für das Fach Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache beruhen auf den Vorgaben der
Modulhandbuch Erziehungswissenschaft
 Fächerübergreifender Bachelor (für M.Ed. LG) Grundwissen Erziehungswissenschaft/Psychologie FüBA A.2.1 ; Institut für Psychologie Prof. Dr. Andreas Wernet 2. und 3. Semester (nach Studienplan) Vorlesungen
Fächerübergreifender Bachelor (für M.Ed. LG) Grundwissen Erziehungswissenschaft/Psychologie FüBA A.2.1 ; Institut für Psychologie Prof. Dr. Andreas Wernet 2. und 3. Semester (nach Studienplan) Vorlesungen
mögliche Semesterplanung zum Rahmenthema 1 (Abitur 2015)
 mögliche Semesterplanung zum Rahmenthema 1 (Abitur 2015) Rahmenthema 1: Krisen, Umbrüche und Revolutionen Kernmodul: Theorien und Modelle zu Umbruchsituationen (KM) Wahlpflichtmodul: Republik seit dem
mögliche Semesterplanung zum Rahmenthema 1 (Abitur 2015) Rahmenthema 1: Krisen, Umbrüche und Revolutionen Kernmodul: Theorien und Modelle zu Umbruchsituationen (KM) Wahlpflichtmodul: Republik seit dem
Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen
 Zeno Kupper Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen PABST SCIENCE PUBLISHERS Lengerich, Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Riga, Scottsdale (USA), Wien, Zagreb Inhaltsverzeichnis Einleitung und
Zeno Kupper Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen PABST SCIENCE PUBLISHERS Lengerich, Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Riga, Scottsdale (USA), Wien, Zagreb Inhaltsverzeichnis Einleitung und
RHETORIK SEK. Entwickelt an den docemus Privatschulen
 RHETORIK SEK Entwickelt an den docemus Privatschulen Erarbeitet: Dr. Ramona Benkenstein Idee/Layout: Brandung. Ideen, Marken, Strategien www.brandung-online.de ISBN 978-3-942657-01-3 1. Auflage 2010 Polymathes
RHETORIK SEK Entwickelt an den docemus Privatschulen Erarbeitet: Dr. Ramona Benkenstein Idee/Layout: Brandung. Ideen, Marken, Strategien www.brandung-online.de ISBN 978-3-942657-01-3 1. Auflage 2010 Polymathes
Möglichkeiten biografisch orientierter Unterrichtsarbeit in der Schule
 Pädagogik Dr. Gerold Schmidt-Callsen Möglichkeiten biografisch orientierter Unterrichtsarbeit in der Schule Vor dem Hintergrund der Merkmale biografischer Arbeit von Hans-Georg Ruhe Studienarbeit Gerold
Pädagogik Dr. Gerold Schmidt-Callsen Möglichkeiten biografisch orientierter Unterrichtsarbeit in der Schule Vor dem Hintergrund der Merkmale biografischer Arbeit von Hans-Georg Ruhe Studienarbeit Gerold
Zur Anwendung heuristischer Hilfsmittel beim Lösen von Sachaufgaben im Mathematikunterricht der Grundschule
 Naturwissenschaft Stefanie Kahl Zur Anwendung heuristischer Hilfsmittel beim Lösen von Sachaufgaben im Mathematikunterricht der Grundschule Examensarbeit Zur Anwendung heuristischer Hilfsmittel beim Lösen
Naturwissenschaft Stefanie Kahl Zur Anwendung heuristischer Hilfsmittel beim Lösen von Sachaufgaben im Mathematikunterricht der Grundschule Examensarbeit Zur Anwendung heuristischer Hilfsmittel beim Lösen
Entstehung und Verlauf des Forschungsprojekts...7
 Inhaltsverzeichnis 1. Entstehung und Verlauf des Forschungsprojekts...7 2. Der Elternfragebogen... 10 2.1 Das methodische Vorgehen... 10 2.2 Die Ergebnisse des Elternfragebogens... 12 2.2.1 Trägerschaft
Inhaltsverzeichnis 1. Entstehung und Verlauf des Forschungsprojekts...7 2. Der Elternfragebogen... 10 2.1 Das methodische Vorgehen... 10 2.2 Die Ergebnisse des Elternfragebogens... 12 2.2.1 Trägerschaft
Textverständlichkeit. Der Prozess des Verstehens am Beispiel des Wissenschaftsjournalismus
 Medien Ariane Bartfeld Textverständlichkeit. Der Prozess des Verstehens am Beispiel des Wissenschaftsjournalismus Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Die Vielfalt des Journalismus 3
Medien Ariane Bartfeld Textverständlichkeit. Der Prozess des Verstehens am Beispiel des Wissenschaftsjournalismus Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Die Vielfalt des Journalismus 3
Modulhandbuch für den Masterstudiengang Lehramt im Fach Mathematik. Modulhandbuch für den Masterstudiengang. Lehramt im Fach Mathematik
 Modulhandbuch für den Masterstudiengang Lehramt im Fach Mathematik Modulhandbuch für den Masterstudiengang Lehramt im Fach Mathematik Stand: Juni 2016 Modulhandbuch für den Masterstudiengang Lehramt im
Modulhandbuch für den Masterstudiengang Lehramt im Fach Mathematik Modulhandbuch für den Masterstudiengang Lehramt im Fach Mathematik Stand: Juni 2016 Modulhandbuch für den Masterstudiengang Lehramt im
PRAKTIKUMSABLAUF PRAKTIKUM PHYSIKALISCHE SCHULEXPERIMENTE
 Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Physik, Professur Didaktik der Physik PRAKTIKUMSABLAUF PRAKTIKUM PHYSIKALISCHE SCHULEXPERIMENTE Technische Universität Dresden, Fakultät Mathematik und
Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Physik, Professur Didaktik der Physik PRAKTIKUMSABLAUF PRAKTIKUM PHYSIKALISCHE SCHULEXPERIMENTE Technische Universität Dresden, Fakultät Mathematik und
Gerechtigkeit und soziale Konflikte Konflikt
 Gerechtigkeit und soziale Konflikte Konflikt Überzeugung, dass die gegenwärtigen Ziele der Parteien nicht gleichzeitig erreicht werden können 1 Konflikte Latente vs. Explizite Konflikte Justiziable vs.
Gerechtigkeit und soziale Konflikte Konflikt Überzeugung, dass die gegenwärtigen Ziele der Parteien nicht gleichzeitig erreicht werden können 1 Konflikte Latente vs. Explizite Konflikte Justiziable vs.
Das Phasenmodell literarischen Verstehens von G.Waldmann
 Germanistik Britta Wehen Das Phasenmodell literarischen Verstehens von G.Waldmann Überlegungen zur theoretischen Herleitung und Begründung sowie zur Umsetzung am Beispiel des Gedichts Inventur von Günter
Germanistik Britta Wehen Das Phasenmodell literarischen Verstehens von G.Waldmann Überlegungen zur theoretischen Herleitung und Begründung sowie zur Umsetzung am Beispiel des Gedichts Inventur von Günter
Lehrveranstaltungstypen im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft
 Lehrveranstaltungstypen im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft Im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft werden sechs Lehrveranstaltungstypen angeboten, die jeweils durch eine spezifische Gewichtung der
Lehrveranstaltungstypen im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft Im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft werden sechs Lehrveranstaltungstypen angeboten, die jeweils durch eine spezifische Gewichtung der
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Kreative Lyrikwerkstatt: Exillyrik - Heinrich Heine und Bertolt Brecht
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kreative Lyrikwerkstatt: Exillyrik - Heinrich Heine und Bertolt Brecht Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kreative Lyrikwerkstatt: Exillyrik - Heinrich Heine und Bertolt Brecht Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Die Erziehungswissenschaft im Rahmen des Studiengangs Bachelor im Primarbereich (Lehramt Grundschule)
 Die Erziehungswissenschaft im Rahmen des Studiengangs Bachelor im Primarbereich (Lehramt Grundschule) Die Erziehungswissenschaft im Rahmen des Studiengangs Bachelor im Sekundarbereich (Lehramt Sekundarstufe
Die Erziehungswissenschaft im Rahmen des Studiengangs Bachelor im Primarbereich (Lehramt Grundschule) Die Erziehungswissenschaft im Rahmen des Studiengangs Bachelor im Sekundarbereich (Lehramt Sekundarstufe
15-14,5 3+ 14-13,5 3 13-12,5 3-
 //GRUNDLAGEN ZUR LEISTUNGSBEWERTUNG IM FACH LATEIN IN DER SEKUNDARSTUFE I Die Schule ist einem pädagogischen Leistungsprinzip verpflichtet, das Leistungsanforderungen mit individueller Förderung verbindet,
//GRUNDLAGEN ZUR LEISTUNGSBEWERTUNG IM FACH LATEIN IN DER SEKUNDARSTUFE I Die Schule ist einem pädagogischen Leistungsprinzip verpflichtet, das Leistungsanforderungen mit individueller Förderung verbindet,
3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung
 Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
Ausbildung zum Change Berater Die Change Safari
 Ausbildung zum Change Berater Die Change Safari Mit erfahrenen Guides ins Neuland: Willkommen zur Change Safari! Veränderungen sind nicht nur notwendiges Übel, sie können Unternehmen wesentliche Schritte
Ausbildung zum Change Berater Die Change Safari Mit erfahrenen Guides ins Neuland: Willkommen zur Change Safari! Veränderungen sind nicht nur notwendiges Übel, sie können Unternehmen wesentliche Schritte
Aufbaumodul Antike und Mittelalter
 Aufbaumodul Antike und Mittelalter 0100 240 h Modulbeauftragter Prof. Dr. Konrad Vössing Alten und Mittelalterlichen Geschichte Themen zur Alten und Mittelalterlichen Geschichte Vorlesung zur Alten oder
Aufbaumodul Antike und Mittelalter 0100 240 h Modulbeauftragter Prof. Dr. Konrad Vössing Alten und Mittelalterlichen Geschichte Themen zur Alten und Mittelalterlichen Geschichte Vorlesung zur Alten oder
Qualitätssicherung an Gemeinschaftsschulen
 Qualitätssicherung an Gemeinschaftsschulen Schulen sind dann dauerhaft erfolgreich, wenn sie ihre Qualität evaluieren und stetig weiterentwickeln. Dazu brauchen sie Leitlinien für die zentralen Aspekte
Qualitätssicherung an Gemeinschaftsschulen Schulen sind dann dauerhaft erfolgreich, wenn sie ihre Qualität evaluieren und stetig weiterentwickeln. Dazu brauchen sie Leitlinien für die zentralen Aspekte
UNTERRICHT MIT NEUEN MEDIEN. Karl Ulrich Templ Didaktik der Politischen Bildung
 UNTERRICHT MIT NEUEN MEDIEN Didaktische Anforderungen an Unterricht mit Medien Unterricht soll jeweils von einer für die Lernenden bedeutsamen Aufgabe ausgehen (Probleme, Entscheidungsfälle, Gestaltungsund
UNTERRICHT MIT NEUEN MEDIEN Didaktische Anforderungen an Unterricht mit Medien Unterricht soll jeweils von einer für die Lernenden bedeutsamen Aufgabe ausgehen (Probleme, Entscheidungsfälle, Gestaltungsund
Modularisiertes Studium der Geographiedidaktik
 Modularisiertes Studium der Geographiedidaktik an der Universität Erlangen-Nürnberg Grundmodule für alle Lehramtsstudiengänge (GS, HS, RS, Gym) Modul 1a (DIDGEO) Grundlagen der Geographiedidaktik / Planung
Modularisiertes Studium der Geographiedidaktik an der Universität Erlangen-Nürnberg Grundmodule für alle Lehramtsstudiengänge (GS, HS, RS, Gym) Modul 1a (DIDGEO) Grundlagen der Geographiedidaktik / Planung
oder Klausur (60-90 Min.) Päd 4 Päd. Arbeitsfelder und Handlungsformen*) FS Vorlesung: Pädagogische Institutionen und Arbeitsfelder (2 SWS)
 Module im Bachelorstudium Pädagogik 1. Überblick 2. Modulbeschreibungen (ab S. 3) Modul ECTS Prüfungs- oder Studienleistung Päd 1 Modul Einführung in die Pädagogik *) 10 1. FS Vorlesung: Einführung in
Module im Bachelorstudium Pädagogik 1. Überblick 2. Modulbeschreibungen (ab S. 3) Modul ECTS Prüfungs- oder Studienleistung Päd 1 Modul Einführung in die Pädagogik *) 10 1. FS Vorlesung: Einführung in
Zentralabitur 2018 Russisch
 Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2018 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien,
Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2018 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien,
Schulinterner Lehrplan Deutsch am Mädchengymnasium Essen- Borbeck unter G8 Bedingungen
 Schulinterner Lehrplan Deutsch am Mädchengymnasium Essen- Borbeck unter G8 Bedingungen Sprechen und Schreiben Jg.5 Umgang mit Texten Jg.5 Reflexion über Sprache Jg.5 1 Wir und unsere neue Schule Kennen
Schulinterner Lehrplan Deutsch am Mädchengymnasium Essen- Borbeck unter G8 Bedingungen Sprechen und Schreiben Jg.5 Umgang mit Texten Jg.5 Reflexion über Sprache Jg.5 1 Wir und unsere neue Schule Kennen
Die Quantitative und Qualitative Sozialforschung unterscheiden sich bei signifikanten Punkten wie das Forschungsverständnis, der Ausgangspunkt oder
 1 2 3 Die Quantitative und Qualitative Sozialforschung unterscheiden sich bei signifikanten Punkten wie das Forschungsverständnis, der Ausgangspunkt oder die Forschungsziele. Ein erstes Unterscheidungsmerkmal
1 2 3 Die Quantitative und Qualitative Sozialforschung unterscheiden sich bei signifikanten Punkten wie das Forschungsverständnis, der Ausgangspunkt oder die Forschungsziele. Ein erstes Unterscheidungsmerkmal
Konstruktion von Aufgaben für die Schreibentwicklung in der Sek. II und Individualisierung
 Forum Sekundarstufe II Profilobestufe Konstruktion von Aufgaben für die Schreibentwicklung in der Sek. II und Individualisierung LI: Renate Schatzmann Ausgangspunkt meiner Überlegungen Diskrepanz der Schülerleistungen
Forum Sekundarstufe II Profilobestufe Konstruktion von Aufgaben für die Schreibentwicklung in der Sek. II und Individualisierung LI: Renate Schatzmann Ausgangspunkt meiner Überlegungen Diskrepanz der Schülerleistungen
2. Klassenarbeiten Im Fach Biologie werden in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten geschrieben.
 1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
1./2. Semester. 1 Modulstruktur: Nr. Element / Lehrveranstaltung Typ Leistungspunkte
 MA Modul 1: BK Praxissemester Fachdidaktik Sozialpädagogik Studiengänge: Master Lehramt an Berufskollegs 2 Semester 1./2. Semester 7 LP : 210 Std. 1 Vorbereitungsseminar Seminar 2 2 Begleitseminar Seminar
MA Modul 1: BK Praxissemester Fachdidaktik Sozialpädagogik Studiengänge: Master Lehramt an Berufskollegs 2 Semester 1./2. Semester 7 LP : 210 Std. 1 Vorbereitungsseminar Seminar 2 2 Begleitseminar Seminar
Lernen mit Portfolio Chancen und Grenzen
 Lernen mit Portfolio Chancen und Grenzen Prof. Dr. Tina Hascher, Fachbereich Erziehungswissenschaft "eportfolio im:focus - Erwartungen, Strategien, Modellfälle, Erfahrungen, 09. Mai 2007 Gliederung 1.
Lernen mit Portfolio Chancen und Grenzen Prof. Dr. Tina Hascher, Fachbereich Erziehungswissenschaft "eportfolio im:focus - Erwartungen, Strategien, Modellfälle, Erfahrungen, 09. Mai 2007 Gliederung 1.
Kompetenzorientierung im RU
 Kompetenzorientierung im RU Nicht Paradigmenwechsel, sondern Perspektivewechsel Paradigmenwechsel suggeriert, dass etwas grundsätzlich Neues passiert und das bisher Praktizierte überholt ist. LehrerInnen
Kompetenzorientierung im RU Nicht Paradigmenwechsel, sondern Perspektivewechsel Paradigmenwechsel suggeriert, dass etwas grundsätzlich Neues passiert und das bisher Praktizierte überholt ist. LehrerInnen
Grundlagen der Sportpädagogik
 Grundlagen der Sportpädagogik Vorlesung zum Themenbereich Grundlagen des Schulsports (Modul 1.1 für f r RPO und GHPO) Do 9.30-11 Uhr im Seminarraum des Sportzentrums Sportzentrum der Pädagogischen Hochschule
Grundlagen der Sportpädagogik Vorlesung zum Themenbereich Grundlagen des Schulsports (Modul 1.1 für f r RPO und GHPO) Do 9.30-11 Uhr im Seminarraum des Sportzentrums Sportzentrum der Pädagogischen Hochschule
Zentralabitur 2019 Russisch
 Zentralabitur 2019 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2019 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Die Fraktion der FDP hat folgende Kleine Anfrage an den Senat gerichtet.
 Antwort des Senats auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP vom 2. September 2010 Außerschulische Lernorte in Bremen und Bremerhaven Die Fraktion der FDP hat folgende Kleine Anfrage an den Senat gerichtet.
Antwort des Senats auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP vom 2. September 2010 Außerschulische Lernorte in Bremen und Bremerhaven Die Fraktion der FDP hat folgende Kleine Anfrage an den Senat gerichtet.
Vertiefung (VT) VTA7 Führung & Kultur Zirkler Michael, Prof. Dr. phil. Bommeli Berenice, MSc ZFH. Arbeits- & Organisationspsychologie MSc
 Modulbeschreibung Modul-Kategorie Modul-Nummer Modul- Fach- & Modul- Verantwortung Wissenschaftliche Mitarbeit Kurse: Vertiefung (VT) VTA7 Führung & Kultur Zirkler Michael, Prof. Dr. phil. Bommeli Berenice,
Modulbeschreibung Modul-Kategorie Modul-Nummer Modul- Fach- & Modul- Verantwortung Wissenschaftliche Mitarbeit Kurse: Vertiefung (VT) VTA7 Führung & Kultur Zirkler Michael, Prof. Dr. phil. Bommeli Berenice,
Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften neue LPO I. Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik
 Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften neue LPO I Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik Inhaltliche Teilgebiete der Allgemeinen Pädagogik gemäß 32 LPO I a) theoretische
Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften neue LPO I Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik Inhaltliche Teilgebiete der Allgemeinen Pädagogik gemäß 32 LPO I a) theoretische
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1)
 Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
Die Förderung von Medienkompetenz im Kindergarten Eine empirische Studie zu Bedingungen und Handlungsformen der Medienerziehung
 Ulrike Six, Roland Gimmler Die Förderung von Medienkompetenz im Kindergarten Eine empirische Studie zu Bedingungen und Handlungsformen der Medienerziehung unter Mitarbeit von Kathrin Aehling, Christoph
Ulrike Six, Roland Gimmler Die Förderung von Medienkompetenz im Kindergarten Eine empirische Studie zu Bedingungen und Handlungsformen der Medienerziehung unter Mitarbeit von Kathrin Aehling, Christoph
Praxismodul Soziologie
 Praxismodul Soziologie Berufspraktikum oder Forschungspraktikum Praxismodul 1 Zeitliche Einordnung und Stellenwert des Praxismoduls Theorien Methoden Gegenstände Berufspraktikum Praxismodul Forschungspraktikum
Praxismodul Soziologie Berufspraktikum oder Forschungspraktikum Praxismodul 1 Zeitliche Einordnung und Stellenwert des Praxismoduls Theorien Methoden Gegenstände Berufspraktikum Praxismodul Forschungspraktikum
GYMNASIUM HORN-BAD MEINBERG
 Gymnasium Horn-Bad Meinberg Kernlehrplan Deutsch Klasse und 10 (G8) Schuljahr 08/0 GYMNASIUM HORN-BAD MEINBERG Jgst. Unterrichtsinhalt/- gegenstand Generationenkonflikte Kurzgeschichte Lebensraum Stadt
Gymnasium Horn-Bad Meinberg Kernlehrplan Deutsch Klasse und 10 (G8) Schuljahr 08/0 GYMNASIUM HORN-BAD MEINBERG Jgst. Unterrichtsinhalt/- gegenstand Generationenkonflikte Kurzgeschichte Lebensraum Stadt
Theorien für den Unterricht
 Theorien für den Unterricht Einführung & Überblick & Literatur Vorlesung im WS 2010/2011 2 EC Daniela Martinek Überblick Organisation WS 2010/2011 Bedeutung von Theorien Bildungsziele der Schule Angebots-Nutzungsmodell
Theorien für den Unterricht Einführung & Überblick & Literatur Vorlesung im WS 2010/2011 2 EC Daniela Martinek Überblick Organisation WS 2010/2011 Bedeutung von Theorien Bildungsziele der Schule Angebots-Nutzungsmodell
Zentralabitur 2017 Evangelische Religionslehre
 Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2017 Evangelische Religionslehre I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen
Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2017 Evangelische Religionslehre I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen
Wissen sichtbar machen
 Wissen sichtbar machen Wissensmanagement mit Mapping- Techniken herausgegeben von Heinz Mandl und Frank Fischer Hogrefe Verlag für Psychologie Göttingen Bern Toronto Seattle Inhaltsverzeichnis I Zur Einführung
Wissen sichtbar machen Wissensmanagement mit Mapping- Techniken herausgegeben von Heinz Mandl und Frank Fischer Hogrefe Verlag für Psychologie Göttingen Bern Toronto Seattle Inhaltsverzeichnis I Zur Einführung
Peter Rieger Universität Leipzig Fakultät für Physik und Geowissenschaften
 Peter Rieger Universität Leipzig Fakultät für Physik und Geowissenschaften Bereich Didaktik der Physik Neben einer Verbesserung des mathematisch - naturwissenschaftlichen Unterrichts müssen die Schüler
Peter Rieger Universität Leipzig Fakultät für Physik und Geowissenschaften Bereich Didaktik der Physik Neben einer Verbesserung des mathematisch - naturwissenschaftlichen Unterrichts müssen die Schüler
Situiertes Lernen. Seminar zum semesterbegleitenden fachdidaktischen Praktikum Mathematik. Referentin: Stephanie Jennewein
 Situiertes Lernen Seminar zum semesterbegleitenden fachdidaktischen Praktikum Mathematik Referentin: Stephanie Jennewein Verlauf 1. Situiertes Lernen 2. Situiertes Lernen im Unterricht 3. Gruppenarbeit
Situiertes Lernen Seminar zum semesterbegleitenden fachdidaktischen Praktikum Mathematik Referentin: Stephanie Jennewein Verlauf 1. Situiertes Lernen 2. Situiertes Lernen im Unterricht 3. Gruppenarbeit
Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung.
 Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung. Exposé aus Medienpädagogik Themenfeld Wechselverhältnis Medientheorie Medienpädagogik Artikel
Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung. Exposé aus Medienpädagogik Themenfeld Wechselverhältnis Medientheorie Medienpädagogik Artikel
Kindertageseinrichtungen auf dem Weg
 Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Kindertageseinrichtungen auf dem Weg von der Integration zur Inklusion Von der Integration zur Inklusion den Blickwinkel verändern 2 Von der Integration zur Inklusion
Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Kindertageseinrichtungen auf dem Weg von der Integration zur Inklusion Von der Integration zur Inklusion den Blickwinkel verändern 2 Von der Integration zur Inklusion
