Katrin Prölß (Autor) Untersuchung von Energie- und Massespeicherungsvorgängen in Pkw-Kälteanlagen
|
|
|
- Ella Schmidt
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Katrin Prölß (utor) Untersuchung von Energie- und Massespeicherungsvorgängen in Pkw-Kälteanlagen Copyright: Cuvillier erlag, Inhaberin nnette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, Göttingen, Germany Telefon: +49 (0) , Website:
2 Kapitel 2 Thermodynamische und strömungstechnische Grundlagen Nachfolgend werden die physikalischen Grundlagen erläutert, auf denen die im späteren erlauf der rbeit vorgestellten Modelle basieren. Zunächst werden die strömungstechnischen Basisgleichungen der Energie-, Masse- und Impulserhaltung vorgestellt und auf die eindimensionale Fluidströmung reduziert. nschließend wird die thermodynamische Beschreibung des rbeitsmediums erläutert. Es folgen die Grundlagen der Wärme- und Stoffübertragung, die zur Beschreibung der Luftentfeuchtung im erdampfer benötigt werden und verwendete Korrelationen auf der Kältemittelseite. bschließend wird die theoretische Basis für eine Modellierung der Zweiphasenströmung erläutert. 2.1 Erhaltungsgleichungen Für die Erhaltungsgleichungen der Strömungsmechanik existieren mehrere gleichwertige arstellungsformen, deren Wahl sich nach ihrer erwendung richtet. Für die Finite-olumen-Methode, die in dieser rbeit in eindimensionaler Form zum Einsatz kommt, wird eine über ein endliches Kontrollvolumen integrierte Form angewendet. ie Erhaltungsgleichungen lassen sich aus grundlegenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten ableiten, die sich auf ein Fluidelement beziehen, das sich mit der Geschwindigkeit w durch den Raum bewegt (Herwig, 2002). In diesem Fall werden als Fluidelement die Teilchen zusammengefasst, die sich zum Zeitpunkt t in dem Kontrollvolumen K mit dem olumen (t) befinden. ie Masse dieses Fluidelementes m bleibt erhalten, also gilt m = 0. (2.1) Mit m wird dabei die totale bleitung nach der Zeit in der teilchenfesten oder Lagrang schen Betrachtungsweise bezeichnet. er erste Hauptsatz der Thermodynamik führt zur Energieerhaltung, nach der die Änderung der Energie E eines Fluidelementes der Summe aller übertragenden Wärmestrome Q und der pro Zeiteinheit verrichteten rbeit P ist. E = (t) Q + (t) P (2.2) 13
3 Kapitel 2 Thermodynamische und strömungstechnische Grundlagen ie Impulserhaltung folgt dem Newtonschen xiom der Mechanik, nach dem die zeitliche Änderung des Impulses eines Körpers gleich der Summe aller an ihm angreifenden Kräfte ist, I = (t) F. (2.3) Im Gegensatz zu der Lagrange-Betrachtung, die einem Fluidelement auf seinem Weg durch den Raum folgt, ist für die erwendung in der Finiten-olumen-Methode eine ortsfeste Betrachtung eher geeignet. iese Form der Erhaltungsgleichungen wird auch als Eulersche Betrachtungsweise bezeichnet und lässt sich mit Hilfe des Reynoldschen Transporttheorems in Gleichung 2.4 aus der Lagrange-Form bilden. Es drückt aus, dass die zeitliche Änderung einer beliebigen mit dem Massenstrom transportierten Größe Φ in der teilchenfesten Betrachtung gleich seiner zeitlichen Änderung in einem ortsfesten Kontrollvolumen zusätzlich der ifferenz der einund austretenden Ströme dieser Größe über die Oberfläche des Kontrollvolumens ist. Für eine mathematische Herleitung sei z.b. auf (Spurk, 2007) verwiesen. ρ Φd = (t) (ρ Φ) t d + (ρ Φ)w n d (2.4) In Gleichung 2.4 ist ein ortsfestes Kontrollvolumen mit unveränderlichen Grenzen, dass zum Zeitpunkt t mit dem olumen (t) zusammenfällt. Mit dem Einheitsvektor n normal zur Oberfläche (nach außen positiv) beschreibt das Skalarprodukt w n den nteil des Geschwindigkeitsvektors, der senkrecht zur Oberfläche steht. ngewendet auf die Erhaltungsgleichungen und mit geeigneten Modellannahmen werden in den folgenden bschnitten Massen-, Energie- und Impulsbilanzen für ein ortsfestes endliches Kontrollvolumen aufgestellt. In einem weiteren Schritt erfolgt die nwendung auf ein quasi-eindimensionales olumenelement mit einem veränderlichen Strömungsquerschnitt, wie es in bbildung 2.1 skizziert ist. arin ist w die mittlere Geschwindigkeit über den Strömungsquerschnitt. ie Indizes e und a bezeichnen Größen am Ein- bzw. ustritt des Kontrollvolumens. bbildung 2.1: urchströmtes olumen mit einem sich ändernden Strömungsquerschnitt 14
4 2.1 Erhaltungsgleichungen Massenerhaltung Mit Φ = 1 entspricht der linke Term in Gl. (2.4) der zeitlichen Massenänderung in einem teilchenfesten olumen ρ d = m (t) (2.5) us Gl. 2.1 und Gl. 2.4 folgt daher für Φ=1 die Massenerhaltung für ein ortsfestes olumen mit ρ t d + ρ w n d = 0 (2.6) arin kann der erste Term als zeitliche Änderung der Gesamtmasse m in dem betrachteten Kontrollvolumens bezeichnet werden, der zweite Term beschreibt die ein- und austretenden Massenströme. Für das in bbildung 2.1 skizzierte Kontrollvolumen folgt somit unter der nnahme, dass w senkrecht auf steht dm dt = (ρw) e (ρw) a (2.7) mit der efinition des Massenstromes ṁ ρw. (2.8) Im stationären Fall (dm/dt = 0) wird Gl. (2.7) auch als Kontinuitätsgleichung bezeichnet. llgemein formuliert für ein beliebiges Kontrollvolumen mit N ein- oder austretenden Massenströmen gilt dm dt = N ṁ i=1 (2.9) Eintretende Massenströme besitzen dabei ein positives, austretende Massenströme ein negatives orzeichen. Fluide, die aus k Komponenten bestehen, erhöhen die nzahl der Massenbilanzen auf eine pro Spezies bzw. k 1 zusätzlich zu einer Gesamtbilanz. 15
5 Kapitel 2 Thermodynamische und strömungstechnische Grundlagen Impulsbilanz ie zeitliche Änderung des Impulses in einem teilchenfesten olumen entspricht der linken Seite von Gl. 2.4 wenn für Φ der Geschwindigkeitsvektor w eingesetzt wird. ρ w d = I (t) (2.10) amit folgt für die ortsfeste Betrachtungsweise aus Gl. 2.4 die Impulserhaltung zu (ρ w) t d + ρ w(w n)d = F + F (2.11) a Kräfte und Geschwindigkeiten in ektorform vorliegen, entspricht Gleichung 2.11 tatsächlich drei skalaren Gleichungen in den drei kartesischen Raumkoordinaten. ie rechte Seite der Gleichung setzt sich aus olumen- und Oberflächenkräften (F bzw. F ) zusammen. ls olumenkraft sei hier nur der Einfluss des Schwerkraftfeldes genannt. Weitere mögliche Einflüsse, die auf das gesamte olumen wirken, wie. z.b. elektromagnetische Kräfte, bleiben unberücksichtigt. F = F g = ρ g d (2.12) ie Oberflächenkräfte ergeben sich aus dem Produkt des jeweiligen Oberflächenelementes und der darauf wirkenden Schub- und Normalspannungen. er Spannungstensor T für ein infinitesimales quaderförmiges Element enthält 9 Komponenten für die erknüpfung der Flächennormalen mit den Kraftwirkungslinien jeweils in den drei Raumkoordinaten. ie integrale Formulierung der resultierenden Oberflächenkräfte lautet F s = Tn d (2.13) nschaulich lassen sich die Oberflächenkräfte auf viskose Scherkräfte und Strömungsturbulenzen zurückführen. Eine mathematische erknüpfung der einzelnen Komponenten des Spannungstensors mit dem vorherrschenden Geschwindigkeitsfeld wird durch einen geeigneten nsatz, z.b. für ein Newtonsches Fluid oder ein Turbulenzmodell hergestellt. Zu beachten ist, dass 16
6 2.1 Erhaltungsgleichungen der durch den thermodynamischen ruck verursachte nteil der Normalspannungen, also der nteil, der bei einem ruhenden Fluid nicht zu Null wird, in T nicht berücksichtigt und separat aufgeführt wird (Gl. 2.14). abei ist die aus dem ruck resultierende Kraft stets der Flächennormalen entgegengerichtet. F p = pn d (2.14) F = F s + F p (2.15) In Systemsimulationen mit eindimensionalen Strömungsansätzen wird häufig die Impulsbilanz in einer Raumkoordinate verwendet, z.b. in (Tummescheit, 2002), (Elmqvist u. a., 2003) und (Pfafferott, 2005). ies ist jedoch nur unter bestimmten oraussetzungen physikalisch korrekt, wie im Folgenden erläutert werden soll. Für das Strömungselement in bbildung 2.1 folgt jedoch zunächst mit den Gleichungen in der Raumkoordinate der Hauptströmungsrichtung x: di x dt = (ṁw) e (ṁw) a +(p) e (p) a + z a z e Δx gm + F s,x (2.16) abei ist z a z e der Höhenunterschied der Strömungsmitte zwischen us- und Eintritt, g die Erdbeschleunigung und w die über den Querschnitt gemittelte Geschwindigkeit in x-richtung. er letzte Term in Gl kann jedoch nicht ohne weiteres ausgewertet werden, da die Geschwindigkeitsterme senkrecht zur Hauptströmungsrichtung in der eindimensionalen Betrachtungsweise keine Berücksichtigung finden. Ändert sich der Strömungsquerschnitt nicht, entspricht der Term den durch die Wandreibung hervorgerufenen Kräften auf die Oberfläche des olumenelementes, hat also einen reinen dissipativen Charakter. Bei einer Querschnitts- oder Richtungsänderung beinhaltet der Term jedoch auch die Normalkräfte auf die jeweiligen Flächen und kann in der eindimensionalen Betrachtung nicht aufgelöst werden. In ausgebildeten Strömungen, d.h. Strömungen in denen sich das Geschwindigkeitsprofil im weiteren erlauf der Strömung nicht mehr ändert, kann aus einer Kräftebilanz ein direkter Zusammenhang zwischen dem Reibungswiderstand der Rohrwand, der aus den dortigen Scherspannungen resultiert und dem ruckverlust über die freien Strömungsflächen hergestellt werden. as bedeutet aber auch, dass Strömungsquerschnitt und ichte des Mediums über die Lauflänge konstant sind. ann kann eine Rohrreibungszahl (Herwig, 2002) λ R wie folgt definiert werden. λ R = 2 h ( dp) ρw 2 dx (2.17) arin ist h = 4 U (2.18) 17
7 Kapitel 2 Thermodynamische und strömungstechnische Grundlagen der hydraulische urchmesser mit dem Umfang des Strömungsquerschnittes U und der Querschnittsfläche. Integriert über die Lauflänge l = x 2 x 1 folgt damit für den Zusammenhang zwischen Massenstrom und ruckverlust aufgrund von Wandrauhigkeiten Δp diss = λ R ṁ 2 l 2ρ h 2. (2.19) ie Rohrreibungszahl λ R wird in bhängigkeit der Reynoldszahl und der Rohrrauhigkeit anhand von Korrelationen aus der Literatur bestimt (di06, 2006; Bohl, 2005). Empirisch bestimmte Widerstandsbeiswerte können in ähnlicher Form wie in Gleichung 2.19 für Einzelwiderstände, z. B. Rohrumlenkungen oder plötzliche Querschnittsänderungen verwendet werden: ṁ 2 Δp diss = ζ 2ρ 2 (2.20) ie Widerstandsbeiwerte ζ werden in hydrodynamisch und thermisch voll ausgebildeten nund bströmungen einzelner Komponenten experimentell bestimmt und vertafelt, siehe z.b. (Idelchik, 1994). abei ist zusätzlich angegeben, auf welche Querschnittsfläche in Gl. (2.20 sich der Widerstandsbeiwert bezieht. Bei einer neinanderreihung von Einzelwiderständen bildet sich in der Realität die Strömung eventuell nicht voll aus, und diese Tatsache sollte in der Interpretation der Berechnungsergebnisse berücksichtigt werden. ie in dieser rbeit verwendeten Modelle enthalten die Impulserhaltung reduziert auf eine algebraische Beziehung zwischen Reibungsdruckverlust und Massenstrom. aher wird diese in den folgenden Kapiteln allgemein als Bewegungsgleichung bezeichnet. Physikalisch entspricht dies einer quasistatischen Betrachtung, da die zeitliche Änderung des Impulses deutlich schneller ist, als die Änderungen von ruck und Temperatur. In früheren Modellen (Pfafferott, 2005; Tummescheit, 2002) für ähnliche nwendungen wurde die komplette Impulsbilanz verwendet. ies führt zu Gleichungssystemen, die sich in der Regel leichter initialisieren lassen, da der Massenstrom als numerischer Zustand vorgegeben wird. Sie erhöhen jedoch den Rechenaufwand und machen das Gleichungssystem anfälliger für Schwingungen Energieerhaltung ie Änderung der Energie in einem teilchenfesten olumen entspricht dem linksseitigen Term in Gl. 2.4, wenn Φ=egesetzt wird. ρed = E (2.21) (t) ie spezifische Energie e setzt sich dabei aus der spezifischen inneren Energie u und der kinetischen Energie des Fluidelementes zusammen. e = u + w2 2 (2.22) 18
15 Eindimensionale Strömungen
 97 Durch Druckunterschiede entstehen Strömungen, die sich auf unterschiedliche Weise beschreiben lassen. Bei der Lagrange schen oder materiellen Beschreibung betrachtet man das einelne Fluidteilchen, das
97 Durch Druckunterschiede entstehen Strömungen, die sich auf unterschiedliche Weise beschreiben lassen. Bei der Lagrange schen oder materiellen Beschreibung betrachtet man das einelne Fluidteilchen, das
25. Vorlesung Sommersemester
 25. Vorlesung Sommersemester 1 Dynamik der Flüssigkeiten Als Beispiel für die Mechanik der Kontinua soll hier noch auf die Bewegung von Flüssigkeiten, eingegangen werden. Traditionell unterscheidet man
25. Vorlesung Sommersemester 1 Dynamik der Flüssigkeiten Als Beispiel für die Mechanik der Kontinua soll hier noch auf die Bewegung von Flüssigkeiten, eingegangen werden. Traditionell unterscheidet man
I.1.3 b. (I.7a) I.1 Grundbegriffe der Newton schen Mechanik 9
 I. Grundbegriffe der Newton schen Mechanik 9 I..3 b Arbeit einer Kraft Wird die Wirkung einer Kraft über ein Zeitintervall oder genauer über die Strecke, welche das mechanische System in diesem Zeitintervall
I. Grundbegriffe der Newton schen Mechanik 9 I..3 b Arbeit einer Kraft Wird die Wirkung einer Kraft über ein Zeitintervall oder genauer über die Strecke, welche das mechanische System in diesem Zeitintervall
https://cuvillier.de/de/shop/publications/73
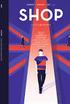 Stephan Meyer (Autor) Energieeffizienzsteigerung entlang der Supply Chain Entscheidungsmodell zur wertschöpfungskettenorientierten Emissionsminderung in Transformationsländern https://cuvillier.de/de/shop/publications/73
Stephan Meyer (Autor) Energieeffizienzsteigerung entlang der Supply Chain Entscheidungsmodell zur wertschöpfungskettenorientierten Emissionsminderung in Transformationsländern https://cuvillier.de/de/shop/publications/73
1. Die Wellengleichung
 1. Die Wellengleichung Die Wellengleichung ist eine partielle Differenzialgleichung für das Schallfeld. Sie lässt sich durch Linearisierung aus der Massenbilanz, der Impulsbilanz und der Energiebilanz
1. Die Wellengleichung Die Wellengleichung ist eine partielle Differenzialgleichung für das Schallfeld. Sie lässt sich durch Linearisierung aus der Massenbilanz, der Impulsbilanz und der Energiebilanz
Newtonschen. (III.27a) oder, in tensorieller Schreibweise
 III.. Nicht-ideales Fluid: Navier Stokes-Gleichung In einem bewegten realen Fluid gibt es Reibungskräfte, die zum Transport von Impuls zwischen benachbarten Fluidschichten beitragen, wenn diese Schichten
III.. Nicht-ideales Fluid: Navier Stokes-Gleichung In einem bewegten realen Fluid gibt es Reibungskräfte, die zum Transport von Impuls zwischen benachbarten Fluidschichten beitragen, wenn diese Schichten
Kompressible Strömungen
 Kompressible Strömungen Problemstellungen: - Wie lassen sich Überschallströmungen realisieren? - Welche Windkanalgeometrie ist notwendig? - Thermodynamische Beziehungen in Überschallströmungen? - Unterschall
Kompressible Strömungen Problemstellungen: - Wie lassen sich Überschallströmungen realisieren? - Welche Windkanalgeometrie ist notwendig? - Thermodynamische Beziehungen in Überschallströmungen? - Unterschall
Relativistische Punktmechanik
 KAPITEL II Relativistische Punktmechanik Der Formalismus des vorigen Kapitels wird nun angewandt, um die charakteristischen Größen und Funktionen zur Beschreibung der Bewegung eines freien relativistischen
KAPITEL II Relativistische Punktmechanik Der Formalismus des vorigen Kapitels wird nun angewandt, um die charakteristischen Größen und Funktionen zur Beschreibung der Bewegung eines freien relativistischen
Hydrodynamik Kontinuitätsgleichung. Massenerhaltung: ρ. Massenfluss. inkompressibles Fluid: (ρ 1 = ρ 2 = konst) Erhaltung des Volumenstroms : v
 Hydrodynamik Kontinuitätsgleichung A2, rho2, v2 A1, rho1, v1 Stromröhre Massenerhaltung: ρ } 1 v {{ 1 A } 1 = ρ } 2 v {{ 2 A } 2 m 1 inkompressibles Fluid: (ρ 1 = ρ 2 = konst) Erhaltung des Volumenstroms
Hydrodynamik Kontinuitätsgleichung A2, rho2, v2 A1, rho1, v1 Stromröhre Massenerhaltung: ρ } 1 v {{ 1 A } 1 = ρ } 2 v {{ 2 A } 2 m 1 inkompressibles Fluid: (ρ 1 = ρ 2 = konst) Erhaltung des Volumenstroms
Bedeutung des Schneidstrahls fu r die Fugenbildung beim Laserstrahl-Schneiden
 Bedeutung des Schneidstrahls fu r die Fugenbildung beim Laserstrahl-Schneiden Mit Hilfe der Erhaltungssätze der klassischen Physik für Masse, Impuls und Energie wird in diesem Kapitel abgeleitet, welche
Bedeutung des Schneidstrahls fu r die Fugenbildung beim Laserstrahl-Schneiden Mit Hilfe der Erhaltungssätze der klassischen Physik für Masse, Impuls und Energie wird in diesem Kapitel abgeleitet, welche
Systemverfahrenstechnik SS2013 Projektübung
 Steffen Hermann & Christian Müller Systemverfahrenstechnik SS2013 1. Projektübung Projektübung Studiengang: Systemtechnik und Technische Kybernetik Institut für Automatisierungstechnik Fakultät für Elektro-
Steffen Hermann & Christian Müller Systemverfahrenstechnik SS2013 1. Projektübung Projektübung Studiengang: Systemtechnik und Technische Kybernetik Institut für Automatisierungstechnik Fakultät für Elektro-
Fragen zur Prüfungsvorbereitung Strömungsmechanik II. Stand Sommersemester 2009
 Fragen zur Prüfungsvorbereitung Strömungsmechanik II Stand Sommersemester 2009 Allgemein Sicherer Umgang in der für die im Vorlesungsrahmen benötigte Tensorrechnung. Insbesondere Kenntnis der einzelnen
Fragen zur Prüfungsvorbereitung Strömungsmechanik II Stand Sommersemester 2009 Allgemein Sicherer Umgang in der für die im Vorlesungsrahmen benötigte Tensorrechnung. Insbesondere Kenntnis der einzelnen
Theoretische Physik: Mechanik
 Ferienkurs Theoretische Physik: Mechanik Sommer 2017 Vorlesung 1 (mit freundlicher Genehmigung von Merlin Mitschek und Verena Walbrecht) Technische Universität München 1 Fakultät für Physik Inhaltsverzeichnis
Ferienkurs Theoretische Physik: Mechanik Sommer 2017 Vorlesung 1 (mit freundlicher Genehmigung von Merlin Mitschek und Verena Walbrecht) Technische Universität München 1 Fakultät für Physik Inhaltsverzeichnis
12 Der erste Hauptsatz der Thermodynamik für geschlossene Systeme
 Der erste Hauptsatz der Thermodynamik für geschlossene Systeme Der erste Hauptsatz ist die thermodynamische Formulierung des Satzes von der Erhaltung der Energie. Er besagt, daß Energie weder erzeugt noch
Der erste Hauptsatz der Thermodynamik für geschlossene Systeme Der erste Hauptsatz ist die thermodynamische Formulierung des Satzes von der Erhaltung der Energie. Er besagt, daß Energie weder erzeugt noch
III. Grundgleichungen der nicht-relativistischen Hydrodynamik
 N.BORGHINI Hydrodynamik Theoretische Physik I III. Grundgleichungen der nicht-relativistischen Hydrodynamik Wie in Kap. I schon diskutiert wurde, sind die Freiheitsgrade zur Charakterisierung einer trömung
N.BORGHINI Hydrodynamik Theoretische Physik I III. Grundgleichungen der nicht-relativistischen Hydrodynamik Wie in Kap. I schon diskutiert wurde, sind die Freiheitsgrade zur Charakterisierung einer trömung
KAPITEL VIII. Elektrostatik. VIII.1 Elektrisches Potential. VIII.1.1 Skalarpotential. VIII.1.2 Poisson-Gleichung
 KAPITEL III Elektrostatik Hier fehlt die obligatorische Einleitung... Im stationären Fall vereinfachen sich die Maxwell Gauß und die Maxwell Faraday-Gleichungen für die elektrische Feldstärke E( r) die
KAPITEL III Elektrostatik Hier fehlt die obligatorische Einleitung... Im stationären Fall vereinfachen sich die Maxwell Gauß und die Maxwell Faraday-Gleichungen für die elektrische Feldstärke E( r) die
Jürgen Krahl (Herausgeber) Josef Löffl (Herausgeber) Strömungen
 Jürgen Krahl (Herausgeber) Josef Löffl (Herausgeber) Strömungen https://cuvillier.de/de/shop/publications/7012 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen,
Jürgen Krahl (Herausgeber) Josef Löffl (Herausgeber) Strömungen https://cuvillier.de/de/shop/publications/7012 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen,
Physik I Mechanik und Thermodynamik
 Physik I Mechanik und Thermodynamik 1 Einführung: 1.1 Was ist Physik? 1.2 Experiment - Modell - Theorie 1.3 Geschichte der Physik 1.4 Physik und andere Wissenschaften 1.5 Maßsysteme 1.6 Messfehler und
Physik I Mechanik und Thermodynamik 1 Einführung: 1.1 Was ist Physik? 1.2 Experiment - Modell - Theorie 1.3 Geschichte der Physik 1.4 Physik und andere Wissenschaften 1.5 Maßsysteme 1.6 Messfehler und
1.3. DAS COULOMBSCHE GESETZ, ELEKTROSTATISCHES FELD 9
 8 KAPITEL. ELEKTROSTATIK.3 Das Coulombsche Gesetz, elektrostatisches Feld Zur Einführung verschiedener Grundbegriffe betrachten wir zunächst einmal die Kraft, die zwischen zwei Ladungen q an der Position
8 KAPITEL. ELEKTROSTATIK.3 Das Coulombsche Gesetz, elektrostatisches Feld Zur Einführung verschiedener Grundbegriffe betrachten wir zunächst einmal die Kraft, die zwischen zwei Ladungen q an der Position
Kontinuierliche Systeme und diskrete Systeme
 Kontinuierliche Systeme und diskrete Systeme home/lehre/vl-mhs-1/inhalt/folien/vorlesung/1_disk_kont_sys/deckblatt.tex Seite 1 von 24. p.1/24 Inhaltsverzeichnis Grundbegriffe ingenieurwissenschaftlicher
Kontinuierliche Systeme und diskrete Systeme home/lehre/vl-mhs-1/inhalt/folien/vorlesung/1_disk_kont_sys/deckblatt.tex Seite 1 von 24. p.1/24 Inhaltsverzeichnis Grundbegriffe ingenieurwissenschaftlicher
9.4 Stationäre kompressible Strömungen in Rohren oder Kanälen konstanten Querschnitts
 9.4 Stationäre kompressible Strömungen in Rohren oder Kanälen konstanten Querschnitts Die Strömung tritt mit dem Zustand 1 in die Rohrleitung ein. Für ein aus der Rohrstrecke herausgeschnittenes Element
9.4 Stationäre kompressible Strömungen in Rohren oder Kanälen konstanten Querschnitts Die Strömung tritt mit dem Zustand 1 in die Rohrleitung ein. Für ein aus der Rohrstrecke herausgeschnittenes Element
Energie aus thermodynamischer Sicht
 Energie aus thermodynamischer Sicht 2 Um sich einer präzisen Definition der Größe Energie anzunähern, soll zunächst noch einmal der zuvor erwähnte mechanische Energiebegriff aufgegriffen werden, jetzt
Energie aus thermodynamischer Sicht 2 Um sich einer präzisen Definition der Größe Energie anzunähern, soll zunächst noch einmal der zuvor erwähnte mechanische Energiebegriff aufgegriffen werden, jetzt
3. Prinzip der virtuellen Arbeit
 3. Prinzip der virtuellen rbeit Mit dem Satz von Castigliano können erschiebungen für Freiheitsgrade berechnet werden, an denen Lasten angreifen. Dabei werden nicht immer alle Terme der Formänderungsenergie
3. Prinzip der virtuellen rbeit Mit dem Satz von Castigliano können erschiebungen für Freiheitsgrade berechnet werden, an denen Lasten angreifen. Dabei werden nicht immer alle Terme der Formänderungsenergie
2. Lagrange-Gleichungen
 2. Lagrange-Gleichungen Mit dem Prinzip der virtuellen Leistung lassen sich die Bewegungsgleichungen für komplexe Systeme einfach aufstellen. Aus dem Prinzip der virtuellen Leistung lassen sich die Lagrange-Gleichungen
2. Lagrange-Gleichungen Mit dem Prinzip der virtuellen Leistung lassen sich die Bewegungsgleichungen für komplexe Systeme einfach aufstellen. Aus dem Prinzip der virtuellen Leistung lassen sich die Lagrange-Gleichungen
IV. Strömungen eines idealen Fluids
 IV. Strömungen eines idealen Fluids Dieses Kapitel befasst sich mit einigen Lösungen des Systems von Gleichungen (III.8), (III.18) und (III.4) für die Bewegung eines idealen Fluids. Dabei wird angenommen,
IV. Strömungen eines idealen Fluids Dieses Kapitel befasst sich mit einigen Lösungen des Systems von Gleichungen (III.8), (III.18) und (III.4) für die Bewegung eines idealen Fluids. Dabei wird angenommen,
Einführung in die Strömungsmechanik
 Einführung in die Strömungsmechanik Rolf Radespiel Fluideigenschaften Grundlegende Prinzipien und Gleichungen Profile Windkanal und Druckmessungen BRAUNSCHWEIG, 5. JUNI 2002 Was versteht man unter Strömungsmechanik?
Einführung in die Strömungsmechanik Rolf Radespiel Fluideigenschaften Grundlegende Prinzipien und Gleichungen Profile Windkanal und Druckmessungen BRAUNSCHWEIG, 5. JUNI 2002 Was versteht man unter Strömungsmechanik?
Klausur Strömungsmechanik I (Bachelor) & Technische Strömungslehre (Diplom)
 (Name, Matr.-Nr, Unterschrift) Klausur Strömungsmechanik I (Bachelor) & Technische Strömungslehre (iplom) 1. Aufgabe (10 Punkte) 09. 08. 2013 In einem mit einer Flüssigkeit der ichteρ 1 gefüllten zylindrischen
(Name, Matr.-Nr, Unterschrift) Klausur Strömungsmechanik I (Bachelor) & Technische Strömungslehre (iplom) 1. Aufgabe (10 Punkte) 09. 08. 2013 In einem mit einer Flüssigkeit der ichteρ 1 gefüllten zylindrischen
Physik I Mechanik und Thermodynamik
 Physik I Mechanik und Thermodynamik Physik I Mechanik und Thermodynamik 1 Einführung: 1.1 Was ist Physik? 1.2 Experiment - Modell - Theorie 1.3 Geschichte der Physik 1.4 Physik und andere Wissenschaften
Physik I Mechanik und Thermodynamik Physik I Mechanik und Thermodynamik 1 Einführung: 1.1 Was ist Physik? 1.2 Experiment - Modell - Theorie 1.3 Geschichte der Physik 1.4 Physik und andere Wissenschaften
Bernoulligleichung. umax. Bernoulligleichung. Stromfadenvorstellung. Bild 1: Stromfaden als Sonderform der Stromröhre
 Bernoulligleichung 1 Bernoulligleichung Stromfadenvorstellung Bild 1: Stromfaden als Sonderform der Stromröhre Im Arbeitsblatt Kontinuitätsgleichung wurde die Stromröhre eingeführt. Sie ist ein Bilanzgebiet
Bernoulligleichung 1 Bernoulligleichung Stromfadenvorstellung Bild 1: Stromfaden als Sonderform der Stromröhre Im Arbeitsblatt Kontinuitätsgleichung wurde die Stromröhre eingeführt. Sie ist ein Bilanzgebiet
Mehrdimensionale Probleme: Wärmeleitung
 Mehrdimensionale Probleme: Wärmeleitung 2 Bei der Anwendung der Randelementmethode auf mehrdimensionale Probleme ergeben sich neue Probleme, insbesondere bei der mathematischen Beschreibung. In diesem
Mehrdimensionale Probleme: Wärmeleitung 2 Bei der Anwendung der Randelementmethode auf mehrdimensionale Probleme ergeben sich neue Probleme, insbesondere bei der mathematischen Beschreibung. In diesem
NTB Druckdatum: SC. typische Zeitkonstante für die Wärmeleitungsgleichung Beispiel
 SCIENTIFIC COMPUTING Die eindimensionale Wärmeleitungsgleichung (WLG) Begriffe Temperatur Spezifische Wärmekapazität Wärmefluss Wärmeleitkoeffizient Fourier'sche Gesetz Spezifische Wärmeleistung Mass für
SCIENTIFIC COMPUTING Die eindimensionale Wärmeleitungsgleichung (WLG) Begriffe Temperatur Spezifische Wärmekapazität Wärmefluss Wärmeleitkoeffizient Fourier'sche Gesetz Spezifische Wärmeleistung Mass für
Momentaufnahme Langzeitaufnahme Kurzzeitaufnahme. Vektorbild Stromlinienbild gerichtetes Stromlinienbild
 Nur für Lehrzwecke Siehe www.tfh-berlin.de/emr/rechtliche Hinweise 006 Darstellung von Teilchenbewegungen SL/Krz Momentaufnahme Langzeitaufnahme Kurzzeitaufnahme Vektorbild Stromlinienbild gerichtetes
Nur für Lehrzwecke Siehe www.tfh-berlin.de/emr/rechtliche Hinweise 006 Darstellung von Teilchenbewegungen SL/Krz Momentaufnahme Langzeitaufnahme Kurzzeitaufnahme Vektorbild Stromlinienbild gerichtetes
3 Grundlegende strömungstechnische und thermodynamische Voraussetzungen
 3 Grundlegende strömungstechnische und thermodynamische Voraussetzungen 3.1 Stationär durchströmte offene Systeme - Grundlegende Beziehungen - nergiesatz stationär durchströmter offener Systeme - nwendung
3 Grundlegende strömungstechnische und thermodynamische Voraussetzungen 3.1 Stationär durchströmte offene Systeme - Grundlegende Beziehungen - nergiesatz stationär durchströmter offener Systeme - nwendung
Übungen zur Theoretischen Physik 1 Lösungen zu Blatt 12. Präsenzübungen
 Prof. C. Greiner, Dr. H. van Hees Wintersemester 13/14 Übungen zur Theoretischen Physik 1 Lösungen zu Blatt 1 Präsenzübungen (P7) Viererimpuls und relativistisches Electron im Plattenkondensator (a) Es
Prof. C. Greiner, Dr. H. van Hees Wintersemester 13/14 Übungen zur Theoretischen Physik 1 Lösungen zu Blatt 1 Präsenzübungen (P7) Viererimpuls und relativistisches Electron im Plattenkondensator (a) Es
1. Wirbelströmungen 1.2 Gesetz von Biot-Savart
 1. Wirbelströmungen 1.2 Gesetz von Biot-Savart Das Biot-Savart-Gesetz ist formuliert für unbeschränkte Gebiete. Wie können Ränder beschrieben werden (z.b. feste Wände)? Randbedingung für eine reibungsfreie
1. Wirbelströmungen 1.2 Gesetz von Biot-Savart Das Biot-Savart-Gesetz ist formuliert für unbeschränkte Gebiete. Wie können Ränder beschrieben werden (z.b. feste Wände)? Randbedingung für eine reibungsfreie
Analytische Mechanik in a Nutshell. Karsten Kirchgessner Dezember Januar 2008
 Analytische Mechanik in a Nutshell Karsten Kirchgessner Dezember 2007 - Januar 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Definitionen und Basisüberlegungen 1 2 Schlussfolgerungen aus dem d Alembert schen Prinzip 2 2.1
Analytische Mechanik in a Nutshell Karsten Kirchgessner Dezember 2007 - Januar 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Definitionen und Basisüberlegungen 1 2 Schlussfolgerungen aus dem d Alembert schen Prinzip 2 2.1
Angewandte Strömungssimulation
 Angewandte Strömungssimulation 7. Vorlesung Stefan Hickel Numerische Strömungsberechnung Physikalische Modellierung Mathematische Modellierung Numerische Modellierung Lösung Auswertung Parameter und Kennzahlen
Angewandte Strömungssimulation 7. Vorlesung Stefan Hickel Numerische Strömungsberechnung Physikalische Modellierung Mathematische Modellierung Numerische Modellierung Lösung Auswertung Parameter und Kennzahlen
Kapitel 2 ARBEIT, ENERGIEERHALTUNG, WÄRME UND ERSTER HAUPTSATZ LERNZIELE INHALT. Definition der mechanischen Arbeit
 Kapitel 2 ARBEIT, ENERGIEERHALTUNG, WÄRME UND ERSTER HAUPTSATZ LERNZIELE Definition der Arbeit Mechanische Energieformen, kinetische Energie, potentielle Energie, Rotationsenergie Mechanischer Energieerhaltungssatz
Kapitel 2 ARBEIT, ENERGIEERHALTUNG, WÄRME UND ERSTER HAUPTSATZ LERNZIELE Definition der Arbeit Mechanische Energieformen, kinetische Energie, potentielle Energie, Rotationsenergie Mechanischer Energieerhaltungssatz
1 Elektromagnetische Wellen im Vakuum
 Technische Universität München Christian Neumann Ferienkurs Elektrodynamik orlesung Donnerstag SS 9 Elektromagnetische Wellen im akuum Zunächst einige grundlegende Eigenschaften von elektromagnetischen
Technische Universität München Christian Neumann Ferienkurs Elektrodynamik orlesung Donnerstag SS 9 Elektromagnetische Wellen im akuum Zunächst einige grundlegende Eigenschaften von elektromagnetischen
Physikalische Chemie Physikalische Chemie I SoSe 2009 Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas. Thermodynamik
 Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas Thermodynamik Teilgebiet der klassischen Physik. Wir betrachten statistisch viele Teilchen. Informationen über einzelne Teilchen werden nicht gewonnen bzw.
Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas Thermodynamik Teilgebiet der klassischen Physik. Wir betrachten statistisch viele Teilchen. Informationen über einzelne Teilchen werden nicht gewonnen bzw.
Ergänzende Materialien zur Vorlesung Theoretische Mechanik, WS 2005/06
 Ergänzende Materialien zur Vorlesung Theoretische Mechanik, WS 25/6 Dörte Hansen Seminar 1 Dissipative Kräfte I Reibung Wenn wir in der theoretischen Mechanik die Bewegung eines Körpers beschreiben wollen,
Ergänzende Materialien zur Vorlesung Theoretische Mechanik, WS 25/6 Dörte Hansen Seminar 1 Dissipative Kräfte I Reibung Wenn wir in der theoretischen Mechanik die Bewegung eines Körpers beschreiben wollen,
Physikalisches Praktikum M 7 Kreisel
 1 Physikalisches Praktikum M 7 Kreisel Versuchsziel Quantitative Untersuchung des Zusammenhangs von Präzessionsfrequenz, Rotationsfrequenz und dem auf die Kreiselachse ausgeübten Kippmoment Literatur /1/
1 Physikalisches Praktikum M 7 Kreisel Versuchsziel Quantitative Untersuchung des Zusammenhangs von Präzessionsfrequenz, Rotationsfrequenz und dem auf die Kreiselachse ausgeübten Kippmoment Literatur /1/
ν und λ ausgedrückt in Energie E und Impuls p
 phys4.011 Page 1 8.3 Die Schrödinger-Gleichung die grundlegende Gleichung der Quantenmechanik (in den bis jetzt diskutierten Fällen) eine Wellengleichung für Materiewellen (gilt aber auch allgemeiner)
phys4.011 Page 1 8.3 Die Schrödinger-Gleichung die grundlegende Gleichung der Quantenmechanik (in den bis jetzt diskutierten Fällen) eine Wellengleichung für Materiewellen (gilt aber auch allgemeiner)
2. Lagrange-Gleichungen
 2. Lagrange-Gleichungen Mit dem Prinzip der virtuellen Leistung lassen sich die Bewegungsgleichungen für komplexe Systeme einfach aufstellen. Aus dem Prinzip der virtuellen Leistung lassen sich die Lagrange-Gleichungen
2. Lagrange-Gleichungen Mit dem Prinzip der virtuellen Leistung lassen sich die Bewegungsgleichungen für komplexe Systeme einfach aufstellen. Aus dem Prinzip der virtuellen Leistung lassen sich die Lagrange-Gleichungen
Technische Universität Wien Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik. SCHRIFTLICHE PRÜFUNG zur VU Modellbildung am 3.10.
 Technische Universität Wien Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik SCHRIFTLICHE PRÜFUNG zur VU Modellbildung am 3.10.014 Arbeitszeit: 10 min Name: Vorname(n): Matrikelnummer: Note: Aufgabe
Technische Universität Wien Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik SCHRIFTLICHE PRÜFUNG zur VU Modellbildung am 3.10.014 Arbeitszeit: 10 min Name: Vorname(n): Matrikelnummer: Note: Aufgabe
X.3.1 Energiedichte und -stromdichte des elektromagnetischen Feldes
 X.3 Energie und Impuls des elektromagnetischen Feldes 169 X.3 Energie und Impuls des elektromagnetischen Feldes Genau wie mechanische Systeme trägt das elektromagnetische Feld Energie ( X.3.1 und Impuls
X.3 Energie und Impuls des elektromagnetischen Feldes 169 X.3 Energie und Impuls des elektromagnetischen Feldes Genau wie mechanische Systeme trägt das elektromagnetische Feld Energie ( X.3.1 und Impuls
Thermodynamik (Wärmelehre) III kinetische Gastheorie
 Physik A VL6 (07.1.01) Thermodynamik (Wärmelehre) III kinetische Gastheorie Thermische Bewegung Die kinetische Gastheorie Mikroskopische Betrachtung des Druckes Mawell sche Geschwindigkeitserteilung gdes
Physik A VL6 (07.1.01) Thermodynamik (Wärmelehre) III kinetische Gastheorie Thermische Bewegung Die kinetische Gastheorie Mikroskopische Betrachtung des Druckes Mawell sche Geschwindigkeitserteilung gdes
10. und 11. Vorlesung Sommersemester
 10. und 11. Vorlesung Sommersemester 1 Die Legendre-Transformation 1.1 Noch einmal mit mehr Details Diese Ableitung wirkt einfach, ist aber in dieser Form sicher nicht so leicht verständlich. Deswegen
10. und 11. Vorlesung Sommersemester 1 Die Legendre-Transformation 1.1 Noch einmal mit mehr Details Diese Ableitung wirkt einfach, ist aber in dieser Form sicher nicht so leicht verständlich. Deswegen
Thermodynamik II Musterlösung Rechenübung 9
 Thermodynamik II Musterlösung Rechenübung 9 Aufgabe 1 Der Wärmetransfer des Festkörpers und diejenige des finiten Fluidvolumens sind über den konvektiven Wärmeübergang, der von A und α abhängt, gekoppelt.
Thermodynamik II Musterlösung Rechenübung 9 Aufgabe 1 Der Wärmetransfer des Festkörpers und diejenige des finiten Fluidvolumens sind über den konvektiven Wärmeübergang, der von A und α abhängt, gekoppelt.
Theoretische Physik: Mechanik
 Ferienkurs Theoretische Physik: Mechanik Sommer 2016 Vorlesung 1 (mit freundlicher Genehmigung von Verena Walbrecht) Technische Universität München 1 Fakultät für Physik Inhaltsverzeichnis 1 Mathematische
Ferienkurs Theoretische Physik: Mechanik Sommer 2016 Vorlesung 1 (mit freundlicher Genehmigung von Verena Walbrecht) Technische Universität München 1 Fakultät für Physik Inhaltsverzeichnis 1 Mathematische
Es kann günstig sein, Koordinatentransformationen im Phasenraum durchzuführen. V.3.4 a
 V.3.4 Kanonische Transformationen Es kann günstig sein Koordinatentransformationen im Phasenraum durchzuführen. V.3.4 a Koordinatentransformation im Phasenraum Wir betrachten eine allgemeine Koordinatentransformation
V.3.4 Kanonische Transformationen Es kann günstig sein Koordinatentransformationen im Phasenraum durchzuführen. V.3.4 a Koordinatentransformation im Phasenraum Wir betrachten eine allgemeine Koordinatentransformation
Klausur. Strömungsmechanik
 Strömungsmechanik Klausur Strömungsmechanik. Juli 007 Name, Vorname: Matrikelnummer: Fachrichtung: Unterschrift: Bewertung: Aufgabe : Aufgabe : Aufgabe 3: Aufgabe 4: Gesamtpunktzahl: Klausur Strömungsmechanik
Strömungsmechanik Klausur Strömungsmechanik. Juli 007 Name, Vorname: Matrikelnummer: Fachrichtung: Unterschrift: Bewertung: Aufgabe : Aufgabe : Aufgabe 3: Aufgabe 4: Gesamtpunktzahl: Klausur Strömungsmechanik
Hydrodynamik - Euler- und Navier-Stokes-Gleichungen, Potential- und Wirbelströmung
 Hydrodynamik - Euler- und Navier-Stokes-Gleichungen, Potential- und Wirbelströmung ndrey Butkevich und Benjamin Schmiedel 14. Juli 2017 Ein Vortag über Euler- und Navier-Stokes-Gleichungen sowie Potential-
Hydrodynamik - Euler- und Navier-Stokes-Gleichungen, Potential- und Wirbelströmung ndrey Butkevich und Benjamin Schmiedel 14. Juli 2017 Ein Vortag über Euler- und Navier-Stokes-Gleichungen sowie Potential-
Ableitungen von skalaren Feldern Der Gradient
 Ableitungen von skalaren Feldern Der Gradient In der letzten Vorlesung haben wir das zu einem konservativen Kraftfeld zugehörige Potential V ( r) = F ( s) d s + V ( r0 ) kennengelernt und als potentielle
Ableitungen von skalaren Feldern Der Gradient In der letzten Vorlesung haben wir das zu einem konservativen Kraftfeld zugehörige Potential V ( r) = F ( s) d s + V ( r0 ) kennengelernt und als potentielle
Brownsche Bewegung Seminar - Weiche Materie
 Brownsche Bewegung Seminar - Weiche Materie Simon Schnyder 11. Februar 2008 Übersicht Abbildung: 3 Realisationen des Weges eines Brownschen Teilchens mit gl. Startort Struktur des Vortrags Brownsches Teilchen
Brownsche Bewegung Seminar - Weiche Materie Simon Schnyder 11. Februar 2008 Übersicht Abbildung: 3 Realisationen des Weges eines Brownschen Teilchens mit gl. Startort Struktur des Vortrags Brownsches Teilchen
4.1.4 Stationäre kompressible Strömungen in Rohren oder Kanälen
 4.1.4 Stationäre kompressible Strömungen in Rohren oder Kanälen 4.1.4-1 konstanten Querschnitts Die Strömung tritt mit dem Zustand 1 in die Rohrleitung ein. Für ein aus der Rohrstrecke herausgeschnittenes
4.1.4 Stationäre kompressible Strömungen in Rohren oder Kanälen 4.1.4-1 konstanten Querschnitts Die Strömung tritt mit dem Zustand 1 in die Rohrleitung ein. Für ein aus der Rohrstrecke herausgeschnittenes
Elektrostatik. Im stationären Fall vereinfachen sich die Maxwell Gauß- und Maxwell Faraday-Gleichungen zu
 KAPITEL II Elektrostatik Im stationären Fall vereinfachen sich die Maxwell Gauß- und Maxwell Faraday-Gleichungen zu E( r) = ρ el.( r) E( r) = 0. (II.1a) (II.1b) Dabei hängt die Rotation der jetzt zeitunabhängigen
KAPITEL II Elektrostatik Im stationären Fall vereinfachen sich die Maxwell Gauß- und Maxwell Faraday-Gleichungen zu E( r) = ρ el.( r) E( r) = 0. (II.1a) (II.1b) Dabei hängt die Rotation der jetzt zeitunabhängigen
5. Zustandsgleichung des starren Körpers
 5. Zustandsgleichung des starren Körpers 5.1 Zustandsgleichung 5.2 Körper im Schwerefeld 5.3 Stabilität freier Rotationen 2.5-1 5.1 Zustandsgleichung Zustand: Der Zustand eines starren Körpers ist durch
5. Zustandsgleichung des starren Körpers 5.1 Zustandsgleichung 5.2 Körper im Schwerefeld 5.3 Stabilität freier Rotationen 2.5-1 5.1 Zustandsgleichung Zustand: Der Zustand eines starren Körpers ist durch
Hydrodynamik: bewegte Flüssigkeiten
 Hydrodynamik: bewegte Flüssigkeiten Wir betrachten eine stationäre Strömung, d.h. die Geschwindigkeit der Strömung an einem gegebenen Punkt bleibt konstant im Laufe der Zeit. Außerdem betrachten wir zunächst
Hydrodynamik: bewegte Flüssigkeiten Wir betrachten eine stationäre Strömung, d.h. die Geschwindigkeit der Strömung an einem gegebenen Punkt bleibt konstant im Laufe der Zeit. Außerdem betrachten wir zunächst
2.2 Dynamik von Massenpunkten
 - 36-2.2 Dynamik von Massenpunkten Die Dynamik befasst sich mit der Bewegung, welche von Kräften erzeugt und geändert wird. 2.2.1 Definitionen Die wichtigsten Grundbegriffe der Dynamik sind die Masse,
- 36-2.2 Dynamik von Massenpunkten Die Dynamik befasst sich mit der Bewegung, welche von Kräften erzeugt und geändert wird. 2.2.1 Definitionen Die wichtigsten Grundbegriffe der Dynamik sind die Masse,
Transport Einführung
 Transport Einführung home/lehre/vl-mhs-1/inhalt/folien/vorlesung/8_transport/deckblatt.tex Seite 1 von 24. p.1/24 1. Einführung 2. Transportgleichung 3. Analytische Lösung Inhaltsverzeichnis 4. Diskretisierung
Transport Einführung home/lehre/vl-mhs-1/inhalt/folien/vorlesung/8_transport/deckblatt.tex Seite 1 von 24. p.1/24 1. Einführung 2. Transportgleichung 3. Analytische Lösung Inhaltsverzeichnis 4. Diskretisierung
4. Hamiltonformalismus
 4. Hamiltonormalismus Für die praktische Lösung von Problemen bietet der Hamiltonormalismus meist keinen Vorteil gegenüber dem Lagrangeormalismus. Allerdings bietet der Hamiltonormalismus einen direkten
4. Hamiltonormalismus Für die praktische Lösung von Problemen bietet der Hamiltonormalismus meist keinen Vorteil gegenüber dem Lagrangeormalismus. Allerdings bietet der Hamiltonormalismus einen direkten
Grundlagen und Grundgleichungen der Strömungsmechanik
 Inhalt Teil I Grundlagen und Grundgleichungen der Strömungsmechanik 1 Einführung... 3 2 Hydromechanische Grundlagen... 7 2.1 Transportbilanz am Raumelement... 7 2.1.1 Allgemeine Transportbilanz... 7 2.1.2
Inhalt Teil I Grundlagen und Grundgleichungen der Strömungsmechanik 1 Einführung... 3 2 Hydromechanische Grundlagen... 7 2.1 Transportbilanz am Raumelement... 7 2.1.1 Allgemeine Transportbilanz... 7 2.1.2
8. Energie, Impuls und Drehimpuls des elektromagnetischen
 8. Energie, Impuls und Drehimpuls des elektromagnetischen Feldes 8.1 Energie In Abschnitt 2.5 hatten wir dem elektrostatischen Feld eine Energie zugeordnet, charakterisiert durch die Energiedichte ω el
8. Energie, Impuls und Drehimpuls des elektromagnetischen Feldes 8.1 Energie In Abschnitt 2.5 hatten wir dem elektrostatischen Feld eine Energie zugeordnet, charakterisiert durch die Energiedichte ω el
Teil III. Grundlagen der Elektrodynamik
 Teil III Grundlagen der Elektrodynamik 75 6. Die Maxwellschen Gleichungen 6.1 Konzept des elektromagnetischen eldes Im folgenden sollen die Grundgleichungen für das elektrische eld E( x, t) und für das
Teil III Grundlagen der Elektrodynamik 75 6. Die Maxwellschen Gleichungen 6.1 Konzept des elektromagnetischen eldes Im folgenden sollen die Grundgleichungen für das elektrische eld E( x, t) und für das
Grundlagen der Hydromechanik
 Berichte aus der Umweltwissenschaft Rainer Helmig, Holger Class Grundlagen der Hydromechanik / Shaker Verlag Aachen 2005 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis
Berichte aus der Umweltwissenschaft Rainer Helmig, Holger Class Grundlagen der Hydromechanik / Shaker Verlag Aachen 2005 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis
Newton-Beschreibung: Bewegung eines Massenpunkts auf einer Oberfläche
 Newton-Beschreibung: Bewegung eines Massenpunkts auf einer Oberfläche R. Mahnke (Univ. Rostock), J. Kaupužs (Lettische Univ. Riga) 3. Mai 24 Zusammenfassung Ziel dieses Kommentars ist es, die Newtonschen
Newton-Beschreibung: Bewegung eines Massenpunkts auf einer Oberfläche R. Mahnke (Univ. Rostock), J. Kaupužs (Lettische Univ. Riga) 3. Mai 24 Zusammenfassung Ziel dieses Kommentars ist es, die Newtonschen
Prüfungsfragen und Prüfungsaufgaben
 Mathematische Modelle in der Technik WS 3/4 Prüfungsfragen und Prüfungsaufgaben Fragen - 9:. Modellieren Sie ein örtlich eindimensionales, stationäres Wärmeleitproblem (Integralbilanzformulierung, differentielle
Mathematische Modelle in der Technik WS 3/4 Prüfungsfragen und Prüfungsaufgaben Fragen - 9:. Modellieren Sie ein örtlich eindimensionales, stationäres Wärmeleitproblem (Integralbilanzformulierung, differentielle
Vektoren, Tensoren, Operatoren Tensoren Rang 0 Skalar p,ρ,t,... Rang 1 Vektor F, v, I,... Spannungstensor
 Vektoren, Tensoren, Operatoren Tensoren Rang 0 Skalar p,ρ,t,... Rang 1 Vektor F, v, I,... Rang 2 Dyade }{{} σ, τ,... Spannungstensor Differential-Operatoren Nabla- / x Operator / y in kartesischen / Koordinaten
Vektoren, Tensoren, Operatoren Tensoren Rang 0 Skalar p,ρ,t,... Rang 1 Vektor F, v, I,... Rang 2 Dyade }{{} σ, τ,... Spannungstensor Differential-Operatoren Nabla- / x Operator / y in kartesischen / Koordinaten
4.2. Stationäre, eindimensionale, inkompressible Strömungen mit freier Oberfläche in einem Schwerefeld Einleitende Bemerkungen
 Inhalt von Abschnitt 4.2 4.2-0.1 4.2. Stationäre, eindimensionale, inkompressible Strömungen mit freier Oberfläche in einem Schwerefeld 4.2.0 Einleitende Bemerkungen 4.2.1 Stationäre Bilanzgleichungen
Inhalt von Abschnitt 4.2 4.2-0.1 4.2. Stationäre, eindimensionale, inkompressible Strömungen mit freier Oberfläche in einem Schwerefeld 4.2.0 Einleitende Bemerkungen 4.2.1 Stationäre Bilanzgleichungen
Zur Erinnerung. Stichworte aus der 15. Vorlesung:
 Zur Erinnerung Stichworte aus der 5. Vorlesung: Kinetische Gastheorie: Modell des idealen Gases Rückführung makroskopischer Effekte auf mikroskopische Ursachen Druck, Temperatur Druck Impulsübertrag an
Zur Erinnerung Stichworte aus der 5. Vorlesung: Kinetische Gastheorie: Modell des idealen Gases Rückführung makroskopischer Effekte auf mikroskopische Ursachen Druck, Temperatur Druck Impulsübertrag an
 Sinkt ein Körper in einer zähen Flüssigkeit mit einer konstanten, gleichförmigen Geschwindigkeit, so (A) wirkt auf den Körper keine Gewichtskraft (B) ist der auf den Körper wirkende Schweredruck gleich
Sinkt ein Körper in einer zähen Flüssigkeit mit einer konstanten, gleichförmigen Geschwindigkeit, so (A) wirkt auf den Körper keine Gewichtskraft (B) ist der auf den Körper wirkende Schweredruck gleich
... (Name, Matr.-Nr, Unterschrift) Klausur Technische Strömungslehre
 ...... (Name, Matr.-Nr, Unterschrift) Klausur Technische Strömungslehre 16. 3. 006 1. Aufgabe (6 Punkte) Eine starre, mit Luft im Umgebungszustand gefüllte Boje hat die Form eines Kegels (Höhe h 0, Radius
...... (Name, Matr.-Nr, Unterschrift) Klausur Technische Strömungslehre 16. 3. 006 1. Aufgabe (6 Punkte) Eine starre, mit Luft im Umgebungszustand gefüllte Boje hat die Form eines Kegels (Höhe h 0, Radius
Grundlagen der Physik 2 Schwingungen und Wärmelehre
 Grundlagen der Physik 2 Schwingungen und Wärmelehre Othmar Marti othmar.marti@uni-ulm.de Institut für Experimentelle Physik 31. 05. 2007 Othmar Marti (Universität Ulm) Schwingungen und Wärmelehre 31. 05.
Grundlagen der Physik 2 Schwingungen und Wärmelehre Othmar Marti othmar.marti@uni-ulm.de Institut für Experimentelle Physik 31. 05. 2007 Othmar Marti (Universität Ulm) Schwingungen und Wärmelehre 31. 05.
9. Vorlesung Wintersemester
 9. Vorlesung Wintersemester 1 Die Phase der angeregten Schwingung Wertebereich: bei der oben abgeleiteten Formel tan φ = β ω ω ω0. (1) ist noch zu sehen, in welchem Bereich der Winkel liegt. Aus der ursprünglichen
9. Vorlesung Wintersemester 1 Die Phase der angeregten Schwingung Wertebereich: bei der oben abgeleiteten Formel tan φ = β ω ω ω0. (1) ist noch zu sehen, in welchem Bereich der Winkel liegt. Aus der ursprünglichen
Wir erinnern zunächst an die verschiedenen Arten von Funktionen, die uns bisher begegnet sind: V : r 0 3 V ( r) 0 3
 3 1. Mathematische Grundlagen Zur Vorbereitung fassen wir in diesem ersten Kapitel die wichtigsten mathematischen Konzepte zusammen, mit denen wir in der Elektrodynamik immer wieder umgehen werden. 1.1.
3 1. Mathematische Grundlagen Zur Vorbereitung fassen wir in diesem ersten Kapitel die wichtigsten mathematischen Konzepte zusammen, mit denen wir in der Elektrodynamik immer wieder umgehen werden. 1.1.
2. Kontinuierliche Massenänderung
 Untersucht wird ein Körper, der kontinuierlich Masse ausstößt. Es sollen zunächst keine äußeren Kräfte auf den Körper wirken. Bezeichnungen: Masse des ausstoßenden Körpers: m(t) Pro Zeiteinheit ausgestoßene
Untersucht wird ein Körper, der kontinuierlich Masse ausstößt. Es sollen zunächst keine äußeren Kräfte auf den Körper wirken. Bezeichnungen: Masse des ausstoßenden Körpers: m(t) Pro Zeiteinheit ausgestoßene
Heinz Herwig. Strömungsmechanik. Einführung in die Physik von technischen Strömungen Mit 83 Abbildungen und 13 Tabellen STUDIUM VIEWEG+ TEUBNER
 Heinz Herwig Strömungsmechanik Einführung in die Physik von technischen Strömungen Mit 83 Abbildungen und 13 Tabellen STUDIUM VIEWEG+ TEUBNER vii 0 Das methodische Konzept dieses Buches 1 A Einführung
Heinz Herwig Strömungsmechanik Einführung in die Physik von technischen Strömungen Mit 83 Abbildungen und 13 Tabellen STUDIUM VIEWEG+ TEUBNER vii 0 Das methodische Konzept dieses Buches 1 A Einführung
Simulationstechnik V
 Simulationstechnik V Vorlesung/Praktikum an der RWTH Aachen Numerische Simulation von Strömungsvorgängen B. Binninger Institut für Technische Verbrennung Templergraben 64 4. Teil Finite-Volumen-Methode
Simulationstechnik V Vorlesung/Praktikum an der RWTH Aachen Numerische Simulation von Strömungsvorgängen B. Binninger Institut für Technische Verbrennung Templergraben 64 4. Teil Finite-Volumen-Methode
5 Der quantenmechanische Hilbertraum
 5 Der quantenmechanische Hilbertraum 5.1 Die Wellenfunktion eines Teilchens Der Bewegungs- Zustand eines Teilchens Elektrons zu einem Zeitpunkt t, in der klassischen Mechanik das Wertepaar r,p von Ort
5 Der quantenmechanische Hilbertraum 5.1 Die Wellenfunktion eines Teilchens Der Bewegungs- Zustand eines Teilchens Elektrons zu einem Zeitpunkt t, in der klassischen Mechanik das Wertepaar r,p von Ort
Magnetostatik. B( r) = 0
 KAPITEL III Magnetostatik Die Magnetostatik ist die Lehre der magnetischen Felder, die von zeitlich konstanten elektrischen Strömen herrühren. Im entsprechenden stationären Regime vereinfachen sich die
KAPITEL III Magnetostatik Die Magnetostatik ist die Lehre der magnetischen Felder, die von zeitlich konstanten elektrischen Strömen herrühren. Im entsprechenden stationären Regime vereinfachen sich die
Theoretische Physik (Elektrodynamik)
 Theoretische Physik (Elektrodynamik) Andreas Knorr andreas.knorr@physik.tu-berlin.de PN 72 Technische Universität Berlin Theoretische Physik III (Elektrodynamik) p.127 I Vorkenntnisse und Geschichte (1)
Theoretische Physik (Elektrodynamik) Andreas Knorr andreas.knorr@physik.tu-berlin.de PN 72 Technische Universität Berlin Theoretische Physik III (Elektrodynamik) p.127 I Vorkenntnisse und Geschichte (1)
Ricardo Fiorenzano de Albuquerque (Autor) Untersuchung von Ejektor-Kälteanlagen beim Einsatz in tropischen Gebieten
 Ricardo Fiorenzano de Albuquerque (Autor) Untersuchung von Ejektor-Kälteanlagen beim Einsatz in tropischen Gebieten https://cuvillier.de/de/shop/publications/389 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Ricardo Fiorenzano de Albuquerque (Autor) Untersuchung von Ejektor-Kälteanlagen beim Einsatz in tropischen Gebieten https://cuvillier.de/de/shop/publications/389 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
3 Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik
 3 Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik 3.1 Der Begriff der inneren Energie Wir betrachten zunächst ein isoliertes System, d. h. es können weder Teilchen noch Energie mit der Umgebung ausgetauscht werden.
3 Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik 3.1 Der Begriff der inneren Energie Wir betrachten zunächst ein isoliertes System, d. h. es können weder Teilchen noch Energie mit der Umgebung ausgetauscht werden.
Kontinuitätsgleichung und Bernoulli Gleichung
 Kontinuitätsgleichung und Bernoulli Gleichung Kontinuitätsgleichung: Stromlinie Stromröhre C m& konst inkomressible (dichtebest. ) Fluide m& V& (Massenstrom) V & m& (Volumenstrom) Bs. : Durch eine Rohrleitung
Kontinuitätsgleichung und Bernoulli Gleichung Kontinuitätsgleichung: Stromlinie Stromröhre C m& konst inkomressible (dichtebest. ) Fluide m& V& (Massenstrom) V & m& (Volumenstrom) Bs. : Durch eine Rohrleitung
Sei Φ(x, y, z) ein skalares Feld, also eine Funktion, deren Wert in jedem Raumpunkt definiert ist.
 Beim Differenzieren von Vektoren im Zusammenhang mit den Kreisbewegungen haben wir bereits gesehen, dass ein Vektor als dreiwertige Funktion a(x, y, z) aufgefasst werden kann, die an jedem Punkt im dreidimensionalen
Beim Differenzieren von Vektoren im Zusammenhang mit den Kreisbewegungen haben wir bereits gesehen, dass ein Vektor als dreiwertige Funktion a(x, y, z) aufgefasst werden kann, die an jedem Punkt im dreidimensionalen
Integration (handgestrickt)
 Integration (handgestrickt) C c (R n ) :={f : R n R; f stetig, Träger(f) beschränkt}. B + b (Rn ) := { f : R n R; abei bedeutet f m konvergiert. J (R n ) := {f; a) f beschränkt, b) Träger(f) beschränkt,
Integration (handgestrickt) C c (R n ) :={f : R n R; f stetig, Träger(f) beschränkt}. B + b (Rn ) := { f : R n R; abei bedeutet f m konvergiert. J (R n ) := {f; a) f beschränkt, b) Träger(f) beschränkt,
Physik I Mechanik und Thermodynamik
 Physik I Mechanik und Thermodynamik Einführung:. Was ist Physik?. Experiment - Modell - Theorie.3 Geschichte der Physik.4 Physik und andere Wissenschaften.5 Maßsysteme.6 Messfehler und Messgenauigkeit
Physik I Mechanik und Thermodynamik Einführung:. Was ist Physik?. Experiment - Modell - Theorie.3 Geschichte der Physik.4 Physik und andere Wissenschaften.5 Maßsysteme.6 Messfehler und Messgenauigkeit
Wetter. Benjamin Bogner
 Warum ändert sich das ständig? vorhersage 25.05.2011 Warum ändert sich das ständig? vorhersage Inhaltsverzeichnis 1 Definition 2 Warum ändert sich das ständig? Ein einfaches Atmosphärenmodell Ursache der
Warum ändert sich das ständig? vorhersage 25.05.2011 Warum ändert sich das ständig? vorhersage Inhaltsverzeichnis 1 Definition 2 Warum ändert sich das ständig? Ein einfaches Atmosphärenmodell Ursache der
1. Geradlinige Bewegung
 1. Geradlinige Bewegung 1.1 Kinematik 1.2 Schwerpunktsatz 1.3 Dynamisches Gleichgewicht 1.4 Arbeit und Energie 1.5 Leistung Prof. Dr. Wandinger 3. Kinematik und Kinetik TM 3.1-1 1.1 Kinematik Ort: Bei
1. Geradlinige Bewegung 1.1 Kinematik 1.2 Schwerpunktsatz 1.3 Dynamisches Gleichgewicht 1.4 Arbeit und Energie 1.5 Leistung Prof. Dr. Wandinger 3. Kinematik und Kinetik TM 3.1-1 1.1 Kinematik Ort: Bei
1 Lagrange-Formalismus
 Lagrange-Formalismus SS 4 In der gestrigen Vorlesung haben wir die Beschreibung eines physikalischen Systems mit Hilfe der Newton schen Axiome kennen gelernt. Oft ist es aber nicht so einfach die Kraftbilanz
Lagrange-Formalismus SS 4 In der gestrigen Vorlesung haben wir die Beschreibung eines physikalischen Systems mit Hilfe der Newton schen Axiome kennen gelernt. Oft ist es aber nicht so einfach die Kraftbilanz
Physikunterricht 11. Jahrgang P. HEINECKE.
 Physikunterricht 11. Jahrgang P. HEINECKE Hannover, Juli 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Kinematik 3 1.1 Gleichförmige Bewegung.................................. 3 1.2 Gleichmäßig
Physikunterricht 11. Jahrgang P. HEINECKE Hannover, Juli 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Kinematik 3 1.1 Gleichförmige Bewegung.................................. 3 1.2 Gleichmäßig
1.9. Hydrodynamik Volumenstrom und Massenstrom Die Strömungsgeschwindigkeit
 1.9.1. Volumenstrom und Massenstrom 1.9. Hydrodynamik Strömt eine Flüssigkeit durch ein Gefäss, so bezeichnet der Volumenstrom V an einer gegebenen Querschnittsfläche das durchgeströmte Volumen dv in der
1.9.1. Volumenstrom und Massenstrom 1.9. Hydrodynamik Strömt eine Flüssigkeit durch ein Gefäss, so bezeichnet der Volumenstrom V an einer gegebenen Querschnittsfläche das durchgeströmte Volumen dv in der
Vorlesung STRÖMUNGSLEHRE Zusammenfassung
 Lehrstuhl für Fluiddynamik und Strömungstechnik Vorlesung STRÖMUNGSLEHRE Zusammenfassung WS 008/009 Dr.-Ing. Jörg Franke Bewegung von Fluiden ( Flüssigkeiten und Gase) - Hydro- und Aerostatik > Druckverteilung
Lehrstuhl für Fluiddynamik und Strömungstechnik Vorlesung STRÖMUNGSLEHRE Zusammenfassung WS 008/009 Dr.-Ing. Jörg Franke Bewegung von Fluiden ( Flüssigkeiten und Gase) - Hydro- und Aerostatik > Druckverteilung
Strömungsmechanik. YJ Springer. Heinz Herwig. Eine Einführung in die Physik und die mathematische Modellierung von Strömungen
 Heinz Herwig Strömungsmechanik Eine Einführung in die Physik und die mathematische Modellierung von Strömungen 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage Mit 100 Abbildungen und 48 Tabellen YJ Springer
Heinz Herwig Strömungsmechanik Eine Einführung in die Physik und die mathematische Modellierung von Strömungen 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage Mit 100 Abbildungen und 48 Tabellen YJ Springer
Energie und Energieerhaltung
 Arbeit und Energie Energie und Energieerhaltung Es gibt keine Evidenz irgendwelcher Art dafür, dass Energieerhaltung in irgendeinem System nicht erfüllt ist. Energie im Austausch In mechanischen und biologischen
Arbeit und Energie Energie und Energieerhaltung Es gibt keine Evidenz irgendwelcher Art dafür, dass Energieerhaltung in irgendeinem System nicht erfüllt ist. Energie im Austausch In mechanischen und biologischen
3 Flächen und Flächenintegrale
 3 Flächen Flächen sind im dreidimensionalen Ram eingebettete zweidimensionale geometrische Objekte In der Mechanik werden zb Membranen nd chalen als Flächen idealisiert In der Geometrie treten Flächen
3 Flächen Flächen sind im dreidimensionalen Ram eingebettete zweidimensionale geometrische Objekte In der Mechanik werden zb Membranen nd chalen als Flächen idealisiert In der Geometrie treten Flächen
