Angaben, funktionale Angabezusätze, Angabetexte, Angabestrukturen, Strukturanzeiger, Kommentare und mehr. Ein Beitrag zur Theorie der Wörterbuchform
|
|
|
- Justus Lange
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Herbert Ernst Wiegand n, funktionale zusätze, texte, strukturen, Strukturanzeiger, Kommentare und mehr. Ein Beitrag zur Theorie der Wörterbuchform Herbert Ernst Wiegand n, funktionale zusätze, texte, strukturen 1 Vorbemerkung zum alltags- und werkstattsprachlichen Gebrauch von 10.4 ntypologie mit Bezug auf die nsegmentierbarkeit 10.5 ntypologie mit Bezug auf die 2 n im Rahmen einer allgemeinen Theorie der Lexikographie nauslagerung und die nskopen 3 Auf dem Weg zu einer Definition von 10.6 ntypologie mit Bezug auf die nerweiterung 3.1 Erster Terminus für ein Definiens: Lexikographischer akzessiver Eintrag 10.7 ntypologie mit Bezug auf die nglossierung 3.2 Zweiter Terminus für ein Definiens: Kondensierter lexikographischer 10.8 ntypologie mit Bezug auf die nadressierung akzessiver Eintrag 10.9 ntypologie mit Bezug auf die 3.3 Dritter Terminus für ein Definiens: nkondensierung Funktionales Textsegment ntypologie mit Bezug auf die 3.4 Vierter Terminus für ein Definiens: form nakzessivität ntypologie mit Bezug auf die 3.5 Fünfter Terminus für ein Definiens: Genuine funktion nidentifizierung ntypologie mit Bezug auf die 3.6 Sechster Terminus für ein Definiens: gegenstand nstandardisierung ntypologie mit Bezug auf die 3.7 Siebter Terminus für ein Definiens: Lexikographische Information npositionierung ntypologie mit Bezug auf den 3.8 Vorschlag für eine Definition von Textkonstituentenstatus von n 4 Die methodische Ermittlung von funktionalen Textsegmenten bei der Wörterbuchanalyse ntypologie mit Bezug auf die genuine funktion der Verweisvermittlung 4.1 Methoden zur Ermittlung von funktionalen Textsegmenten: Eine kurze Charakteristik ntypologie mit Bezug auf die genuine funktion der 4.2 Beispiele für die Methodenanwendung Adressenvermittlung 5 Zur Notationsweise bei den Symbolen für 11 Funktionale zusätze klassen 12 texte 6 n und Textverdichtung 13 Strukturanzeiger 7 n und Adressierung 14 Schlussbemerkung 8 n und Verweisung 15 Literatur 9 n und textuelle Strukturen 15.1 Wörterbücher 10 Ansätze zu einem Typologiesystem für 15.2 Sonstige Literatur n 16 Anhänge 10.1 ntypologie mit Bezug auf zwei 16.1 Anhang I: Termini für n Typen der genuinen funktion 16.2 Anhang II: Termini für funktionale 10.2 ntypologie mit Bezug auf die zusätze form 16.3 Anhang III: Termini für Strukturanzeiger 10.3 ntypologie mit Bezug auf die ndistribution
2 n, funktionale zusätze, texte, strukturen 203 Begriffe sind die Inseln im Meer des Ungesagten (Helmar Nahr) 1 Vorbemerkung zum alltags- und werkstattsprachlichen Gebrauch von Der alltägliche Gebrauch von innerhalb der neuhochdeutschen Standardsprache ist in den einschlägigen ein- und mehrbändigen Wörterbüchern der deutschen Leitvarietät der älteren und jüngeren Gegenwartssprache, wie z.b. im Sprach-Brockhaus 1982, Hwdg, Wahrig- 6 Dw, Wdg, Gilwb 1995, Duden-Gw, Duden- 2 Gw, Duden- 3 Gw, Duden- 4 Duw und Bw relativ einheitlich lexikographisch bearbeitet. wird als n-fach polysem semantisch lemmatisiert, wobei n leicht unterschiedlich ist. Der Artikel zu aus dem Duden- 3 Gw findet sich in (Abb. 1-1). Abb. 1-1: Wörterbuchartikel wa 1 aus Duden- 3 Gw Wie zu erwarten war, ist weder der werkstattsprachliche Gebrauch von im Rahmen der Lexikographie noch der metalexikographische Gebrauch berücksichtigt. Dies ist allein deswegen erwartbar, weil als metalexikographischer Terminus bisher in keinem der linguistischen Fachwörterbücher des Deutschen primär gebucht ist (vgl. Bussmann 2002, Abraham 1988, Glück/Schmöe 2005, Lewandowski 1994 u.a.) und weil es ein deutschsprachiges Wörterbuch zur Lexikographie bisher nicht gibt. 1 Nicht zu erwarten war aller- 1 Ein solches Wörterbuch ist in Arbeit; vgl.: und dazu Kammerer 2001[2002], Wiegand 2003, 2004, 2004a. Ein weiteres Wörterbuch ist geplant; vgl. dazu: Schierholz/Wiegand 2004[2005] und
3 204 Herbert Ernst Wiegand dings, dass ein systematischer Gebrauchsunterschied von im alltäglichen Gebrauch nicht beachtet wurde, auf den bereits in Wiegand (1988, 763ff) ausdrücklich hingewiesen wurde. Man kann z.b. äußern: (1) Alle notwendigen n habe ich in die vorgeschriebenen Spalten des Formulars eingetragen. Nach (1) sind n schriftkonstituierte textuelle Phänomene, die eine bestimmte konkrete Form, eine bestimmte Position und eine Funktion aufweisen und das Ergebnis einer Schreibhandlung bilden. Man kann aber auch äußern: (2) Mit den Eintragungen in die vorgeschriebenen Spalten des Formulars habe ich alle n gemacht. Nach (2) ist das gleiche Ergebnis der Schreibhandlung ein Mittel, um n zu machen. In der lexikographischen Werkstattsprache (sensu Wiegand 2004, 140ff) treten beide Möglichkeiten des Gebrauchs von auf. Dies führt in der Regel zu keinen Verständigungsproblemen, auch wenn so manche Feststellung in den Metatexten deutscher Wörterbücher für ein theoretisch geschultes Ohr relativ unerträglich ist. Wörterbuchkritische Beispiele will ich mir hier jedoch schenken. Wenn es allerdings in lexikographietheoretischen Zusammenhängen u.a. um die Frage geht, was genau unter einer verstanden werden soll und was nicht, dann muss die Variabilität des alltäglichen Gebrauchs von kontrolliert eingeschränkt werden, und zwar möglichst so, dass keine kontraintuitiven Regelungen vorgenommen werden. Wollte man dem alltäglichen Gebrauch uneingeschränkt folgen, könnte man z.b. feststellen: (3) In wa 1 ist -n eine Pluralbildungsangabe. (4) In wa 1 wird mit der Pluralbildungsangabe -n eine zur Pluralbildung gemacht. (5) In wa 1 wird mit -n, der zur Pluralbildung, eine Pluralbildungsangabe gemacht. Eine brauchbare Terminologisierung von kann nur an die Gebrauchsweise anschließen, für die (3) ein Beispiel ist. Man wird also davon ausgehen, dass man feststellt: (3') In wa 1 ist -n eine Pluralbildungsangabe, mit der etwas angegeben wird. Das Etwas ist aber lexikographietheoretisch betrachtet keine, sondern der gegenstand (vgl. 3.6, D 3-5). Weiterhin muss auf das Folgende hingewiesen werden: Beim Gebrauch der lexikographischen Werkstattsprache macht es sich kaum bemerkbar, wenn die Phänomene, die (i) zum Wörterbuchgegenstandsbereich (sensu Wiegand 1998, 303), (ii) zum Wörterbuchgegenstand (vgl. unten D 3-4) und (iii) zu einem Wörterbuch und damit zum lexikographischen Metabereich (sensu Wiegand 1998, 64) gehören, nicht immer klar getrennt werden. Für die Systematische Wörterbuchforschung hat die Vernachlässigung der Unterschiede jedoch verheerende Folgen, weil damit eine trennscharfe Terminologie und damit einhergehend eine klare Begriffsbildung und Gegenstandskonstitution verhindert wird. So ist es beispielsweise vollständig in Ordnung, wenn sich in einem der Metatexte des Duden- 3 Gw unter der Zwischenüberschrift Der Aufbau der Einträge. 1. Die wichtigsten Elemente folgende Aufzählung findet:
4 n, funktionale zusätze, texte, strukturen Stichwort mit 2 n zur Silbentrennung und 3 Betonung; 4 der Aussprache; 5 grammatische n; 6 etymologische n; 7 Benennung der Sprachebene und 8 Hinweis auf den Sprachgebrauch; 9 zeitliche und 10 regionale Einordnung; 11 des Sachgebiets bzw. der Fach- oder Sondersprache; 12 Bedeutungsangabe (Definition); 13 Anwendungsbeispiele; 14 Anwendungsbeispiele mit übertragener Bedeutung; 15 Belegzitate; 16 Redensarten; 17 Sprichwörter; 18 idiomatische Wendungen. In zwei zitierten Wörterbuchartikeln, die auf diese Aufzählung folgen, finden sich dann direkt hinter den Elementen die Zahlen 1 bis 18, so dass ein Benutzer erkennen kann, um welche Elemente es sich handelt. Ein Teil der in dieser Aufzählung verwendeten Ausdrücke ist für eine lexikographietheoretische Betrachtung jedoch unbrauchbar. Dies sei im Folgenden an einigen Beispielen gezeigt. Beginnen wir mit der Nr. 18. Die Zahl 18 steht im zitierten Artikel zum Lemmazeichen Ende hinter folgendem Textstück *das dicke E.. Natürlich ist dieses keine idiomatische Wendung, denn im Wörterbuchgegenstandsbereich kommt das dicke E. nicht vor, weil niemand äußert das dicke E., wenn er das dicke Ende meint. Vielmehr ist das dicke E. eine verdichtete einer idiomatischen Wendung, mit der eine abgekürzte idiomatische Wendung genannt (oder: erwähnt) wird; das dicke E. gehört als zum Wörterbuch und damit zum lexikographischen Metabereich. Die idiomatische Wendung das dicke Ende tritt nur im Wörterbuchgegenstandsbereich auf. Sie kann im Wörterbuch lediglich lexikographisch bearbeitet werden; dazu muss sie zunächst genannt (oder: erwähnt) werden. Entsprechendes gilt für Nr. 16 und Nr. 17. In einem Wörterbuchartikel treten weder Redensarten noch Sprichwörter auf, sondern n einer Redensart und n eines Sprichwortes. So ist z.b. alles hat ein E., nur die Wurst hat zwei durchaus keine Redensart, denn niemand verwendet diese angebliche Redensart in dieser Form; vielmehr handelt es sich um eine verdichtete einer Redensart, die man nicht verwenden kann. Entsprechendes gilt für das funktionale Textsegment E. gut, alles gut. Dies ist kein Sprichwort, sondern eine verdichtete Sprichwortangabe. Nehmen wir als nächste die Nr. 13. Diese steht hinter so genannten Anwendungsbeispielen. Nebenbei bemerkt: Anwendungsbeispiel ist ein Beispiel für typischen Lexikographenjargon. Denn man wendet die Wörter nicht an, sondern man verwendet sie! Die 13 steht hinter folgendem Textstück das spitze, stumpfe E.; das E. der Straße. Was würden Sie denn sagen, verehrte Leserin und geehrter Leser, wenn Sie jemanden um ein Beispiel für die alltägliche Verwendung von Ende bitten und Sie erhalten die Antwort: Das spitze, stumpfe E.? Man sollte also nicht die Beispiele mit einer zweifach verdichteten Beispielangabe verwechseln, anhand derer zwei Beispiele erschlossen werden können, nämlich das spitze Ende und das stumpfe Ende. Weiterhin fragt man sich, warum zwischen zeitlicher Einordnung, regionaler Einordnung, Hinweis auf den Sprachgebrauch und Benennung der Sprachebene unterschieden wird. Denn hierbei handelt es sich jedesmal um verschiedene n, weswegen sie auch so genannt werden sollten. Durch die unterschiedlichen Bezeichnungen wird eine Verschiedenheit suggeriert, die nicht existiert. Stilistische Variation ist hier nicht angebracht. Schließlich wird auch nicht klar, dass das so genannte Stichwort selbst eine polyfunktionale
5 206 Herbert Ernst Wiegand ist, mit der eine bestimmte Wortform genannt und deren Schreibung oder Rechtschreibung angezeigt wird. In der Perspektive der Systematischen Wörterbuchforschung treten in Wörterbuchartikeln und in den anderen lexikographischen akzessiven Einträgen neben Abbildungen der verschiedensten Art, die in diesem Beitrag nicht berücksichtigt werden, nur folgende funktionale Textsegmente auf: n, funktionale zusätze, texte und Strukturanzeiger. Diese werden in diesem Beitrag behandelt, und zwar ohne Anspruch auf Exhaustivität, aber dennoch mit der erklärten Absicht, einen zusammenfassenden Überblick zu geben, zu dem auch die Nennung bisher ungelöster Probleme gehört. 2 n im Rahmen einer allgemeinen Theorie der Lexikographie Bisher sind mir keine Gründe bekannt geworden, die in Wiegand (1998, 5 10) entworfene Architektur für eine allgemeine Theorie der Lexikographie zu modifizieren. Vielmehr gibt es international zunehmend deutliche Anzeichen dafür, dass diese auch für andere Forscher akzeptabel ist (vgl. z.b. neuerdings Gouws/Prinsloo 2005). Um den theorieinternen Ort zu markieren, an dem die Ergebnisse dieser Studie zu situieren sind, sei zunächst das Folgende rekapituliert: In der Systematischen Wörterbuchforschung als einem der vier Forschungsgebiete der Wörterbuchforschung wird eine Theorie des lexikographischen Prozesses erarbeitet. Diese Theorie beantwortet die Fragen, wie Wörterbücher unterschiedlicher Typen gemacht werden, wie Wörterbücher beschaffen sind und wie sie eingeteilt werden können, wenn diese Fragen als solche nach invarianten Eigenschaften verstanden werden. Entsprechend besteht eine Theorie des lexikographischen Prozesses aus den folgenden drei Teiltheorien: einer Theorie der lexikographischen Datenbearbeitung einer Theorie der lexikographischen Textträger und einer Theorie der Wörterbucheinteilung. Die Theorie der lexikographischen Textträger besteht ihrerseits aus einer Theorie der Wörterbuchform und einer Theorie des Wörterbuchgegenstandes (vgl. Wiegand 1998). n werden in den beiden zuletzt genannten Teiltheorien behandelt. Denn sie weisen Eigenschaften auf, die zur Wörterbuchform gehören, sowie auch Eigenschaften, die zum Wörterbuchgegenstand zu rechnen sind. Wie aus dem Untertitel dieses Beitrages zu erkennen ist, stehen im Zentrum dieser Untersuchung die erstgenannten Eigenschaften von n und der anderen genannten Datentypen. Es geht entsprechend im Folgenden nicht um Fragen, wie z.b. dieser: Mit welchen typen ist die Grammatik der lexikographisch zu bearbeitenden Sprache in einem Wörterbuch eines bestimmten Typs zu präsentieren? Denn bei der Beantwortung dieser Frage geht es vor allem darum, welche grammatischen Eigenschaftsausprägungen sprachlicher Ausdrücke zum gegenstand werden und damit geht es in erster Linie um den Wörterbuchgegenstand. Es sei aber expressis verbis betont, dass auch dann, wenn im Folgenden n vor allem in der Perspektive einer
6 n, funktionale zusätze, texte, strukturen 207 Theorie der Wörterbuchform betrachtet werden, nicht vernachlässigt werden kann, dass alle n einen gegenstand aufweisen, so dass anhand von n lexikographische Informationen über den Wörterbuchgegenstandsbereich und z.t. auch über die Wörterbuchbasis und über die Wörterbuchform erhältlich sind (vgl. bes. 10.1). 3 Auf dem Weg zu einer Definition von Meine letzte Definition des Terminus findet sich in Wiegand (1989c, 427). Da sie bereits Ende 1986 ausgearbeitet wurde, sind seitdem fast zwei Jahrzehnte ins Land gegangen: Es ist also an der Zeit, die Definition unter Berücksichtigung des neuesten Entwicklungsstandes der Theorie der lexikographischen Textträger zu überdenken und gegebenenfalls neu zu formulieren. Ich gehe dabei nachfolgend so vor, dass ich alle metalexikographischen Termini, die im Definiens einer neu zu formulierenden Definition von auftreten, schrittweise einführe und z.t. selbst definiere oder charakterisiere und in ihre näheren terminologischen und sachlichen Zusammenhänge stelle. 3.1 Erster Terminus für ein Definiens: Lexikographischer akzessiver Eintrag In Wiegand (2003[2004], 194ff) wurde der Terminus akzessiver Eintrag eingeführt. Dieser bezeichnet die textuelle Basiseinheit von gedruckten Nachschlagewerken aller Art, und zwar auch von nichtlexikographischen Nachschlagewerken, wie z.b. Telephonbüchern und Warenkatalogen und gilt als Äquivalent zu engl. (basic) reference unit. Der Terminus bringt damit das auf den Begriff, was allen gedruckten Nachschlagewerken zusammen mit mindestens einer äußeren Zugriffsstruktur gemeinsam ist. Bei lexikographischen Nachschlagewerken wird entsprechend von lexikographischen akzessiven Einträgen gesprochen. In Wiegand (2003 [2004], 195) wurde erwogen, eine terminologische Synonymiebeziehung anzusetzen, die zwischen den Termini lexikographischer akzessiver Eintrag und akzessiver Wörterbucheintrag besteht (vgl. auch Wiegand 2005, 199). Es hat sich aber inzwischen herausgestellt, dass dies unzweckmäßig ist, und zwar aus folgenden zwei Gründen: (a) Es gibt publizierte lexikographische Texte, die inhaltlich zu einem Wörterbuch gehören, aber nicht zum Buchblock des Wörterbuches oder zum Buchblock eines Wörterbuchbandes, sondern die selbständig erschienen sind und in denen sich Außentexte mit äußeren Zugriffsstrukturen finden, die akzessive Außentexteinträge aufweisen. Ein Beispiel ist das alphabetisch geordnete Gebietsverzeichnis in Wbö-Beih. 2 (vgl. Abb. 3-3). Solche akzessiven Einträge sind offenbar keine akzessiven Wörterbucheinträge, weil sie nicht Teil eines Wörterbuches sind; sie sind aber lexikographische akzessive Einträge. (b) Alle Typen von lexikographischen Listen (sensu Wiegand 1998, ), die in lexikographischen Prozessen Verwendung finden, weisen lexikographische akzessive Einträge auf, die aber nicht als akzessive Wörterbucheinträge gelten können. Weiterhin gilt das Folgende: Neben den Wörterbuchartikeln als den zentralen akzessiven Einträgen finden
7 208 Herbert Ernst Wiegand sich nicht nur in Umtexten akzessive Einträge (was die Def. D 2-2 in Wiegand 2003[2004], 195 nahelegt), sondern auch in eingelagerten Binnentexten sowie in Einschüben und damit in allen Arten von wörterbuchinternen Teiltexten. Entsprechend wird die genannte Definition D 2-2 leicht modifiziert; sie lautet dann wie folgt: (D 3-1: lexikographischer akzessiver Eintrag) Ein lexikographischer akzessiver Eintrag ist die textuelle lexikographische Basiseinheit eines gedruckten Wörterbuches oder eines anderen lexikographischen Textes mit äußerer Zugriffsstruktur und durch folgende drei Charakteristika gekennzeichnet: (a) Er weist mindestens ein Zugriffstextelement auf. (b) Er tritt als Konstituente aller Teiltexte eines Wörterbuches mit äußerer Zugriffsstruktur auf sowie als Konstituente von Außentexten mit äußerer Zugriffsstruktur und von lexikographischen Listen. (c) Er enthält zugriffsbereite lexikographische Daten, die entweder alle oder zum Teil solche Daten sind, anhand derer lexikographische Informationen zum jeweiligen Nachschlagegegenstand erhältlich sind, der entweder mit dem Zugriffstextelement oder aber mit den Teiltext- oder Außentexttiteln genannt wird. Es ergibt sich dann der Ausschnitt aus einer Typologie für akzessive Einträge in (Abb. 3-1), der im Anschluss an die (Abb. 2-9) in Wiegand (2003[2004], 196) und darüber hinaus erheblich erweitert werden kann, was aber für den hiesigen Zusammenhang nicht erforderlich ist. akzessiver Eintrag lexikographischer akzessiver Eintrag nichtlexikographischer akzessiver Eintrag akzessiver Außentexteintrag akzessiver Wörterbucheintrag akzessiver Listeneintrag akzessiver Wörterverzeichniseintrag (=Wörterbuchartikel) akzessiver Binnentexteintrag akzessiver Umtexteintrag akzessiver Einschubeintrag Abb. 3-1: Nichtkommentierter Typologiegraph zu einem Ausschnitt aus einer Typologie akzessiver Einträge; Darstellungskonvention: X Y bedeutet von unten nach oben gelesen soviel wie X ist ein Untertyp von Y Alle akzessiven Wörterbucheinträge sind damit zugleich akzessive Teiltexteinträge. Denn nicht nur eingelagerte Binnentexte, Umtexte und Einschübe, sondern auch das oder gegebenenfalls die Wörterverzeichnisse sind lexikographische Teiltexte. Die Wörterbuchartikel sind nicht nur die wichtigsten akzessiven Wörterbucheinträge, sondern sie unterscheiden
8 n, funktionale zusätze, texte, strukturen 209 sich von den anderen drei Eintragstypen auch dadurch, dass nur sie ein makrostrukturelles Zugriffstextelement aufweisen. TS 0 lexikographischer akzessiver Eintrag TK : Vorhandensein von standardisierter Textkondensation ohne standardisierte Textkondensation mit standardisierter Textkondensation TS 1 nichtkondensierter lexikographischer akzessiver Eintrag kondensierter lexikographischer akzessiver Eintrag TK 2 2-2: Vorhandensein von texten u. n mit mindestens einer u. ohne text mit mindestens einer u. einem text TS 2 vollständig kondensierter lexikographischer akzessiver Eintrag partiell kondensierter lexikographischer akzessiver Eintrag Abb. 3-2: Erweitert kommentierter Typologiegraph zu einer Typologie lexikographischer akzessiver Einträge mit Bezug auf die Textkondensation; Abkürzungen und Darstellungskonventionen: TS = Typologiestufe; TK = Typologiekriterium; in TK x y-z zählt der obere Index x die Typologiekriterien im gesamten Typologiesystem; der untere Index y-z gibt mit y die Typologiestufe und mit z die Anzahl der Typen auf dieser Typologiestufe und damit die quantitative Ausprägungsstruktur des TK relativ zu einer Typologie oder zu einem Typologieausschnitt an; TK und TK bedeuten soviel wie die Anwendung des TK führt zu der Unterteilung 3.2 Zweiter Terminus für ein Definiens: Kondensierter lexikographischer akzessiver Eintrag Im Folgenden schließe ich an meine Darstellungen der lexikographischen Textverdichtung an (vgl. Wiegand 1996, 1998b und 2003[2004], ).
9 210 Herbert Ernst Wiegand Es geht mir im Folgenden allerdings nur darum, darauf hinzuweisen, dass die Eigenschaften von Wörterbuchartikeln, die durch die innere Textkondensierung zustandekommen, auch bei allen anderen lexikographischen akzessiven Einträgen auftreten können, die zum Typologieausschnitt in Abb. 3-1) gehören. Dies bedeutet, dass die in Wiegand (2003[2004], 207f) als Teil eines typologischen Systems für Wörterbuchartikel ausgearbeitete Artikeltypologie mit Bezug auf die innere Textkondensierung auf alle lexikographischen akzessiven Einträge erweitert werden kann. Entsprechend ergibt sich dann die Typologie für lexikographische akzessive Einträge mit Bezug auf die Textkondensation, die sich in (Abb. 3-2) findet. Natürlich vererbt sich die in (Abb. 3-2) dargebotene Einteilung gleichartig auf alle in (Abb. 3-1) unterschiedenen Subtypen von lexikographischen akzessiven Einträgen, so dass es um dies nur an einem Subtyp zu erläutern zum Typ des akzessiven Binnentexteintrages folgende Subtypen gibt: Auf der Typologiestufe TS 1 liegen folgende beiden dichotomischen Typen: der Typ des nichtkondensierten akzessiven Binnentexteintrages und der Typ des kondensierten akzessiven Binnentexteintrags. Auf TS 2 liegen folgende beiden Typen: der Typ des vollständig kondensierten akzessiven Binnentexteintrages und der Typ des partiell kondensierten akzessiven Binnentexteintrages. Es folgen nun einige Erläuterungen zur (Abb. 3-2). Da ab sofort in diesem Beitrag ja klar ist, dass es nicht um nichtlexikographische akzessive Einträge geht, lasse ich das Attribut lexikographisch meistens weg. Der tiefgreifende Unterschied zwischen kondensierten und nichtkondensierten Wörterbuchartikeln, der u.a. in Wiegand (2003[2004]) erläutert wurde, gilt in den wichtigsten Aspekten auch für alle anderen akzessiven Einträge. Entsprechend treten in nichtkondensierten akzessiven Einträgen keine n auf. In vollständig kondensierten akzessiven Einträgen treten dagegen nur n auf, während in partiell kondensierten akzessiven Einträgen neben n mindestens ein text auftritt. Zwar sind Wörterbuchartikel diejenigen akzessiven Einträge, in denen die meisten n zu finden sind. Die traditionelle Auffassung, n seien ausschließlich in Wörterbuchartikeln zu finden, muss allerdings revidiert werden. So finden sich z.b. in (Abb. 3-3) drei akzessive lexikographische Einträge mit zahlreichen n, die zu unterschiedlichen Klassen von n mit gleicher allgemeiner genuiner nfunktion gehören. (a) Achens.Beck. Achenseebecken wnotir Gm. Achenkirch, Eben am Achensee (b) Ac Actinium Ag Argentum (Silber) Al Aluminium Am Americum Ar Argon As Arsen (c) 300 S + Vb* + PN die Blumen sind bunt; Karl ist Lehrer Abb. 3-3: Lexikographische akzessive Einträge (a) (c) aus Wbö-Beih. 2, Duden-WbAbk 2005 und Bw
10 n, funktionale zusätze, texte, strukturen 211 In (Abb. 3-3) ist (a) ein akzessiver Außentexteintrag aus dem alphabetischen Gebietsverzeichnis des Wbö-Beih. 2; er weist folgende Außentextangaben auf: die zweifach verdichtete Gebietsangabe Achens. Beck., die als Leitelementträger fungiert die Gebietsangabe Achenseebecken, die zugleich als Abkürzungs-auflösungsangabe fungiert die verdichtete des übergeordneten Gebietes wnotir, mit der eine Abkürzung für westliches Nordosttirol genannt wird die verdichtete Gemeindeidentifizierungsangabe Gm., mit der eine Abkürzung für Gemeinde genannt wird die beiden Gemeindeangaben: Achenkirch und Eben am Achensee. (b) enthält die ersten sechs akzessiven Binnentexteinträge eines in die Artikelstrecke C unter dem Binnentexttitel Chemische Elemente eingelagerten Binnentextes aus dem Duden-Wbabk In (b) treten als Binnentextangaben sechs Abkürzungsangaben auf, die als Leitelementträger fungieren (z.b. Ag ). Weiterhin finden sich sechs n des wissenschaftlichen Elementennamens; diese fungieren als Abkürzungsauflösungsangabe. Schließlich findet sich eine deutsche Wortäquivalentangabe, nämlich Silber. (c) ist ein akzessiver Umtexteintrag aus einem Umtext des Bw mit dem Umtexttitel Satzmuster für Verben. In (c) folgen auf den numerischen Leitelementträger 300 drei Umtextangaben: Zuerst kommt die Satzmusterangabe S + Vb* + PN, und auf diese folgen zwei musterbezogene Kompetenzbeispielangaben. Für das später auszuarbeitende typologische System für n können daher bereits an dieser Stelle folgende typen unterschieden werden: Artikelinterne n, Binnentextangaben, Umtextangaben, einschubinterne n, Außentextangaben und Listenangaben (vgl. Abb ). 3.3 Dritter Terminus für ein Definiens: Funktionales Textsegment Der Terminus funktionales Textsegment wurde in Wiegand (1989c, 425ff) eingeführt. Die zugehörige Definition wird im Folgenden leicht modifiziert. Dabei wird berücksichtigt, dass im Rahmen der Lexikographie funktionale Textsegmente nicht nur in Wörterbuchartikeln auftreten; weiterhin wird bei der typologischen Einteilung darauf geachtet, dass erstens auch texte zu berücksichtigen sind, und zwar als solche funktionalen Textsegmente, die mindestens einen Satz umfassen, während sprachliche n niemals satzwertig sind; zweitens werden auch funktionale zusätze als funktionale Textsegmente berücksichtigt. Die Definition lautet wie folgt: (D 3-2: funktionales Textsegment) Ein funktionales Textsegment ist ein Teil eines lexikographischen akzessiven Eintrags, bestehend aus einer Form und wenigstens einer genuinen Funktion, die der Form in ihrer Ganzheit zugeordnet ist. In der bisherigen Forschung wurden nur zwei Typen von funktionalen Textsegmenten unterschieden: die n und die Strukturanzeiger. Es hat sich aber inzwischen herausgestellt, dass es notwendig und zweckmäßig ist, zwei weitere Typen von funktionalen Textsegmenten mit funktion zu unterscheiden: den Typ des textes (vgl. auch 12) und den des funktionalen zusatzes (vgl. auch 11). Die Gründe dafür werden wir später genauer kennenlernen.
11 212 Herbert Ernst Wiegand Berücksichtigt man die genannten Typen, benötigt man einen oberbegrifflichen Terminus für, funktionaler zusatz und text. Mein Vorschlag lautet: funktionales Textsegment mit funktion. Ein Einwortterminus wäre sicher besser handhabbar; es hat sich aber kein passender finden lassen. Der oberste Ausschnitt aus einer Typologie für funktionale Textsegmente hat entsprechend die Form, die aus (Abb. 3-4) ersichtlich ist. TS 1 auf den Wörterbuchgegenstand, die Wörterbuchform u. die Wörterbuchbasis bezogen TS 2 Textsegment mit funktion funktionales Textsegment TK : Bezug des funktio Textsegmentes nur auf die Wörterbuchform bezogen nichttypographischer Strukturanzeiger (= ns) TK 5 3-2: Zugehörig zu einem semiotis System funktional segmentierbar TK 4 3-3: Segmentierbarkeit funktional-positional segmentierbar numerischer ns alphanumerischer ns TS 3 funktionaler funktional-positional zusatz isolierbares Textsegment (mit funktion) sprachlicher ns (weitere) TK 6 4-2: Status als linguistische Einheit unterhalb der Satzgrenze mindestens ein Satz TS 4 text Abb. 3-4: Erweitert kommentierter Typologiegraph zu einem Ausschnitt aus einer Typologie funktionaler Textsegmente
12 n, funktionale zusätze, texte, strukturen Vierter Terminus für ein Definiens: form n bestehen aus formen und genuinen funktionen (vgl. D 3-3). Die form einer ist mit ihrer graphischen Gestalt identisch; entsprechend ist die form einer konkreten visuell wahrnehmbar. formen können sprachlich sein, sowie numerisch und alphanumerisch; weiterhin können sie als symbole gegeben sein. Die form von n, die zur gleichen Klasse von n mit gleicher allgemeiner genuiner Funktion gehören, kann innerhalb eines Wörterbuchs stets gleich sein, wie z.b. bei verdichteten Wortartangaben, oder sie kann wechseln, wie z.b. bei Bedeutungsparaphrasenangaben. formen können typographisch homogen oder heterogen sein. Bei nichtelementaren n können die formen polysemiotisch sein. Schließlich können formen schwarz, einfarbig (z.b. rot in Rechtschreibwörterbüchern) und mehrfarbig sein. Den sprachlichen formen entsprechen folgende sprachliche Formen: nicht frei vorkommende Morpheme (z.b. bei Flexivangaben) Wortformen (z.b. bei Antonym-, Synonym-, Wortäquivalent- und Kompositumangaben) nicht satzwertige Syntagmen (z.b. bei Kollokationsangaben und Phrasemangaben) satzwertige Syntagmen (z.b. bei Kompetenzbeispielangaben und Sprichwortangaben). Die Wortformen können abgekürzt sein, wie z.b. meistens bei den Markierungsangaben (z.b. umg. = umgangssprachlich); weiterhin können sie gekürzt sein, wie z.b. bei Singularund Pluralbildungsangaben. In diesem Fall werden die getilgten Teile durch gebundene Platzhaltersymbole ersetzt (z.b. -en in wa 3 in Abb. 4-3). Bei formen, denen Syntagmen entsprechen, können syntagmainterne Wortformen abgekürzt sein; weiterhin können die Syntagmen durch Platzhaltersymbole gekürzt sein. Ein solcher Fall ist z.b. gegeben, wenn in einer Kompetenzbeispielangabe für den Gebrauch des Lemmazeichens dieses durch eine Tilde ersetzt ist. formen elementarer n, denen gekürzte oder abgekürzte Wortformen oder Syntagmen entsprechen, sind immer formen von verdichteten n. Aufgrund unterschiedlicher Formgebung, die besonders häufig durch unterschiedliche Schriftschnitte, wie z.b. gerade, kursiv und fett erfolgt, fungieren formen für den kundigen Benutzer als typographische Mikrostrukturanzeiger; letztere sind also Eigenschaften der form. Anhand der form kann der kundige Benutzer erkennen, zu welchem typ eine gehört und weiterhin in den meisten Fällen auch die textuelle position. Bei Nullangaben liegt ein besonderer Fall vor. Bei ihnen ist die form keine graphische Gestalt, sondern ein positionenspezifisches Leerzeichen. In der Darstellung einer konkreten Struktur eines akzessiven lexikographischen Eintrages mittels eines Baumgraphen wird daher als Leerzeichen ein so genannter blank [ i AB j ] verwendet, dessen beide Nachbarschaftsvariablen i und j mit Abkürzungen der unmittelbar vorausgehenden und der unmittelbar folgenden n belegt werden können, so dass jeder blank eindeutig identifiziert ist (vgl. z.b. Abb. 9-3).
13 214 Herbert Ernst Wiegand 3.5 Fünfter Terminus für ein Definiens: Genuine funktion Jeder form ist vom Lexikographen eine genuine funktion zugeordnet. Ein terminologisches Synonym zu genuine funktion ist genuiner zweck. Üblich sind auch die beiden Kurzformen genuine Funktion und genuiner Zweck. Der Terminus genuine funktion ist wie folgt definiert: (D 3-3: genuine funktion) Die einer form zugeordnete genuine funktion besteht darin, dass die durch die Zuordnung gegebene anhand bestimmter Eigenschaften dazu dient, Wissen zum gegenstand zu erhalten, so dass der Benutzer diejenigen Benutzerziele erreichen kann, zu deren Erreichung die bestimmt ist. Eine Konkretisierung zu (D 3-3) kann wie folgt gegeben werden: Eine Bedeutungsparaphrasenangabe, wie z.b. Stoff, der den Organismus sehr schädigt od. tödlich wirkt zum Lemmazeichen Gift, ist dazu bestimmt, dass ein Benutzer, z.b. mit der Suchfrage Was bedeutet Gift?, sein Benutzerziel erreichen kann, das darin besteht, die oder eine Bedeutung von Gift zu erfahren. Die Eigenschaft, anhand derer dies möglich ist, ist die Bedeutung der Bedeutungsparaphrase, die mit der Bedeutungsparaphrasenangabe genannt wird. Die spezifische genuine Funktion der zitierten Bedeutungsparaphrasenangabe besteht mithin darin, dass der Benutzer die Bedeutung von Gift erfährt. Die gleiche allgemeine genuine Funktion (oder: der gleiche allgemeine genuine Zweck) von Bedeutungsparaphrasenangaben besteht entsprechend darin, die Bedeutung eines paraphrasierten Ausdruckes zu erfahren. Im gegebenen Beispiel ist der gegenstand ein Element des Wörterbuchgegenstandes (i.s.v. D 3-4 im nächsten Abschnitt). Daher wird mit der Bedeutungsparaphrasenangabe ein Wissen zum Wörterbuchgegenstand vermittelt. Entsprechend liegt ein bestimmter Typ von genuiner nfunktion vor, nämlich der Typ der (genuinen) wörterbuchgegenstandsbezogenen funktion. Zu diesem Typ gehören, um nur wenige weitere Beispiele zu nennen, auch die genuinen nfunktionen von Kompetenzbeispielangaben, Perfektbildungsangaben, Partizipvariantenangaben, Silbengrenzenangaben und Archaismusangaben. Neben den Hunderten von n, deren gegenstand ein Element des Wörterbuchgegenstands ist, gibt es zahlreiche typen, deren zugehörige n einen gegenstand aufweisen, der eine Eigenschaft der Wörterbuchform ist oder durch eine solche Eigenschaft bedingt ist. Entsprechend liegt hier ein weiterer Typ von genuiner funktion vor: Der Typ der wörterbuchformbezogenen funktion. Schließlich gibt es zahlreiche n, deren gegenstand ein Sachverhalt ist, in den Eigenschaften der Wörterbuchbasis involviert sind. Solche n sind z.b. Textstellenangabe, zur Beleglage, Quellendatierungsangabe und Beleglückenangabe (vgl. Abb ). Die genuine funktion dieser n gehört zum dritten Typ der genuinen funktion, nämlich dem Typ der wörterbuchbasisbezogenen funktion. Die genuine Funktion ist stets der form als einer Ganzheit zugeordnet; dies gilt auch für nichtelementare n. Einer form können mehrere genuine funktionen zugeordnet sein; dann ist die polyfunktional. Die gleiche genuine funktion kann mehreren verschiedenen formen zugeordnet sein. Beispielsweise weisen die drei verdichteten Genusangaben m., Mas und m drei verschiedene Anga-
14 n, funktionale zusätze, texte, strukturen 215 beformen auf, aber alle die gleiche spezifische genuine funktion, wenn sie an das gleiche Substantivlemma adressiert sind. 3.6 Sechster Terminus für ein Definiens: gegenstand Zum Terminus gegenstand wurden in der mir bekannten einschlägigen Literatur bisher kaum hinreichend klare Aussagen gemacht. Isolieren wir als Demonstrationsobjekt aus einem Wörterbuchartikel zu Mann folgenden Ausschnitt (a): a 1 : Mann [ ] m. [ ] Der Ausschnitt a 1 besteht aus der Lemmazeichengestaltangabe Mann und der elementaren verdichteten Genusangabe m.. Letztere ist an die Lemmazeichengestaltangabe adressiert. Diese ist eine nichtadressierte. Die Adressierungsbeziehung, in der m. zu Mann steht, ist eine syntaktische Beziehung. Weiterhin besteht von m. zu dem Lemmazeichen Mann, das in a 1 mit Mann genannt (oder: erwähnt) wird, eine beziehung. Fragen wir nun zuerst: Was ist der gegenstand von m.? Eine konkrete Antwort kann lauten: Der gegenstand der elementaren verdichteten Genusangabe m. in a 1 ist das Genus des Lemmazeichens Mann. Das heißt auch: Der gegenstand ist eine Eigenschaftsausprägung der Eigenschaft, maskulin zu sein, bei dem im Wörterbuch erwähnten (oder: genannten) Substantiv Mann. Damit ist klar, dass der gegenstand von m. in a 1 genau ein Element der Menge ist, die Wörterbuchgegenstand genannt wird und nach Wiegand (1998, 302), wenn es sich um Sprachwörterbücher handelt, wie folgt definiert ist: (D 3-4: Wörterbuchgegenstand) Der Wörterbuchgegenstand eines bestimmten Wörterbuches ist die Menge der in diesem Wörterbuch lexikographisch bearbeiteten Eigenschaftsausprägungen von wenigstens einer, höchstens a- ber endlich vielen sprachlichen Eigenschaften bei einer bestimmten Menge von im Wörterbuch erwähnten sprachlichen Ausdrücken, die zu einem bestimmten Wörterbuchgegenstandsbereich gehören. Wichtig ist nun, dass man sich klar macht, dass der gegenstand bei adressierten n meistens nicht etwas ist, das wahrgenommen werden kann, sondern der Benutzer kann ihn nur dann erfahren, wenn er bestimmte kognitive Operationen gleichzeitig mit der Ausführung seiner Benutzungshandlungen vollzieht. Im Beispiel muss er m. auf seine Bezugsadresse beziehen und damit auf die Lemmazeichengestaltangabe, um als punktuelles Wissen und gemäß der beziehung von m. zu Mann die zugehörige lexikographische Information zu erhalten, dass Mann maskulin ist. Diese Operation entspricht in den hier wesentlichen Aspekten derjenigen, die eine Person ausführen muss, wenn sie den Satz: Mann ist maskulin verstehen möchte, der daher auch ein möglicher Satz eines zugehörigen Volltextes (sensu Wiegand 1998b) ist. Die Lemmazeichengestaltangabe Mann gehört zu den nichtadressierten n. Bei nichtadressierten n ist der gegenstand eine wahrnehmbare Zeichengestalt, die dadurch angegeben wird, dass sie genannt (oder: erwähnt) wird. Um eine lexikographische Information zu erhalten, muss der Benutzer keine Operationen ausführen wie im Falle der adressierten n. Vielmehr besteht die Informationsgewinnung gerade darin, dass
15 216 Herbert Ernst Wiegand der Benutzer die jeweilige Zeichengestalt als eine konkrete bestimmte Schriftzeichenfolge richtig erkennt. Auch in diesem Fall ist der gegenstand eine sprachliche Eigenschaftsausprägung, nämlich die der Eigenschaft des zugehörigen Zeichens, mit einer bestimmten Folge von Schriftzeichen geschrieben zu werden. Auch der gegenstand nichtadressierter n ist damit ein Element des Wörterbuchgegenstandes. Neben den n, die eine wörterbuchgegenstandsbezogene funktion aufweisen, gib es wie wir im vorigen Abschnitt gesehen haben n, die ein wörterbuchformbezogene und solche, die eine wörterbuchbasisbezogene nfunktion aufweisen. Entsprechend lassen sich drei Typen von gegenständen unterscheiden: der wörterbuchgegenstandbezogene gegenstand der wörterbuchformbezogenen gegenstand und der wörterbuchbasisbezogenen ngegenstand. Der gegenstand ist wie folgt definiert: (D 3-5: gegentand) Ein ngegenstand ist dasjenige, was mit einer elementaren angegeben wird. 3.7 Siebter Terminus für ein Definiens: Lexikographische Information Für eine Theorie des lexikographischen Prozesses ist es unbedingt erforderlich, dass sie durchgehend lexikographische Daten von lexikographischen Informationen unterscheidet. Anderenfalls ist es nicht möglich, zwischen dem, was tatsächlich im Wörterbuch steht und dem, was der Benutzer weiß und versteht, zu unterscheiden (vgl. Wiegand 1998, u. 300). Lexikographische Daten sind extraindividuelle textuelle Phänomene, die vom Benutzer so interpretierbar sind, dass lexikographische Informationen entstehen. Diese sind kognitive Entitäten, und zwar Wissensausschnitte, die anhand von lexikographischen Daten erarbeitet werden. n sind lexikographische Daten, zu denen nur dann, wenn lexikographische akzessive Einträge dadurch zum Text-in-Funktion werden, dass ein Benutzer sie liest, in Informationserarbeitungsprozessen lexikographische Information entstehen. Weiteres, was ich zu diesem Themenkomplex gesagt habe, möchte ich hier nicht wiederholen. 3.8 Vorschlag für eine Definition von Definitionen von Termini dass sei hier in Erinnerung gerufen sind Texte, mit denen fachliche Gegenstände dadurch konstituiert werden, dass das Bedeutungswissen zum Terminus relativ zur jeweiligen Forschungslage textuell fixiert wird. Entsprechend sind auch Definitionen historisch. Sie können sich mit der Forschungslage ändern. Sie stehen in Definitionsketten, wenn die im Definiens verwendeten Termini ebenfalls definiert sind. Nach den Ausführungen zu den Termini, die im Definiens auftreten, lautet mein Vorschlag für eine Definition von wie folgt: (D 3-6: ) Eine ist ein funktional-positional isolierbares, nicht satzwertiges funktionales Textsegment in kondensierten lexikographischen akzessiven Einträgen, das als wahrnehmbare -
16 n, funktionale zusätze, texte, strukturen 217 form gegeben ist, der mindestens eine genuine funktion zugeordnet ist, die gerade darin besteht, dass für einen Benutzer Wissen zum gegenstand als lexikographische Information erhältlich ist. Es folgen einige Bemerkungen zur Definition (D 3-6). Deren Aufgabe besteht u.a. gerade darin, eine deutliche Abgrenzung gegenüber den anderen funktionalen Textsegmenten zu erbringen. Um dies zu erreichen, kann der Text des Definiens in Details durchaus unterschiedlich formuliert sein. Wirft man in Kenntnis von (D 3-6) einen Blick auf (Abb. 3-4), dann ist ersichtlich, dass im Definiens die Abgrenzung des Terminus zum kohyponymen Terminus text auf der dritten Typologiestufe TS 3 durch die Formulierung nicht satzwertig erreicht wird. Die Abgrenzung zum Terminus nichttypographischer Strukturanzeiger auf der ersten Typologiestufe TS 1 erfolgt durch die Nennung der genuinen funktion, die Strukturanzeiger nicht aufweisen. Mit Rücksicht auf die Definitionskette, in der (D 3-6) steht, und zwar insonderheit unter Berücksichtigung von (D 3-3), kann (D 3-6) auf eine kürzere Form aufweisen, die wie folgt lautet: (D 3-6': ) Eine ist ein funktional-positional isolierbares, nicht satzwertiges Textsegment, bestehend aus einer wahrnehmbaren form und mindestens einer genuinen funktion. Hinsichtlich ihrer definitorischen Funktion sind (D 3-6) und (D 3-6') äquivalent. 4 Die methodische Ermittlung von funktionalen Textsegmenten bei der Wörterbuchanalyse Innerhalb der Systematischen Wörterbuchforschung (sensu Wiegand 1998, 7ff) werden funktionale Textsegmente nicht ausschließlich intuitiv auf der Basis von alltagsweltlichen Erfahrungen im Umgang mit Wörterbüchern bestimmt. Vielmehr erfolgt die Ermittlung von n, Abgabetexten, funktionalen zusätzen und Strukturanzeigern, die in kondensierten lexikographischen akzessiven Einträgen auftreten, intuitionsgestützt durch die Anwendung von metalexikographischen Methoden. Daher erfolgt zunächst eine kurze Darstellung einschlägiger Methoden. 4.1 Methoden zur Ermittlung von funktionalen Textsegmenten: Eine kurze Charakteristik In Wiegand (1989c, ; 1990, 20 26; 1991, ; 2000, ) wurden die Methoden zur Ermittlung von funktionalen Textsegmenten in unterschiedlichen Zusammenhängen ausführlich dargestellt. Dabei wurden auch die wissenschaftstheoretischen Aspekte und die verschiedenen Bedingungen für die Methodenanwendung berücksichtigt, so dass die folgende Darstellung kurz gehalten werden kann, auch wenn einige neuere Aspekte
17 218 Herbert Ernst Wiegand zu berücksichtigen sind, die sich durch den weiteren Ausbau der Theorie inzwischen ergeben haben. Bei den Methoden zur Ermittlung von funktionalen Textsegmenten handelt es sich nicht um linguistische, sondern um metalexikographische Textsegmentationsmethoden für die partielle und vollständige Zerlegung von kondensierten lexikographischen akzessiven Einträgen in eine Menge von funktionalen Textsegmenten. Die Methoden gelten nicht als Entdeckungsprozeduren, die subjektunabhängig und erfahrungsfrei funktionieren; ihre Anwendung erfolgt intuitionsgestützt, was hier heißen soll, dass jemand, der eine der Segmentationsmethoden erfolgreich anwenden möchte, mindestens Erfahrungen im vortheoretischen Umgang mit Wörterbüchern haben und die jeweiligen Benutzungshinweise kennen muss, so dass er ein kundiger Benutzer (sensu Wiegand 1998, 506) ist. Der metalexikographische Segmentationsbegriff ist anders gefasst als der linguistische. Eine metalexikographische Segmentation führt nicht nur zu sprachlichen Segmenten einer sprachlichen Kette, zu denen es mindestens einen unmittelbaren Segmentvorgänger oder einen unmittelbaren Segmentnachfolger oder beides gibt. Mit einer Segmentationsmethode für lineare Äußerungen, die nur senkrechte Segmentationsfugen zulässt, kann z.b. eine unten um eine Wortakzent- und Vokalquantitätskennzeichnung zur Kürze unten erweiterte Lemmazeichengestaltangabe, wie z.b. mịttelbar in wa 5 (in Abb. 5-2), nicht in ihre funktionalen Teile zerlegt werden, da der durch einen positionsspezifische Unterpunkt realisierte polyfunktionale zusatz nicht von der Segmentation erfasst wird. Auch der positionsspezifische Unterpunkt gilt jedoch nach dem metalexikographischen Segmentationsbegriff als ein Segment, und zwar als ein Textsegment ohne eigene textuelle Position in der sprachlichen Kette; vielmehr weist der Unterpunkt eine spezifische Position unterhalb eines spezifischen Kettenteils auf. Um ihn abzutrennen sind daher nicht nur vertikale, sondern auch horizontale Segmentationsfugen zugelassen. Die Segmentation mittels horizontaler Segmentationsfugen heißt segmentative Isolierung (vgl. Wiegand 2006). Sie muss von der Isolierung von Eigenschaftsausprägungen, die nicht segmentativ verläuft, unterschieden werden (vgl. Wiegand 1990 u. 2006). Eine metalexikographische Textsegmentationsmethode besteht aus folgenden Teilen: (i) (ii) (iii) einer Menge von geordnet anzuwendenden Anweisungen, wie zu segmentieren ist, aus expliziten Konventionen für spezielle Fälle und/oder spezifische Analyseziele sowie aus mindestens einer Beschreibungssprache für die Darstellung der Segmentationsergebnisse. Die Beschreibungssprache kann auch als eigenständig und als ein Darstellungsmittel betrachtet werden, das nicht als Teil einer Segmentationsmethode gilt, sondern lediglich als ihr zugeordnet (vgl. Wiegand 2006). Zwei Hauptvarianten der metalexikographischen Segmentationsmethoden lassen sich unterscheiden: (1) Die Methode der funktionalen Segmentation und (2) die Methode der funktional-positionalen Segmentation. Eine korrekte Anwendung beider Methoden ist nur dann erfolgt, wenn das Segmentationsergebnis eine Menge ist, die ausschließlich funktionale Textsegmente aufweist. Dadurch unterscheiden sich (1) und (2) von Methoden der nichtfunktionalen Segmentation (vgl. Abb.9-1).
18 n, funktionale zusätze, texte, strukturen 219 Die Anwendung von (1) führt zu funktionalen Textsegmenten sowie einem Wissen über die Teil-Ganzes-Beziehungen (oder: die partitiven Beziehungen), in denen die funktionalen Textsegmente in einem lexikographischen akzessiven Eintrag stehen. Die Anwendung von (2) führt zu den gleichen Ergebnissen wie die Anwendung von (1) und darüber hinaus zu einem Wissen über die Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen (oder: die präzedentiven Beziehungen), in denen die funktionalen Textsegmente eines akzessiven Eintrages zueinander stehen. Anders ausgedrückt heißt das Letztere: Die Anwendung von (2) führt zu Textkonstituenten als den Elementen von hierarchischen Textkonstituentenstrukturen (vgl. auch 10 14). Beide Hauptvarianten weisen mehrere Untervarianten auf. Letztere ergeben sich aus den jeweiligen Festlegungen, aus welchen Klassen von funktionalen Textsegmenten die Segmentationsergebnisse stammen müssen, die beim Segmentieren zu berücksichtigen sind. Entsprechend weist die Methode der funktionalen Segmentation folgende vier Untervarianten auf: (1a) (1b) (1c) (1d) Die Methode der nichtexhaustiven funktionalen Segmentation. Bei ihrer Anwendung werden von den insgesamt erhältlichen funktionalen Textsegmenten als Segmentationsergebnisse nur die nichtelementaren und elementaren n sowie falls vorhanden die texte berücksichtigt und darüber hinaus die eintragsinternen partitiven Beziehungen. Die Methode der exhaustiven funktionalen Segmentation. Bei ihrer Anwendung wird alles berücksichtigt, was bei der Anwendung von (1a) berücksichtigt wird und zusätzlich die nichttypographischen Mikrostrukturanzeiger sowie die partitiven Beziehungen, in denen diese zu den nichtelementaren n und gegebenenfalls zum Text des gesamten akzessiven Eintrages stehen. Die Methode der nichtexhaustiven funktionalen Segmentation mit segmentativer Isolierung funktionaler zusätze. Bei ihrer Anwendung wird alles berücksichtigt, was bei der Anwendung von (1a) Berücksichtigung findet und zusätzlich die funktionalen zusätze sowie deren partitive Beziehungen zu den erweiterten n. Die Methode der exhaustiven funktionalen Segmentation mit segmentativer Isolierung funktionaler zusätze. Bei ihrer Anwendung wird alles berücksichtigt, was bei der Anwendung von (1b) Berücksichtigung findet und zusätzlich die funktionalen zusätze sowie deren partitive Beziehungen zu den erweiterten n. Bei der zweiten Hauptvariante, der Methode der funktional-positionalen Segmentation, lassen sich die folgenden vier Untervarianten unterscheiden: (2a) (2b) (2c) Die Methode der nichtexhaustiven funktional-positionalen Segmentation. Bei ihrer Anwendung werden die gleichen Phänomene berücksichtigt wie bei der Anwendung von (1a) und darüber hinaus alle eintragsinternen präzedentiven Beziehungen, in denen die n und gegebenenfalls die texte zueinander stehen. Mit anderen Worten: Bei der Anwendung von (2a) wird die Berücksichtigung der Reihenfolge von n und texten und damit die Berücksichtigung ihrer Position verlangt. Die Methode der exhaustiven funktional-positionalen Segmentation. Bei ihrer Anwendung wird alles berücksichtigt, was bei der Anwendung von (2a) berücksichtigt wird und zusätzlich die nichttypographischen Mikrostrukturanzeiger sowie die partitiven und präzedentiven Beziehungen, in denen diese zu den n und gegebenenfalls zum Text des gesamten akzessiven Eintrags stehen. Die Methode der nichtexhaustiven funktional-positionalen Segmentation mit segmentativer Isolierung funktionaler zusätze.
19 220 Herbert Ernst Wiegand (2d) Bei ihrer Anwendung wird alles berücksichtigt, was bei der Anwendung von (2a) berücksichtigt wird und zusätzlich die funktionalen zusätze sowie deren partitive Beziehungen zu den erweiterten n. Die Methode der exhaustiven funktional-positionalen Segmentation mit segmentativer Isolierung funktionaler zusätze. Bei ihrer Anwendung wird alles berücksichtigt, was bei der Anwendung von (2b) berücksichtigt wird und zusätzlich die funktionalen zusätze sowie deren partitive Beziehungen zu den erweiterten n. Bei der Anwendung der Methodenvarianten (1a), (1b), (2a) und (2b) treten ausschließlich vertikale Segmentationen auf. Bei den Methodenvarianten (1c), (1d), (2c) und (2d) handelt es sich um Methodenkombinationen: Kombiniert wird die Methode der vertikalen Segmentation mit solchen der segmentativen Isolierung, deren Anwendung zu Phänomenen führt, die als Teile der Texte zu gelten haben. Die letztgenannte Methode muss von derjenigen unterschieden werden, deren Anwendung zu separierten typographischen Mikrostrukturanzeigern führt, die keine textuellen Teile, sondern Eigenschaften von formen sind (vgl. Wiegand 1990 u. 2006). Im Folgenden werden mögliche Anwendungen der charakterisierten Methoden ausschnittsweise vorgeführt. 4.2 Beispiele für die Methodenanwendung Gegeben sei wa 2 in (Abb. 4-1): Abb. 4-1: Wörterbuchartikel wa 2 aus Dgwdaf Es war gesagt worden, dass ohne ein praktisches Wissen über Wörterbücher die Anwendung von Segmentationsergebnissen auf Wörterbuchartikel und andere akzessive Einträge zu keinen brauchbaren Ergebnissen führt. Wie eine Anwendung der Methode der nichtexhaustiven funktionalen Segmentation erfolgt, wenn nur ein praktisches Wissen vorliegt, habe ich empirisch untersucht, allerdings nur mit 20 DaF-Studenten als Probanden. Die Probanden wurden so ausgewählt, dass keiner über ein theoretisches Wissen zu Wörterbuchtexten auf der Basis meiner Theorie lexikographischer Texte verfügte. Alle mussten die allgemeine Wörterbuchbenutzungspraxis (sensu Wiegand 1998, 370) beherrschen. Alle Probanden bekamen die gleichen Aufgaben. Die erste Aufgabe bestand darin, drei in Kopien vorgelegte Wörterbuchartikel aus dem Dgwdaf so vertikal zu segmentieren, dass alle n (mit wörterbuchgegenstandsbezogener funktion) durch einen senkrechten Strich von einander zu trennen waren. Nach der Bekanntgabe der Aufgabe wurde den Pro-
Adressierung in Printwörterbüchern Präzisierungen und weiterführende Überlegungen
 Herbert Ernst Wiegand Adressierung in Printwörterbüchern Präzisierungen und weiterführende Überlegungen Herbert Ernst Wiegand Adressierung in Printwörterbüchern 1 Zur Anknüpfung an den vorausgehenden lexikographietheoretischen
Herbert Ernst Wiegand Adressierung in Printwörterbüchern Präzisierungen und weiterführende Überlegungen Herbert Ernst Wiegand Adressierung in Printwörterbüchern 1 Zur Anknüpfung an den vorausgehenden lexikographietheoretischen
Nichtnatürlich über natürliche Sprache schreiben
 Nichtnatürlich über natürliche Sprache schreiben Zu einigen formalen Aspekten von Wörterbuchartikeln herbert ernst wiegand Einem aus dem Adressatenkreis dankbar gewidmet: Michael Schröder, Chef der HNO-
Nichtnatürlich über natürliche Sprache schreiben Zu einigen formalen Aspekten von Wörterbuchartikeln herbert ernst wiegand Einem aus dem Adressatenkreis dankbar gewidmet: Michael Schröder, Chef der HNO-
7. Mediostrukturen in Printwörterbüchern: Ein Überblick
 1 7. Mediostrukturen in Printwörterbüchern: Ein Überblick 1. Zur Forschungslage 2. Grundlegende Differenzierungen: Verweisvoraussetzungen, verweisrelevante Textsegmente, Verweisbeziehungen und Verweise
1 7. Mediostrukturen in Printwörterbüchern: Ein Überblick 1. Zur Forschungslage 2. Grundlegende Differenzierungen: Verweisvoraussetzungen, verweisrelevante Textsegmente, Verweisbeziehungen und Verweise
Kotextspezifische Semantik, Pragmatik und Wörterbuchform. Glossate in einsprachigen Wörterbüchern Rufus H. Gouws zum 60sten Geburtstag gewidmet
 1 Herbert Ernst Wiegand Kotextspezifische Semantik, Pragmatik und Wörterbuchform. e in einsprachigen Wörterbüchern Rufus H. Gouws zum 60sten Geburtstag gewidmet 1 Vorbemerkung: Worum es geht 2 Die Verwendung
1 Herbert Ernst Wiegand Kotextspezifische Semantik, Pragmatik und Wörterbuchform. e in einsprachigen Wörterbüchern Rufus H. Gouws zum 60sten Geburtstag gewidmet 1 Vorbemerkung: Worum es geht 2 Die Verwendung
FACHSPRACHE. Einführung
 FACHSPRACHE Einführung FACHTEXT Der Fachtext ist Instrument und Resultat der im Zusammenhang mit einer spezialisierten gesellschaftlich-produktiven Tätigkeit ausgeübten sprachlich-kommunikativen Tätigkeit;
FACHSPRACHE Einführung FACHTEXT Der Fachtext ist Instrument und Resultat der im Zusammenhang mit einer spezialisierten gesellschaftlich-produktiven Tätigkeit ausgeübten sprachlich-kommunikativen Tätigkeit;
Semantik, Pragmatik und Wörterbuchform in einsprachigen Wörterbüchern
 Herbert Ernst Wiegand Semantik, Pragmatik und Wörterbuchform in einsprachigen Wörterbüchern Abstract This contribution looks at a question that has up to now not yet been put, i.e. which textual dictionary
Herbert Ernst Wiegand Semantik, Pragmatik und Wörterbuchform in einsprachigen Wörterbüchern Abstract This contribution looks at a question that has up to now not yet been put, i.e. which textual dictionary
Computerlexikographie-Tutorium
 Computerlexikographie-Tutorium 09.05.2008 Themen für heute: Teil I: Aufbau der Wörterbücher Mikrostruktur Rey-Debove Herbert Ernst Wiegand Beispiele Teil II: Mikrostrukturprogramme in Online-Lexika elexiko
Computerlexikographie-Tutorium 09.05.2008 Themen für heute: Teil I: Aufbau der Wörterbücher Mikrostruktur Rey-Debove Herbert Ernst Wiegand Beispiele Teil II: Mikrostrukturprogramme in Online-Lexika elexiko
Über die Konstruktion einer hierarchischen Textverbundgesamtstruktur. Ein Beitrag zur Theorie der Wörterbuchform
 Über die Konstruktion einer hierarchischen Textverbundgesamtstruktur. Ein Beitrag zur Theorie der Wörterbuchform Helmut Henne zum 80sten Geburtstag gewidmet Herbert Ernst Wiegand, Germanistisches Seminar,
Über die Konstruktion einer hierarchischen Textverbundgesamtstruktur. Ein Beitrag zur Theorie der Wörterbuchform Helmut Henne zum 80sten Geburtstag gewidmet Herbert Ernst Wiegand, Germanistisches Seminar,
4. Makrostrukturen in Printwörterbüchern: Ein Überblick. 1 Zur historischen Entwicklung des Begriffs der Makrostruktur
 1 4. en in Printwörterbüchern: Ein Überblick 1 Zur historischen Entwicklung des Begriffs der 2 Ein neuer Begriff von 3 Typen von en: eine Auswahl 3.1 Übersicht über einen Ausschnitt aus einem Typologiesystem
1 4. en in Printwörterbüchern: Ein Überblick 1 Zur historischen Entwicklung des Begriffs der 2 Ein neuer Begriff von 3 Typen von en: eine Auswahl 3.1 Übersicht über einen Ausschnitt aus einem Typologiesystem
2.2.4 Logische Äquivalenz
 2.2.4 Logische Äquivalenz (I) Penélope raucht nicht und sie trinkt nicht. (II) Es ist nicht der Fall, dass Penélope raucht oder trinkt. Offenbar behaupten beide Aussagen denselben Sachverhalt, sie unterscheiden
2.2.4 Logische Äquivalenz (I) Penélope raucht nicht und sie trinkt nicht. (II) Es ist nicht der Fall, dass Penélope raucht oder trinkt. Offenbar behaupten beide Aussagen denselben Sachverhalt, sie unterscheiden
doi: /
 384 Resensies / Reviews Herbert Ernst Wiegand und Mª Teresa Fuentes Morán. Estructuras lexicográficas. Aspectos centrales de una teoría de la forma del diccionario. (Colección Lexicografía 2). 2010, 485
384 Resensies / Reviews Herbert Ernst Wiegand und Mª Teresa Fuentes Morán. Estructuras lexicográficas. Aspectos centrales de una teoría de la forma del diccionario. (Colección Lexicografía 2). 2010, 485
Problembereich Getrennt- und Zusammenschreibung
 Germanistik Annika Christof Problembereich Getrennt- und Zusammenschreibung Studienarbeit 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Allgemeines zur Getrennt- und Zusammenschreibung... 2 2.1. Grundlagen
Germanistik Annika Christof Problembereich Getrennt- und Zusammenschreibung Studienarbeit 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Allgemeines zur Getrennt- und Zusammenschreibung... 2 2.1. Grundlagen
Kopiervorlagen. Rechtschreibung und Wortkunde. Schülerduden. Arbeitsblätter zur Benutzung eines Wörterbuchs zum Üben und Wiederholen 5. bis 10.
 Kopiervorlagen Schülerduden Rechtschreibung und Wortkunde Arbeitsblätter zur Benutzung eines Wörterbuchs zum Üben und Wiederholen 5. bis 10. Klasse Für den Deutschunterricht an Gymnasium, Realschule und
Kopiervorlagen Schülerduden Rechtschreibung und Wortkunde Arbeitsblätter zur Benutzung eines Wörterbuchs zum Üben und Wiederholen 5. bis 10. Klasse Für den Deutschunterricht an Gymnasium, Realschule und
Universität Hamburg. Institut für Germanistik I Seminar 1b: Wort, Name, Begriff Seminarleiter: Prof. Dr. Walther v. Hahn
 Universität Hamburg Institut für Germanistik I 07.137 Seminar 1b: Wort, Name, Begriff Seminarleiter: Prof. Dr. Walther v. Hahn Lexikographie 20.06.2006 Referentin: Yvette Richau Was ist Lexikographie?
Universität Hamburg Institut für Germanistik I 07.137 Seminar 1b: Wort, Name, Begriff Seminarleiter: Prof. Dr. Walther v. Hahn Lexikographie 20.06.2006 Referentin: Yvette Richau Was ist Lexikographie?
Das vernetzte Balkendiagramm
 Das vernetzte Balkendiagramm Von kritischen Wegen in Projekten Die Ausarbeitung stammt aus dem Jahr 1990 und behandelt lediglich das vernetzte Balkendiagramm aus dem Bereich Softwaretechnik. Vernetztes
Das vernetzte Balkendiagramm Von kritischen Wegen in Projekten Die Ausarbeitung stammt aus dem Jahr 1990 und behandelt lediglich das vernetzte Balkendiagramm aus dem Bereich Softwaretechnik. Vernetztes
Der Status der Einheit Wort im Französischen
 Sprachen Rainer Kohlhaupt Der Status der Einheit Wort im Französischen Studienarbeit Der Status der Einheit Wort im Französischen von Rainer Kohlhaupt Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Verschiedene
Sprachen Rainer Kohlhaupt Der Status der Einheit Wort im Französischen Studienarbeit Der Status der Einheit Wort im Französischen von Rainer Kohlhaupt Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Verschiedene
3. Sitzung. Wie schreibe ich eine Hausarbeit?
 3. Sitzung Wie schreibe ich eine Hausarbeit? Inhalt der heutigen Veranstaltung I. Aufgabe einer Hausarbeit II. Schreibprozess III. Themenfindung IV. Elemente einer Hausarbeit V. Fragestellung VI. Hausarbeit
3. Sitzung Wie schreibe ich eine Hausarbeit? Inhalt der heutigen Veranstaltung I. Aufgabe einer Hausarbeit II. Schreibprozess III. Themenfindung IV. Elemente einer Hausarbeit V. Fragestellung VI. Hausarbeit
Skalare Differenzialgleichungen
 3 Skalare Differenzialgleichungen Differenzialgleichungen stellen eine Beziehung her zwischen einer oder mehreren Funktionen und ihren Ableitungen. Da Ableitungen Veränderungen beschreiben, modellieren
3 Skalare Differenzialgleichungen Differenzialgleichungen stellen eine Beziehung her zwischen einer oder mehreren Funktionen und ihren Ableitungen. Da Ableitungen Veränderungen beschreiben, modellieren
Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.
 16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
2.1.3 Interpretation von aussagenlogischen Formeln. 1) Intensionale Interpretation
 2.1.3 Interpretation von aussagenlogischen Formeln 1) Intensionale Interpretation Definition 11: Eine intensionale Interpretation einer aussagenlogischen Formel besteht aus der Zuordnung von Aussagen zu
2.1.3 Interpretation von aussagenlogischen Formeln 1) Intensionale Interpretation Definition 11: Eine intensionale Interpretation einer aussagenlogischen Formel besteht aus der Zuordnung von Aussagen zu
Über die Datenakzessivität in Printwörterbüchern. Einblicke in neuere Entwicklungen einer Theorie der Wörterbuchform *
 Über die Datenakzessivität in Printwörterbüchern. Einblicke in neuere Entwicklungen einer Theorie der Wörterbuchform * Herbert Ernst Wiegand, Germanistisches Seminar, Universität Heidelberg, Heidelberg,
Über die Datenakzessivität in Printwörterbüchern. Einblicke in neuere Entwicklungen einer Theorie der Wörterbuchform * Herbert Ernst Wiegand, Germanistisches Seminar, Universität Heidelberg, Heidelberg,
KAPITEL I EINLEITUNG
 KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
Thesaurus 1. Merkmale:
 Thesaurus 1 Eine Dokumentationssprache ist eine Menge sprachlicher Ausdrücke, die, nach bestimmten Regeln angewendet, der Beschreibung von Dokumenten zum Zweck des Speicherns und einer gezielten Wiederauffindung
Thesaurus 1 Eine Dokumentationssprache ist eine Menge sprachlicher Ausdrücke, die, nach bestimmten Regeln angewendet, der Beschreibung von Dokumenten zum Zweck des Speicherns und einer gezielten Wiederauffindung
Christoph Selter für das Projekt PIK AS, IEEM, TU Dortmund. Die Zahlen sind nach dem Alferbeet geordnet
 Christoph Selter für das Projekt PIK AS, IEEM, TU Dortmund Die Zahlen sind nach dem Alferbeet geordnet 1 1. Entdecken, Beschreiben, Begründen Prozess- und inhaltsbezogene Kompetenzen fördern! Prozessbezogene
Christoph Selter für das Projekt PIK AS, IEEM, TU Dortmund Die Zahlen sind nach dem Alferbeet geordnet 1 1. Entdecken, Beschreiben, Begründen Prozess- und inhaltsbezogene Kompetenzen fördern! Prozessbezogene
Dieses Kapitel vermittelt:
 2 Funktionen Lernziele Dieses Kapitel vermittelt: wie die Abhängigkeit quantitativer Größen mit Funktionen beschrieben wird die erforderlichen Grundkenntnisse elementarer Funktionen grundlegende Eigenschaften
2 Funktionen Lernziele Dieses Kapitel vermittelt: wie die Abhängigkeit quantitativer Größen mit Funktionen beschrieben wird die erforderlichen Grundkenntnisse elementarer Funktionen grundlegende Eigenschaften
- 1 - angeführt. Die Beschleunigung ist die zweite Ableitung des Ortes x nach der Zeit, und das Gesetz lässt sich damit als 2.
 - 1 - Gewöhnliche Differentialgleichungen Teil I: Überblick Ein großer Teil der Grundgesetze der Phsik ist in Form von Gleichungen formuliert, in denen Ableitungen phsikalischer Größen vorkommen. Als Beispiel
- 1 - Gewöhnliche Differentialgleichungen Teil I: Überblick Ein großer Teil der Grundgesetze der Phsik ist in Form von Gleichungen formuliert, in denen Ableitungen phsikalischer Größen vorkommen. Als Beispiel
(fast alles) was Sie schon immer über deutsche Grammatik wissen wollten und einfach nachschlagen können
 (fast alles) was Sie schon immer über deutsche Grammatik wissen wollten und einfach nachschlagen können Seit fast 20 Jahren betreibt das Institut für Deutsche Sprache (IDS) das grammatische Informationssystem
(fast alles) was Sie schon immer über deutsche Grammatik wissen wollten und einfach nachschlagen können Seit fast 20 Jahren betreibt das Institut für Deutsche Sprache (IDS) das grammatische Informationssystem
1.3 Relationen und Funktionen
 1.3. RELATIONEN UND FUNKTIONEN 1 1.3 Relationen und Funktionen Es gibt eine Konstruktion (Übungsaufgabe!) einer Klasse (a, b) mit der Eigenschaft (a, b) = (c, d) a = c b = d. Diese Klasse (a, b) heißt
1.3. RELATIONEN UND FUNKTIONEN 1 1.3 Relationen und Funktionen Es gibt eine Konstruktion (Übungsaufgabe!) einer Klasse (a, b) mit der Eigenschaft (a, b) = (c, d) a = c b = d. Diese Klasse (a, b) heißt
Adressierung in der ein- und zweisprachigen. Eine einführende Übersicht über die Forschungs- und Problemlage
 Adressierung in der ein- und zweisprachigen Lexikographie. Eine einführende Übersicht über die Forschungs- und Problemlage Herbert Ernst Wiegand, Germanistisches Seminar, Universität Heidelberg, Heidelberg,
Adressierung in der ein- und zweisprachigen Lexikographie. Eine einführende Übersicht über die Forschungs- und Problemlage Herbert Ernst Wiegand, Germanistisches Seminar, Universität Heidelberg, Heidelberg,
Über die Datenakzessivität in Printwörterbüchern. Einblicke in neuere Entwicklungen einer Theorie der Wörterbuchform *
 Über die Datenakzessivität in Printwörterbüchern. Einblicke in neuere Entwicklungen einer Theorie der Wörterbuchform * Herbert Ernst Wiegand, Germanistisches Seminar, Universität Heidelberg, Heidelberg,
Über die Datenakzessivität in Printwörterbüchern. Einblicke in neuere Entwicklungen einer Theorie der Wörterbuchform * Herbert Ernst Wiegand, Germanistisches Seminar, Universität Heidelberg, Heidelberg,
Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik
 Hans-Rüdiger Fluck Unter Mitarbeit von Jü Jianhua, Wang Fang, Yuan Jie Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik Einführung in die Fachsprachen und die Didaktik/Methodik des fachorientierten Fremdsprachenunterrichts
Hans-Rüdiger Fluck Unter Mitarbeit von Jü Jianhua, Wang Fang, Yuan Jie Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik Einführung in die Fachsprachen und die Didaktik/Methodik des fachorientierten Fremdsprachenunterrichts
Eine neue Adressierungsart: Positionsadressierung bei indexikalischen Angaben und funktionalen Angabezusätzen
 Eine neue Adressierungsart: Positionsadressierung bei indexikalischen Angaben und funktionalen Angabezusätzen Herbert Ernst Wiegand, Germanistisches Seminar, Universität Heidelberg, Heidelberg, Bundesrepublik
Eine neue Adressierungsart: Positionsadressierung bei indexikalischen Angaben und funktionalen Angabezusätzen Herbert Ernst Wiegand, Germanistisches Seminar, Universität Heidelberg, Heidelberg, Bundesrepublik
Terminologiearbeit und Terminographie. Von Thomas Hopp
 und Terminographie Von Thomas Hopp Datenkategorien Gliederung Terminologiearbeit Datenkategorien zur Terminologieverwaltung Referat Terminologiearbeit Thomas Hopp 3.Semester 2 Datenkategorien Terminologiearbeit
und Terminographie Von Thomas Hopp Datenkategorien Gliederung Terminologiearbeit Datenkategorien zur Terminologieverwaltung Referat Terminologiearbeit Thomas Hopp 3.Semester 2 Datenkategorien Terminologiearbeit
Inhalt. 2. Fragestellung... 21
 Inhalt 1. Hinführung und Vorbemerkungen............................... 12 1.1 «E hoch Dings»: Zum Gegenstand dieser Arbeit................. 12 1.2 Disziplinäre Ausrichtung...................................
Inhalt 1. Hinführung und Vorbemerkungen............................... 12 1.1 «E hoch Dings»: Zum Gegenstand dieser Arbeit................. 12 1.2 Disziplinäre Ausrichtung...................................
1 Darstellung von Modalverben in einschlägigen Grammatiken am Beispiel von Eisenberg (1989) und Engel (1988)
 Textmuster Daniel Händel 2003-2015 (daniel.haendel@rub.de) 1 5 1 Darstellung von Modalverben in einschlägigen Grammatiken am Beispiel von Eisenberg (1989) und Engel (1988) Zur Klassifizierung beziehungsweise
Textmuster Daniel Händel 2003-2015 (daniel.haendel@rub.de) 1 5 1 Darstellung von Modalverben in einschlägigen Grammatiken am Beispiel von Eisenberg (1989) und Engel (1988) Zur Klassifizierung beziehungsweise
WIKI IN EWS Grundlegende Syntaxelemente zur Bearbeitung von Wiki-Artikeln
 WIKI IN EWS Grundlegende Syntaxelemente zur Bearbeitung von Wiki-Artikeln Jede EWS-Veranstaltung umfasst ein Wiki auf Grundlage der Software MediaWiki, auf welcher auch die Online-Ezyklopädie Wikipedia
WIKI IN EWS Grundlegende Syntaxelemente zur Bearbeitung von Wiki-Artikeln Jede EWS-Veranstaltung umfasst ein Wiki auf Grundlage der Software MediaWiki, auf welcher auch die Online-Ezyklopädie Wikipedia
Wissenschaftliches Schreiben. Recherche- und Schreibseminar Melanie Seiß
 Wissenschaftliches Schreiben Recherche- und Schreibseminar Melanie Seiß Inhalt Wissenschaftliche Arbeit Nach Beendigung der Vorarbeit: Gliederung und Literatur mit DozentIn besprechen vor Beginn des Schreibens:
Wissenschaftliches Schreiben Recherche- und Schreibseminar Melanie Seiß Inhalt Wissenschaftliche Arbeit Nach Beendigung der Vorarbeit: Gliederung und Literatur mit DozentIn besprechen vor Beginn des Schreibens:
5.2 Diagonalisierbarkeit und Trigonalisierung
 HINWEIS: Sie finden hier eine vorläufige Kurzfassung des Inhalts; es sind weder Beweise ausgeführt noch ausführliche Beispiele angegeben. Bitte informieren Sie sich in der Vorlesung. c M. Roczen und H.
HINWEIS: Sie finden hier eine vorläufige Kurzfassung des Inhalts; es sind weder Beweise ausgeführt noch ausführliche Beispiele angegeben. Bitte informieren Sie sich in der Vorlesung. c M. Roczen und H.
Zum Wandel der Fremd- und Selbstdarstellung in Heirats- und Kontaktanzeigen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine empirische Untersuchung
 Zum Wandel der Fremd- und Selbstdarstellung in Heirats- und Kontaktanzeigen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine empirische Untersuchung Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung
Zum Wandel der Fremd- und Selbstdarstellung in Heirats- und Kontaktanzeigen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine empirische Untersuchung Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung
Teil 1 Gleichungen und Ungleichungen
 Teil 1 Gleichungen und Ungleichungen Gleichungen Eine mathematische Gleichung ist eine logische Aussage über die Gleichheit von Termen. Das, was links vom Gleichheitszeichen (=) steht, hat den gleichen
Teil 1 Gleichungen und Ungleichungen Gleichungen Eine mathematische Gleichung ist eine logische Aussage über die Gleichheit von Termen. Das, was links vom Gleichheitszeichen (=) steht, hat den gleichen
Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht
 Germanistik Mohamed Chaabani Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Forschungsarbeit 1 Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Chaabani Mohamed Abstract Gegenstand dieser Arbeit
Germanistik Mohamed Chaabani Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Forschungsarbeit 1 Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Chaabani Mohamed Abstract Gegenstand dieser Arbeit
Kapitel 6. Fixpunkte und semantische Bereiche
 Kapitel 6 Fixpunkte und semantische Bereiche Sowohl bei der Definition der operationalen Semantik als auch bei der Definition der mathematischen Semantik haben wir mehr oder weniger explizit Fixpunkte
Kapitel 6 Fixpunkte und semantische Bereiche Sowohl bei der Definition der operationalen Semantik als auch bei der Definition der mathematischen Semantik haben wir mehr oder weniger explizit Fixpunkte
Lexikalische Semantik. Was ist ein Wort? Was ist in einem Wort?
 Lexikalische Semantik Was ist ein Wort? Was ist in einem Wort? Was ist ein Wort? Er machte nicht viele Wörter. Deine Wörter in Gottes Ohr! Ich stehe zu meinen Wörtern Ein Essay von 4000 Worten Im Deutschen
Lexikalische Semantik Was ist ein Wort? Was ist in einem Wort? Was ist ein Wort? Er machte nicht viele Wörter. Deine Wörter in Gottes Ohr! Ich stehe zu meinen Wörtern Ein Essay von 4000 Worten Im Deutschen
Theoriebedingte Wörterbuchformprobleme. Ein Beitrag zur Wörterbuchkritik und zur Erweiterung der Theorie der Wörterbuchform *
 Theoriebedingte Wörterbuchformprobleme und wörterbuchformbedingte Benutzerprobleme I. Ein Beitrag zur Wörterbuchkritik und zur Erweiterung der Theorie der Wörterbuchform * Herbert Ernst Wiegand, Stellenbosch
Theoriebedingte Wörterbuchformprobleme und wörterbuchformbedingte Benutzerprobleme I. Ein Beitrag zur Wörterbuchkritik und zur Erweiterung der Theorie der Wörterbuchform * Herbert Ernst Wiegand, Stellenbosch
Ausgewählte neuartige Komponenten der Wörterbuchform in deutschen und englischen einsprachigen Lernerwörterbüchern
 Herbert Ernst Wiegand Ausgewählte neuartige Komponenten der Wörterbuchform in deutschen und englischen einsprachigen Lernerwörterbüchern 1. Vorbemerkung 2. Benutzerfreundliche Hilfen für den externen Zugriff
Herbert Ernst Wiegand Ausgewählte neuartige Komponenten der Wörterbuchform in deutschen und englischen einsprachigen Lernerwörterbüchern 1. Vorbemerkung 2. Benutzerfreundliche Hilfen für den externen Zugriff
7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten
 7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten Zwischenresümee 1. Logik ist ein grundlegender Teil der Lehre vom richtigen Argumentieren. 2. Speziell geht es der Logik um einen spezifischen Aspekt der Güte
7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten Zwischenresümee 1. Logik ist ein grundlegender Teil der Lehre vom richtigen Argumentieren. 2. Speziell geht es der Logik um einen spezifischen Aspekt der Güte
2. Symmetrische Gruppen
 14 Andreas Gathmann 2 Symmetrische Gruppen Im letzten Kapitel haben wir Gruppen eingeführt und ihre elementaren Eigenschaften untersucht Wir wollen nun eine neue wichtige Klasse von Beispielen von Gruppen
14 Andreas Gathmann 2 Symmetrische Gruppen Im letzten Kapitel haben wir Gruppen eingeführt und ihre elementaren Eigenschaften untersucht Wir wollen nun eine neue wichtige Klasse von Beispielen von Gruppen
Makro- und mikrostrukturelle Präsentationsprobleme bei Phrasemen in allgemeinen einsprachigen Wörterbüchern. Vorschläge für ihre Lösung
 1 Herbert Ernst Wiegand Makro- und mikrostrukturelle Präsentationsprobleme bei Phrasemen in allgemeinen einsprachigen Wörterbüchern. Vorschläge für ihre Lösung 1. Vorbemerkungen Reflektieren überhaupt
1 Herbert Ernst Wiegand Makro- und mikrostrukturelle Präsentationsprobleme bei Phrasemen in allgemeinen einsprachigen Wörterbüchern. Vorschläge für ihre Lösung 1. Vorbemerkungen Reflektieren überhaupt
B Grundbegriffe zu Mengen und Abbildungen
 B Grundbegriffe zu Mengen und Abbildungen Die Sprache der Mengen und Abbildungen hat sich als Basissprache in der modernen Mathematik durchgesetzt. Da sie sehr praktisch ist, wird sie auch in diesem Buch
B Grundbegriffe zu Mengen und Abbildungen Die Sprache der Mengen und Abbildungen hat sich als Basissprache in der modernen Mathematik durchgesetzt. Da sie sehr praktisch ist, wird sie auch in diesem Buch
URIEL WEINREICH. Sprachen in Kontakt. Ergebnisse und Probleme der Zweisprachigkeitsforschung. Mit einem Vorwort von Andre Martinet
 URIEL WEINREICH Sprachen in Kontakt Ergebnisse und Probleme der Zweisprachigkeitsforschung Mit einem Vorwort von Andre Martinet Herausgegeben und mit einem Nachwort zur deutschen Ausgabe versehen von A.
URIEL WEINREICH Sprachen in Kontakt Ergebnisse und Probleme der Zweisprachigkeitsforschung Mit einem Vorwort von Andre Martinet Herausgegeben und mit einem Nachwort zur deutschen Ausgabe versehen von A.
Beurteilungsbogen für schriftliche Hausarbeiten. Form:
 Beurteilungsbogen für schriftliche Hausarbeiten Name der_des Student_in: Veranstaltung und Semester: Hausarbeitstitel: Länge: Datum: Form: Deckblatt 2 Auflistung aller notwendigen Informationen 1 Angemessene
Beurteilungsbogen für schriftliche Hausarbeiten Name der_des Student_in: Veranstaltung und Semester: Hausarbeitstitel: Länge: Datum: Form: Deckblatt 2 Auflistung aller notwendigen Informationen 1 Angemessene
Welcher Platz gebührt der Geschichte der Mathematik in einer Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften?
 Welcher Platz gebührt der Geschichte der Mathematik in einer Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften? Von G. ENESTRöM aus Stockholm. Die Beantwortung der Frage, die ich heute zu behandeln beabsichtige,
Welcher Platz gebührt der Geschichte der Mathematik in einer Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften? Von G. ENESTRöM aus Stockholm. Die Beantwortung der Frage, die ich heute zu behandeln beabsichtige,
Phraseologie der deutschen Gegen warts sprache
 Wolfgang Fleischer Phraseologie der deutschen Gegen warts sprache 2., durchgesehene und ergdnzte Auflage Max Niemeyer Verlag Tubingen 1997 Inhaltsverzeichnis Vorwort IX 1. Geschichte und Hauptprobleme
Wolfgang Fleischer Phraseologie der deutschen Gegen warts sprache 2., durchgesehene und ergdnzte Auflage Max Niemeyer Verlag Tubingen 1997 Inhaltsverzeichnis Vorwort IX 1. Geschichte und Hauptprobleme
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
 Österreichisches Sprachdiplom Deutsch Allgemeiner Aufbau der Lernziellisten - Die Inhalte der Lernzielbeschreibungen im Detail A1. Sprechhandlungen Im jeweiligen Themenbereich werden unter Punkt Sprechhandlungen
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch Allgemeiner Aufbau der Lernziellisten - Die Inhalte der Lernzielbeschreibungen im Detail A1. Sprechhandlungen Im jeweiligen Themenbereich werden unter Punkt Sprechhandlungen
L I S E - M E I T N E R - G Y M N A S I U M L E V E R K U S E N
 L E V E R K U S E N H A U S C U R R I C U L U M D E U T S C H Jahrgangsstufen 5/6 Lehrwerk: Deutschbuch (Cornelsen Neue Ausgabe) (im Folgenden DB) Klasse 5 Gegenstand Sprechen und Zuhören Schreiben 5.1
L E V E R K U S E N H A U S C U R R I C U L U M D E U T S C H Jahrgangsstufen 5/6 Lehrwerk: Deutschbuch (Cornelsen Neue Ausgabe) (im Folgenden DB) Klasse 5 Gegenstand Sprechen und Zuhören Schreiben 5.1
Das diesem Dokument zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen
 Das diesem Dokument zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 16OH21005 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser
Das diesem Dokument zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 16OH21005 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser
3.4 Der Gaußsche Algorithmus
 94 34 Der Gaußsche Algorithmus Wir kommen jetzt zur expliziten numerischen Lösung des eingangs als eine Motivierung für die Lineare Algebra angegebenen linearen Gleichungssystems 341 n 1 a ik x k = b i,
94 34 Der Gaußsche Algorithmus Wir kommen jetzt zur expliziten numerischen Lösung des eingangs als eine Motivierung für die Lineare Algebra angegebenen linearen Gleichungssystems 341 n 1 a ik x k = b i,
Grundbegriffe der Mengenlehre
 Grundbegriffe der Mengenlehre Krzysztof P. Rybakowski Universität Rostock Fachbereich Mathematik 2003 11 07 1 Vorbemerkungen Ohne die Sprache der Mengenlehre lässt sich Mathematik nicht verstehen. Die
Grundbegriffe der Mengenlehre Krzysztof P. Rybakowski Universität Rostock Fachbereich Mathematik 2003 11 07 1 Vorbemerkungen Ohne die Sprache der Mengenlehre lässt sich Mathematik nicht verstehen. Die
Belastungs-Beanpruchungs-Konzept und Gefährdungsbeurteilung
 Belastungs-Beanpruchungs-Konzept und Gefährdungsbeurteilung von Wolfgang Laurig Die Begriffe "Belastung" und "Beanspruchung" Eine erste Verwendung der beiden Worte Belastung" und Beanspruchung" mit Hinweisen
Belastungs-Beanpruchungs-Konzept und Gefährdungsbeurteilung von Wolfgang Laurig Die Begriffe "Belastung" und "Beanspruchung" Eine erste Verwendung der beiden Worte Belastung" und Beanspruchung" mit Hinweisen
Bachelorarbeit. Was ist zu tun?
 Bachelorarbeit Was ist zu tun? Titelseite Zusammenfassung/Summary Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Einleitung Material und Methoden Ergebnisse Diskussion Ausblick Literaturverzeichnis Danksagung
Bachelorarbeit Was ist zu tun? Titelseite Zusammenfassung/Summary Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Einleitung Material und Methoden Ergebnisse Diskussion Ausblick Literaturverzeichnis Danksagung
Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:
 18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
Einführung. Gegenstandsbereich der Syntax. Ansatzabhängigkeit der syntaktischen Beschreibungen. Grundlegende Unterscheidungen: Wörter und Verwandtes
 Einführung Gegenstandsbereich der Syntax Ansatzabhängigkeit der syntaktischen Beschreibungen Grundlegende Unterscheidungen: Wörter und Verwandtes Allgemeine Syntax vs Syntax des Deutschen Idiolekte und
Einführung Gegenstandsbereich der Syntax Ansatzabhängigkeit der syntaktischen Beschreibungen Grundlegende Unterscheidungen: Wörter und Verwandtes Allgemeine Syntax vs Syntax des Deutschen Idiolekte und
Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert
 VitDovalil Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert Die Entwicklung in ausgesuchten Bereichen der Grammatik PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften 0. Vorwort.
VitDovalil Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert Die Entwicklung in ausgesuchten Bereichen der Grammatik PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften 0. Vorwort.
Ordinalzahlen. Sei (X, ) eine total geordnete Menge und a X. Dann
 Ordinalzahlen Im Rahmen der Ordnungsrelationen wurden bisher die Begriffe Partialordnung und Totalordnung (lineare Ordnung) erwähnt. Ein weiterer wichtiger Ordnungsbegriff ist die Wohlordnung. Wohlgeordnete
Ordinalzahlen Im Rahmen der Ordnungsrelationen wurden bisher die Begriffe Partialordnung und Totalordnung (lineare Ordnung) erwähnt. Ein weiterer wichtiger Ordnungsbegriff ist die Wohlordnung. Wohlgeordnete
ER-Modell, Normalisierung
 ER-Modell Mit dem Entity-Relationship-Modell kann die grundlegende Tabellen- und Beziehungsstruktur einer Datenbank strukturiert entworfen und visualisiert werden. Das fertige ER-Modell kann dann ganz
ER-Modell Mit dem Entity-Relationship-Modell kann die grundlegende Tabellen- und Beziehungsstruktur einer Datenbank strukturiert entworfen und visualisiert werden. Das fertige ER-Modell kann dann ganz
Adressierung in der ein- und zweisprachigen. Eine einfiihrende Ubersicht tiber die Forschungs- und Problemlage
 Adressierung in der ein- und zweisprachigen Lex~~ographie. Eine einfiihrende Ubersicht tiber die Forschungs- und Problemlage Herbert Ernst Wiegand, Germanistisches Seminar, Universitiit Heidelberg, Heidelberg,
Adressierung in der ein- und zweisprachigen Lex~~ographie. Eine einfiihrende Ubersicht tiber die Forschungs- und Problemlage Herbert Ernst Wiegand, Germanistisches Seminar, Universitiit Heidelberg, Heidelberg,
Morphologische Merkmale. Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle
 Morphologische Merkmale Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle Merkmale Das Wort 'Merkmal' ' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft'
Morphologische Merkmale Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle Merkmale Das Wort 'Merkmal' ' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft'
Objektorientierte Modellierung (1)
 Objektorientierte Modellierung (1) Die objektorientierte Modellierung verwendet: Klassen und deren Objekte Beziehungen zwischen Objekten bzw. Klassen Klassen und Objekte Definition Klasse Eine Klasse ist
Objektorientierte Modellierung (1) Die objektorientierte Modellierung verwendet: Klassen und deren Objekte Beziehungen zwischen Objekten bzw. Klassen Klassen und Objekte Definition Klasse Eine Klasse ist
1 Zahlentheorie. 1.1 Kongruenzen
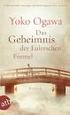 3 Zahlentheorie. Kongruenzen Der letzte Abschnitt zeigte, daß es sinnvoll ist, mit großen Zahlen möglichst einfach rechnen zu können. Oft kommt es nicht darauf, an eine Zahl im Detail zu kennen, sondern
3 Zahlentheorie. Kongruenzen Der letzte Abschnitt zeigte, daß es sinnvoll ist, mit großen Zahlen möglichst einfach rechnen zu können. Oft kommt es nicht darauf, an eine Zahl im Detail zu kennen, sondern
3. Relationen Erläuterungen und Schreibweisen
 3. Relationen Eine Relation ist allgemein eine Beziehung, die zwischen Dingen bestehen kann. Relationen im Sinne der Mathematik sind ausschließlich diejenigen Beziehungen, bei denen stets klar ist, ob
3. Relationen Eine Relation ist allgemein eine Beziehung, die zwischen Dingen bestehen kann. Relationen im Sinne der Mathematik sind ausschließlich diejenigen Beziehungen, bei denen stets klar ist, ob
Logik und modelltheoretische Semantik. Was ist Bedeutung?
 Logik und modelltheoretische Semantik Was ist Bedeutung? Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 30.5.2017 Zangenfeind: Was ist Bedeutung? 1 / 19 Zunächst: der
Logik und modelltheoretische Semantik Was ist Bedeutung? Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 30.5.2017 Zangenfeind: Was ist Bedeutung? 1 / 19 Zunächst: der
Aufbau der Klausur Controlling 2
 Aufbau der Klausur Controlling 2 Erster Teil der Klausur Bearbeitungsdauer 60 Minuten (d. h. 60 Punkte) Genau ein Thema aus mehreren Themen ist zu beantworten Es sind Zusammenhänge problemorientiert zu
Aufbau der Klausur Controlling 2 Erster Teil der Klausur Bearbeitungsdauer 60 Minuten (d. h. 60 Punkte) Genau ein Thema aus mehreren Themen ist zu beantworten Es sind Zusammenhänge problemorientiert zu
Die mathematische Seite
 Kellerautomaten In der ersten Vorlesung haben wir den endlichen Automaten kennengelernt. Mit diesem werden wir uns in der zweiten Vorlesung noch etwas eingängiger beschäftigen und bspw. Ansätze zur Konstruktion
Kellerautomaten In der ersten Vorlesung haben wir den endlichen Automaten kennengelernt. Mit diesem werden wir uns in der zweiten Vorlesung noch etwas eingängiger beschäftigen und bspw. Ansätze zur Konstruktion
Kurs: Lexikographie und Korpora (Gergely Pethő), 6. Sitzung
 DIE LEXIKOGRAPHISCHE DEFINITION Kurs: Lexikographie und Korpora (Gergely Pethő), 6. Sitzung 2002. 04. 05. 12 00 Uhr, Universität Debrecen, Institut für Germanistik I. Arten von Bedeutungsangaben a) lemmatisch
DIE LEXIKOGRAPHISCHE DEFINITION Kurs: Lexikographie und Korpora (Gergely Pethő), 6. Sitzung 2002. 04. 05. 12 00 Uhr, Universität Debrecen, Institut für Germanistik I. Arten von Bedeutungsangaben a) lemmatisch
Dante Bemabei. Der Bindestrich. Vorschlas zur Systematisierung. PETER LANG Europäischer Verla3 der Wissenschaften
 Dante Bemabei Der Bindestrich Vorschlas zur Systematisierung PETER LANG Europäischer Verla3 der Wissenschaften Inhaltsverzeichnis 1 EINLEITUNG 11 2 EINFÜHRUNG IN DIE PROBLEMATIK 14 2.1 Historische Aspekte
Dante Bemabei Der Bindestrich Vorschlas zur Systematisierung PETER LANG Europäischer Verla3 der Wissenschaften Inhaltsverzeichnis 1 EINLEITUNG 11 2 EINFÜHRUNG IN DIE PROBLEMATIK 14 2.1 Historische Aspekte
L L. Titel. Gegenstand/ Schulstufe. Bezug zum Fachlehrplan. Bezug zu BiSt. Von der Praxis für die Praxis
 Titel Gegenstand/ Schulstufe Bezug zum Fachlehrplan Bezug zu BiSt Die Beschreibung Deutsch, Lesen, Schreiben 4. Schulstufe Deutsch, Lesen, Schreiben BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE Verfassen von Texten: Im Teilbereich
Titel Gegenstand/ Schulstufe Bezug zum Fachlehrplan Bezug zu BiSt Die Beschreibung Deutsch, Lesen, Schreiben 4. Schulstufe Deutsch, Lesen, Schreiben BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE Verfassen von Texten: Im Teilbereich
13 Auswahlaxiom und Zornsches Lemma
 13 Auswahlaxiom und Zornsches Lemma Handout zur Funktionalanalysis I von H. Glöckner, 25.11.2008 Wichtige Teile der modernen Mathematik beruhen auf dem sogenannten Auswahlaxiom der Mengenlehre. Dieses
13 Auswahlaxiom und Zornsches Lemma Handout zur Funktionalanalysis I von H. Glöckner, 25.11.2008 Wichtige Teile der modernen Mathematik beruhen auf dem sogenannten Auswahlaxiom der Mengenlehre. Dieses
Hinweise zum Verfassen von Bachelor- und Masterarbeiten
 Hinweise zum Verfassen von Bachelor- und Masterarbeiten Allgemeine Hinweise - BSc und MSc Arbeiten folgen demselben Schema und unterscheiden sich lediglich im Umfang - Schrift 12 pt Times oder 11 pt Arial/Helvetica,
Hinweise zum Verfassen von Bachelor- und Masterarbeiten Allgemeine Hinweise - BSc und MSc Arbeiten folgen demselben Schema und unterscheiden sich lediglich im Umfang - Schrift 12 pt Times oder 11 pt Arial/Helvetica,
Kapitel 25 Checklisten für die Beurteilung psychologischer Gutachten durch Fachfremde
 Kapitel 25 Checklisten für die Beurteilung psychologischer Gutachten durch Fachfremde Westhoff, K. & Kluck, M.-L. (2008 5 ). Psychologische Gutachten schreiben und beurteilen. Heidelberg: Springer. GH
Kapitel 25 Checklisten für die Beurteilung psychologischer Gutachten durch Fachfremde Westhoff, K. & Kluck, M.-L. (2008 5 ). Psychologische Gutachten schreiben und beurteilen. Heidelberg: Springer. GH
Plank, WS 03/04, EinfLing, M&S 4b 1 Morphologische Analyse:
 Plank, WS 03/04, EinfLing, M&S 4b 1 Morphologische Analyse: Segmentieren in Morphe (gegebenenfalls) Zusammenfassen von Morphen als Realisierungen eines Morphems Erfassen von Allomorphie-Beziehungen (Art
Plank, WS 03/04, EinfLing, M&S 4b 1 Morphologische Analyse: Segmentieren in Morphe (gegebenenfalls) Zusammenfassen von Morphen als Realisierungen eines Morphems Erfassen von Allomorphie-Beziehungen (Art
Pronomen Überblicksübung: Lösung
 Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten : Bestimmung der Überblick: Lösung 1 Überblicksübung: Lösung Unterstreiche zuerst in folgenden Sätzen alle (inklusive Artikel). Gib dann alle grammatischen Merkmale
Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten : Bestimmung der Überblick: Lösung 1 Überblicksübung: Lösung Unterstreiche zuerst in folgenden Sätzen alle (inklusive Artikel). Gib dann alle grammatischen Merkmale
Obligatorik Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
 Obligatorik Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Unterrichtsvorhaben Erlebnisse im Alltag spannend erzählen (Kap. 3) Rechtschreibung und Wortbildung (Lehrbuch Kap. 7) Sachtexte lesen (Kap. 4.2) Allerlei Wörter -Wortarten
Obligatorik Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Unterrichtsvorhaben Erlebnisse im Alltag spannend erzählen (Kap. 3) Rechtschreibung und Wortbildung (Lehrbuch Kap. 7) Sachtexte lesen (Kap. 4.2) Allerlei Wörter -Wortarten
1 Goldener Schnitt Pascalsches Dreieck Der Binomische Lehrsatz ( ) ß mit a multipliziert. ( a+ b) 4 = a 3 +3a 2 b+3ab 2 + b 3
 1 Goldener Schnitt Pascalsches Dreieck 17 1.3 Pascalsches Dreieck 1.3.1 Der Binomische Lehrsatz Aus der Schule ist Ihnen mit Sicherheit die Binomische Regel bekannt: ( ) 2 = a 2 +2ab+ b 2 a+ b Diese Regel
1 Goldener Schnitt Pascalsches Dreieck 17 1.3 Pascalsches Dreieck 1.3.1 Der Binomische Lehrsatz Aus der Schule ist Ihnen mit Sicherheit die Binomische Regel bekannt: ( ) 2 = a 2 +2ab+ b 2 a+ b Diese Regel
Das Kurzwort im Deutschen
 Dorothea Kobler-Trül Das Kurzwort im Deutschen Eine Untersuchung zu Definition, Typologie und Entwicklung Max Niemeyer Verlag Tübingen 1994 Inhaltsverzeichnis Vorwort Verzeichnis der in dieser Arbeit verwendeten
Dorothea Kobler-Trül Das Kurzwort im Deutschen Eine Untersuchung zu Definition, Typologie und Entwicklung Max Niemeyer Verlag Tübingen 1994 Inhaltsverzeichnis Vorwort Verzeichnis der in dieser Arbeit verwendeten
How to read a book. Vier Lesestufen. Folie 1. Folie 2. Folie 3. Lesen und Notieren. Der Klassiker. (1972) von Mortimer J. Adler & Charles v.
 Folie 1 Lesen und Notieren Prof Dr Fred Karl Veranstaltung Wissenschaftliches Arbeiten / Generationen und das lange Leben Sommersemester 2006 Folie 2 Der Klassiker How to read a book (1972) von Mortimer
Folie 1 Lesen und Notieren Prof Dr Fred Karl Veranstaltung Wissenschaftliches Arbeiten / Generationen und das lange Leben Sommersemester 2006 Folie 2 Der Klassiker How to read a book (1972) von Mortimer
Deutsch. Bachelor Lehrveranstaltungen
 en Dozent/in:: Dr. Radka Ivanova Christo Stanchev Stanislava Stoeva. e Gegenwartssprache Sprachpraktischer Kurs Mikaela Petkova - Kesanlis Lilia Burova Denitza Dimitrova Georgi Marinov Diana Nikolova Dr.
en Dozent/in:: Dr. Radka Ivanova Christo Stanchev Stanislava Stoeva. e Gegenwartssprache Sprachpraktischer Kurs Mikaela Petkova - Kesanlis Lilia Burova Denitza Dimitrova Georgi Marinov Diana Nikolova Dr.
Terminologie zum Dreyer & Bosse BHKW 110 kw
 Terminologie zum Dreyer & Bosse BHKW 110 kw Teilgruppe 1: Terminologische Erfassung der Fachwörter des Dreyer & Bosse BHKW 110 kw Begriffe des Textkorpus von % bis Bedienelement Bearbeitet von: Lars Nordmann
Terminologie zum Dreyer & Bosse BHKW 110 kw Teilgruppe 1: Terminologische Erfassung der Fachwörter des Dreyer & Bosse BHKW 110 kw Begriffe des Textkorpus von % bis Bedienelement Bearbeitet von: Lars Nordmann
B E N U T Z E R D O K U M E N TA T I O N ( A L E P H I N O
 B E N U T Z E R D O K U M E N TA T I O N ( A L E P H I N O 5. 0 ) Thesaurus Ex Libris Deutschland GmbH (2014) Version 5.0 Zuletzt aktualisiert: 21.07.2014 1 DEFINITION...3 2 ERFASSUNG VON THESAURUSBEGRIFFEN...3
B E N U T Z E R D O K U M E N TA T I O N ( A L E P H I N O 5. 0 ) Thesaurus Ex Libris Deutschland GmbH (2014) Version 5.0 Zuletzt aktualisiert: 21.07.2014 1 DEFINITION...3 2 ERFASSUNG VON THESAURUSBEGRIFFEN...3
Summen, Indices und Multiindices
 Summen, Indices und Multiindices 1 Einleitung Möchten wir zwei Zahlen a und b addieren, so schreiben wir für gewöhnlich a + b. Genauso schreiben wir a + b + c, für die Summe von drei Zahlen a, b und c.
Summen, Indices und Multiindices 1 Einleitung Möchten wir zwei Zahlen a und b addieren, so schreiben wir für gewöhnlich a + b. Genauso schreiben wir a + b + c, für die Summe von drei Zahlen a, b und c.
Demo für
 SUMMENZEICHEN Regeln und Anwendungen Gebrauchs des Summenzeichens mit Aufgaben aus vielen Bereichen für Angela Datei Nr. 4 Stand:. Oktober INTERNETBIBLIOTHEK FÜR SCHULMATHEMATIK Demo für 4 Summenzeichen
SUMMENZEICHEN Regeln und Anwendungen Gebrauchs des Summenzeichens mit Aufgaben aus vielen Bereichen für Angela Datei Nr. 4 Stand:. Oktober INTERNETBIBLIOTHEK FÜR SCHULMATHEMATIK Demo für 4 Summenzeichen
24. Mathematik Olympiade 1. Stufe (Schulolympiade) Klasse 7 Saison 1984/1985 Aufgaben und Lösungen
 4. Mathematik Olympiade 1. Stufe (Schulolympiade) Klasse 7 Saison 1984/1985 Aufgaben und Lösungen 1 OJM 4. Mathematik-Olympiade 1. Stufe (Schulolympiade) Klasse 7 Aufgaben Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen
4. Mathematik Olympiade 1. Stufe (Schulolympiade) Klasse 7 Saison 1984/1985 Aufgaben und Lösungen 1 OJM 4. Mathematik-Olympiade 1. Stufe (Schulolympiade) Klasse 7 Aufgaben Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen
Die Analyse elektronischer Textkorpora als Methode linguistischer Untersuchungen
 Die Analyse elektronischer Textkorpora als Methode linguistischer Untersuchungen Stefan Engelberg Seminar, Marmara-Universität Istanbul, FS 2009 http://www.ids-mannheim.de/ll/lehre/engelberg/ Webseite_Korpusanalyse/Korpusanalyse.html
Die Analyse elektronischer Textkorpora als Methode linguistischer Untersuchungen Stefan Engelberg Seminar, Marmara-Universität Istanbul, FS 2009 http://www.ids-mannheim.de/ll/lehre/engelberg/ Webseite_Korpusanalyse/Korpusanalyse.html
Wie verstehen wir etwas? sprachliche Äußerungen. Sprachphilosophie, Bedeutungstheorie. Personen mit ihren geistigen Eigenschaften in der Welt
 Donald Davidson *1917 in Springfield, Massachusetts, USA Studium in Harvard, 1941 abgeschlossen mit einem Master in Klassischer Philosophie 1949 Promotion in Harvard über Platons Philebus Unter Quines
Donald Davidson *1917 in Springfield, Massachusetts, USA Studium in Harvard, 1941 abgeschlossen mit einem Master in Klassischer Philosophie 1949 Promotion in Harvard über Platons Philebus Unter Quines
Einführung in die Informatik I (autip)
 Einführung in die Informatik I (autip) Dr. Stefan Lewandowski Fakultät 5: Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik Abteilung Formale Konzepte Universität Stuttgart 24. Oktober 2007 Was Sie bis
Einführung in die Informatik I (autip) Dr. Stefan Lewandowski Fakultät 5: Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik Abteilung Formale Konzepte Universität Stuttgart 24. Oktober 2007 Was Sie bis
2. Stetige lineare Funktionale
 -21-2. Stetige lineare Funktionale Die am Ende von 1 angedeutete Eigenschaft, die ein lineares Funktional T : D(ú) 6 verallgemeinerten Funktion macht, ist die Stetigkeit von T in jedem n 0 0 D(ú). Wenn
-21-2. Stetige lineare Funktionale Die am Ende von 1 angedeutete Eigenschaft, die ein lineares Funktional T : D(ú) 6 verallgemeinerten Funktion macht, ist die Stetigkeit von T in jedem n 0 0 D(ú). Wenn
Erkenntnis: Was kann ich wissen?
 Erkenntnis: Was kann ich wissen? Philosophie Die Grundfragen Immanuel Kants Hochschule Aalen, 26.03.18 Karl Mertens Immanuel Kant, Logik (AA IX, 23-25, bes. 25): "Philosophie ist also das System der philosophischen
Erkenntnis: Was kann ich wissen? Philosophie Die Grundfragen Immanuel Kants Hochschule Aalen, 26.03.18 Karl Mertens Immanuel Kant, Logik (AA IX, 23-25, bes. 25): "Philosophie ist also das System der philosophischen
Französisch (2. FS): Kompetenzraster zum gemeinsamen Bildungsplan 2016 Sek I
 LSF 1 LSF 2 LSF 3 LSF 4 LSF 5 LSF 6 VERSTEHEN SPRECHEN SCHREIBEN SPRAC H MITTE LN SPRA CHLI CHE MITT EL 1 Ich kann verstehen, was ich höre 2 Methoden und 3 Ich kann Texte lesen und verstehen. 4 Ich kann
LSF 1 LSF 2 LSF 3 LSF 4 LSF 5 LSF 6 VERSTEHEN SPRECHEN SCHREIBEN SPRAC H MITTE LN SPRA CHLI CHE MITT EL 1 Ich kann verstehen, was ich höre 2 Methoden und 3 Ich kann Texte lesen und verstehen. 4 Ich kann
