1 Mathematische Grundlagen der Robotik
|
|
|
- Peter Bader
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Robotik - Formelsammlung (powered by LTEX) Seite von 8 Mathematische Grundlagen der Robotik. TI Taschenrechner Befehle [x, x ; x, x ] [ x x ] x x [...] Inverse Matrix [...] (ND CTLOG) T Transponierte Matrix [...] T. Matritzenrechnen.. Vektoren im Raum p B = x B x y B y z B z Transponierung: a T b = (a a... a n ).. Matrizen Multiplikation ( muss gleich viele Spalten haben wie B Zeilen hat). Übersicht Transponierte Matrix: T = [a T ik ] = [a ki] vertauschen der Zeilen mit Spalten Einheitsmatrix: I n = Determinante x Matrix x Matrix [ ] a a det = a a a a a a. a a a det a a a = a a a + a a a + a a a a a a a a a a a a. a a a Null ( = 0) - Wenn eine (n,n)-matrix ist, so wird = 0 unter einer der folgenden Bedingungen: Zwei Zeilen/Spalten sind linear abhängig (gleich oder ein Vielfaches der anderen). lle Elemente einer Zeile/Spalte sind Null. Silvano Ferretti, Sven rnold, rjen Visser. Januar 009
2 Robotik - Formelsammlung (powered by LTEX) Seite von 8.5 Inverse Matrix (Existiert nur wenn Matrix regulär: det 0) x Matrix: [ ] [ ] a b d b = = c d ad bc c a x Matrix: = a b c d e f g h i = ei fh ch bi bf ce fg di ai cg cd af det() dh eg bg ah ae bd.6 Basis Rotationsmatrizen Rotation um die x-chse 0 0 R x (θ) = 0 cosθ sinθ 0 sinθ cosθ Rotation um die y-chse cosβ 0 sinβ R y (β) = 0 0 sinβ 0 cosβ Rotation um die z-chse cosα sinα 0 R z (α) = sinα cosα ufeinanderfolgende Rotationen Koordinatensysteme {}, {B}, {C} mit gleichem Ursprung Körperfestkoordinatensystem (Eulerwinkel) B p = B C R Cp p = B R Bp p = C R Cp C R = B R BC R Raumfestkoordinatensystem ( Roll-Gier-Nick Winkel) B p = B RB C R C R Cp p = B R Bp p = C R Cp C R = B C R B R.8 Konvention rctan : Θ = arctan( y x ) : Θ = + arctan( y Θ = arctan (y, x) = x ) : Θ = + arctan( y x ) 4: Θ = arctan( y x ) sin {}}{ θ = arctan( y, cos {}}{ x ) 4 θ = arctan( y x ) θ = + arctan( y x ) θ = + arctan( y x ) θ = arctan( y x ) 0 θ θ θ θ 0 für +y, +x für +y, x für y, x für y, +x θ = für x = 0, y > 0 θ = für x = 0, y < 0 θ = 0 für x = 0, y = 0 rctan mit TR: R P θ(x, Y ) CHTUNG: X und Y sind vertauscht!!!.9 Rücktransformation auf Winkel Raumfestes Koordinatensystem (X-Y-Z Roll-Gier-Nick Winkel) Rotationsmatrix: B R(α, β, γ) = r r r r r r r r r nsatz: cosβ = r + r sinβ = r Winkel: β = arctan( r, r + r ) α = arctan( r cosβ, r cosβ ) γ = arctan( r cosβ, r cosβ ) wenn β = 90 : α = 0, γ = arctan(r, r ) wenn β = 90 : α = 0, γ = arctan(r, r ) Körperfestes Koordinatensystem (Z-Y-Z Euler Winkel) Rotationsmatrix: B R(α, β, γ) = r r r r r r r r r nsatz: sinβ = r + r cosβ = r Winkel: β = arctan( r + r, r ) α = arctan( r sinβ, r sinβ ) γ = arctan( r sinβ, r sinβ ) wenn β = 0 : α = 0, γ = arctan( r, r ) wenn β = 80 : α = 0, γ = arctan(r, r ) Silvano Ferretti, Sven rnold, rjen Visser. Januar 009
3 Robotik - Formelsammlung (powered by LTEX) Seite von 8.0 Transformations Matrix.0. ufbau (RotationsMatrix und Verschiebung in einer Matrix) r r r o ab Transformationsmatrix: T = r r r o ab x = bei Ortsvektor r r r o ab x = 0 bei Feiem Vektor x.0. Multiplikation Transformations Matrix über mehrere Koordinatensysteme: 0 nt = 0 T T... n n T; B T Transformationsmatrix von Koordinatensystem nach B.0. Punkte in verschiedenen Koordinatensystemen B P = B T P P = B T BP = B T BP. Jacobi Matrix (erklärt durch Beispiel) Die Jacobi-Matrix eines Roboterarms beschreibt die bbildung von Gelenkgeschwindigkeiten auf die Lineargeschwindigkeit des TCP und die zeitlichen Änderungen der Orientierung des End-Effektors bezogen auf ein Referenzkoordinatensystemk z.b. auf das Basiskoordinatensystem O auf. In der Positionsbeschreibung werden alle Parameter die einen Einfluss auf den Greifer haben aufgestellt und dann für die Jakobi-Matrix nach diesen Partiell abgeleitet. Für die Jacobi Matrizen empfehlen sich Kurzschreibweisen c = cos(θ + θ ) s = sin(θ + θ ).. Vorwärtskinematik Geg: Gelenkkoordinaten und Geschwindigkeiten: q; ẋ Ges: Geschwindigkeit des Endeffektors: Ẋ = [ẋẏż α β γ] T Lsg: Jacobi-Matrix = Ẋ = J(q) q Positionsbeschreibung [ ] [ des Endeffektors: ] xe d cosθ = + l cos(θ + θ ) und Φ y e d sinθ + l sin(θ + θ ) e = θ + θ Jacobi-Matrix: J = x e θ y e θ Φ e θ x e d y e d Φ e d x e θ y e θ Φ e θ d sin(θ ) l sin(θ + θ ) cos(θ ) l sin(θ + θ ) = d cos(θ ) + l cos(θ + θ ) sin(θ ) l cos(θ + θ ) 0.. Rückwertskinematik Geg: Geschwindigkeiten des Endeffektors: ẋ Ges: Gelenkgeschwindigkeiten: q Lsg: Jacobi-Matrix = q = J ẋ Singularität: Die Jacobi-Matrix kann in singulären Stellungen nicht invertiert werden (d.h. die Determinante von J ist 0) und der Roboter kann in bestimmten Richtungen keine Bewegungen vornehmen. Mehr: Skript-Kinematik (S. ff) & UB5 Bahnplanung (ufg. )) Silvano Ferretti, Sven rnold, rjen Visser. Januar 009
4 Robotik - Formelsammlung (powered by LTEX) Seite 4 von 8. Denavit-Hartenberg blauf:. Gelenke nummerieren in aufsteigender Reihenfolge. Starten in der Basis mit Nummer null.. Jeden chskörper mit Koordinatensystem belegen.. Die z i -Koordinatenachse muss mit der i+ Gelenkachse zusammenfallen. 4. Die x i -chse liegt entlang der Normalen zwischen der z i und z i -chse und zeigt vom Gelenk i zum Gelenk i+. 5. y i -chsen vervollständigen mit der Rechten-Hand-Regel. (x:daumen, y:zeigfinger, z:mittelfinger) 6. Festlegen der DH-Parameter (siehe DH-Parameter) und eintragen in DH-Tabelle. 7. DH-Matrizen berechnen und miteinander mulitplizieren. nmerkung Koordinatensysteme: z i -chse muss grundsätzlich mit Bewegungsachse des zugehörigen chskörper zusammenfallen. Bei Rotationsgelenken gilt die Rechte-Handregel für Drehungen. Ursprung des Koordinatensystems im Schnittpunkt der Bewegungsachsen. DH-Parameter: Linklänge a i (Fixwert): Linkdrehung α i (Fixwert): Link Offset d i (Variable): Gelenkwinkel θ i (Variable): Für z i - und z i -chse wird die gem. Normale mit Länge a i in x i -Richtung gemessen. Drehwinkel um x i -chse bis z i - und z i -chse in gleiche Richtung zeigen. bstand von x i - und x i -chse entlang der z i -chse. Drehwinkel um z i -chse bis x i - und x i -chse in gleiche Richtung zeigen. DH-Tabelle: Gelenk Nr. Linklänge a i Linkdrehung α i Link Offset d i Gelenkwinkel θ i i i+... DH-Matrizen: cos(θ i ) sin(θ i )cos(α i ) sin(θ i )sin(α i ) a i cos(θ i ) i i T = sin(θ i ) cos(θ i )cos(α i ) cos(θ i )sin(α i ) a i sin(θ i ) 0 sin(α i ) cos(α i ) d i Beispiel: 0 nt = n i= i i T (θ i ) = 0 T T... n n T α i = Linkdrehung a i = Linklänge [chsenabstand] d i = Offset Θ i = Gelenkwinkel Silvano Ferretti, Sven rnold, rjen Visser. Januar 009
5 Robotik - Formelsammlung (powered by LTEX) Seite 5 von 8 Kinematik, Kräfte & Dynamik. Kräfte τ n = 0 J T n 0F n 0 F n = [0 F x,n 0 F y,n 0 F z,n 0 M x,n 0 M y,n 0 M z,n ] T zumbeispiel : τ τ τ = J F x F y F z Silvano Ferretti, Sven rnold, rjen Visser. Januar 009
6 Robotik - Formelsammlung (powered by LTEX) Seite 6 von 8 Wichtige Formeln sin (b) + cos (b) = tan(b) = sin(b) cos(b). Funktionswerte für Winkelargumente deg rad sin cos tan deg rad sin cos deg rad sin cos deg rad sin cos Periodizität cos(a + k ) = cos(a) sin(a + k ) = sin(a) (k Z). Quadrantenbeziehungen sin( a) = sin(a) cos( a) = cos(a) sin( a) = sin(a) cos( a) = cos(a) sin( + a) = sin(a) cos( + a) = cos(a) sin ( a) = sin ( + a) = cos(a) cos ( a) = cos ( + a) = sin(a).4 dditionstheoreme sin(a ± b) = sin(a) cos(b) ± cos(a) sin(b) cos(a ± b) = cos(a) cos(b) sin(a) sin(b) tan(a ± b) = tan(a)±tan(b) tan(a) tan(b).5 Doppel- und Halbwinkel sin(a) = sin(a) cos(a) cos(a) = cos (a) sin (a) = cos (a) = sin (a) cos ( ) a = +cos(a) sin ( ) a = cos(a).6 Summe, Differenz und Produkte sin(a) + sin(b) = sin ( ) ( a+b cos a b ) sin(a) sin(b) = sin ( ) ( a b cos a+b ) cos(a) + cos(b) = cos ( ) ( a+b cos a b ) sin(a) sin(b) = (cos(a b) cos(a+b)) cos(a) cos(b) = sin ( ) ( a+b cos a b ) cos(a) cos(b) = (cos(a b)+cos(a+b)) sin(a) cos(b) = (sin(a b) + sin(a + b)) tan(a) ± tan(b) = sin(a±b) cos(a) cos(b).7 Differentialrechnung a = 0 [a = const.] x = sin(x) = cos(x) cos(x) = sin(x) tan(x) = cos (x) (u + v w) = u + v u (au) = au [a = const.] (uv) = u v + uv ( u v ) = vu uv v (u(v(y(x)))) = u (v)v (y)y (x) Silvano Ferretti, Sven rnold, rjen Visser. Januar 009
7 Robotik - Formelsammlung (powered by LTEX) Seite 7 von 8 4 Symbole und Theorie 4. Darstellung kinematischer Gelenke 4. Bewegungsarten Silvano Ferretti, Sven rnold, rjen Visser. Januar 009
8 Robotik - Formelsammlung (powered by LTEX) Seite 8 von 8 4. PTP-Synchron synchron PTP Synchron PTP Vollsynchron PTP 4.4 Übersicht von Skript und Übungen Silvano Ferretti, Sven rnold, rjen Visser. Januar 009
Basiswissen Matrizen
 Basiswissen Matrizen Mathematik GK 32 Definition (Die Matrix) Eine Matrix A mit m Zeilen und n Spalten heißt m x n Matrix: a a 2 a 4 A a 2 a 22 a 24 a 4 a 42 a 44 Definition 2 (Die Addition von Matrizen)
Basiswissen Matrizen Mathematik GK 32 Definition (Die Matrix) Eine Matrix A mit m Zeilen und n Spalten heißt m x n Matrix: a a 2 a 4 A a 2 a 22 a 24 a 4 a 42 a 44 Definition 2 (Die Addition von Matrizen)
Was ist Robotik? Robotik heute:
 Grundlagen Was ist Robotik? Das Wort Robot / Roboter entstand 92 in einer Geschichte von Karel Ċapek und geht auf das tschechische Wort robota (rbeit, Fronarbeit) zurück. Dessen Ursprung ist das altkirchenslawische
Grundlagen Was ist Robotik? Das Wort Robot / Roboter entstand 92 in einer Geschichte von Karel Ċapek und geht auf das tschechische Wort robota (rbeit, Fronarbeit) zurück. Dessen Ursprung ist das altkirchenslawische
Entwicklung einer allgemeinen dynamischen inversen Kinematik
 Entwicklung einer allgemeinen dynamischen inversen Kinematik Christoph Schmiedecke Studiendepartment Informatik Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 06. Januar 2010 Inhaltsverzeichnis 1 Motivation
Entwicklung einer allgemeinen dynamischen inversen Kinematik Christoph Schmiedecke Studiendepartment Informatik Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 06. Januar 2010 Inhaltsverzeichnis 1 Motivation
Einführung in die Robotik. Jianwei Zhang
 - Jianwei Zhang zhang@informatik.uni-hamburg.de Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften Technische Aspekte Multimodaler Systeme 19. April 2011 J. Zhang 63 Gliederung Allgemeine Informationen
- Jianwei Zhang zhang@informatik.uni-hamburg.de Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften Technische Aspekte Multimodaler Systeme 19. April 2011 J. Zhang 63 Gliederung Allgemeine Informationen
Grundlagen der Robotik Klausur am Musterlösung Nachname: Vorname: Matrikelnummer:
 Prof. Dr. K. Wüst SS 202 Fachbereich MNI TH Mittelhessen Grundlagen der Robotik Klausur am 6.7.202 Musterlösung Nachname: Vorname: Matrikelnummer: Aufgabe Punkte erreicht 22 2 22 3 8 4 8 Bonusfrage 0 Summe
Prof. Dr. K. Wüst SS 202 Fachbereich MNI TH Mittelhessen Grundlagen der Robotik Klausur am 6.7.202 Musterlösung Nachname: Vorname: Matrikelnummer: Aufgabe Punkte erreicht 22 2 22 3 8 4 8 Bonusfrage 0 Summe
Klausur Robotik/Steuerungstechnik
 Prof. Dr. K. Wüst SS 2009 Fachbereich MNI FH Gießen-Friedberg Klausur Robotik/Steuerungstechnik 9.7.2009 Nachname: Vorname: Matrikelnummer: Aufgabe Punkte erreicht 1 30 2 30 3 40 4 20 Summe 120 Mit Lösungen
Prof. Dr. K. Wüst SS 2009 Fachbereich MNI FH Gießen-Friedberg Klausur Robotik/Steuerungstechnik 9.7.2009 Nachname: Vorname: Matrikelnummer: Aufgabe Punkte erreicht 1 30 2 30 3 40 4 20 Summe 120 Mit Lösungen
Lösungen Serie 5 (Determinante)
 Name: Seite: Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) Hochschule für Technik Lösungen Serie 5 (Determinante) Dozent: R Burkhardt Büro: 463 Klasse: Studienjahr Semester: Datum: HS 2008/09 Aufgabe Bestimme
Name: Seite: Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) Hochschule für Technik Lösungen Serie 5 (Determinante) Dozent: R Burkhardt Büro: 463 Klasse: Studienjahr Semester: Datum: HS 2008/09 Aufgabe Bestimme
Einführung in die Robotik. Jianwei Zhang
 - Jianwei Zhang zhang@informatik.uni-hamburg.de Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften Technische Aspekte Multimodaler Systeme 20. April 2010 J. Zhang 63 Gliederung Allgemeine Informationen
- Jianwei Zhang zhang@informatik.uni-hamburg.de Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften Technische Aspekte Multimodaler Systeme 20. April 2010 J. Zhang 63 Gliederung Allgemeine Informationen
1 Definition. 2 Besondere Typen. 2.1 Vektoren und transponieren A = 2.2 Quadratische Matrix. 2.3 Diagonalmatrix. 2.
 Definition Die rechteckige Anordnung von m n Elementen a ij in m Zeilen und n Spalten heißt m n- Matrix. Gewöhnlich handelt es sich bei den Elementen a ij der Matrix um reelle Zahlen. Man nennt das Paar
Definition Die rechteckige Anordnung von m n Elementen a ij in m Zeilen und n Spalten heißt m n- Matrix. Gewöhnlich handelt es sich bei den Elementen a ij der Matrix um reelle Zahlen. Man nennt das Paar
Klausur Mehrkörperdynamik 26/07/2012
 Klausur Mehrkörperdynamik 26/07/2012 Matrikelnummer: Folgende Angaben sind freiwillig: Name, Vorname: Studiengang: Hinweise: Die Bearbeitungszeit der Klausur beträgt zwei Stunden. Zulässige Hilfsmittel
Klausur Mehrkörperdynamik 26/07/2012 Matrikelnummer: Folgende Angaben sind freiwillig: Name, Vorname: Studiengang: Hinweise: Die Bearbeitungszeit der Klausur beträgt zwei Stunden. Zulässige Hilfsmittel
AW 1 - Vortrag. Simulationsmodell für visuell geführte Roboter. von Bernd Pohlmann. Betreuender: Prof. Dr. Andreas Meisel
 AW 1 - Vortrag Simulationsmodell für visuell geführte Roboter von Betreuender: Prof. Dr. Andreas Meisel Inhalt 1. Motivation 2. Ziel 3. Einführung Robotik 4. Kinematik 5. Denavit-Hartenberg 6. Kameramodell
AW 1 - Vortrag Simulationsmodell für visuell geführte Roboter von Betreuender: Prof. Dr. Andreas Meisel Inhalt 1. Motivation 2. Ziel 3. Einführung Robotik 4. Kinematik 5. Denavit-Hartenberg 6. Kameramodell
Gliederung. Gliederung (cont.) Kinematik-Gleichungen - (1) Allgemeine Informationen Einführung Koordinaten eines Manipulators. Kinematik-Gleichungen
 - Gliederung Jianwei Zhang zhang@informatik.uni-hamburg.de Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften Technische Aspekte Multimodaler Systeme 20. April 2010 Allgemeine Informationen Einführung
- Gliederung Jianwei Zhang zhang@informatik.uni-hamburg.de Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften Technische Aspekte Multimodaler Systeme 20. April 2010 Allgemeine Informationen Einführung
Matrizen und Determinanten, Aufgaben
 Matrizen und Determinanten, Aufgaben Inhaltsverzeichnis 1 Multiplikation von Matrizen 1 11 Lösungen 3 2 Determinanten 6 21 Lösungen 7 3 Inverse Matrix 8 31 Lösungen 9 4 Matrizengleichungen 11 41 Lösungen
Matrizen und Determinanten, Aufgaben Inhaltsverzeichnis 1 Multiplikation von Matrizen 1 11 Lösungen 3 2 Determinanten 6 21 Lösungen 7 3 Inverse Matrix 8 31 Lösungen 9 4 Matrizengleichungen 11 41 Lösungen
Musterlösungen Blatt Mathematischer Vorkurs. Sommersemester Dr. O. Zobay. Matrizen
 Musterlösungen Blatt 8 34007 Mathematischer Vorkurs Sommersemester 007 Dr O Zobay Matrizen Welche Matrixprodukte können mit den folgenden Matrizen gebildet werden? ( 4 5 A, B ( 0 9 7, C 8 0 5 4 Wir können
Musterlösungen Blatt 8 34007 Mathematischer Vorkurs Sommersemester 007 Dr O Zobay Matrizen Welche Matrixprodukte können mit den folgenden Matrizen gebildet werden? ( 4 5 A, B ( 0 9 7, C 8 0 5 4 Wir können
Vektoren und Matrizen
 Universität Basel Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum Vektoren und Matrizen Dr. Thomas Zehrt Inhalt: 1. Vektoren (a) Einführung (b) Linearkombinationen (c) Länge eines Vektors (d) Skalarprodukt (e) Geraden
Universität Basel Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum Vektoren und Matrizen Dr. Thomas Zehrt Inhalt: 1. Vektoren (a) Einführung (b) Linearkombinationen (c) Länge eines Vektors (d) Skalarprodukt (e) Geraden
Vektoren und Matrizen
 Vektoren und Matrizen Einführung: Wie wir gesehen haben, trägt der R 2, also die Menge aller Zahlenpaare, eine Körperstruktur mit der Multiplikation (a + bi(c + di ac bd + (ad + bci Man kann jedoch zeigen,
Vektoren und Matrizen Einführung: Wie wir gesehen haben, trägt der R 2, also die Menge aller Zahlenpaare, eine Körperstruktur mit der Multiplikation (a + bi(c + di ac bd + (ad + bci Man kann jedoch zeigen,
Lineare Abbildungen. De nition Seien V, W Vektorräume. Eine Abbildung f : V! W heißt linear, wenn gilt
 Lineare Abbildungen Lineare Abbildungen De nition Seien V, W Vektorräume. Eine Abbildung f : V! W heißt linear, wenn gilt (L. ) f ist homogen; d.h. f( ~v) = f(~v) für alle 2 R, ~v 2 V, (L. ) f ist additiv;
Lineare Abbildungen Lineare Abbildungen De nition Seien V, W Vektorräume. Eine Abbildung f : V! W heißt linear, wenn gilt (L. ) f ist homogen; d.h. f( ~v) = f(~v) für alle 2 R, ~v 2 V, (L. ) f ist additiv;
B. Heimann, W. Gerth, K. Popp: Mechatronik. Dritte, neu bearbeitete Auflage. Carl Hanser Verlag, München, 2007.
 Vorwort Nachfolgend soll die Koordinatentransformation nach Denavit-Hartenberg-Konvention am Beispiel eines realen Industrieroboters demonstriert werden. In der Kürze kann auf die nötigen Grundlagen nicht
Vorwort Nachfolgend soll die Koordinatentransformation nach Denavit-Hartenberg-Konvention am Beispiel eines realen Industrieroboters demonstriert werden. In der Kürze kann auf die nötigen Grundlagen nicht
Die Festlegung der Koordinatensysteme gemäß Denavit-Hartenberg-Konventionen
 1 Die Festlegung der Koordinatensysteme gemäß Denavit-Hartenberg-Konventionen 1. Nummerierung die Armteile Der festgeschraubte Fuß ist Armteil 0, das erste drehbare Armteil ist Armteil 1 usw. Das letzte
1 Die Festlegung der Koordinatensysteme gemäß Denavit-Hartenberg-Konventionen 1. Nummerierung die Armteile Der festgeschraubte Fuß ist Armteil 0, das erste drehbare Armteil ist Armteil 1 usw. Das letzte
Transformation - Homogene Koordinaten. y + b )
 Transformation - Homogene Koordinaten In der "üblichen" Behandlung werden für die Verschiebung (Translation) und die Drehung (Rotation) verschiedene Rechenvorschriften benutzt - einmal Addition von Vektoren
Transformation - Homogene Koordinaten In der "üblichen" Behandlung werden für die Verschiebung (Translation) und die Drehung (Rotation) verschiedene Rechenvorschriften benutzt - einmal Addition von Vektoren
4 Roboterkinematik. Roboterarm und Gelenke
 4 Roboterkinematik Roboterarm und Gelenke 4.1 Grundlegende Begriffe Mechanismus besteht aus einer Anzahl von starren Körpern (Glieder diese sind durch Gelenke verbunden Ein Gelenk verbindet genau zwei
4 Roboterkinematik Roboterarm und Gelenke 4.1 Grundlegende Begriffe Mechanismus besteht aus einer Anzahl von starren Körpern (Glieder diese sind durch Gelenke verbunden Ein Gelenk verbindet genau zwei
Gliederung. Gliederung (cont.) Koordinaten eines Manipulators. Allgemeine Informationen Einführung
 - Gliederung Jianwei Zhang zhang@informatik.uni-hamburg.de Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften Technische Aspekte Multimodaler Systeme 14. April 2009 Allgemeine Informationen Einführung
- Gliederung Jianwei Zhang zhang@informatik.uni-hamburg.de Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften Technische Aspekte Multimodaler Systeme 14. April 2009 Allgemeine Informationen Einführung
Bogenmaß, Trigonometrie und Vektoren
 20 1 Einführung Bogenmaß: Bogenmaß, Trigonometrie und Vektoren Winkel können in Grad ( ) oder im Bogenmaß (Einheit: 1 Radiant, Abkürzung 1 rad) angegeben werden. Dabei gilt 2 rad 360. Die Einheit 1 rad
20 1 Einführung Bogenmaß: Bogenmaß, Trigonometrie und Vektoren Winkel können in Grad ( ) oder im Bogenmaß (Einheit: 1 Radiant, Abkürzung 1 rad) angegeben werden. Dabei gilt 2 rad 360. Die Einheit 1 rad
Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme
 Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme Lineares Gleichungssystem: Ax b, A R m n, x R n, b R m L R m R n Lx Ax Bemerkung b 0 R m Das Gleichungssystem heißt homogen a A0 0 Das LGS ist stets lösbar b Wenn
Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme Lineares Gleichungssystem: Ax b, A R m n, x R n, b R m L R m R n Lx Ax Bemerkung b 0 R m Das Gleichungssystem heißt homogen a A0 0 Das LGS ist stets lösbar b Wenn
2.3.4 Drehungen in drei Dimensionen
 2.3.4 Drehungen in drei Dimensionen Wir verallgemeinern die bisherigen Betrachtungen nun auf den dreidimensionalen Fall. Für Drehungen des Koordinatensystems um die Koordinatenachsen ergibt sich 1 x 1
2.3.4 Drehungen in drei Dimensionen Wir verallgemeinern die bisherigen Betrachtungen nun auf den dreidimensionalen Fall. Für Drehungen des Koordinatensystems um die Koordinatenachsen ergibt sich 1 x 1
2D-Transformationen. Kapitel 6. 6.1 Translation. 6.2 Skalierung
 Kapitel 6 2D-Transformationen Mit Hilfe von Transformationen ist es möglich, die Position, die Orientierung, die Form und die Größe der grafischen Objekte zu manipulieren. Transformationen eines Objekts
Kapitel 6 2D-Transformationen Mit Hilfe von Transformationen ist es möglich, die Position, die Orientierung, die Form und die Größe der grafischen Objekte zu manipulieren. Transformationen eines Objekts
Th. Risse, HSB: MAI WS05 1
 Th. Risse, HSB: MAI WS05 1 Einige Übungsaufgaben zur analytischen Geometrie & linearen Algebra viele weitere Übungsaufgaben mit Lösungen z.b. in Brauch/Dreyer/Haacke, Papula, Stingl, Stöcker, Minorski
Th. Risse, HSB: MAI WS05 1 Einige Übungsaufgaben zur analytischen Geometrie & linearen Algebra viele weitere Übungsaufgaben mit Lösungen z.b. in Brauch/Dreyer/Haacke, Papula, Stingl, Stöcker, Minorski
Inverse Matrix. 1-E Ma 1 Lubov Vassilevskaya
 Inverse Matrix -E Ma Lubov Vassilevskaya Inverse Matrix Eine n-reihige, quadratische Matrix heißt regulär, wenn ihre Determinante einen von Null verschiedenen Wert besitzt. Anderenfalls heißt sie singulär.
Inverse Matrix -E Ma Lubov Vassilevskaya Inverse Matrix Eine n-reihige, quadratische Matrix heißt regulär, wenn ihre Determinante einen von Null verschiedenen Wert besitzt. Anderenfalls heißt sie singulär.
Papierfalten und Algebra
 Arbeitsblätter zum Thema Papierfalten und Algebra en Robert Geretschläger Graz, Österreich 009 Blatt 1 Lösen quadratischer Gleichungen mit Zirkel und Lineal AUFGABE 1 Zeige, dass die x-koordinaten der
Arbeitsblätter zum Thema Papierfalten und Algebra en Robert Geretschläger Graz, Österreich 009 Blatt 1 Lösen quadratischer Gleichungen mit Zirkel und Lineal AUFGABE 1 Zeige, dass die x-koordinaten der
Vorwärtskinematik und inverse Kinematik. Andreas Schmidtke
 Vorwärtskinematik und inverse Kinematik Andreas Schmidtke Übersicht 1. Vorwärtskinematik 2. Standardframes 3. Inverse Kinematik 4. Bemerkungen zur Numerik Übersicht 1. Vorwärtskinematik 1. Modellierung
Vorwärtskinematik und inverse Kinematik Andreas Schmidtke Übersicht 1. Vorwärtskinematik 2. Standardframes 3. Inverse Kinematik 4. Bemerkungen zur Numerik Übersicht 1. Vorwärtskinematik 1. Modellierung
Ziel: Beschreibung der unterschiedlichen Gelenktypen und deren Einfluss auf die Bewegung der Körper
 Kinematik Gelenkkinematik Ziel: Beschreibung der unterschiedlichen Gelenktypen und deren Einfluss auf die Bewegung der Körper Definition: Ein (kinematisches) Gelenk ist eine Verbindung zwischen zwei Segmenten,
Kinematik Gelenkkinematik Ziel: Beschreibung der unterschiedlichen Gelenktypen und deren Einfluss auf die Bewegung der Körper Definition: Ein (kinematisches) Gelenk ist eine Verbindung zwischen zwei Segmenten,
Kinematik (1) Bisher: Darstellung von Vektoren bei bekannten Beziehungen zwischen den Koordinatensystemen
 Kinematik ( Kinematik Bisher: Darstellung von Vektoren bei bekannten Beziehungen zwischen den Koordinatensystemen Jetzt: Beschreibung der Bewegung von mechanischen Systemen Hier nur Behandlung der Position
Kinematik ( Kinematik Bisher: Darstellung von Vektoren bei bekannten Beziehungen zwischen den Koordinatensystemen Jetzt: Beschreibung der Bewegung von mechanischen Systemen Hier nur Behandlung der Position
Aufgaben zur Klausurvorbereitung Mathematik I
 Aufgaben zur Klausurvorbereitung Mathematik I 1 Geben Sie eine Beschreibung der Ebene E im R 3, in der die Punkte p = (3, 9, 1), q = (2, 8, 2) und r = (5, 6, 1) liegen, in Hesse-Normalform an 2 Im Rahmen
Aufgaben zur Klausurvorbereitung Mathematik I 1 Geben Sie eine Beschreibung der Ebene E im R 3, in der die Punkte p = (3, 9, 1), q = (2, 8, 2) und r = (5, 6, 1) liegen, in Hesse-Normalform an 2 Im Rahmen
Transformation Allgemeines Die Lage eines Punktes kann durch einen Ortsvektor (ausgehend vom Ursprung des Koordinatensystems
 Transformation - 1 1. Allgemeines 2. Zwei durch eine Translation verknüpfte gleichartige Basissysteme 3. Zwei durch eine Translation verknüpfte verschiedenartige Basissysteme (noch gleiche Orientierung)
Transformation - 1 1. Allgemeines 2. Zwei durch eine Translation verknüpfte gleichartige Basissysteme 3. Zwei durch eine Translation verknüpfte verschiedenartige Basissysteme (noch gleiche Orientierung)
y x x y ( 2x 3y + z x + z
 Matrizen Aufgabe Sei f R R 3 definiert durch ( ) x 3y x f = x + y y x Berechnen Sie die Matrix Darstellung von f Aufgabe Eine lineare Funktion f hat die Matrix Darstellung A = 0 4 0 0 0 0 0 Berechnen Sie
Matrizen Aufgabe Sei f R R 3 definiert durch ( ) x 3y x f = x + y y x Berechnen Sie die Matrix Darstellung von f Aufgabe Eine lineare Funktion f hat die Matrix Darstellung A = 0 4 0 0 0 0 0 Berechnen Sie
1 Bestimmung der inversen Matrix
 Inhaltsverzeichnis 1 Bestimmung der inversen Matrix Die inverse Matrix A 1 zu einer Matrix A kann nur bestimmt werden, wenn die Determinante der Matrix A von Null verschieden ist. Im folgenden wird die
Inhaltsverzeichnis 1 Bestimmung der inversen Matrix Die inverse Matrix A 1 zu einer Matrix A kann nur bestimmt werden, wenn die Determinante der Matrix A von Null verschieden ist. Im folgenden wird die
Ferienkurs Mathematik für Physiker I Blatt 3 ( )
 Ferienkurs Mathematik für Physiker I WS 6/7 Ferienkurs Mathematik für Physiker I Blatt 3 (9.3.7) Aufgabe : Matrizenrechung 3 (a) Ermitteln Sie für die Matrix A = 3 4 den Ausdruck A + A + A + 6 A3. 3 4
Ferienkurs Mathematik für Physiker I WS 6/7 Ferienkurs Mathematik für Physiker I Blatt 3 (9.3.7) Aufgabe : Matrizenrechung 3 (a) Ermitteln Sie für die Matrix A = 3 4 den Ausdruck A + A + A + 6 A3. 3 4
Einführung in die Matrixalgebra
 Einführung in die Matrixalgebra Sven Garbade Fakultät für Angewandte Psychologie SRH Hochschule Heidelberg sven.garbade@hochschule-heidelberg.de Bachelor S. Garbade (SRH Heidelberg) Matrixalgebra Bachelor
Einführung in die Matrixalgebra Sven Garbade Fakultät für Angewandte Psychologie SRH Hochschule Heidelberg sven.garbade@hochschule-heidelberg.de Bachelor S. Garbade (SRH Heidelberg) Matrixalgebra Bachelor
Zusammenfassung und Beispiellösungen. zur Linearen Algebra
 Zusammenfassung und Beispiellösungen zur Linearen Algebra Inhaltsverzeichnis TI Taschenrechner Funktionen für Matrizen... n*m Matrix... Diagonal und Dreiecksmatrix... Transponierte der Matrix A (AT)...
Zusammenfassung und Beispiellösungen zur Linearen Algebra Inhaltsverzeichnis TI Taschenrechner Funktionen für Matrizen... n*m Matrix... Diagonal und Dreiecksmatrix... Transponierte der Matrix A (AT)...
Prof. J. Zhang Universität Hamburg. AB Technische Aspekte Multimodaler Systeme. 28. Oktober 2004
 zhang@informatik.uni-hamburg.de Universität Hamburg AB Technische Aspekte Multimodaler Systeme zhang@informatik.uni-hamburg.de Inhaltsverzeichnis 2. Koordinaten eines Manipulator.................. 32 Warum
zhang@informatik.uni-hamburg.de Universität Hamburg AB Technische Aspekte Multimodaler Systeme zhang@informatik.uni-hamburg.de Inhaltsverzeichnis 2. Koordinaten eines Manipulator.................. 32 Warum
Nützliches Hilfsmittel (um Schreiberei zu reduzieren): 'Erweiterte Matrix': Gauß- Verfahren
 L5.4 Inverse einer Matrix Ausgangsfrage: Wie löst man ein lineares Gleichungsystem (LSG)? Betrachte n lineare Gleichungen für n Unbekannte: Ziel: durch geeignete Umformungen bringe man das LSG in folgende
L5.4 Inverse einer Matrix Ausgangsfrage: Wie löst man ein lineares Gleichungsystem (LSG)? Betrachte n lineare Gleichungen für n Unbekannte: Ziel: durch geeignete Umformungen bringe man das LSG in folgende
Vektorrechnung. 1. Vektoren im R 2, R 3 Größen in Physik und Technik:
 Vektorrechnung 1. Vektoren im R 2, R 3 Größen in Physik und Technik: - skalare Größen: Länge [m], Zeit [sec], Masse [kg], Energie [N m], elektr. Spannung [V ],... gekennzeichnet durch: Maßzahl ( R) [Maßeinheit]
Vektorrechnung 1. Vektoren im R 2, R 3 Größen in Physik und Technik: - skalare Größen: Länge [m], Zeit [sec], Masse [kg], Energie [N m], elektr. Spannung [V ],... gekennzeichnet durch: Maßzahl ( R) [Maßeinheit]
Matrizen. Stefan Keppeler. 19. & 26. November Mathematik I für Biologen, Geowissenschaftler und Geoökologen
 Mathematik I für Biologen, Geowissenschaftler und Geoökologen 19. & 26. November 2008 Definition, Summe & Produkt Transponierte Beispiel: Einwohnerzahlen Leslie-Populationsmodell Beispiel Addition Multiplikation
Mathematik I für Biologen, Geowissenschaftler und Geoökologen 19. & 26. November 2008 Definition, Summe & Produkt Transponierte Beispiel: Einwohnerzahlen Leslie-Populationsmodell Beispiel Addition Multiplikation
Matrizen. Stefan Keppeler. 28. November Mathematik I für Biologen, Geowissenschaftler und Geoökologen
 Mathematik I für Biologen, Geowissenschaftler und Geoökologen Matrizen 28. November 2007 Summe & Produkt Beispiel: Einwohnerzahlen Beispiel Addition Multiplikation Inverse Addition & Multiplikation Anwendung
Mathematik I für Biologen, Geowissenschaftler und Geoökologen Matrizen 28. November 2007 Summe & Produkt Beispiel: Einwohnerzahlen Beispiel Addition Multiplikation Inverse Addition & Multiplikation Anwendung
++ + = 0 so erhält man eine quadratische Gleichung mit zwei Variablen dx+ey+f = 0 1.1
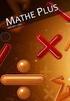 Hauptachsentransformation. Einleitung Schneidet man den geraden Kreiskegel mit der Gleichung = + und die Ebene ++ + = 0 so erhält man eine quadratische Gleichung mit zwei Variablen +2 + +dx+ey+f = 0. Die
Hauptachsentransformation. Einleitung Schneidet man den geraden Kreiskegel mit der Gleichung = + und die Ebene ++ + = 0 so erhält man eine quadratische Gleichung mit zwei Variablen +2 + +dx+ey+f = 0. Die
L5.2 Inverse einer Matrix Betrachte im Folgenden lineare Abbildungen der Form: dann ist die Matrix, durch die A dargestellt wird, 'quadratisch', d.h.
 L5.2 Inverse einer Matrix Betrachte im Folgenden lineare Abbildungen der Form: gleich viel Zeilen wie Spalten dann ist die Matrix, durch die A dargestellt wird, 'quadratisch', d.h. 'Identitätsabbildung':
L5.2 Inverse einer Matrix Betrachte im Folgenden lineare Abbildungen der Form: gleich viel Zeilen wie Spalten dann ist die Matrix, durch die A dargestellt wird, 'quadratisch', d.h. 'Identitätsabbildung':
Höhere Mathematik III WS 05/06 Lösungshinweis Aufgabe G 11 Blatt 2
 Höhere Mathematik III WS 5/6 Lösungshinweis Aufgabe G 11 Blatt Die zu optimierende Zielfunktion ist der Abstand zum Ursprung. Ein bekannter Trick (Vereinfachung der Rechnung) besteht darin, das Quadrat
Höhere Mathematik III WS 5/6 Lösungshinweis Aufgabe G 11 Blatt Die zu optimierende Zielfunktion ist der Abstand zum Ursprung. Ein bekannter Trick (Vereinfachung der Rechnung) besteht darin, das Quadrat
Determinante. Die Determinante. einer quadratischen Matrix A mit Spalten a j kann durch folgende Eigenschaften definiert werden.
 Determinante Die Determinante det A = det(a 1,..., a n ) einer quadratischen Matrix A mit Spalten a j kann durch folgende Eigenschaften definiert werden. Multilineariät: det(..., αa j + βb j,...) = α det(...,
Determinante Die Determinante det A = det(a 1,..., a n ) einer quadratischen Matrix A mit Spalten a j kann durch folgende Eigenschaften definiert werden. Multilineariät: det(..., αa j + βb j,...) = α det(...,
In allen Fällen spielt die 'Determinante' einer Matrix eine zentrale Rolle.
 Nachschlag:Transposition von Matrizen Sei Explizit: Def: "Transponierte v. A": (tausche Zeilen mit Spalten d.h., spiegle in der Diagonale) m Reihen, n Spalten n Reihen, m Spalten z.b. m=2,n=3: Eigenschaft:
Nachschlag:Transposition von Matrizen Sei Explizit: Def: "Transponierte v. A": (tausche Zeilen mit Spalten d.h., spiegle in der Diagonale) m Reihen, n Spalten n Reihen, m Spalten z.b. m=2,n=3: Eigenschaft:
4 Vorlesung: 21.11. 2005 Matrix und Determinante
 4 Vorlesung: 2111 2005 Matrix und Determinante 41 Matrix und Determinante Zur Lösung von m Gleichungen mit n Unbekannten kann man alle Parameter der Gleichungen in einem rechteckigen Zahlenschema, einer
4 Vorlesung: 2111 2005 Matrix und Determinante 41 Matrix und Determinante Zur Lösung von m Gleichungen mit n Unbekannten kann man alle Parameter der Gleichungen in einem rechteckigen Zahlenschema, einer
1. Grundlagen der ebenen Kinematik
 Lage: Die Lage eines starren Körpers in der Ebene ist durch die Angabe von zwei Punkten A und P eindeutig festgelegt. Die Lage eines beliebigen Punktes P wird durch Polarkoordinaten bezüglich des Bezugspunktes
Lage: Die Lage eines starren Körpers in der Ebene ist durch die Angabe von zwei Punkten A und P eindeutig festgelegt. Die Lage eines beliebigen Punktes P wird durch Polarkoordinaten bezüglich des Bezugspunktes
C A R L V O N O S S I E T Z K Y. Transformationen. Johannes Diemke. Übung im Modul OpenGL mit Java Wintersemester 2010/2011
 C A R L V O N O S S I E T Z K Y Transformationen Johannes Diemke Übung im Modul OpenGL mit Java Wintersemester 2010/2011 Motivation Transformationen Sind Grundlage vieler Verfahren der Computergrafik Model-
C A R L V O N O S S I E T Z K Y Transformationen Johannes Diemke Übung im Modul OpenGL mit Java Wintersemester 2010/2011 Motivation Transformationen Sind Grundlage vieler Verfahren der Computergrafik Model-
Mathematische Grundlagen
 Kapitel 2 Mathematische Grundlagen In diesem Kapitel werden die mathematischen Grundlagen dargelegt, die für die Darstellung von dreidimensionalen Objekten notwendig sind. 2. 3D-Koordinatensystem Weit
Kapitel 2 Mathematische Grundlagen In diesem Kapitel werden die mathematischen Grundlagen dargelegt, die für die Darstellung von dreidimensionalen Objekten notwendig sind. 2. 3D-Koordinatensystem Weit
5. Raum-Zeit-Symmetrien: Erhaltungssätze
 5. Raum-Zeit-Symmetrien: Erhaltungssätze Unter Symmetrie versteht man die Invarianz unter einer bestimmten Operation. Ein Objekt wird als symmetrisch bezeichnet, wenn es gegenüber Symmetrieoperationen
5. Raum-Zeit-Symmetrien: Erhaltungssätze Unter Symmetrie versteht man die Invarianz unter einer bestimmten Operation. Ein Objekt wird als symmetrisch bezeichnet, wenn es gegenüber Symmetrieoperationen
Mathematiklabor 2. Übungsblatt
 Dr. Jörg-M. Sautter 3.4.7 Mathematiklabor. Übungsblatt Aufgabe : (Wiederholung) Laden Sie die Dateien mlintro?.m herunter und gehen Sie diese Schritt für Schritt durch. Aufgabe : (Matrix- und Vektoroperationen,
Dr. Jörg-M. Sautter 3.4.7 Mathematiklabor. Übungsblatt Aufgabe : (Wiederholung) Laden Sie die Dateien mlintro?.m herunter und gehen Sie diese Schritt für Schritt durch. Aufgabe : (Matrix- und Vektoroperationen,
44 Orthogonale Matrizen
 44 Orthogonale Matrizen 44.1 Motivation Im euklidischen Raum IR n haben wir gesehen, dass Orthonormalbasen zu besonders einfachen und schönen Beschreibungen führen. Wir wollen das Konzept der Orthonormalität
44 Orthogonale Matrizen 44.1 Motivation Im euklidischen Raum IR n haben wir gesehen, dass Orthonormalbasen zu besonders einfachen und schönen Beschreibungen führen. Wir wollen das Konzept der Orthonormalität
3 Matrizenrechnung. 3. November
 3. November 008 4 3 Matrizenrechnung 3.1 Transponierter Vektor: Die Notation x R n bezieht sich per Definition 1 immer auf einen stehenden Vektor, x 1 x x =.. x n Der transponierte Vektor x T ist das zugehörige
3. November 008 4 3 Matrizenrechnung 3.1 Transponierter Vektor: Die Notation x R n bezieht sich per Definition 1 immer auf einen stehenden Vektor, x 1 x x =.. x n Der transponierte Vektor x T ist das zugehörige
4 Lineare Abbildungen
 17. November 2008 34 4 Lineare Abbildungen 4.1 Lineare Abbildung: Eine Funktion f : R n R m heißt lineare Abbildung von R n nach R m, wenn für alle x 1, x 2 und alle α R gilt f(αx 1 ) = αf(x 1 ) f(x 1
17. November 2008 34 4 Lineare Abbildungen 4.1 Lineare Abbildung: Eine Funktion f : R n R m heißt lineare Abbildung von R n nach R m, wenn für alle x 1, x 2 und alle α R gilt f(αx 1 ) = αf(x 1 ) f(x 1
Übung 1: Homogene Transformationen
 Übung 1: Homogene Transformationen Aufgabe 1.1: Bestimmen Sie die homogene Transformationsmatri für die folgende Sequenz von Rotationen: T 1 =Rot z,90 Rot,90 und T 2 =Rot,90 Rot z,90 Zeichnen Sie die entsprechenden
Übung 1: Homogene Transformationen Aufgabe 1.1: Bestimmen Sie die homogene Transformationsmatri für die folgende Sequenz von Rotationen: T 1 =Rot z,90 Rot,90 und T 2 =Rot,90 Rot z,90 Zeichnen Sie die entsprechenden
13. ABBILDUNGEN EUKLIDISCHEN VEKTORRÄUMEN
 13. ABBILDUNGEN in EUKLIDISCHEN VEKTORRÄUMEN 1 Orthogonale Abbildungen im R 2 und R 3. Eine orthogonale Abbildung ist eine lineare Abbildung, die Längen und Orthogonalität erhält. Die zugehörige Matrix
13. ABBILDUNGEN in EUKLIDISCHEN VEKTORRÄUMEN 1 Orthogonale Abbildungen im R 2 und R 3. Eine orthogonale Abbildung ist eine lineare Abbildung, die Längen und Orthogonalität erhält. Die zugehörige Matrix
Matrizen und Drehungen
 Matrizen und Drehungen 20. Noember 2003 Diese Ausführungen sind im wesentlichen dem Skript zur Vorlesung Einführung in die Theoretische Physik I und II on PD Dr. Horst Fichtner entnommen. Dieses entstand
Matrizen und Drehungen 20. Noember 2003 Diese Ausführungen sind im wesentlichen dem Skript zur Vorlesung Einführung in die Theoretische Physik I und II on PD Dr. Horst Fichtner entnommen. Dieses entstand
Mathematik LK 12 M1, 4. Kursarbeit Matrizen und Stochastik Lösung )
 Aufgabe 1: Berechne die Determinante und die Transponierte der folgenden Matrizen: 0 1 1.1 M =( 0 4 1 4 det M =0 4 1 4= 4 M T =( 5 3 3 1.2 1 1 3 A=( =( A T 3 0 1 5 1 3 3 1 0 3 3 1 4 4 det M = 5 1 1+3 3
Aufgabe 1: Berechne die Determinante und die Transponierte der folgenden Matrizen: 0 1 1.1 M =( 0 4 1 4 det M =0 4 1 4= 4 M T =( 5 3 3 1.2 1 1 3 A=( =( A T 3 0 1 5 1 3 3 1 0 3 3 1 4 4 det M = 5 1 1+3 3
Regelungstechnik I (WS 15/16) Übung 2
 Regelungstechnik I (WS 5/6) Übung Prof. Dr. Ing. habil. Thomas Meurer Lehrstuhl für Regelungstechnik Aufgabe. (Linearität, Zeitinvarianz). Überprüfen Sie die folgenden dynamischen Systeme auf Linearität
Regelungstechnik I (WS 5/6) Übung Prof. Dr. Ing. habil. Thomas Meurer Lehrstuhl für Regelungstechnik Aufgabe. (Linearität, Zeitinvarianz). Überprüfen Sie die folgenden dynamischen Systeme auf Linearität
Lineare Algebra und Computer Grafik
 Lineare Algebra und Computer Grafik Kurze Zusammenfassung (Stand: 3 Juli 2) Prof Dr V Stahl Copyright 28 by Volker Stahl All rights reserved V Stahl Lineare Algebra und Computer Grafik Zusammenfassung
Lineare Algebra und Computer Grafik Kurze Zusammenfassung (Stand: 3 Juli 2) Prof Dr V Stahl Copyright 28 by Volker Stahl All rights reserved V Stahl Lineare Algebra und Computer Grafik Zusammenfassung
36 2 Lineare Algebra
 6 Lineare Algebra Quadratische Matrizen a a n sei jetzt n m, A, a ij R, i, j,, n a n a nn Definition Eine quadratische Matrix A heißt invertierbar genau dann, wenn es eine quadratische Matrix B gibt, so
6 Lineare Algebra Quadratische Matrizen a a n sei jetzt n m, A, a ij R, i, j,, n a n a nn Definition Eine quadratische Matrix A heißt invertierbar genau dann, wenn es eine quadratische Matrix B gibt, so
Position und Orientierung
 Position und Orientierung Grundlagen Koordinatensysteme, Punkte und Körper, Position und Orientierung Allgemeine Transformationen Rotation, homogene Koodinaten, Translation, Transformation 2D-Transformationen
Position und Orientierung Grundlagen Koordinatensysteme, Punkte und Körper, Position und Orientierung Allgemeine Transformationen Rotation, homogene Koodinaten, Translation, Transformation 2D-Transformationen
Kinematik des Puma 200
 Kinematik des Puma 200 1 2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 3 2 Denavit-Hartenberg-Konfiguration 5 3 Mehrdeutigkeiten 7 4 Direkte Kinematik 10 5 Inverse Kinematik 13 6 Orientierung des
Kinematik des Puma 200 1 2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 3 2 Denavit-Hartenberg-Konfiguration 5 3 Mehrdeutigkeiten 7 4 Direkte Kinematik 10 5 Inverse Kinematik 13 6 Orientierung des
5 Lineare Gleichungssysteme und Determinanten
 5 Lineare Gleichungssysteme und Determinanten 51 Lineare Gleichungssysteme Definition 51 Bei einem linearen Gleichungssystem (LGS) sind n Unbekannte x 1, x 2,, x n so zu bestimmen, dass ein System von
5 Lineare Gleichungssysteme und Determinanten 51 Lineare Gleichungssysteme Definition 51 Bei einem linearen Gleichungssystem (LGS) sind n Unbekannte x 1, x 2,, x n so zu bestimmen, dass ein System von
Serie 8: Online-Test
 D-MAVT Lineare Algebra I HS 018 Prof Dr N Hungerbühler Serie 8: Online-Test Schicken Sie Ihre Lösung bis spätestens Freitag, den 3 November um 14:00 Uhr ab Diese Serie besteht nur aus Multiple-Choice-Aufgaben
D-MAVT Lineare Algebra I HS 018 Prof Dr N Hungerbühler Serie 8: Online-Test Schicken Sie Ihre Lösung bis spätestens Freitag, den 3 November um 14:00 Uhr ab Diese Serie besteht nur aus Multiple-Choice-Aufgaben
Solutions I Publication:
 WS 215/16 Solutions I Publication: 28.1.15 1 Vektor I 4 2 Ein Objekt A befindet sich bei a = 5. Das zweite Objekt B befindet sich bei b = 4. 2 3 (a) Die Entfernung von Objekt A zum Ursprung ist die Länge
WS 215/16 Solutions I Publication: 28.1.15 1 Vektor I 4 2 Ein Objekt A befindet sich bei a = 5. Das zweite Objekt B befindet sich bei b = 4. 2 3 (a) Die Entfernung von Objekt A zum Ursprung ist die Länge
5. Zustandsgleichung des starren Körpers
 5. Zustandsgleichung des starren Körpers 5.1 Zustandsgleichung 5.2 Körper im Schwerefeld 5.3 Stabilität freier Rotationen 2.5-1 5.1 Zustandsgleichung Zustand: Der Zustand eines starren Körpers ist durch
5. Zustandsgleichung des starren Körpers 5.1 Zustandsgleichung 5.2 Körper im Schwerefeld 5.3 Stabilität freier Rotationen 2.5-1 5.1 Zustandsgleichung Zustand: Der Zustand eines starren Körpers ist durch
Nützliches Hilfsmittel (um Schreiberei zu reduzieren): 'Erweiterte Matrix': Gauß- Verfahren
 L5.4 Inverse einer Matrix Ausgangsfrage: Wie löst man ein lineares Gleichungsystem (LSG)? Betrachte n lineare Gleichungen für n Unbekannte: Ziel: durch geeignete Umformungen bringe man das LSG in folgende
L5.4 Inverse einer Matrix Ausgangsfrage: Wie löst man ein lineares Gleichungsystem (LSG)? Betrachte n lineare Gleichungen für n Unbekannte: Ziel: durch geeignete Umformungen bringe man das LSG in folgende
3 Determinanten, Eigenwerte, Normalformen
 Determinanten, Eigenwerte, Normalformen.1 Determinanten Beispiel. Betrachte folgendes Parallelogramm in der Ebene R 2 : y (a + c, b + d) (c, d) (a, b) x Man rechnet leicht nach, dass die Fläche F dieses
Determinanten, Eigenwerte, Normalformen.1 Determinanten Beispiel. Betrachte folgendes Parallelogramm in der Ebene R 2 : y (a + c, b + d) (c, d) (a, b) x Man rechnet leicht nach, dass die Fläche F dieses
Übungen zum Ferienkurs Analysis II
 Übungen zum Ferienkurs Analysis II Implizite Funktionen und Differentialgleichungen 4.1 Umkehrbarkeit Man betrachte die durch g(s, t) = (e s cos(t), e s sin(t)) gegebene Funktion g : R 2 R 2. Zeigen Sie,
Übungen zum Ferienkurs Analysis II Implizite Funktionen und Differentialgleichungen 4.1 Umkehrbarkeit Man betrachte die durch g(s, t) = (e s cos(t), e s sin(t)) gegebene Funktion g : R 2 R 2. Zeigen Sie,
Aufgaben zur Klausurvorbereitung Seite 1 von 11. Die Aufgaben 7-10 dienen zur Vorbereitung auf die Klausur und müssen nicht abgegeben werden!
 Aufgaben ur Klausurvorbereitung Seite 1 von 11 Aufgabe 7.1 Die Aufgaben 7-10 dienen ur Vorbereitung auf die Klausur und müssen nicht abgegeben werden! Thema: Unterlagen: Grundlagen der Robotik Vorlesungsunterlagen
Aufgaben ur Klausurvorbereitung Seite 1 von 11 Aufgabe 7.1 Die Aufgaben 7-10 dienen ur Vorbereitung auf die Klausur und müssen nicht abgegeben werden! Thema: Unterlagen: Grundlagen der Robotik Vorlesungsunterlagen
a 11 a 12 a 1(m 1) a 1m a n1 a n2 a n(m 1) a nm Matrizen Betrachten wir das nachfolgende Rechteckschema:
 Matrizen Betrachten wir das nachfolgende Rechteckschema: a 12 a 1(m 1 a 1m a n1 a n2 a n(m 1 a nm Ein solches Schema nennt man (n m-matrix, da es aus n Zeilen und m Spalten besteht Jeder einzelne Eintrag
Matrizen Betrachten wir das nachfolgende Rechteckschema: a 12 a 1(m 1 a 1m a n1 a n2 a n(m 1 a nm Ein solches Schema nennt man (n m-matrix, da es aus n Zeilen und m Spalten besteht Jeder einzelne Eintrag
Lineare Algebra: Determinanten und Eigenwerte
 : und Eigenwerte 16. Dezember 2011 der Ordnung 2 I Im Folgenden: quadratische Matrizen Sei ( a b A = c d eine 2 2-Matrix. Die Determinante D(A (bzw. det(a oder Det(A von A ist gleich ad bc. Det(A = a b
: und Eigenwerte 16. Dezember 2011 der Ordnung 2 I Im Folgenden: quadratische Matrizen Sei ( a b A = c d eine 2 2-Matrix. Die Determinante D(A (bzw. det(a oder Det(A von A ist gleich ad bc. Det(A = a b
MLAN1 1 MATRIZEN 1 0 = A T =
 MLAN1 1 MATRIZEN 1 1 Matrizen Eine m n Matrix ein rechteckiges Zahlenschema a 11 a 12 a 13 a 1n a 21 a 22 a 23 a 2n a m1 a m2 a m3 amn mit m Zeilen und n Spalten bestehend aus m n Zahlen Die Matrixelemente
MLAN1 1 MATRIZEN 1 1 Matrizen Eine m n Matrix ein rechteckiges Zahlenschema a 11 a 12 a 13 a 1n a 21 a 22 a 23 a 2n a m1 a m2 a m3 amn mit m Zeilen und n Spalten bestehend aus m n Zahlen Die Matrixelemente
Goniometrische Gleichungen:
 Mathematik/Di FH Regensburg 1 Goniometrische Gleichungen: Für die nachfolgenden Beispiele goniometrischer Gleichungen sind folgende Symmetriegleichungen für die trigonometrischen Funktionen zu beachten
Mathematik/Di FH Regensburg 1 Goniometrische Gleichungen: Für die nachfolgenden Beispiele goniometrischer Gleichungen sind folgende Symmetriegleichungen für die trigonometrischen Funktionen zu beachten
A = ( a 1,..., a n ) ii) Zwei Matrizen sind gleich, wenn die Einträge an den gleichen Positionen übereinstimmen. so heißt die n n Matrix
 Matrizen Definition: i Eine m n Matrix A ist ein rechteckiges Schema aus Zahlen, mit m Zeilen und n Spalten: a a 2 a n a 2 a 22 a 2n a m a m2 a mn Die Spaltenvektoren dieser Matrix seien mit a,, a n bezeichnet
Matrizen Definition: i Eine m n Matrix A ist ein rechteckiges Schema aus Zahlen, mit m Zeilen und n Spalten: a a 2 a n a 2 a 22 a 2n a m a m2 a mn Die Spaltenvektoren dieser Matrix seien mit a,, a n bezeichnet
Wirtschaftsmathematik: Formelsammlung (V1.40)
 Wirtschaftsmathematik: Formelsammlung (V.40) Grundlagen n! = 2 3... n = 0! = n i für n N, n 0, i= pq-formel Lösung von x 2 + px + q = 0 x /2 = p p 2 ± 2 4 q abc-formel Lösung von ax 2 + bx + c = 0 Binomische
Wirtschaftsmathematik: Formelsammlung (V.40) Grundlagen n! = 2 3... n = 0! = n i für n N, n 0, i= pq-formel Lösung von x 2 + px + q = 0 x /2 = p p 2 ± 2 4 q abc-formel Lösung von ax 2 + bx + c = 0 Binomische
Lineare Gleichungssysteme
 Fakultät Grundlagen Juli 2015 Fakultät Grundlagen Übersicht Lineare Gleichungssystem mit 2 Variablen 1 Lineare Gleichungssystem mit 2 Variablen Beispiele 2 Fakultät Grundlagen Folie: 2 Beispiel I Lineare
Fakultät Grundlagen Juli 2015 Fakultät Grundlagen Übersicht Lineare Gleichungssystem mit 2 Variablen 1 Lineare Gleichungssystem mit 2 Variablen Beispiele 2 Fakultät Grundlagen Folie: 2 Beispiel I Lineare
Koordinaten, Transformationen und Roboter
 Koordinaten, Transformationen und Roboter Dipl.-Inform. Wolfgang Globke Institut für Algebra und Geometrie Arbeitsgruppe Differentialgeometrie Universität Karlsruhe 1 / 48 Einleitung Seit Anbeginn der
Koordinaten, Transformationen und Roboter Dipl.-Inform. Wolfgang Globke Institut für Algebra und Geometrie Arbeitsgruppe Differentialgeometrie Universität Karlsruhe 1 / 48 Einleitung Seit Anbeginn der
Ferienkurs Mathematik für Physiker I Skript Teil 3 ( )
 Ferienkurs Mathematik für Physiker I WS 2016/17 Ferienkurs Mathematik für Physiker I Skript Teil 3 (29032017) 1 Lineare Gleichungssysteme Oft hat man es in der Physik mit unbekannten Größen zu tun, für
Ferienkurs Mathematik für Physiker I WS 2016/17 Ferienkurs Mathematik für Physiker I Skript Teil 3 (29032017) 1 Lineare Gleichungssysteme Oft hat man es in der Physik mit unbekannten Größen zu tun, für
Zusammenfassung Vektorrechnung und Komplexe Zahlen
 Zusammenfassung Vektorrechnung und Komplexe Zahlen Michael Goerz 8. April 006 Inhalt Vektoren, Geraden und Ebenen. Länge eines Vektors.......................... Skalarprodukt..............................
Zusammenfassung Vektorrechnung und Komplexe Zahlen Michael Goerz 8. April 006 Inhalt Vektoren, Geraden und Ebenen. Länge eines Vektors.......................... Skalarprodukt..............................
Kapitel 3. Transformationen
 Oyun Namdag Am 08.11.2007 WS 07/08 Proseminar Numerik: Mathematics for 3D game programming & computer graphics Dozenten: Prof. Dr. V. Schulz, C. Schillings Universität Trier Kapitel 3 Transformationen
Oyun Namdag Am 08.11.2007 WS 07/08 Proseminar Numerik: Mathematics for 3D game programming & computer graphics Dozenten: Prof. Dr. V. Schulz, C. Schillings Universität Trier Kapitel 3 Transformationen
Matrizen. a12 a1. a11. a1n a 21. a 2 j. a 22. a 2n. A = (a i j ) (m, n) = i te Zeile. a i 1. a i 2. a i n. a i j. a m1 a m 2 a m j a m n] j te Spalte
![Matrizen. a12 a1. a11. a1n a 21. a 2 j. a 22. a 2n. A = (a i j ) (m, n) = i te Zeile. a i 1. a i 2. a i n. a i j. a m1 a m 2 a m j a m n] j te Spalte Matrizen. a12 a1. a11. a1n a 21. a 2 j. a 22. a 2n. A = (a i j ) (m, n) = i te Zeile. a i 1. a i 2. a i n. a i j. a m1 a m 2 a m j a m n] j te Spalte](/thumbs/71/64996309.jpg) Mathematik I Matrizen In diesem Kapitel werden wir lernen was Matrizen sind und wie man mit Matrizen rechnet. Matrizen ermöglichen eine kompakte Darstellungsform vieler mathematischer Strukturen. Zum Darstellung
Mathematik I Matrizen In diesem Kapitel werden wir lernen was Matrizen sind und wie man mit Matrizen rechnet. Matrizen ermöglichen eine kompakte Darstellungsform vieler mathematischer Strukturen. Zum Darstellung
Transformation - 3. Für "übliche" Anwendungen in der Geometrie ist es sinnvoll, bei Transformationen eine gleiche
 Transformation - 3 Wiederholung und spezielle Angaben im Zusammenhang mit Kreis-Berechnungen 1. Problemstellung Im Zusammenhang mit der Berechnung von Schnittflächen kann es sinnvoll sein, die Berechnung
Transformation - 3 Wiederholung und spezielle Angaben im Zusammenhang mit Kreis-Berechnungen 1. Problemstellung Im Zusammenhang mit der Berechnung von Schnittflächen kann es sinnvoll sein, die Berechnung
a ij i - te Gleichung (Zeile), i = 1, 2,3,..., m I) MATRIZEN Motivation: 1) Speichern geometrischer Daten: Punkte, Vektoren. 2) Lineare Gleichungen
 I) MATRIZEN Motivation: 1) Speichern geometrischer Daten: Punkte, Vektoren. 2) Lineare Gleichungen y 1 = a 11 x 1 + a 12 x 2 + a 13 x3 y 2 = a 21 x 1 + a 22 x 2 + a 23 x3... Koeffizienten a ij i - te Gleichung
I) MATRIZEN Motivation: 1) Speichern geometrischer Daten: Punkte, Vektoren. 2) Lineare Gleichungen y 1 = a 11 x 1 + a 12 x 2 + a 13 x3 y 2 = a 21 x 1 + a 22 x 2 + a 23 x3... Koeffizienten a ij i - te Gleichung
2 Die Algebra der Matrizen
 Die Algebra der Matrizen Ein Hauptziel der Vorlesung zur Linearen Algebra besteht darin, Aussagen über die Lösungsmenge linearer Gleichungssysteme zu machen Etwa ob das Gleichungssystem x y + z 1 x + y
Die Algebra der Matrizen Ein Hauptziel der Vorlesung zur Linearen Algebra besteht darin, Aussagen über die Lösungsmenge linearer Gleichungssysteme zu machen Etwa ob das Gleichungssystem x y + z 1 x + y
Mathematik 2 für Naturwissenschaften
 Hans Walser Mathematik 2 für Naturwissenschaften Spender A B AB 0 Empfänger A B AB 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 verträglich 0 unverträglich Modul 210 Koordinatensysteme. Matrizen Lernumgebung Hans
Hans Walser Mathematik 2 für Naturwissenschaften Spender A B AB 0 Empfänger A B AB 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 verträglich 0 unverträglich Modul 210 Koordinatensysteme. Matrizen Lernumgebung Hans
I) MATRIZEN. 1) Speichern geometrischer Daten: Punkte, Vektoren. j - te Variable (Spalte), j = 1,2,3,..., n
 I) MATRIZEN Motivation: 1) Speichern geometrischer Daten: Punkte, Vektoren. 2) Lineare Gleichungen y1 = a11x1+ a12x2 + a13x3 y2 = a21x1+ a22x2 + a23x3... Koeffizienten a ij i - te Gleichung (Zeile), i
I) MATRIZEN Motivation: 1) Speichern geometrischer Daten: Punkte, Vektoren. 2) Lineare Gleichungen y1 = a11x1+ a12x2 + a13x3 y2 = a21x1+ a22x2 + a23x3... Koeffizienten a ij i - te Gleichung (Zeile), i
IV. Matrizenrechnung. Gliederung. I. Motivation. Lesen mathematischer Symbole. III. Wissenschaftliche Argumentation. i. Rechenoperationen mit Matrizen
 Gliederung I. Motivation II. Lesen mathematischer Symbole III. Wissenschaftliche Argumentation IV. Matrizenrechnung i. Rechenoperationen mit Matrizen ii. iii. iv. Inverse einer Matrize Determinante Definitheit
Gliederung I. Motivation II. Lesen mathematischer Symbole III. Wissenschaftliche Argumentation IV. Matrizenrechnung i. Rechenoperationen mit Matrizen ii. iii. iv. Inverse einer Matrize Determinante Definitheit
Matrizen spielen bei der Formulierung ökonometrischer Modelle eine zentrale Rolle: kompakte, stringente Darstellung der Modelle
 2. Matrixalgebra Warum Beschäftigung mit Matrixalgebra? Matrizen spielen bei der Formulierung ökonometrischer Modelle eine zentrale Rolle: kompakte, stringente Darstellung der Modelle bequeme mathematische
2. Matrixalgebra Warum Beschäftigung mit Matrixalgebra? Matrizen spielen bei der Formulierung ökonometrischer Modelle eine zentrale Rolle: kompakte, stringente Darstellung der Modelle bequeme mathematische
Serie 10: Inverse Matrix und Determinante
 D-ERDW, D-HEST, D-USYS Mathematik I HS 5 Dr Ana Cannas Serie 0: Inverse Matrix und Determinante Bemerkung: Die Aufgaben dieser Serie bilden den Fokus der Übungsgruppen vom und 5 November Gegeben sind die
D-ERDW, D-HEST, D-USYS Mathematik I HS 5 Dr Ana Cannas Serie 0: Inverse Matrix und Determinante Bemerkung: Die Aufgaben dieser Serie bilden den Fokus der Übungsgruppen vom und 5 November Gegeben sind die
Prof. Dr. J. Schumacher Merkblatt zur Strömungsmechanik 1 Institut für Thermo- und Fluiddynamik Technische Universität Ilmenau
 Prof. Dr. J. Schumacher Merkblatt zur Strömungsmechanik 1 Institut für Thermo- und Fluiddynamik Technische Universität Ilmenau Mathematische Grundlagen Mit den folgenden mathematischen Grundlagen sollten
Prof. Dr. J. Schumacher Merkblatt zur Strömungsmechanik 1 Institut für Thermo- und Fluiddynamik Technische Universität Ilmenau Mathematische Grundlagen Mit den folgenden mathematischen Grundlagen sollten
Skript Lineare Algebra
 Skript Lineare Algebra sehr einfach Erstellt: 2018/19 Von: www.mathe-in-smarties.de Inhaltsverzeichnis Vorwort... 2 1. Vektoren... 3 2. Geraden... 6 3. Ebenen... 8 4. Lagebeziehungen... 10 a) Punkt - Gerade...
Skript Lineare Algebra sehr einfach Erstellt: 2018/19 Von: www.mathe-in-smarties.de Inhaltsverzeichnis Vorwort... 2 1. Vektoren... 3 2. Geraden... 6 3. Ebenen... 8 4. Lagebeziehungen... 10 a) Punkt - Gerade...
