Präparative und röntgenographische Untersuchungen über Cäsium-Silber-Gold(III)-Chlorid
|
|
|
- Markus Franke
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Präparative und röntgenographische Untersuchungen über Cäsium-Silber-Gold(III)-Chlorid Preparation and X-ray Investigations of Cesium Silver Gold(III) Chloride Hans Joachim Berthold* und Wolfgang Ludwig Institut für Anorganische Chemie der Universität Hannover, Callin-Str. 9, D-3000 Hannover 1 Z. Naturforsch. 85b, (1980); eingegangen am 7. Februar 1980 Cesium Silver Gold(III) Chloride, Preparation, Chemical Composition, Nonstoichiometric Phases, Lattice Constants Cesium silver gold(iii) chloride has been prepared from hydrochloric acid solutions. The composition of the preparations is variable and depends on the ratio [Au(III)]/[Ag(I)] in solution. It corresponds to the formula Cs2Agi_aAui+a;/3Cl6. In the range 0 < x < 0,64 six crystallographically different phases have been observed. Above x 0,42 a cubic phase is obtained. The stoichiometric compound Cs2AgAuCl6 is obtained only from solutions with [Au(III)]/[Ag(I)] < 1. Reports in the literature which claim the stoichiometric compound Cs2AgAuCl6 to exist in a cubic and in a tetragonal form cannot be confirmed. Cs2AgAuCl6 crystallizes orthorhombically with the lattice constants a = 15,21 A, b = 15,16 A and 10,32 A (Z = 8). Einleitung Cäsium-Silber-Gold(III)-Chlorid ist erstmals 1918 von Emich [1] durch Umsetzung von Silberchlorid und Gold(III)chlorid mit Cäsiumchlorid in salzsaurer Lösung dargestellt worden. In späteren Mitteilungen berichten Bayer [2] und Emich [3], daß die Zusammensetzung der schwarzen Verbindung vom Konzentrationsverhältnis [Ag(I)]/[Au(III)] in den Lösungen abhängig ist. Nach ihren Angaben kommt dem Cäsium-Silber-Gold-Chlorid die Formel Cs3AgzAu2_ /3CI9 (0 < x < 6) zu. Wells berichtet 1922 ebenfalls über die Darstellung von CäsiumSilber-Gold-Chlorid [4,5]. Er gibt für die Verbindung die stöchiometrische Zusammensetzung Cs 2 AgAuCl6 an und erklärt die diesem Ergebnis widersprechenden Angaben von Bayer damit, daß dessen Präparate neben Cs2AgAuCl6 wechselnde Anteile anderer Cäsiumchloroaurate enthalten hätten [6]. Die Zusammensetzung Cs2AgAuCl6 für das Cäsium-SilberGold-Chlorid wird 1925 nach erneuten Untersuchungen im Arbeitskreis von Emich durch Vogel [7] bestätigt gelangen Ferrari und Cecconi [8] im Zusammenhang mit Untersuchungen über das Cäsium-Silber-Gold-Bromid zu der Auffassung, daß die von Bayer hergestellten Cäsium-Silber-GoldChloride aufgrund struktureller Überlegungen - als Hexachloroaurate(III) aufgefaßt - durch die Formel * Sonderdruckanforderungen an Berthold /80/ /$ 01.00/0 Prof. Dr. H. J. Cs2Agj/Au(i_2/)/3[AuCl6] beschrieben werden können. Präparative Untersuchungen über die Chlorverbindung wurden von Ferrari und Cecconi nicht durchgeführt. Erste röntgenographische Untersuchungen an pulverförmigen Präparaten von Cäsium-SilberGold-Chlorid wurden 1934 von Elliott [9] durchgeführt. Er teilt mit, daß die Verbindung Cs2AgAuCl6 kubisch primitiv mit der Gitterkonstanten a = 5,33 Ä (Z = 1/2) kristallisiert und eine dem Perowskittyp (ABX3) ähnliche Struktur besitzt, in der die Silber- und Goldatome statistisch auf die B-Positionen des Gitters verteilt sind. Unterschiede zwischen den beobachteten und berechneten Intensitäten einiger Interferenzen führt er darauf zurück, daß sich die Chloratome näher bei den Goldatomen befinden als bei den Silberatomen. Ferrari [10] findet 1937 für Cs 2 AgAuCl 6 eine kubisch flächenzentrierte Elementarzelle mit der Gitterkonstanten a = 10,45 Ä [Z = 4). Er nimmt an, daß die Silber- und Goldatome geordnet verteilt sind, und daß die Struktur oktaedrische AuCU 3 - Anionen enthält. Elliott und Pauling [11] bestätigen 1938 die früher von Elliott beobachtete kubisch primitive Elementarzelle. Die Gitterkonstante wird von ihnen jetzt mit a = 5,28 Ä angegeben. Die bereits früher von Elliott für diese Phase festgestellte Abweichung von der idealen Perowskitstruktur wird nunmehr auf das Vorliegen linearer AgCl2~- und quadratischer AuCL^-Komplexe mit statistischer Orientierung be- Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschung in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.v. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht: Creative Commons Namensnennung-Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz. This work has been digitalized and published in 2013 by Verlag Zeitschrift für Naturforschung in cooperation with the Max Planck Society for the Advancement of Science under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Germany License. Zum ist eine Anpassung der Lizenzbedingungen (Entfall der Creative Commons Lizenzbedingung Keine Bearbeitung ) beabsichtigt, um eine Nachnutzung auch im Rahmen zukünftiger wissenschaftlicher Nutzungsformen zu ermöglichen. On it is planned to change the License Conditions (the removal of the Creative Commons License condition no derivative works ). This is to allow reuse in the area of future scientific usage.
2 652 H. J. Berthold-W. Ludwig Cäsium-Silber-Gk)ld(III)-Chlorid 652 züglich der drei kubischen Kristallachsen zurückgeführt. Neben der kubischen Form des CsaAgAuCle wird von Elliott und Pauling eine tetragonale Form mit den Gitterkonstanten a = 7,38 Ä und 11,01 Ä (c/a = 1, ; Z = 2) beschrieben, die nach ihrer Ansicht mit dem Cs2Au I Au III Cl6 (Raumgruppe I4/mmm) isotyp ist und auf den Gitterplätzen lineare AgCl2~- und quadratische AuCLr-Komplexe in geordneter Folge enthält. Die Autoren erhielten die tetragonale Form durch längeres Tempern der kub. Form bei 350 C in geschlossenen Ampullen und anschließendes langsames Abkühlen der Proben. Sie nehmen an, daß das tetragonale Cs2AgAuCl6 die thermodynamisch stabile Modifikation ist, und daß die kub. Modifikation bei Raumtemperatur metastabil ist äußern sich Ferrari und Coghi [12] erneut zur Struktur des Cs2AgAuCl6. Sie vertreten weiterhin die Auffassung, daß die Verbindung kubisch flächenzentriert kristallisiert ( a = 10,45 Ä), und daß in der Struktur oktaedrische AuCle 3 ~-Baugruppen vorliegen. Untersuchungen über die Existenz einer tetragonalen Modifikation wurden nicht durchgeführt. Zur Klärung der widersprüchlichen Literaturangaben hinsichtlich der Zusammensetzung des Cäsium-Silber-Gold-Chlorids und der Größe der Elementarzelle sowie zur Überprüfung der Angaben von Elliott und Pauling über die Existenz zweier Modifikationen des Cs2AgAuCl6 wurden erneut präparative und röntgenographische Untersuchungen durchgeführt. gewählt. In der Regel wurden 200 mg AgN03 pro 150 ml Lösung eingesetzt. Die Ausgangsstoffe Cäsiumchlorid, Gold(IIl)chlorid und Silbernitrat wurden in 150 ml halbkonzentrierter Salzsäure gelöst, die Lösungen zum Sieden erhitzt und im Verlaufe von ca. 20 h auf Raumtemperatur abgekühlt. Die hierbei abgeschiedenen schwarzen Kristalle wurden abfiltriert, mit kalter konz. Salzsäure kurz gewaschen und über Kaliumhydroxid getrocknet. Zur Analyse der Verbindungen wurden die Proben in heißem Wasser zersetzt und das dabei gebildete AgCl abfiltriert, getrocknet und zur Bestimmung des Silbergehaltes der Proben ausgewogen. Die Ermittlung des Goldgehaltes erfolgte nach der Reduktion des im Filtrat befindlichen Gold(III) mittels Hydraziniumsulfat durch Auswägen des Metalls. Der Cäsiumgehalt der Präparate wurde wiederholt gravimetrisch bestimmt, meistens jedoch als CsCl aus der Differenz Einwaage minus (AgCl + AuCla) berechnet. Versuchsergebnisse Die Ergebnisse der drei Versuchsreihen sind in Abb. l a, b und c wiedergegeben. In den Diagrammen ist jeweils das analytisch bestimmte Verhältnis Gold/Silber (Au/Ag) der untersuchten Präparate gegen das Konzentrations Verhältnis [Au (III)]/[Ag(I)] 3.5 a) c? ,5 Experimentelles Drei Versuchsreihen wurden durchgeführt, bei denen einmal der Einfluß des Konzentrationsverhältnisses [Au(III)]/[Ag(I)] und zum anderen der Einfluß der Cäsiumionenkonzentration auf die Zusammensetzung des Cäsium-Silber-Gold-Chlorids untersucht wurde. Die Cäsiumkonzentration in den zur Herstellung der Präparate verwendeten Lösungen wurde bei den einzelnen Versuchsreihen jeweils konstant gehalten und betrug 4 g, 2 g bzw. 1 g CsCl pro 150 ml Lösung. Die gewünschte Variation des Konzentrationsverhältnisses [Au(III)]/[Ag(I)] erfolgte bei der Mehrzahl der Versuche durch Veränderung der Konzentration des Gold(III). Die Konzentration der Lösungen an Ag(I) wurde wegen der geringen Löslichkeit des AgCl in salzsaurer Lösung zur Erzielung guter Ausbeuten in der Nähe der Sättigungskonzentration 2, , [AuOI%9o)r Abb. 1. Abhängigkeit des Gold/Silber-Verhältnisses Au/Ag der festen Produkte vom Konzentrationsverhältnis [Au(III)]/[Ag(I)] in der Lösung bei der Darstellung von Cäsium-Silber-Gold-Chlorid aus Lösungen mit 4 g CsCl/150 ml (a), 2 g CsCl/150 ml (b) und 1 g CsCl/150 ml (c). Die verschiedenen Symbole der Meßpunkte entsprechen unterschiedlichen Phasen.
3 H. J. Berthold-W. Ludwig Cäsium-Silber-Gk)ld(III)-Chlorid 653 Tab. I. Vergleich der analytisch bestimmten Silber- und Goldgehalte einiger Proben von Cs2AgAuCle mit den berechneten Werten (letzte Spalte). %Ag: %Au: 13,79 25,16 13,72 25,34 13,69 25,19 13,71 25,25 der beiden Übergangsmetalle in den Ausgangslösungen aufgetragen. Zur Kennzeichnung röntgenographisch unterschiedlicher Phasen wurden für die einzelnen Meßpunkte unterschiedliche Zeichen benutzt. Fallen zwei Zeichen auf einen Meßpunkt, so zeigt dies an, daß bei den betreffenden Versuchen Gemische der entsprechenden Phasen erhalten worden sind. Aus der Abbildung geht hervor, daß Präparate der stöchiometrischen Zusammensetzung C^AgAuCle (Verhältnis Au/Ag = 1) nur dann erhalten werden, wenn die Ausgangslösungen ein Konzentrationsverhältnis [Au(III)]/ [Ag(I)] < 1 besitzen, also Silber im Überschuß gegenüber Gold enthalten. Tab. I zeigt eine Zusammenstellung der Silber- und Goldgehalte einiger aus solchen Lösungen erhaltener Präparate. Die für Cs2AgAuCl6 berechneten Werte sind in der letzten Spalte aufgeführt. Präparate der stöchiometrischen Zusammensetzung C^AgAuCl«werden im folgenden als a-cäsium-silber-goldchlorid bezeichnet. 13,73 25,26 13,68 25,25 13,65; 25,21; ber.: ber.: 13,77 25,17 Formel Cs3Ag2;Au2-2:/3Cl9 mit 0 < x < 6 beschreibt somit die Zusammensetzung des Cäsium-SilberGold-Chlorids im Prinzip richtig. Sie schließt allerdings auch Produkte mit Au/Ag-Verhältnissen < 1 ein ( x > l, 5 ), die jedoch von uns nicht erhalten werden konnten (vgl. Abb. 1), und die auch von Bayer nicht beobachtet worden sind. Wir sind daher der Ansicht, daß die Cäsium-Silber-Gold-Chloride durch die Formel Cs2Agi- x Aui +z /3Cl6 (0 < x < 1) beschrieben werden müssen. Diese Formel wird im Unterschied zur Formel von Bayer auch den Inhalten der Elementarzellen der verschiedenen von uns beobachteten Phasen gerecht. % Ag Erreicht das Konzentrations Verhältnis [Au(III)]/ [Ag(I)] in der Lösung den Wert 1 oder wird dieser Wert überschritten, so steigt das Verhältnis Au/Ag in den Präparaten an (Abb. 1). Bei gleichen Konzentrationsverhältnissen [Au(III)]/[Ag(I)] entstehen dabei um so goldreichere Produkte, je höher der Cäsiumgehalt der Lösung ist. Dies geht deutlich aus dem steileren Anstieg der Meßpunkte in Abb. l a (4 g CsCl/150 ml Lösung) im Vergleich zum Anstieg der Meßpunkte in A b b. 1 b (2 g CsCl/150 ml Lösung) bzw. Abb. l c (1 g CsCl/150 ml Lösung) hervor. Bei Konzentrationsverhältnissen [Au(III)]/[Ag(I)] > 3,5 tritt eine mit steigendem Goldüberschuß in den Lösungen zunehmende Bildung von Cäsiumtetrachloroaurat als Nebenprodukt auf. Wegen seiner gelben Farbe konnte evtl. ausgeschiedenes CsAuCL unter dem Mikroskop leicht von den schwarzen Kristallen des Cäsium-Silber-GoldChlorids abgetrennt werden. Die Analysen sämtlicher so hergestellter Präparate ergaben ein Äquivalentverhältnis (Silber(I) -fgold(iii))/cäsium = 2/1, woraus das Verhältnis Cäsium/Chlor = 1/3 folgt. Die von Bayer angegebene Abb. 2. Analytisch bestimmte Silber- und Goldgehalte von Cäsium-Silber-Gold-Chloriden. Die Gerade entspricht den mit der Formel Cs2Agi_:rAui+a;/3Cl6 berechneten Werten. Abb. 2 zeigt die Übereinstimmung der Analysenergebnisse mit den nach der Formel Cs 2 Agi- z Aui +;r /3C]6 berechneten Werten am Beispiel der aus Lösungen mit 4 g CsCl/150 ml erhaltenen Präparate. In der Abbildung ist der analytisch ermittelte Silbergehalt gegen den Goldgehalt der Proben in Massenprozenten aufgetragen. Die eingezeichnete Gerade gibt den
4 654 H. J. Berthold-W. Ludwig Cäsium-Silber-Gk)ld(III)-Chlorid 654 berechneten Zusammenhang zwischen Silber- und Goldgehalt wieder. Die zugehörigen x-werte sind am oberen Bildrand angegeben. Insgesamt wurden von uns Präparate mit Werten für x zwischen 0 und 0,64 hergestellt. Die Darstellung silberärmerer Produkte durch Erhöhung des Konzentrationsverhältnisses [Au(III)]/[Ag(I)] über die in Abb. 1 angegebenen Grenzwerte hinaus erwies sich als nicht möglich, da die sehr goldreichen Lösungen bereits vor der Abscheidung des Cäsium- Silber-Gold-Chlorids größere Mengen an CsAuCU abschieden und sich das Verhältnis [Au(III)]/ [Ag(I)] dadurch wieder zu niedrigeren Werten verschob. Versuche, durch Erhöhung der Cäsiumchloridkonzentration auf g CsCl/150 ml Lösung bereits bei kleineren Goldüberschüssen in der Lösung zu silberärmeren Präparaten zu gelangen, führten zu Substanzen, deren Zusammensetzung nicht mehr der Formel Cs2Agi-iAui+z/3Cl6 entspricht. über die beobachteten Phasen, ihre Phasenbreiten, die Kristallsysteme und die Gitterkonstanten der Phasen. Die Strichdiagramme von Guinier-Aufnahmen (CuKa) sind in Abb. 3 wiedergegeben. a) b) 0<\l CD<N 0<N CD<N o CD CD CD «N*- *N >JO <N<N OO OO ntv» NtO Ooo s»to CDCD (O'N TOO TOS»COO 0\r o<\iio ^ «Nvrto OM O 00<0<N CD OD Nv»f\ O'CD^O CD nt CD CD^N Ergebnisse der röntgenographischen Untersuchungen Röntgenographische Untersuchungen haben ergeben, daß im System Cs2Agi-xAui+i/3Cl6 (0 < <0,64) sechs kristallographisch verschiedene Phasen auftreten (vgl. Abb. 1). Tab. II gibt eine Übersicht "NO <V3 vtc3 ~-if\4 v»c> O O OC3«N O-. CMC IO<\ Tab. II. Übersicht über die im System Cäsium-Silber- Gold-Chlorid beobachteten Phasen der Zusammensetzung Cs2Ag1_xAui+x/3Cl6 a. d) O CD O O Phase x Kristallsystem Gitterkonstanten a 0 orthorhombisch a b = a' <0,06 orthorhombisch a b = ß 0,05-0,30 tetragonal b a Y 0,33-0,39 tetragonal 0 a = c 15,21 15,16 10,32 15,21-15,20 15,16-15,20 10,32-10,34 7,60-7,56 10,35-10,44 7,46 10,73-10,71 6 >0,42 kubisch a 5,30-5,291 X 0,04-0,17 orthorhombisch a = b = 10,84-10,77 10,69-10,68 10,36-10,40 a Die Überlappung der oberen Grenze der a'-phase und der unteren Grenze der /?-Phase entspricht unseren Beobachtungen und dürfte auf geringfügige Unterschiede in den Kristallisationsbedingungen der Präparate zurückzuführen sein. Wegen der -Phase vgl. den_text auf Seite 655; b c/a < Y2; c c/a > f2\ d für 0,42 < x < 0,64. e) fncdcd 'N'NCD '^'NNTCDCD N»X*CD r Theta Abb. 3. Strichdiagramme von Guinier-Aufnahmen (CuKa) der verschiedenen Phasen des Cäsium-Silber- Gold-Chlorids Cs2Agi_xAui+x/3Cl6. Auf eine lückenlose Angabe der Indizes wurde aus Platzgründen verzichtet. Desgleichen wurde bei den Diagrammen b-f darauf verzichtet, die mit steigendem Glanzwinkel zunehmende Linien Verbreiterung wiederzugeben. a) a-phase, x = 0 d) y-phase, x = 0,35 b) a'-phase, z = 0,05 e) ö-phase, x = 0,50 c) /?-Phase, x = 0,13 f) e-phase, z = 0,05.
5 656 H. J. Berthold-W. Ludwig Cäsium-Silber-Gk)ld(III)-Chlorid Stöchiometrisch zusammengesetztes a-cäsiumsilber-gold-chlorid, Cs2AgAuCl6, kristallisiert orthorhombiseh mit den Gitterkonstanten a = 15,21 Ä, b = 15,16 Ä und 10,32 Ä. Die primitive Elementarzelle enthält 8 Formeleinheiten. Berücksichtigt man bei der Indizierung der Pulveraufnahme nur die starken Reflexe und läßt man ferner die bei einigen Interferenzen beobachtete geringfügige Aufspaltung in zwei sehr nahe benachbarte Linien (vgl. Abb. 3a) außer acht, so liefert die Auswertung der Aufnahme eine kleinere tetragonale Elementarzelle (Z = 2) mit den Gitterkonstanten at *> a/2 ** 6/2 «7,59 Ä und c t = 10,32 Ä (ct/at = 1,36). Sie ist in geometrischer Hinsicht der Elementarzelle des tetragonalen Cs2AuAuCl6 (a = 7,50 Ä, 10,89 Ä, c\a = 1,452) sehr ähnlich. Eine Einkristallstrukturuntersuchung des Cs2AgAuCl6 ist im Gange. Bereits geringe Abweichungen von der Zusammensetzung Cs2AgAuClß entsprechend der Formel Cs2Ag1-IAui4a:/3Cl6 mit 0 <x < 0, 0 6 sind röntgenographisch deutlich erkennbar. Die Abweichung von der Stöchiometrie zeigt sich auf den Pulveraufnahmen der Präparate dadurch an, daß die Überstrukturlinien, die die große orthorhombische Elementarzelle für Cs2AgAuCl6 fordern, mit steigendem Wert des Parameters x breiter und schwächer werden und nach und nach verschwinden. Gleichzeitig nähert sich das Achsenverhältnis ajb dem Wert 1, der bei x = 0,05 erreicht wird (vgl. Abb. 3 b). Von den Überstrukturlinien, die die große Elementarzelle mit 8 Formeleinheiten verlangen, sind in diesem Falle nur noch die Reflexe 101 und 211 (vgl. Abb. 3 a) vorhanden. Die Gitterkonstanten für x = 0,05 lauten a = b = 15,20 Ä, 10,34 Ä. Wegen der Ähnlichkeit der Phase mit der a-phase wird sie als a'-phase bezeichnet. ß-Cäsium-Silber-Gold-Chlorid tritt bei Produkten mit 0,05 < x < 0,30 auf (vgl. hierzu Fußnote 1 der Tab. II). Das Beugungsbild der ß-Phase gleicht weitgehend dem der a- bzw. a'-phase, jedoch fehlen die für diese beiden Phasen charakteristischen Überstrukturlinien. Die Indizierung der Aufnahmen führt auf eine innenzentrierte tetragonale Elementarzelle (Z 2). Während die Gitterkonstante a im angegebenen Phasenbereich mit sinkendem Silbergehalt von 7,60 Ä auf 7,56 Ä abnimmt, steigt die Gitterkonstante c von 10,35 Ä auf 10,44 Ä an. Entsprechend steigt das Achsenverhältnis c/a von 1,36 auf 1,38. Das Beugungsdiagramm eines Präparats mit = 0,13 ist in Abb. 3c wiedergegeben. 655 y-cs2agi-xaui+a;/3cl6 (0,33 < x < 0,39) kristallisiert ebenfalls tetragonal innenzentriert mit 2 Formeleinheiten in der Elementarzelle. Die Gitterkonstante a ist bei dieser Phase unabhängig von der Zusammensetzung der Proben und beträgt 7,46 Ä, wohingegen die Gitterkonstante c mit sinkendem Silbergehalt von 10,73 Ä auf 10,71 Ä abnimmt. Von der /S-Phase unterscheidet sich die y-phase durch das mit c/a = 1,439-1,436 wesentlich größere Achsenverhältnis. Abb. 3d zeigt das Beugungsdiagramm eines Produkts mit = 0,35. Sinkt der Silbergehalt der Präparate auf Werte entsprechend x > 0,42, so tritt eine kubische Phase auf, die als <5-Cäsium-Silber-Gold-Chlorid bezeichnet wird. Ihre Elementarzelle ist primitiv (Z = 1/2), und die Gitterkonstante nimmt in dem von uns untersuchten Bereich 0,42 < z < 0,64 von 5,30 auf 5,29 Ä ab. Das kubische <5-Cs2Agi-:rAui+;r/3Cl6 entspricht der von Elliott und Pauling beschriebenen kubischen Modifikation des Cs2AgAuCle" [11]. Überstrukturreflexe, wie sie für die von Ferrari [10] angegebene flächenzentrierte kubische Struktur zu erwarten wären, wurden von uns nicht beobachtet. Das Beugungsdiagramm eines Präparats mit x = 0,50 ist in Abb. 3e wiedergegeben. Bei der Versuchsreihe mit 1 g CsCl/150 ml wurde bei Präparaten mit 0,04 < x < 0,17 neben den sonst in diesem Bereich beobachteten Phasen (a', ß) eine weitere Phase erhalten, die als e-phase bezeichnet wird (vgl. Abb. l c ). -Cs2Agi-zAui+x/3Cl6 kristallisiert flächenzentriert orthorhombisch mit den Gitterkonstanten a = 10,84-10,77 Ä, b = 10,69 bis 10,68 Ä und 10,36-10,40 Ä. Die Elementarzelle enthält 4 Formeleinheiten. Abb. 3 f zeigt das Beugungsdiagramm eines Präparats mit x 0,05. Die Pulveraufnahmen der nichtstöchiometrischen Phasen des Cs2Agi-aAui+j:/3Cl6 (0 <x < 0, 4 2 ) zeigen bei kleinen Glanzwinkeln scharfe Reflexe und weisen eine mit steigendem Glanz winkel zunehmende Linienverbreiterung auf. Das Ausmaß der Verbreiterung ist dabei um so größer, je geringer der Silbergehalt und je höher demzufolge der Goldgehalt der Präparate ist. Im Hinblick auf die strukturelle Verwandtschaft der Phasen und den in der Formel Cs2Agi_a;Aui+x/3Cl6 zum Ausdruck kommenden perowskitähnlichen Aufbau der Strukturen nehmen wir an, daß von den x jeweils im Gitter vorhandenen freien Silberplätzen ein Drittel durch Gold(III)-Atome besetzt ist, während zwei Drittel als Leerstellen vorliegen. Berück-
6 656 H. J. Berthold-W. Ludwig Cäsium-Silber-Gk)ld(III)-Chlorid 656 sichtigt man, daß die den Gold(III)-Atomen benachbarten Chloratome sicherlich andere Koordinationspolyeder ausbilden als die den noch vorhandenen Silberatomen und die den Leerstellen benachbarten Chloratome, so wird deutlich, daß ein Defizit im Silberuntergitter örtliche Verzerrungen hervorrufen muß. Die hiermit verbundenen Gitterstörungen sind die wesentliche Ursache der beobachteten Linienverbreiterung. In geringem Umfang tragen allerdings auch Gitterkonstantenschwankungen als Folge unterschiedlicher Zusammensetzung zeitlich nacheinander aus der Lösung abgeschiedener Kristalle zur Linienverbreiterung bei. Die inhomogene Zusammensetzung der Präparate ergibt sich aus der Tatsache, daß das Verhältnis Au/Ag in den Kristallen stets kleiner ist als das momentane Konzentrationsverhältnis [Au(III)]/[Ag(I)] in der Lösung (vgl. Abb. 1). Dieses steigt demzufolge im Verlauf der Kristallabscheidung ständig an und damit wiederum auch das Verhältnis Au/Ag in den nach und nach abgeschiedenen Kristallen. Die analytisch bestimmte Zusammensetzung der Präparate stellt somit nur einen Mittelwert für die betrachtete Probe dar*. Daß die Linienverbreiterung vorwiegend auf * Änderungen des Verhältnisses [Au(III)]/[Ag(I)] in den Lösungen während der Kristallisation dürften auch für das häufige Auftreten von Gemischen ver- Gitterstörungen und nicht auf inhomogener Zusammensetzung der untersuchten Kristalle beruht, folgt aus Versuchen, die abgebrochen wurden, nachdem erst etwa 2% der insgesamt zu erwartenden Substanzmenge aus kristallisiert war. Die Pulveraufnahmen der sicherlich noch weitestgehend homogen zusammengesetzten Kristallfraktionen ließen keine signifikante Steigerung der Linienschärfe gegenüber den Aufnahmen entsprechender, auf die übliche Weise dargestellter Präparate erkennen. Bemerkenswert ist, daß die Aufnahmen der besonders goldreichen kubischen <5-Phase (x > 0,42) deutlich geringere Linienverbreiterung aufweisen als die Pulveraufnahmen der übrigen nichtstöchiometrischen Phasen. Ursache hierfür dürfte die bei dieser Phase statistische Verteilung der Silber- und Goldatome sowie der Leerstellen auf alle B-Plätze des Perowskitgitters sein, die in der kleinen Elementarzelle mit a = 5,30-5,29 Ä und Z = 1/2 zum Ausdruck kommt. Bei den Pulveraufnahmen von Präparaten der y- und der -Phase beobachteten wir zusätzlich zur allgemeinen Linienverbreiterung eine Verbreiterung einzelner Reflexe zu höheren Glanzwinkeln hin, die auf zweidimensionale Gitterstörungen hindeutet. schiedener Phasen bei der Herstellung der Cäsium - Silber-Gold-Chloride verantwortlich sein (vgl. Abb. 1). [1] F. Emich, Monatsh. Chem. 39, 775 (1918). [2] E. Bayer, Monatsh. Chem. 41, 223 (1920). [3] F. Emich, Monatsh. Chem. 41, 243 (1920). [4] H. L. Wells, Am. J. Sei. (5) 3, 257 (1922). [5] H. L. Wells, Am. J. Sei. (5) 3, 315 (1922). [6] H. L. Wells, Am. J. Sei. (5) 4, 476 (1922). [7] J. Vogel, Monatsh. Chem. 46, 265 (1925). [8] A. Ferrari und R. Cecconi, Gazz. Chim. Ital. 72, 170 (1942). [9] N. Elliott, J. Chem. Phys. 2, 419 (1934). [10] A. Ferrari, Gazz. Chim. Ital. 67, 94 (1937). [11] N. Elliott und L. Pauling, J. Am. Chem. Soc. 60, 1846 (1938). [12] A. Ferrari und L. Coghi, Gazz. Chim. Ital. 71, 440 (1941).
Die Kristallstruktur der Salze K 2 Au 2 I 6 und Cs2Ag_rAuI1_aAu1,IBr6. Ein Beitrag zur Kristallchemie der Alkalihexahalogenoaurate(I,III)
 Die Kristallstruktur der Salze K Au I 6 und CsAg_rAuI1_aAu1,IBr6. Ein Beitrag zur Kristallchemie der Alkalihexahalogenoaurate(I,III) Crystal Structure of the Salts KAUIÖ and CsAga;AuII_a;AuIIIBr6. A Contribution
Die Kristallstruktur der Salze K Au I 6 und CsAg_rAuI1_aAu1,IBr6. Ein Beitrag zur Kristallchemie der Alkalihexahalogenoaurate(I,III) Crystal Structure of the Salts KAUIÖ and CsAga;AuII_a;AuIIIBr6. A Contribution
Grundlagen der Chemie Ionenradien
 Ionenradien Prof. Annie Powell KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Ionenradien In einem Ionenkristall halten benachbarte
Ionenradien Prof. Annie Powell KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Ionenradien In einem Ionenkristall halten benachbarte
Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:
 18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
3.6 Phosphate der Strukturfamilie M 2 O(PO 4 ) 93
 3.6 Phosphate der Strukturfamilie M 2 O(PO 4 ) 93 Abbildung 3.29 Ti 5 O 4 (PO 4 ). ORTEP-Darstellung eines Ausschnitts der "Ketten" aus flächenverknüpften [TiO 6 ]-Oktaedern einschließlich der in der Idealstruktur
3.6 Phosphate der Strukturfamilie M 2 O(PO 4 ) 93 Abbildung 3.29 Ti 5 O 4 (PO 4 ). ORTEP-Darstellung eines Ausschnitts der "Ketten" aus flächenverknüpften [TiO 6 ]-Oktaedern einschließlich der in der Idealstruktur
Polymorphie von Triamcinoloacetonid
 Versuch F4 Polymorphie von Triamcinoloacetonid Einführung Der Begriff Polymorphie bezeichnet die Eigenschaft chemischer Verbindung in mehreren kristallinen Modifikationen vorzukommen. Findet sich für eine
Versuch F4 Polymorphie von Triamcinoloacetonid Einführung Der Begriff Polymorphie bezeichnet die Eigenschaft chemischer Verbindung in mehreren kristallinen Modifikationen vorzukommen. Findet sich für eine
Anorganische Chemie III
 Seminar zu Vorlesung Anorganische Chemie III Wintersemester 2012/13 Christoph Wölper Universität Duisburg-Essen > Intermetallische Phasen Hume-Rothery-Phasen # späte Übergangsmetalle (Gruppe T2) und Gruppe
Seminar zu Vorlesung Anorganische Chemie III Wintersemester 2012/13 Christoph Wölper Universität Duisburg-Essen > Intermetallische Phasen Hume-Rothery-Phasen # späte Übergangsmetalle (Gruppe T2) und Gruppe
Darstellung des Messings Cu 2 Zn
 Darstellung des Messings Cu 2 Zn Andreas J. Wagner 7. Juli 2004 1 Theorie Legierungen sind intermetallische Verbindungen. Im beschriebenen Versuch war es das Ziel, ein Messing 1 der Zusammensetzung Cu
Darstellung des Messings Cu 2 Zn Andreas J. Wagner 7. Juli 2004 1 Theorie Legierungen sind intermetallische Verbindungen. Im beschriebenen Versuch war es das Ziel, ein Messing 1 der Zusammensetzung Cu
3.Präparat / Versuch 8.3
 .Präparat ersuch 8. Herstellung von Nitropentainkobalt(III)-chlorid ([NH ) 5 NO ]Cl ) 1. Herstellungsvorschrift: (Quelle 1, ) Es sollen g Nitropentainkobalt(III)-chlorid hergestellt werden. a) Herstellung
.Präparat ersuch 8. Herstellung von Nitropentainkobalt(III)-chlorid ([NH ) 5 NO ]Cl ) 1. Herstellungsvorschrift: (Quelle 1, ) Es sollen g Nitropentainkobalt(III)-chlorid hergestellt werden. a) Herstellung
Anorganische-Chemie. Michael Beetz Arbeitskreis Prof. Bein. Grundpraktikum für Biologen 2017
 Michael Beetz Arbeitskreis Prof. Bein Butenandstr. 11, Haus E, E 3.027 michael.beetz@cup.uni-muenchen.de Anorganische-Chemie Grundpraktikum für Biologen 2017 Trennungsgänge und Nachweise # 2 Trennungsgänge
Michael Beetz Arbeitskreis Prof. Bein Butenandstr. 11, Haus E, E 3.027 michael.beetz@cup.uni-muenchen.de Anorganische-Chemie Grundpraktikum für Biologen 2017 Trennungsgänge und Nachweise # 2 Trennungsgänge
Schmelzdiagramm eines binären Stoffgemisches
 Praktikum Physikalische Chemie I 30. Oktober 2015 Schmelzdiagramm eines binären Stoffgemisches Guido Petri Anastasiya Knoch PC111/112, Gruppe 11 1. Theorie hinter dem Versuch Ein Schmelzdiagramm zeigt
Praktikum Physikalische Chemie I 30. Oktober 2015 Schmelzdiagramm eines binären Stoffgemisches Guido Petri Anastasiya Knoch PC111/112, Gruppe 11 1. Theorie hinter dem Versuch Ein Schmelzdiagramm zeigt
Grundlagen der Röntgenpulverdiffraktometrie. Seminar zur Vorlesung Anorganische Chemie I und II
 David Enseling und Thomas Jüstel Seminar zur Vorlesung Anorganische Chemie I und II Folie 1 Entdeckung + erste Anwendung der X-Strahlen Wilhelm Roentgen, December of 1895. The X-ray of Mrs. Roentgen's
David Enseling und Thomas Jüstel Seminar zur Vorlesung Anorganische Chemie I und II Folie 1 Entdeckung + erste Anwendung der X-Strahlen Wilhelm Roentgen, December of 1895. The X-ray of Mrs. Roentgen's
Festkörperchemie SYNTHESE. Shake and bake Methode: Sol-Gel-Methode. Am Beispiel :
 Festkörperchemie SYNTHESE Shake and bake Methode: Am Beispiel : Man zerkleinert die Salze mechanisch, damit eine möglichst große Grenzfläche zwischen den beiden Komponenten entsteht und vermischt das ganze.
Festkörperchemie SYNTHESE Shake and bake Methode: Am Beispiel : Man zerkleinert die Salze mechanisch, damit eine möglichst große Grenzfläche zwischen den beiden Komponenten entsteht und vermischt das ganze.
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde Festkörper, ausgewählte Beispiele spezieller Eigenschaften von Feststoffen, Kohlenstoffmodifikationen, Nichtstöchiometrie, Unterscheidung kristalliner und amorpher
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde Festkörper, ausgewählte Beispiele spezieller Eigenschaften von Feststoffen, Kohlenstoffmodifikationen, Nichtstöchiometrie, Unterscheidung kristalliner und amorpher
Statistische Randnotizen
 Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde:
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Ionenbindung, Koordinationspolyeder, ionische Strukturen, NaCl, CsCl, ZnS, Elementarzelle, Gitter, Gitterkonstanten, 7 Kristallsysteme, Ionenradien, Gitterenergie
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Ionenbindung, Koordinationspolyeder, ionische Strukturen, NaCl, CsCl, ZnS, Elementarzelle, Gitter, Gitterkonstanten, 7 Kristallsysteme, Ionenradien, Gitterenergie
Wechselwirkung zwischen Licht und chemischen Verbindungen
 Photometer Zielbegriffe Photometrie. Gesetz v. Lambert-Beer, Metallkomplexe, Elektronenanregung, Flammenfärbung, Farbe Erläuterungen Die beiden Versuche des 4. Praktikumstages sollen Sie mit der Photometrie
Photometer Zielbegriffe Photometrie. Gesetz v. Lambert-Beer, Metallkomplexe, Elektronenanregung, Flammenfärbung, Farbe Erläuterungen Die beiden Versuche des 4. Praktikumstages sollen Sie mit der Photometrie
6. Die Chemische Bindung
 6. Die Chemische Bindung Hauptbindungsarten Kovalente Bindung I Kovalente Bindung II Ionenbindung Metallische Bindung Nebenbindungsarten Van der Waals Wechselwirkung Wasserstoffbrückenbindung Salzartige
6. Die Chemische Bindung Hauptbindungsarten Kovalente Bindung I Kovalente Bindung II Ionenbindung Metallische Bindung Nebenbindungsarten Van der Waals Wechselwirkung Wasserstoffbrückenbindung Salzartige
DIE FEINBÄULICHE RELATION ZWISCHEN EUDIDYMIT UND EPIDIDYMIT
 DIE FEINBÄULICHE RELATION ZWISCHEN EUDIDYMIT UND EPIDIDYMIT VON W. H. ZACHARIASEN ie Verbindung NaBeSi3Ü7 (0H) kommt in der Natur in zwei D Modifikationen vor, nämlich als die seltenen Minerale Eudidymit
DIE FEINBÄULICHE RELATION ZWISCHEN EUDIDYMIT UND EPIDIDYMIT VON W. H. ZACHARIASEN ie Verbindung NaBeSi3Ü7 (0H) kommt in der Natur in zwei D Modifikationen vor, nämlich als die seltenen Minerale Eudidymit
Alles was uns umgibt!
 Was ist Chemie? Womit befasst sich die Chemie? Die Chemie ist eine Naturwissenschaft, die sich mit der Materie (den Stoffen), ihren Eigenschaften und deren Umwandlung befasst Was ist Chemie? Was ist Materie?
Was ist Chemie? Womit befasst sich die Chemie? Die Chemie ist eine Naturwissenschaft, die sich mit der Materie (den Stoffen), ihren Eigenschaften und deren Umwandlung befasst Was ist Chemie? Was ist Materie?
Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz
 Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz Sebastian Pfitzner 5. Juni 03 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Anna Andrle (55077) Arbeitsplatz: Platz 3 Betreuer:
Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz Sebastian Pfitzner 5. Juni 03 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Anna Andrle (55077) Arbeitsplatz: Platz 3 Betreuer:
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene im II. Physikalischen Institut. Versuch Nr. 24: Röntgenographische Methoden
 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene im II. Physikalischen Institut Versuch Nr. 24: Röntgenographische Methoden Betreuer: M. Cwik, Tel.: 470 3574, E-mail: cwik@ph2.uni-koeln.de November 2004 Im
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene im II. Physikalischen Institut Versuch Nr. 24: Röntgenographische Methoden Betreuer: M. Cwik, Tel.: 470 3574, E-mail: cwik@ph2.uni-koeln.de November 2004 Im
Thema heute: Grundlegende Ionenstrukturen
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde Einfache Metallstrukturen, Dichtestpackung von "Atomkugeln", N Oktaeder-, 2N Tetraederlücken, Hexagonal-dichte Packung, Schichtfolge ABAB, hexagonale Elementarzelle,
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde Einfache Metallstrukturen, Dichtestpackung von "Atomkugeln", N Oktaeder-, 2N Tetraederlücken, Hexagonal-dichte Packung, Schichtfolge ABAB, hexagonale Elementarzelle,
1. Kristalliner Zustand der Materie
 Vorwort Eine Vorlesung über Festkörperphysikgehörtzu den Pflichtveranstaltungen des Physikstudiums an Universitäten und Technischen Hochschulen. Sie wird im allgemeinen als Einführungsvorlesung innerhalb
Vorwort Eine Vorlesung über Festkörperphysikgehörtzu den Pflichtveranstaltungen des Physikstudiums an Universitäten und Technischen Hochschulen. Sie wird im allgemeinen als Einführungsvorlesung innerhalb
Allgemeine Chemie I Herbstsemester 2012
 Lösung 4 Allgemeine Chemie I Herbstsemester 2012 1. Aufgabe Im Vorlesungsskript sind für Xenon die Werte σ(xe) = 406 pm und ε = 236 kjmol 1 tabelliert. ( ) 12 ( ) 6 σ σ E i j = 4ε (1) r i j r i j r i j
Lösung 4 Allgemeine Chemie I Herbstsemester 2012 1. Aufgabe Im Vorlesungsskript sind für Xenon die Werte σ(xe) = 406 pm und ε = 236 kjmol 1 tabelliert. ( ) 12 ( ) 6 σ σ E i j = 4ε (1) r i j r i j r i j
Protokoll Grundpraktikum: O1 Dünne Linsen
 Protokoll Grundpraktikum: O1 Dünne Linsen Sebastian Pfitzner 22. Januar 2013 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Jannis Schürmer (552892) Arbeitsplatz: 3 Betreuer: A. Ahlrichs Versuchsdatum: 16.01.2013
Protokoll Grundpraktikum: O1 Dünne Linsen Sebastian Pfitzner 22. Januar 2013 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Jannis Schürmer (552892) Arbeitsplatz: 3 Betreuer: A. Ahlrichs Versuchsdatum: 16.01.2013
ISP-Methodenkurs. Pulverdiffraktometrie. Prof. Dr. Michael Fröba, AC Raum 114, Tel: 040 /
 ISP-Methodenkurs Pulverdiffraktometrie Prof. Dr. Michael Fröba, AC Raum 4, Tel: 4 / 4838-337 www.chemie.uni-hamburg.de/ac/froeba/ Röntgenstrahlung (I) Wilhelm Conrad Röntgen (845-93) 879-888 Professor
ISP-Methodenkurs Pulverdiffraktometrie Prof. Dr. Michael Fröba, AC Raum 4, Tel: 4 / 4838-337 www.chemie.uni-hamburg.de/ac/froeba/ Röntgenstrahlung (I) Wilhelm Conrad Röntgen (845-93) 879-888 Professor
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde:
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Hybridisierung und Molekülstruktur, sp 3 -Hybridorbitale (Tetraeder), sp 2 - Hybridorbitale (trigonal planare Anordnung), sp-hybridorbitale (lineare Anordnung),
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Hybridisierung und Molekülstruktur, sp 3 -Hybridorbitale (Tetraeder), sp 2 - Hybridorbitale (trigonal planare Anordnung), sp-hybridorbitale (lineare Anordnung),
1. Klausur Allgemeine und Anorganische Chemie B.Sc. Chemie
 1. Klausur Allgemeine und Anorganische Chemie B.Sc. Chemie Name: Vorname: Matrikel Nr.: 15.12.2010 Die Durchführung und Auswertung der 12 Aufgaben im zweiten Teil dieser Klausur mit je vier Aussagen (a-d)
1. Klausur Allgemeine und Anorganische Chemie B.Sc. Chemie Name: Vorname: Matrikel Nr.: 15.12.2010 Die Durchführung und Auswertung der 12 Aufgaben im zweiten Teil dieser Klausur mit je vier Aussagen (a-d)
Grundlagen der Elektrotechnik: Wechselstromwiderstand Xc Seite 1 R =
 Grundlagen der Elektrotechnik: Wechselstromwiderstand Xc Seite 1 Versuch zur Ermittlung der Formel für X C In der Erklärung des Ohmschen Gesetzes ergab sich die Formel: R = Durch die Versuche mit einem
Grundlagen der Elektrotechnik: Wechselstromwiderstand Xc Seite 1 Versuch zur Ermittlung der Formel für X C In der Erklärung des Ohmschen Gesetzes ergab sich die Formel: R = Durch die Versuche mit einem
Physik IV Einführung in die Atomistik und die Struktur der Materie
 Physik IV Einführung in die Atomistik und die Struktur der Materie Sommersemester 2011 Vorlesung 21 30.06.2011 Physik IV - Einführung in die Atomistik Vorlesung 21 Prof. Thorsten Kröll 30.06.2011 1 H 2
Physik IV Einführung in die Atomistik und die Struktur der Materie Sommersemester 2011 Vorlesung 21 30.06.2011 Physik IV - Einführung in die Atomistik Vorlesung 21 Prof. Thorsten Kröll 30.06.2011 1 H 2
Trisacetylacetonatoferrat(III) Fe(acac) 3
 Trisacetylacetonatoferrat(III) Fe(acac) 3 Mols, 21. 11. 2004 Marco Lendi, AC II 1. Synthese 1.1 Methode Wasserfreies Eisen(III)chlorid wird in wässriger, basischer Lösung durch Erhitzen in Eisen(III)hydroxid
Trisacetylacetonatoferrat(III) Fe(acac) 3 Mols, 21. 11. 2004 Marco Lendi, AC II 1. Synthese 1.1 Methode Wasserfreies Eisen(III)chlorid wird in wässriger, basischer Lösung durch Erhitzen in Eisen(III)hydroxid
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde Gitterpunkte, Gittergeraden, Gitterebenen, Weiß'sche Koeffizienten, Miller Indizes Symmetrie in Festkörpern, Symmetrieelemente, Symmetrieoperationen, Punktgruppenymmetrie,
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde Gitterpunkte, Gittergeraden, Gitterebenen, Weiß'sche Koeffizienten, Miller Indizes Symmetrie in Festkörpern, Symmetrieelemente, Symmetrieoperationen, Punktgruppenymmetrie,
Dichlorobis(triphenylphosphin)nickel(II)
 Praktikum Org. und Anorg. Chemie II D-CHAB Wintersemester 04/05 Zürich, den 8. November 2004 Dichlorobis(triphenylphosphin)nickel(II) [Ni 2 ( ) 2 ] Ni 1 1. SYNTHESE 1.1 Methode [1] Nickel(II)chlorid reagiert
Praktikum Org. und Anorg. Chemie II D-CHAB Wintersemester 04/05 Zürich, den 8. November 2004 Dichlorobis(triphenylphosphin)nickel(II) [Ni 2 ( ) 2 ] Ni 1 1. SYNTHESE 1.1 Methode [1] Nickel(II)chlorid reagiert
Strukturchemie. Kristallstrukturen. Elementstrukturen. Kugelpackungen. Kubisch dichte Kugelpackung. Lehramt 1a Sommersemester
 Kugelpackungen Kubisch dichte Kugelpackung Lehramt 1a Sommersemester 2010 1 Kugelpackungen: kubisch dichte Packung (kdp, ccp) C B A A C B A C B A C Lehramt 1a Sommersemester 2010 2 Kugelpackungen Atome
Kugelpackungen Kubisch dichte Kugelpackung Lehramt 1a Sommersemester 2010 1 Kugelpackungen: kubisch dichte Packung (kdp, ccp) C B A A C B A C B A C Lehramt 1a Sommersemester 2010 2 Kugelpackungen Atome
Darstellung von Borphosphid
 Darstellung von Borphosphid B P BP + Bor M = 10,81 g/mol Phosphor M = 30,97 g/mol Borphosphid M = 41,78 g/mol 1. Reaktionstyp Das Produkt wird aus den Elementen in einer Festkörperreaktion dargestellt.
Darstellung von Borphosphid B P BP + Bor M = 10,81 g/mol Phosphor M = 30,97 g/mol Borphosphid M = 41,78 g/mol 1. Reaktionstyp Das Produkt wird aus den Elementen in einer Festkörperreaktion dargestellt.
Typisch metallische Eigenschaften:
 Typisch metallische Eigenschaften: hohe elektrische Leitfähigkeit hohe thermische Leitfähigkeit bei Energiezufuhr (Wärme, elektromagnetische Strahlung) können Elektronen emittiert werden metallischer Glanz
Typisch metallische Eigenschaften: hohe elektrische Leitfähigkeit hohe thermische Leitfähigkeit bei Energiezufuhr (Wärme, elektromagnetische Strahlung) können Elektronen emittiert werden metallischer Glanz
Tris(acetylacetonato)eisen(III)
 Praktikum rg. und Anorg. Chemie II DCHAB Wintersemester 04/05 Zürich, den 15. November 2004 Tris(acetylacetonato)eisen(III) [Fe(acac) 3 ] Fe 1 1. SYNTHESE 1.1 Methode [1] Eisen(III)chlorid wird mit Ammoniak
Praktikum rg. und Anorg. Chemie II DCHAB Wintersemester 04/05 Zürich, den 15. November 2004 Tris(acetylacetonato)eisen(III) [Fe(acac) 3 ] Fe 1 1. SYNTHESE 1.1 Methode [1] Eisen(III)chlorid wird mit Ammoniak
Zentralabitur 2011 Physik Schülermaterial Aufgabe I ga Bearbeitungszeit: 220 min
 Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Gefügeumwandlung in Fe-C-Legierungen
 Werkstoffwissenschaftliches Grundpraktikum Versuch vom 18. Mai 2009 Betreuer: Thomas Wöhrle Gefügeumwandlung in Fe-C-Legierungen Gruppe 3 Protokoll: Simon Kumm, uni@simon-kumm.de Mitarbeiter: Philipp Kaller,
Werkstoffwissenschaftliches Grundpraktikum Versuch vom 18. Mai 2009 Betreuer: Thomas Wöhrle Gefügeumwandlung in Fe-C-Legierungen Gruppe 3 Protokoll: Simon Kumm, uni@simon-kumm.de Mitarbeiter: Philipp Kaller,
Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau
 Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau Einleitung Lösungen mit verschiedenen ph-werten von stark sauer bis stark basisch werden mit gleich viel Thymolblau-Lösung versetzt.
Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau Einleitung Lösungen mit verschiedenen ph-werten von stark sauer bis stark basisch werden mit gleich viel Thymolblau-Lösung versetzt.
HÖHERE PHYSIK SKRIPTUM VORLESUNGBLATT XII
 Prof. Dr. F. Koch Dr. H. E. Porteanu fkoch@ph.tum.de porteanu@ph.tum.de SS 2005 HÖHERE PHYSIK SKRIPTUM VORLESUNGBLATT XII 19.05.05 Festkörperphysik - Kristalle Nach unserem kurzen Ausflug in die Molekülphysik
Prof. Dr. F. Koch Dr. H. E. Porteanu fkoch@ph.tum.de porteanu@ph.tum.de SS 2005 HÖHERE PHYSIK SKRIPTUM VORLESUNGBLATT XII 19.05.05 Festkörperphysik - Kristalle Nach unserem kurzen Ausflug in die Molekülphysik
Pflichtaufgaben. Die geradlinige Bewegung eines PKW ist durch folgende Zeit-Geschwindigkeit- Messwertpaare beschrieben.
 Abitur 2002 Physik Gk Seite 3 Pflichtaufgaben (24 BE) Aufgabe P1 Mechanik Die geradlinige Bewegung eines PKW ist durch folgende Zeit-Geschwindigkeit- Messwertpaare beschrieben. t in s 0 7 37 40 100 v in
Abitur 2002 Physik Gk Seite 3 Pflichtaufgaben (24 BE) Aufgabe P1 Mechanik Die geradlinige Bewegung eines PKW ist durch folgende Zeit-Geschwindigkeit- Messwertpaare beschrieben. t in s 0 7 37 40 100 v in
Klausuraufgaben Grundpraktikum Testat vom Seite- 1 - Punkte. Bitte eintragen: Bitte ankreuzen: Frage 1
 Klausuraufgaben Grundpraktikum Testat vom 6.6.02 Seite- 1 - Punkte Matrikelnummer: Name: Bitte eintragen: Vorname: Bitte ankreuzen: Fachrichtung: Chemie Biotechnologie Pharmazie Frage 1 Schreiben Sie die
Klausuraufgaben Grundpraktikum Testat vom 6.6.02 Seite- 1 - Punkte Matrikelnummer: Name: Bitte eintragen: Vorname: Bitte ankreuzen: Fachrichtung: Chemie Biotechnologie Pharmazie Frage 1 Schreiben Sie die
Ein Gemisch aus 13,2 g (0,1mol) 2,5-Dimethoxyterahydrofuran und 80ml 0,6 N Salzsäure werden erhitzt bis vollständige Lösung eintritt.
 1.Acetondicarbonsäureanhydrid 40g (0,27mol)Acetondicarbonsäure werden in einer Lösung aus 100ml Eisessig und 43ml (0,45mol) Essigsäureanhydrid gelöst. Die Temperatur sollte 20 C nicht überschreiten und
1.Acetondicarbonsäureanhydrid 40g (0,27mol)Acetondicarbonsäure werden in einer Lösung aus 100ml Eisessig und 43ml (0,45mol) Essigsäureanhydrid gelöst. Die Temperatur sollte 20 C nicht überschreiten und
Kurs Röntgenstrukturanalyse, Teil 1: Der kristalline Zustand
 Kurs Röntgenstrukturanalyse, Teil 1: Der kristalline Zustand Beispiel 1: Difluoramin M. F. Klapdor, H. Willner, W. Poll, D. Mootz, Angew. Chem. 1996, 108, 336. Gitterpunkt, Gitter, Elementarzelle, Gitterkonstanten,
Kurs Röntgenstrukturanalyse, Teil 1: Der kristalline Zustand Beispiel 1: Difluoramin M. F. Klapdor, H. Willner, W. Poll, D. Mootz, Angew. Chem. 1996, 108, 336. Gitterpunkt, Gitter, Elementarzelle, Gitterkonstanten,
Raumfahrtmedizin. darauf hin, dass es auch einen Zusammenhang zwischen Knochenabbau, Bluthochdruck und Kochsalzzufuhr gibt. 64 DLR NACHRICHTEN 113
 Raumfahrtmedizin Gibt es einen Die geringe mechanische Belastung der unteren Extremitäten von Astronauten im All ist eine wesentliche Ursache für den Knochenabbau in Schwerelosigkeit. Gleichzeitig haben
Raumfahrtmedizin Gibt es einen Die geringe mechanische Belastung der unteren Extremitäten von Astronauten im All ist eine wesentliche Ursache für den Knochenabbau in Schwerelosigkeit. Gleichzeitig haben
Übung 9. Allgemeine Chemie I Herbstsemester Vergleichen Sie die Abbildung 30.1 (MM., p. 515).
 Übung 9 Allgemeine Chemie I Herbstsemester 2012 1. Aufgabe Vergleichen Sie die Abbildung 30.1 (MM., p. 515). 2. Aufgabe Der Chelateffekt beruht darauf, dass ein mehrzähniger Ligand (einer, der simultan
Übung 9 Allgemeine Chemie I Herbstsemester 2012 1. Aufgabe Vergleichen Sie die Abbildung 30.1 (MM., p. 515). 2. Aufgabe Der Chelateffekt beruht darauf, dass ein mehrzähniger Ligand (einer, der simultan
Thema heute: Aufbau fester Stoffe - Kristallographie
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Thema: Ionenbindung Ionenbindung, Kationen, Anionen, Coulomb-Kräfte Thema heute: Aufbau fester Stoffe - Kristallographie 244 Aufbau fester Materie Im Gegensatz
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Thema: Ionenbindung Ionenbindung, Kationen, Anionen, Coulomb-Kräfte Thema heute: Aufbau fester Stoffe - Kristallographie 244 Aufbau fester Materie Im Gegensatz
Diskussion der Ergebnisse
 5 Diskussion der Ergebnisse Die Auswertung der Basiseigenschaften der Gläser beider Versuchsreihen lieferte folgende Ergebnisse: Die optische Einteilung der hergestellten Gläser konnte in zwei Gruppen
5 Diskussion der Ergebnisse Die Auswertung der Basiseigenschaften der Gläser beider Versuchsreihen lieferte folgende Ergebnisse: Die optische Einteilung der hergestellten Gläser konnte in zwei Gruppen
Versuchsprotokoll Kapitel 6
 Versuchsprotokoll Kapitel 6 Felix, Sebastian, Tobias, Raphael, Joel 1. Semester 21 Inhaltsverzeichnis Einleitung...3 Versuch 6.1...3 Einwaagen und Herstellung der Verdünnungen...3 Photospektrometrisches
Versuchsprotokoll Kapitel 6 Felix, Sebastian, Tobias, Raphael, Joel 1. Semester 21 Inhaltsverzeichnis Einleitung...3 Versuch 6.1...3 Einwaagen und Herstellung der Verdünnungen...3 Photospektrometrisches
Kartendienst zur Luftschadstoffbelastung in Deutschland
 Kartendienst zur Luftschadstoffbelastung in Deutschland Eine interaktive Darstellung der räumlichen Verteilung von Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid Informationen zur Handhabung I. Datenaufbereitung
Kartendienst zur Luftschadstoffbelastung in Deutschland Eine interaktive Darstellung der räumlichen Verteilung von Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid Informationen zur Handhabung I. Datenaufbereitung
Sind Sie nun bereit für die Lernkontrolle? Lösen Sie die Aufgaben zu diesem Thema.
 Anwendungen des chemischen Gleichgewichtes 7 Gruppe1: Gruppe 1 Die Konzentration beeinflusst das chemische Gleichgewicht Uebersicht Die Reaktionsteilnehmer einer chemischen Reaktion im Gleichgewicht liegen
Anwendungen des chemischen Gleichgewichtes 7 Gruppe1: Gruppe 1 Die Konzentration beeinflusst das chemische Gleichgewicht Uebersicht Die Reaktionsteilnehmer einer chemischen Reaktion im Gleichgewicht liegen
Klausuraufgaben Grundpraktikum Testat vom Seite- 1 - Punkte. Bitte eintragen: Bitte ankreuzen: Frage 1
 Klausuraufgaben Grundpraktikum Testat vom 6.6.02 Seite- 1 - Punkte Matrikelnummer: ame: Bitte eintragen: Vorname: Bitte ankreuzen: Fachrichtung: Chemie Biotechnologie Pharmazie Frage 1 Schreiben Sie die
Klausuraufgaben Grundpraktikum Testat vom 6.6.02 Seite- 1 - Punkte Matrikelnummer: ame: Bitte eintragen: Vorname: Bitte ankreuzen: Fachrichtung: Chemie Biotechnologie Pharmazie Frage 1 Schreiben Sie die
Konzentrationsbestimmung von Zink, Natrium und Calcium in verschiedenen Mineralwassern mittels Atom-Absorptions-Spektroskopie
 Analytisches Physikalisches Praktikum SS 07 AAS Konzentrationsbestimmung von Zink, Natrium und Calcium in verschiedenen Mineralwassern mittels Atom-Absorptions-Spektroskopie Assistent: Markus Wälle, waelle@inorg.chem.ethz.ch
Analytisches Physikalisches Praktikum SS 07 AAS Konzentrationsbestimmung von Zink, Natrium und Calcium in verschiedenen Mineralwassern mittels Atom-Absorptions-Spektroskopie Assistent: Markus Wälle, waelle@inorg.chem.ethz.ch
Grundlagen der Kinetik
 Kapitel 1 Grundlagen der Kinetik In diesem Kapitel werden die folgenden Themen kurz wiederholt: Die differenziellen und integralen Geschwindigkeitsgesetze von irreversiblen Reaktionen., 1., und. Ordnung
Kapitel 1 Grundlagen der Kinetik In diesem Kapitel werden die folgenden Themen kurz wiederholt: Die differenziellen und integralen Geschwindigkeitsgesetze von irreversiblen Reaktionen., 1., und. Ordnung
Key-Words: Niedertemperatursynthese, Nanopartikel, Mikrowellen, Intermetallische Verbindungen
 Metalle aus der Mikrowelle Eine leistungsstarke Methode Key-Words: Niedertemperatursynthese, Nanopartikel, Mikrowellen, Intermetallische Verbindungen Mit dem mikrowellenunterstützten Polyol-Prozess ist
Metalle aus der Mikrowelle Eine leistungsstarke Methode Key-Words: Niedertemperatursynthese, Nanopartikel, Mikrowellen, Intermetallische Verbindungen Mit dem mikrowellenunterstützten Polyol-Prozess ist
3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung
 Eigene Untersuchungen 25 3.2 Ergebnisse 3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung Untersucht wurde, ob die Magnetfeldbehandlung mit 1, 8, 12, 29 und 5 Hz einen Einfluss
Eigene Untersuchungen 25 3.2 Ergebnisse 3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung Untersucht wurde, ob die Magnetfeldbehandlung mit 1, 8, 12, 29 und 5 Hz einen Einfluss
Über den Einfluß von Gasen, besonders von Sauerstoffspuren, auf die elektrischen Eigenschaften von aufgedampften PbS-Schichten 1
 zur Zeit t = 0, ineinander diffundieren. Als Ganzes sei das Gas in Ruhe (u = 0). Zur Zeit t = oo werden die Relativkonzentrationen yi ^ in beiden Kammern gleich sein. Die Temperatur der Wände habe den
zur Zeit t = 0, ineinander diffundieren. Als Ganzes sei das Gas in Ruhe (u = 0). Zur Zeit t = oo werden die Relativkonzentrationen yi ^ in beiden Kammern gleich sein. Die Temperatur der Wände habe den
Versuch 2: Kristallisation (und Reaktionskinetik)
 Praktikum Chemie I WS 2006/2007 Versuch 2: Kristallisation (und Reaktionskinetik) Sylvie Ruch Annette Altwegg Patricia Doll Sylvie Ruch 18.12.06 Assistent: Dean Glettig sruch@student.ethz.ch 1. Zusammenfassung
Praktikum Chemie I WS 2006/2007 Versuch 2: Kristallisation (und Reaktionskinetik) Sylvie Ruch Annette Altwegg Patricia Doll Sylvie Ruch 18.12.06 Assistent: Dean Glettig sruch@student.ethz.ch 1. Zusammenfassung
12 Zusammenfassung. Zusammenfassung 207
 Zusammenfassung 207 12 Zusammenfassung Die Arbeit liefert einen Beitrag zur Ermittlung der hydraulischen Verluste von Stirnradverzahnungen. Insbesondere wurde der Einfluss des Flanken- und des Kopfspieles
Zusammenfassung 207 12 Zusammenfassung Die Arbeit liefert einen Beitrag zur Ermittlung der hydraulischen Verluste von Stirnradverzahnungen. Insbesondere wurde der Einfluss des Flanken- und des Kopfspieles
2. Woche. Anorganische Analysenmethodik
 2. Woche Anorganische Analysenmethodik Die analytische Chemie befasst sich mit den Methoden zur Ermittlung der stofflichen Zusammensetzung. Durch eine qualitative Analyse wird festgestellt, welche Atome
2. Woche Anorganische Analysenmethodik Die analytische Chemie befasst sich mit den Methoden zur Ermittlung der stofflichen Zusammensetzung. Durch eine qualitative Analyse wird festgestellt, welche Atome
Grundlagen der Chemie Verschieben von Gleichgewichten
 Verschieben von Gleichgewichten Prof. Annie Powell KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Prinzip des kleinsten Zwangs Das
Verschieben von Gleichgewichten Prof. Annie Powell KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Prinzip des kleinsten Zwangs Das
Rotation. Versuch: Inhaltsverzeichnis. Fachrichtung Physik. Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010. Physikalisches Grundpraktikum
 Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Versuch: RO Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010 Rotation Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung 2 2 Allgemeine Grundlagen 2 2.1
Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Versuch: RO Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010 Rotation Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung 2 2 Allgemeine Grundlagen 2 2.1
Versuch P2-13: Interferenz. Auswertung. Von Jan Oertlin und Ingo Medebach. 3. Mai 2010
 Versuch P2-13: Interferenz Auswertung Von Jan Oertlin und Ingo Medebach 3. Mai 2010 Inhaltsverzeichnis 1 Newtonsche Ringe 2 1.1 Krümmungsradius R einer symmetrischen sphärischen Bikonvexlinse..........
Versuch P2-13: Interferenz Auswertung Von Jan Oertlin und Ingo Medebach 3. Mai 2010 Inhaltsverzeichnis 1 Newtonsche Ringe 2 1.1 Krümmungsradius R einer symmetrischen sphärischen Bikonvexlinse..........
Beugung am Spalt und Gitter
 Demonstrationspraktikum für Lehramtskandidaten Versuch O1 Beugung am Spalt und Gitter Sommersemester 2006 Name: Daniel Scholz Mitarbeiter: Steffen Ravekes EMail: daniel@mehr-davon.de Gruppe: 4 Durchgeführt
Demonstrationspraktikum für Lehramtskandidaten Versuch O1 Beugung am Spalt und Gitter Sommersemester 2006 Name: Daniel Scholz Mitarbeiter: Steffen Ravekes EMail: daniel@mehr-davon.de Gruppe: 4 Durchgeführt
Tab. 4.1: Altersverteilung der Gesamtstichprobe BASG SASG BAS SAS UDS SCH AVP Mittelwert Median Standardabweichung 44,36 43,00 11,84
 Im weiteren wird gemäß den allgemeinen statistischen Regeln zufolge bei Vorliegen von p=,5 und
Im weiteren wird gemäß den allgemeinen statistischen Regeln zufolge bei Vorliegen von p=,5 und
Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum I. Quantitative Analyse. Prof. Dr. M. Scheer Patrick Schwarz
 Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum I Quantitative Analyse Prof. Dr. M. Scheer Patrick Schwarz Termine und Organisatorisches Immer Donnerstag, 11:00 12:00 in HS 44 Am Semesteranfang zusätzlich
Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum I Quantitative Analyse Prof. Dr. M. Scheer Patrick Schwarz Termine und Organisatorisches Immer Donnerstag, 11:00 12:00 in HS 44 Am Semesteranfang zusätzlich
Abschlussklausur Allgemeine und Anorganische Chemie Teil 2 (Geologie, Geophysik und Mineralogie)
 Abschlussklausur Allgemeine und Anorganische Chemie Teil 2 (Geologie, Geophysik und Mineralogie) Teilnehmer/in:... Matrikel-Nr.:... - 1. Sie sollen aus NaCl und Wasser 500 ml einer Lösung herstellen, die
Abschlussklausur Allgemeine und Anorganische Chemie Teil 2 (Geologie, Geophysik und Mineralogie) Teilnehmer/in:... Matrikel-Nr.:... - 1. Sie sollen aus NaCl und Wasser 500 ml einer Lösung herstellen, die
Einführung. Ablesen von einander zugeordneten Werten
 Einführung Zusammenhänge zwischen Größen wie Temperatur, Geschwindigkeit, Lautstärke, Fahrstrecke, Preis, Einkommen, Steuer etc. werden mit beschrieben. Eine Zuordnung f, die jedem x A genau ein y B zuweist,
Einführung Zusammenhänge zwischen Größen wie Temperatur, Geschwindigkeit, Lautstärke, Fahrstrecke, Preis, Einkommen, Steuer etc. werden mit beschrieben. Eine Zuordnung f, die jedem x A genau ein y B zuweist,
Lösungen zu Janssen/Laatz, Statistische Datenanalyse mit SPSS 1. LÖSUNG 7 a)
 LÖSUNG 7 a) Lösungen zu Janssen/Laatz, Statistische Datenanalyse mit SPSS 1 Aufrufen der Varianzanalyse: "Analysieren", "Mittelwerte vergleichen", "Einfaktorielle ANOVA ", "Abhängige Variablen:" TVHOURS;
LÖSUNG 7 a) Lösungen zu Janssen/Laatz, Statistische Datenanalyse mit SPSS 1 Aufrufen der Varianzanalyse: "Analysieren", "Mittelwerte vergleichen", "Einfaktorielle ANOVA ", "Abhängige Variablen:" TVHOURS;
Zum Kalium-Natrium-Verhältnis in Demeter-Möhren
 Zum Kalium-Natrium-Verhältnis in Demeter-Möhren Auszug aus HAGEL, I. (1995): Zum Kalium-Natrium-Verhältnis in Demeter-Möhren. Lebendige Erde 2, 103-109. Biologisch-dynamisch angebaute Möhren (Markenzeichen
Zum Kalium-Natrium-Verhältnis in Demeter-Möhren Auszug aus HAGEL, I. (1995): Zum Kalium-Natrium-Verhältnis in Demeter-Möhren. Lebendige Erde 2, 103-109. Biologisch-dynamisch angebaute Möhren (Markenzeichen
Titration von Metallorganylen und Darstellung der dazu benötigten
 Kapitel 1 Titration von tallorganylen und Darstellung der dazu benötigten Indikatoren -(2-Tolyl)pivalinsäureamid, ein Indikator zur Konzentrationsbestimmung von -rganylen [1] Reaktionstyp: Syntheseleistung:
Kapitel 1 Titration von tallorganylen und Darstellung der dazu benötigten Indikatoren -(2-Tolyl)pivalinsäureamid, ein Indikator zur Konzentrationsbestimmung von -rganylen [1] Reaktionstyp: Syntheseleistung:
Methoden der Chemie III Teil 1 Modul M.Che.1101 WS 2010/11 12 Moderne Methoden der Anorganischen Chemie Mi 10:15-12:00, Hörsaal II George Sheldrick
 Methoden der Chemie III Teil 1 Modul M.Che.1101 WS 2010/11 12 Moderne Methoden der Anorganischen Chemie Mi 10:15-12:00, Hörsaal II George Sheldrick gsheldr@shelx.uni-ac.gwdg.de Röntgenbeugung an Pulvern
Methoden der Chemie III Teil 1 Modul M.Che.1101 WS 2010/11 12 Moderne Methoden der Anorganischen Chemie Mi 10:15-12:00, Hörsaal II George Sheldrick gsheldr@shelx.uni-ac.gwdg.de Röntgenbeugung an Pulvern
1. Qualitativer Nachweis von Anionen und Sodaauszug
 Anionennachweis 1 1. Qualitativer Nachweis von Anionen und Sodaauszug Die moderne Analytische Chemie unterscheidet zwischen den Bereichen der qualitativen und quantitativen Analyse sowie der Strukturanalyse.
Anionennachweis 1 1. Qualitativer Nachweis von Anionen und Sodaauszug Die moderne Analytische Chemie unterscheidet zwischen den Bereichen der qualitativen und quantitativen Analyse sowie der Strukturanalyse.
Anorganisches Praktikum 1. Semester. FB Chemieingenieurwesen. Labor für Anorg. Chemie Angew. Materialwiss. Versuchsvorschriften
 Anorganisches Praktikum 1. Semester FB Chemieingenieurwesen Labor für Anorg. Chemie Angew. Materialwiss. Versuchsvorschriften 1 Gravimetrie Bestimmung von Nickel Sie erhalten eine Lösung, die 0.1-0.2g
Anorganisches Praktikum 1. Semester FB Chemieingenieurwesen Labor für Anorg. Chemie Angew. Materialwiss. Versuchsvorschriften 1 Gravimetrie Bestimmung von Nickel Sie erhalten eine Lösung, die 0.1-0.2g
Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern
 Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern Worum geht es in diesem Modul? Schätzer als Zufallsvariablen Vorbereitung einer Simulation Verteilung von P-Dach Empirische Lage- und Streuungsparameter zur
Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern Worum geht es in diesem Modul? Schätzer als Zufallsvariablen Vorbereitung einer Simulation Verteilung von P-Dach Empirische Lage- und Streuungsparameter zur
TEP Strukturbestimmung von NaCl-Einkristallen verschiedener Orientierungen
 Strukturbestimmung von NaCl-Einkristallen TEP Verwandte Begriffe Charakteristische Röntgenstrahlung, Energieniveaus, Kristallstrukturen, Reziproke Gitter, Millersche- Indizes, Atomfaktor, Strukturfaktor,
Strukturbestimmung von NaCl-Einkristallen TEP Verwandte Begriffe Charakteristische Röntgenstrahlung, Energieniveaus, Kristallstrukturen, Reziproke Gitter, Millersche- Indizes, Atomfaktor, Strukturfaktor,
1.1 Wichtige Begriffe und Größen 1.2 Zustand eines Systems 1.3 Zustandsdiagramme eines Systems 1.4 Gibb sche Phasenregel
 Studieneinheit II Grundlegende Begriffe. Wichtige Begriffe und Größen. Zustand eines Systems. Zustandsdiagramme eines Systems.4 Gibb sche Phasenregel Gleichgewichtssysteme. Einstoff-Systeme. Binäre (Zweistoff-)
Studieneinheit II Grundlegende Begriffe. Wichtige Begriffe und Größen. Zustand eines Systems. Zustandsdiagramme eines Systems.4 Gibb sche Phasenregel Gleichgewichtssysteme. Einstoff-Systeme. Binäre (Zweistoff-)
Biochemisches Grundpraktikum
 Biochemisches Grundpraktikum Versuch Nummer G-01 01: Potentiometrische und spektrophotometrische Bestim- mung von Ionisationskonstanten Gliederung: I. Titrationskurve von Histidin und Bestimmung der pk-werte...
Biochemisches Grundpraktikum Versuch Nummer G-01 01: Potentiometrische und spektrophotometrische Bestim- mung von Ionisationskonstanten Gliederung: I. Titrationskurve von Histidin und Bestimmung der pk-werte...
Dünnschichtchromatographie
 PB III/Seminar DC Dünnschichtchromatographie Dr. Johanna Liebl Chromatographie - Prinzip physikalisch-chemische Trennmethoden Prinzip: Verteilung von Substanzen zwischen einer ruhenden (stationären) und
PB III/Seminar DC Dünnschichtchromatographie Dr. Johanna Liebl Chromatographie - Prinzip physikalisch-chemische Trennmethoden Prinzip: Verteilung von Substanzen zwischen einer ruhenden (stationären) und
Statistische Tests (Signifikanztests)
 Statistische Tests (Signifikanztests) [testing statistical hypothesis] Prüfen und Bewerten von Hypothesen (Annahmen, Vermutungen) über die Verteilungen von Merkmalen in einer Grundgesamtheit (Population)
Statistische Tests (Signifikanztests) [testing statistical hypothesis] Prüfen und Bewerten von Hypothesen (Annahmen, Vermutungen) über die Verteilungen von Merkmalen in einer Grundgesamtheit (Population)
Festk0203_ /11/2002. Neben Translationen gibt es noch weitere Deckoperationen die eine Struktur in sich überführen können:
 Festk234 37 11/11/22 2.9. Drehungen und Drehinversionen Bereits kennen gelernt: Translationssymmetrie. Neben Translationen gibt es noch weitere Deckoperationen die eine Struktur in sich überführen können:
Festk234 37 11/11/22 2.9. Drehungen und Drehinversionen Bereits kennen gelernt: Translationssymmetrie. Neben Translationen gibt es noch weitere Deckoperationen die eine Struktur in sich überführen können:
Anorganische Chemie III
 Seminar zu Vorlesung Anorganische Chemie III Wintersemester 2012/13 Christoph Wölper Universität Duisburg-Essen Symmetrie Kombination von Symmetrie-Elementen Symmetrie Kombination von Symmetrie-Elementen
Seminar zu Vorlesung Anorganische Chemie III Wintersemester 2012/13 Christoph Wölper Universität Duisburg-Essen Symmetrie Kombination von Symmetrie-Elementen Symmetrie Kombination von Symmetrie-Elementen
Mathe - Lernzettel: Nullstellen, Monotonie und Ableitungen
 Mathe - Lernzettel: Nullstellen, Monotonie und Ableitungen Leun4m 29. April 2015 Version: 0 Ich kann nicht für Richtigkeit garantieren! Inhaltsverzeichnis 1 Themenübersicht 1 2 Funktionen und Graphen 2
Mathe - Lernzettel: Nullstellen, Monotonie und Ableitungen Leun4m 29. April 2015 Version: 0 Ich kann nicht für Richtigkeit garantieren! Inhaltsverzeichnis 1 Themenübersicht 1 2 Funktionen und Graphen 2
Seminar: Löse- und Fällungsgleichgewichte
 1 Seminar: Löse- und Fällungsgleichgewichte Ziel des Seminars: Lösungs- und Fällungsgleichgewichte sollen verstanden werden. Weiters soll durch praxisrelevante Beispiele die medizinische und klinische
1 Seminar: Löse- und Fällungsgleichgewichte Ziel des Seminars: Lösungs- und Fällungsgleichgewichte sollen verstanden werden. Weiters soll durch praxisrelevante Beispiele die medizinische und klinische
Präzision in der Analytik Ein unentbehrlicher Teil der Methodenvalidierung
 Abacus Validation Systems Präzision in der Analytik Ein unentbehrlicher Teil der Methodenvalidierung Joachim Pum, MMed (Univ. Pretoria) 2008 Definition Präzision ist das Maß für die Streuung von Analysenergebnissen
Abacus Validation Systems Präzision in der Analytik Ein unentbehrlicher Teil der Methodenvalidierung Joachim Pum, MMed (Univ. Pretoria) 2008 Definition Präzision ist das Maß für die Streuung von Analysenergebnissen
Anorganisches Praktikum 1. Semester. FB Chemieingenieurwesen. Labor für Anorg. Chemie Angew. Materialwiss. Versuchsvorschriften
 Anorganisches Praktikum 1. Semester FB Chemieingenieurwesen Labor für Anorg. Chemie Angew. Materialwiss. Versuchsvorschriften 1 Gravimetrie Bestimmung von Nickel Sie erhalten eine Lösung, die 0.1-0.2g
Anorganisches Praktikum 1. Semester FB Chemieingenieurwesen Labor für Anorg. Chemie Angew. Materialwiss. Versuchsvorschriften 1 Gravimetrie Bestimmung von Nickel Sie erhalten eine Lösung, die 0.1-0.2g
Biometrieübung 11 Kontingenztafeln
 Biometrieübung 11 (Kontingenztafeln) - Aufgabe Biometrieübung 11 Kontingenztafeln Aufgabe 1 2x2-Kontingenztafeln 100 weibliche Patienten sind mit einer konventionellen Therapie behandelt worden 85 Patientinnen
Biometrieübung 11 (Kontingenztafeln) - Aufgabe Biometrieübung 11 Kontingenztafeln Aufgabe 1 2x2-Kontingenztafeln 100 weibliche Patienten sind mit einer konventionellen Therapie behandelt worden 85 Patientinnen
Fe 4 S 4 l2(spph 3 )2: ein neutraler, gemischt substituierter Eisen-Schwefel-Cluster
 Fe 4 S 4 l2(spph 3 )2: ein neutraler, gemischt substituierter Eisen-Schwefel-Cluster Fe 4 S 4 I 2 (SPPh 3 ) 2 : a Neutral, Mixed Terminal Ligand Iron-Sulfur Cluster Wolfgang Saak und Siegfried Pohl* Fachbereich
Fe 4 S 4 l2(spph 3 )2: ein neutraler, gemischt substituierter Eisen-Schwefel-Cluster Fe 4 S 4 I 2 (SPPh 3 ) 2 : a Neutral, Mixed Terminal Ligand Iron-Sulfur Cluster Wolfgang Saak und Siegfried Pohl* Fachbereich
Anhang C Jährliche Überprüfung der Vorgaben
 Anhang C Jährliche Überprüfung der Vorgaben Verfahren und Softwareanforderungen zur Auswahl der Vorgabenstammblätter, die zur jährlichen Überprüfung der Vorgaben anstehen. Für allgemeine (grundlegende)
Anhang C Jährliche Überprüfung der Vorgaben Verfahren und Softwareanforderungen zur Auswahl der Vorgabenstammblätter, die zur jährlichen Überprüfung der Vorgaben anstehen. Für allgemeine (grundlegende)
Proteinbestimmung in biogenem Material durch Elementaranalyse von Stickstoff. Elementaranalyse Info 1
 Proteinbestimmung in biogenem Material durch Elementaranalyse von Stickstoff Elementaranalyse Info 1 Einleitung 1 qualitative und quantitative Analyse organischer Verbindungen. Es wird nach der Menge jener
Proteinbestimmung in biogenem Material durch Elementaranalyse von Stickstoff Elementaranalyse Info 1 Einleitung 1 qualitative und quantitative Analyse organischer Verbindungen. Es wird nach der Menge jener
7. Woche. Gesamtanalyse (Vollanalyse) einfacher Salze. Qualitative Analyse anorganischer Verbindungen
 7. Woche Gesamtanalyse (Vollanalyse) einfacher Salze Qualitative Analyse anorganischer Verbindungen Die qualitative Analyse ist ein Teil der analytischen Chemie, der sich mit der qualitativen Zusammensetzung
7. Woche Gesamtanalyse (Vollanalyse) einfacher Salze Qualitative Analyse anorganischer Verbindungen Die qualitative Analyse ist ein Teil der analytischen Chemie, der sich mit der qualitativen Zusammensetzung
3.4.6 Cycloaddition von Anthracen und 1,4-Benzochinon unter Aluminiumchlorid- Katalyse zum 1:1-Addukt 6a und zum 2:1-Addukt 6b
 3.4.6 Cycloaddition von Anthracen und 1,4-Benzochinon unter Aluminiumchlorid- Katalyse zum 1:1-Addukt 6a und zum 2:1-Addukt 6b 1 : 1 6a + AlCl 3 C 2 Cl 2 2 : 1 6b C 14 10 (178.2) C 6 4 2 (108.1) AlCl 3
3.4.6 Cycloaddition von Anthracen und 1,4-Benzochinon unter Aluminiumchlorid- Katalyse zum 1:1-Addukt 6a und zum 2:1-Addukt 6b 1 : 1 6a + AlCl 3 C 2 Cl 2 2 : 1 6b C 14 10 (178.2) C 6 4 2 (108.1) AlCl 3
E3 Aktivitätskoeffizient
 Physikalisch-Chemische Praktika E3 Aktivitätskoeffizient Stichworte zur Vorbereitung: Den Kontext der folgenden Stichworte sollten Sie zur Vorbesprechung und während der Durchführung des Praktikumstermins
Physikalisch-Chemische Praktika E3 Aktivitätskoeffizient Stichworte zur Vorbereitung: Den Kontext der folgenden Stichworte sollten Sie zur Vorbesprechung und während der Durchführung des Praktikumstermins
Ohmscher Spannungsteiler
 Fakultät Technik Bereich Informationstechnik Ohmscher Spannungsteiler Beispielbericht Blockveranstaltung im SS2006 Technische Dokumentation von M. Mustermann Fakultät Technik Bereich Informationstechnik
Fakultät Technik Bereich Informationstechnik Ohmscher Spannungsteiler Beispielbericht Blockveranstaltung im SS2006 Technische Dokumentation von M. Mustermann Fakultät Technik Bereich Informationstechnik
Gliederung der Vorlesung im SS
 Gliederung der Vorlesung im SS A. Struktureller Aufbau von Werkstoffen. Atomare Struktur.. Atomaufbau und Periodensystem der Elemente.2. Interatomare Bindungen.3. Aggregatzustände 2. Struktur des Festkörpers
Gliederung der Vorlesung im SS A. Struktureller Aufbau von Werkstoffen. Atomare Struktur.. Atomaufbau und Periodensystem der Elemente.2. Interatomare Bindungen.3. Aggregatzustände 2. Struktur des Festkörpers
F-Praktikum Physik: Widerstand bei tiefen Temperaturen
 F-Praktikum Physik: Widerstand bei tiefen Temperaturen David Riemenschneider & Felix Spanier 11. Januar 2001 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Theorie 3 2.1 Grüneisen-Theorie...............................
F-Praktikum Physik: Widerstand bei tiefen Temperaturen David Riemenschneider & Felix Spanier 11. Januar 2001 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Theorie 3 2.1 Grüneisen-Theorie...............................
Mathematik II Frühjahrssemester 2013
 Mathematik II Frühjahrssemester 2013 Prof. Dr. Erich Walter Farkas Kapitel 8. Funktionen von mehreren Variablen 8.2 Partielle Differentiation Prof. Dr. Erich Walter Farkas Mathematik I+II, 8.2 Part. Diff.
Mathematik II Frühjahrssemester 2013 Prof. Dr. Erich Walter Farkas Kapitel 8. Funktionen von mehreren Variablen 8.2 Partielle Differentiation Prof. Dr. Erich Walter Farkas Mathematik I+II, 8.2 Part. Diff.
Mathematik II Frühlingsemester 2015 Kap. 9: Funktionen von mehreren Variablen 9.2 Partielle Differentiation
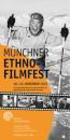 Mathematik II Frühlingsemester 2015 Kap. 9: Funktionen von mehreren Variablen 9.2 Partielle Differentiation www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/fs2015/other/mathematik2 biol Prof. Dr. Erich Walter
Mathematik II Frühlingsemester 2015 Kap. 9: Funktionen von mehreren Variablen 9.2 Partielle Differentiation www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/fs2015/other/mathematik2 biol Prof. Dr. Erich Walter
