Energetische und kinetische Untersuchung chemischer Reaktionen
|
|
|
- Jasper Biermann
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Energetishe und kinetishe Untersuhung hemisher Reaktionen Thermodynamik Wann läuft eine hemishe Reaktion freiwillig ab? Wie viel Energie wird dabei abgegeben oder aufgenommen? Reaktionskinetik Wie shnell laufen Reaktionen ab? Welhe Faktoren beeinflussen die Reaktionsgeshwindigkeit? Thermodynamik und Kinetik 1
2 System System Art der Wände Einstoffsysteme Mehrstoffsysteme Zahl der Phasen homogen heterogen Abgeshlossen Geshlossen offen Der Zustand eines Systems wird durh Zustandsgrößen beshrieben (Druk, Temperatur, Volumen, Konzentration)
3 Innere Energie Ein System hat eine bestimmte Energie, die man als innere Energie U bezeihnet. U = Summe aller möglihen Energieformen (Anziehungs- und Abstoßungskräfte zwishen den Atomen, Molekülen oder Ionen und deren kinetishe Energie et.) U ist eine Zustandsfunktion Thermodynamik und Kinetik 3
4 1. Hauptsatz Die innere Energie ändert sih: - wenn vom System Wärme Q aufgenommen oder abgegeben wird - wenn vom System oder am System Arbeit W geleistet wird. U U U R 2 1 QW R U > 0 Energie wird aufgenommen R U < 0 Energie wird abgegeben (1) Thermodynamik und Kinetik 4
5 1. Hauptsatz Die von einem geshlossenen System mit der Umgebung ausgetaushte Summe von Arbeit und Wärme ist gleih der Änderung der inneren Energie. Für ein abgeshlossenes System gilt: Δ R U = 0 und U = onst. Energie kann niht vernihtet werden oder neu entstehen Thermodynamik und Kinetik 5
6 Volumenarbeit Chemishe Reaktion in einem mit einem beweglihen Kolben versehenen Gefäß es entsteht ein Gas, der Kolben wird nah oben gedrükt. Das System leistet also mehanishe Arbeit. Diese Arbeit ist die Volumenarbeit, die bei isobaren Reaktionen eine Rolle spielt. W pv Thermodynamik und Kinetik 6
7 Reaktionsenthalpie Wenn das Volumen konstant ist (isohore Reaktion), fällt die Änderung der inneren Energie (Reaktionsenergie) als Wärmeenergie an. U Q v Die meisten hemishen Reaktionen verlaufen aber bei konstantem Druk. Nur noh ein Teil kann als Wärme abgegeben werden! (Volumenarbeit notwendig, um Druk konstant zu halten) U Qp pv Reaktionsenergie: Δ R U = verbleibende Wärmeenergie +Volumenarbeit Thermodynamik und Kinetik 7
8 Reaktionsenthalpie verbleibende Wärmeenergie = Reaktionsenthalpie R H R U pv Die Reaktionswärme einer hemishen Reaktion, die bei konstantem Druk abläuft, bezeihnet man als Reaktionsenthalpie. Q p 3H 2 N2 2NH3 RH -92,3kJ/mol exotherm: Wärmeenergie wird frei, R H hat negatives Vorzeihen N2 O2 2NO RH 180,6kJ/mol endotherm: Zufuhr von Wärme, R H hat positives Vorzeihen Thermodynamik und Kinetik 8
9 Reaktionsenthalpie Reaktionsenthalpien können experimentell bestimmt werden. Sie sind von der Temperatur abhängig. Liegen für die Ausgangs- und Endstoffe Werte für die Bildungsenthalpie (=Reaktionsenthalpien für die Bildung der Verbindung aus den Elementverbindungen) vor, ist eine Berehnung möglih. Reaktionsenthalpie = Bildungsenthalpie der Produkte Bildungsenthalpie der Reaktanden Thermodynamik und Kinetik 9
10 Satz von HESS German H. Hess ( ): Die Reaktionsenthalpie einer Reaktion ist unabhängig davon, ob sie in einem Shritt abläuft oder niht. Weg 1: C O 2 CO 2 R H= - 393,8 kj/mol Weg 2: 1 C O2 2 CO 1. Shritt: R H = -110,6 kj/mol 1 2. Shritt: CO O2 CO2 R H = -283,2 kj/mol Thermodynamik und Kinetik 10
11 Entropie Wärme geht IMMER vom wärmeren zum kälteren Körper über. Zwei Gase vermishen sih IMMER freiwillig und entmishen sih nie. Es handelt sih um irreversible Prozesse! In einem energetish und stofflih angeshlossenem System laufen nur Vorgänge ab, die den Ordnungszustand verringern Thermodynamik und Kinetik 11
12 Entropie Entropie = Maß für die Unordnung eines Systems. Je mehr Zufall in einem System stekt, desto höher ist die Entropie. Die Entropie ist ein Maß für die Verteilung von Energie und Materie. Je höher die Entropie, desto gleihmäßiger und zufälliger ist etwas verteilt. In der Mathematik, Statistik und Informationstheorie ist die Entropie eine Maß für die Menge an Zufällen oder wahrsheinlihen Zuständen. (Beim Mishen eines geordneten Kartenspiels gibt es viele untershiedlihe neue Folgen, das man wieder das geordnete Spiel erhält, ist unwahrsheinlih) Thermodynamik und Kinetik 12
13 Entropie Beim Verteilen von vier Münzen in zwei Kästen Thermodynamik und Kinetik 13
14 Entropie In der Natur sind entropiereihe, ungeordnete Zustände wahrsheinliher als entropiearme, geordnete. Ein geordnetes System geht irgendwann wieder in einen ungeordneten Zustand über, während ein ungeordnetes System nie spontan in ein geordnetes übergeht. Geordnete Zustände gehen sehr leiht in ungeordnete über, der umgekehrte Weg erfordert die Zufuhr von Energie. S Umgebung S System 0 Wenn eine Reaktion durh eine Entropieabnahme gekennzeihnet ist, muss in der Umgebung eine Entropiezunahme erfolgen. Das gilt für alle tatsählih ablaufenden Reaktionen (=irreversible Prozesse). Reversible Prozesse verlaufen unendlih langsam Thermodynamik und Kinetik 14
15 Entropie und Biologie Lebewesen stellen hohgeordnete Gebilde dar, die eigentlih im Laufe der Zeit zerfallen müssten. Sie existieren, weil sie ständig Energie (Nahrung, Sonnenliht) aufnehmen, um den Zustand der geringen Entropie aufreht zu erhalten. Außerdem geben Lebewesen übershüssige Entropie an die Umwelt ab: Tiere nehmen entropiearme Nährstoffe wie Gluose auf und stellen daraus entropiereihe Produkte wie Kohlendioxid und Wasserdampf her. Energiereihe Nährstoffe wie z.b. Fett oder Gluose werden vom Lebewesen aufgenommen und dann in energiearme Verbindungen wie Wasser und Kohlendioxid abgebaut. Bei diesen exothermen Reaktionen wird sehr viel Energie freigesetzt. Die so gewonnene Energie kann zur Aufrehterhaltung des entropiearmen Zustandes eingesetzt werden. Lebewesen sind entropiearme Systeme hoher Ordnung. Dieser unwahrsheinlihe Zustand kann nur durh permanente Zufuhr von Energie sowie durh Abgabe von Entropie aufreht erhalten werden Thermodynamik und Kinetik 15
16 Entropie Thermodynamik und Kinetik 16
17 Entropie und 2. Hauptsatz In einem abgeshlossenen System können nur Vorgänge ablaufen, bei denen die Entropie wähst. Ein solhes System strebt einem Zustand maximaler Entropie bzw. Unordnung an. Es gibt keine periodish arbeitende Mashine, die keine andere Veränderung in der Welt hervorruft, als Wärme von einem kalten zu einem warmen Körper zu überführen (Clausius). Für die Entropie können Absolutwerte angegeben werden Thermodynamik und Kinetik 17
18 Freie Reaktionsenthalpie Gibbs-Helmholtz-Gleihung (Oliver W. Gibbs , Hermann L. von Helmholtz ): Verknüpfung von Enthalpie und Entropie R G = R H - T R S G = freie Reaktionsenthalpie, beshreibt die Fähigkeit eines Systems, bei Reaktionen Arbeit zu vollbringen, ist ein Maß für die Triebkraft einer Reaktion Thermodynamik und Kinetik 18
19 Freie Reaktionsenthalpie Für geshlossene Systeme gilt: 1. R G<0, Reaktion läuft freiwillig ab = exergon 2. R G>0, Reaktion läuft niht freiwillig ab = endergon 3. R G=0, es liegt ein hemishes Gleihgewiht vor R G bezieht sih auf beliebige Konzentration bei beliebiger T und beliebigen Druk! R G 0 bezieht sih auf Reaktionen unter Standardbedingungen (298 K, 1013 hpa, molarer Umsatz) Thermodynamik und Kinetik 19
20 Gekoppelte Reaktionen Reaktionsfolgen: Aus A entsteht B, das reagiert gleih weiter zu C. Solhe Reaktionen sind miteinander gekoppelt. Teilreaktion 1: A B R G 0 1 Teilreaktion 2: B C R G 0 2 Gesamtreaktion: A C R G 0 = R G RG Thermodynamik und Kinetik 20
21 NH 2 Universelle Energiewährung N N O O O N N H 2 O + HO P O P O P OH OH OH O O ATP OH OH NH 2 N N O O O N N HO P OH + HO P O P OH OH OH O O ADP OH OH Thermodynamik und Kinetik 21
22 Energiediagramm Thermodynamik und Kinetik 22
23 Das hemishe Gleihgewiht Reaktanden werden niht vollständig umgesetzt, obwohl das Stoffmengenverhältnis genau der Reaktionsgleihung entspriht. Klassishes Beispiel: Reaktion von Wasserstoff und Iod zu Iodwasserstoff bei 490 C H 2 + I 2 2 HI 1897 von Max Bodenstein ( ) untersuht Konzentrationsänderung sind anhand der Farbe der Stoffe gut erkennbar Thermodynamik und Kinetik 23
24 Das hemishe Gleihgewiht 1 mol Wasserstoff und 1 mol Iod bilden ein System, das neben den Produkten auh noh einen Teil der Reaktanden enthält: 1 mol H 2 und 1 mol I 2 bilden bei 490 C 1,544 mol HI. 0,228 mol H 2 und 0,228 mol I 2 haben niht miteinander reagiert Thermodynamik und Kinetik 24
25 Das hemishe Gleihgewiht Rükreaktion ist möglih: 2HI H 2 + I 2 2 mol HI zerfallen niht vollständig, bei 490 C erhält man: 1,544 mol HI, 0,228 mol H 2 und 0,228 mol I 2. Keine weitere Änderung der Zusammensetzung des Reaktionsgemishes! Hin- und Rükreaktion laufen gleih shnell ab. Chemishes Gleihgewiht Thermodynamik und Kinetik 25
26 Das Massenwirkungsgesetz H I 2HI 2 2 K H 2 2 HI I 2 Alle Konzentrationsangaben beziehen sih auf das Gleihgewiht! Thermodynamik und Kinetik 26
27 Das Massenwirkungsgesetz aa bb C dd K C a A d D b B theoretish abgeleitet von C. M. Guldberg ( ) und P. Waage ( )
28 Das Massenwirkungsgesetz Was sagt die Gleihgewihtskonstante? K wesentlih größer als 1: Reaktion läuft nahezu vollständig in Rihtung der Endprodukte ab K annähernd 1: im Gleihgewihtszustand liegen alle Reaktionsteilnehmer in ähnlihen Konzentrationen vor K sehr viel kleiner als 1: Reaktion läuft praktish niht ab Thermodynamik und Kinetik 28
29 Homogene und heterogene Gleihgewihte Homogene Gleihgewihte: Alle an der Reaktion beteiligten Stoffe liegen in derselben Phase vor. Heterogene Gleihgewihte: Am Gleihgewiht sind mehrere Phasen beteiligt. Die Gegenwart fester Stoff ist zwar für den Ablauf der Reaktion notwendig, ihre Menge hat keinen Einfluss. Deshalb treten für feste Phasen im MWG keine Konzentrationsglieder auf! Thermodynamik und Kinetik 29
30 Shwerlöslihe Salze Ein heterogenes Gleihgewiht Eine gesättigte Lösung steht mit einem festen Bodenkörper in Kontakt. Es stellt sih ein dynamishes heterogenes Gleihgewiht ein. Beim Lösevorgang treten die Ionen aus dem Kristall und werden hydratisiert. Wegen der elektrishen Neutralität müssen gleih viel Kationen und Anionen in Lösung gehen. Im Gleihgewihtszustand werden pro Zeiteinheit ebenso viel Ionenpaare aus der Lösung im Kristall eingebaut, wie aus dem Gitter in Lösung gehen. Bodenkörpe r Ionen in Lösung Thermodynamik und Kinetik 30
31 Löslihkeitsprodukt AB B A L AB B A L B A B A L B A AB B A A B B A AB B A AB L AB B A L K K Feste Phasen werden im MWG niht berüksihtigt! Thermodynamik und Kinetik 31
32 Lösungen eines shwerlöslihen Salzes Beispiel: Silberhlorid AgCl L AgCl mol / l Gesättigte Lösung Übersättigte Lösung Ungesättigte Lösung 10 5 mol / l Ag Cl Ag Cl mol / l Ag Cl mol / l Thermodynamik und Kinetik 32
33 NERNST-Verteilungssatz Wie verteilen sih Stoffe in der Umwelt oder Arzneimittel im Körper? Voraussetzung: zwei Lösungsmittel A und B, die sih niht vollständig ineinander lösen (Hexan/Wasser) ein Stoff C, der sih in beiden Lösungsmitteln löslih ist C verteilt sih in Abhängigkeit von der jeweiligen Löslihkeit in A und B. Ist C hydrophil reihert er sih im Wasser an, ist C hydrophob reihert er sih in Hexan an. Bei geg. Temperatur ist das Verhältnis der Konzentration von C in A und B konstant. K C C in der Oberphase in der Unterphase Thermodynamik und Kinetik 33
34 Henry-Dalton-Gesetz Verteilung eines Gases zwishen einer Gas- und einer Flüssigphase K A in der Flüssigkeit p in der Gasphase A K p A ist temperaturabhängig und bei geg. Gas für ein Lösungsmittel spezifish. Partialdruk (derjenige Druk des Gases, den es ausüben würde, wenn es im Gesamtraum des Gasgemishes allein vorhanden wäre) spielt in der Physiologie bei der Beshreibung des Gasaustaushes eine große Rolle Drukerhöhung führt zu einer höheren Konzentration des Gases Drukminderung führt zu Entweihen von Gas (Gefahr von Bläshenbildung bei Tauhern, deshalb Ersatz von dem gut löslihen N 2 durh He) Thermodynamik und Kinetik 34
35 Gleihgewihte in Gegenwart von Membranen Diffusion (passive) Diffusion = Konzentrationsausgleih infolge der Eigenbewegung der Teilhen (entlang des Konzentrationsgradienten) erfolgt auh durh Trennwände hindurh Wanderung immer in Rihtung der geringeren Konzentration, im Gleihgewihtszustand ist die Teilhenkonzentration auf beiden Seiten der Membran gleih (aber die Teilhen wandern hin und her!) in den Zellen häufig Transport von Stoffen gegen den Konzentrationsgradienten = aktiver Transport Thermodynamik und Kinetik 35
36 Diffusion an Membranen Kalium-Natrium-Pumpe Die Konzentration der Kalium-Ionen ist in der Zelle größer als im extrazellulären Raum. Lebende Zelle: Konzentrationsgradienten werden unter Aufwendung von Energie aufreht erhalten. Aktiver Transport: Einshleusen von Stoffen gegen einen Konzentrationsgradienten Thermodynamik und Kinetik 36
37 Gleihgewihte in Gegenwart von Membranen Dialyse Einshränkungen bei der Membran: Porengröße etwa 10 nm semipermeabel durhlässig für Wasser, kleine Moleküle und Ionen Nutzung für die Trennung niedermolekularer von hohmolekularen Bestandteilen; die Lösung kommt in einen Beutel, die aus einer halbdurhlässigen Membran besteht, und wird in reines Lösungsmittel gehängt (weltweit erste Blutwäshe über semipermeable Membranen beim Menshen in Gießen; ab 1945 setzte Willem Kolff in Kampen (Niederlande) Zellophan-Shläuhen als Dialysemembran ein). Niere hält Volumen und Zusammensetzung der extrazellulären Flüssigkeit konstant Quelle: Apothekenumshau Thermodynamik und Kinetik 37
38 Osmose Die Poren der semipermeablen Membran sind nur noh für die Wassermoleküle durhlässig. Der osmotishe Druk ist nur von der Teilhenanzahl des gelösten Stoffes in der konzentrierten Lösung abhängig. Im Gleihgewiht ist der hydrostatishe Druk ebenso groß wie der osmotishe Thermodynamik und Kinetik 38
39 Osmose Berehnung für den Idealzustand = Konzentration der gelösten Teilhen p V = n R x x x T V = Lösungsmittelvolumen p = n V R T x x x = R x T n = Stoffmenge (Mol) der gelösten Teilhen R = 8,31451 J/mol K Die Lösung von 1 mol Gluose in 22,4 l hat bei 0 C einen theoretishen osmotishen Druk von 101 kpa (760 Torr). Die Lösung von 1 mol NaCl in 22,4 l hat bei 0 C einen theoretishen osmotishen Druk von 202 kpa Thermodynamik und Kinetik 39
40 Osmose Berehnung für den Realzustand isotonishe Kohsalzlösung Isotonishe Kohsalzlösung enthalt 9 g NaCl in 1000g Lösung. Unter Berüksihtigung der Dihte entspriht das einem Volumen von 0,992 l, in 1 l sind somit 9,1 g NaCl, also 0,155 mol NaCl oder 0,31 mol Na + - und Cl - -Ionen enthalten. l bar p Ionen gesamt R T 0,31mol / l 0, K 8bar mol K Es wird wegen interionishen WW ein Korrekturfaktor notwendig: i=[1+f a (ν-1)]=[1+0,86(2-1)]=1,86. mit f a =0,86 für NaCl und v=2 wegen Zerfalls in zwei Ionen. l bar p undiss. NaCl i R T 0,15523mol / l [1 0,86(2 1)] 0, K 7, 44bar mol K Thermodynamik und Kinetik 40
41 Osmose Isotonish hypotonish hypertonish Lösungen mit gleihem osmotishen Druk sind isotonish. Dest. Wasser ist hypotonish zur Zelllösung der Erythroyten - Folge: Anshwellen und Platzen (Osmotisher Shok). Eine hypertonishe Lösung hat einen höheren osmotishen Druk (Anwendung beim Konservieren, Shrumpfung durh Zukerzugabe) Thermodynamik und Kinetik 41
42 Salzwasser-Osmose-Kraftwerke Flusswasser soll in Beken fließen, dort hat es Kontakt über eine semipermeable Membran mit Meerwasser Flusswasser tritt in den Bekenbereih des Meerwassers, das Volumen steigt an, abfließendes Wasser könnte eine Turbine antreiben Hauptproblem: Effektivität der Membran, vor Projektbeginn 1997 nur 0,1 Watt pro m 2 Membranflähe Thermodynamik und Kinetik 42
43 Kolligative Eigenshaften abhängig nur von der Anzahl und niht von der Art der gelösten Teilhen! Osmotisher Druk, Dampfdrukerniedrigung, Siedepunktserhöhung, Gefrierpunktserniedrigung Beispiel: Zugabe von einem Mol Teilhen zu 1 l Wasser erniedrigt den Gefrierpunkt von Wasser um 1,86 C, zu Campher um 39,7 C. Zustandsdiagramm von Wasser und einer wässrigen Lösung Thermodynamik und Kinetik 43
44 Donnan-Gleihgewiht Diffusion und Elektroneutralität Beginn Gleihgewiht 10 K + 10 Cl - 5 Prot - 5 Prot - 5 K + 6 K + 9 K + 6 Cl - 4 Cl - außen innen außen innen Es erfolgt eine Ionenwanderung, bis gilt: K I Cl I K II Cl II Thermodynamik und Kinetik 44
45 Donnan-Gleihgewiht Und die Osmose? Beginn 10 K + 10 Cl - Gleihgewiht 5 Prot - 5 Prot - 5 K + 6 K + 9 K + 6 Cl - 4 Cl - außen innen außen innen Durh das osmotishe Ungleihgewiht müssen K-Ionen den Innenraum verlassen, dadurh entsteht außen eine positive, innen eine negative Ladung Membran (Donnan-)potenzial Thermodynamik und Kinetik 45
46 Ist Wasser gefährlih? Dehydrierung Dehydratisierung? Vor Wassermangel shützen: der Durst das antidiuretishe Hormon! Wenn man auf einmal zwei Liter Wasser trinkt, sinkt die Na-Konzentration im extrazellulären Raum von 144 auf 138 mmol/l Thermodynamik und Kinetik 46
47 Wasserverteilung und Wasserbilanz Alle Abbildungen und Infos zu Wasser: Klaus Roth, Chemie in unserer Zeit 2014, 48, Thermodynamik und Kinetik 47
48 Thermodynamik und Kinetik 48
49 Prinzip des kleinsten Zwangs Henry Le Châtelier ( ) + Karl F. Braun ( ) Beeinflussung der Gleihgewihtslage (besser der Ausbeute): 1. Änderungen der Konzentrationen bzw. der Partialdrüke der Reaktionsteilnehmer 2. Temperaturänderungen 3. Drukänderungen bei Reaktionen, in denen sih die Stoffmenge der gasförmigen Reaktionspartner ändert Thermodynamik und Kinetik 49
50 Prinzip des kleinsten Zwangs Ziel: Erhöhung der Ausbeute eines Reaktionsproduktes Konzentrationserhöhung eines Ausgangsstoffes führt zur Erhöhung der Konzentration des Endproduktes. Entfernung eines Reaktionsproduktes führt zur Erhöhung der Konzentration des anderen Reaktionsproduktes Thermodynamik und Kinetik 50
51 Prinzip des kleinsten Zwangs Die Gleihgewihtskonstante hängt von der Temperatur ab! Temperaturerhöhung führt bei exothermen hemishen Reaktionen zu einer Vershiebung des Gleihgewihts in Rihtung der Ausgangsstoffe, bei endothermen Reaktionen in Rihtung der Endprodukte. Beispiel: Knallgasreaktion bei 300 K beträgt die Gleihgewihtskonstante K 1 =10 40 bar bei 1000 K beträgt die Gleihgewihtskonstante K 2 = bar ln K K 2 1 H R 0 1 ( T 2 1 ) T Thermodynamik und Kinetik 51
52 Prinzip des kleinsten Zwangs Untersuhung des Boudouard-Gleihgewihts (Otave Leopold Boudouard ) Bei Reaktionen mit Stoffmengenänderungen gasförmiger Komponenten vershiebt sih durh Drukerhöhung das Gleihgewiht (die Ausbeute) in Rihtung der Seite mit der kleineren Stoffmenge. C CO 2 2 CO H 172,5kJ mol -1 t in C p in bar p CO bar in p CO2 in bar p CO2 /p C O Kp in bar ,58 0,42 0,72 0, ,47 7,53 3,05 0, Tab. zur Drukabhängigkeit Grafik zum Temp. einfluss Thermodynamik und Kinetik 52
53 Kesselstein und Tropfsteinhöhlen In Wasser shwerlöslihes CaCO 3 kann in CO 2 -haltigem Wasser in löslihes Caliumhydrogenarbonat reagieren. Beim Erhitzen vershiebt sih das Gleihgewiht nah links, es fällt Kesselstein aus. Kommt das Wasser in Höhlen, verändern sih die Drukbedingungen, CO 2 entweiht, Tropfsteine bilden sih. H O CO Ca CaCO 2HCO Thermodynamik und Kinetik 53
54 Attahöhle Attendorn (NRW) Stalagmiten, Stalaktiten, Stalagnaten
55 Steinerne Rinnen
56 Thermodynamik und Gleihgewiht Δ R G und Δ R G 0 Für das Gleihgewiht gilt: Δ R G = 0, keine Triebkraft Δ R G darf niht mit Δ R G 0 verwehselt werden! Δ R G 0 beshreibt die Energiedifferenz, die frei wird oder die aufzubringen ist, wenn die Ausgangsstoffe vollständig in die Produkte übergehen (Umsatz 100%). Δ R G beshreibt die tatsählihen Verhältnisse. R G R G 0 RT ln C a A d D b B R R G G 0 0 RT ln K Thermodynamik und Kinetik 56
57 Freie Reaktionsenthalpie unter Standardbedingungen Zusammenhang von Δ R G 0 und K (bei 25 C) K Δ R G 0 (kj/mol) , , , , Thermodynamik und Kinetik 57
58 Energiediagramm und Gleihgewiht Thermodynamik und Kinetik 58
59 Gekoppelte Reaktionen Teilreaktion 1: A B K 1 B A Teilreaktion 2: Gesamtreaktion: B C A C K 2 K ges C B C A K 2 B K1 K2 B K Thermodynamik und Kinetik 59
60 Fließgleihgewiht Zufluss- und Abflussgeshwindigkeit beim mittleren Beken sind gleih. Fließgleihgewihte können nur durh Energiezufuhr aufreht erhalten bleiben. Die Konzentration von B ist konstant, die Reaktionen von A nah B und von B nah C laufen gleih shnell ab, ΔG< Thermodynamik und Kinetik 60
61 Gluosegleihgewiht Gluosekonzentration soll konstant bleiben Nahrung Gluose CO 2 Speiherfette andere Abbauprodukte Thermodynamik und Kinetik 61
62 Kinetishe Betrahtungen Wie verändert sih der Energie während der Reaktion? Thermodynamik und Kinetik 62
63 Reaktionsgeshwindigkeit Änderung der Konzentration mit der Zeit Durhshnittsgeshwindigkeit ablesbar aus dem Sekantenanstieg v ( B) t ( A) t Momentangeshwindigkeit ablesbar aus dem Tangentenanstieg v d( B) dt d( A) dt Thermodynamik und Kinetik 63
64 Geshwindigkeitsgleihung Reaktionsgeshwindigkeit ist eine Funktion vershiedener Variablen: Konzentration der Reaktionsteilnehmer, Konzentration vom LM, Temperatur u.a. v f ( 2 1,,... m, T) Diese Funktion ist das Zeitgesetz oder die Geshwindigkeitsgleihung. Häufig gibt es die einfahe Form: v a k( T) A b B Thermodynamik und Kinetik 64
65 Geshwindigkeitsgleihung Geshwindigkeitskonstante und Reaktionsordnung v k m n ( A) ( B) k Geshwindigkeitskonstante (für Reaktion spezifish, abhängig von Aktivierungsenergie, Temperatur und räumlihen Faktoren) Reaktionsordnung: Summe der Exponenten der Konzentrationen Thermodynamik und Kinetik 65
66 Reaktionen n-ter Ordnung Beispiele Reaktion 0. Ordnung: v k Reaktionen an Phasengrenzen Reaktion 1. Ordnung: Reaktion 2. Ordnung: v v k (A) k 2 ( A) Umlagerungen, Hydrolysen, radioaktiver Zerfall v k ( A) ( B) Reaktionsordnungen können nur experimentell ermittelt werden! Thermodynamik und Kinetik 66
67 Reaktionen pseudo-1. Ordnung Bimolekular = 2. Ordnung? In der Literatur wird niht deutlih zwishen der mikroskopishen Molekularität und der makroskopishen Reaktionsordnung untershieden. Die meisten bimolekularen Reaktionen verlaufen nah einem Zeitgesetz 2. Ordnung. Vermutung: die Hydrolyse von Saharose hat eine Kinetik 2. Ordnung Thermodynamik und Kinetik 67
68 Reaktionen pseudo-1. Ordnung Bimolekular = 2. Ordnung? Vermutung: Reaktion 2. Ordnung Experimenteller Befund: Reaktion 1. Ordnung Ursahe: großer Übershuss des Lösungsmittel, Konzentration ändert sih faktish niht Da es sih um eine bimolekulare Reaktion handelt, spriht man von Reaktionen pseudoerster Ordnung (oder sheinbar erster Ordnung) Thermodynamik und Kinetik 68
69 Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeshwindigkeit Die Anzahl der Teilhen mit hoher Energie nimmt mit steigender Temperatur zu Thermodynamik und Kinetik 69
70 Aktivierungsenergie Beim Zusammenstoß von Teilhen kommt es erst dann zur Reaktion, wenn sie eine bestimmte Mindestenergie haben. Beziehung zwishen der Geshwindigkeitskonstanten und der Aktivierungsenergie (Arrhenius): k A e E A RT Thermodynamik und Kinetik 70
71 Aktivierungsenergie Thermodynamik und Kinetik 71
72 Katalyse Katalysatoren - Enzyme Viele Reaktionen, vor allem Reaktionen in Lebewesen, würden bei Körpertemperatur unendlih langsam ablaufen. Um sie zu beshleunigen, verwendet man Katalysatoren. Lebewesen produzieren ihre eigenen Katalysatoren: die Enzyme Thermodynamik und Kinetik 72
73 Energieprofil Reaktanden Thermodynamik und Kinetik 73
74 Enzyme Die Reaktionen in lebenden Organismen laufen bei verhältnismäßig kleinen Temperaturen, in der Regel unter 40 C ab. hohaktive Katalysatoren = Enzyme Enzyme = Proteine + Metallionen als Komplexe oder organishe Cofaktoren eingelagert sind. Enzyme sind sehr selektiv, d.h. sie besitzen (in der Regel) eine hohe Substratspezifität Thermodynamik und Kinetik 74
75 Enzyme Amylase Die Amylase kommt im Mundspeihel vor. Sie gehört zu den Verdauungsenzymen und spaltet die Gluose- Ketten der Stärke in das Disaharid Maltose Thermodynamik und Kinetik 75
76 Enzyme Suinat-Dehydrogenase ist ein Enzymkomplex aus vier Untereinheiten ist das einzige membranständige Protein des Citratylus und ist als Komplex II der Atmungskette in die Elektronentransportkette der inneren Mitohondrien-Membran eingebunden katalysiert die Oxidation von Suinat (Bernsteinsäure) zu Fumarat (Fumarsäure) mit FAD als OxM und gleihzeitigen Transport von zwei Elektronen über die Membrangrenze sowie mithilfe dieser Elektronen die Reduktion von Ubihinon zu Ubihinol Mutationen in einen der vier odierenden Gene können zu erblihen Stoffwehselkrankheiten führen Thermodynamik und Kinetik 76
77 Gleihgewiht und Geshwindigkeit Im Gleihgewiht verlaufen Hin- und Rükreaktion gleih shnell! A v v v k k k hin rük hin hin hin rük B k v A C D hin k rük A rük B A D B k B rük D K D Thermodynamik und Kinetik 77
78 Hinweis auf formalen Fehler Häufig wird diese Ableitung auh benutzt, wenn sowohl Hin- und Rükreaktion komplex verlaufen. Die Beträge der Stöhiometriezahlen werden dann als Reaktionsordnungen behandelt. Das ist eigentlih kinetish falsh! Thermodynamik und Kinetik 78
Das Chemische Gleichgewicht Massenwirkungsgesetz
 Das Chemishe Gleihgewiht Massenwirkungsgesetz Reversible Reaktionen: Beisiel : (Bodenstein 899 Edukt (Reaktanden Produkt H + I HIH Beobahtung: Die Reaktion verläuft unvollständig! ndig! D.h. niht alle
Das Chemishe Gleihgewiht Massenwirkungsgesetz Reversible Reaktionen: Beisiel : (Bodenstein 899 Edukt (Reaktanden Produkt H + I HIH Beobahtung: Die Reaktion verläuft unvollständig! ndig! D.h. niht alle
Spezialfälle. BOYLE-MARIOTT`sches Gesetz p V = n R T bei T, n = konstant: p V = const. GAY-LUSSAC`sches Gesetz. bei V, n = konstant: p = const.
 Spezialfälle BOYLE-MARIOTT`sches Gesetz p V = n R T bei T, n = konstant: p V = const. GAY-LUSSAC`sches Gesetz p V = n R T bei V, n = konstant: p = const. T Druck Druck V = const. Volumen T 2 T 1 Temperatur
Spezialfälle BOYLE-MARIOTT`sches Gesetz p V = n R T bei T, n = konstant: p V = const. GAY-LUSSAC`sches Gesetz p V = n R T bei V, n = konstant: p = const. T Druck Druck V = const. Volumen T 2 T 1 Temperatur
Vorlesung Anorganische Chemie
 Vorlesung Anorganische Chemie Prof. Ingo Krossing WS 2007/08 B.Sc. Chemie Lernziele Block 5 Verhalten von Lösungen Konzentrationen Solvatation und Solvatationsenthalpie Kolligative Eigenschaften Kryoskopie/Ebullioskopie
Vorlesung Anorganische Chemie Prof. Ingo Krossing WS 2007/08 B.Sc. Chemie Lernziele Block 5 Verhalten von Lösungen Konzentrationen Solvatation und Solvatationsenthalpie Kolligative Eigenschaften Kryoskopie/Ebullioskopie
Allgemeine Chemie 3.6 KINETIK
 Allgemeine Chemie. CEMISCE REAKTINEN.6 KINETIK 1 Kinetik hemisher Reaktionen Die Kinetik befasst sih mit den Geshwindigkeiten und Mehanismen hemisher Reaktionen. Sie beshreibt zeitabhängige Konzentrationsänderungen
Allgemeine Chemie. CEMISCE REAKTINEN.6 KINETIK 1 Kinetik hemisher Reaktionen Die Kinetik befasst sih mit den Geshwindigkeiten und Mehanismen hemisher Reaktionen. Sie beshreibt zeitabhängige Konzentrationsänderungen
Die Innere Energie U
 Die Innere Energie U U ist die Summe aller einem System innewohnenden Energien. Es ist unmöglich, diese zu berechnen. U kann nicht absolut angegeben werden! Differenzen in U ( U) können gemessen werden.
Die Innere Energie U U ist die Summe aller einem System innewohnenden Energien. Es ist unmöglich, diese zu berechnen. U kann nicht absolut angegeben werden! Differenzen in U ( U) können gemessen werden.
Richtung chemischer Reaktionen, chemisches Gleichgewicht. Massenwirkungsgesetz
 Richtung chemischer Reaktionen, chemisches Gleichgewicht a A + b B K [C] [A] c a [D] [B] c C + d D d b K = Gleichgewichtskonstante Massenwirkungsgesetz [ ] = in Lösung: Konzentration (in mol L -1 ), für
Richtung chemischer Reaktionen, chemisches Gleichgewicht a A + b B K [C] [A] c a [D] [B] c C + d D d b K = Gleichgewichtskonstante Massenwirkungsgesetz [ ] = in Lösung: Konzentration (in mol L -1 ), für
Richtung chemischer Reaktionen, Chemisches Gleichgewicht. Massenwirkungsgesetz
 Richtung chemischer Reaktionen, Chemisches Gleichgewicht a A + b B K = [C] [A] c a [D] [B] c C + d D d b Massenwirkungsgesetz K = Gleichgewichtskonstante [ ] = in Lösung: Konzentration (in mol L -1 ),
Richtung chemischer Reaktionen, Chemisches Gleichgewicht a A + b B K = [C] [A] c a [D] [B] c C + d D d b Massenwirkungsgesetz K = Gleichgewichtskonstante [ ] = in Lösung: Konzentration (in mol L -1 ),
6. Tag: Chemisches Gleichgewicht und Reaktionskinetik
 6. Tag: Chemisches Gleichgewicht und Reaktionskinetik 1 6. Tag: Chemisches Gleichgewicht und Reaktionskinetik 1. Das chemische Gleichgewicht Eine chemische Reaktion läuft in beiden Richtungen ab. Wenn
6. Tag: Chemisches Gleichgewicht und Reaktionskinetik 1 6. Tag: Chemisches Gleichgewicht und Reaktionskinetik 1. Das chemische Gleichgewicht Eine chemische Reaktion läuft in beiden Richtungen ab. Wenn
2. Chemische Reaktionen und chemisches Gleichgewicht
 2. Chemische Reaktionen und chemisches Gleichgewicht 2.1 Enthalpie (ΔH) Bei chemischen Reaktionen reagieren die Edukte zu Produkten. Diese unterscheiden sich in der inneren Energie. Es gibt dabei zwei
2. Chemische Reaktionen und chemisches Gleichgewicht 2.1 Enthalpie (ΔH) Bei chemischen Reaktionen reagieren die Edukte zu Produkten. Diese unterscheiden sich in der inneren Energie. Es gibt dabei zwei
Thermodynamik. Thermodynamik ist die Lehre von den Energieänderungen im Verlauf von physikalischen und chemischen Vorgängen.
 Thermodynamik Was ist das? Thermodynamik ist die Lehre von den Energieänderungen im Verlauf von physikalischen und chemischen Vorgängen. Gesetze der Thermodynamik Erlauben die Voraussage, ob eine bestimmte
Thermodynamik Was ist das? Thermodynamik ist die Lehre von den Energieänderungen im Verlauf von physikalischen und chemischen Vorgängen. Gesetze der Thermodynamik Erlauben die Voraussage, ob eine bestimmte
Richtung von spontanem Prozeßablauf und Veränderung der G in Abhängigkeit vom Vorzeichen der Enthalpie und der Entropie
 Richtung von spontanem Prozeßablauf und Veränderung der G in Abhängigkeit vom Vorzeichen der Enthalpie und der Entropie H S G= H-T S Prozeß 1. (-) (+) (-) immer exergonisch, erfolgt spontan bei allen Temperaturen
Richtung von spontanem Prozeßablauf und Veränderung der G in Abhängigkeit vom Vorzeichen der Enthalpie und der Entropie H S G= H-T S Prozeß 1. (-) (+) (-) immer exergonisch, erfolgt spontan bei allen Temperaturen
Allgemeine Chemie für Studierende mit Nebenfach Chemie Andreas Rammo
 Allgemeine Chemie für Studierende mit Nebenfach Chemie Andreas Rammo Allgemeine und Anorganische Chemie Universität des Saarlandes E-Mail: a.rammo@mx.uni-saarland.de innere Energie U Energieumsatz bei
Allgemeine Chemie für Studierende mit Nebenfach Chemie Andreas Rammo Allgemeine und Anorganische Chemie Universität des Saarlandes E-Mail: a.rammo@mx.uni-saarland.de innere Energie U Energieumsatz bei
Allgemeine Chemie für r Studierende der Zahnmedizin
 Allgemeine Chemie für r Studierende der Zahnmedizin Allgemeine und Anorganische Chemie Teil 3 Dr. Ulrich Schatzschneider Institut für Anorganische und Angewandte Chemie, Universität Hamburg Lehrstuhl für
Allgemeine Chemie für r Studierende der Zahnmedizin Allgemeine und Anorganische Chemie Teil 3 Dr. Ulrich Schatzschneider Institut für Anorganische und Angewandte Chemie, Universität Hamburg Lehrstuhl für
Thermodynamik & Kinetik
 Thermodynamik & Kinetik Inhaltsverzeichnis Ihr versteht die Begriffe offenes System, geschlossenes System, isoliertes System, Enthalpie, exotherm und endotherm... 3 Ihr kennt die Funktionsweise eines Kalorimeters
Thermodynamik & Kinetik Inhaltsverzeichnis Ihr versteht die Begriffe offenes System, geschlossenes System, isoliertes System, Enthalpie, exotherm und endotherm... 3 Ihr kennt die Funktionsweise eines Kalorimeters
Hausarbeit. Das Fällungs- und Löslichkeitsgleichgewicht. über. von Marie Sander
 Hausarbeit über Das Fällungs- und Löslichkeitsgleichgewicht von Marie Sander Inhaltsverzeichnis 1. Einstieg in das Thema 2. Einflüsse auf das Löslichkeitsgleichgewicht - Das Prinzip von Le Chatelier 3.
Hausarbeit über Das Fällungs- und Löslichkeitsgleichgewicht von Marie Sander Inhaltsverzeichnis 1. Einstieg in das Thema 2. Einflüsse auf das Löslichkeitsgleichgewicht - Das Prinzip von Le Chatelier 3.
Chemie für Biologen. Vorlesung im. WS 2004/05 V2, Mi 10-12, S04 T01 A02. Paul Rademacher Institut für Organische Chemie der Universität Duisburg-Essen
 Chemie für Biologen Vorlesung im WS 200/05 V2, Mi 10-12, S0 T01 A02 Paul Rademacher Institut für Organische Chemie der Universität Duisburg-Essen (Teil : 03.11.200) MILESS: Chemie für Biologen 66 Chemische
Chemie für Biologen Vorlesung im WS 200/05 V2, Mi 10-12, S0 T01 A02 Paul Rademacher Institut für Organische Chemie der Universität Duisburg-Essen (Teil : 03.11.200) MILESS: Chemie für Biologen 66 Chemische
Thermo Dynamik. Mechanische Bewegung (= Arbeit) Wärme (aus Reaktion) maximale Umsetzung
 Thermo Dynamik Wärme (aus Reaktion) Mechanische Bewegung (= Arbeit) maximale Umsetzung Aussagen der Thermodynamik: Quantifizieren von: Enthalpie-Änderungen Entropie-Änderungen Arbeit, maximale (Gibbs Energie)
Thermo Dynamik Wärme (aus Reaktion) Mechanische Bewegung (= Arbeit) maximale Umsetzung Aussagen der Thermodynamik: Quantifizieren von: Enthalpie-Änderungen Entropie-Änderungen Arbeit, maximale (Gibbs Energie)
Grundlagen der Physiologie
 Grundlagen der Physiologie Bioenergetik www.icbm.de/pmbio Energieformen Von Lebewesen verwertete Energieformen o Energie ist etwas, das Arbeit ermöglicht. o Lebewesen nutzen nur zwei Formen: -- Licht --
Grundlagen der Physiologie Bioenergetik www.icbm.de/pmbio Energieformen Von Lebewesen verwertete Energieformen o Energie ist etwas, das Arbeit ermöglicht. o Lebewesen nutzen nur zwei Formen: -- Licht --
Allgemeine Chemie für r Studierende der Medizin
 Allgemeine Chemie für r Studierende der Medizin Allgemeine und Anorganische Chemie Teil 4+5 Dr. Ulrich Schatzschneider Institut für Anorganische und Angewandte Chemie, Universität Hamburg Lehrstuhl für
Allgemeine Chemie für r Studierende der Medizin Allgemeine und Anorganische Chemie Teil 4+5 Dr. Ulrich Schatzschneider Institut für Anorganische und Angewandte Chemie, Universität Hamburg Lehrstuhl für
endotherme Reaktionen
 Exotherme/endotherme endotherme Reaktionen Edukte - H Produkte Exotherme Reaktion Edukte Produkte + H Endotherme Reaktion 101 Das Massenwirkungsgesetz Das Massenwirkungsgesetz Gleichgewicht chemischer
Exotherme/endotherme endotherme Reaktionen Edukte - H Produkte Exotherme Reaktion Edukte Produkte + H Endotherme Reaktion 101 Das Massenwirkungsgesetz Das Massenwirkungsgesetz Gleichgewicht chemischer
Auswahlverfahren Medizin Prüfungsgebiet Chemie. 3.Termin Chemische Gleichung, Chemisches Rechnen, Kinetik, Thermodynamik, Chemisches Gleichgewicht
 Auswahlverfahren Medizin Prüfungsgebiet Chemie 3.Termin Chemische Gleichung, Chemisches Rechnen, Kinetik, Thermodynamik, Chemisches Gleichgewicht Kursleiter Mag. Wolfgang Mittergradnegger IFS Kurs 2009
Auswahlverfahren Medizin Prüfungsgebiet Chemie 3.Termin Chemische Gleichung, Chemisches Rechnen, Kinetik, Thermodynamik, Chemisches Gleichgewicht Kursleiter Mag. Wolfgang Mittergradnegger IFS Kurs 2009
Grundlagen der Chemie
 1 Das Massenwirkungsgesetz Verschiebung von Gleichgewichtslagen Metastabile Systeme/Katalysatoren Löslichkeitsprodukt Das Massenwirkungsgesetz Wenn Substanzen miteinander eine reversible chemische Reaktion
1 Das Massenwirkungsgesetz Verschiebung von Gleichgewichtslagen Metastabile Systeme/Katalysatoren Löslichkeitsprodukt Das Massenwirkungsgesetz Wenn Substanzen miteinander eine reversible chemische Reaktion
Modul BCh 1.2 Praktikum Anorganische und Analytische Chemie I
 Institut für Anorganische Chemie Prof. Dr. R. Streubel Modul BCh 1.2 Praktikum Anorganische und Analytische Chemie I Vorlesung für die Studiengänge Bachelor Chemie und Lebensmittelchemie Im WS 08/09 Die
Institut für Anorganische Chemie Prof. Dr. R. Streubel Modul BCh 1.2 Praktikum Anorganische und Analytische Chemie I Vorlesung für die Studiengänge Bachelor Chemie und Lebensmittelchemie Im WS 08/09 Die
Klausur Chemie für Verfahrenstechniker III
 Name: Matr.-Nr.: Klausur Chemie für Verfahrenstehniker III 6. 1. 26 Aufgabe 1 (2.5 Punkte) 1.1 Die Reaktion: C (s) + CO 2 (g) 2 CO (g) ist endotherm. Wie wird das Gleihgewiht beeinflusst, wenn a) CO 2
Name: Matr.-Nr.: Klausur Chemie für Verfahrenstehniker III 6. 1. 26 Aufgabe 1 (2.5 Punkte) 1.1 Die Reaktion: C (s) + CO 2 (g) 2 CO (g) ist endotherm. Wie wird das Gleihgewiht beeinflusst, wenn a) CO 2
Bevor man sich an diesen Hauptsatz heranwagt, muss man sich über einige Begriffe klar sein. Dazu gehört zunächst die Energie.
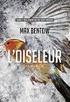 Thermodynamik 1 1.Hauptsatz der Thermodynamik Bevor man sich an diesen Hauptsatz heranwagt, muss man sich über einige Begriffe klar sein. Dazu gehört zunächst die Energie. Energie ist die Fähigkeit Arbeit
Thermodynamik 1 1.Hauptsatz der Thermodynamik Bevor man sich an diesen Hauptsatz heranwagt, muss man sich über einige Begriffe klar sein. Dazu gehört zunächst die Energie. Energie ist die Fähigkeit Arbeit
Allgemeine Chemie. Die chemische Reaktion
 Allgemeine Chemie Die chemische Reaktion Dirk Broßke Berlin, Dezember 2005 1 3.Die chemische Reaktion In chemischen Reaktionen sind eine Vielzahl von Teilchen beteiligt. Die Gesetzmäßigkeiten chemischer
Allgemeine Chemie Die chemische Reaktion Dirk Broßke Berlin, Dezember 2005 1 3.Die chemische Reaktion In chemischen Reaktionen sind eine Vielzahl von Teilchen beteiligt. Die Gesetzmäßigkeiten chemischer
Enthalpie H (Wärmeinhalt, Wärmefunktion)
 Enthalpie H (Wärmeinhalt, Wärmefunktion) U = Q + W Innere Energie: Bei konstantem Volumen ablaufende Zustandsänderung (isochorer Prozess, dv=) W=p V= U=Q v Bei Zustandsänderung unter konstantem Druck (isobarer
Enthalpie H (Wärmeinhalt, Wärmefunktion) U = Q + W Innere Energie: Bei konstantem Volumen ablaufende Zustandsänderung (isochorer Prozess, dv=) W=p V= U=Q v Bei Zustandsänderung unter konstantem Druck (isobarer
Bekannter Stoff aus dem 1. Semester:
 Bekannter Stoff aus dem 1. Semester: Atombau! Arten der Teilchen! Elemente/Isotope! Kernchemie! Elektronenhülle/Quantenzahlen Chemische Bindung! Zustände der Materie! Ionenbindung! Atombindung! Metallbindung
Bekannter Stoff aus dem 1. Semester: Atombau! Arten der Teilchen! Elemente/Isotope! Kernchemie! Elektronenhülle/Quantenzahlen Chemische Bindung! Zustände der Materie! Ionenbindung! Atombindung! Metallbindung
Das chemische Gleichgewicht
 Das chemische Gleichgewicht Modell: Geschlossenes Gefäß mit Flüssigkeit, die verdampft ( T=const ) Moleküle treten über in die Dampfphase H 2 O (l) H 2 O (g) H 2 O (g) Dampfdruck p H 2 O (l) T = const.
Das chemische Gleichgewicht Modell: Geschlossenes Gefäß mit Flüssigkeit, die verdampft ( T=const ) Moleküle treten über in die Dampfphase H 2 O (l) H 2 O (g) H 2 O (g) Dampfdruck p H 2 O (l) T = const.
INVERSION DES ROHRZUCKERS
 INVERSION DES ROHRZUCKERS 1. Versuhsplatz Komponenten: - Thermostat - Polarimeter - zerlegbare Küvette - Thermometer 2. Allgemeines zum Versuh Im Rahmen der Reaktionskinetik wird der zeitlihe Ablauf von
INVERSION DES ROHRZUCKERS 1. Versuhsplatz Komponenten: - Thermostat - Polarimeter - zerlegbare Küvette - Thermometer 2. Allgemeines zum Versuh Im Rahmen der Reaktionskinetik wird der zeitlihe Ablauf von
Planung, Bau und Betrieb von Chemieanlagen - Übung Allgemeine Chemie. Allgemeine Chemie. Rückblick auf vorherige Übung
 Planung, Bau und Betrieb von Chemieanlagen - Übung Allgemeine Chemie 1 Allgemeine Chemie Rückblick auf vorherige Übung 2 Löslichkeit Was ist eine Lösung? - Eine Lösung ist ein einphasiges (homogenes) Gemisch
Planung, Bau und Betrieb von Chemieanlagen - Übung Allgemeine Chemie 1 Allgemeine Chemie Rückblick auf vorherige Übung 2 Löslichkeit Was ist eine Lösung? - Eine Lösung ist ein einphasiges (homogenes) Gemisch
... Matrikel-Nummer Name Vorname. ... Semester Geburtstag Geburtsort
 Klausur zu Vorlesung und Übung P WS 2003/04 S. Universität Regensburg Naturwissenshaftlihe Fakultät IV- hemie und Pharmazie Bitte ausfüllen... Matrikel-Nummer Name Vorname... Semester Geburtstag Geburtsort
Klausur zu Vorlesung und Übung P WS 2003/04 S. Universität Regensburg Naturwissenshaftlihe Fakultät IV- hemie und Pharmazie Bitte ausfüllen... Matrikel-Nummer Name Vorname... Semester Geburtstag Geburtsort
Weiterführende Aufgaben zu chemischen Gleichgewichten
 Weiterführende Aufgaben zu hemishen Gleihgewihten Fahshule für Tehnik Suhe nah Ruhe, aber durh das Gleihgewiht, niht durh den Stillstand deiner Tätigkeiten. Friedrih Shiller Der Shlüssel zur Gelassenheit
Weiterführende Aufgaben zu hemishen Gleihgewihten Fahshule für Tehnik Suhe nah Ruhe, aber durh das Gleihgewiht, niht durh den Stillstand deiner Tätigkeiten. Friedrih Shiller Der Shlüssel zur Gelassenheit
12 Jahre später finden Sie hier den an gewundenen Seidenfäden aufgehangenen Knaben, der einen weiteren Knaben an die linke Hand faßt, aus dessen
 1 Jahre später finden Sie hier den an gewundenen Seidenfäden aufgehangenen Knaben, der einen weiteren Knaben an die linke Hand faßt, aus dessen rehter dann ein Funken sprühen wird. Der hängende Knabe wird
1 Jahre später finden Sie hier den an gewundenen Seidenfäden aufgehangenen Knaben, der einen weiteren Knaben an die linke Hand faßt, aus dessen rehter dann ein Funken sprühen wird. Der hängende Knabe wird
Eine chemische Reaktion läuft ab, wenn reaktionsfähige Teilchen mit genügend Energie zusammenstoßen.
 1) DEFINITIONEN DIE CHEMISCHE REAKTION Eine chemische Reaktion läuft ab, wenn reaktionsfähige Teilchen mit genügend Energie zusammenstoßen. Der Massenerhalt: Die Masse ändert sich im Laufe einer Reaktion
1) DEFINITIONEN DIE CHEMISCHE REAKTION Eine chemische Reaktion läuft ab, wenn reaktionsfähige Teilchen mit genügend Energie zusammenstoßen. Der Massenerhalt: Die Masse ändert sich im Laufe einer Reaktion
Kapitel 2 Die chemische Reaktion
 Kapitel 2 Die chemische Reaktion 2.1 Die Triebkraft chemischer Reaktionen (und nicht nur der) Es gilt universell: Jedes materielle System versucht, den unter den gegebenen Umständen energieärmsten Zustand
Kapitel 2 Die chemische Reaktion 2.1 Die Triebkraft chemischer Reaktionen (und nicht nur der) Es gilt universell: Jedes materielle System versucht, den unter den gegebenen Umständen energieärmsten Zustand
Thermochemie. Arbeit ist das Produkt aus wirkender Kraft F und Weglänge s. w = F s 1 J = 1 Nm = 1 kgm 2 /s 2
 Thermochemie Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu leisten. E pot = m g h E kin = ½ m v 2 Arbeit ist das Produkt aus wirkender Kraft F und Weglänge s. w = F s 1 J = 1 Nm = 1 kgm 2 /s 2 Eine wirkende Kraft
Thermochemie Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu leisten. E pot = m g h E kin = ½ m v 2 Arbeit ist das Produkt aus wirkender Kraft F und Weglänge s. w = F s 1 J = 1 Nm = 1 kgm 2 /s 2 Eine wirkende Kraft
Das Chemische Gleichgewicht
 Das Chemische Gleichgewicht Geschwindigkeit der Hinreaktion: v hin = k hin c(a 2 ) c(x 2 ) Geschwindigkeit der Rückreaktion: v rück = k rück c 2 (AX) Gleichgewicht: v hin = v rück k hin c(a 2 ) c(x 2 )
Das Chemische Gleichgewicht Geschwindigkeit der Hinreaktion: v hin = k hin c(a 2 ) c(x 2 ) Geschwindigkeit der Rückreaktion: v rück = k rück c 2 (AX) Gleichgewicht: v hin = v rück k hin c(a 2 ) c(x 2 )
Kompressionsfaktor. Der Kompressionsfaktor (Realgasfaktor) beschreibt die Abweichung eines realen Gases vom idealen Verhalten:
 Kompressionsfaktor Der Kompressionsfaktor (Realgasfaktor) beshreibt die Abweihung eines realen Gases om idealen Verhalten: pv m ZRT Z pvm RT kleine Drüke: nahezu keine zwishenmolekulare Kräfte pv m ~ RT
Kompressionsfaktor Der Kompressionsfaktor (Realgasfaktor) beshreibt die Abweihung eines realen Gases om idealen Verhalten: pv m ZRT Z pvm RT kleine Drüke: nahezu keine zwishenmolekulare Kräfte pv m ~ RT
Stoffwechsel. Die Chemie des Lebens ist in Stoffwechselwegen organisiert
 Die Chemie des Lebens ist in Stoffwechselwegen organisiert Der Stoffwechsel ist die Summe aller chemischen Reaktionen, die in den Zellen eines Organismus auftreten. Unter Mithilfe von Enzymen verläuft
Die Chemie des Lebens ist in Stoffwechselwegen organisiert Der Stoffwechsel ist die Summe aller chemischen Reaktionen, die in den Zellen eines Organismus auftreten. Unter Mithilfe von Enzymen verläuft
d( ) Thermodynamische Grundlagen 1. Lineare irreversible Thermodynamik
 Ludwig Pohlmann Thermodynamik offener Systeme und Selbstorganisationsphänomene SS 007 Thermodynamishe Grundlagen 1. Lineare irreversible Thermodynamik Beispiel Diffusion: der Fluß der diffundierenden Teilhen
Ludwig Pohlmann Thermodynamik offener Systeme und Selbstorganisationsphänomene SS 007 Thermodynamishe Grundlagen 1. Lineare irreversible Thermodynamik Beispiel Diffusion: der Fluß der diffundierenden Teilhen
Versuch LF: Leitfähigkeit
 Versuhsdatum: 8.9.9 Versuh LF: Versuhsdatum: 8.9.9 Seite -- Versuhsdatum: 8.9.9 Einleitung bedeutet, dass ein hemisher Stoff oder ein Stoffgemish in der Lage ist, Energie oder Ionen zu transportieren und
Versuhsdatum: 8.9.9 Versuh LF: Versuhsdatum: 8.9.9 Seite -- Versuhsdatum: 8.9.9 Einleitung bedeutet, dass ein hemisher Stoff oder ein Stoffgemish in der Lage ist, Energie oder Ionen zu transportieren und
Allgemeine Chemie. SS 2014 Thomas Loerting. Thomas Loerting Allgemeine Chemie
 Allgemeine Chemie SS 2014 Thomas Loerting 1 Inhalt 1 Der Aufbau der Materie (Teil 1) 2 Die chemische Bindung (Teil 2) 3 Die chemische Reaktion (Teil 3) 2 Definitionen von den an einer chemischen Reaktion
Allgemeine Chemie SS 2014 Thomas Loerting 1 Inhalt 1 Der Aufbau der Materie (Teil 1) 2 Die chemische Bindung (Teil 2) 3 Die chemische Reaktion (Teil 3) 2 Definitionen von den an einer chemischen Reaktion
a) Welche der folgenden Aussagen treffen nicht zu? (Dies bezieht sind nur auf Aufgabenteil a)
 Aufgabe 1: Multiple Choice (10P) Geben Sie an, welche der Aussagen richtig sind. Unabhängig von der Form der Fragestellung (Singular oder Plural) können eine oder mehrere Antworten richtig sein. a) Welche
Aufgabe 1: Multiple Choice (10P) Geben Sie an, welche der Aussagen richtig sind. Unabhängig von der Form der Fragestellung (Singular oder Plural) können eine oder mehrere Antworten richtig sein. a) Welche
Reaktionskinetik. Katalyse
 Reaktionskinetik Katalyse Katalysatoren beshleunigen hemishe Reaktionen, ohne das Gleihgewiht zu beeinflussen. Sie beeinflussen nur die Aktiierungsenergie Katalyse Katalysatoren beeinflussen den Reaktionsweg
Reaktionskinetik Katalyse Katalysatoren beshleunigen hemishe Reaktionen, ohne das Gleihgewiht zu beeinflussen. Sie beeinflussen nur die Aktiierungsenergie Katalyse Katalysatoren beeinflussen den Reaktionsweg
Grundlagen der Chemie Elektrolyt- und Nichtelektrolytlösungen
 Elektrolyt- und Nichtelektrolytlösungen Prof. Annie Powell KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Elektrolyt- und Nichtelektrolytlösungen
Elektrolyt- und Nichtelektrolytlösungen Prof. Annie Powell KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Elektrolyt- und Nichtelektrolytlösungen
3.4 Energieumsatz bei Reaktionen
 3.4 Energieumsatz bei Reaktionen Versuch: Verbrennen eines Stückes Holz Beobachtung: Energie wird freigesetzt in Form von Wärme. Jede Reaktion ist mit einem Energieumsatz gekoppelt. Reaktionen, bei denen
3.4 Energieumsatz bei Reaktionen Versuch: Verbrennen eines Stückes Holz Beobachtung: Energie wird freigesetzt in Form von Wärme. Jede Reaktion ist mit einem Energieumsatz gekoppelt. Reaktionen, bei denen
Das Chemische Gleichgewicht
 Das Chemische Gleichgewicht a A + b B c C + d D r r r r Für r G = 0 gilt: Q = K r G G E D r G = dg dx
Das Chemische Gleichgewicht a A + b B c C + d D r r r r Für r G = 0 gilt: Q = K r G G E D r G = dg dx
Chemie Zusammenfassung KA 2
 Chemie Zusammenfassung KA 2 Wärmemenge Q bei einer Reaktion Chemische Reaktionen haben eine Gemeinsamkeit: Bei der Reaktion wird entweder Energie/Wärme frei (exotherm). Oder es wird Wärme/Energie aufgenommen
Chemie Zusammenfassung KA 2 Wärmemenge Q bei einer Reaktion Chemische Reaktionen haben eine Gemeinsamkeit: Bei der Reaktion wird entweder Energie/Wärme frei (exotherm). Oder es wird Wärme/Energie aufgenommen
Polarimetrie 1. Polarimetrie
 Polarimetrie 1 Polarimetrie Bei Reaktionen mit optish aktiven Reaktanten kann die Konzentration der an der Reaktion beteiligten toffe gut polarimetrish gemessen werden, indem für das Gemish der Drehwinkel
Polarimetrie 1 Polarimetrie Bei Reaktionen mit optish aktiven Reaktanten kann die Konzentration der an der Reaktion beteiligten toffe gut polarimetrish gemessen werden, indem für das Gemish der Drehwinkel
Vorlesung Allgemeine Chemie Teil Physikalische Chemie WS 2009/10
 Vorlesung Allgemeine Chemie Teil Physikalische Chemie WS 2009/10 Dr. Lars Birlenbach Physikalische Chemie, Universität Siegen Raum AR-F0102 Tel.: 0271 740 2817 email: birlenbach@chemie.uni-siegen.de Lars
Vorlesung Allgemeine Chemie Teil Physikalische Chemie WS 2009/10 Dr. Lars Birlenbach Physikalische Chemie, Universität Siegen Raum AR-F0102 Tel.: 0271 740 2817 email: birlenbach@chemie.uni-siegen.de Lars
Grundlagen der Chemie Verschieben von Gleichgewichten
 Verschieben von Gleichgewichten Prof. Annie Powell KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Prinzip des kleinsten Zwangs Das
Verschieben von Gleichgewichten Prof. Annie Powell KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Prinzip des kleinsten Zwangs Das
Die Zelle. Membranen: Struktur und Funktion
 Die Zelle Membranen: Struktur und Funktion 8.4 Die Fluidität von Membranen. 8.6 Die Feinstruktur der Plasmamembran einer Tierzelle (Querschnitt). (Zum Aufbau der extrazellulären Matrix siehe auch Abbildung
Die Zelle Membranen: Struktur und Funktion 8.4 Die Fluidität von Membranen. 8.6 Die Feinstruktur der Plasmamembran einer Tierzelle (Querschnitt). (Zum Aufbau der extrazellulären Matrix siehe auch Abbildung
Uebersicht. Vorgehen. Wissenserwerb. Anwendungen des chemischen Gleichgewichtes 28
 Anwendungen des chemischen Gleichgewichtes 28 Gruppe1: Gruppe 3 Die Temperatur beeinflusst das chemische Gleichgewicht Uebersicht Die Reaktionsteilnehmer einer reversiblen Reaktion liegen bei konstanter
Anwendungen des chemischen Gleichgewichtes 28 Gruppe1: Gruppe 3 Die Temperatur beeinflusst das chemische Gleichgewicht Uebersicht Die Reaktionsteilnehmer einer reversiblen Reaktion liegen bei konstanter
0.1 Geschwindigkeit bei Reaktionen
 1 0.1 Geschwindigkeit bei Reaktionen Salzsäure reagiert mit Magnesium Erklärung 2HCl + Mg MgCl 2 + H 2 Das M g-pulver reagiert schneller mit der Salzsäure als die Mg-Späne. Definition: Reaktionsgeschwindigkeit
1 0.1 Geschwindigkeit bei Reaktionen Salzsäure reagiert mit Magnesium Erklärung 2HCl + Mg MgCl 2 + H 2 Das M g-pulver reagiert schneller mit der Salzsäure als die Mg-Späne. Definition: Reaktionsgeschwindigkeit
Die Theorie des aktivierten Komplexes
 Die Theorie des aktiierten Komplexes Theorie kommt aus der statistishen Thermodynamik! (wird in höheren Semestern behandelt) Streke über die der aktiierten Komplex existiert A+BC AB+C A+BC A..B. C AB+C
Die Theorie des aktiierten Komplexes Theorie kommt aus der statistishen Thermodynamik! (wird in höheren Semestern behandelt) Streke über die der aktiierten Komplex existiert A+BC AB+C A+BC A..B. C AB+C
Grundlagen der Chemie Chemisches Gleichgewicht
 Chemisches Gleichgewicht Prof. Annie Powell KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Das Massenwirkungsgesetz Wenn Substanzen
Chemisches Gleichgewicht Prof. Annie Powell KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Das Massenwirkungsgesetz Wenn Substanzen
Thermodynamik. Thermodynamik
 Geschlossenes System: Energieaustausch, aber kein Materieaustausch mit der Umgebung. Innere Energie: Jeder Stoff hat in sich Energie in irgendeiner Form gespeichert: die innere Energie U. U 1 = innere
Geschlossenes System: Energieaustausch, aber kein Materieaustausch mit der Umgebung. Innere Energie: Jeder Stoff hat in sich Energie in irgendeiner Form gespeichert: die innere Energie U. U 1 = innere
Metabolismus Umwandlung von Stoffen und Energie nach den Gesetzen der Thermodynamik
 Metabolismus Umwandlung von Stoffen und Energie nach den Gesetzen der Thermodynamik Der Metabolismus oder Stoffwechsel ist die Gesamtheit der in einem Organismus ablaufenden (bio)chemischen Prozesse Der
Metabolismus Umwandlung von Stoffen und Energie nach den Gesetzen der Thermodynamik Der Metabolismus oder Stoffwechsel ist die Gesamtheit der in einem Organismus ablaufenden (bio)chemischen Prozesse Der
Reaktion und Energie
 Reaktion und Energie Grundsätzliches Bei chemischen Reaktionen werden die Atome der Ausgangsstoffe neu angeordnet, d. h. Bindungen werden gespalten und neu geknüpft. Die Alltasgserfahrung legt nahe, dass
Reaktion und Energie Grundsätzliches Bei chemischen Reaktionen werden die Atome der Ausgangsstoffe neu angeordnet, d. h. Bindungen werden gespalten und neu geknüpft. Die Alltasgserfahrung legt nahe, dass
Thermodynamik 2. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Entropie. Die statistische Definition der Entropie.
 Thermodynamik 2. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Entropie. Die statistische Definition der Entropie. Die Hauptsätze der Thermodynamik Kurze Zusammenfassung der Hauptsätze 0. Hauptsatz: Stehen zwei
Thermodynamik 2. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Entropie. Die statistische Definition der Entropie. Die Hauptsätze der Thermodynamik Kurze Zusammenfassung der Hauptsätze 0. Hauptsatz: Stehen zwei
Praktikumsrelevante Themen
 Praktikumsrelevante Themen Lösungen Der Auflösungsprozess Beeinflussung der Löslichkeit durch Temperatur und Druck Konzentration von Lösungen Dampfdruck, Siede- und Gefrierpunkt von Lösungen Lösungen von
Praktikumsrelevante Themen Lösungen Der Auflösungsprozess Beeinflussung der Löslichkeit durch Temperatur und Druck Konzentration von Lösungen Dampfdruck, Siede- und Gefrierpunkt von Lösungen Lösungen von
PCG Grundpraktikum Versuch 5 Lösungswärme Multiple Choice Test
 PCG Grundpraktikum Versuch 5 Lösungswärme Multiple Choice Test 1. Zu jedem Versuch im PCG wird ein Vorgespräch durchgeführt. Für den Versuch Lösungswärme wird dieses Vorgespräch durch einen Multiple Choice
PCG Grundpraktikum Versuch 5 Lösungswärme Multiple Choice Test 1. Zu jedem Versuch im PCG wird ein Vorgespräch durchgeführt. Für den Versuch Lösungswärme wird dieses Vorgespräch durch einen Multiple Choice
1) Ein offenes System zeichnet sich immer durch eine konstante Temperatur aus. zeichnet sich immer durch eine konstante Masse aus.
 1) Ein offenes System zeichnet sich immer durch eine konstante Temperatur aus. zeichnet sich immer durch eine konstante Masse aus. kann mit der Umgebung Energie austauschen. kann mit der Umgebung Entropie
1) Ein offenes System zeichnet sich immer durch eine konstante Temperatur aus. zeichnet sich immer durch eine konstante Masse aus. kann mit der Umgebung Energie austauschen. kann mit der Umgebung Entropie
Basiswissen Chemie. Vorkurs des MINTroduce-Projekts
 Basiswissen Chemie Vorkurs des MINTroduce-Projekts Christoph Wölper christoph.woelper@uni-due.de Sprechzeiten (Raum: S07 S00 C24 oder S07 S00 D27) Organisatorisches Änderungen für nächste Woche Vorlesung
Basiswissen Chemie Vorkurs des MINTroduce-Projekts Christoph Wölper christoph.woelper@uni-due.de Sprechzeiten (Raum: S07 S00 C24 oder S07 S00 D27) Organisatorisches Änderungen für nächste Woche Vorlesung
6.2 Zweiter HS der Thermodynamik
 Die Änderung des Energieinhaltes eines Systems ohne Stoffaustausch kann durch Zu-/Abfuhr von Wärme Q bzw. mechanischer Arbeit W erfolgen Wird die Arbeit reversibel geleistet (Volumenarbeit), so gilt W
Die Änderung des Energieinhaltes eines Systems ohne Stoffaustausch kann durch Zu-/Abfuhr von Wärme Q bzw. mechanischer Arbeit W erfolgen Wird die Arbeit reversibel geleistet (Volumenarbeit), so gilt W
Transportprozesse (molekulare Interpretation)
 Transportproesse (molekulare Interpretation) Der Ausgangspunkt der Betrahtung ist die ufällige Bewegung von Molekülen in Gasen. Die kinetishe Gastheorie kann ur molekularen Interpretation makroskopisher
Transportproesse (molekulare Interpretation) Der Ausgangspunkt der Betrahtung ist die ufällige Bewegung von Molekülen in Gasen. Die kinetishe Gastheorie kann ur molekularen Interpretation makroskopisher
4.3 Reaktionsgeschwindigkeit und Katalysator
 4.3 Reaktionsgeschwindigkeit und Katalysator - Neben der thermodynamischen Lage des chemischen Gleichgewichts ist der zeitliche Ablauf der Reaktion, also die Geschwindigkeit der Ein- Einstellung des Gleichgewichts,
4.3 Reaktionsgeschwindigkeit und Katalysator - Neben der thermodynamischen Lage des chemischen Gleichgewichts ist der zeitliche Ablauf der Reaktion, also die Geschwindigkeit der Ein- Einstellung des Gleichgewichts,
Roland Reich. Thermodynamik. Grundlagen und Anwendungen in der allgemeinen Chemie. Zweite, verbesserte Auflage VCH. Weinheim New York Basel Cambridge
 Roland Reich Thermodynamik Grundlagen und Anwendungen in der allgemeinen Chemie Zweite, verbesserte Auflage VCH Weinheim New York Basel Cambridge Inhaltsverzeichnis Formelzeichen Maßeinheiten XV XX 1.
Roland Reich Thermodynamik Grundlagen und Anwendungen in der allgemeinen Chemie Zweite, verbesserte Auflage VCH Weinheim New York Basel Cambridge Inhaltsverzeichnis Formelzeichen Maßeinheiten XV XX 1.
Kinetische Theorie der Gase
 Kinetishe heorie der Gase 1 Zusammenassung Zusammenhang zwishen Druk, olumen und emeratur nr Nk B Ideales Gasgesetz Anzahl Atome in 1 g 1 C Avogadrozahl N N A 6.0 10 A 1 mol Boltzmannkonstante k k B R
Kinetishe heorie der Gase 1 Zusammenassung Zusammenhang zwishen Druk, olumen und emeratur nr Nk B Ideales Gasgesetz Anzahl Atome in 1 g 1 C Avogadrozahl N N A 6.0 10 A 1 mol Boltzmannkonstante k k B R
5 Teilchen treffen Teilchen: Reaktionskinetik
 5 Teilchen treffen Teilchen: Reaktionskinetik 5.1 Elementarreaktionen und Mehrschritt-Reaktionen Wassergasreaktion: H 2 O + CO CO 2 + H 2 Dies ist lediglich der makroskopisch sichtbare Ablauf der Reaktion.
5 Teilchen treffen Teilchen: Reaktionskinetik 5.1 Elementarreaktionen und Mehrschritt-Reaktionen Wassergasreaktion: H 2 O + CO CO 2 + H 2 Dies ist lediglich der makroskopisch sichtbare Ablauf der Reaktion.
Massenwirkungsgesetz (MWG) und Reaktionskombinationen
 Massenwirkungsgesetz (MWG) und Reaktionskombinationen Das Massenwirkungsgesetz stellt den Zusammenhang zwischen Aktivitäten (bzw. Konzentrationen) der Produkte und der Edukte einer chemischen Reaktion,
Massenwirkungsgesetz (MWG) und Reaktionskombinationen Das Massenwirkungsgesetz stellt den Zusammenhang zwischen Aktivitäten (bzw. Konzentrationen) der Produkte und der Edukte einer chemischen Reaktion,
A 2.6 Wie ist die Zusammensetzung der Flüssigkeit und des Dampfes eines Stickstoff-Sauerstoff-Gemischs
 A 2.1 Bei - 10 o C beträgt der Dampfdruck des Kohlendioxids 26,47 bar, die Dichte der Flüssigkeit 980,8 kg/m 3 und die Dichte des Dampfes 70,5 kg/m 3. Bei - 7,5 o C beträgt der Dampfdruck 28,44 bar. Man
A 2.1 Bei - 10 o C beträgt der Dampfdruck des Kohlendioxids 26,47 bar, die Dichte der Flüssigkeit 980,8 kg/m 3 und die Dichte des Dampfes 70,5 kg/m 3. Bei - 7,5 o C beträgt der Dampfdruck 28,44 bar. Man
Übung zum chemischen Praktikum für Studierende der Biologie und Medizin Übung Nr. 1, /
 Übung zum chemischen Praktikum für Studierende der Biologie und Medizin Übung Nr. 1, 18.04.11 / 19.04.11 Lösung 1. Proteine sind Biopolymere, welche aus langen Ketten von Aminosäuren bestehen. a) Zeichnen
Übung zum chemischen Praktikum für Studierende der Biologie und Medizin Übung Nr. 1, 18.04.11 / 19.04.11 Lösung 1. Proteine sind Biopolymere, welche aus langen Ketten von Aminosäuren bestehen. a) Zeichnen
Bernhard Härder. Einführung in die PHYSIKALISCHE CHEMIE ein Lehrbuch Chemische Thermodynamik W/ WESTAR.P WISSENSCHAFTEN. Skripte, Lehrbücher Band 2
 Bernhard Härder Einführung in die PHYSIKALISCHE CHEMIE ein Lehrbuch Chemische Thermodynamik Skripte, Lehrbücher Band 2 W/ WESTAR.P WISSENSCHAFTEN Inhaltsverzeichnis Vorwort zur ersten Auflage Vorwort zur
Bernhard Härder Einführung in die PHYSIKALISCHE CHEMIE ein Lehrbuch Chemische Thermodynamik Skripte, Lehrbücher Band 2 W/ WESTAR.P WISSENSCHAFTEN Inhaltsverzeichnis Vorwort zur ersten Auflage Vorwort zur
Der Zustand eines Systems ist durch Zustandsgrößen charakterisiert.
 Grundbegriffe der Thermodynamik Die Thermodynamik beschäftigt sich mit der Interpretation gegenseitiger Abhängigkeit von stofflichen und energetischen Phänomenen in der Natur. Die Thermodynamik kann voraussagen,
Grundbegriffe der Thermodynamik Die Thermodynamik beschäftigt sich mit der Interpretation gegenseitiger Abhängigkeit von stofflichen und energetischen Phänomenen in der Natur. Die Thermodynamik kann voraussagen,
Massenwirkungsgesetz (MWG) und Reaktionskombination
 Universität des Saarlandes - Fachrichtung Anorganische Chemie C h e m i s c h e s E i n f ü h r u n g s p r a k t i k u m Massenwirkungsgesetz (MWG) und Reaktionskombination Das Massenwirkungsgesetz stellt
Universität des Saarlandes - Fachrichtung Anorganische Chemie C h e m i s c h e s E i n f ü h r u n g s p r a k t i k u m Massenwirkungsgesetz (MWG) und Reaktionskombination Das Massenwirkungsgesetz stellt
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlegung WS 2014/15 Chemie I Dr. Helge Klemmer
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlegung WS 2014/15 Chemie I 12.12.2014 Gase Flüssigkeiten Feststoffe Wiederholung Teil 2 (05.12.2014) Ideales Gasgesetz: pv Reale Gase: Zwischenmolekularen Wechselwirkungen
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlegung WS 2014/15 Chemie I 12.12.2014 Gase Flüssigkeiten Feststoffe Wiederholung Teil 2 (05.12.2014) Ideales Gasgesetz: pv Reale Gase: Zwischenmolekularen Wechselwirkungen
Vorlesung Anorganische Chemie
 Vorlesung Anorganische Chemie Prof. Ingo Krossing WS 2007/08 B.Sc. Chemie Login Prüfungsanmeldung Nur Bachelor! https://www.verwaltung.uni-freiburg.de/qis E-Mail Frau Jones: friederike.jones.pruefamt@cpg.uni-freiburg.de
Vorlesung Anorganische Chemie Prof. Ingo Krossing WS 2007/08 B.Sc. Chemie Login Prüfungsanmeldung Nur Bachelor! https://www.verwaltung.uni-freiburg.de/qis E-Mail Frau Jones: friederike.jones.pruefamt@cpg.uni-freiburg.de
Kurze Einführung in die Thermodynamik mit Begriffsklärungen
 Kurze Einführung in die Thermodynamik mit Begriffsklärungen Gliederung 1. Begriffsklärungen 2. Energieumwandlungen 3. Molare Volumenarbeit 4. Hauptsätze der Thermodynamik 5. Quellen 1. Begriffsklärungen
Kurze Einführung in die Thermodynamik mit Begriffsklärungen Gliederung 1. Begriffsklärungen 2. Energieumwandlungen 3. Molare Volumenarbeit 4. Hauptsätze der Thermodynamik 5. Quellen 1. Begriffsklärungen
Chemisches Gleichgewicht in homogenen Systemen I Seminarvortrag SoSe 08
 Chemisches Gleichgewicht in homogenen Systemen I Seminarvortrag SoSe 08 Sebastian Meiss 14. Mai 2008 1 Historischer Einstieg Erstmals wurde das Massenwirkungsgesetz 1867 von dem norwegischen Mathematiker
Chemisches Gleichgewicht in homogenen Systemen I Seminarvortrag SoSe 08 Sebastian Meiss 14. Mai 2008 1 Historischer Einstieg Erstmals wurde das Massenwirkungsgesetz 1867 von dem norwegischen Mathematiker
19. Ladungstransport über Wasserstoffbrückenbindungen. 1. Aufgabe
 19. Ladungstransport über Wasserstoffbrükenbindungen 1 19. Ladungstransport über Wasserstoffbrükenbindungen 1. Aufgabe Untersuhung der spezifishen Leitfähigkeit von Cl- bzw. KCl-haltigen Methanol/Wasser
19. Ladungstransport über Wasserstoffbrükenbindungen 1 19. Ladungstransport über Wasserstoffbrükenbindungen 1. Aufgabe Untersuhung der spezifishen Leitfähigkeit von Cl- bzw. KCl-haltigen Methanol/Wasser
1. Klausur ist am 5.12.! Jetzt lernen! Klausuranmeldung: Bitte heute in Listen eintragen!
 1. Klausur ist am 5.12.! Jetzt lernen! Klausuranmeldung: Bitte heute in Listen eintragen! Aggregatzustände Fest, flüssig, gasförmig Schmelz -wärme Kondensations -wärme Die Umwandlung von Aggregatzuständen
1. Klausur ist am 5.12.! Jetzt lernen! Klausuranmeldung: Bitte heute in Listen eintragen! Aggregatzustände Fest, flüssig, gasförmig Schmelz -wärme Kondensations -wärme Die Umwandlung von Aggregatzuständen
Zustandsbeschreibungen
 Aggregatzustände fest Kristall, geordnet Modifikationen Fernordnung flüssig teilgeordnet Fluktuationen Nahordnung gasförmig regellose Bewegung Unabhängigkeit ngigkeit (ideales Gas) Zustandsbeschreibung
Aggregatzustände fest Kristall, geordnet Modifikationen Fernordnung flüssig teilgeordnet Fluktuationen Nahordnung gasförmig regellose Bewegung Unabhängigkeit ngigkeit (ideales Gas) Zustandsbeschreibung
Klausur Physikalische Chemie für TUHH (Chemie III)
 07.03.2012 14.00 Uhr 17.00 Uhr Moritz / Pauer Klausur Physikalische Chemie für TUHH (Chemie III) Die folgende Tabelle dient Korrekturzwecken und darf vom Studenten nicht ausgefüllt werden. 1 2 3 4 5 6
07.03.2012 14.00 Uhr 17.00 Uhr Moritz / Pauer Klausur Physikalische Chemie für TUHH (Chemie III) Die folgende Tabelle dient Korrekturzwecken und darf vom Studenten nicht ausgefüllt werden. 1 2 3 4 5 6
Basiskenntnistest - Chemie
 Basiskenntnistest - Chemie 1.) Welche Aussage trifft auf Alkohole zu? a. ) Die funktionelle Gruppe der Alkohole ist die Hydroxygruppe. b. ) Alle Alkohole sind ungiftig. c. ) Mehrwertige Alkohole werden
Basiskenntnistest - Chemie 1.) Welche Aussage trifft auf Alkohole zu? a. ) Die funktionelle Gruppe der Alkohole ist die Hydroxygruppe. b. ) Alle Alkohole sind ungiftig. c. ) Mehrwertige Alkohole werden
BIOPHYSIK. Elektrischer Ladungstransport. Transportprozessen: Strömungsmechanik + Diffusion Allgemeine Beschreibung. Elektrische Stromstärke (I): C s
 BOPHYSK 4. Vorlesung Transportprozessen: Strömungsmehanik + Diffusion llgemeine Beshreibung Elektrisher Ladungstransport (elektr. Strom) Volumentransport (Strömung von Flüssigkeiten und Gasen) Strofftransport
BOPHYSK 4. Vorlesung Transportprozessen: Strömungsmehanik + Diffusion llgemeine Beshreibung Elektrisher Ladungstransport (elektr. Strom) Volumentransport (Strömung von Flüssigkeiten und Gasen) Strofftransport
Chemie Klausur
 Chemie Klausur 12.1 1 21. Oktober 2002 Aufgaben Aufgabe 1 1.1. Definiere: Innere Energie, Enthalpieänderung, Volumenarbeit, Standard-Bildungsenthalpie, molare Standard- Bildungsenthalpie. 4 VP 1.2. Stelle
Chemie Klausur 12.1 1 21. Oktober 2002 Aufgaben Aufgabe 1 1.1. Definiere: Innere Energie, Enthalpieänderung, Volumenarbeit, Standard-Bildungsenthalpie, molare Standard- Bildungsenthalpie. 4 VP 1.2. Stelle
Lösung Sauerstoff: 1s 2 2s 2 2p 4, Bor: 1s 2 2s 2 2p 1, Chlor: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Neon: 1s 2 2s 2 2p 6
 1 of 6 10.05.2005 10:56 Lösung 1 1.1 1 mol Natrium wiegt 23 g => 3 mol Natrium wiegen 69 g. 1 mol Na enthält N A = 6.02 x 10 23 Teilchen => 3 mol enthalten 1.806 x 10 24 Teilchen. 1.2 Ein halbes mol Wasser
1 of 6 10.05.2005 10:56 Lösung 1 1.1 1 mol Natrium wiegt 23 g => 3 mol Natrium wiegen 69 g. 1 mol Na enthält N A = 6.02 x 10 23 Teilchen => 3 mol enthalten 1.806 x 10 24 Teilchen. 1.2 Ein halbes mol Wasser
Wir gehen jetzt zu reversiblen Reaktionen über und betrachten eine reversible Reaktion einfacher Art in der allgemeinen Form (s. Gl.(A.
 Prof. Dr. H.-H. ohler, W 004/05 PC1 apitel.4 - Reversible Reation.4-1.4 Reversible Reationen.4.1 Diretionale und Netto-Reationsgeshwindigeit Wir gehen jetzt zu reversiblen Reationen über und betrahten
Prof. Dr. H.-H. ohler, W 004/05 PC1 apitel.4 - Reversible Reation.4-1.4 Reversible Reationen.4.1 Diretionale und Netto-Reationsgeshwindigeit Wir gehen jetzt zu reversiblen Reationen über und betrahten
Übungen zur VL Chemie für Biologen und Humanbiologen 05.12.2011 Lösung Übung 6
 Übungen zur VL Chemie für Biologen und Humanbiologen 05.12.2011 Lösung Übung 6 Thermodynamik und Gleichgewichte 1. a) Was sagt die Enthalpie aus? Die Enthalpie H beschreibt den Energiegehalt von Materie
Übungen zur VL Chemie für Biologen und Humanbiologen 05.12.2011 Lösung Übung 6 Thermodynamik und Gleichgewichte 1. a) Was sagt die Enthalpie aus? Die Enthalpie H beschreibt den Energiegehalt von Materie
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie Physikalisch-Chemisches Praktikum für Studenten L2
 Institut für Physikalische und Theoretische Chemie Physikalisch-Chemisches Praktikum für Studenten L2 10. Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit: Arrhenius-Beziehung Thema In diesem Versuch
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie Physikalisch-Chemisches Praktikum für Studenten L2 10. Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit: Arrhenius-Beziehung Thema In diesem Versuch
Name: Punktzahl: von 57 Note:
 Testen Sie Ihr Wissen! Übungsprobe zu den Tertia-Themen und Säure-Base-Reaktionen Name: Punktzahl: von 57 Note: Für die folgenden Fragen haben Sie 60 Minuten Zeit. Viel Erfolg! Hilfsmittel: das ausgeteilte
Testen Sie Ihr Wissen! Übungsprobe zu den Tertia-Themen und Säure-Base-Reaktionen Name: Punktzahl: von 57 Note: Für die folgenden Fragen haben Sie 60 Minuten Zeit. Viel Erfolg! Hilfsmittel: das ausgeteilte
Studienbegleitende Prüfung Modul 12 Anorganisch-Chemisches Grundpraktikum SS
 Studienbegleitende Prüfung Modul 12 Anorganish-Chemishes Grundpraktikum SS 2004 03.09.2004 ame: Vorname: Matrikelnummer: Fahsemester: Punkte: ote: Frage 1 Welhe Oxidationsstufen besitzt Chlor in: ClO -
Studienbegleitende Prüfung Modul 12 Anorganish-Chemishes Grundpraktikum SS 2004 03.09.2004 ame: Vorname: Matrikelnummer: Fahsemester: Punkte: ote: Frage 1 Welhe Oxidationsstufen besitzt Chlor in: ClO -
Fragen zum Thema chemische Reaktionen Klasse 4 1. Was gehört zu einer chemische Reaktionsgleichung? 2. Wie nennt man die Stoffe, die vor der Reaktion
 1. Was gehört zu einer chemische Reaktionsgleichung? 2. Wie nennt man die Stoffe, die vor der Reaktion vorliegen? 3. Wie nennt man die Stoffe, die nach der Reaktion vorliegen? 4. Womit wird die Richtung
1. Was gehört zu einer chemische Reaktionsgleichung? 2. Wie nennt man die Stoffe, die vor der Reaktion vorliegen? 3. Wie nennt man die Stoffe, die nach der Reaktion vorliegen? 4. Womit wird die Richtung
Anorganische-Chemie. Dr. Stefan Wuttke Butenandstr. 11, Haus E, E
 Dr. Stefan Wuttke Butenandstr. 11, Haus E, E 3.039 stefan.wuttke@cup.uni-muenchen.de www.wuttkegroup.de Anorganische-Chemie Grundpraktikum für Biologen 2016 Wie zählen wir Mengen in der Chemie? Stefan
Dr. Stefan Wuttke Butenandstr. 11, Haus E, E 3.039 stefan.wuttke@cup.uni-muenchen.de www.wuttkegroup.de Anorganische-Chemie Grundpraktikum für Biologen 2016 Wie zählen wir Mengen in der Chemie? Stefan
Chemie für. Mediziner und Medizinische Biologen
 Chemie für Mediziner und Medizinische Biologen Hochschuldozent Klaus Schaper WS 2007/2008 Vorlesung: Chemie für Mediziner und Medizinische Biologen an der Universität Duisburg-Essen Seite 427 Beispiele
Chemie für Mediziner und Medizinische Biologen Hochschuldozent Klaus Schaper WS 2007/2008 Vorlesung: Chemie für Mediziner und Medizinische Biologen an der Universität Duisburg-Essen Seite 427 Beispiele
4.1.1 Kelvin-Planck-Formulierung des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik. Thermischer Wirkungsgrad einer Arbeitsmaschine:
 4. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik 4.1. Klassische Formulierungen 4.1.1 Kelvin-Planck-Formulierung des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik Thermischer Wirkungsgrad einer Arbeitsmaschine: Beispiel Ottomotor
4. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik 4.1. Klassische Formulierungen 4.1.1 Kelvin-Planck-Formulierung des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik Thermischer Wirkungsgrad einer Arbeitsmaschine: Beispiel Ottomotor
Anorganische-Chemie. Dr. Stefan Wuttke Butenandstr. 11, Haus E, E
 Dr. Stefan Wuttke Butenandstr. 11, Haus E, E 3.039 stefan.wuttke@cup.uni-muenchen.de www.wuttkegroup.de Anorganische-Chemie Grundpraktikum für Biologen 2014/2015 Wie zählen wir Mengen in der Chemie? Stefan
Dr. Stefan Wuttke Butenandstr. 11, Haus E, E 3.039 stefan.wuttke@cup.uni-muenchen.de www.wuttkegroup.de Anorganische-Chemie Grundpraktikum für Biologen 2014/2015 Wie zählen wir Mengen in der Chemie? Stefan
