Agenda. Ökonomische Begriffe und Konzepte. Klassische Kostenrechnung: Kostenartenrechnung. Klassische Kostenrechnung: Kostenstellenrechnung
|
|
|
- Achim Graf
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Agenda Ökonomische Begriffe und Konzepte Klassische Kostenrechnung: Kostenartenrechnung Klassische Kostenrechnung: Kostenstellenrechnung Klassische Kostenrechnung: Kostenträgerrechnung Prozessorientierte Kostenrechnung Integrierte Kostenrechnung Plankostenrechnung Literatur 1
2 Prozessorientierte Kostenrechnung Produktionsfaktoren Unterscheidung der Ressourcen: Produktionsfaktoren und deren Maßgrößen Produktionsfaktoren Verbrauch von Repetierfaktoren Gebrauch von Potentialfaktoren Material-Einsatz Personal-Einsatz Technologie-Einsatz Werkstoffe in Form von Roh- und Hilfsstoffen Arbeitsleistung Betriebsmittel in Form von Anlagen und deren Betriebsstoffe, Know How,... Mengen Personen-Stunden Maschinen-Stunden und Mengen 2
3 Prozessorientierte Kostenrechnung Modellierung der REAL-Ressourcen-Transformation <<Resource>> MAT-Einsatz <<Resource>> TECH-Einsatz <<Resource>> PERS-Einsatz <<Process>> Fertigung <<Performance>> Prozess-Ausbringung t0 t1 Aus ökonomisch-rationalen Überlegungen gilt es die zwischen den Ressourcen herrschende Limitationalitäten zu berücksichtigen. Eine Mehrleistung lässt sich nur erzielen, wenn alle Faktoren in den jeweiligen Verhältnissen, d.h. linear erhöht werden. linearlimitationales Input/Output-Modell 3
4 Prozessorientierte Kostenrechnung Input/Output-Prozesse Modellierung der REAL-Ressourcen-Transformation: I/O-fix vs. I/O-variabel t0 <<Process>> I/O-fix t1 <<Process>> I/O-variabel NOK OK <<Objective>> Vorgabe I/O-fixe Prozesse: einmaliger Prozess I/O-variable Prozesse: laufender Prozess Darstellung als Prozessschleife 4
5 Prozessorientierte Kostenrechnung Konstruktion als 3-Ressourcen-Modell Produktionsfunktion: Input Output Generische Produktionsfunktion x r M, r P, r T = f r M, r P, r T x(r) gibt die erbrachte Leistung x in Abhängigkeit vom Einsatz der Material- r M, Personal- r P und Technologiefaktoren r T an. Faktoreinsatzfunktion: Output Input r i x = f 1 x r i (x) wird durch Inversion der Produktionsfunktion abgeleitet und gibt den Einsatz des Produktionsfaktors i r i in Abhängigkeit von der Ausbringung x an. 5
6 Prozessorientierte Kostenrechnung Einsatzfunktion Lineare Einsatzfunktion von Produktionsfaktor i: r i = a i x Spezialfall: Gutenberg-Produktionsfunktion (1951) r i = a i (d i ) x sodass r i x = a i(d i ) wobei r i a i x a i (d i ) d i TLE ZE ME Periodeneinsatz von Faktor i Produktionskoeffizient von i Periodenausbringung Ökonomisch (ME/ZE) vs. technische (TLE/ZE) Verbrauchsfunktion Intensität: ME/ZE vs. TLE/ZE Technische Leistungseinheit Zeiteinheit Mengeneinheit 6
7 Prozessorientierte Kostenrechnung Leontief-Produktionsfunktion (1/2) linear-limitationales I/O-Modell: Konstruktion aus der generischen Produktionsfunktion Partielle Ausbringungsfunktionen für die MAT-, PERS- und TECH-Ressourcen: x r M = a M 1 r M = r M a M x r P = a P 1 r P = r P a P wobei a -1 M a -1 P a -1 T MAT-Produktivität PERS-Produktivität TECH-Produktivität x r T = a T 1 r T = r T a T 7
8 Prozessorientierte Kostenrechnung Leontief-Produktionsfunktion (2/2) Zusammenführung der ressourcenspezifischen Output-Funktionen über die min-funktion, der zufolge das Minimum der drei Funktionsargumente das Output-Niveau bestimmt x r M, r P, r T = min x r M ; x r P ; x(r T ) = min = min = min r M a M ; r P a P ; r T a T 1 r a M ; 1 r M a P ; 1 r P a T T 1 = d T min = 65 min a M r M ; d P r P ; d T r T 1 1 r a M d M ; r T c P ; r T PT r M 1 65 ; r P 2 ; r T wobei d i Intensität von Faktor i c PT Faktoreinsatzverhältnis von PERS zu TECH, für den gilt: r P r T = c PT 8
9 Prozessorientierte Kostenrechnung Guss-Prozess (1/3) Leontief-Produktionsfunktion: x r M, r P, r T = 65 min r M 1 65 ; r P 2 ; r T r T1 \ r P
10 Prozessorientierte Kostenrechnung Guss-Prozess (2/3) Leontief-Produktionsfunktion: x r M, r P, r T = 65 min r M 1 65 ; r P 2 ; r T Leontief Produktionsfunktion 1 1 TECH- 3 2 Einsatz (ZE) Ausbringung 150 (ME) Datenreihen4 Datenreihen Datenreihen2PERS-Einsatz (ZE) Datenreihen1 10
11 Prozessorientierte Kostenrechnung Guss-Prozess (3/3) Effiziente Potenzialfaktorkombination durch Elimination aller ökonomisch ineffizienter Kombinationen, welche Ressourcenverschwendungen darstellen: Leontief Produktionsfunktion r T1 \ r P TECH-Einsatz (ZE) Ausbringung 150 (ME) Datenreihen4 4 Datenreihen3 Datenreihen2 PERS-Einsatz (ZE) Datenreihen1 11
12 Prozessorientierte Kostenrechnung Prozesskostenmodell: Konstruktion Partielle Prozesskosten (variable ressourcenspezifische Prozesskosten): κ vi,j = r i,j q i,j wobei κ vi,j r i,j q i,j variable Prozesskosten der Ressource i im Prozess j Einsatz der Ressource i im Prozess j (Faktoreinsatz) Preis der Ressource i (Faktorpreis) im Prozess j Variable Prozesskosten: κ v,j = κ vi,j i wobei κ v,j κ M,j κ vp,j κ vt,j = κ M,j + κ vp,j + κ vt,j variablen Prozesskosten im Prozess j MAT-Prozesskosten im Prozess j variable PERS-Prozesskosten im Prozess j variable TECH-Prozesskosten im Prozess j 13
13 Prozessorientierte Kostenrechnung Prozesskostenmodell: Kalibrierung (1/2) Partielle Prozesskosten (variable ressourcenspezifische Prozesskosten): κ M,Guss = r M,Guss q M,Guss = 389,89 1,5448 = 602,32 Variable Prozesskosten: κ v,guss = κ M,Guss + κ vp,guss + κ vt,guss = 602, , ,44 = 761,02 14
14 Prozessorientierte Kostenrechnung Prozesskostenmodell: Kalibrierung (2/2) Guss (=G) Press (=P) Zug (=Z) MAT-Einsatz r M,j 389,89 543,18 217,08 PERS-Einsatz r vp,j 12,00 3,50 3,50 TECH-Einsatz r vt,j 6,00 3,50 6,90 MAT-Faktorpreis q M,j 1,5448 1,0769 1,3422 PERS-Faktorpreis q vp,j 7,5213 7,5213 7,5213 TECH-Faktorpreis q vt,j 11, , ,4068 MAT-Prozesskosten k M,j 602,32 584,96 291,36 PERS-Prozesskosten k vp,j 90,26 26,32 26,32 TECH-Prozesskosten k vt,j 68,44 39,92 78,71 var. Prozesskosten k v,j 761,02 651,21 396,39 Bestimmung der Faktorpreise: MAT-Ressource und Fremdleistungen werden vielfach marktmäßig bestimmt; PERS- und TECH-Ressourcen werden zumeist historisch bestimmt. 15
15 Prozessorientierte Kostenrechnung Prozesskostenmodell: Aggregation (1/2) Partielle Periodenkosten (mittels zeitlicher Aggregation Längsschnittaggregation): K vi,j = κ vi,j w j wobei K vi,j w j variable Periodenkosten der Ressource i im Prozess j Wiederholungen des Prozesses j Variable Periodenkosten: K v,j = K vi,j i = K M,j + K vp,j + K vt,j wobei K v,j variable Periodenkosten im Prozess j Gesamte variable Periodenkosten (mittels Querschnittaggregation): K v = K v,j j wobei K v gesamten variablen Periodenkosten 16
16 Prozessorientierte Kostenrechnung Prozesskostenmodell: Aggregation (2/2) Guss (=G) Press (=P) Zug (=Z) Gesamt MAT-Prozesskosten k M,j 602,32 584,96 291,36 PERS-Prozesskosten k vp,j 90,26 26,32 26,32 TECH-Prozesskosten k vt,j 68,44 39,92 78,71 var. Prozesskosten k v,j 761,02 651,21 396,39 Wiederholungen w j MAT-Periodenkosten K M,j K M var. PERS-Periodenkosten K vp,j K vp var. TECH-Periodenkosten K vt,j K vt var. Periodenkosten K v,j K v K M,Guss = κ M,Guss w M,Guss = 602, = K v,guss = K M,Guss + K vp,guss + K vt,guss = = K v = K v,guss + K v,press + K v,zug = =
17 Prozessorientierte Kostenrechnung Prozesskostenfunktion: Ausbringungsbezogene Kostenfunktion (1/3) K j X j = K f,j + k v,j X j wobei K j X j K f,j k v,j gesamte PeriodenKosten des Prozesses j periodische Ausbringung des Prozesses j fixe Periodenkosten des Prozesses j variable Einheitskosten des Prozesses j k v,j = κ v,j x j wobei κ v,j x j variable Prozesskosten des Prozesses j Losgröße des Prozesses j Berechnung von prozessbezogenen Gesamtkosten über die Betrachtungsperiode für unterschiedliche Ausbringungsmengen möglich. Setzt man für X j die tatsächlich erbrachte Ist-Ausbringung ein, so liefert die ausbringungsbezogene Kostenfunktion die Istkosten. 18
18 Prozessorientierte Kostenrechnung Prozesskostenfunktion: Ausbringungsbezogene Kostenfunktion (2/3) Guss (=G) Press (=P) Zug (=Z) var. Prozesskosten k v,j 761,02 651,21 396,39 fixe Periodenkosten K f,j Losgröße x j 389,9 543,2 217,1 var. Einheitskosten k v,j 1,9519 1,1989 1,8260 k v,guss = κ v,guss x Guss = 761,02 389,9 = 1,9519 K Guss X Guss = K f,guss + k v,guss X Guss = ,9519 X Guss Berechnung der Fixkosten des Prozesses j (K f,j ) aus den beiden Potenzialfaktoren (PERS und TECH) einfachster Fall: Division der periodischen Fixkosten durch die Anzahl der periodischen Prozessdurchführungen. 19
19 Kosten (GE) Prozessorientierte Kostenrechnung Prozesskostenfunktion: Ausbringungsbezogene Kostenfunktion (3/3) Ökonomische Bewertung - Vergleich der Kostenfunktionen der alten und der neuen Technologie: Kostenfunktion alte Tech. neue Tech Ausbringung (ME) 20
20 Agenda Ökonomische Begriffe und Konzepte Klassische Kostenrechnung: Kostenartenrechnung Klassische Kostenrechnung: Kostenstellenrechnung Klassische Kostenrechnung: Kostenträgerrechnung Prozessorientierte Kostenrechnung Integrierte Kostenrechnung Plankostenrechnung Literatur 21
21 Integrierte Kostenrechnung Enterprise Information System Management and Internal Control: Check- and Act-Activities Operational Supply Chain Financial Risk Acquisition Business Conversion Business Human Resource Customer Relationship Business Planning: Plan-Activities Operational Financial Human Res. Corporate... Business Process: Do-Activities Financing Business Revenue Business Corporate Compliance... Enterprise Information System Prozess-, Geschäfts- und Unternehmens- MGT EIS (B&M-Fachbereich) Integration von B&M und IT IT-Applikation ERP-CONTROL ist ein Prototyp einer semantisch integrierten EIS-Applikation 22
22 Integrierte Kostenrechnung Betrachtung im B&M-semantischen Integrationsrahmen Business Domain Management D. Geschäfts- Objekte Geschäfts- Prozesse MGT- Objekte MGT- Prozesse A) B&M Perspective (User s View) REA Informationen PDCA Informationen REA Aktivitätsdiagramme MGT- Aktivitätsdiagramme fachliche Anforderungen B) IS Perspective (Designer s View) C) IT Perspective (Programmer s View) REA- Daten- Modelle GUI-Technologie REA- Workflow- Modelle Logik-Technologie Datenbank-Technologie PDCA- Daten- Modelle MGT- Workflow- Modelle GUI-Technologie Logik-Technologie Datenbank-Technologie technische Anforderungen Säule 1a Säule 2a Säule 1b Säule 2b Umsetzung des Grundsatzes IT follows Business and Management : Betrachtung der Geschäfts- und Managementbereiche aus 3 Perspektiven 23
23 Integrierte Kostenrechnung Produktionsprozess: Beschreibung Ein Produktionsprozess besteht aus drei Arbeitsschritten: 1. Schritt: Die Materialien werden vom Eingangslager in die Produktionsstätte geliefert. 2. Schritt: In der Produktionsstätte wird der Fertigungsprozess durchgeführt. 3. Schritt: Die erstellten Produkte werden in das Ausgangslager geliefert. Aufgabe: Modellieren Sie den Produktionsprozess Welches Diagramm ist zu verwenden? Welche Ereignisse finden statt? Welche Ressourcen sind involviert? Welche Agenten sind beteiligt? 24
24 Integrierte Kostenrechnung Produktionsprozess: Modellierung <<Agent>> Eingangslager <<Agent>> Produktionsstätte <<Agent>> Ausgangslager <<Resource>> Material <<Resource>> Material <<Resource>> Personal <<Resource>> Ausrüstung <<Resource>> Produkt <<Do>> Anlieferung <<Do>> Fertigung <<Do>> Auslieferung <<Resource>> ICU <<Resource>> Produkt <<Resource>> ICU <<Resource>> ICU <<Resource>> ICU Modellierung des Produktionsprozesses: REA-Aktivitätsdiagramm Modellierung der drei Agenten (Eingangslager, Produktionsstätte, Ausgangslager), Modellierung der drei Aktivitäten (Anlieferung, Fertigung und Auslieferung), Modellierung der Ressourcenflüsse (Material, Produkt, und Internal Currency Unit) und der Einsätze der Potenzialfaktoren (Personal und Ausrüstung) 25
25 Integrierte Kostenrechnung Fertigungsprozess: Produktionstheoretische Modellierung (1/2) Guss (=G) Press (=P) Zug (=Z) Perioden-Ausbringung X j d j Intensität (ökonomische) I/O-variabel 65,0 155,2 I/O-fix 31,5 Dauer r T,j I/O-variabel 6 3,5 I/O-fix 6,9 Losgrößen x j I/O-variabel 389,9 543,2 I/O-fix 217,1 Wiederholungen w j Fertigungsprozesse werden aus produktionstheoretischer Sicht mit dem Input/Output- Modell betrachtet Industrielle Fertigungsprozesse werden mit limitationalen Produktionsfunktionen modelliert, wenn sie keine Substitution zwischen den Potenzialfaktoren Personal und Technologie (Ausrüstung) zulassen 26
26 Integrierte Kostenrechnung Fertigungsprozess: Produktionstheoretische Modellierung (2/2) wobei c PT,j d i,j R i,j r i,j w j X j x j X Zug ( R M, Zug, R P, Zug, R T, Zug ) d T, Zug r min c x P, Zug PT, Zug ; r T, Zug 3,45 31,5 min ;6,9 w 0,5 Zug 217,1 Zug w Faktoreinsatzverhältnis zwischen Personal und Technologie im Prozess j Prozess-Intensität (ME/ZE) der Ressource i im Prozess j (Produktionsgeschwindigkeit bzw. Produktivität) Periodischer Einsatz (in ZE) der Ressource i im Prozess j Dauer (Maschinen- oder Betriebsstunden) der Ressource i im Prozess j (PERS- bzw. TECH-Einsatz pro Prozess-Durchführung) Wiederholungen des Prozesses j Periodische Ausbringung (Output in ME) des Prozesses j Losgröße (Output in ME) des Prozesses j Zug Zug-Prozess: Input/Output-fixer Prozess limitationale Produktionsfunktion 27
27 Integrierte Kostenrechnung Fertigungsprozess: Mehrstufige Modellierung im ECSI-Standard Ein Prozesssegment umfasst die notwendigen Klassen von Personal, Ausrüstung und benötigtem Material und/oder es legt spezifische Ressourcen fest, wie erforderliche Ausrüstungen. Ein Prozesssegment darf auch die Anzahl der benötigten Ressourcen definieren. [ECSI08, S. 42] 28
28 Integrierte Kostenrechnung Fertigungsprozess: 3-Stufiges Prozessdatenmodell Prozessdatenmodell: 3-stufige Modellierung 1. Stufe: Spezifikation von Prozessperformancedaten anhand der Input/Output-Variabilität, der Prozessdauer und der Produktionsintensität (Produktions-geschwindigkeit, Produktivität) 2. Stufe: Spezifikation der im Fertigungsprozess benötigten Ressourcenkategorien inklusive Produktionskoeffizienten 3. Stufe: Spezifikation der im Fertigungsprozess benötigten Ressourceneigenschaften (properties) Vorteile der mehrstufigen Modellierung Erweiterbarkeit hinsichtlich zusätzlicher Ressourcenkategorien und -eigenschaften Verfügbarkeit unterschiedlich granularer Informationen für die Planung 29
29 Integrierte Kostenrechnung Fertigungsprozess: 1) Spezifikation der Prozessperformancedaten ProcessSegment id description duration duruom processio 1 Pull process 6,9 machineh/run fixed 2 Press process 3,5 machineh/run variable 3 Mold process 6,0 machineh/run variable ProcessParameters id description value UoM procsegid 1 Production intensity 31,4638 kg/machineh 1 2 Production intensity 65,0000 kg/machineh 2 3 Production intensity 155,2000 kg/machineh 3 ProcessSegment-Klasse enthält Input/Output-Spezifikation (processio), wobei I/O-fixe (fixed) und I/O-variable (variable) Fertigungsprozesse unterschieden werden Zug-Prozess ist I/O-fix, zumal die Prozessdauer (duration) eine fixe Größe ist ProcessParameters-Klasse enthält die Produktionsintensität (production intensity) 30
30 Integrierte Kostenrechnung Fertigungsprozess: 2) Spezifikation der Ressourcenkategorien Equipment-, Personnel- und MaterialSegmentSpecification-Klassen benennen die im Fertigungsprozess benötigen Ressourcenkategorien Produktionskoeffizienten spezifizieren den ressourcenbezogenen Einsatz pro erstellter Leistungseinheit EquipmentSegmentSpecification id description prodcoeff coeffuom procsegid 1 Pull machine 0,0318 machineh/kg 1 2 Mold machine 0,0154 machineh/kg 3 3 Press machine 0,0064 machineh/kg 2 PersonnelSegmentSpecification id description inputratio ratiouom procsegid 1 Pull worker 0,5 workh/machh 1 MaterialSegmentSpecification id description prodcoeff coeffuom procsegid 1 Paraffin material 0,9960 kg/kg 1 2 Wick material 0,0040 kg/kg 1 Limitationalität der Potenzialfaktoren: Faktoreinsatzverhältnis (inputratio) 31
31 Integrierte Kostenrechnung Fertigungsprozess: 3) Spezifikation der Ressourceneigenschaften EquipmentSpecificationProperty id description property propvalue equsegspecid equid 1 Pull machine capability pull 1 1 PersonnelSpecificationProperty id description property propvalue perssegspecid persid 1 Pull worker competence pull 1 1 MaterialSpecificationProperty id description property propvalue matsegspecid matid 1 Paraffin material firmness medium Wick material thickness thick 2 2 Equipment-, Personnel- und MaterialSpecificationProperty-Klassen benennen die Ressourceneigenschaften (property), welche zur Fertigung von konkreten Produkten benötigt werden Weitere enthalten sie die Verknüpfungen zu den konkreten Ressourcen, womit die Prozess- mit den Ressourcen-Datenmodellen verbunden werden 32
32 Integrierte Kostenrechnung Fertigungsprozess: Ressourcendatenmodelle für Potenzialfaktoren Equipment id description property propvalue priceperunit priceuom 1 Pull machine capability pull 11,4068 EUR/machineH 2 Mold machine capability mold 11,4068 EUR/machineH 3 Press machine capability press 11,4068 EUR/machineH Personnel id description property propvalue priceperunit priceuom 1 Peter Meter competence pull 7,5213 EUR/workingH 2 Sabine Mueller competence press 7,5213 EUR/workingH 3 Han Solo competence mold 7,5213 EUR/workingH Potenzialressourcen-Datenmodelle spezifizieren Eigenschaften und Preise der Potenzialfaktoren Personal (personnel) und Ausrüstung (equipment) Eigenschaften werden über das Prozessdatenmodell angefordert Ressourcenpreise werden zur Kostenkalkulation benötigt Kalibrierung der Ressourcenpreise erfordert eine ressourcenbasierte Kostenrechnung 33
33 Integrierte Kostenrechnung Fertigungsprozess: Ressourcendatenmodelle für Repetierfaktoren Material id description property propvalue priceperunit priceuom actualstock stockuom 1 Paraffin firmness medium 1,2000 EUR/kg 512,40 kg 2 Wick thickness thick 33,2600 EUR/kg 6,81 kg 3 Color color red 24,1500 EUR/kg 13,76 kg 4 Container size large 0,5177 EUR/kg 189,58 kg 5 Pull Candle size regular 1,8260 EUR/kg 7.579,25 kg Financial id description property propvalue priceperunit priceuom actualstock stockuom 1 Cash currency EUR 1,0000 EUR 3.945,85 EUR 2 ICU currency EUR 1,0000 EUR 0,00 EUR Repetierressourcen-Datenmodelle spezifizieren Eigenschaften und Preise des Repetierfaktors Material (material) Finanzressourcen (financial) werden zur REA-konformen Verbuchung der im Produktionsprozesses fließenden Materialen und Produkte benötigt 34
34 Integrierte Kostenrechnung Produktionsprozess: Tausch- und Transformationsprozesse <<Agent>> Eingangslager <<Agent>> Produktionsstätte <<Agent>> Ausgangslager <<Resource>> Material <<Resource>> Material <<Resource>> Personal <<Resource>> Ausrüstung <<Resource>> Produkt <<Do>> Anlieferung <<Do>> Fertigung <<Do>> Auslieferung <<Resource>> ICU <<Resource>> Produkt <<Resource>> ICU <<Resource>> ICU <<Resource>> ICU Kategorisierung der drei Arbeitsschritte des Produktionsprozesses: 1. Schritt: Anlieferung der Materialien = REA-Tauschprozess 2. Schritt: Durchführung des Fertigungsprozesses = REA-Transformationsprozess 3. Schritt: Auslieferung der Produkte = REA-Tauschprozess 35
35 Integrierte Kostenrechnung Produktionsprozess: Involvierte Agenten Agent id description 1 Entry warehouse 2 Exit warehouse 3 Production facility Agent-Klasse spezifiziert die 3 Agenten im Produktionsprozess involvierten Agenten: Eingangslager (entry warehouse) Ausgangslager (exit warehouse) Produktionsstätte (production facility) 36
36 Integrierte Kostenrechnung Produktionsprozess: 1) Anlieferung der Materialien (1/2) Event id description timestamp fromagent toagent dualevent 1 EntryWarehouseToProductionFacility XX 08:30: ProductionFacilityToEntryWarehouse XX 08:30: Materialanlieferung: Am um Uhr werden die im Fertigungs-prozess benötigten Materialien in Form von Paraffin (paraffin) und Docht (wick) vom Eingangslager (agentid = 1) in die Produktionsstätte (agentid = 3) geliefert REA-Tauschprozess: Der Materialanlieferung steht ein gleichwertiger Finanzressourcenfluss gegenüber (dualevent = 2), welcher von der Produktionsstätte (agentid = 3) ins Eingangslager (agentid = 1) fließt Beide Ressourcenflüsse in werden in der Event-Klasse aufgezeichnet 37
37 Integrierte Kostenrechnung Produktionsprozess: 1) Anlieferung der Materialien (2/2) MaterialFlow id quantity value matid eventid 1 216,22 259, ,88 29, FinancialFlow id quantity value finid eventid 1 288,63 288, Materialanlieferung: In der MaterialFlow-Klasse werden die beiden für den Zug- Fertigungsprozess angelieferte Ressourcen in Form von Paraffin (matid = 1) und Docht (matid = 2) mengen- (quantity) und wertmäßig (value) erfasst Finanzressourcenfluss: In der FinancialFlow-Klasse werden die Verrechnungspreise für die beiden angelieferten Materialen anhand der Internal Currency Unit (finid = 2) mengen- und wertmäßig erfasst Menge und Wert sind bei der ICU aufgrund des Preises von 1 ident 38
38 Integrierte Kostenrechnung Produktionsprozess: 2) Durchführung der Fertigung (1/2) SegmentResponse id starttime endtime segreqid XX 09:00: XX 15:54:00 1 SegmentRequirement id starttimescheduled endtimescheduled procsegid XX 09:00: XX 15:54:00 1 Durchführung des Fertigungsprozesses ist ein REA-Transformationsprozess, wobei aus Potenzial- und Repetierfaktoren Produkte erzeugt werden Produktionsleitsystem: Zeitliche Aufzeichnung der Durchführung des Fertigungsprozesses erfolgt in der SegmentResponse-Klasse Aufgezeichnete SegmentResponse-Instanz bezieht sich auf einen offenen Auftrag, welcher zeitlich vor der Durchführung in der Produktionsplanung geplant und in der SegmentRequirement-Klasse angelegt wurde 39
39 Integrierte Kostenrechnung Produktionsprozess: 2) Durchführung der Fertigung (2/2) GoodsProducedActual id description matid producedquantity segrespid 1 Pull candle 5 217,10 1 EquipmentUsedActual id description equid usedquantity segrespid 1 Pull machine 1 6,90 1 PersonnelUsedActual id description persid usedquantity segrespid 1 Peter Meter 1 3,45 1 RawMaterialConsumedActual id description matid consumedquantity segrespid 1 Paraffin 1 216, Wick 2 0,88 1 Produktionsleitsystem: Mengenaufzeichnung von Leistungen und Einsätzen Ausbringung (Output) in der GoodsProducedActual-Klasse Potenzialfaktor-Einsätze (Input) in EquipmentUsedActual und PersonnelUsedActual Repetierfaktor-Einsätze (Input) in RawMaterialConsumedActual 40
40 Integrierte Kostenrechnung Produktionsprozess: 3) Auslieferung der Produkte (1/2) Event id description timestamp fromagent toagent dualevent 1 EntryWarehouseToProductionFacility XX 08:30: ProductionFacilityToEntryWarehouse XX 08:30: ProductionFacilityToExitWarehouse XX 16:00: ExitWarehouseToProductionFacility XX 16:00: Produktauslieferung: Nach Beendigung der Fertigung werden am um Uhr die erzeugten Produkte in Form von Zugkerzen (pull candle) von der Produktionsstätte (agentid = 3) in das Ausgangslager (agentid = 2) geliefert REA-Tauschprozess: Der Produktauslieferung steht ein gleichwertiger Finanzressourcenfluss gegenüber (dualevent = 4), welcher vom Ausgangslager (agentid = 2) zur Produktionsstätte (agentid = 3) fließt 41
41 Integrierte Kostenrechnung Produktionsprozess: 3) Auslieferung der Produkte (2/2) MaterialFlow id quantity value matid eventid 1 216,22 259, ,88 29, ,10 396, FinancialFlow id quantity value finid eventid 1 288,63 288, ,43 396, Produktauslieferung: In der MaterialFlow-Klasse werden die ausgelieferten Zugkerzen (matid = 5) mengen- und wertmäßig erfasst Finanzressourcenfluss: In der FinancialFlow-Klasse werden die Verrechnungspreise für die ausgelieferten Zugkerzen anhand der Internal Currency Unit (finid = 2) mengenund wertmäßig erfasst Produktionsstätte erzielt einen ICU-Gewinn, da ICU-Zufluss > ICU-Abfluss 42
42 Agenda Ökonomische Begriffe und Konzepte Klassische Kostenrechnung: Kostenartenrechnung Klassische Kostenrechnung: Kostenstellenrechnung Klassische Kostenrechnung: Kostenträgerrechnung Prozessorientierte Kostenrechnung Integrierte Kostenrechnung Plankostenrechnung Literatur 43
43 Plankostenrechnung Begriffserklärungen Planungsperiode: am Anfang: Plankosten am Ende: Istkosten Dynamische Betrachtung, da man die Kosten im Zeitablauf betrachtet Sollkosten: kalibrierte Plan-Kostenfunktion, welche an der Stelle der Istleistung ausgewertet wird Vergleich von Soll- und Istkosten: Realisationskontrolle bzw. Soll/Ist-Vergleich Ursachen für Abweichungen beim Soll/Ist-Vergleich: Ausführungsursache Planungsursache Erfassungsursache 44
44 Plankostenrechnung Analytische Gemeinkosten-Planung (1/3) Konstruktion und Kalibrierung der GK-Kostenfunktion 1. Schritt der analytischen Planung: Spezifikation des zur Planung verwendeten Modells Modellkonstruktion (hier: ausbringungsbezogene Gemeinkosten-Kostenfunktion): K G,s X s = k vg,s X s + K f,s = k vpg,s + k vtg,s X s + K f,s wobei K G,s (X s ) X s k vg,s k vpg,s k vtg,s a P,s q P,s a T,s q T,s = a P,s q P,s + a T,s q T,s X s + K f,s GK der KOST s in Abhängigkeit von X s Ausbringung der KOST s variabler GKS der KOST s variable PERS-GKS der KOST s variable TECH-GKS der KOST s PERS-Produktionskoeffizient der KOST s PERS-Faktorpreis der KOST s TECH-Produktionskoeffizient der KOST s TECH-Faktorpreis der KOST s 45
45 Plankostenrechnung Analytische Gemeinkosten-Planung (2/3) Konstruktion und Kalibrierung der GK-Kostenfunktion 2. Schritt der analytischen Planung: Kalibrierung der Modellgleichung (exemplarische Darstellung für den variablen GKS k vgk,s ): Naive Kalibrierung Extrapolation von historischen Werten: k Plan vg,s = K Plan Ist vg,s K vg,s Plan X =! Ist s X s Ausbringungsbezogene GK-Kostenfunktion für die Fertigungskostenstelle: K Plan G,F X Plan F = k Plan vg,f X Plan Plan F + K f,f = 0,3008 X F Plan mit k Plan vg,f = K Plan vg,f X Plan =! K Ist vg,f F X Ist F = = 0,
46 Plankostenrechnung Analytische Gemeinkosten-Planung (3/3) Konstruktion und Kalibrierung der GK-Kostenfunktion 2. Schritt der analytischen Planung: Kalibrierung der Modellgleichung (exemplarische Darstellung für den variablen GKS k vgk,s ): GKS auf Basis variabler Kosten: Material-KOST Fertigung-KOST Produktion Perioden-Ausbringung X F X F X F period. f.kost-gk K f G,M K f G,F K f,fm period. v.kost-gk K v G,M K v G,F K v G,FM period. KOST-GK K G,M K G,F K G,FM f.kost-gks k f G,M 0,0979 k f G,F 0,4812 k f,fm 0,5791 v.kost-gks k v G,M 0,1949 k v G,F 0,3008 k v G,FM 0,4957 KOST-GKS k G,M 0,2928 k G,F 0,7820 k G,FM 1,
47 Plankostenrechnung Verbrauchsabweichung (1/2) Die Kostenplanung wird am Anfang der Planungsperiode durchgeführt. Während der Planungsperiode werden die Istkosten erfasst, sodass sie am Periodenende bekannt sind. Durch den Vergleich der Plan- und der Istkosten werden Abweichungen bestimmt. Beim Vergleich der Sollkosten K Soll (Plankostenfunktion ausgewertet bei der Istbeschäftigung) mit den Istkosten wird die Verbrauchsabweichung VA bestimmt. Soll-Kostenfunktion: K Soll X Ist = K v Soll + K f Plan = k v Plan X Ist + K f Plan Verbrauchsabweichung: VA = K v Ist K v Soll = K v Ist k v Plan X Ist 48
48 KOST Plan-EKS/-GKS bzw. Plan- Fixkosten der Kostenfunktion kostenstelle: Kostenkategorie Plan-Beschäftigung X Plan Plan-Kosten K Plan Ist-Kosten K Ist Ist-Beschäftigung X Ist Soll-Kosten K Soll Verbauchsabweichung = VA = K Ist - K Soll Plankostenrechnung Verbrauchsabweichung (2/2) Exemplarische Darstellung der Berechnung der Verbrauchsabweichung der Fertigungs- v.fert.-gk Fert. k v G,F 0, f.fert.-gk Fert. k f G,F 0, Fert.-GK k G,F 0, K F Soll X F Ist = K Soll Plan vg,f + K f,f = k Plan vg,f X Ist Plan F + K f,f = 0,3008 X F Ist Ist VA F = K vg,f Ist = K vg,f Soll K vg,f k Plan Ist vg,f X F = , =
49 Plankostenrechnung Risikonormierte Verbrauchsabweichung (1/3) Einheitsbezogene Verbrauchsabweichung va: va = VA X Ist = K Ist v X Ist K v Soll X Ist = k v Ist k v Plan Durchführung aller Verbrauchsabweichungen bereits in einem mittelgroßen Unternehmen führt zu einem unvertretbar hohen Arbeitsaufwand Überprüfung der Verbrauchsabweichungen auf ihre statistische Signifikanz mittel z-test (Einheitskosten sind normalverteilte Zufallsvariable) Risikonormierte Verbrauchsabweichung (standard normalverteilte Zufallsvariable) va RA : va RA = va StdAbw k = z 50
50 KOST Plan-EKS/-GKS bzw. Plan- Fixkosten der Kostenfunktion Kostenkategorie Plan-Beschäftigung X Plan Plan-Kosten K Plan Ist-Kosten K Ist Ist-Beschäftigung X Ist Soll-Kosten K Soll Verbauchsabweichung = VA = K Ist - K Soll Verbrauchsabweichg. pro X Ist va=va/x Ist Volatilitäten der Einheitskosten risikonormierte Verbr.Abw. va RN = z p-wert p(z~n<=z) Plankostenrechnung Risikonormierte Verbrauchsabweichung (2/3) Zur Beurteilung der statistischen Signifikanz wird der aus der z-test-statistik ermittelte z- Wert in den entsprechenden p-wert umgerechnet. Exemplarische Darstellung der Berechnung des z-wert für den variablen Gemeinkostensatz der Fertigungskostenstelle: va RA vg,f = va vg,f StdAbw k vg,f = 0,0156 0,011 = 1,41 = z vg,f v.fert.-gk Fert. k v G,F 0, ,0156 0,011 1,41 92,13% f.fert.-gk Fert. k f G,F 0, Fert.-GK k G,F 0,
51 Plankostenrechnung Risikonormierte Verbrauchsabweichung (3/3) In MS-Excel: NORMVERT-Funktion: Pr Z vg,f z vg,f = 0,9213 Da der p-wert über 90% liegt, hat die Verbrauchsabweichung eine bereits als kritisch einzustufende Höhe erreicht. z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,0 50,00% 50,40% 50,80% 51,20% 51,60% 51,99% 52,39% 52,79% 53,19% 53,59% 0,1 53,98% 54,38% 54,78% 55,17% 55,57% 55,96% 56,36% 56,75% 57,14% 57,53% 0,2 57,93% 58,32% 58,71% 59,10% 59,48% 59,87% 60,26% 60,64% 61,03% 61,41% 0,3 61,79% 62,17% 62,55% 62,93% 63,31% 63,68% 64,06% 64,43% 64,80% 65,17% 0,4 65,54% 65,91% 66,28% 66,64% 67,00% 67,36% 67,72% 68,08% 68,44% 68,79% 0,5 69,15% 69,50% 69,85% 70,19% 70,54% 70,88% 71,23% 71,57% 71,90% 72,24% 0,6 72,57% 72,91% 73,24% 73,57% 73,89% 74,22% 74,54% 74,86% 75,17% 75,49% 0,7 75,80% 76,11% 76,42% 76,73% 77,04% 77,34% 77,64% 77,94% 78,23% 78,52% 0,8 78,81% 79,10% 79,39% 79,67% 79,95% 80,23% 80,51% 80,78% 81,06% 81,33% 0,9 81,59% 81,86% 82,12% 82,38% 82,64% 82,89% 83,15% 83,40% 83,65% 83,89% 1,0 84,13% 84,38% 84,61% 84,85% 85,08% 85,31% 85,54% 85,77% 85,99% 86,21% 1,1 86,43% 86,65% 86,86% 87,08% 87,29% 87,49% 87,70% 87,90% 88,10% 88,30% 1,2 88,49% 88,69% 88,88% 89,07% 89,25% 89,44% 89,62% 89,80% 89,97% 90,15% 1,3 90,32% 90,49% 90,66% 90,82% 90,99% 91,15% 91,31% 91,47% 91,62% 91,77% 1,4 91,92% 92,07% 92,22% 92,36% 92,51% 92,65% 92,79% 92,92% 93,06% 93,19% 1,5 93,32% 93,45% 93,57% 93,70% 93,82% 93,94% 94,06% 94,18% 94,29% 94,41% 1,6 94,52% 94,63% 94,74% 94,84% 94,95% 95,05% 95,15% 95,25% 95,35% 95,45% 1,7 95,54% 95,64% 95,73% 95,82% 95,91% 95,99% 96,08% 96,16% 96,25% 96,33% 1,8 96,41% 96,49% 96,56% 96,64% 96,71% 96,78% 96,86% 96,93% 96,99% 97,06% 1,9 97,13% 97,19% 97,26% 97,32% 97,38% 97,44% 97,50% 97,56% 97,61% 97,67% 2,0 97,72% 97,78% 97,83% 97,88% 97,93% 97,98% 98,03% 98,08% 98,12% 98,17% 2,1 98,21% 98,26% 98,30% 98,34% 98,38% 98,42% 98,46% 98,50% 98,54% 98,57% 2,2 98,61% 98,64% 98,68% 98,71% 98,75% 98,78% 98,81% 98,84% 98,87% 98,90% 2,3 98,93% 98,96% 98,98% 99,01% 99,04% 99,06% 99,09% 99,11% 99,13% 99,16% 2,4 99,18% 99,20% 99,22% 99,25% 99,27% 99,29% 99,31% 99,32% 99,34% 99,36% 2,5 99,38% 99,40% 99,41% 99,43% 99,45% 99,46% 99,48% 99,49% 99,51% 99,52% 2,6 99,53% 99,55% 99,56% 99,57% 99,59% 99,60% 99,61% 99,62% 99,63% 99,64% 2,7 99,65% 99,66% 99,67% 99,68% 99,69% 99,70% 99,71% 99,72% 99,73% 99,74% 2,8 99,74% 99,75% 99,76% 99,77% 99,77% 99,78% 99,79% 99,79% 99,80% 99,81% 2,9 99,81% 99,82% 99,82% 99,83% 99,84% 99,84% 99,85% 99,85% 99,86% 99,86% 3,0 99,87% 99,87% 99,87% 99,88% 99,88% 99,89% 99,89% 99,89% 99,90% 99,90% 52
52 Plankostenrechnung Analyse der Verbrauchsabweichung Die ausbringungsbezogene Kostenfunktion ist nur zur Ermittlung der Sollkosten geeignet. Die Offenlegung der Ursachen erfordert den Übergang zu einsatzbezogenen Kostenfunktionen. Die Verbrauchsabweichung lässt sich zerlegen in die Preisabweichung, die Mengenabweichung und die Abweichungsinterdependenz. VA = K v Ist K v Soll = R Ist i q Ist i R Plan Plan i i i q i = R Ist i q Ist i R Plan Plan i i q i = R i Plan + R i q i Plan + q i R i Plan q i Plan i = ( R i Plan q i i Preisabweichung + q i Plan R i Mengenabweichung + R i q i ) Abweichungs interdependenz 53
53 Plankostenrechnung Analyse der Verbrauchsabweichung Die ausbringungsbezogene Kostenfunktion ist nur zur Ermittlung der Sollkosten geeignet. Die Offenlegung der Ursachen erfordert den Übergang zu einsatzbezogenen Kostenfunktionen. Die Verbrauchsabweichung lässt sich zerlegen in die Preisabweichung, die Mengenabweichung und die Abweichungsinterdependenz. q i Dq i = q i Ist - q i Plan Preisabweichung Mengenabweichung Abweichungsinterdependenz q i Plan R i Plan DR i = R i Ist - R i Plan R i 54
54 Plankostenrechnung Verrechnungskosten Bei den Verrechnungskosten K verr handelt es sich um die am Jahresanfang in der Kostenplanung ermittelten Plankosten, welche aliquot zu der in der Periode abgesetzten Leistung verrechnet werden. K verr X Ist = k verr X Ist Der Verrechnungskostensatz k verr wird auf Vollkostenbasis berechnet, d.h: k verr = k v Plan + k f Plan 55
55 Plankostenrechnung Gesamtabweichung Beim Vergleich der Istkosten und der Verrechnungskosten wird die Gesamtabweichung GA bestimmt: GA = K Ist K verr Ist GA>0 so spricht man von einer Unterdeckung, bei GA<0 von einer Überdeckung. 56
56 Plankostenrechnung Verbrauchs- und Beschäftigungsabweichung (1/2) Die Gesamtabweichung lässt sich in zwei Teile aufspalten Verbrauchs- und Beschäftigungsabweichung BA. GA = VA + BA sodass BA = GA VA = K Ist K verr K Ist K Soll = K Soll K verr 57
57 Plankostenrechnung Verbrauchs- und Beschäftigungsabweichung (2/2) BA = K Soll K verr = k v Plan X Ist + K f Plan k verr X Ist = k v Plan k verr X Ist + K f Plan = k v Plan k v Plan k f Plan X Ist + K f Plan = K f Plan k f Plan X Ist Nutzkosten Leerkosten Die Nutzkosten sind die aliquoten Fixkosten, welcher mit der Istleistung genutzt werden. Sie werden vom gesamten Fixkostenblock K f abgezogen, woraus sie die nicht genutzten Kosten ergeben, welche als Leerkosten bezeichnet werden. 58
58 Plankostenrechnung Ermittlung und Analyse der Gesamt- und Beschäftigungsabweichung (1/3) Exemplarische Darstellung anhand der kalibrierten HK-Verrechnungskosten-Funktion: K verr Ist HK X F = k verr HK X Ist Ist F = 2,7780 X F mit k verr HK = K M,F Plan + K Plan P,F + K Plan vg,fm X F Plan = Plan + K f,fm = 2,7780 =! K Ist M,F + K Ist Ist P,F + K vg,fm X F Ist Ist + K f,fm 59
59 Kostenkategorie KOST Ist-Kosten K Ist Ist-Beschäftigung X Ist Soll-Kosten K Soll Verbauchsabweichung = VA = K Ist - K Soll verrechnete Plankosten K verr (= VK) Beschäftigungsabweichg. = BA = K Soll - K verr GA = VA + BA = K Ist - K verr Plankostenrechnung Ermittlung und Analyse der Gesamt- und Beschäftigungsabweichung (2/3) k bzw. Kf Plan-EKS/-GKS bzw. Plan- Fixkosten der Kostenfunktion BA HK = K Soll HK K verr HK = k Plan vhk X Ist F + K Plan f,fm k verr Ist HK X F = 2, , = 901 GA HK = VA HK + BA HK = = TK v.hk k vhk 2, K f,fm Fixkosten FM k f,fm 0,5791 VK HK k HK 2,
60 Ist-, Plan-, Sollkosten Plankostenrechnung Ermittlung und Analyse der Gesamt- und Beschäftigungsabweichung (3/3) Kosten-Planung u. Kontrolle Verbrauchsabweichung Plan-K. Ist-K Beschäftigungsabweichung Gesamtabweichung Soll-K Beschäftigung (Ausbringung) Gesamtabweichung: Differenz zwischen den Istkosten und den Verrechnungskosten welche auf der Verrechnungskosten-Funktion liegen; Verbrauchsabweichung: Differenz zwischen den Istkosten und den Sollkosten; Beschäftigungsabweichung: Differenz zwischen den Sollkosten und den Verrechnungskosten 61
61 v.gk EK Kostenkategorie KOST Plan-EKS/-GKS bzw. Plan- Fixkosten der Kostenfunktio n k bzw. Kf Ist-Kosten K Ist Ist-Beschäftigung X Ist Soll-Kosten K Soll Verbauchsabweichung = VA = K Ist - K Soll verrechnete Plankosten K verr (= VK) Beschäftigungsabweichg. = BA = K Soll - K verr GA = VA + BA = K Ist - K verr Plankostenrechnung Negative Beschäftigungsabweichung Negative Leerkosten: aufgrund der über die Planleistung hinausgehenden Istleistung MAT-EK Fert. k M,F 1, PERS-EK Fert. k P,F 0, MP-EK k MP,F 1, v.fert-gk Fert. k v G,F 0, v.mat-gk Mat. k v G,M 0, TK v.hk k v HK 2, Fixkosten FM K f,fm k f,fm 0,5791 VK HK k HK 2,
62 Agenda Ökonomische Begriffe und Konzepte Klassische Kostenrechnung: Kostenartenrechnung Klassische Kostenrechnung: Kostenstellenrechnung Klassische Kostenrechnung: Kostenträgerrechnung Prozessorientierte Kostenrechnung Prozesskostenrechnung Plankostenrechnung Literatur 63
63 Literatur Enterprise Control System Integration-Standard [ECSI08-1] (IEC :2003; German version EN :2008): Integration von Unternehmens-EDV und Leitsystemen Teil 1: Modelle und Terminologie Ewert R./Wagenhofer A. [EwWa03]: Interne Unternehmensrechnung, 5. Auflage, Springer, Berlin et al Garrison R./Noreen E. [GaNo00]: Managerial Accouting, 9 th Edition, Irwin McGraw-Hill, Boston et al., 2000 Haberstock L. [Habe08a]: Kostenrechnung I Einführung, 13., neu bearbeitete Auflage (bearbeitet von Volker Breithecker), Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2008 Haberstock L. [Habe08b]: Kostenrechnung II - (Grenz-)Plankostenrechnung mit Fragen, Aufgaben und Lösungen, 10., neu bearbeitete Auflage (bearbeitet von Volker Breithecker), Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2008 Hoitsch H.J./Lingnau V. [HoLi07]: Kosten- und Erlösrechnung - Eine controllingorientierte Einführung, 6. Auflage, Springer, Berlin/Heidelberg, 2007 Horsch J. [Horsch10]: Kostenrechnung Klassische und neue Methoden in der Unternehmenspraxis, Gabler, Wiesbaden, 2010 Horváth P. [Horv02]: Controlling, 8. Auflage, Vahlen Verlag, München,
64 Literatur Internationale Group of Controlling (Hrsg.) [IGoC05]: Controller-Wörterbuch: Die zentralen Begriffe der Controllerarbeit mit ausführlichen Erläuterungen Deutsch- Englisch/Englisch-Deutsch, 3. Überarbeitete und erweiterte Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 2005 Kilger W./Pampel J./Vikas K. [KPVi07]: Flexible Plankostenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung, Gabler Verlag, 12. Auflage, Wiesbaden, 2007 Kistner K.-P., Steven M. [KiSt94]: Betriebswirtschaftslehre im Grundstudium, 1 Produktion, Absatz, Finanzierung, Physica Verlag, Heidelberg, 1994 McCarthy W. [McCa82]: The REA Accounting Model A Generalized Framework for Accounting Systems in a Shared Data Environment, The Accounting Review, Vol. LVII, No. 3, July, 1082, S Schweitzer M./Küpper H.-U. [ScKü08]: Systeme der Kosten- und Erlösrechnung, 9. Auflage, Vahlen, München, 2008 Unified Modeling Language [UML07]: Superstructure, Version 2.1.1, , 65
Lösung Handout zu Aufgabenblatt 03: Kosten- und Erlösrechnung
 Lösung Handout zu Aufgabenblatt 03: Kosten- und Erlösrechnung Aufgabe 3.1 zu a) und b): BAB der Spindel GmbH Werkstatt Lager Dreherei Fräserei Vertrieb Gesamt Fix Var. Gesamt Fix Var. Gesamt Fix Var. Gesamt
Lösung Handout zu Aufgabenblatt 03: Kosten- und Erlösrechnung Aufgabe 3.1 zu a) und b): BAB der Spindel GmbH Werkstatt Lager Dreherei Fräserei Vertrieb Gesamt Fix Var. Gesamt Fix Var. Gesamt Fix Var. Gesamt
Kosten- und Leistungsrechnung
 1 Skontrationsmethode: Summe der Entnahmen lt. MES Kosten- und Leistungsrechnung Inventurmethode: Verbrauch = Anfangsbestand + Zugänge Endbestand Durchschnittspreisverfahren: AB + Zugang (in ) = /kg AB
1 Skontrationsmethode: Summe der Entnahmen lt. MES Kosten- und Leistungsrechnung Inventurmethode: Verbrauch = Anfangsbestand + Zugänge Endbestand Durchschnittspreisverfahren: AB + Zugang (in ) = /kg AB
Plankostenrechnung mit der Variatormethode
 PROF. DR. HEINZ LOTHAR GROB DIPL.-WIRT. INFORM. SASCHA AUSTRUP LEHRSTUHL FÜR WIRTSCHAFTSINFORMATI UND CONTROLLING WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT MÜNSTER Plankostenrechnung mit der Variatormethode Gut
PROF. DR. HEINZ LOTHAR GROB DIPL.-WIRT. INFORM. SASCHA AUSTRUP LEHRSTUHL FÜR WIRTSCHAFTSINFORMATI UND CONTROLLING WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT MÜNSTER Plankostenrechnung mit der Variatormethode Gut
Flexible Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis
 Hausarbeit Flexible Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis angefertigt im Fach Rechnungswesen WF 63 / Herr Hagel erstellt von Felix Winters vorgelegt am 06.05.2008 1 Gliederung 1. Plankostenrechnung 1.1
Hausarbeit Flexible Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis angefertigt im Fach Rechnungswesen WF 63 / Herr Hagel erstellt von Felix Winters vorgelegt am 06.05.2008 1 Gliederung 1. Plankostenrechnung 1.1
Inhaltsverzeichnis Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung...1 Grundbegriffe und Grundüberlegungen in der Kosten- und Leistungsrechnung...
 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung...1 1.1 Einordnung der Kosten- und Leistungsrechnung...1 1.2 Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung...2 1.3 Aufgaben einer entscheidungsorientierten
Inhaltsverzeichnis 1 Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung...1 1.1 Einordnung der Kosten- und Leistungsrechnung...1 1.2 Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung...2 1.3 Aufgaben einer entscheidungsorientierten
Flexible Plankostenrechnung. Ermittlung der Ist-Daten. Kostenkontrolle
 2.1 Plankostenrechnung Systeme der Kostenrechnung nach Zeitbezug nach Umfang der Kostenverrechnung Systeme der Plankostenrechnung Starre Plankostenrechnung Flexible Plankostenrechnung Flexible Plankostenrechnung
2.1 Plankostenrechnung Systeme der Kostenrechnung nach Zeitbezug nach Umfang der Kostenverrechnung Systeme der Plankostenrechnung Starre Plankostenrechnung Flexible Plankostenrechnung Flexible Plankostenrechnung
Internes Rechnungswesen Tutorium
 Internes Rechnungswesen Tutorium Kontakt Dennis Pilarczyk Carolin Beck Dienstags: Mittwochs: 16:15Uhr-17:45Uhr 08:30Uhr-10:00Uhr Raum3.4.002 Raum 5.2.001 dennis.pilarczyk@study.hs-duesseldorf.de carolin.beck@study.hs-duesseldorf.de
Internes Rechnungswesen Tutorium Kontakt Dennis Pilarczyk Carolin Beck Dienstags: Mittwochs: 16:15Uhr-17:45Uhr 08:30Uhr-10:00Uhr Raum3.4.002 Raum 5.2.001 dennis.pilarczyk@study.hs-duesseldorf.de carolin.beck@study.hs-duesseldorf.de
Vordiplom Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre (Kostenrechnung und Controlling) 02. August 2004
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Professor Dr. rer. pol. Wolfgang Becker Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre UnternehmensFührung&Controlling Vordiplom Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre (Kostenrechnung
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Professor Dr. rer. pol. Wolfgang Becker Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre UnternehmensFührung&Controlling Vordiplom Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre (Kostenrechnung
Prüfung. Aktivitätsanalyse und Kostenbewertung (11018) für FWW
 Prüfung Aktivitätsanalyse und Kostenbewertung (11018) für FWW Prüfer: Prof. Dr. Luhmer Winter 2010/2011 Hinweise: Die Prüfung umfasst 9 Aufgaben, die alle zu bearbeiten sind. Die Bearbeitungszeit beträgt
Prüfung Aktivitätsanalyse und Kostenbewertung (11018) für FWW Prüfer: Prof. Dr. Luhmer Winter 2010/2011 Hinweise: Die Prüfung umfasst 9 Aufgaben, die alle zu bearbeiten sind. Die Bearbeitungszeit beträgt
Planung ausgewählter Gemeinkostenarten
 Kostenplanung Planung ausgewählter Gemeinkostenarten Planung ausgewählter Gemeinkostenarten Die Planung der Gemeinkosten bezieht sich auf die Kosten für Personal Hilfs- und Betriebsstoffe Werkzeuge Abschreibungen
Kostenplanung Planung ausgewählter Gemeinkostenarten Planung ausgewählter Gemeinkostenarten Die Planung der Gemeinkosten bezieht sich auf die Kosten für Personal Hilfs- und Betriebsstoffe Werkzeuge Abschreibungen
Vordiplom Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre (Kostenrechnung und Controlling) 07. August 2006
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Univ.- Professor Dr. Wolfgang Becker Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre UnternehmensFührung&Controlling Wissen schafft Wert! Vordiplom Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Univ.- Professor Dr. Wolfgang Becker Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre UnternehmensFührung&Controlling Wissen schafft Wert! Vordiplom Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre
Inhaltsverzeichnis. Kapitel A: Technologie 19
 0 Einführung 1 0.1 Gegenstand der Produktionswirtschaftslehre 1 0.2 Theorie betrieblicher Wertschöpfung und Produktionsmanagementlehre 6 0.3 Aufgabe und Struktur der Theorie betrieblicher Wertschöpfung
0 Einführung 1 0.1 Gegenstand der Produktionswirtschaftslehre 1 0.2 Theorie betrieblicher Wertschöpfung und Produktionsmanagementlehre 6 0.3 Aufgabe und Struktur der Theorie betrieblicher Wertschöpfung
Kosten- und Erlösrechnung (Nebenfach) Sommersemester 2013
 Kosten- und Erlösrechnung (Nebenfach) Sommersemester 2013 Mitschrift der Vorlesung vom 17.04.2013 Dr. Markus Brunner Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre Controlling Technische Universität München Literaturempfehlungen
Kosten- und Erlösrechnung (Nebenfach) Sommersemester 2013 Mitschrift der Vorlesung vom 17.04.2013 Dr. Markus Brunner Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre Controlling Technische Universität München Literaturempfehlungen
Vorwort Inhaltsverzeichnis AbkÅrzungsverzeichnis
 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Inhaltsverzeichnis AbkÅrzungsverzeichnis Seiten V VII XIII Teil A: Aufgaben I. Grundlagen 1 65 141 1. Erstellen der Ergebnistabelle, AbstimmungsmÇglichkeiten, Beurteilung der
INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Inhaltsverzeichnis AbkÅrzungsverzeichnis Seiten V VII XIII Teil A: Aufgaben I. Grundlagen 1 65 141 1. Erstellen der Ergebnistabelle, AbstimmungsmÇglichkeiten, Beurteilung der
Kosten- und Leistungsrechnung
 Kosten- und Leistungsrechnung Kostenrechnung Kostenartenrechnung welche Erfassung und Klassifizierung aller entstehenden Werteverzehre. Kostenstellenrechnung wo Zurechnung der Kosten auf den Ort Ihrer
Kosten- und Leistungsrechnung Kostenrechnung Kostenartenrechnung welche Erfassung und Klassifizierung aller entstehenden Werteverzehre. Kostenstellenrechnung wo Zurechnung der Kosten auf den Ort Ihrer
Lösung der Aufgaben aus dem Kurs Grundbegriffe und Systeme der KLR in der Modulabschlussklausur: Internes Rechnungswesen und funktionale Steuerung
 Lösung der Aufgaben aus dem Kurs Grundbegriffe und Systeme der KLR in der Modulabschlussklausur: Internes Rechnungswesen und funktionale Steuerung Klausurkolloquium zur Modulabschlussklausur SS 2015 Hagen,
Lösung der Aufgaben aus dem Kurs Grundbegriffe und Systeme der KLR in der Modulabschlussklausur: Internes Rechnungswesen und funktionale Steuerung Klausurkolloquium zur Modulabschlussklausur SS 2015 Hagen,
Vordiplom Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre (Kostenrechnung und Controlling) 20. Februar 2006
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Univ.- Professor Dr. Wolfgang Becker Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre UnternehmensFührung&Controlling Wissen schafft Wert! Vordiplom Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Univ.- Professor Dr. Wolfgang Becker Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre UnternehmensFührung&Controlling Wissen schafft Wert! Vordiplom Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre
= 15 USD/Std. Beschäftigungsabweichung = Sollkosten der Istbeschäftigung verrechnete Plankosten bei Istbeschäftigung
 FS 28 1. Basisplanstückkosten = 15. 000 USD 1. 000 Stunden = 15 USD/Std. Istkosten = 14.500 USD Verrechnete Plankosten bei Istbeschäftigung = 15 USD/Std. * 800 Std. = 1000 USD Sollkosten der Istbeschäftigung
FS 28 1. Basisplanstückkosten = 15. 000 USD 1. 000 Stunden = 15 USD/Std. Istkosten = 14.500 USD Verrechnete Plankosten bei Istbeschäftigung = 15 USD/Std. * 800 Std. = 1000 USD Sollkosten der Istbeschäftigung
Industrie 4.0 Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung grundlegend
 Industrie 4.0 Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung grundlegend Flexibilisierung durch digitale und agile Produktionsnetzwerke Awraam Zapounidis / awraam.zapounidis@ge.com / +49 172 27 64 833 GE Intelligent
Industrie 4.0 Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung grundlegend Flexibilisierung durch digitale und agile Produktionsnetzwerke Awraam Zapounidis / awraam.zapounidis@ge.com / +49 172 27 64 833 GE Intelligent
Sustainability Balanced Scorecard as a Framework for Eco-Efficiency Analysis
 Sustainability Balanced Scorecard as a Framework for Eco-Efficiency Analysis Andreas Möller amoeller@uni-lueneburg.de umweltinformatik.uni-lueneburg.de Stefan Schaltegger schaltegger@uni-lueneburgde www.uni-lueneburg.de/csm
Sustainability Balanced Scorecard as a Framework for Eco-Efficiency Analysis Andreas Möller amoeller@uni-lueneburg.de umweltinformatik.uni-lueneburg.de Stefan Schaltegger schaltegger@uni-lueneburgde www.uni-lueneburg.de/csm
Plankostenrechnung Grundlagen
 der Die ist ein Verfahren der Kosten- und Leistungsrechnung. In diesem Verfahren werden für Kosten und Leistungen zukunftsbezogene Daten ermittelt (Plandaten). Die als Instrument des Controllings dient
der Die ist ein Verfahren der Kosten- und Leistungsrechnung. In diesem Verfahren werden für Kosten und Leistungen zukunftsbezogene Daten ermittelt (Plandaten). Die als Instrument des Controllings dient
Produktionswirtschaft
 Produktionswirtschaft Eine Einführung mit Anwendungen und Kontrollfragen von Univ.-Prof. Dr. Egon Jehle, Dortmund unter Mitwirkung von Dipl.-Kfm. Dr. Klaus Müller, Mühlacker und Dipl.-Kfm. Dr. Horst Michael,
Produktionswirtschaft Eine Einführung mit Anwendungen und Kontrollfragen von Univ.-Prof. Dr. Egon Jehle, Dortmund unter Mitwirkung von Dipl.-Kfm. Dr. Klaus Müller, Mühlacker und Dipl.-Kfm. Dr. Horst Michael,
Internes Rechnungswesen Tutorium
 Internes Rechnungswesen Tutorium Kontakt Annabelle Ritter annabelle.ritter@study.hs-duesseldorf.de Dienstag Mittwoch 14:30-16:00 08:30-10:00 R 4.E.001 R 3.3.036 Die Veranstaltungen in der KW 44 werden
Internes Rechnungswesen Tutorium Kontakt Annabelle Ritter annabelle.ritter@study.hs-duesseldorf.de Dienstag Mittwoch 14:30-16:00 08:30-10:00 R 4.E.001 R 3.3.036 Die Veranstaltungen in der KW 44 werden
Vorlesung 4: Unternehmen: Input - Blackbox - Output
 Vorlesung 4: Unternehmen: Input - Blackbox - Output Prof. Dr. Anne Neumann 25. November 2015 Prof. Dr. Anne Neumann EVWL 25. November 2015 1 / 30 Semesterablauf Vorlesung Mittwoch, 15:30-17:00 Uhr, N115
Vorlesung 4: Unternehmen: Input - Blackbox - Output Prof. Dr. Anne Neumann 25. November 2015 Prof. Dr. Anne Neumann EVWL 25. November 2015 1 / 30 Semesterablauf Vorlesung Mittwoch, 15:30-17:00 Uhr, N115
7,43 4,75 700 357,33. Ab einer Menge von 358 Stück wird Gewinn erwirtschaftet, da hier neben den variablen auch die fixen Kosten gedeckt sind.
 Übung 1 einstufige Divisionskalkulation anwendbar in Einproduktunternehmen ohne Lagerhaltung a) durchschnittl. SK/Stück 5201 700 7,43 b) Bei Vorliegen von fixen Kosten können die errechneten Durchschnittskosten
Übung 1 einstufige Divisionskalkulation anwendbar in Einproduktunternehmen ohne Lagerhaltung a) durchschnittl. SK/Stück 5201 700 7,43 b) Bei Vorliegen von fixen Kosten können die errechneten Durchschnittskosten
Financial Reporting LEX Dozentin: Corinne Bächli,
 LionsExchange Mid-Term-Repetitorium Financial Reporting LEX Dozentin: Corinne Bächli, corinne.baechli@uzh.ch Seite 1 Mid-Term Repetitorien (FS16) In den kommenden Wochen finden folgende Repetitorien statt:
LionsExchange Mid-Term-Repetitorium Financial Reporting LEX Dozentin: Corinne Bächli, corinne.baechli@uzh.ch Seite 1 Mid-Term Repetitorien (FS16) In den kommenden Wochen finden folgende Repetitorien statt:
Lösung, Beispiel: Plankostenrechnung und Maschinenstundensatz (eventuelle Fehler inbegriffen)
 Übung Plankostenrechnung mit sätzen Seite 1 Lösung, Beispiel: Plankostenrechnung und satz (eventuelle Fehler inbegriffen) Teilaufgabe 1) Berechnung des satzes Kostenart Formel Gesamtbetrag Kalkulatorische
Übung Plankostenrechnung mit sätzen Seite 1 Lösung, Beispiel: Plankostenrechnung und satz (eventuelle Fehler inbegriffen) Teilaufgabe 1) Berechnung des satzes Kostenart Formel Gesamtbetrag Kalkulatorische
SAP Flexible Plankostenrechnung
 SAP Flexible Plankostenrechnung Nice-To-Know Stand: Juli 2015 Inhalt Ausgangssituation Auswirkungen / Vorteile Werteflüsse Vorgehensmodell Seite 3 Seite 5 Seite 8 Seite 11 2 3 Ausgangssituation Ausgangslage
SAP Flexible Plankostenrechnung Nice-To-Know Stand: Juli 2015 Inhalt Ausgangssituation Auswirkungen / Vorteile Werteflüsse Vorgehensmodell Seite 3 Seite 5 Seite 8 Seite 11 2 3 Ausgangssituation Ausgangslage
Inhaltsverzeichnis Teil I Grundlagen 1 Logistik als Objekt der Kostenrechnung
 Teil I Grundlagen 1 Logistik als Objekt der Kostenrechnung........................ 3 1.1 Einführung............................................. 3 1.2 Logistik als funktionale Spezialisierung......................
Teil I Grundlagen 1 Logistik als Objekt der Kostenrechnung........................ 3 1.1 Einführung............................................. 3 1.2 Logistik als funktionale Spezialisierung......................
Bisher: Vollkostenrechnung; sie erfasst alle Kostenarten periodengerecht und weist sie den einzelnen Kostenträger verursachungsgerecht zu.
 1 REWE ÜBUNG 12 REWE II Inhalte: Optimales Produktionsprogramm, Deckungsbeitragsrechnung, Plankostenrechnung 1. Deckungsbeitragsrechnung Bisher: Vollkostenrechnung; sie erfasst alle Kostenarten periodengerecht
1 REWE ÜBUNG 12 REWE II Inhalte: Optimales Produktionsprogramm, Deckungsbeitragsrechnung, Plankostenrechnung 1. Deckungsbeitragsrechnung Bisher: Vollkostenrechnung; sie erfasst alle Kostenarten periodengerecht
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre Dipl. Betriebswirtin (FH) Nicole Kalina-Klensch www.fh-kl.de 21.10.2011 Überblick Produktionsfaktoren Volkswirtschaftliche PF Betriebswirtschaftliche PF Ökonomisches
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre Dipl. Betriebswirtin (FH) Nicole Kalina-Klensch www.fh-kl.de 21.10.2011 Überblick Produktionsfaktoren Volkswirtschaftliche PF Betriebswirtschaftliche PF Ökonomisches
Kosten-Leistungsrechnung Plankostenrechnung, Seite 1
 Plankostenrechnung, Seite 1 Um was geht s? Bei der Plankostenrechnung geht es darum, herauszufinden, welche Ursachen für Abweichungen zwischen den anfänglich geplanten und den erst später feststellbaren
Plankostenrechnung, Seite 1 Um was geht s? Bei der Plankostenrechnung geht es darum, herauszufinden, welche Ursachen für Abweichungen zwischen den anfänglich geplanten und den erst später feststellbaren
Übungsaufgaben zur Vorlesung BWL A Produktion:
 Betriebswirtschaftslehre, insbes. Produktionswirtschaft Prof. Dr. Stefan Betz Übungsaufgaben zur Vorlesung BWL A Produktion: Aufgabe 1 Definieren Sie die folgenden Begriffe, und grenzen Sie diese voneinander
Betriebswirtschaftslehre, insbes. Produktionswirtschaft Prof. Dr. Stefan Betz Übungsaufgaben zur Vorlesung BWL A Produktion: Aufgabe 1 Definieren Sie die folgenden Begriffe, und grenzen Sie diese voneinander
1 Grundlagen der Kosten- & Leistungsrechnung
 Seite 1/7 1 Grundlagen der Kosten- & Leistungsrechnung Aufgabe 1 Erläutere den Unterschied zwischen Auszahlungen, Ausgaben, Aufwendungen und Kosten. Aufgabe 2 Ordne die folgenden Geschäftsvorfälle eines
Seite 1/7 1 Grundlagen der Kosten- & Leistungsrechnung Aufgabe 1 Erläutere den Unterschied zwischen Auszahlungen, Ausgaben, Aufwendungen und Kosten. Aufgabe 2 Ordne die folgenden Geschäftsvorfälle eines
Kosten- und Leistungsrechnung. Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling Prof. Dr. Karl Stoffel Sommersemester 2009
 Kosten- und Leistungsrechnung Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling Prof. Dr. Karl Stoffel Sommersemester 2009 Verrechnungspreis-/Kostenträgerverfahren Einer Instandhaltungskostenstelle werden
Kosten- und Leistungsrechnung Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling Prof. Dr. Karl Stoffel Sommersemester 2009 Verrechnungspreis-/Kostenträgerverfahren Einer Instandhaltungskostenstelle werden
Kostenrechnung Kostenartenrechnung
 Methoden zur Entscheidungsfindung Grundlagen neue Systeme Funktionen Plankostenrechnung Produktionsprogrammplanung Kostenrechnung Kostenartenrechnung Gliederung von Kostenarten Erfassung von Kostenarten
Methoden zur Entscheidungsfindung Grundlagen neue Systeme Funktionen Plankostenrechnung Produktionsprogrammplanung Kostenrechnung Kostenartenrechnung Gliederung von Kostenarten Erfassung von Kostenarten
Kosten- und Leistungsrechnung
 Kosten- und Leistungsrechnung Plankostenrechnung Kosten- und Leistungsrechnung Systeme der Kosten-und Leistungsrechnung Kriterien: vergangenheitsorientiert zukunftsorientiert Zeitbezug Sachumfang Ist-Kosten
Kosten- und Leistungsrechnung Plankostenrechnung Kosten- und Leistungsrechnung Systeme der Kosten-und Leistungsrechnung Kriterien: vergangenheitsorientiert zukunftsorientiert Zeitbezug Sachumfang Ist-Kosten
Wirtschaftlichkeitsrechnung (SS 2009)
 Wirtschaftlichkeitsrechnung (SS 2009) Systeme der Kostenrechnung (2009-07-15) Veranstaltungskonzept KAR & KStR Buchführung + Inhalte des GB Statische Verfahren Systeme der Kostenrechnung GuV und Abschreibungen
Wirtschaftlichkeitsrechnung (SS 2009) Systeme der Kostenrechnung (2009-07-15) Veranstaltungskonzept KAR & KStR Buchführung + Inhalte des GB Statische Verfahren Systeme der Kostenrechnung GuV und Abschreibungen
Neoklassische Produktions- und Kostenfunktion Mathematische Beschreibung zu einer Modellabbildung mit Excel
 Neoklassische Produktions- und Kostenfunktion Mathematische Beschreibung zu einer Modellabbildung mit Excel Dieses Skript ist die allgemeine Basis eines Modells zur Simulation der ökonomischen Folgen technischer
Neoklassische Produktions- und Kostenfunktion Mathematische Beschreibung zu einer Modellabbildung mit Excel Dieses Skript ist die allgemeine Basis eines Modells zur Simulation der ökonomischen Folgen technischer
Kostenrechnung. Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft FRIEDRICH KIEHL VERLAG GMBH LUDWIGSHAFEN (RHEIN)
 Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft Herausgeber: Prof. DipL-Kfm. Klaus Olfert Kostenrechnung von Prof. Dipl.-Kfm. Klaus Olfert 7., durchgesehene Auflage FRIEDRICH KIEHL VERLAG GMBH LUDWIGSHAFEN
Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft Herausgeber: Prof. DipL-Kfm. Klaus Olfert Kostenrechnung von Prof. Dipl.-Kfm. Klaus Olfert 7., durchgesehene Auflage FRIEDRICH KIEHL VERLAG GMBH LUDWIGSHAFEN
Kostenträgerrechnung Kostenträgerzeitrechnung und Kostenträgerstückrechnung
 G Kosten- und Leistungsrechnung Kostenträgerrechnung Kostenträgerzeitrechnung und Kostenträgerstückrechnung Aufgabe 74 Welche der Definition(en) passt (passen) auf den Begriff Kostenträger? a) Anlagen
G Kosten- und Leistungsrechnung Kostenträgerrechnung Kostenträgerzeitrechnung und Kostenträgerstückrechnung Aufgabe 74 Welche der Definition(en) passt (passen) auf den Begriff Kostenträger? a) Anlagen
Vordiplom Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre (Kostenrechnung und Controlling) 25. Februar 2004
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Professor Dr. rer. pol. Wolfgang Becker Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre UnternehmensFührung&Controlling Vordiplom Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre (Kostenrechnung
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Professor Dr. rer. pol. Wolfgang Becker Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre UnternehmensFührung&Controlling Vordiplom Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre (Kostenrechnung
Aufgaben und Fälle zur Kostenrechnung
 Aufgaben und Fälle zur Kostenrechnung von Professorin Dr. Christa Drees-Behrens und / Professor Dr. Andreas Schmidt 3., korrigierte Auflage Oldenbourg Verlag München IX 1. Einführung und Grundlagen 1.1.
Aufgaben und Fälle zur Kostenrechnung von Professorin Dr. Christa Drees-Behrens und / Professor Dr. Andreas Schmidt 3., korrigierte Auflage Oldenbourg Verlag München IX 1. Einführung und Grundlagen 1.1.
Cockpits und Standardreporting mit Infor PM 10 09.30 10.15 Uhr
 Cockpits und Standardreporting mit Infor PM 10 09.30 10.15 Uhr Bernhard Rummich Presales Manager PM Schalten Sie bitte während der Präsentation die Mikrofone Ihrer Telefone aus, um störende Nebengeräusche
Cockpits und Standardreporting mit Infor PM 10 09.30 10.15 Uhr Bernhard Rummich Presales Manager PM Schalten Sie bitte während der Präsentation die Mikrofone Ihrer Telefone aus, um störende Nebengeräusche
Beispiel eines Kostenplans einer Vertriebskostenstelle
 Kostenplanung Planung der Gemeinkosten Beispiel eines Kostenplans einer Vertriebskostenstelle Schweitzer / Küpper: S.423 Beispiel: Verrechnungssatzplanung einer Vertriebskostenstelle Homogene Kostenverursachung
Kostenplanung Planung der Gemeinkosten Beispiel eines Kostenplans einer Vertriebskostenstelle Schweitzer / Küpper: S.423 Beispiel: Verrechnungssatzplanung einer Vertriebskostenstelle Homogene Kostenverursachung
Internes Rechnungswesen
 Internes Rechnungswesen Wintersemester 2016/2017 Vorlesung Professor Dr. Louis Velthuis Lehrstuhl für Controlling Johannes Gutenberg-Universität Mainz Passwortschutz des Downloadcenters Der Benutzername
Internes Rechnungswesen Wintersemester 2016/2017 Vorlesung Professor Dr. Louis Velthuis Lehrstuhl für Controlling Johannes Gutenberg-Universität Mainz Passwortschutz des Downloadcenters Der Benutzername
Kosten- und Erlösrechnung (Nebenfach) Sommersemester 2012
 Kosten- und Erlösrechnung (Nebenfach) Sommersemester 2012 Dr. Markus Brunner Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre Controlling Technische Universität München Mitschrift der Vorlesung vom 27.06.2012 Auf
Kosten- und Erlösrechnung (Nebenfach) Sommersemester 2012 Dr. Markus Brunner Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre Controlling Technische Universität München Mitschrift der Vorlesung vom 27.06.2012 Auf
Übung Kostenrechnung SS 2014
 SS 2014 Übung 2 Kostenartenrechnung / Kostenstellenrechnung ! Anlagekosten: Kalkulatorische Zinsen! Neben den Abschreibungen stellen Zinskosten die zweite wichtige Kostenart von Anlagekosten dar! Zinskosten
SS 2014 Übung 2 Kostenartenrechnung / Kostenstellenrechnung ! Anlagekosten: Kalkulatorische Zinsen! Neben den Abschreibungen stellen Zinskosten die zweite wichtige Kostenart von Anlagekosten dar! Zinskosten
Deckungsbeitragsrechnung (DBR)
 Deckungsbeitragsrechnung (DBR) Unterschied zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung Ein in Aussicht gestellter Kundenauftrag für Produkt P mit einem Preislimit von 35.000,00 soll durch die Betriebsbuchhaltung
Deckungsbeitragsrechnung (DBR) Unterschied zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung Ein in Aussicht gestellter Kundenauftrag für Produkt P mit einem Preislimit von 35.000,00 soll durch die Betriebsbuchhaltung
Übungsbuch zur Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
 Übungsbuch zur Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre von Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Günter Wöhe t Univ.-Prof. Dr. Ulrich Döring Univ.-Prof. Dr. Gerrit Brösel 15., überarbeitete und
Übungsbuch zur Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre von Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Günter Wöhe t Univ.-Prof. Dr. Ulrich Döring Univ.-Prof. Dr. Gerrit Brösel 15., überarbeitete und
Jahresverzeichnis PDF
 Verlag Jahresverzeichnis/ VolumeList Jahresverzeichnis PDF Bibliothek (Hardcopy) von bis von bis von bis Betriebswirt (Der Betriebswirt) Deutscher Betriebswirte Verlag 2006 2013 2000 2013 Controlling Beck
Verlag Jahresverzeichnis/ VolumeList Jahresverzeichnis PDF Bibliothek (Hardcopy) von bis von bis von bis Betriebswirt (Der Betriebswirt) Deutscher Betriebswirte Verlag 2006 2013 2000 2013 Controlling Beck
3 Gliederungsmöglichkeiten von Kostenarten
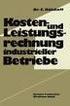 1 von 5 04.10.2010 14:21 Hinweis: Diese Druckversion der Lerneinheit stellt aufgrund der Beschaffenheit des Mediums eine im Funktionsumfang stark eingeschränkte Variante des Lernmaterials dar. Um alle
1 von 5 04.10.2010 14:21 Hinweis: Diese Druckversion der Lerneinheit stellt aufgrund der Beschaffenheit des Mediums eine im Funktionsumfang stark eingeschränkte Variante des Lernmaterials dar. Um alle
Aufgabenblatt 4: Erlösrechnung
 MANAGERIAL ACCOUNTING WS 10/11 Aufgabenblatt 4: Erlösrechnung Aufgabe 4.1: Formen der Periodenerfolgsrechnung Grundsätzlich zwei Hauptkategorien: 1. (Kalkulatorische) Stückerfolgsrechnung: Einfache Subtraktion
MANAGERIAL ACCOUNTING WS 10/11 Aufgabenblatt 4: Erlösrechnung Aufgabe 4.1: Formen der Periodenerfolgsrechnung Grundsätzlich zwei Hauptkategorien: 1. (Kalkulatorische) Stückerfolgsrechnung: Einfache Subtraktion
PROMIDIS Fallstudien Produktivitätsmessung / Datenanalysen Softwaretechnische Umsetzung
 PROMIDIS Fallstudien Produktivitätsmessung / Datenanalysen Softwaretechnische Umsetzung Dr. Peter Weiß für Universität Hamburg 11. April 2014 1 Übersicht Fallstudien Softwaretechnische Umsetzung Productivity
PROMIDIS Fallstudien Produktivitätsmessung / Datenanalysen Softwaretechnische Umsetzung Dr. Peter Weiß für Universität Hamburg 11. April 2014 1 Übersicht Fallstudien Softwaretechnische Umsetzung Productivity
Fixe und variable Kosten
 Fie und variable osten = Outputmenge = Gesamtkosten f = Fikosten v = variable ( Ausbringungsmenge, Pr oduktionsmenge) osten k = Stückkosten ( Durchschnittskosten) k f = fiestückkosten k v = variabke =
Fie und variable osten = Outputmenge = Gesamtkosten f = Fikosten v = variable ( Ausbringungsmenge, Pr oduktionsmenge) osten k = Stückkosten ( Durchschnittskosten) k f = fiestückkosten k v = variabke =
RW 2-2: Kosten- und Leistungsrechnung im Industriebetrieb (1)
 Rechnungswesen RW 2-2: Kosten- und Leistungsrechnung im Industriebetrieb (1) Petra Grabowski Steuerberaterin & Diplom-Betriebswirtin (FH) Hagdornstr. 8, 40721 Hilden Tel.: (0 21 03) 911 331 Fax: (0 21
Rechnungswesen RW 2-2: Kosten- und Leistungsrechnung im Industriebetrieb (1) Petra Grabowski Steuerberaterin & Diplom-Betriebswirtin (FH) Hagdornstr. 8, 40721 Hilden Tel.: (0 21 03) 911 331 Fax: (0 21
3. Einführung in die Kostenrechnung
 3. Einführung in die Kostenrechnung 3.1. Der Weg zur Kostenrechnung Grundsätzlich sind verschiedene Möglichkeiten zur Einführung und Gestaltung einer Kostenrechnung vorhanden. Unsere Projektarbeit dient
3. Einführung in die Kostenrechnung 3.1. Der Weg zur Kostenrechnung Grundsätzlich sind verschiedene Möglichkeiten zur Einführung und Gestaltung einer Kostenrechnung vorhanden. Unsere Projektarbeit dient
Kostenträgerrechnung
 Kapitel 4: 4.1 Teilgebiete der KLR Kostenartenrechnung Kostenstellenrechnung 4.2 Grundschema der Vollkostenrechnung Gesamtkosten in der Kostenartenrechnung Einzelkosten Gemeinkosten Kostenstellenrechnung
Kapitel 4: 4.1 Teilgebiete der KLR Kostenartenrechnung Kostenstellenrechnung 4.2 Grundschema der Vollkostenrechnung Gesamtkosten in der Kostenartenrechnung Einzelkosten Gemeinkosten Kostenstellenrechnung
Management Accounting
 Technische Universität München Management Accounting Lehrstuhl für BWL - Controlling Prof. Dr. Gunther Friedl Emails für Fragen und Anmerkungen: cornelia.hojer@tum.de Handout 10: Investitionstheoretischer
Technische Universität München Management Accounting Lehrstuhl für BWL - Controlling Prof. Dr. Gunther Friedl Emails für Fragen und Anmerkungen: cornelia.hojer@tum.de Handout 10: Investitionstheoretischer
Beispiel für ein Simulationsverfahren: Analyse eines Investitionsprojekts (2)
 3.1.4 Konzepte zur Berücksichtigung unsicherer Erwartungen Investitionsprojekts (2) 2. Festlegung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen w() für die einzelnen Einflussfaktoren A0 im Bereich w (A0) Von 200.000
3.1.4 Konzepte zur Berücksichtigung unsicherer Erwartungen Investitionsprojekts (2) 2. Festlegung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen w() für die einzelnen Einflussfaktoren A0 im Bereich w (A0) Von 200.000
Lösung 2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
 Lösung 1 a) Variable Kosten je Stuhl Rohr 3,2 m x 1,5 /m 4,80 3,7 m x 1,2 /m 4,44 9,24 Lösung 2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Kosten Mischkosten variable Kosten variabel : fix 50.000 50.000 fixe Kosten
Lösung 1 a) Variable Kosten je Stuhl Rohr 3,2 m x 1,5 /m 4,80 3,7 m x 1,2 /m 4,44 9,24 Lösung 2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Kosten Mischkosten variable Kosten variabel : fix 50.000 50.000 fixe Kosten
Übungsbuch Beschaffung, Produktion und Logistik
 Vahlens Übungsbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Übungsbuch Beschaffung, Produktion und Logistik Aufgaben, Lösungen und Implementierung in Excel von Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Ulrich Küpper,
Vahlens Übungsbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Übungsbuch Beschaffung, Produktion und Logistik Aufgaben, Lösungen und Implementierung in Excel von Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Ulrich Küpper,
Deckungsbeitragsrechnung mit Standardkosten
 Seite 1 Deckungsbeitragsrechnung mit Standardkosten Die Mobilis AG stellt für grosse Sportartikelhändler auf Bestellung zwei Produkte her: Inlineskates (kurz Skates) werden auch Rollerblades genannt. Sie
Seite 1 Deckungsbeitragsrechnung mit Standardkosten Die Mobilis AG stellt für grosse Sportartikelhändler auf Bestellung zwei Produkte her: Inlineskates (kurz Skates) werden auch Rollerblades genannt. Sie
Übungsblatt 1. a) Wie können diese drei Bereiche weiter unterteilt werden?
 INSTITUT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIONS- UND INVESTITIONSFORSCHUNG Georg-August-Universität Göttingen Abteilung für Unternehmensplanung Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Bloech Aufgabe. (Produktionsfaktorsystem)
INSTITUT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIONS- UND INVESTITIONSFORSCHUNG Georg-August-Universität Göttingen Abteilung für Unternehmensplanung Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Bloech Aufgabe. (Produktionsfaktorsystem)
Internes Rechnungswesen
 Internes Rechnungswesen Pflichtkurs Bachelor SS 06 Prof. Dr. Barbara Schöndube-Pirchegger Lehrstuhl für Unternehmensrechnung und Controlling Allgemeine Informationen Kontakt Büro: Vilfredo Pareto Gebäude
Internes Rechnungswesen Pflichtkurs Bachelor SS 06 Prof. Dr. Barbara Schöndube-Pirchegger Lehrstuhl für Unternehmensrechnung und Controlling Allgemeine Informationen Kontakt Büro: Vilfredo Pareto Gebäude
Vielfalt als Zukunft Instandhaltung
 10.02.2016, 13.00 13.30 CET Dr. Franziska Hasselmann Studienleitung CAS Managing Infrastructure Assets Maintenance Schweiz 2016 Vielfalt als Zukunft Instandhaltung Einladungstext zum Vortrag... Täglich
10.02.2016, 13.00 13.30 CET Dr. Franziska Hasselmann Studienleitung CAS Managing Infrastructure Assets Maintenance Schweiz 2016 Vielfalt als Zukunft Instandhaltung Einladungstext zum Vortrag... Täglich
1. Anwendungspotentiale der flexiblen Planung zur Bewertung von Organisationen eine kritische
 Grundlagenliteratur für die Themen 1 6: Eisenführ, F.; Weber, M.; Langer, T. (2010): Rationales Entscheiden, 5. überarb. u. erw. Aufl., Springer Verlag: Berlin [u.a.], S. 19 37. Laux, H.; Gillenkirch,
Grundlagenliteratur für die Themen 1 6: Eisenführ, F.; Weber, M.; Langer, T. (2010): Rationales Entscheiden, 5. überarb. u. erw. Aufl., Springer Verlag: Berlin [u.a.], S. 19 37. Laux, H.; Gillenkirch,
THEORIE 17. Inhaltsverzeichnis. 1. Das Wesen der Betriebsbuchhaltung. 2. Die Vollkostenrechnung 26
 Betriebsbuchhaltung THEORIE 17 1. Das Wesen der Betriebsbuchhaltung 1.1. Die Grundsätze der Betriebsbuchhaltung 1.2. Die Struktur der Betriebsbuchhaltung 21 Die Methoden der Betriebsbuchhaltung 22 Das
Betriebsbuchhaltung THEORIE 17 1. Das Wesen der Betriebsbuchhaltung 1.1. Die Grundsätze der Betriebsbuchhaltung 1.2. Die Struktur der Betriebsbuchhaltung 21 Die Methoden der Betriebsbuchhaltung 22 Das
Kosten- und Erlösrechnung (Nebenfach) Sommersemester 2012
 Kosten- und Erlösrechnung (Nebenfach) Sommersemester 2012 Dr. Markus Brunner Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre Controlling Technische Universität München Mitschrift der Vorlesung vom 16.05.2012 Primärkostenverteilung
Kosten- und Erlösrechnung (Nebenfach) Sommersemester 2012 Dr. Markus Brunner Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre Controlling Technische Universität München Mitschrift der Vorlesung vom 16.05.2012 Primärkostenverteilung
Notationen zur Prozessmodellierung
 Notationen zur Prozessmodellierung August 2014 Inhalt (erweiterte) ereignisgesteuerte Prozesskette (eepk) 3 Wertschöpfungskettendiagramm (WKD) 5 Business Process Model and Notation (BPMN) 7 Unified Modeling
Notationen zur Prozessmodellierung August 2014 Inhalt (erweiterte) ereignisgesteuerte Prozesskette (eepk) 3 Wertschöpfungskettendiagramm (WKD) 5 Business Process Model and Notation (BPMN) 7 Unified Modeling
Roadmap. Lernziele. Break-even-Punkte selbstständig berechnen und entsprechende Analysen durchführen.
 Roadmap Datum Skript Thema (Kapitel) 3.1.9 KOKA 1-3 Einführung Betriebsbuchhaltung artenrechnung 14.11.9 KOKA 4-5 stellenrechnung 11.12.9 KOKA 5 trägerrechnung 23.1.1 KOKA 6 Kalkulation 3.1.1 TK 1-3 Teilkostenrechnung,
Roadmap Datum Skript Thema (Kapitel) 3.1.9 KOKA 1-3 Einführung Betriebsbuchhaltung artenrechnung 14.11.9 KOKA 4-5 stellenrechnung 11.12.9 KOKA 5 trägerrechnung 23.1.1 KOKA 6 Kalkulation 3.1.1 TK 1-3 Teilkostenrechnung,
VO Grundlagen der Mikroökonomie
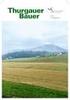 Institut für Wirtschaftsmathematik Ökonomie VO 105.620 Grundlagen der Mikroökonomie Die Kosten der Produktion (Kapitel 7) ZIEL: Die Messung von Kosten Die Kosten in der kurzen Frist Die Kosten in der langen
Institut für Wirtschaftsmathematik Ökonomie VO 105.620 Grundlagen der Mikroökonomie Die Kosten der Produktion (Kapitel 7) ZIEL: Die Messung von Kosten Die Kosten in der kurzen Frist Die Kosten in der langen
Jason T. Roff UML. IT Tutorial. Übersetzung aus dem Amerikanischen von Reinhard Engel
 Jason T. Roff UML IT Tutorial Übersetzung aus dem Amerikanischen von Reinhard Engel Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Einführung 11 Grundlagen der UML 15 Warum wir Software modellieren 16 Analyse,
Jason T. Roff UML IT Tutorial Übersetzung aus dem Amerikanischen von Reinhard Engel Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Einführung 11 Grundlagen der UML 15 Warum wir Software modellieren 16 Analyse,
Übung zu Mikroökonomik II
 Prof. Dr. G. Rübel SS 2005 Dr. H. Möller-de Beer Dipl.-Vw. E. Söbbeke Übung zu Mikroökonomik II Aufgabe 1: Eine gewinnmaximierende Unternehmung produziere ein Gut mit zwei kontinuierlich substituierbaren
Prof. Dr. G. Rübel SS 2005 Dr. H. Möller-de Beer Dipl.-Vw. E. Söbbeke Übung zu Mikroökonomik II Aufgabe 1: Eine gewinnmaximierende Unternehmung produziere ein Gut mit zwei kontinuierlich substituierbaren
Produktionsprozess. Input. Produktionsfaktoren. Kombination und Transformation. Hauptprodukt, Nebenprodukt, Abprodukt. Output
 Produktionsprozess Input Produktionsfaktoren Produktionsprozess Kombination und Transformation Output Hauptprodukt, Nebenprodukt, Abprodukt Produktionsfaktoren (BWL) Produktionsfaktoren Spezifizierte Faktoren
Produktionsprozess Input Produktionsfaktoren Produktionsprozess Kombination und Transformation Output Hauptprodukt, Nebenprodukt, Abprodukt Produktionsfaktoren (BWL) Produktionsfaktoren Spezifizierte Faktoren
IT-Beratung: Vom Geschäftsprozess zur IT-Lösung
 Ralf Heib Senior Vice-President Geschäftsleitung DACH IT-Beratung: Vom Geschäftsprozess zur IT-Lösung www.ids-scheer.com Wofür steht IDS Scheer? Wir machen unsere Kunden in ihrem Geschäft erfolgreicher.
Ralf Heib Senior Vice-President Geschäftsleitung DACH IT-Beratung: Vom Geschäftsprozess zur IT-Lösung www.ids-scheer.com Wofür steht IDS Scheer? Wir machen unsere Kunden in ihrem Geschäft erfolgreicher.
Kosten-Leistungsrechnung Rechenweg Plankostenrechnung bei Maschinenstundensätzen, Seite 1
 Rechenweg Plankostenrechnung bei sätzen, Seite 1 Zur Problemstellung Bei der Preiskalkulation mit sätzen werden alle, die durch eine Maschine verursacht sein können, zusammengetragen. Anschließend wird
Rechenweg Plankostenrechnung bei sätzen, Seite 1 Zur Problemstellung Bei der Preiskalkulation mit sätzen werden alle, die durch eine Maschine verursacht sein können, zusammengetragen. Anschließend wird
Ein Ansatz für eine Ontologie-basierte Verbindung von IT Monitoring und IT Governance
 Ein Ansatz für eine Ontologie-basierte Verbindung von IT Monitoring und IT Governance MITA 2014 23.09.2014 Andreas Textor andreas.textor@hs-rm.de Hochschule RheinMain Labor für Verteilte Systeme Fachbereich
Ein Ansatz für eine Ontologie-basierte Verbindung von IT Monitoring und IT Governance MITA 2014 23.09.2014 Andreas Textor andreas.textor@hs-rm.de Hochschule RheinMain Labor für Verteilte Systeme Fachbereich
Gliederung zu Kapitel Erfolgsrechnung
 Gliederung zu Kapitel 6 6. Erfolgsrechnung 6.1 Aufgaben der Erfolgsrechnung 6.2 Verfahren der Periodenerfolgsrechnung 6.3 Voll- und Teilkosten in der Periodenerfolgsrechnung 6.4 Deckungsbeitragsrechnung
Gliederung zu Kapitel 6 6. Erfolgsrechnung 6.1 Aufgaben der Erfolgsrechnung 6.2 Verfahren der Periodenerfolgsrechnung 6.3 Voll- und Teilkosten in der Periodenerfolgsrechnung 6.4 Deckungsbeitragsrechnung
CONTROLLING IN DER PRAXIS AM BEISPIEL VON OPEL/VAUXHALL
 CONTROLLING IN DER PRAXIS AM BEISPIEL VON OPEL/VAUXHALL 7. Dezember, 2015 Dr. Rembert Koch, Director Aftersales Finance, Opel Group GmbH www.opel.com AGENDA 2 Übersicht Opel / Vauxhall in Europa Organisation
CONTROLLING IN DER PRAXIS AM BEISPIEL VON OPEL/VAUXHALL 7. Dezember, 2015 Dr. Rembert Koch, Director Aftersales Finance, Opel Group GmbH www.opel.com AGENDA 2 Übersicht Opel / Vauxhall in Europa Organisation
Deckungsbeitragsrechnung (DBR)
 Deckungsbeitragsrechnung (DBR) Unterschied zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung Ein in Aussicht gestellter Kundenauftrag für Produkt P mit einem Preislimit von 35.000,00 soll durch die Betriebsbuchhaltung
Deckungsbeitragsrechnung (DBR) Unterschied zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung Ein in Aussicht gestellter Kundenauftrag für Produkt P mit einem Preislimit von 35.000,00 soll durch die Betriebsbuchhaltung
Fragen aus dem OnlineTED
 Fragen aus dem OnlineTED Wann führt die lineare Abschreibung dazu, dass im Zeitverlauf steigende Anteile des Restbuchwerts abgeschrieben werden? A Immer B Nie C Nur in der ersten Hälfte des Abschreibungszeitraums
Fragen aus dem OnlineTED Wann führt die lineare Abschreibung dazu, dass im Zeitverlauf steigende Anteile des Restbuchwerts abgeschrieben werden? A Immer B Nie C Nur in der ersten Hälfte des Abschreibungszeitraums
Einführung in die Wirtschaftswissenschaften für Nicht-ÖkonomInnen. Teil 3: Unternehmenstheorie
 Einführung in die Wirtschaftswissenschaften für Nicht-ÖkonomInnen Teil 3: Unternehmenstheorie Dieses Werk ist unter einem Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen
Einführung in die Wirtschaftswissenschaften für Nicht-ÖkonomInnen Teil 3: Unternehmenstheorie Dieses Werk ist unter einem Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen
Operations Management
 Operations Management Qualitätsmanagement Prof. Dr. Helmut Dietl Lernziele Nach dieser Veranstaltung sollen Sie wissen, was man unter Qualitätsmanagement versteht welche Ziele das Qualitätsmanagement verfolgt
Operations Management Qualitätsmanagement Prof. Dr. Helmut Dietl Lernziele Nach dieser Veranstaltung sollen Sie wissen, was man unter Qualitätsmanagement versteht welche Ziele das Qualitätsmanagement verfolgt
Diploma Hochschule. STUDIENGANG Betriebswirtschaft BACHELOR OF ARTS KLAUSUR IM MODUL: Kostenrechnung
 Diploma Hochschule STUDIENGANG Betriebswirtschaft BACHELOR OF ARTS KLAUSUR IM MODUL: Kostenrechnung Studienzentrum Prüfer: Bonn Petra Grabowski Datum: 28. April 2012 Bearbeitungszeit: 120 Minuten Punkte:
Diploma Hochschule STUDIENGANG Betriebswirtschaft BACHELOR OF ARTS KLAUSUR IM MODUL: Kostenrechnung Studienzentrum Prüfer: Bonn Petra Grabowski Datum: 28. April 2012 Bearbeitungszeit: 120 Minuten Punkte:
Grundlagen einer ordentlichen Preiskalkulation
 Grundlagen einer ordentlichen Preiskalkulation Grundlagen einer ordentlichen Preiskalkulation Grundlagen einer ordentlichen Preiskalkulation Verständliche Erläuterungen und praktische Hilfen Vortrag von
Grundlagen einer ordentlichen Preiskalkulation Grundlagen einer ordentlichen Preiskalkulation Grundlagen einer ordentlichen Preiskalkulation Verständliche Erläuterungen und praktische Hilfen Vortrag von
Operatives Verrechnungspreis-Management Praxisbericht einer hoch effizienten Softwarelösung
 www.pwc.de ICV Congress der Controller 2016 Themenzentrum C Operatives Verrechnungspreis-Management Praxisbericht einer hoch effizienten Softwarelösung in cooperation with Praxisbericht: Interdisziplinäre
www.pwc.de ICV Congress der Controller 2016 Themenzentrum C Operatives Verrechnungspreis-Management Praxisbericht einer hoch effizienten Softwarelösung in cooperation with Praxisbericht: Interdisziplinäre
Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen für angehende Führungskräfte
 Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen für angehende Führungskräfte M. Fehr F. Angst Building Competence. Crossing Borders. F Kosten- und Leistungsrechnung 2 1. Einführung RECHNUNGSWESEN FINANZBUCHHALTUNG
Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen für angehende Führungskräfte M. Fehr F. Angst Building Competence. Crossing Borders. F Kosten- und Leistungsrechnung 2 1. Einführung RECHNUNGSWESEN FINANZBUCHHALTUNG
1.) Teilkosten-Verfahren - Kostenspaltung 1.) Kostenauflösung oder Kostenspaltung = TRENNUNG DER VARIABLEN UND FIXEN KOSTEN Grafisch
 + Buchungen im Soll - Buchungen im Haben 1.) Teilkosten-Verfahren - Kostenspaltung 1.) Kostenauflösung oder Kostenspaltung = TRENNUNG DER VARIABLEN UND FIXEN KOSTEN Grafisch 2.) Kostenspaltung: Schärverfahren
+ Buchungen im Soll - Buchungen im Haben 1.) Teilkosten-Verfahren - Kostenspaltung 1.) Kostenauflösung oder Kostenspaltung = TRENNUNG DER VARIABLEN UND FIXEN KOSTEN Grafisch 2.) Kostenspaltung: Schärverfahren
Einführung in die Produktionswirtschaft
 Ch. Schneeweiß Einführung in die Produktionswirtschaft Dritte, revidierte Auflage Mit 67 Abbildungen Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo Inhaltsverzeichnis Kapitel 1 PRODUKTIONSYSSTEME
Ch. Schneeweiß Einführung in die Produktionswirtschaft Dritte, revidierte Auflage Mit 67 Abbildungen Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo Inhaltsverzeichnis Kapitel 1 PRODUKTIONSYSSTEME
Kommunales Rechnungswesen
 Klaus Homann Kommunales Rechnungswesen Buchführung, Kostenrechnung und Wirtschaftlichkeitsrechnung in Kommunalverwaltungen 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Verlag Gerhard Homann Schwede 1991 Inhaltsverzeichnis
Klaus Homann Kommunales Rechnungswesen Buchführung, Kostenrechnung und Wirtschaftlichkeitsrechnung in Kommunalverwaltungen 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Verlag Gerhard Homann Schwede 1991 Inhaltsverzeichnis
Aufgaben zu Teil I 1. 1 Aus: Götze, U.: Kostenrechnung und Kostenmanagement, 5. Aufl., Berlin u. a. 2010, S. 23 ff.
 Aufgaben zu Teil I 1 1 Aus: Götze, U.: Kostenrechnung und Kostenmanagement, 5. Aufl., Berlin u. a. 2010, S. 23 ff. Kontrollfragen 1 1) Was versteht man unter dem Betriebswirtschaftlichen Rechnungswesen,
Aufgaben zu Teil I 1 1 Aus: Götze, U.: Kostenrechnung und Kostenmanagement, 5. Aufl., Berlin u. a. 2010, S. 23 ff. Kontrollfragen 1 1) Was versteht man unter dem Betriebswirtschaftlichen Rechnungswesen,
Teilkostenrechnung. ( Finanzbuchhaltung; bestimmt durch steuerliche Vorschriften; externes Rechnungswesen)
 1 Teilkostenrechnung 1 Kostenrechnung als Instrument des betrieblichen Controllings Controlling (Internes Rechnungswesen) Das interne Rechnungswesen als Führungssubsystem befasst sich mit Beschaffung,
1 Teilkostenrechnung 1 Kostenrechnung als Instrument des betrieblichen Controllings Controlling (Internes Rechnungswesen) Das interne Rechnungswesen als Führungssubsystem befasst sich mit Beschaffung,
IWW Studienprogramm. Vertiefungsstudium. Kostenrechnungssysteme. Lösungshinweise zur 3. Musterklausur
 Institut für Wirtschaftswissenschaftliche Forschung und Weiterbildung GmbH Institut an der FernUniversität in Hagen IWW Studienprogramm Vertiefungsstudium Kostenrechnungssysteme Lösungshinweise zur 3.
Institut für Wirtschaftswissenschaftliche Forschung und Weiterbildung GmbH Institut an der FernUniversität in Hagen IWW Studienprogramm Vertiefungsstudium Kostenrechnungssysteme Lösungshinweise zur 3.
Türkisch-Deutsche Universität. Datenblatt für Vorlesungen
 Türkisch-Deutsche Universität Datenblatt für en Code Semester Lieferkettenmanagement BWL005 5 ECTS (Wochenstunden) (Wochenstunden) (Wochenstunden) 3 2 - - Voraussetzungen Lehrsprache sniveau Stellung der
Türkisch-Deutsche Universität Datenblatt für en Code Semester Lieferkettenmanagement BWL005 5 ECTS (Wochenstunden) (Wochenstunden) (Wochenstunden) 3 2 - - Voraussetzungen Lehrsprache sniveau Stellung der
RUP Analyse und Design: Überblick
 Inhaltsverzeichnis Übersicht [, 2, 8] 3. Vorgehensweise............................... 5 2 Planungsmethoden 37 2. Definitionsphase.............................. 6 3 Rational Unified Process [5, 6] und
Inhaltsverzeichnis Übersicht [, 2, 8] 3. Vorgehensweise............................... 5 2 Planungsmethoden 37 2. Definitionsphase.............................. 6 3 Rational Unified Process [5, 6] und
Corporate Management. Scientific Abstract WS 2010/2011. Zusammenhang von Produktion und Marketing
 Corporate Management Scientific Abstract Alexander Gruber WS 2010/2011 Zusammenhang von Produktion und Marketing Alexander Gruber, Zusammenhang von Produktion und Marketing 1 Agenda 1. Einführung 2. Zusammenhang
Corporate Management Scientific Abstract Alexander Gruber WS 2010/2011 Zusammenhang von Produktion und Marketing Alexander Gruber, Zusammenhang von Produktion und Marketing 1 Agenda 1. Einführung 2. Zusammenhang
Gliederung der Vollkostenrechnung (VKR) (VKR) Kostenstellenrechnung
 Gliederung der Vollkostenrechnung (VKR) (VKR) Welche Kosten sind entstanden? Wo sind die Kosten entstanden? Welches Erzeugnis hat die Kosten zu tragen? Kostenartenrechnung Grundlage für Kostenstellenrechnung
Gliederung der Vollkostenrechnung (VKR) (VKR) Welche Kosten sind entstanden? Wo sind die Kosten entstanden? Welches Erzeugnis hat die Kosten zu tragen? Kostenartenrechnung Grundlage für Kostenstellenrechnung
Service Economics Strategische Grundlage für Integiertes IT-Servicemanagement. Dr. Peter Nattermann. Business Unit Manager Service Economics USU AG
 Economics Strategische Grundlage für Integiertes IT-management Dr. Peter Nattermann Business Unit Manager Economics USU AG Agenda 1 Geschäftsmodell des Providers 2 Lifecycle Management 3 Modellierung 4
Economics Strategische Grundlage für Integiertes IT-management Dr. Peter Nattermann Business Unit Manager Economics USU AG Agenda 1 Geschäftsmodell des Providers 2 Lifecycle Management 3 Modellierung 4
Technologien. live in der Entsorgungsbranche. Thomas Karle Division Manager Business Applications PROMATIS software GmbH. Münster 13.
 DOAG Hochschul-Regionaltreffen h lt Oracle Applikationen und Technologien Münster 13. Juli 2009 live in der Entsorgungsbranche Thomas Karle Division Manager Business Applications PROMATIS software GmbH
DOAG Hochschul-Regionaltreffen h lt Oracle Applikationen und Technologien Münster 13. Juli 2009 live in der Entsorgungsbranche Thomas Karle Division Manager Business Applications PROMATIS software GmbH
