Lawinensimulation in der Gefahrenzonenplanung
|
|
|
- Wolfgang Ritter
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung Sektion Kärnten Gebietsbauleitung Gailtal und Mittleres Drautal Lawinensimulation in der Gefahrenzonenplanung Lawinen Bad Bleiberg Exkursionsführer im Rahmen der Tagung 30 Jahre Gefahrenzonenplan Vom September 2005 in Villach, Kärnten Referenz: Kulterer, K. (2004): Gefahrenzonenplan: Einfluss von Stützverbauungen anhand der Lawinen Hohentratten- und Alpenlahner, Diplomarbeit am Institut für Alpine Naturgefahren in Zusammenarbeit mit dem Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung, Sektion Kärnten
2 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite- 2 - INHALTSVERZEICHNIS 1 BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGSGEBIETES GEOGRAPHISCHE LAGE GEBIETSCHARAKTERISTIK GEOLOGISCHE UND TEKTONISCHE SITUATION KLIMATISCHE VERHÄLTNISSE Das Klima in Kärnten Niederschlagsverhältnisse Temperaturverhältnisse Windverhältnisse SCHNEEVERHÄLTNISSE Schneeverhältnisse im Arbeitsgebiet Maximale Gesamtschneehöhe Neuschneesummen Tage mit Schneefall BESTEHENDE VEGETATION Wald im Gemeindegebiet Bewirtschaftung BESCHREIBUNG DER LAWINEN BILDDOKUMENTATION LAWINENCHRONIK BESTEHENDE VERBAUUNGSMAßNAHMEN LAWINENDYNAMISCHE BERECHNUNGEN ALLGEMEINE EINFÜHRUNG IN DIE LAWINENSIMULATION EINGANGSPARAMETER Fläche der Abbruchgebiete Anbruchshöhen Schneekubatur Vergleich der Modelle ERGEBNISSE DER SIMULATIONEN GEFAHRENZONENPLANUNG DAS BEMESSUNGSEREIGNIS DER BESTEHENDE LAWINEN-GEFAHRENZONENPLAN FÜR DEN ORT BAD BLEIBERG VERGLEICH DES BESTEHENDEN GEFAHRENZONENPLANS MIT DEN ERGEBNISSEN DER MODELLRECHNUNG BESTIMMUNG DER ABGRENZUNGEN DER GEFAHRENZONEN ZUSAMMENFASSUNG VERZEICHNISSE ABBILDUNGSVERZEICHNIS TABELLENVERZEICHNIS LITERATURVERZEICHNIS...28
3 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite- 3-1 BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGSGEBIETES 1.1 Geographische Lage Die Marktgemeinde Bad Bleiberg (Abbildung 1) gehört zum Politischen Bezirk Villach, besteht aus den zwei Katastralgemeinden Bad Bleiberg und Kreuth, umfasst 44,82 km² und liegt im Mittel auf einer Seehöhe von 900m. (AMT D. KÄRNTNER LANDESREGIERUNG, 1994) Abbildung 1: Lage des Untersuchungsgebietes der Lawinen Alpen- und Hohentrattenlahner auf der Villacher Alpe und des Talortes Bad Bleiberg, Kärnten (Quelle: BEV; ÖK 1:50.000). 1.2 Gebietscharakteristik Am Fuße des Dobratsch-Nordabhanges erstreckt sich in OW-Richtung das Bleiberger Hochtal mit durchschnittlich 900 m Meereshöhe. Die große Bedeutung dieses Ortes lag schon seit jeher im Bergbau. Die Marktgemeinde Bad Bleiberg zählt 2004 etwa 3000 Einwohner; einziger Verkehrsweg durch das enge Tal ist die Bleiberger Landesstraße. Die südliche Grenze bilden der Kamm und das Plateau des Dobratsch, die nördliche der Kamm des Erzberges. Die landschaftliche Prägung erhält das Gebiet durch den Dobratsch, der das Tal stark verschattet und den Erzberg mit seinen zahlreichen Abraumhalden des ehemaligen Bleiberger Bergwerksunions (BBU) -Betriebes.
4 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite- 4 - Hydrologisch teilt sich das Tal in ein westliches Einzugsgebiet mit dem Nötschbach, der zur Gail entwässert, und in ein östliches Einzugsgebiet mit dem Weißenbach, der zur Drau entwässert. Die überwiegenden Bodenformen bilden Lockersedimentbraunerden, Rendsinen und Schwemmböden wurde in der Grube Rudolf eine Thermalquelle angefahren, die gefasst wurde und mit dem Bau des Thermalbades 1966 setzte die Entwicklung des Fremdenverkehrs ein, der heute als wirtschaftliche Haupteinnahmequelle fungiert. Durch den Neubau eines Kurzentrums 2003 sowie durch die Sanierung und teilweisen Begradigung der Bleiberger Landesstraße wird der Faktor des Wellness - Urlaubes in Bad Bleiberg auch wegen der nahen Lage zu den Nachbarstaaten Italien und Slowenien eine immer größere Bedeutung erlangen. Besiedelung: Die Geschichte Bleibergs ist stark mit der des Bergbaues verbunden. Somit beginnt die Besiedelung des Hochtales mit dem Einsetzen der Entdeckung des schürfbaren Erzes. Die Bevölkerungszahl erreichte 1869 nach der Gründung der BBU mit 4061 ihren Höchststand und sank seither tendenziell auf derzeit 2843 Einwohner (Gde. Bad Bleiberg, 2004). 1.3 Geologische und tektonische Situation Nach KRAINER (1998) gehört das Dobratschmassiv zur geologisch tektonischen Einheit des Drauzuges. Es wird allseits von Störungen begrenzt: im Süden (Gailtal) von der Periadratischen Naht, der größten Störungszone der Ostalpen. Im Norden wird das Dobratschmassiv von einer das Bleibergtal entlang ziehenden Störung begrenzt (Bleiberger Bruch). Nach Westen sind die Gesteine des Dobratschmassivs auf die Gesteine des Karbon von Nötsch aufgeschoben und nach Osten sind die Gesteine entlang von Nord-Süd verlaufenden Störungen treppenartig gegen das Villacher Becken abgesenkt und werden von der Drautalstörung schräg abgeschnitten. Das Dobratschmassiv wird im Wesentlichen aus Sedimentgesteinen des oberen Perms und der Trias aufgebaut.
5 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite- 5 - Das Dobratschmassiv besteht aus zwei übereinander liegenden Decken: Dobratsch- Gipfelscholle und Dobratsch-Basisdecke (Abbildung 2). Abbildung 2: Schichtenfolge als Profil durch das Dobratschmassiv (nach KRAINER 1998) Durch die Dobratsch-Überschiebung kommt es zu einer Schichtwiederholung ab dem Alpinen Muschelkalk. Die Basisdecke besteht aus einer Schichtfolge, die von den Grödener Schichten bis zu den Raibler Schichten reicht, die Gipfelscholle besteht aus Alpinem Muschelkalk, Buntkalken und vor allem Wettersteinkalk, untergeordnet aus Raibler Schichten und Hauptdolomit. Die starke Übersteilung der Hänge ist auf die glaziale Erosion durch den mächtigen Gailgletscher zurückzuführen, der sich während der letzten Eiszeitperiode (Würm) bei Villach mit dem Draugletscher vereint hat. Der Gailgletscher erreichte im unteren Gailtal eine Eismächtigkeit von über 1000 m. Diese mächtigen Eismassen haben die Lockersedimente im Talbereich größtenteils erodiert und außerdem die Talflanken stark übersteilt. Landschaftlich prägend sind die stehenden Wände aus Wettersteinkalk des Dobratsch und die als Lahner bezeichnenden Landformen ( Lahner weist mundartlich auf die Funktion als Lawinenbahn hin) aus brüchigem Wettersteindolomit. 1.4 Klimatische Verhältnisse Das Klima in Kärnten Unter dem Einfluss von 3 Zonen gibt es große Gegensätze: Im Nordwesten herrscht ozeanisch beeinflusstes alpines Klima, das Klagenfurter Becken hat als vorgeschobener Raum des pannonischen Klimas extremes Beckenklima, im Drautal und im unteren Gailtal wirkt sich der Einfluss des Mittelmeerklimas aus. Der wichtigste Klimafaktor Kärntens ist die fast geschlossene Umwallung mit Gebirgszügen von überwiegend Hochgebirgscharakter, und die im Wesentlichen beckenartige Ausgestaltung des zentralen bzw. östlichen Landesteils (WAKONIGG, 1998).
6 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Niederschlagsverhältnisse Das Gailtal zählt zu den niederschlagsreichsten Landschaften Kärntens. Der Hauptanteil des Niederschlages entstammt Südwetterlagen. Tiefdruckentwicklungen im Mittelmeer stauen sich an den Alpen und regnen bzw. schneien in den Staugebieten ab. Im Süd-Westen Kärntens, also im Gail und Lesachtal, aber auch im oberen Drautal, treten in den Tallagen jährliche mittlere Niederschlagssummen von 1100 mm bis 1500 mm auf (WLS REPORT 99, 2004). Abbildung 3: Klimadiagramme der Klimastationen Bad Bleiberg und Villacher Alpe (WALTER & LIETH,1967) Niederschlagsstation Bad Bleiberg Villacher Alpe Messstellennummer Seehöhe [m ü. A.] Beobachtungsbeginn Betreiber ZAMG ZAMG Gerät Ombrometer Ombrometer Maximaler Jahresniederschlag [mm]: Mittlerer Jahresniederschlag [mm]: Maximaler Monatsniederschlag [mm]: Mittlerer Monatsniederschlag [mm]: Maximaler Tagesniederschlag [mm]: Mittlerer Tagesniederschlag [mm]: Tage mit Niederschlag >= 0.1 [mm]: Tage mit Niederschlag >= 1.0 [mm]: Tabelle 1: Kennwerte der Meteorologischen Stationen im Arbeitsgebiet (ZAMG, 2004)
7 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Temperaturverhältnisse Bei Betrachtung der Temperaturverhältnisse in Kärnten fällt auf, dass neben dem ozeanischen Klima, das im restlichen Mitteleuropa vorherrschend ist, auch das kontinentale Klima einen Einfluss ausübt. Dieser wird vor allem in der großen Jahresschwankung der Temperatur deutlich, die besonders in den Tal- und Beckenlagen, bedingt durch die orographische Lage, eine beträchtliche Spannweite erreicht (Tabelle 2). Monat T in C N in mm Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr Tabelle 2: Temperaturverhältnisse der Station Villacher Alpe (ZAMG, 2004) Windverhältnisse Die Verteilung der Windrichtungen auf der Station Villacher Alpe ist wie folgt (ZAMG, 2004): 35% Südwest 10% Nordost 07% Süd 18 % Nord 03% Südost 13% Nordwest 06% Ost 08% West In Bad Bleiberg herrschen nach der Lage her überwiegend West- bzw. Ostwinde vor. 1.5 Schneeverhältnisse Schneeverhältnisse im Arbeitsgebiet Starke Schneefälle stehen meist in Zusammenhang mit Südwetter- oder Tiefdrucklagen. Letztere weisen in der jahreszeitlichen Häufigkeitsverteilung im Winter ihr Minimum und im Frühling ihr Maximum auf. Das deutet darauf hin, dass sich die ergiebigeren Schneefälle häufiger im Februar und März als zu Anfang des Winters einstellen (TROSCHL, 1980). Es werden drei typische Wetterlagen für Großschneefälle genannt, nämlich West- und Nordwestlagen Genuatief und Vb-Lagen Kaltlufteinbrüche aus Norden bzw. Nordwesten
8 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Maximale Gesamtschneehöhe Niederschlagsstation Bad Bleiberg Villacher Alpe Seehöhe [m ü. A.] Jänner Februar März April Mai Juni Juli 0 60 August 0 15 September 0 37 Oktober November Dezember Jahr Tabelle 3: Maximale Gesamtschneehöhe im Bereich des Arbeitsgebietes ( ) Die Werte der Tabelle 3 decken sich mit den Angaben von TROSCHL (1980), der den Zeitpunkt des Eintretens der maximalen Schneehöhe für die tiefen Lagen mit Ende Jänner / Anfang Februar sowie in der nivalen Region mit April bis Mai angibt. Aus den Daten der ZAMG über die mittleren größten Schneehöhen im Bereich des Arbeitsgebietes ergeben sich folgende Mittelwerte (Tabelle 4): Niederschlagsstation Bad Bleiberg Villacher Alpe Seehöhe [m ü. A.] Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr Tabelle 4: Mittlere Maximale Gesamtschneehöhen
9 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Neuschneesummen Die mittleren Neuschneesummen (Tabelle 5) der Stationen südlich der Hohen Tauern sind nach STEINHAUSER (1968) durchwegs geringer als im österreichischen Durchschnitt und weisen eine sehr große Veränderlichkeit auf. Niederschlagsstation Bad Bleiberg Villacher Alpe Seehöhe [m ü. A.] Jänner Februar März April Mai Juni 0 46 Juli 0 20 August 0 15 September 0 45 Oktober November Dezember Jahr Tabelle 5: Maximale Monats-Neuschneesumme Tage mit Schneefall Die größte Zahl der Tage mit Schneefall (Tabelle 6) weisen in Kärnten nach TROSCHL (1980) normalerweise der Dezember und Jänner auf. Im Jänner, dem kältesten Monat, liegt die Seehöhe, ab der Niederschläge nur mehr in fester Form fallen, bei 1500 m. Die winterlichen Niederschläge fallen also auch in den Gebirgslagen gelegentlich als Regen oder Schneeregen. Niederschlagsstation Bad Bleiberg Villacher Alpe Seehöhe [m ü. A.] Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr Tabelle 6: Zahl der Tage mit Schneefall (Mittelwerte )
10 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Bestehende Vegetation Wald im Gemeindegebiet Die Gemeinde Bad Bleiberg liegt im südöstlichen Wuchsbezirk Gailtaler Alpen des südlich randalpinen Fichten Tannen Buchenwaldgebietes (MAYER, 1971). Abbildung 4: Verteilung der Vegetation (KAGIS, 2004) Anthropogen begünstigt sind im montanen Bereich Eibe und Bergahorn (MAYER, 1971). Am Dobratsch drückte die seit dem frühen Mittelalter betriebene Weidenutzung die Baumgrenze auf 1800 m, die von Fichte und Lärche gebildete Waldgrenze auf 1700 m. Kurze Vegetationsperiode, Wind, verminderte Humusbildung, schwaches Bodenleben, Nährstoffarmut, starke Sommererwärmung und winterliche Frosttrocknis lassen eine Wiederbewaldung des Dobratschplateaus nicht bzw. nur in einem begrenztem Ausmaß zu (FINA, 1985). Die Verbreitung der Schlusswaldgesellschaften wird aber primär durch das Klima, erst sekundär durch edaphische Faktoren entschieden Bewirtschaftung Die Bewirtschaftung erfolgt heute schutzwaldartig, wobei eine Deklaration zum Bannwald nicht besteht. Die Nutzung beschränkt sich auf Nebennutzung, so sie überhaupt möglich ist (FINA, 1985).
11 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite BESCHREIBUNG DER LAWINEN 2.1 Bilddokumentation Abbildung 5: Übersicht der Lawinenstriche Bad Bleiberg 1975 (WLV, 2004) (Stützverbauungen im Abbruchgebiet: Hohentrattenlahner, Alpenlahner, Pfarriese )
12 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Lawinenchronik (Auszüge, stark verkürzt) 1348 Erdbeben, Dobratschabsturz Dezember Villacher Amtmann Konrad Senft: 14 Personen getötet, 32 Häuser zerstört 1648 St. Bartholomäus-Kirche wurde zerstört (Kessellahner) 1664 Nach Bericht von Monsieur Donellen anlässlich seiner Europareise des Eduard Brown 1672 : 16 Häuser vernichtet Jänner Almlahner: mehrere Häuser und Stadeln vernichtet, Frl. Kilzer wurden die Beine abgeschlagen März Perscha sche Mühlen in Hüttendorf Nr. 73 durch eine sehr große Lawine aus dem Hohentrattenlahner zerstört, 1 Knabe wurde getötet, die anderen Verschütteten konnten lebend geborgen werden Feber Alle Lahner und Riesen; 39 Menschen getötet, mehrere Menschen verletzt, 21 Objekte zerstört, 11 Objekte beschädigt Feber Almlahner; gerettet wurden einige verschüttete Personen, 3 Häuser zerstört März Almlahner; 5 Häuser wurden zerstört, 1 Haus wurde nicht mehr aufgebaut Feber Hohentrattenlahner; Lawine in einer Breite von 40 m und bis 10 m Höhe sperrte die Straße zwischen Friedhof und Ortschaftsbeginn März Almlahner; Grundlawine bis 40 m an den Gendarmerieposten 10. März Almlahner; 2 Grundlawinen diese überlagernd, 1 Ast östlich, 1 Ast gegen Norden (Kandolf) und 1 Ast in Richtung Talstation Gondelbahn ORF März Almlahner; Lockerschneelawine löst Grundlawine aus 31. März Windlawine bringt Äste und Stämme bis 10 m an die Landesstraße 31. März Hohentrattenlahner; eine Lockerschneelawine löst eine zweite aus, beide jedoch mehrere Grundlawinen. Die Staublawine war im Ortsbereich noch spürbar und hüllte alles in Schneestaub. Die Bleiberger Landesstraße wurde auf eine Länge von 350 m verschüttet 6. April 8.30 Uhr und Uhr Grundlawine bis etwa 100 m, Breite rd. 150 m, m 7. April Uhr auf diese Lawine weitere z.t. große Lawinen April Hohentrattenlahner; Lawine größeren Ausmaßes kommt etwa 100 m oberhalb der Landesstraße zum Stehen Abbildung 6: Vor allem kam 1975 der östliche Lawinenast des Hohentrattenlahners wiederum zum Durchbruch und riss Hunderte Festmeter Holz mit sich. (ZAWORKA, 1980, Foto: Archiv ZAWORKA)
13 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Abbildung 7: Die Schneemassen verlegten die Landesstraße in einer Länge von 320 m stellenweise bis 7 m Höhe und drangen bis in den Friedhof vor. (ZAWORKA, 1980, Foto: WLV, 2004) Die Ablagerungen bzw. Reichweiten der Lawinenereignisse 1879, 1902, 1909, 1917, 1951,1952 und 1975 sind in Abbildung 8 dargestellt. Abbildung 8: Vergleich der kartierten Ausschüttungsgrenzen mit dem bestehenden Lawinengefahrenzonenplan (Kulterer, 2004)
14 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Bestehende Verbauungsmaßnahmen Der Beginn der Verbauungstätigkeit am Alpenlahner erfolgte im Jahre 1969, jener am Hohentrattenlahner im Jahre Das Lawinenkatastrophenereignis aus dem Jahre 1975 machte dann eine Fortsetzung der Verbauung zum Schutze von Bleiberg dringend erforderlich. Die Dringlichkeit der Verbauungsmaßnahmen wurde dadurch unterstrichen, da die für die Wirtschaft dieses Gebietes überaus bedeutende Bleiberger Landesstraße fast alljährlich durch Lawinenabgänge unterbrochen wurde - oder vorsorglich gesperrt werden musste - und im Wirtschaftsablauf dadurch schwerer Schaden erwachsen ist (WLV, 2004). Abbildung 9 : Übersicht der Stützverbauung im Anbruchgebiet des Hohentrattenlahners und des Alpenlahners (links), Stützverbauungstypen (rechts) (WLV, Kulterer 2004) Wesentliche Beobachtungserkenntnisse lagen im Verwehungsverbau. So hat der Wind einen maßgeblichen Anteil an schadbringenden Lawinenabgängen. Südwinde, insbesonders SOund SW- Winde vermögen aus dem Dobratschplateau enorme Schneemassen gegen die kritischen Abbruchbereiche des Alpen- und Hohentrattenlahners zu verfrachten und akute Lawinengefahr hervorzurufen. Diesem Umstand Rechnung tragend, wurden im Verbauungsprojekt 1977 zahlreiche Verwehungsverbauungen in der Form von Treibschneewänden an geeigneten Geländestellen geplant. Abbildung 10: Treibschneewände im Nährgebiet (Kulterer, 2004)
15 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite LAWINENDYNAMISCHE BERECHNUNGEN 3.1 Allgemeine Einführung in die Lawinensimulation Aufgrund der unmittelbaren Auswirkungen der Gefahrenzonenplanung auf die Raumordnung auf der einen Seite und der Kosten der Schutzmaßnahmen (Stützverbauungen, Erweiterungen) auf der anderen Seite ist eine möglichst präzise Abschätzung der zu erwartenden Lawinenauslauflängen, Fließhöhen und Drücke erforderlich. Die in der Vergangenheit vorhandenen Möglichkeiten setzten sich aus der Chronik, Befragungen, Geländebegehung und Geländeinterpretation, klimatischen Verhältnissen, Luftbildinterpretation und der Erfahrung und dem Expertenwissen zusammen. Mit der Lawinensimulation stehen nun ergänzende Werkzeuge zur Verfügung, die nicht nur eine qualitative Einschätzung erlauben, sondern auch quantitative Aussagen ermöglichen und somit eine weitgehend objektive Grundlage darstellen. Es sollte aber festgehalten werden, dass aufgrund der Ungenauigkeiten bzw. Verteilungen der Eingangsdaten (Geländemodell, Anbruchgebiet, Anbruchmächtigkeit ) die Simulationen nur eine grobe Abstraktion der realen Umwelt darstellen (WLV, 2003). Abbildung 11: Fließdruckauswirkungen mit Einfluss der Stützverbauung SAMOS Modell
16 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Abbildung 12: Fließdruckauswirkungen im Auslaufbereich der Lawinen Hohentrattenlahner (li) und Alpenlahner (re) mit Einfluss der Verbauung SAMOS Modell Fliessdruck mit Verbauung SAMOS 100 kg 1 to 2,5 to Abbildung 13: Ablagerungen der Lawine Hohentrattenlahner im Bereich der Bleiberger Landesstraße, Anbruchgebiet teilverbaut (April 1975, WLV 2004)
17 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Abbildung 14: Ergebnisse der Fließhöhen mit Einfluss der Stützerbauung ELBA Simulation Abbildung 15: Ergebnisse der Fließhöhen ohne Einfluss der Stützverbauung ELBA Simulation
18 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Eingangsparameter Digitales Geländemodell - DGM Im digitalen Geländemodell für die Lawinen Bleiberg wurden zwei Auswertebereiche festgelegt: Der Bereich der Auslaufzone wurde mit einem mittleren Punktabstand von 7,5 m ausgewertet, der Bereich im Anbruchgebiet sowie die Sturzbahn mit einem mittleren Punktabstand von 20 m. Die Geländeinformation wurde zusätzlich durch die Auswertung von Straßen sowie Bruchkanten und Formenlinien ergänzt. Weiters wurden die bestehenden Verbauungen sowie Bestandsränder ausgewertet. Es ist allgemein wichtig festzuhalten, dass die Simulationen auf dem Sommergeländemodell durchgeführt wurden. Die Topographie des Wintergeländes kann sich infolge der Schneebedeckung oder auf Grund von Vorlawinen in einzelnen Hangabschnitten deutlich vom Sommergelände unterscheiden und/oder die Lawinenbahn ungünstig beeinflussen. Dieser Tatsache ist bei der Umsetzung der Simulationsergebnisse Rechnung zu tragen (WLV, 2004). Abbildung 16: 3d Geländemodell mit 100m Schichtenlinien, Bruchkanten, Formenlinien, Wege und Bestandesränder (WLV, 2004)
19 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Fläche der Abbruchgebiete Die maßgebenden Anbruchgebiete für die Simulationen der Lawinen Hohentrattenlahner und Alpenlahner wurden anhand von Geländebegehungen, Befragungen der ortskundigen Bergführer und mit Rücksprache der Wetterbeobachter sowie der Ableitungen aus dem digitalen Geländemodell (Neigungs- und Expositionskarte, schattierte Reliefdarstellung) festgelegt und im Laufe der Simulationen überarbeitet um die optimale Ergebnisse für die aufgezeichneten Ereignisse zu erzielen. In weiterer Folge wurden die aus der Extremwertstatistik errechneten maximalen Schneehöhen für ein 150-jährliches Ereignis als Eingangsparameter verwendet und so ein ca. 150-jährliches Bemessungsszenario errechnet. Als untere Begrenzung wurde die Baumgrenze bzw. Bereiche mit einer Neigung kleiner als 28 gewählt. Anbruchgebiete Exposition Abbrüche d0* mittl. Neigung neigungsfaktor (d0) d0 proj.fläche(m²) anrissmasse alpenlahner SW-N ab01o 2,5 34,4042 0,73 1,825 1, SW-N ab01u 1,79 36,7999 0,66 1,181 1, SO-N ab02o 2,5 43,5175 0,54 1,35 1, SO-N ab02u 1,78 44,3762 0,53 0,943 0, SO-N ab03 1,79 38,2000 0,62 1,11 1, hohentrattenlahner N-NO ab01o 2,5 36,9440 0,66 1,65 1, N-NO ab01u 1,75 39,5053 0,61 1,068 1, N-NO ab02o 2,5 43,0738 0,54 1,35 1, N-NO ab02u 1,83 41,4004 0,57 1,043 1, Tabelle 7: Exposition, Neigungen; Anbruchsfläche und Schneemasse der Abbruchgebiete ab03 ab02u ab01u ab02u ab01u alpenlahner ab02o ab01o ab02o ab01o hohentrattenlahner Abbildung 17: Abgrenzung der für die Simulationen relevanten Abbruchgebiete
20 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Anbruchshöhen Schneekubatur Die Extremwertanalysen liefern folgende Werte für die zu erwartenden Neuschneemengen und Gesamtschneehöhen: Maximale Schneehöhe 1Tages-Neuschnee 3Tages-Neuschnee mit Max. ohne Max. mit Max. ohne Max. mit Max. ohne Max. 30j j j Verteilung LOG-WEIB-3 WEIB-3-MLH GUMBEL-MLH LOG-WEIB-2 LOG-N-3-MLH LOG-NORMAL2 µ= 2,58 2,55 1,55 1,52 1,91 1,88 sigma= 0,53 0,48 0,38 0,34 0,39 0,35 Tabelle 8: Maximale 1-; 3-Tages und Gesamtschneemengen Die maßgebliche 150-jährliche 3-Tages Neuschneesumme beträgt demnach 195 cm. Für die Bestimmung des Bemessungsereignisses müssen Korrekturen für die Neigung, die Einwehung und den Höhenunterschied zur meteorologischen Station durchgeführt werden: a) Neigungskorrektur Gemäß Schweizer Richtlinien werden die Niederschlagsmengen entsprechend der mittleren Neigungen der Abbruchgebiete um 0,53-0,73 reduziert (vgl. auch Tabelle 7). Abbildung 18: Sturzbahn Lawine Hohentrattenlahner 10.April.1984 (WLV, 2004) b) Windkorrektur In den Katastrophenwintern traten regelmäßig Schneefälle mit Bewindung aus Süd und Südwest auf. Deutlich zu sehen ist dies anhand der Verfüllung der Treibschneewände in der Nähe der Abbruchkante. Im Ereignisfallfall wurde den Simulationen einer maximalen Hinterfüllung der Stützverbauung unterstellt. Abbildung 19: Hinterfüllung der Stützverbauung 10.April.1984 (WLV, 2004) c) Höhenkorrektur Da die maßgebenden meteorologischen Daten auf der Station Villacher Alpe auf 2140 m ü. A. gemessen wurden, muss laut Schweizer Richtlinien die 150-jährlichen 3-Tagesneuschneesumme pro 100 Höhenmetern um 5 cm reduziert werden (vgl. auch Tabelle 7). Abbildung 20: Übersicht des Nährgebietes mit Treibschneewänden am 10.April 1984 (WLV, 2004)
21 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Vergleich der Modelle Die Simulationen wurden zur objektiveren Beurteilung der Gefährdung mit verschiedenen 1- und 2-dimensionalen Lawinenmodellen durchgeführt. 1-dimesionales Modell LIED / BAKKEHOI AVAL 1D 2-dimesionales Modell ELBA - KLEEMAYR / VOLK SAMOS Tabelle 9: Dimensionalität der verwendeten Verfahren Die in die Berechnungen eingehenden Parameter sind: ELBA SAMOS AVAL 1D LIED Geländemodell Geländemodell Längsprofil Längsprofil Anbruchgebiet Anbruchgebiet Anbruchgebiet Neigung Abbruch Geländerauhigkeit Geländerauhigkeit Trockene Reibung 10 Punkt (beta) Trockene Reibung Dichte Abbruchgebiet Turbulente Reibung Dichte Abbruchgebiet Dichte Fliesslawine Dichte (konstant) Snow entrainment Snow entrainment Partikeldurchmesser Tabelle 10: Modellparameter der Simulationsmodelle 3.3 Ergebnisse der Simulationen Mit Hilfe der Lawinensimulation können folgende Aussagen getroffen werden: Die Gefährdung durch Lawinen im untersuchten Gebiet wird durch die vorliegenden Lawinensimulationen bestätigt. Das Straßennetz am Hangfuß des Hohentrattenlahner und Alpenlahners liegt im unmittelbaren Wirkungsbereich von Lawinen aus den jeweiligen Lawinenstrichen. Die Reduktion der potentiellen Anbruchmassen um ca. 25 % durch die getätigten Verbauungsmaßnahmen bewirkt nur sehr geringe Änderungen in den Lawinenauslauflängen, aber eine signifikante Reduzierung der Ablagerungshöhen. Die bestehende Verbauung führt zu einer Herabsetzung der Ereigniswahrscheinlichkeit im Gefährdungsbereich durch die Reduktion der Abbruchsmasse.
22 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite GEFAHRENZONENPLANUNG 4.1 Das Bemessungsereignis Wenn man die beiden Großereignisse 1879 und 1975, die bis in den Ort reichten, für die Abschätzung der Jährlichkeit heranzieht, so ergibt sich eine Zeitdauer zwischen den beiden Ereignissen von 96 Jahren. Das ist bedeutend kürzer als es für den Gefahrenzonenplan maßgebend ist. Die Abschätzung einer Jährlichkeit aus nur zwei Großereignissen ist aber ohnehin statistisch unzulässig. Wenn man alle sieben bekannten Lawinenabgänge, die den Talboden erreicht haben, heranzieht, so ergibt sich für ein solches Ereignis eine Wiederkehrdauer von 15 bis 30 Jahren. Der Winter 1998/99 hat gezeigt, dass es für Lawinen-Gefahrenzonenpläne nicht ausreicht, nur auf ein Bemessungsereignis von 150 Jahren abzugrenzen. Es müssen vielmehr auch Großlawinen höherer Jährlichkeit berücksichtigt werden. Daher erfolgt auch die Abgrenzung der Lawinen-Gefahrenzonen für den Ort Bleiberg nicht für ein starres 150jährliches Ereignis, dessen Größenordnung nicht genau feststellbar ist, sondern auf ein mögliches Großereignis der Lawinen Alpenlahner und Hohentrattenlahner. 4.2 Der bestehende Lawinen-Gefahrenzonenplan für den Ort Bad Bleiberg Der Lawinen - Gefahrenzonenplan für den Ort Bad Bleiberg wurde im Jahre 1979 erstellt. Die Abgrenzung der Gefahrenzonen erfolgte aufgrund der Chronikangaben über die Großereignisse und aufgrund von Fotos der Lawinenabgänge. Weiters wurden Auslauflängen nach VOELLMY und LATSCH errechnet. Die Bereiche der Lawinenablagerungen von 1879 und 1975 wurden als Rote Gefahrenzone ausgeschieden, wobei der Bereich zwischen den beiden Lawinenablagerungen ebenfalls der Roten Gefahrenzone zugeordnet wurde. Als Gelbe Gefahrenzone wurde eine angemessene Sicherheitszone an die Rote Gefahrenzone angefügt. Lawinendynamische Berechnungen wurden für die Erstellung des Gefahrenzonenplans keine durchgeführt. Das Bearbeitungsgebiet (raumrelevanter Bereich) ist nach oben hin auf rund 930 m ü. A. auf der Südseite des Gemeindegebietes abgegrenzt. Die Lawinen - Gefahrenzonen sind im GZP von 1979 wie folgt abgegrenzt: Lawine Hohentrattenlahner: Rote Lawinen - Gefahrenzone: Über den Bereich des Friedhofes mit seitlicher Berührung des westlichen Ortsteiles von Hüttendorf sowie im Westen knapp vor Ortsbeginn von Bad Bleiberg.
23 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Gelbe Lawinen - Gefahrenzone: Entsprechend der Geländeausformung bzw. möglichen Auswirkungen von Staublawinen wurde eine entsprechend breite gelbe Zone anschließend an die rote Zone ausgewiesen. Lawine Alpenlahner: Rote Lawinen - Gefahrenzone: Nördliche Begrenzung ist die Landesstraße, westlich der Bereich der ORF-Talstation, östlich des Weges zu Parz. Nr. 7368/2 über den östlichen Rand der Parz. Nr. 488 bogenförmig zur Landesstraße. Gelbe Lawinen - Gefahrenzone: Seitliche Begleitung der Landesstraße, hinsichtlich der Auslauflänge Erweiterung über den Ortsraum. Entsprechend der Geländeausformung bzw. möglichen Auswirkungen von Staublawinen wurde eine entsprechend breite gelbe Zone anschließend an die rote Zone ausgewiesen. 4.3 Vergleich des bestehenden Gefahrenzonenplans mit den Ergebnissen der Modellrechnung Die Berechnungen nach der einparametrige Gleichung nach LIED et al. (1995) zeigen jedoch, dass ein weiters Vordringen der Lawinen Hohentrattenlahner und Alpenlahner, als es bisher beobachtet wurde. Dies ist jedoch mit der undetailierte Beschreibung des Geländes durch das Pauschalgefälle zu begründen. Die durch die zweidimensionalen Simulationsmodelle ELBA und SAMOS bestimmten Ablagerungsgrenzen zeigen eine sehr gute Übereinstimmung mit den beobachteten Reichweiten sowie eine Bestätigung des Gefahrenzonenplanes im Bereich des Alpenlahners. Im Bereich des Hohentrattenlahners zeigten die Modellrechnungen eine zu großflächig ausgeschiedene rote Gefahrenzone: Die Verbauungsmaßnahmen bewirken in dem Bereich des Friedhofes und ehemaligen Sägewerkes eine Reduzierung der Ablagerungshöhen und des Lawinendrucks. Diese Modelle zeigen auch, dass eine Katastrophenlawine aus dem Alpenlahner, wie sie im Worst Case Szenario errechnet wurde, den Ort Bad Bleiberg in einem größeren Ausmaß betreffen würde, als bisher aufgezeichnet.
24 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Bestimmung der Abgrenzungen der Gefahrenzonen Die genauen Abgrenzungskriterien für die Rote und Gelbe Lawinengefahrenzone sind durch den Lawinendruck p (kn/m²) und die Ablagerungshöhe festgelegt: Gefahrenzone Lawinendruck p (kn/m²) Ablagerungshöhe Rote Gefahrenzone p > 10 kn/m² t > 1,5 m Gelbe Gefahrenzone p > 10 kn/m² > p > 1 kn/m² 0,2 m < t <1,5 m Tabelle 11: Abgrenzungskriterien des Lawinengefahrenzonenplanes nach dem Lawinenerlass 1999 Diese Abgrenzungskriterien erfolgen nach dem Lawinenerlass des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 1. Juli 1999, der eine Änderung der seit 1976 gültigen Richtlinie darstellt. Da die Simulationen eine sehr genaue Übereinstimmung mit der Abgrenzung der Gefahrenzonen zeigen, nur der Verlauf des Lawinendruckes mit 25 kn/m² der bestehenden Roten Gefahrenzone als zu großflächig ausgeschieden wurde, kann die bestehende Zonierung des Gefahrenzonenplanes von 1979 übernommen und den Kriterien des Lawinenerlasses von 1999 angepasst werden. Für eine Möglichkeit der Revision des Lawinen - Gefahrenzonenplan der Ortschaft Bad Bleiberg bedeutet dies, dass die Abgrenzung der Gefahrenzonen des bestehenden Gefahrenzonenplanes im Bereich des Alpenlahners übernommen und den Abgrenzungskriterien des Lawinenerlasses von 1999 angepasst wird. Im Bereich des Hohentrattenlahner wird in dem Vorschlag zur Revision die rote Gefahrenzone den Ergebnissen aus den Modellrechnungen angepasst. Auch aufgrund der Geländeverhältnisse und den kartierten Auslaufgrenze wäre diese Ausscheidung der roten Zone als besser angepasst zu erachten.
25 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite ZUSAMMENFASSUNG Ziel der vorliegenden Untersuchungen war die Überprüfung der Lawinengefahrenzonen für den Ort Bad Bleiberg mittels neuer Methoden zur Lawinensimulation. Neue Grenzwerte für die Abgrenzung von Gefährdungsbereichen von Lawinen in Österreich und die Berücksichtigung von mittlerweile errichteten Stütz- und Verwehungsbauten waren Anlass für die vorliegenden Untersuchungen. Der Einsatz von Simulationsmodellen zur Ermittlung der Gefahrenzonen erwies sich als wertvolles, unterstützendes Hilfsmittel zur Rekonstruktion von Katastrophenlawinen und in weiterer Folge zur Abgrenzung der Gefährdungsbereiche. Für die untersuchten Lawinen, deren Gefährdungsbereiche ohne Berücksichtung von Stützverbauungen und in erster Linie auf Basis der bekannten Ausschüttungsgrenzen früherer Lawinenereignisse kartiert wurden, konnten die bestehenden Gefahrenzonen durch die Simulationen weitestgehend bestätigt werden. Dies bedeutet, dass die bestehenden Gefahrenzonen aufgrund der neuen Abgrenzungskriterien für Lawinendruck und Ablagerungshöhe nicht verändert werden müssen. In Zukunft soll die Simulation von Lawinen als ergänzende und unterstützende Methode zu den bewährten Verfahren ein fester Bestandteil zur Ermittlung von Lawinengefahrenzonen werden.
26 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Mögliche Rücknahmen der Gefahrenzonen Pfarriese Hohentrattenlahner Meter GZP Vorschlag Revision Law. rot Revision Law. gelb Revision GZP Law. rot Law. gelb Raumrelevanz Fliessdruck mit Verbauung SAMOS 100 kg 1 to 2,5 to N Abbildung 21: Vorschlag zur Revision des GZP Bad Bleiberg im Bereich des Hohentrattenlahners (Kulterer, 2004)
27 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite VERZEICHNISSE 6.1 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Lage des Untersuchungsgebietes der Lawinen Alpen- und Hohentrattenlahner auf der Villacher Alpe und des Talortes Bad Bleiberg, Kärnten (Quelle: BEV; ÖK 1:50.000)... 3 Abbildung 2: Schichtenfolge als Profil durch das Dobratschmassiv (nach KRAINER 1998)... 5 Abbildung 3: Klimadiagramme der Klimastationen Bad Bleiberg und Villacher Alpe (WALTER & LIETH,1967)... 6 Abbildung 4: Verteilung der Vegetation (KAGIS, 2004) Abbildung 5: Übersicht der Lawinenstriche Bad Bleiberg 1975 (WLV, 2004) Abbildung 6: Vor allem kam 1975 der östliche Lawinenast des Hohentrattenlahners wiederum zum Durchbruch und riss Hunderte Festmeter Holz mit. (ZAWORKA, 1980, Foto: Archiv ZAWORKA) Abbildung 7: Die Schneemassen verlegten die Landesstraße in einer Länge von 320m stellenweise bis 7m Höhe und drangen bis in den Friedhof vor. (ZAWORKA, 1980, Foto: WLV, 2004) Abbildung 8: Vergleich der kartierten Ausschüttungsgrenzen mit dem bestehenden Lawinengefahrenzonenplan (Kulterer, 2004) Abbildung 9 : Übersicht der Stützverbauung im Anbruchgebiet des Hohentrattenlahners und des Alpenlahners (links), Stützverbauungstypen (rechts) (WLV, Kulterer 2004) Abbildung 10: Treibschneewände im Nährgebiet (Kulterer, 2004) Abbildung 11: Fließdruckauswirkungen mit Einfluss der Stützverbauung SAMOS Modell Abbildung 12: Fließdruckauswirkungen im Auslaufbereich der Lawinen Hohentrattenlahner (li) und Alpenlahner (re) mit Einfluss der Verbauung SAMOS Modell Abbildung 13: Ablagerungen der Lawine Hohentrattenlahner, Bereich der Bleiberger Landesstraße, Anbruchgebiet teilverbaut (April 1975, WLV 2004) Abbildung 14: Ergebnisse der Fließhöhen mit Einfluss der Stützerbauung ELBA Simulation Abbildung 15: Ergebnisse der Fließhöhen ohne Einfluss der Stützverbauung ELBA Simulation Abbildung 16: 3D Geländemodell mit 100m Schichtenlinien, Bruchkanten, Formenlinien, Wege und Bestandesränder (WLV, 2004) Abbildung 17: Abgrenzung der für die Simulationen relevanten Abbruchgebiete Abbildung 18: Sturzbahn Hohentrattenlahner 10.April.1984 (WLV, 2004) Abbildung 19: Hinterfüllung der Stützverbauung 10.April.1984 (WLV, 2004) Abbildung 20: Übersicht des Nährgebietes am 10.April 1984 (WLV, 2004) Abbildung 21: Vorschlag zur Revision des GZP Bad Bleiberg im Bereich des Hohentrattenlahners (Kulterer, 2004) Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Kennwerte der Meteorologischen Stationen im Arbeitsgebiet (ZAMG, 2004)... 6 Tabelle 2: Temperaturverhältnisse der Station Villacher Alpe (ZAMG, 2004)... 7 Tabelle 3: Maximale Gesamtschneehöhe im Bereich des Arbeitsgebietes ( )... 8 Tabelle 4: Mittlere Maximale Gesamtschneehöhen Tabelle 5: Maximale Monats-Neuschneesumme Tabelle 6: Zahl der Tage mit Schneefall (Mittelwerte )... 9 Tabelle 7: Exposition, Neigungen; Anbruchsfläche und Schneemasse der Abbruchgebiete Tabelle 8: Maximale 1-; 3-Tages und Gesamtschneemengen Tabelle 9: Dimensionalität der verwendeten Verfahren Tabelle 10: Modellparameter der Simulationsmodelle Tabelle 11: Abgrenzungskriterien des Lawinengefahrenzonenplanes nach dem Lawinenerlass
28 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite Literaturverzeichnis Amt der Kärntner Landesregierung, 1994: Kärnten - Seine 131 Gemeinden, Eigenverlag der Kärntner Landesregierung, Klagenfurt BBU-BLEIBERG: Exkursionsführer: Lawinenverbauung auf der Villacher Alpe, Waldbewirtschaftung der BBU am Lawinenhang, 1982 BUWAL, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, et WSL, Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, Eidgenössisches Institut für Schnee und Lawinenforschung, 1990: Richtlinien für den Lawinenverbau im Anbruchgebiet, Bern Davos BMLF, Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, 2000: Lawinen in Österreich, Lawinengefahren und Lawinenschutz. - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien FINA, J., 1985: Diplomarbeit: Landschaftsanalyse und Ortsbildgestaltung Bad Bleiberg, Beiträge zum örtlichen Entwicklungskonzept für einen Kärntner Industrie- Kurort, eingereicht am Institut für Landschaftsgestaltung, Universität für Bodenkultur- Wien FLIRI, F., 1974: Niederschlag und Lufttemperatur im Alpenraum, Wissenschaftliche Alpenvereinshefte, Heft 24, Deutscher und Österreichischer Alpenverein, Innsbruck Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung - WLV, Sektion Kärnten, 1966: Verbauungsprojekt - Lawinen bei Bleiberg, Technischer Bericht Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung -WLV, Sektion Kärnten, 1977: Verbauungsprojekt - Lawinen bei Bleiberg, Technischer Bericht Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung - WLV, Sektion Kärnten, 1979: Gefahrenzonenplan Bad Bleiberg 1979 Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung - WLV, Zentrum für Lawinensimulation, 2003: Lawinensimulationen Hohentrattenlahner, Interner Bericht, unveröffentlicht Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung WLV, Zentrum für Lawinensimulation, 2004: Lawinensimulationen Lawinen Bleiberg, Interner Bericht, unveröffentlicht Gefahrenzonenplan-Verordnung 1976, in: WOHANKA, E., STÜRZENBECHER, K., BLAUENSTEINER, R., JÄGER, F:; (Hrsg.), 1993: Forstrecht mit Kommentar, Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei Gemeinde Bad Bleiberg, 2004: Mündliche Überlieferung Gemeindeamt Bad Bleiberg, Juli 2004 HÜBL, J., LEBER, D., BRAUNER, M., JANU, S., VOLK, G., HOLZINGER, H., GRUBER, H., (2004): WLS Report 99: Dokumentation von Unwetterereignissen in den Gemeinden St. Stefan/Vorderberg und Feistritz an der Gail vom 29. August 2003, im Auftrag der Sektion Kärnten, unveröffentlicht Hydrographisches Zentralbüro, 1994: Die Niederschläge, Schneeverhältnisse und Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum , Beiträge zur Hydrographie Österreichs, Heft Nr. 52, HZB im BMLF, Wien Hydrographisches Zentralbüro, 1998: Hydrographisches Jahrbuch von Österreich 1995, 103. Band, HZB im BMLF, Wien KAGIS KÄRNTEN ATLAS, 2004: vom KLEEMAYR, K. et VOLK, G., 1999: Lawinensimulationsmodell ELBA, Interner Bericht KRAINER, K., 1998: Geologie in Bergsturz - Landschaft - Schütt 1998, Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten, Klagenfurt LIED, K. et BAKKEHOI, S., 1980: Empirical calculations of snow-avalanche run-out distance based on topographic parameters, Journal of Glaciology, Vol. 26, No. 94, Cambridge MAYER, H., EGGER, H., FRAUENDORFER, R. (1971): Die Waldgebiete und Wuchsbezirke Österreichs Entwurf einer neuen Waldgebietsgliederung auf vegetationskundlicher Grundlage, Zentralblatt für das gesamte Forstwesen, Jg. 88 (1971), Heft 3, Österreichischer Agrarverlag, Wien PASCHINGER, H., 1976: Kärnten - Eine geographische Landeskunde / Erster Teil, Verlag des Landesmuseums für Kärnten, Klagenfurt
29 Wildbach- und Lawinenverbauung, 2005 Exkursionsführer Lawinen Bad Bleiberg Seite ROHRER, M. B.; 1992: Züricher Geographischen Schriften 49: Die Schneedecke im Schweizer Alpenraum und ihre Modellierung, Geographische Institut ETH Zürich SCHMIDT, A., 2002: Es fielen die Berg`um bei Villach Katastrophen am Dobratsch und ihre Wahrnehmung, in: Alles Dobratsch- Stadt Blick Berg, KOROSCHITZ, W.(Hg.) 2002; Drava Verlag, Klagenfurt SCHMIDT, R.; 2003: Diplomarbeit: Untersuchung verschiedener digitaler Geländemodelle hinsichtlich ihrer Eignung für die dynamische Lawinensimulation mit dem dreidimensionalen zweiphasigen Simulationsprogramm SAMOS, eingereicht am Institut für Geographie an der Leopold Franzens - Universität Innsbruck STEINHAUSER, F., 1968: Die Schneeverhältnisse im Sonnblickgebiet, in: Jahresbericht des Sonnblickvereins für die Jahre , Springer-Verlag Wien TROSCHL, H., 1980: Klimatographischer Abriss von Kärnten - Klimadaten gemeinde-weise, Schriftenreihe für Raumforschung und Raumplanung, Kärntner Landesregierung, Abt. Landesplanung, Band 21, Klagenfurt WALTER, H., et LIETH, H., 1967: Klimadiagramm-Weltatlas, VEB Gustav Fischer Verlag, Jena ZAMG Kärnten, 2004: Klimadaten der meteorologischen Station Villacher Alpe, Bearbeiter: Mag. Paul Rainer, Klagenfurt 2004 ZAWORKA, J., 1985: Lawinen bedrohen Bleiberg in Bad Bleiberg 1985, Marktgemeinde Bad Bleiberg
Berechnung der Erhöhung der Durchschnittsprämien
 Wolfram Fischer Berechnung der Erhöhung der Durchschnittsprämien Oktober 2004 1 Zusammenfassung Zur Berechnung der Durchschnittsprämien wird das gesamte gemeldete Prämienvolumen Zusammenfassung durch die
Wolfram Fischer Berechnung der Erhöhung der Durchschnittsprämien Oktober 2004 1 Zusammenfassung Zur Berechnung der Durchschnittsprämien wird das gesamte gemeldete Prämienvolumen Zusammenfassung durch die
Vermögensbildung: Sparen und Wertsteigerung bei Immobilien liegen vorn
 An die Redaktionen von Presse, Funk und Fernsehen 32 02. 09. 2002 Vermögensbildung: Sparen und Wertsteigerung bei Immobilien liegen vorn Das aktive Sparen ist nach wie vor die wichtigste Einflussgröße
An die Redaktionen von Presse, Funk und Fernsehen 32 02. 09. 2002 Vermögensbildung: Sparen und Wertsteigerung bei Immobilien liegen vorn Das aktive Sparen ist nach wie vor die wichtigste Einflussgröße
Energetische Klassen von Gebäuden
 Energetische Klassen von Gebäuden Grundsätzlich gibt es Neubauten und Bestandsgebäude. Diese Definition ist immer aktuell. Aber auch ein heutiger Neubau ist in drei (oder vielleicht erst zehn?) Jahren
Energetische Klassen von Gebäuden Grundsätzlich gibt es Neubauten und Bestandsgebäude. Diese Definition ist immer aktuell. Aber auch ein heutiger Neubau ist in drei (oder vielleicht erst zehn?) Jahren
Daten sammeln, darstellen, auswerten
 Vertiefen 1 Daten sammeln, darstellen, auswerten zu Aufgabe 1 Schulbuch, Seite 22 1 Haustiere zählen In der Tabelle rechts stehen die Haustiere der Kinder aus der Klasse 5b. a) Wie oft wurden die Haustiere
Vertiefen 1 Daten sammeln, darstellen, auswerten zu Aufgabe 1 Schulbuch, Seite 22 1 Haustiere zählen In der Tabelle rechts stehen die Haustiere der Kinder aus der Klasse 5b. a) Wie oft wurden die Haustiere
Deutschland-Check Nr. 35
 Beschäftigung älterer Arbeitnehmer Ergebnisse des IW-Unternehmervotums Bericht der IW Consult GmbH Köln, 13. Dezember 2012 Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 21 50668
Beschäftigung älterer Arbeitnehmer Ergebnisse des IW-Unternehmervotums Bericht der IW Consult GmbH Köln, 13. Dezember 2012 Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 21 50668
Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Hamburg und Berlin zu einer Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele
 Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Hamburg und Berlin zu einer Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 4. März 2015 q5337/31319 Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer
Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Hamburg und Berlin zu einer Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 4. März 2015 q5337/31319 Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer
Insiderwissen 2013. Hintergrund
 Insiderwissen 213 XING EVENTS mit der Eventmanagement-Software für Online Eventregistrierung &Ticketing amiando, hat es sich erneut zur Aufgabe gemacht zu analysieren, wie Eventveranstalter ihre Veranstaltungen
Insiderwissen 213 XING EVENTS mit der Eventmanagement-Software für Online Eventregistrierung &Ticketing amiando, hat es sich erneut zur Aufgabe gemacht zu analysieren, wie Eventveranstalter ihre Veranstaltungen
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren
 Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS: VERWENDUNG DICHTEBASIERTER TEILROUTEN
 PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS: VERWENDUNG DICHTEBASIERTER TEILROUTEN Karlsruhe, April 2015 Verwendung dichte-basierter Teilrouten Stellen Sie sich vor, in einem belebten Gebäude,
PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS: VERWENDUNG DICHTEBASIERTER TEILROUTEN Karlsruhe, April 2015 Verwendung dichte-basierter Teilrouten Stellen Sie sich vor, in einem belebten Gebäude,
Deutschland-Check Nr. 34
 Die Staatsverschuldung Deutschlands Ergebnisse des IW-Arbeitnehmervotums Bericht der IW Consult GmbH Köln, 12. November 2012 Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 21
Die Staatsverschuldung Deutschlands Ergebnisse des IW-Arbeitnehmervotums Bericht der IW Consult GmbH Köln, 12. November 2012 Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 21
Pädagogik. Melanie Schewtschenko. Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe. Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig?
 Pädagogik Melanie Schewtschenko Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung.2 2. Warum ist Eingewöhnung
Pädagogik Melanie Schewtschenko Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung.2 2. Warum ist Eingewöhnung
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Übungsbuch für den Grundkurs mit Tipps und Lösungen: Analysis
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Übungsbuch für den Grundkurs mit Tipps und Lösungen: Analysis Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Übungsbuch für den Grundkurs mit Tipps und Lösungen: Analysis Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
1. Einführung 2. 2. Erstellung einer Teillieferung 2. 3. Erstellung einer Teilrechnung 6
 Inhalt 1. Einführung 2 2. Erstellung einer Teillieferung 2 3. Erstellung einer Teilrechnung 6 4. Erstellung einer Sammellieferung/ Mehrere Aufträge zu einem Lieferschein zusammenfassen 11 5. Besonderheiten
Inhalt 1. Einführung 2 2. Erstellung einer Teillieferung 2 3. Erstellung einer Teilrechnung 6 4. Erstellung einer Sammellieferung/ Mehrere Aufträge zu einem Lieferschein zusammenfassen 11 5. Besonderheiten
Würfelt man dabei je genau 10 - mal eine 1, 2, 3, 4, 5 und 6, so beträgt die Anzahl. der verschiedenen Reihenfolgen, in denen man dies tun kann, 60!.
 040304 Übung 9a Analysis, Abschnitt 4, Folie 8 Die Wahrscheinlichkeit, dass bei n - maliger Durchführung eines Zufallexperiments ein Ereignis A ( mit Wahrscheinlichkeit p p ( A ) ) für eine beliebige Anzahl
040304 Übung 9a Analysis, Abschnitt 4, Folie 8 Die Wahrscheinlichkeit, dass bei n - maliger Durchführung eines Zufallexperiments ein Ereignis A ( mit Wahrscheinlichkeit p p ( A ) ) für eine beliebige Anzahl
Güte von Tests. die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 2. Art bei der Testentscheidung, nämlich. falsch ist. Darauf haben wir bereits im Kapitel über
 Güte von s Grundlegendes zum Konzept der Güte Ableitung der Gütefunktion des Gauss im Einstichprobenproblem Grafische Darstellung der Gütefunktionen des Gauss im Einstichprobenproblem Ableitung der Gütefunktion
Güte von s Grundlegendes zum Konzept der Güte Ableitung der Gütefunktion des Gauss im Einstichprobenproblem Grafische Darstellung der Gütefunktionen des Gauss im Einstichprobenproblem Ableitung der Gütefunktion
Outsourcing personalwirtschaftlicher Dienstleistungen in Stadtwerken
 Outsourcing personalwirtschaftlicher Dienstleistungen in Stadtwerken Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse der Diplomarbeit von cand. rer. pol. Stefanie Findeis geschrieben an der Professur BWL II
Outsourcing personalwirtschaftlicher Dienstleistungen in Stadtwerken Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse der Diplomarbeit von cand. rer. pol. Stefanie Findeis geschrieben an der Professur BWL II
Modellbildungssysteme: Pädagogische und didaktische Ziele
 Modellbildungssysteme: Pädagogische und didaktische Ziele Was hat Modellbildung mit der Schule zu tun? Der Bildungsplan 1994 formuliert: "Die schnelle Zunahme des Wissens, die hohe Differenzierung und
Modellbildungssysteme: Pädagogische und didaktische Ziele Was hat Modellbildung mit der Schule zu tun? Der Bildungsplan 1994 formuliert: "Die schnelle Zunahme des Wissens, die hohe Differenzierung und
Dezember 2015 meteorologisch gesehen
 Dezember 2015 meteorologisch gesehen In der Naturwissenschaft ist nicht nur die Planung und Durchführung von Experimenten von großer Wichtigkeit, sondern auch die Auswertung und die grafische Darstellung
Dezember 2015 meteorologisch gesehen In der Naturwissenschaft ist nicht nur die Planung und Durchführung von Experimenten von großer Wichtigkeit, sondern auch die Auswertung und die grafische Darstellung
Festigkeit von FDM-3D-Druckteilen
 Festigkeit von FDM-3D-Druckteilen Häufig werden bei 3D-Druck-Filamenten die Kunststoff-Festigkeit und physikalischen Eigenschaften diskutiert ohne die Einflüsse der Geometrie und der Verschweißung der
Festigkeit von FDM-3D-Druckteilen Häufig werden bei 3D-Druck-Filamenten die Kunststoff-Festigkeit und physikalischen Eigenschaften diskutiert ohne die Einflüsse der Geometrie und der Verschweißung der
Psychologie im Arbeitsschutz
 Fachvortrag zur Arbeitsschutztagung 2014 zum Thema: Psychologie im Arbeitsschutz von Dipl. Ing. Mirco Pretzel 23. Januar 2014 Quelle: Dt. Kaltwalzmuseum Hagen-Hohenlimburg 1. Einleitung Was hat mit moderner
Fachvortrag zur Arbeitsschutztagung 2014 zum Thema: Psychologie im Arbeitsschutz von Dipl. Ing. Mirco Pretzel 23. Januar 2014 Quelle: Dt. Kaltwalzmuseum Hagen-Hohenlimburg 1. Einleitung Was hat mit moderner
Mobile Intranet in Unternehmen
 Mobile Intranet in Unternehmen Ergebnisse einer Umfrage unter Intranet Verantwortlichen aexea GmbH - communication. content. consulting Augustenstraße 15 70178 Stuttgart Tel: 0711 87035490 Mobile Intranet
Mobile Intranet in Unternehmen Ergebnisse einer Umfrage unter Intranet Verantwortlichen aexea GmbH - communication. content. consulting Augustenstraße 15 70178 Stuttgart Tel: 0711 87035490 Mobile Intranet
Vermögensverteilung. Vermögensverteilung. Zehntel mit dem höchsten Vermögen. Prozent 61,1 57,9 19,9 19,0 11,8 11,1 5 0,0 0,0 1,3 2,8 7,0 2,8 6,0
 Vermögensverteilung Erwachsene Bevölkerung nach nach Zehnteln Zehnteln (Dezile), (Dezile), Anteile Anteile am am Gesamtvermögen Gesamtvermögen in Prozent, in Prozent, 2002 2002 und und 2007* 2007* Prozent
Vermögensverteilung Erwachsene Bevölkerung nach nach Zehnteln Zehnteln (Dezile), (Dezile), Anteile Anteile am am Gesamtvermögen Gesamtvermögen in Prozent, in Prozent, 2002 2002 und und 2007* 2007* Prozent
OECD Programme for International Student Assessment PISA 2000. Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest. Deutschland
 OECD Programme for International Student Assessment Deutschland PISA 2000 Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest Beispielaufgaben PISA-Hauptstudie 2000 Seite 3 UNIT ÄPFEL Beispielaufgaben
OECD Programme for International Student Assessment Deutschland PISA 2000 Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest Beispielaufgaben PISA-Hauptstudie 2000 Seite 3 UNIT ÄPFEL Beispielaufgaben
Schleswig-Holstein 2011. Kernfach Mathematik
 Aufgabe 6: Stochastik Vorbemerkung: Führen Sie stets geeignete Zufallsvariablen und Namen für Ereignisse ein. Machen Sie auch Angaben über die Verteilung der jeweiligen Zufallsvariablen. Eine repräsentative
Aufgabe 6: Stochastik Vorbemerkung: Führen Sie stets geeignete Zufallsvariablen und Namen für Ereignisse ein. Machen Sie auch Angaben über die Verteilung der jeweiligen Zufallsvariablen. Eine repräsentative
Statistische Materialien zu Existenzgründung und Selbstständigkeit der Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund
 Statistische Materialien zu Existenzgründung und Selbstständigkeit der Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund in Berlin Diese Studie ist im Rahmen des Projektes Netzwerk ethnische Ökonomie entstanden.
Statistische Materialien zu Existenzgründung und Selbstständigkeit der Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund in Berlin Diese Studie ist im Rahmen des Projektes Netzwerk ethnische Ökonomie entstanden.
Deutliche Mehrheit der Bevölkerung für aktive Sterbehilfe
 Allensbacher Kurzbericht 6. Oktober 2014 Deutliche Mehrheit der Bevölkerung für aktive Sterbehilfe Zwei Drittel sind für die Erlaubnis aktiver Sterbehilfe, 60 Prozent für die Zulassung privater Sterbehilfe-Organsationen.
Allensbacher Kurzbericht 6. Oktober 2014 Deutliche Mehrheit der Bevölkerung für aktive Sterbehilfe Zwei Drittel sind für die Erlaubnis aktiver Sterbehilfe, 60 Prozent für die Zulassung privater Sterbehilfe-Organsationen.
II. Zum Jugendbegleiter-Programm
 II. Zum Jugendbegleiter-Programm A. Zu den Jugendbegleiter/inne/n 1. Einsatz von Jugendbegleiter/inne/n Seit Beginn des Schuljahres 2007/2008 setzen die 501 Modellschulen 7.068 Jugendbegleiter/innen ein.
II. Zum Jugendbegleiter-Programm A. Zu den Jugendbegleiter/inne/n 1. Einsatz von Jugendbegleiter/inne/n Seit Beginn des Schuljahres 2007/2008 setzen die 501 Modellschulen 7.068 Jugendbegleiter/innen ein.
Lineare Funktionen. 1 Proportionale Funktionen 3 1.1 Definition... 3 1.2 Eigenschaften... 3. 2 Steigungsdreieck 3
 Lineare Funktionen Inhaltsverzeichnis 1 Proportionale Funktionen 3 1.1 Definition............................... 3 1.2 Eigenschaften............................. 3 2 Steigungsdreieck 3 3 Lineare Funktionen
Lineare Funktionen Inhaltsverzeichnis 1 Proportionale Funktionen 3 1.1 Definition............................... 3 1.2 Eigenschaften............................. 3 2 Steigungsdreieck 3 3 Lineare Funktionen
Naturgefahrenbeurteilungein integrativer Ansatz
 : Naturgefahrenbeurteilungein integrativer Ansatz Ideen für ein modernes Risikomanagementkonzept Dr. Karl Kleemayr : Aktuelle Erkenntnisse FLOOD RISK ERKENNTNISSE 004 Grenzen des Schutzes und der Verantwortung
: Naturgefahrenbeurteilungein integrativer Ansatz Ideen für ein modernes Risikomanagementkonzept Dr. Karl Kleemayr : Aktuelle Erkenntnisse FLOOD RISK ERKENNTNISSE 004 Grenzen des Schutzes und der Verantwortung
Markus Demary / Michael Voigtländer
 Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 50 Markus Demary / Michael Voigtländer Immobilien 2025 Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Wohn- und Büroimmobilienmärkte
Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 50 Markus Demary / Michael Voigtländer Immobilien 2025 Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Wohn- und Büroimmobilienmärkte
Lichtbrechung an Linsen
 Sammellinsen Lichtbrechung an Linsen Fällt ein paralleles Lichtbündel auf eine Sammellinse, so werden die Lichtstrahlen so gebrochen, dass sie durch einen Brennpunkt der Linse verlaufen. Der Abstand zwischen
Sammellinsen Lichtbrechung an Linsen Fällt ein paralleles Lichtbündel auf eine Sammellinse, so werden die Lichtstrahlen so gebrochen, dass sie durch einen Brennpunkt der Linse verlaufen. Der Abstand zwischen
Urheberrecht in der Schule Was Lehrer, Eltern, Schüler, Medienzentren und Schulbehörden vom Urheberrecht wissen sollten
 Band 2 herausgegeben von Stefan Haupt Stefan Haupt Urheberrecht in der Schule Was Lehrer, Eltern, Schüler, Medienzentren und Schulbehörden vom Urheberrecht wissen sollten 2., überarbeitete Auflage Verlag
Band 2 herausgegeben von Stefan Haupt Stefan Haupt Urheberrecht in der Schule Was Lehrer, Eltern, Schüler, Medienzentren und Schulbehörden vom Urheberrecht wissen sollten 2., überarbeitete Auflage Verlag
Soja-Lebensmittel - Quelle von hochwertigem Eiweiß
 Soja-Lebensmittel - Quelle von hochwertigem Eiweiß Thesenpapier des wissenschaftlichen Beirats der ENSA Einleitung Eiweiß ist ein wichtiger Grundnährstoff, der für das Wachstum und die Reparatur aller
Soja-Lebensmittel - Quelle von hochwertigem Eiweiß Thesenpapier des wissenschaftlichen Beirats der ENSA Einleitung Eiweiß ist ein wichtiger Grundnährstoff, der für das Wachstum und die Reparatur aller
Situa?onsbeschreibung aus Sicht einer Gemeinde
 Ein Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz für Mecklenburg- Vorpommern aus Sicht der Stadt Loitz in Vorpommern Situa?onsbeschreibung aus Sicht einer Gemeinde verschiedene Windkra.anlagen unterschiedlichen
Ein Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz für Mecklenburg- Vorpommern aus Sicht der Stadt Loitz in Vorpommern Situa?onsbeschreibung aus Sicht einer Gemeinde verschiedene Windkra.anlagen unterschiedlichen
Bundesverband Flachglas Großhandel Isolierglasherstellung Veredlung e.v. U g -Werte-Tabellen nach DIN EN 673. Flachglasbranche.
 Bundesverband Flachglas Großhandel Isolierglasherstellung Veredlung e.v. U g -Werte-Tabellen nach DIN EN 673 Ug-Werte für die Flachglasbranche Einleitung Die vorliegende Broschüre enthält die Werte für
Bundesverband Flachglas Großhandel Isolierglasherstellung Veredlung e.v. U g -Werte-Tabellen nach DIN EN 673 Ug-Werte für die Flachglasbranche Einleitung Die vorliegende Broschüre enthält die Werte für
Das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft
 Institut für Wachstumsstudien www.wachstumsstudien.de IWS-Papier Nr. 1 Das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland 1950 2002.............Seite 2 Relatives Wachstum in der
Institut für Wachstumsstudien www.wachstumsstudien.de IWS-Papier Nr. 1 Das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland 1950 2002.............Seite 2 Relatives Wachstum in der
Auswertung zur. Hauptklausur Unternehmensbesteuerung. vom 24.02.10. und Ergebnisse der Kundenbefragung
 Auswertung zur Hauptklausur Unternehmensbesteuerung vom 24.02.10 Vergleich: Skriptteufel-Absolventen vs. alle Teilnehmer und Ergebnisse der Kundenbefragung In diesem Dokument vergleichen wir die Klausurergebnisse
Auswertung zur Hauptklausur Unternehmensbesteuerung vom 24.02.10 Vergleich: Skriptteufel-Absolventen vs. alle Teilnehmer und Ergebnisse der Kundenbefragung In diesem Dokument vergleichen wir die Klausurergebnisse
Politikverständnis und Wahlalter. Ergebnisse einer Studie mit Schülern und Studienanfängern
 Politikverständnis und Wahlalter Ergebnisse einer Studie mit Schülern und Studienanfängern Frage: Lässt sich eine Herabsetzung des Wahlalters in Deutschland durch Ergebnisse zum Politikverständnis bei
Politikverständnis und Wahlalter Ergebnisse einer Studie mit Schülern und Studienanfängern Frage: Lässt sich eine Herabsetzung des Wahlalters in Deutschland durch Ergebnisse zum Politikverständnis bei
1 C H R I S T O P H D R Ö S S E R D E R M A T H E M A T I K V E R F Ü H R E R
 C H R I S T O P H D R Ö S S E R D E R M A T H E M A T I K V E R F Ü H R E R L Ö S U N G E N Seite 7 n Wenn vier Menschen auf einem Quadratmeter stehen, dann hat jeder eine Fläche von 50 mal 50 Zentimeter
C H R I S T O P H D R Ö S S E R D E R M A T H E M A T I K V E R F Ü H R E R L Ö S U N G E N Seite 7 n Wenn vier Menschen auf einem Quadratmeter stehen, dann hat jeder eine Fläche von 50 mal 50 Zentimeter
Professionelle Seminare im Bereich MS-Office
 Der Name BEREICH.VERSCHIEBEN() ist etwas unglücklich gewählt. Man kann mit der Funktion Bereiche zwar verschieben, man kann Bereiche aber auch verkleinern oder vergrößern. Besser wäre es, die Funktion
Der Name BEREICH.VERSCHIEBEN() ist etwas unglücklich gewählt. Man kann mit der Funktion Bereiche zwar verschieben, man kann Bereiche aber auch verkleinern oder vergrößern. Besser wäre es, die Funktion
Melanie Kaspar, Prof. Dr. B. Grabowski 1
 7. Hypothesentests Ausgangssituation: Man muss sich zwischen 2 Möglichkeiten (=Hypothesen) entscheiden. Diese Entscheidung soll mit Hilfe von Beobachtungen ( Stichprobe ) getroffen werden. Die Hypothesen
7. Hypothesentests Ausgangssituation: Man muss sich zwischen 2 Möglichkeiten (=Hypothesen) entscheiden. Diese Entscheidung soll mit Hilfe von Beobachtungen ( Stichprobe ) getroffen werden. Die Hypothesen
Schattenwurf von Windkraftanlagen: Erläuterung zur Simulation
 Bayerisches Landesamt für Umwelt Windkraft Schattenwurf von Windkraftanlagen: Erläuterung zur Simulation Die Bewegung der Rotoren von Windkraftanlagen (WKA) führt zu einem bewegten Schattenwurf, der mit
Bayerisches Landesamt für Umwelt Windkraft Schattenwurf von Windkraftanlagen: Erläuterung zur Simulation Die Bewegung der Rotoren von Windkraftanlagen (WKA) führt zu einem bewegten Schattenwurf, der mit
B 2. " Zeigen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Leiterplatte akzeptiert wird, 0,93 beträgt. (genauerer Wert: 0,933).!:!!
 Das folgende System besteht aus 4 Schraubenfedern. Die Federn A ; B funktionieren unabhängig von einander. Die Ausfallzeit T (in Monaten) der Federn sei eine weibullverteilte Zufallsvariable mit den folgenden
Das folgende System besteht aus 4 Schraubenfedern. Die Federn A ; B funktionieren unabhängig von einander. Die Ausfallzeit T (in Monaten) der Federn sei eine weibullverteilte Zufallsvariable mit den folgenden
50. Mathematik-Olympiade 2. Stufe (Regionalrunde) Klasse 11 13. 501322 Lösung 10 Punkte
 50. Mathematik-Olympiade. Stufe (Regionalrunde) Klasse 3 Lösungen c 00 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.v. www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten. 503 Lösung 0 Punkte Es seien
50. Mathematik-Olympiade. Stufe (Regionalrunde) Klasse 3 Lösungen c 00 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.v. www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten. 503 Lösung 0 Punkte Es seien
Kundenorientierte Produktentwicklung
 Kundenorientierte Produktentwicklung Branchenbezogene Forschung Saskia Ernst und Sabrina Möller Conomic Marketing & Strategy Consultants Weinbergweg 23, 06120 Halle an der Saale Telefon: +49 345. 55 59
Kundenorientierte Produktentwicklung Branchenbezogene Forschung Saskia Ernst und Sabrina Möller Conomic Marketing & Strategy Consultants Weinbergweg 23, 06120 Halle an der Saale Telefon: +49 345. 55 59
Statistische Auswertung:
 Statistische Auswertung: Die erhobenen Daten mittels der selbst erstellten Tests (Surfaufgaben) Statistics Punkte aus dem Punkte aus Surftheorietest Punkte aus dem dem und dem Surftheorietest max.14p.
Statistische Auswertung: Die erhobenen Daten mittels der selbst erstellten Tests (Surfaufgaben) Statistics Punkte aus dem Punkte aus Surftheorietest Punkte aus dem dem und dem Surftheorietest max.14p.
Kapitel 4 Die Datenbank Kuchenbestellung Seite 1
 Kapitel 4 Die Datenbank Kuchenbestellung Seite 1 4 Die Datenbank Kuchenbestellung In diesem Kapitel werde ich die Theorie aus Kapitel 2 Die Datenbank Buchausleihe an Hand einer weiteren Datenbank Kuchenbestellung
Kapitel 4 Die Datenbank Kuchenbestellung Seite 1 4 Die Datenbank Kuchenbestellung In diesem Kapitel werde ich die Theorie aus Kapitel 2 Die Datenbank Buchausleihe an Hand einer weiteren Datenbank Kuchenbestellung
Übung 5 : G = Wärmeflussdichte [Watt/m 2 ] c = spezifische Wärmekapazität k = Wärmeleitfähigkeit = *p*c = Wärmediffusität
![Übung 5 : G = Wärmeflussdichte [Watt/m 2 ] c = spezifische Wärmekapazität k = Wärmeleitfähigkeit = *p*c = Wärmediffusität Übung 5 : G = Wärmeflussdichte [Watt/m 2 ] c = spezifische Wärmekapazität k = Wärmeleitfähigkeit = *p*c = Wärmediffusität](/thumbs/26/9283097.jpg) Übung 5 : Theorie : In einem Boden finden immer Temperaturausgleichsprozesse statt. Der Wärmestrom läßt sich in eine vertikale und horizontale Komponente einteilen. Wir betrachten hier den Wärmestrom in
Übung 5 : Theorie : In einem Boden finden immer Temperaturausgleichsprozesse statt. Der Wärmestrom läßt sich in eine vertikale und horizontale Komponente einteilen. Wir betrachten hier den Wärmestrom in
mehrmals mehrmals mehrmals alle seltener nie mindestens **) in der im Monat im Jahr 1 bis 2 alle 1 bis 2 Woche Jahre Jahre % % % % % % %
 Nicht überraschend, aber auch nicht gravierend, sind die altersspezifischen Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit des Apothekenbesuchs: 24 Prozent suchen mindestens mehrmals im Monat eine Apotheke auf,
Nicht überraschend, aber auch nicht gravierend, sind die altersspezifischen Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit des Apothekenbesuchs: 24 Prozent suchen mindestens mehrmals im Monat eine Apotheke auf,
Allensbach: Das Elterngeld im Urteil der jungen Eltern
 August 2007 Allensbach: Das Elterngeld im Urteil der jungen Eltern Allensbach befragte im Juni 2007 eine repräsentative Stichprobe von 1000 Müttern und Vätern, deren (jüngstes) Kind ab dem 1.1.2007 geboren
August 2007 Allensbach: Das Elterngeld im Urteil der jungen Eltern Allensbach befragte im Juni 2007 eine repräsentative Stichprobe von 1000 Müttern und Vätern, deren (jüngstes) Kind ab dem 1.1.2007 geboren
Definition und Abgrenzung des Biodiversitätsschadens
 Fachtagung Schöner Schaden! Biodiversitätsschäden in der Umwelthaftungsrichtlinie Definition und Abgrenzung des Biodiversitätsschadens Universität für Bodenkultur Wien Department für Raum, Landschaft und
Fachtagung Schöner Schaden! Biodiversitätsschäden in der Umwelthaftungsrichtlinie Definition und Abgrenzung des Biodiversitätsschadens Universität für Bodenkultur Wien Department für Raum, Landschaft und
Die Zukunft der Zukunftsforschung im Deutschen Management: eine Delphi Studie
 Die Zukunft der Zukunftsforschung im Deutschen Management: eine Delphi Studie Executive Summary Zukunftsforschung und ihre Methoden erfahren in der jüngsten Vergangenheit ein zunehmendes Interesse. So
Die Zukunft der Zukunftsforschung im Deutschen Management: eine Delphi Studie Executive Summary Zukunftsforschung und ihre Methoden erfahren in der jüngsten Vergangenheit ein zunehmendes Interesse. So
2 Aufbau der Arbeit und wissenschaftliche Problemstellung
 2 Aufbau der Arbeit und wissenschaftliche Problemstellung Nach der Definition der grundlegenden Begriffe, die in dieser Arbeit verwendet werden, soll die Ausbildung, wie sie von der Verfasserin für Schüler
2 Aufbau der Arbeit und wissenschaftliche Problemstellung Nach der Definition der grundlegenden Begriffe, die in dieser Arbeit verwendet werden, soll die Ausbildung, wie sie von der Verfasserin für Schüler
Der Leverage-Effekt wirkt sich unter verschiedenen Umständen auf die Eigenkapitalrendite aus.
 Anhang Leverage-Effekt Leverage-Effekt Bezeichnungs- Herkunft Das englische Wort Leverage heisst Hebelwirkung oder Hebelkraft. Zweck Der Leverage-Effekt wirkt sich unter verschiedenen Umständen auf die
Anhang Leverage-Effekt Leverage-Effekt Bezeichnungs- Herkunft Das englische Wort Leverage heisst Hebelwirkung oder Hebelkraft. Zweck Der Leverage-Effekt wirkt sich unter verschiedenen Umständen auf die
1 Einleitung. 1.1 Motivation und Zielsetzung der Untersuchung
 1 Einleitung 1.1 Motivation und Zielsetzung der Untersuchung Obgleich Tourenplanungsprobleme zu den am häufigsten untersuchten Problemstellungen des Operations Research zählen, konzentriert sich der Großteil
1 Einleitung 1.1 Motivation und Zielsetzung der Untersuchung Obgleich Tourenplanungsprobleme zu den am häufigsten untersuchten Problemstellungen des Operations Research zählen, konzentriert sich der Großteil
Zusammenfassende Beurteilung der Unterrichtsbeispiele für Wirtschaft und Recht
 Zusammenfassende Beurteilung der Unterrichtsbeispiele für Wirtschaft und Recht In die Auswertung der Beurteilungen der Unterrichtsbeispiele gingen von Seiten der SchülerInnen insgesamt acht Items ein,
Zusammenfassende Beurteilung der Unterrichtsbeispiele für Wirtschaft und Recht In die Auswertung der Beurteilungen der Unterrichtsbeispiele gingen von Seiten der SchülerInnen insgesamt acht Items ein,
Arbeitsmarkteffekte von Umschulungen im Bereich der Altenpflege
 Aktuelle Berichte Arbeitsmarkteffekte von Umschulungen im Bereich der Altenpflege 19/2015 In aller Kürze Im Bereich der Weiterbildungen mit Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf für Arbeitslose
Aktuelle Berichte Arbeitsmarkteffekte von Umschulungen im Bereich der Altenpflege 19/2015 In aller Kürze Im Bereich der Weiterbildungen mit Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf für Arbeitslose
CTI SYSTEMS S.A. CTI SYSTEMS S.A. 12, op der Sang. Fax: +352/2685-3000 L- 9779 Lentzweiler. Email: cti@ctisystems.com G.D.
 Z.I. Eselborn - Lentzweiler Phone: +352/2685-2000 12, op der Sang Fax: +352/2685-3000 L- 9779 Lentzweiler Email: cti@ctisystems.com G.D. Luxembourg URL: www.ctisystems.com Benutzung von Höhensicherungsgeräten
Z.I. Eselborn - Lentzweiler Phone: +352/2685-2000 12, op der Sang Fax: +352/2685-3000 L- 9779 Lentzweiler Email: cti@ctisystems.com G.D. Luxembourg URL: www.ctisystems.com Benutzung von Höhensicherungsgeräten
Kleine Anfrage mit Antwort
 Niedersächsischer Landtag 16. Wahlperiode Drucksache 16/1659 Kleine Anfrage mit Antwort Wortlaut der Kleinen Anfrage der Abgeordneten Ina Korter (GRÜNE), eingegangen am 29.07.2009 Zwischenbilanz nach vier
Niedersächsischer Landtag 16. Wahlperiode Drucksache 16/1659 Kleine Anfrage mit Antwort Wortlaut der Kleinen Anfrage der Abgeordneten Ina Korter (GRÜNE), eingegangen am 29.07.2009 Zwischenbilanz nach vier
Approximation durch Taylorpolynome
 TU Berlin Fakultät II - Mathematik und Naturwissenschaften Sekretariat MA 4-1 Straße des 17. Juni 10623 Berlin Hochschultag Approximation durch Taylorpolynome Im Rahmen der Schülerinnen- und Schüler-Uni
TU Berlin Fakultät II - Mathematik und Naturwissenschaften Sekretariat MA 4-1 Straße des 17. Juni 10623 Berlin Hochschultag Approximation durch Taylorpolynome Im Rahmen der Schülerinnen- und Schüler-Uni
Info zum Zusammenhang von Auflösung und Genauigkeit
 Da es oft Nachfragen und Verständnisprobleme mit den oben genannten Begriffen gibt, möchten wir hier versuchen etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Nehmen wir mal an, Sie haben ein Stück Wasserrohr mit der
Da es oft Nachfragen und Verständnisprobleme mit den oben genannten Begriffen gibt, möchten wir hier versuchen etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Nehmen wir mal an, Sie haben ein Stück Wasserrohr mit der
Erster Prüfungsteil: Aufgabe 1
 Erster Prüfungsteil: Aufgabe Kriterien: Der Prüfling Lösung: Punkte: a) entscheidet sich für passenden Wert 8 000 000 b) wählt ein geeignetes Verfahren zur z. B. Dreisatz Berechnung gibt das richtige Ergebnis
Erster Prüfungsteil: Aufgabe Kriterien: Der Prüfling Lösung: Punkte: a) entscheidet sich für passenden Wert 8 000 000 b) wählt ein geeignetes Verfahren zur z. B. Dreisatz Berechnung gibt das richtige Ergebnis
Das Klimaphänomen El Niño - Seine Auswirkungen auf die globalen Ernten. Andreas Gau
 Das Klimaphänomen El Niño - Seine Auswirkungen auf die globalen Ernten Andreas Gau Knechtsteden 02.02.2015 Übersicht Einführung Klimaanomalien neutrale Situation, El Niño und La Niña betroffenen Regionen
Das Klimaphänomen El Niño - Seine Auswirkungen auf die globalen Ernten Andreas Gau Knechtsteden 02.02.2015 Übersicht Einführung Klimaanomalien neutrale Situation, El Niño und La Niña betroffenen Regionen
Im Jahr t = 0 hat eine Stadt 10.000 Einwohner. Nach 15 Jahren hat sich die Einwohnerzahl verdoppelt. z(t) = at + b
 Aufgabe 1: Im Jahr t = 0 hat eine Stadt 10.000 Einwohner. Nach 15 Jahren hat sich die Einwohnerzahl verdoppelt. (a) Nehmen Sie lineares Wachstum gemäß z(t) = at + b an, wobei z die Einwohnerzahl ist und
Aufgabe 1: Im Jahr t = 0 hat eine Stadt 10.000 Einwohner. Nach 15 Jahren hat sich die Einwohnerzahl verdoppelt. (a) Nehmen Sie lineares Wachstum gemäß z(t) = at + b an, wobei z die Einwohnerzahl ist und
Wasserkraft früher und heute!
 Wasserkraft früher und heute! Wasserkraft leistet heute einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung in Österreich und auf der ganzen Welt. Aber war das schon immer so? Quelle: Elvina Schäfer, FOTOLIA In
Wasserkraft früher und heute! Wasserkraft leistet heute einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung in Österreich und auf der ganzen Welt. Aber war das schon immer so? Quelle: Elvina Schäfer, FOTOLIA In
Glaube an die Existenz von Regeln für Vergleiche und Kenntnis der Regeln
 Glaube an die Existenz von Regeln für Vergleiche und Kenntnis der Regeln Regeln ja Regeln nein Kenntnis Regeln ja Kenntnis Regeln nein 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Glauben Sie, dass
Glaube an die Existenz von Regeln für Vergleiche und Kenntnis der Regeln Regeln ja Regeln nein Kenntnis Regeln ja Kenntnis Regeln nein 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Glauben Sie, dass
(beschlossen in der Sitzung des Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision am 1. Dezember 2010 als Fachgutachten KFS/VU 2) Inhaltsverzeichnis
 Fachgutachten des Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision der Kammer der Wirtschaftstreuhänder über Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen von Versicherungsunternehmen
Fachgutachten des Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision der Kammer der Wirtschaftstreuhänder über Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen von Versicherungsunternehmen
Die deutsche Vereinigung - 1989 bis 2015 - Positionen der Bürgerinnen und Bürger. Berlin, 23. Juni 2015
 Die deutsche Vereinigung - 1989 bis 2015 - Positionen der Bürgerinnen und Bürger Berlin, 23. Juni 2015 1 Die deutsche Vereinigung im Ergebnis der friedlichen Revolution und in Verbindung mit dem Zerfall
Die deutsche Vereinigung - 1989 bis 2015 - Positionen der Bürgerinnen und Bürger Berlin, 23. Juni 2015 1 Die deutsche Vereinigung im Ergebnis der friedlichen Revolution und in Verbindung mit dem Zerfall
Abschlußbericht der Fachkonferenzen Deutsch / Englisch/Mathematik mit der Auswertung der Erfahrungen der Lernstandserhebung 2008.
 Abschlußbericht der Fachkonferenzen Deutsch / Englisch/Mathematik mit der Auswertung der Erfahrungen der Lernstandserhebung 2008. Zusammen gefasst von D.Baer (Mittelstufenkoordinator) Einhard Gymnasium
Abschlußbericht der Fachkonferenzen Deutsch / Englisch/Mathematik mit der Auswertung der Erfahrungen der Lernstandserhebung 2008. Zusammen gefasst von D.Baer (Mittelstufenkoordinator) Einhard Gymnasium
Kundenorientierung ist wichtigster Wachstumstreiber in Europa
 Fragen zur Studie beantworten Andreas Scheuermann 0177 50 57 300 Presse.de@mercuriurval.com oder Dr. Cora Steigenberger 040 85 17 16-0 Mercuri Urval Studie Hintergründe und Details Kundenorientierung ist
Fragen zur Studie beantworten Andreas Scheuermann 0177 50 57 300 Presse.de@mercuriurval.com oder Dr. Cora Steigenberger 040 85 17 16-0 Mercuri Urval Studie Hintergründe und Details Kundenorientierung ist
Aufgabensammlung Bruchrechnen
 Aufgabensammlung Bruchrechnen Inhaltsverzeichnis Bruchrechnung. Kürzen und Erweitern.................................. 4. Addition von Brüchen................................... Multiplikation von Brüchen...............................
Aufgabensammlung Bruchrechnen Inhaltsverzeichnis Bruchrechnung. Kürzen und Erweitern.................................. 4. Addition von Brüchen................................... Multiplikation von Brüchen...............................
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der euromicron Aktiengesellschaft communication & control technology mit Sitz in Frankfurt am Main und der - nachfolgend "Organträgerin" - euromicron
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der euromicron Aktiengesellschaft communication & control technology mit Sitz in Frankfurt am Main und der - nachfolgend "Organträgerin" - euromicron
Bericht für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer
 Bericht Restaurant Alfsee Piazza 1/8 Bericht für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer Innenansicht des Restaurants Restaurant Alfsee Piazza Anschrift Alfsee GmbH Am Campingpark 10 49597 Rieste
Bericht Restaurant Alfsee Piazza 1/8 Bericht für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer Innenansicht des Restaurants Restaurant Alfsee Piazza Anschrift Alfsee GmbH Am Campingpark 10 49597 Rieste
Internet- und E-Mail-Überwachung in Unternehmen und Organisationen
 Publiziert in SWITCHjournal 1/2004 Internet- und E-Mail-Überwachung in Unternehmen und Organisationen Dr. Ursula Widmer, Rechtsanwältin, Bern ursula.widmer@widmerpartners-lawyers.ch Die Nutzung von Internet
Publiziert in SWITCHjournal 1/2004 Internet- und E-Mail-Überwachung in Unternehmen und Organisationen Dr. Ursula Widmer, Rechtsanwältin, Bern ursula.widmer@widmerpartners-lawyers.ch Die Nutzung von Internet
Lernerfolge sichern - Ein wichtiger Beitrag zu mehr Motivation
 Lernerfolge sichern - Ein wichtiger Beitrag zu mehr Motivation Einführung Mit welchen Erwartungen gehen Jugendliche eigentlich in ihre Ausbildung? Wir haben zu dieser Frage einmal die Meinungen von Auszubildenden
Lernerfolge sichern - Ein wichtiger Beitrag zu mehr Motivation Einführung Mit welchen Erwartungen gehen Jugendliche eigentlich in ihre Ausbildung? Wir haben zu dieser Frage einmal die Meinungen von Auszubildenden
Plotten von Linien ( nach Jack Bresenham, 1962 )
 Plotten von Linien ( nach Jack Bresenham, 1962 ) Ac Eine auf dem Bildschirm darzustellende Linie sieht treppenförmig aus, weil der Computer Linien aus einzelnen (meist quadratischen) Bildpunkten, Pixels
Plotten von Linien ( nach Jack Bresenham, 1962 ) Ac Eine auf dem Bildschirm darzustellende Linie sieht treppenförmig aus, weil der Computer Linien aus einzelnen (meist quadratischen) Bildpunkten, Pixels
Was ist aus der ersten Generation von Unternehmergesellschaften geworden?
 Prof. Dr. Walter Bayer / Dipl.-Kfm. Thomas Hoffmann, Jena Was ist aus der ersten Generation von Unternehmergesellschaften geworden? In diesen und den nächsten Tagen begehen die ersten Unternehmergesellschaften
Prof. Dr. Walter Bayer / Dipl.-Kfm. Thomas Hoffmann, Jena Was ist aus der ersten Generation von Unternehmergesellschaften geworden? In diesen und den nächsten Tagen begehen die ersten Unternehmergesellschaften
Erstellung von Reports mit Anwender-Dokumentation und System-Dokumentation in der ArtemiS SUITE (ab Version 5.0)
 Erstellung von und System-Dokumentation in der ArtemiS SUITE (ab Version 5.0) In der ArtemiS SUITE steht eine neue, sehr flexible Reporting-Funktion zur Verfügung, die mit der Version 5.0 noch einmal verbessert
Erstellung von und System-Dokumentation in der ArtemiS SUITE (ab Version 5.0) In der ArtemiS SUITE steht eine neue, sehr flexible Reporting-Funktion zur Verfügung, die mit der Version 5.0 noch einmal verbessert
FRAGE 39. Gründe, aus denen die Rechte von Patentinhabern beschränkt werden können
 Jahrbuch 1963, Neue Serie Nr. 13, 1. Teil, 66. Jahrgang, Seite 132 25. Kongress von Berlin, 3. - 8. Juni 1963 Der Kongress ist der Auffassung, dass eine Beschränkung der Rechte des Patentinhabers, die
Jahrbuch 1963, Neue Serie Nr. 13, 1. Teil, 66. Jahrgang, Seite 132 25. Kongress von Berlin, 3. - 8. Juni 1963 Der Kongress ist der Auffassung, dass eine Beschränkung der Rechte des Patentinhabers, die
Media Teil III. Begriffe, Definitionen, Übungen
 Media Teil III. Begriffe, Definitionen, Übungen Kapitel 1 (Intermedia- Vergleich: Affinität) 1 Affinitätsbewertung als Mittel des Intermedia-Vergleichs Um die Streugenauigkeit eines Werbeträgers zu bestimmen,
Media Teil III. Begriffe, Definitionen, Übungen Kapitel 1 (Intermedia- Vergleich: Affinität) 1 Affinitätsbewertung als Mittel des Intermedia-Vergleichs Um die Streugenauigkeit eines Werbeträgers zu bestimmen,
1. Was sind Aufgaben?... 1 2. Aufgaben einrichten... 2 3. Ansicht für die Teilnehmer/innen... 3
 AG elearning Service und Beratung für E-Learning und Mediendidaktik ZEIK Zentrale Einrichtung für Informationsverarbeitung und Kommunikation Moodle an der Universität-Potsdam How-To: Aufgaben Inhalt: 1.
AG elearning Service und Beratung für E-Learning und Mediendidaktik ZEIK Zentrale Einrichtung für Informationsverarbeitung und Kommunikation Moodle an der Universität-Potsdam How-To: Aufgaben Inhalt: 1.
Bürger legen Wert auf selbstbestimmtes Leben
 PRESSEINFORMATION Umfrage Patientenverfügung Bürger legen Wert auf selbstbestimmtes Leben Ergebnisse der forsa-umfrage zur Patientenverfügung im Auftrag von VorsorgeAnwalt e.v. Der Verband VorsorgeAnwalt
PRESSEINFORMATION Umfrage Patientenverfügung Bürger legen Wert auf selbstbestimmtes Leben Ergebnisse der forsa-umfrage zur Patientenverfügung im Auftrag von VorsorgeAnwalt e.v. Der Verband VorsorgeAnwalt
Protokoll des Versuches 7: Umwandlung von elektrischer Energie in Wärmeenergie
 Name: Matrikelnummer: Bachelor Biowissenschaften E-Mail: Physikalisches Anfängerpraktikum II Dozenten: Assistenten: Protokoll des Versuches 7: Umwandlung von elektrischer Energie in ärmeenergie Verantwortlicher
Name: Matrikelnummer: Bachelor Biowissenschaften E-Mail: Physikalisches Anfängerpraktikum II Dozenten: Assistenten: Protokoll des Versuches 7: Umwandlung von elektrischer Energie in ärmeenergie Verantwortlicher
www.mathe-aufgaben.com
 Abiturprüfung Mathematik Baden-Württemberg (ohne CAS) Pflichtteil Aufgaben Aufgabe : ( VP) Bilden Sie die erste Ableitung der Funktion f mit sin() f() =. Aufgabe : ( VP) Berechnen Sie das Integral ( )
Abiturprüfung Mathematik Baden-Württemberg (ohne CAS) Pflichtteil Aufgaben Aufgabe : ( VP) Bilden Sie die erste Ableitung der Funktion f mit sin() f() =. Aufgabe : ( VP) Berechnen Sie das Integral ( )
Wirtschaftsstruktur Allschwil 2003
 Wirtschaftsstruktur Allschwil 2003 Von Dr. Rainer Füeg, Wirtschaftsstudie Nordwestschweiz 1. Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde Allschwil Wirtschaftsstrukturen lassen sich anhand der Zahl der Beschäftigten
Wirtschaftsstruktur Allschwil 2003 Von Dr. Rainer Füeg, Wirtschaftsstudie Nordwestschweiz 1. Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde Allschwil Wirtschaftsstrukturen lassen sich anhand der Zahl der Beschäftigten
Erfahrungen mit Hartz IV- Empfängern
 Erfahrungen mit Hartz IV- Empfängern Ausgewählte Ergebnisse einer Befragung von Unternehmen aus den Branchen Gastronomie, Pflege und Handwerk Pressegespräch der Bundesagentur für Arbeit am 12. November
Erfahrungen mit Hartz IV- Empfängern Ausgewählte Ergebnisse einer Befragung von Unternehmen aus den Branchen Gastronomie, Pflege und Handwerk Pressegespräch der Bundesagentur für Arbeit am 12. November
Ergebnis und Auswertung der BSV-Online-Umfrage zur dienstlichen Beurteilung
 Ergebnis und Auswertung der BSV-Online-Umfrage zur dienstlichen Beurteilung Es waren exakt 237 Rückmeldungen, die wir erhalten, gesammelt und ausgewertet haben und damit ein Vielfaches von dem, was wir
Ergebnis und Auswertung der BSV-Online-Umfrage zur dienstlichen Beurteilung Es waren exakt 237 Rückmeldungen, die wir erhalten, gesammelt und ausgewertet haben und damit ein Vielfaches von dem, was wir
Ein Vorwort, das Sie lesen müssen!
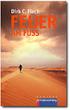 Ein Vorwort, das Sie lesen müssen! Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer am Selbststudium, herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für ein ausgezeichnetes Stenografiesystem entschieden. Sie
Ein Vorwort, das Sie lesen müssen! Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer am Selbststudium, herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für ein ausgezeichnetes Stenografiesystem entschieden. Sie
Leo Baumfeld. Risikoanalyse. Begleiter: ÖAR-Regionalberatung GmbH. Fichtegasse 2 A-1010 Wien. Tel. 01/512 15 95-17, Fax DW 10 Mobil: 0664/43 17 302
 Instrument Risikoanalyse Begleiter: ÖAR-Regionalberatung GmbH Tel. 01/512 15 95-17, Fax DW 10 Mobil: 0664/43 17 302 e-mail: baumfeld@oear.co.at www.oear.at Wien, April 2009 Seite 1 Risikoanalyse Es lohnt
Instrument Risikoanalyse Begleiter: ÖAR-Regionalberatung GmbH Tel. 01/512 15 95-17, Fax DW 10 Mobil: 0664/43 17 302 e-mail: baumfeld@oear.co.at www.oear.at Wien, April 2009 Seite 1 Risikoanalyse Es lohnt
Warum Prozessschutz Was heißt das? Definitionen Ziele Begründungen. von. Dr. Georg Verbücheln
 Warum Prozessschutz Was heißt das? Definitionen Ziele Begründungen von Dr. Georg Verbücheln Einleitung Die Vilmer Thesen Umsetzung von Prozessschutz in der Naturschutzpraxis A Entstehung und Inhalt der
Warum Prozessschutz Was heißt das? Definitionen Ziele Begründungen von Dr. Georg Verbücheln Einleitung Die Vilmer Thesen Umsetzung von Prozessschutz in der Naturschutzpraxis A Entstehung und Inhalt der
Trainingsplan 16-wöchiger Trainingsplan für einen Triathlon (Volkstriathlon), Einsteiger
 Trainingsplan 16-wöchiger Trainingsplan für einen Triathlon (Volkstriathlon), Einsteiger Der Triathlon erfreut sich großer Beliebtheit unter Multisportlern. Neben den bekannten Veranstaltungsformaten wie
Trainingsplan 16-wöchiger Trainingsplan für einen Triathlon (Volkstriathlon), Einsteiger Der Triathlon erfreut sich großer Beliebtheit unter Multisportlern. Neben den bekannten Veranstaltungsformaten wie
1 Mathematische Grundlagen
 Mathematische Grundlagen - 1-1 Mathematische Grundlagen Der Begriff der Menge ist einer der grundlegenden Begriffe in der Mathematik. Mengen dienen dazu, Dinge oder Objekte zu einer Einheit zusammenzufassen.
Mathematische Grundlagen - 1-1 Mathematische Grundlagen Der Begriff der Menge ist einer der grundlegenden Begriffe in der Mathematik. Mengen dienen dazu, Dinge oder Objekte zu einer Einheit zusammenzufassen.
Ein Einfaches AIDS Modell
 Ein Einfaches AIDS Modell Martin Bauer: 990395 Guntram Rümmele: 99008 Das SIR - Modell Die Modellierung von epidemischen Modellen hat schon lange Tradition. Man hat schon immer versucht Erklärungen für
Ein Einfaches AIDS Modell Martin Bauer: 990395 Guntram Rümmele: 99008 Das SIR - Modell Die Modellierung von epidemischen Modellen hat schon lange Tradition. Man hat schon immer versucht Erklärungen für
Durch diese Anleitung soll eine einheitliche Vorgehensweise bei der Vermessung und Bewertung von Golfplätzen sichergestellt werden.
 Da die Länge der Spielbahnen auch unter dem Course-Rating-System (CRS) das wichtigste Bewertungskriterium für einen Golfplatz darstellt, ist die korrekte Vermessung der Spielbahnen eine unverzichtbar notwendige
Da die Länge der Spielbahnen auch unter dem Course-Rating-System (CRS) das wichtigste Bewertungskriterium für einen Golfplatz darstellt, ist die korrekte Vermessung der Spielbahnen eine unverzichtbar notwendige
Kompetenzen und Aufgabenbeispiele Englisch Schreiben
 Institut für Bildungsevaluation Assoziiertes Institut der Universität Zürich Kompetenzen und Aufgabenbeispiele Englisch Schreiben Informationen für Lehrpersonen und Eltern 1. Wie sind die Ergebnisse dargestellt?
Institut für Bildungsevaluation Assoziiertes Institut der Universität Zürich Kompetenzen und Aufgabenbeispiele Englisch Schreiben Informationen für Lehrpersonen und Eltern 1. Wie sind die Ergebnisse dargestellt?
Meinungen zum Sterben Emnid-Umfrage 2001
 Meinungen zum Sterben Emnid-Umfrage 2001 Als Interessenvertretung der Schwerstkranken und Sterbenden beschäftigt sich die Deutsche Hospiz Stiftung seit ihrer Gründung 1995 mit dem Thema "Sterben in Deutschland".
Meinungen zum Sterben Emnid-Umfrage 2001 Als Interessenvertretung der Schwerstkranken und Sterbenden beschäftigt sich die Deutsche Hospiz Stiftung seit ihrer Gründung 1995 mit dem Thema "Sterben in Deutschland".
Behörde für Bildung und Sport Abitur 2008 Lehrermaterialien zum Leistungskurs Mathematik
 Abitur 8 II. Insektenpopulation LA/AG In den Tropen legen die Weibchen einer in Deutschland unbekannten Insektenpopulation jedes Jahr kurz vor Beginn der Regenzeit jeweils 9 Eier und sterben bald darauf.
Abitur 8 II. Insektenpopulation LA/AG In den Tropen legen die Weibchen einer in Deutschland unbekannten Insektenpopulation jedes Jahr kurz vor Beginn der Regenzeit jeweils 9 Eier und sterben bald darauf.
1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG definiert die Anlageberatung als die
 Die gesetzliche Definition der Anlageberatung 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG definiert die Anlageberatung als die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte
Die gesetzliche Definition der Anlageberatung 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG definiert die Anlageberatung als die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte
Handbuch ECDL 2003 Modul 2: Computermanagement und Dateiverwaltung Der Task-Manager
 Handbuch ECDL 2003 Modul 2: Computermanagement und Dateiverwaltung Der Task-Manager Dateiname: ecdl2_03_05_documentation Speicherdatum: 22.11.2004 ECDL 2003 Modul 2 Computermanagement und Dateiverwaltung
Handbuch ECDL 2003 Modul 2: Computermanagement und Dateiverwaltung Der Task-Manager Dateiname: ecdl2_03_05_documentation Speicherdatum: 22.11.2004 ECDL 2003 Modul 2 Computermanagement und Dateiverwaltung
8.2 Thermodynamische Gleichgewichte, insbesondere Gleichgewichte in Mehrkomponentensystemen Mechanisches und thermisches Gleichgewicht
 8.2 Thermodynamische Gleichgewichte, insbesondere Gleichgewichte in Mehrkomponentensystemen Mechanisches und thermisches Gleichgewicht 8.2-1 Stoffliches Gleichgewicht Beispiel Stickstoff Sauerstoff: Desweiteren
8.2 Thermodynamische Gleichgewichte, insbesondere Gleichgewichte in Mehrkomponentensystemen Mechanisches und thermisches Gleichgewicht 8.2-1 Stoffliches Gleichgewicht Beispiel Stickstoff Sauerstoff: Desweiteren
