Vorlesung: Mechanische Verfahrenstechnik Praktikum: Pulverfließeigenschaften und Silodimensionierung
|
|
|
- Clara Böhm
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Vorlesung: Mechanische Verfahrenstechnik Praktikum: Pulverfließeigenschaften und Silodimensionierung 1 Einleitung und Problemstellung Es gibt nur wenige Zweige einer Volkswirtschaft, in der nicht in irgendeiner Form kohäsive Schüttgüter erzeugt, transportiert, umgeschlagen, gelagert, verfahrenstechnisch gewandelt, verarbeitet oder verbraucht werden. Bei den mechanischen Prozessen, d.h. Trenn- und Misch-, Zerkleinerungs- und Agglomerationsprozessen, aber auch thermischen Prozessen, wie z.b. Trocknen und bei heterogenen chemischen Reaktionen in der chemischen Industrie bzw. Grundstoffindustrie, Metallurgie, Glas- und Keramikindustrie, Baustoffindustrie, Leichtund Lebensmittelindustrie, Energiewirtschaft, Landwirtschaft sowie den modernsten Technologien in der Umweltschutztechnik, Werkstofftechnik, Biotechnik und Elektronik müssen Schüttgüter gelagert, gefördert und dosiert werden. Bunker bzw. Silos sind als Schüttgutspeicher ein wesentliches Element von verfahrenstechnischen Haupt-, Hilfs- und Nebenanlagen unterschiedlichster Industriezweige und der Landwirtschaft. Die hauptsächlichsten technologischen Probleme stellen Fließstörungen kohäsiver Schüttgüter durch Schacht- oder Brückenbildung, schwankende Mengenströme, Entmischungen, breite Verweilzeitverteilungen verbunden mit der Gefahr von Zeitverfestigungen, Explosionsgefahr und Verderbgefahr sowie mangelhafte Füllstands-kontrolle, Havariegefahr durch Überlastungen der Bauwerke und Fördertechnik und letztlich mangelhafte Verfügbarkeit der gesamten Bunkeranlage dar. 2 Aufgabenstellung Mit dem im Schüttgutlabor des Instituts für Verfahrenstechnik vorhandenem Ringschergerät RST-XS.s (siehe Abbildung 1 b) sind für das zu untersuchende Schüttgut die Schüttgutkennwerte sowie, die Wandreibung zu bestimmen und ein Massenfluss- bzw. Kernflussbunker auszulegen. Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik 1
2 a) b) Abbildung 1: a) Scherzellenprinzip; b) Ringschergerät RST-XS.s [1] 3 Versuchsdurchführung 3.1 Ermittlung der Momentanfließorte (Normallasten: 2000; 4000; 8000; Pa) Schüttgut locker in den Bodenring füllen (darf beim Füllen nicht verdichtet werden) Überstehendes Schüttgut mit einem Spachtel zunächst in einer Zick-Zack-Bewegung gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig abstreifen. Danach den Spachtel wie in Abbildung 2 a) dargestellt gegen den Uhrzeigersinn führen. Bodenring mit Inhalt wiegen. Gesamtmasse in Software RST-CONTROL 95 eingeben. Messablauf starten und den Anweisungen folgen. Nach jedem Durchgang neu befüllen! Bodenring der Scherzelle Spachtel - max. 10 Spachtel a) b) Abbildung 2: Abstreichen der Schüttgutoberfläche [2] Bodenring Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik 2
3 3.2 Ermittlung des Wandfließortes Vorbereiten der Wandscherzelle: ausreichende Anzahl von Distanzringen und die Wandmaterialprobe in den Bodenring legen, sodass der Abstand zwischen der Oberfläche der Wandmaterialprobe und dem oberen Rand des Bodenrings etwa 4 mm beträgt. Wiegen des Bodenrings mit Distanzringen und der Wandmaterialprobe, jedoch ohne Schüttgut. Weitere Schritte wie unter Versuchsauswertung 4.1 Modellgestützte numerische Auswertung der Fließorte In den meisten Fällen lassen sich Fließorte durch eine Gerade mit ausreichender Genauigkeit beschreiben. Es ergibt sich die folgende Fließortgleichung (τ c Kohäsion, siehe Manuskript MVT Kap ): τ = tan (φ i ) σ + τ c = tan (φ i ) (σ + σ z ) (1) Diese wird mittels linearer Regression der Abscherwerte ermittelt und ausgewertet. Alle Fließkennwerte der vier Fließorte für beginnendes Fließen lassen sich dann wie folgt berechnen (vgl. VO MVT Folien 6.20 bis 6.24): Die einaxiale Druckfestigkeit jedes Fließortes: σ 1 = σ aa + τ c cos(φ i ) (σ aa sin(φ i ) + τ c cos(φ i )) 2 τ 2 aa cos 2 (φ i ) 1 sin(φ i ) (2) Der effektive (innere) Reibungswinkel: φ e = arcsin σ 1 sss(φ i ) + τ c ccc(φ i ) (3) σ 1 τ c ccc(φ i ) Die kleinste Hauptspannung (2-dimensionaler Spannungszustand): Die Mittelpunktspannung beim stationären Fließen: σ 2 = 1 sin(φ e) 1 + sin(φ e ) σ 1 (4) σ M,ss = σ 1 + σ 2 2 (5) Die Radiusspannung beim stationären Fließen: σ R,ss = σ 1 σ 2 2 (6) Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik 3
4 Der stationäre Fließort (SFO) wird durch das Auftragen des Radius beim stationären Fließen über der zugehörigen Mittelpunktspannung aller gemessenen 4 Fließorte ermittelt: σ R,ss = sin(φ ss ) σ M,ss + σ 0 = tan(α) σ M,ss + σ 0 (7) Er wird mittels linearer Regression ausgewertet. Der Anstiegswinkel ist der stationäre (innere) Reibungswinkel: φ ss = arcsin(ttt(α)) (8) Für kohäsive Schüttguter ergibt sich eine nennenswerte isostatische Zugfestigkeit des unverfestigten Schüttgutes σ 0, die aus dem Abszissenabschnitt der Regressionsgraden (7) für σ R,ss = 0 berechnet wird, Abbildung 3. Der effektive Fließort ist nur eine Näherungsgerade für den Fall σ 0 = 0. Der resultierende effektive Reibungswinkel φ e wird für die Trichterauslegung benötigt, Gl. (13): Abbildung 3: Der effektive und stationäre Fließort (EFO & SFO) im σ τ - Diagramm Die Schüttgutdichte wird durch folgende Kompressionsfunktion beschrieben, s. Folie 6.25: ρ b = ρ b,0 1 + σ n M,ss σ 0 (9) Durch Logarithmieren der Gleichung (9) wird diese linearisiert und die Schüttgutdichte des unverfestigten Schüttgutes ρ b,0 (bei σ M,ss = 0) und der Kompressibilitätsindex n mittels linearer Regression ermittelt (σ 0 wurde vorher mit der (7) ermittelt): ln(ρ b ) = ln ρ b,0 + n ln 1 + σ M,ss σ 0 (10) Der Wandreibungswinkel ergibt sich für jeden beliebigen Punkt des Wandfließortes zu: φ W = arctan τ W σ W (11) Im Allgemeinen verlaufen die Wandfließorte linear durch den Koordinatenursprung (ohne Adhäsion), weshalb in diesem Fall der Wandreibungswinkel konstant ist. Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik 4
5 4.2 Zusammenfassung der wichtigsten Eigenschaftsfunktionen kohäsiver Schüttgüter Die Kompressionsfunktion wird ausgedrückt mittels ρ b = f(σ 1 ): n 1 ρ b = ρ b,0 1 + sin(φ ss ) 1 + σ m 1 σ 0 (12) Der spannungsabhängige effektive (innere) Reibungswinkel φ e = f(σ 1 ): σ 1 + σ 0 φ e = arcsin sss(φ ss ) (13) σ 1 sss(φ ss ) σ 0 Die linear approximierte Verfestigungsfunktion σ c = f(σ 1 ) ist ebenfalls als Regressionsgerade auswertbar, siehe Folie 6.47: σ c = a 1 σ 1 + σ c,0 (14) 4.3 Grafische Darstellungen der Ergebnisse Darstellung aller gemessenen Fließorte in einem σ-τ-diagramm, (i.a. lassen sich die Fließorte durch Geraden darstellen), einzeichnen der Mohrschen Spannungskreise Auswertung der wesentlichen Fließkennwerte: Tabelle mit: FO-Nr., σ 1, σ M,ss, σ c, ff c, φ i, φ e und ρ b ; sowie einmalig für alle Fließorte: σ 0, φ ss, ρ b,0 und n; Beurteilung der Fließfähigkeit und Kompressibilität des untersuchten kohäsiven Schüttgutes (siehe Folien 6.25 und 6.31) Darstellung der gemessenen Wandfließorte in einem σ-τ-diagramm, s. Folie Der Wandreibungswinkel ergibt sich aus dem aktuellen Verhältnis von Scher- und Normalspannung an der Wand, siehe Gleichung (11) Grafische Darstellung der wichtigsten Fließkennwerte kohäsiver Schüttgüter: einaxiale Druckfestigkeit: σ c = f(σ 1 ) innerer Reibungswinkel φ i = f(σ 1 ), effektiver innerer Reibungswinkel φ e = f(σ 1 ), Schüttgutdichte ρ b = f(σ 1 ) in Abhängigkeit von der größten Hauptspannung σ 1 beim stationären Fließen (Verfestigen) und Vergleich mit den numerisch ermittelten Kurven Gln. (12) bis (14). 4.4 Silodimensionierung Die Trichterneigung θ entscheidet ob sich im Silo Kern- oder Massenfluss einstellt. Die von Jenike ermittelten Grenzen zwischen beiden werden folgendermaßen beschrieben: Axialsymmetrisches Spannungsfeld (konischer Trichter; m = 1) θ aa = arccos 1 sss(φ e) 2 sss(φ e ) φ w arcsin sss(φ w) (15) sss(φ e ) Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik 5
6 Ebenes Spannungsfeld (keilförmiger Trichter; m = 0) arctan 50 φ e 7,73 φ w θ ee = 60, ,07 42,3 + 0,0131 e 0,06 φ (16) e Zur Gewährleistung von Massenfluss muss die Trichterneigung jeweils kleiner sein als die hier errechneten Grenzwerte! Zudem sind beim konischen Trichter noch 3 als Sicherheitswert abzuziehen. Mit Hilfe des Diagramms in Abbildung 4 kann der Fließfaktor ff als Funktion des effektiven Reibungswinkels bestimmt werden. Abbildung 4: Ermittlung von Näherungswerten des Fließfaktors (Wandreibungswinkel φ w =10 bis 30 ) Durch Kombination der Auflagerspannung σ 1 einer kohäsiven Brücke, σ 1 = σ 1 ff (17) mit der gemessenen Verfestigungsfunktion Gl. (14) erhält man die kritische Druckfestigkeit σ c,kkkk, die kritische Verfestigungsspannung σ 1,kkkk und mit der Kompressionsfunktion Gl. (12) die kritische Schüttgutdichte ρ b,kkkk, siehe Folie Mit Hilfe von Gleichung (18) kann dann die minimal erforderliche Öffnungsweite b min ermittelt werden: b min = (m + 1) σ c,kkkk sin 2 (φ w + θ) ρ b,kkkk g (18) Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik 6
7 5 Hinweise zur Praktikumsvorbereitung Grundwissen sind der Stoff der Vorlesung (Einführung in die) "Mechanische Verfahrenstechnik", diese Praktikumsanleitung und die angegebene Literatur. Anhand der Stichworte können Sie Ihr Wissen prüfen bzw. ergänzen. Die Aufgabenstellung, Versuchsdurchführung und Auswertung sollten Sie soweit kennen, dass Sie im Kolloquium den Ablauf der Untersuchung, die Ermittlung der Messgrößen einschließlich der Versuchsauswertung ausgehend von den theoretischen Grundlagen (physikalische Haftkräfte und Kontinuumsmechanik) anwendungsbezogen (verfahrenstechnische Apparateauslegung der Silo- und Bunkertrichter) erläutern können. Stichworte zur Vorbereitung Aufgaben einer Speichereinrichtung, Silo- und Bunkerprobleme, Massenfluss und Kernfluss; mikroskopische Haftkräfte; MOHRscher Spannungskreis, Fließorte für beginnendes und stationäres Fließen, Zeitfließort, Wandfließort, Kennwerte des Fließverhaltens kohäsiver Schüttgüter (Kohäsion, Adhäsion, Reibungswinkel, Festigkeitskennwerte, Verfestigungsspannung, Fließfunktion), Kompressions- und Verfestigungsfunktionen, fließgerechte Trichterauslegung zur Vermeidung von Brücken- und Schachtbildung. J. Tomas Manuskript & Folien Vorlesung: Mechanische Verfahrenstechnik / Einführung in die Partikeltechnologie; Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg, 2013 D. Schulze Pulver und Schüttgüter Fließeigenschaften und Handhabung; Springer- Verlag, Berlin Heidelberg, 2006 M. Stieß Mechanische Verfahrenstechnik 1; Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, Symbolverzeichnis Symbol S Bezeichnung Einheit b min bmin minimale Trichterauslaufbreite m F N FN Normalkraft N F 1, F 2 F1F2 Scherkraft N ff ff Fließfaktor ff c ffc Fließfunktion n n Kompressibilitätsindex ω omega Winkelgeschwindigkeit 1 s θ Phi Trichterneigungswinkel φ e phie effektive Reibungswinkel φ i phii innerer Reibungswinkel φ ss phist stationärer Reibungswinkel φ W phiw Wandreibungswinkel Pa ρ b rhob Schüttgutdichte kk ρ b,0 rhob0 Schüttdichte (Dichte des unverdichteten Schüttguts) σ sigma Normalspannung Pa σ 0 sigma0 isostatische Zugfestigkeit Pa σ 1 sigma1 größte Hauptspannung Pa σ 1 sigma1' größte Haupspannung in einer Schüttgutbrücke Pa m 3 kk m 3 Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik 7
8 Symbol S Bezeichnung Einheit σ 2 sigma2 kleinste Hauptspannung Pa σ aa sigmaan Normalspannung beim Anscheren Pa σ c sigmac Druckfestigkeit Pa σ M,ss sigmam Mittelpunktspannung Pa σ R,ss sigmar Radiusspannung Pa σ W sigmaw Wandnormalspannung Pa σ z sigmaz dreiachsige Zugspannung Pa τ tau Scherspannung Pa τ c tauc Kohäsion Pa τ W tauw Wandschubspannung Pa 7 Literatur [1] Schulze, Dietmar: Ringschergerät RST-XS.s - noch kleiner - noch mehr Funktionen. [Online] [Zitat vom: 04. Januar 2016.] [2] Schulze, Dietmar: Ringschergerät RST-XS.s Betriebsanleitung v S. 59. Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik 8
9 Messprotokoll für Scherzellen-Messung Datum: Materialart: Kalkstein Feststoffdichte: 1400 kg/m3 Korngröße: 80 µm Einwaage: g Tabelle 1: Momentanfließorte FO-Nr. σ an τ an σ ab τ ab ρ b Tabelle 2: Wandreibungsmessung σ W τ W Pa Pa Pa Pa kg/m Pa Pa Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik 9
Pulver und Schüttgüter
 Pulver und Schüttgüter Fließeigenschaften und Handhabung von Dietmar Schulze 1. Auflage Pulver und Schüttgüter Schulze schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG Thematische
Pulver und Schüttgüter Fließeigenschaften und Handhabung von Dietmar Schulze 1. Auflage Pulver und Schüttgüter Schulze schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG Thematische
Vorlesung "Partikelmechanik und Schüttguttechnik"
 Institut für Verfahrenstechnik Sommersemester 2015 Prof. Dr.-Ing. habil. J. Tomas, 10-237, Tel.: 58 783, juergen.tomas@ovgu.de (vertreten durch P. Müller) Vorlesung "Partikelmechanik und Schüttguttechnik"
Institut für Verfahrenstechnik Sommersemester 2015 Prof. Dr.-Ing. habil. J. Tomas, 10-237, Tel.: 58 783, juergen.tomas@ovgu.de (vertreten durch P. Müller) Vorlesung "Partikelmechanik und Schüttguttechnik"
Fließgerechte Auslegung eines Silos bzw. Bunkers
 Folie 4. 4 Fließgerechte Auslegung eines Silos zw. Bunkers 9 4. Vermeidung der Brückenildung in einem Massenflussunker... 9 4.. Radiales Spannungsfeld... 9 4.. Allgemeines Kräftegleichgewicht an einer
Folie 4. 4 Fließgerechte Auslegung eines Silos zw. Bunkers 9 4. Vermeidung der Brückenildung in einem Massenflussunker... 9 4.. Radiales Spannungsfeld... 9 4.. Allgemeines Kräftegleichgewicht an einer
3 Fließeigenschaften von Schüttgütern
 3 Fließeigenschaften von Schüttgütern Die Fließeigenschaften von Schüttgütern hängen von vielen Parametern ab. Einige mögliche Einflussgrößen sind: Partikelgrößenverteilung, Partikelform, chemische Zusammensetzung
3 Fließeigenschaften von Schüttgütern Die Fließeigenschaften von Schüttgütern hängen von vielen Parametern ab. Einige mögliche Einflussgrößen sind: Partikelgrößenverteilung, Partikelform, chemische Zusammensetzung
Simulation Mechanischer Prozesse Übung Kontaktmodelle
 Übungsaufgabe: Aufgabe : Bestimmung des kritischen Zeitschritts einer Simulation Der kritische Zeitschritt einer Simulation bestimmt die Stabilität der Lösung Die Zeitschrittweite orientiert sich dabei
Übungsaufgabe: Aufgabe : Bestimmung des kritischen Zeitschritts einer Simulation Der kritische Zeitschritt einer Simulation bestimmt die Stabilität der Lösung Die Zeitschrittweite orientiert sich dabei
Pulver und Schüttgüter
 Dietmar Schulze Pulver und Schüttgüter Fließeigenschaften und Handhabung Mit 350 Abbildungen Springer XI 1. Einführung 1 1.1 Häufig auftretende Probleme mit Schüttgütern 1 1.2 Meilensteine der Schüttguttechnik
Dietmar Schulze Pulver und Schüttgüter Fließeigenschaften und Handhabung Mit 350 Abbildungen Springer XI 1. Einführung 1 1.1 Häufig auftretende Probleme mit Schüttgütern 1 1.2 Meilensteine der Schüttguttechnik
Zugstab
 Bisher wurde beim Zugstab die Beanspruchung in einer Schnittebene senkrecht zur Stabachse untersucht. Schnittebenen sind gedankliche Konstrukte, die auch schräg zur Stabachse liegen können. Zur Beurteilung
Bisher wurde beim Zugstab die Beanspruchung in einer Schnittebene senkrecht zur Stabachse untersucht. Schnittebenen sind gedankliche Konstrukte, die auch schräg zur Stabachse liegen können. Zur Beurteilung
Physikalisches Pendel
 Physikalisches Pendel Nach einer kurzen Einführung in die Theorie des physikalisch korrekten Pendels (ausgedehnte Masse) wurden die aus der Theorie gewonnenen Formeln in praktischen Messungen überprüft.
Physikalisches Pendel Nach einer kurzen Einführung in die Theorie des physikalisch korrekten Pendels (ausgedehnte Masse) wurden die aus der Theorie gewonnenen Formeln in praktischen Messungen überprüft.
Folie 7.1. Prof. Dr. J. Tomas, Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik
 Folie 7.1 7 Agglomeration 431 7.1 Prozessziele und Wirkprinzipien... 431 7.2 Beanspruchungsarten und Festigkeit der Agglomerate... 432 7.3 Aufbauagglomeration... 433 7.3.1 Prozessgrundlagen... 433 7.3.2
Folie 7.1 7 Agglomeration 431 7.1 Prozessziele und Wirkprinzipien... 431 7.2 Beanspruchungsarten und Festigkeit der Agglomerate... 432 7.3 Aufbauagglomeration... 433 7.3.1 Prozessgrundlagen... 433 7.3.2
PP Physikalisches Pendel
 PP Physikalisches Pendel Blockpraktikum Frühjahr 2007 (Gruppe 2) 25. April 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 2 Theoretische Grundlagen 2 2.1 Ungedämpftes physikalisches Pendel.......... 2 2.2 Dämpfung
PP Physikalisches Pendel Blockpraktikum Frühjahr 2007 (Gruppe 2) 25. April 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 2 Theoretische Grundlagen 2 2.1 Ungedämpftes physikalisches Pendel.......... 2 2.2 Dämpfung
Grundbau und Bodenmechanik Übung Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit 1. G Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit. Inhaltsverzeichnis
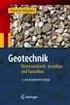 Übung Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit Lehrstuhl für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Tunnelbau G Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit Inhaltsverzeichnis G. Allgemeiner Spannungszustand
Übung Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit Lehrstuhl für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Tunnelbau G Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit Inhaltsverzeichnis G. Allgemeiner Spannungszustand
9 Spannungen im Schüttgut
 9 Spannungen im Schüttgut Die Kenntnis der in einem Schüttgut auftretenden Spannungen ist vor allem hinsichtlich der Lagerung in Silos im Zusammenhang mit den folgenden Themen von Interesse: Verfahrenstechnische
9 Spannungen im Schüttgut Die Kenntnis der in einem Schüttgut auftretenden Spannungen ist vor allem hinsichtlich der Lagerung in Silos im Zusammenhang mit den folgenden Themen von Interesse: Verfahrenstechnische
Grundlagen der Landtechnik
 Grundlagen der Landtechnik Verfahren Konstruktion Wirtschaft VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE Grundl. Landtechnik Bd. 25 (1975) Nr. 3, S. 65 bis 96 Funktionsgerechte Gestaltung von Silos für schwerfließende
Grundlagen der Landtechnik Verfahren Konstruktion Wirtschaft VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE Grundl. Landtechnik Bd. 25 (1975) Nr. 3, S. 65 bis 96 Funktionsgerechte Gestaltung von Silos für schwerfließende
Aufgaben Einführung in die Messtechnik Messen - Vorgang und Tätigkeit
 F Aufgaben Einführung in die Messtechnik Messen - Vorgang und Tätigkeit Wolfgang Kessel Braunschweig Messfehler/Einführung in die Messtechnik (VO 5.075/5.06/5.08).PPT/F/2004-0-25/Ke AUFGABE0 F 2 AUFGABE0:
F Aufgaben Einführung in die Messtechnik Messen - Vorgang und Tätigkeit Wolfgang Kessel Braunschweig Messfehler/Einführung in die Messtechnik (VO 5.075/5.06/5.08).PPT/F/2004-0-25/Ke AUFGABE0 F 2 AUFGABE0:
Verbesserung des Schwerkraftflusses kohäsiver Pulver durch Schwingungseintrag
 Verbesserung des Schwerkraftflusses kohäsiver Pulver durch Schwingungseintrag Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktoringenieur (Dr.-Ing.) von: Dipl.-Ing. Guido Kache geboren am: 17.04.1979
Verbesserung des Schwerkraftflusses kohäsiver Pulver durch Schwingungseintrag Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktoringenieur (Dr.-Ing.) von: Dipl.-Ing. Guido Kache geboren am: 17.04.1979
Schlussbericht. zu dem IGF-Vorhaben
 Schlussbericht zu dem IGF-Vorhaben Analyse und Strategien zum Verringern von Anbackungen bei der Lagerung von Mehrstoffsystemen insbesondere Glasgemenge im Rohstoffsilo der Forschungsstelle(n) TU Bergakademie
Schlussbericht zu dem IGF-Vorhaben Analyse und Strategien zum Verringern von Anbackungen bei der Lagerung von Mehrstoffsystemen insbesondere Glasgemenge im Rohstoffsilo der Forschungsstelle(n) TU Bergakademie
Mathematischer Vorkurs für Physiker WS 2012/13
 TU München Prof. P. Vogl Mathematischer Vorkurs für Physiker WS 2012/13 Übungsblatt 2 Wichtige Formeln aus der Vorlesung: Basisaufgaben Beispiel 1: 1 () grad () = 2 (). () () = ( 0 ) + grad ( 0 ) ( 0 )+
TU München Prof. P. Vogl Mathematischer Vorkurs für Physiker WS 2012/13 Übungsblatt 2 Wichtige Formeln aus der Vorlesung: Basisaufgaben Beispiel 1: 1 () grad () = 2 (). () () = ( 0 ) + grad ( 0 ) ( 0 )+
Inhaltsverzeichnis. 1 Einführung... 1 1.1 Häufig auftretende Probleme mit Schüttgütern... 1 1.2 Meilensteine der Schüttguttechnik... 4 Literatur...
 1 Einführung.......................................................... 1 1.1 Häufig auftretende Probleme mit Schüttgütern........................ 1 1.2 Meilensteine der Schüttguttechnik..................................
1 Einführung.......................................................... 1 1.1 Häufig auftretende Probleme mit Schüttgütern........................ 1 1.2 Meilensteine der Schüttguttechnik..................................
- 1 - Eine Funktion f(x) heißt differenzierbar an der Stelle x 0, wenn der Grenzwert (siehe Kap. 3)
 - 1-4 Differentialrechnung 4.1 Ableitung einer Funktion Eine Funktion f() ist in einer Umgebung definiert. Abb.: Differenzenquotient Man kann immer einen Quotienten bilden, ( + ) f ( + h) f ( ) f h f +
- 1-4 Differentialrechnung 4.1 Ableitung einer Funktion Eine Funktion f() ist in einer Umgebung definiert. Abb.: Differenzenquotient Man kann immer einen Quotienten bilden, ( + ) f ( + h) f ( ) f h f +
Scherfestigkeit von Böden
 Scherfestigkeit von Böden W. Wu 1 1 Scherfestigkeit von Böden Physikalische Ursachen: - Innere Reibung makroskopisches Auf- bzw. Abgleiten Umlagerungen der Bodenkörner bzw. Strukturänderungen Abrieb und
Scherfestigkeit von Böden W. Wu 1 1 Scherfestigkeit von Böden Physikalische Ursachen: - Innere Reibung makroskopisches Auf- bzw. Abgleiten Umlagerungen der Bodenkörner bzw. Strukturänderungen Abrieb und
Gekoppelte Schwingung
 Versuch: GS Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Erstellt: C. Blockwitz am 01. 07. 000 Bearbeitet: E. Hieckmann J. Kelling F. Lemke S. Majewsky i.a. Dr. Escher Aktualisiert: am 16. 09. 009
Versuch: GS Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Erstellt: C. Blockwitz am 01. 07. 000 Bearbeitet: E. Hieckmann J. Kelling F. Lemke S. Majewsky i.a. Dr. Escher Aktualisiert: am 16. 09. 009
Laborpraktikum Grundlagen der Umwelttechnik II
 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig Maschinenbau und Energietechnik Versuchstag: Brennstoff- und Umweltlabor Bearbeiter: Prof. Dr.-Ing. J. Schenk Dipl.- Chem. Dorn Namen: Seminargruppe:
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig Maschinenbau und Energietechnik Versuchstag: Brennstoff- und Umweltlabor Bearbeiter: Prof. Dr.-Ing. J. Schenk Dipl.- Chem. Dorn Namen: Seminargruppe:
1 Lambert-Beersches Gesetz
 Physikalische Chemie II Lösung 6 23. Oktober 205 Lambert-Beersches Gesetz Anhand des idealen Gasgesetzes lässt sich die Teilchenkonzentration C wie folgt ausrechnen: C = N V = n N A V pv =nrt = N A p R
Physikalische Chemie II Lösung 6 23. Oktober 205 Lambert-Beersches Gesetz Anhand des idealen Gasgesetzes lässt sich die Teilchenkonzentration C wie folgt ausrechnen: C = N V = n N A V pv =nrt = N A p R
2. Physikalisches Pendel
 2. Physikalisches Pendel Ein physikalisches Pendel besteht aus einem starren Körper, der um eine Achse drehbar gelagert ist. A L S φ S z G Prof. Dr. Wandinger 6. Schwingungen Dynamik 2 6.2-1 2.1 Bewegungsgleichung
2. Physikalisches Pendel Ein physikalisches Pendel besteht aus einem starren Körper, der um eine Achse drehbar gelagert ist. A L S φ S z G Prof. Dr. Wandinger 6. Schwingungen Dynamik 2 6.2-1 2.1 Bewegungsgleichung
Rotation. Versuch: Inhaltsverzeichnis. Fachrichtung Physik. Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010. Physikalisches Grundpraktikum
 Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Versuch: RO Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010 Rotation Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung 2 2 Allgemeine Grundlagen 2 2.1
Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Versuch: RO Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010 Rotation Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung 2 2 Allgemeine Grundlagen 2 2.1
Physikprotokoll: Massenträgheitsmoment. Issa Kenaan Torben Zech Martin Henning Abdurrahman Namdar
 Physikprotokoll: Massenträgheitsmoment Issa Kenaan 739039 Torben Zech 738845 Martin Henning 736150 Abdurrahman Namdar 739068 1. Juni 2006 1 Inhaltsverzeichnis 1 Vorbereitung zu Hause 3 2 Versuchsaufbau
Physikprotokoll: Massenträgheitsmoment Issa Kenaan 739039 Torben Zech 738845 Martin Henning 736150 Abdurrahman Namdar 739068 1. Juni 2006 1 Inhaltsverzeichnis 1 Vorbereitung zu Hause 3 2 Versuchsaufbau
1.2 Schwingungen von gekoppelten Pendeln
 0 1. Schwingungen von gekoppelten Pendeln Aufgaben In diesem Experiment werden die Schwingungen von zwei Pendeln untersucht, die durch eine Feder miteinander gekoppelt sind. Für verschiedene Kopplungsstärken
0 1. Schwingungen von gekoppelten Pendeln Aufgaben In diesem Experiment werden die Schwingungen von zwei Pendeln untersucht, die durch eine Feder miteinander gekoppelt sind. Für verschiedene Kopplungsstärken
12 Integralrechnung, Schwerpunkt
 Dr. Dirk Windelberg Leibniz Universität Hannover Mathematik für Ingenieure Mathematik http://www.windelberg.de/agq Integralrechnung, Schwerpunkt Schwerpunkt Es sei ϱ die Dichte innerhalb der zu untersuchenden
Dr. Dirk Windelberg Leibniz Universität Hannover Mathematik für Ingenieure Mathematik http://www.windelberg.de/agq Integralrechnung, Schwerpunkt Schwerpunkt Es sei ϱ die Dichte innerhalb der zu untersuchenden
ETH-Aufnahmeprüfung Herbst Physik U 1. Aufgabe 1 [4 pt + 4 pt]: zwei unabhängige Teilaufgaben
![ETH-Aufnahmeprüfung Herbst Physik U 1. Aufgabe 1 [4 pt + 4 pt]: zwei unabhängige Teilaufgaben ETH-Aufnahmeprüfung Herbst Physik U 1. Aufgabe 1 [4 pt + 4 pt]: zwei unabhängige Teilaufgaben](/thumbs/64/51931310.jpg) ETH-Aufnahmeprüfung Herbst 2015 Physik Aufgabe 1 [4 pt + 4 pt]: zwei unabhängige Teilaufgaben U 1 V a) Betrachten Sie den angegebenen Stromkreis: berechnen Sie die Werte, die von den Messgeräten (Ampere-
ETH-Aufnahmeprüfung Herbst 2015 Physik Aufgabe 1 [4 pt + 4 pt]: zwei unabhängige Teilaufgaben U 1 V a) Betrachten Sie den angegebenen Stromkreis: berechnen Sie die Werte, die von den Messgeräten (Ampere-
TE Thermische Emission
 TE Thermische Emission Blockpraktikum Herbst 2007 (Gruppe 2b) 24. Oktober 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 1.1 Kennlinie einer Glühdiode............................. 2 2 Versuch und Auswertung 4
TE Thermische Emission Blockpraktikum Herbst 2007 (Gruppe 2b) 24. Oktober 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 1.1 Kennlinie einer Glühdiode............................. 2 2 Versuch und Auswertung 4
Übungsaufgaben zu Kapitel 7 und 8
 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Sommersemester 016 Fakultät Informatik/Mathematik Prof. Dr.. Jung Übungsaufgaben zu Kapitel 7 und 8 Aufgabe 1: Für die rennweite einer einfachen, bikonvexen
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Sommersemester 016 Fakultät Informatik/Mathematik Prof. Dr.. Jung Übungsaufgaben zu Kapitel 7 und 8 Aufgabe 1: Für die rennweite einer einfachen, bikonvexen
KOMPETENZHEFT ZUR TRIGONOMETRIE, II
 KOMPETENZHEFT ZUR TRIGONOMETRIE, II 1. Aufgabenstellungen Aufgabe 1.1. Bestimme alle Winkel in [0 ; 360 ], die Lösungen der gegebenen Gleichung sind, und zeichne sie am Einheitskreis ein. 1) sin(α) = 0,4
KOMPETENZHEFT ZUR TRIGONOMETRIE, II 1. Aufgabenstellungen Aufgabe 1.1. Bestimme alle Winkel in [0 ; 360 ], die Lösungen der gegebenen Gleichung sind, und zeichne sie am Einheitskreis ein. 1) sin(α) = 0,4
2. Der ebene Spannungszustand
 2. Der ebene Spannungszustand 2.1 Schubspannung 2.2 Dünnwandiger Kessel 2.3 Ebener Spannungszustand 2.4 Spannungstransformation 2.5 Hauptspannungen 2.6 Dehnungen 2.7 Elastizitätsgesetz Prof. Dr. Wandinger
2. Der ebene Spannungszustand 2.1 Schubspannung 2.2 Dünnwandiger Kessel 2.3 Ebener Spannungszustand 2.4 Spannungstransformation 2.5 Hauptspannungen 2.6 Dehnungen 2.7 Elastizitätsgesetz Prof. Dr. Wandinger
Prof. U. Stephan Wi-Ing 1.2
 Seite 1 von 5 Prof. U. Stephan Wi-Ing 1. inweis: Dateien Starmath.ttf und Starbats.ttf im Verzeichnis C:\WINDOWS\FONTS erforderlich Ich vermisse im Vorspann "Was man weiß, was man wissen sollte" die trigonometrischen
Seite 1 von 5 Prof. U. Stephan Wi-Ing 1. inweis: Dateien Starmath.ttf und Starbats.ttf im Verzeichnis C:\WINDOWS\FONTS erforderlich Ich vermisse im Vorspann "Was man weiß, was man wissen sollte" die trigonometrischen
Vorlesung: Mechanische Verfahrenstechnik Seminar - Zerkleinerung
 Vorlesung: Mechanische Verfahrenstechnik Seminar - Zerkleinerung Aufgabe 1: Berechnung des Arbeitsindexes nach Bond In einer Nass-Austragskammer-Kugelmühle (Mahlraum-Durchmesser D = 3100 mm, Länge L =
Vorlesung: Mechanische Verfahrenstechnik Seminar - Zerkleinerung Aufgabe 1: Berechnung des Arbeitsindexes nach Bond In einer Nass-Austragskammer-Kugelmühle (Mahlraum-Durchmesser D = 3100 mm, Länge L =
Trägheitsmoment (TRÄ)
 Physikalisches Praktikum Versuch: TRÄ 8.1.000 Trägheitsmoment (TRÄ) Manuel Staebel 3663 / Michael Wack 34088 1 Versuchsbeschreibung Auf Drehtellern, die mit Drillfedern ausgestattet sind, werden die zu
Physikalisches Praktikum Versuch: TRÄ 8.1.000 Trägheitsmoment (TRÄ) Manuel Staebel 3663 / Michael Wack 34088 1 Versuchsbeschreibung Auf Drehtellern, die mit Drillfedern ausgestattet sind, werden die zu
Oberflächenspannung. Abstract. 1 Theoretische Grundlagen. Phasen und Grenzflächen
 Phasen und Grenzflächen Oberflächenspannung Abstract Die Oberflächenspannung verschiedener Flüssigkeit soll mit Hilfe der Kapillarmethode gemessen werden. Es sollen die mittlere Abstand der einzelnen Moleküle
Phasen und Grenzflächen Oberflächenspannung Abstract Die Oberflächenspannung verschiedener Flüssigkeit soll mit Hilfe der Kapillarmethode gemessen werden. Es sollen die mittlere Abstand der einzelnen Moleküle
Bestimmung der Hafteigenschaften einer Partikelpackung am Beispiel von oberflächenmodifizierten Glaspartikeln
 Bestimmung der Hafteigenschaften einer Partikelpackung am Beispiel von oberflächenmodifizierten Glaspartikeln PiKo Workshop Dialog Experiment-Modell 3.4.4 Z. Kutelova, W. Hintz, J. Tomas Gliederung Einleitung,
Bestimmung der Hafteigenschaften einer Partikelpackung am Beispiel von oberflächenmodifizierten Glaspartikeln PiKo Workshop Dialog Experiment-Modell 3.4.4 Z. Kutelova, W. Hintz, J. Tomas Gliederung Einleitung,
3.3 Absenkungsverlauf
 3.3 Absenkungsverlauf 3.3.1 Aufgabe 3.3.1.1 Verzögerungsfunktion Der Absenkungsverlauf des Grundwassers auf Grund einer Entnahme aus einem Brunnen (z.b. durch einen so genannten Pumpversuch) kann in erster
3.3 Absenkungsverlauf 3.3.1 Aufgabe 3.3.1.1 Verzögerungsfunktion Der Absenkungsverlauf des Grundwassers auf Grund einer Entnahme aus einem Brunnen (z.b. durch einen so genannten Pumpversuch) kann in erster
Die Zentripetalkraft Praktikum 04
 Die Zentripetalkraft Praktikum 04 Raymond KNEIP, LYCEE TECHNIQUE DES ARTS ET METIERS November 2015 1 Zielsetzung Die Gleichung der Zentripetalkraft F Z (Zentralkraft, auch Radialkraft genannt) wird auf
Die Zentripetalkraft Praktikum 04 Raymond KNEIP, LYCEE TECHNIQUE DES ARTS ET METIERS November 2015 1 Zielsetzung Die Gleichung der Zentripetalkraft F Z (Zentralkraft, auch Radialkraft genannt) wird auf
Aktivierungsenergie und TK R -Wert von Halbleiterwerkstoffen
 Fachbereich 1 Laborpraktikum Physikalische Messtechnik/ Werkstofftechnik Aktivierungsenergie und TK R -Wert von Halbleiterwerkstoffen Bearbeitet von Herrn M. Sc. Christof Schultz christof.schultz@htw-berlin.de
Fachbereich 1 Laborpraktikum Physikalische Messtechnik/ Werkstofftechnik Aktivierungsenergie und TK R -Wert von Halbleiterwerkstoffen Bearbeitet von Herrn M. Sc. Christof Schultz christof.schultz@htw-berlin.de
TU Dresden Fachrichtung Mathematik Institut für Numerische Mathematik 1. Dr. M. Herrich SS 2017
 TU Dresden Fachrichtung Mathematik Institut für Numerische Mathematik 1 Prof. Dr. K. Eppler Institut für Numerische Mathematik Dr. M. Herrich SS 2017 Aufgabe 1 Übungen zur Vorlesung Mathematik II 4. Übung,
TU Dresden Fachrichtung Mathematik Institut für Numerische Mathematik 1 Prof. Dr. K. Eppler Institut für Numerische Mathematik Dr. M. Herrich SS 2017 Aufgabe 1 Übungen zur Vorlesung Mathematik II 4. Übung,
Planetenschleifen mit Geogebra 1
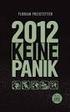 Planetenschleifen Planetenschleifen mit Geogebra Entstehung der Planetenschleifen Nach dem dritten Kepler schen Gesetz stehen die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten im gleichen Verhältnis wie die
Planetenschleifen Planetenschleifen mit Geogebra Entstehung der Planetenschleifen Nach dem dritten Kepler schen Gesetz stehen die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten im gleichen Verhältnis wie die
Wirkungsquantum Ein Physikprotokoll
 Wirkungsquantum Ein Physikprotokoll Physik I für KEB, TFH Berlin 30. Juni 2006 Issa Kenaan 739039 Torben Zech 738845 Martin Henning 736150 Abdurrahman Namdar 739068 Inhaltsverzeichnis 1 Versuchsaufbau
Wirkungsquantum Ein Physikprotokoll Physik I für KEB, TFH Berlin 30. Juni 2006 Issa Kenaan 739039 Torben Zech 738845 Martin Henning 736150 Abdurrahman Namdar 739068 Inhaltsverzeichnis 1 Versuchsaufbau
Gerätetechnisches Praktikum: Leichtbau
 Gerätetechnisches Praktikum: Leichtbau LEICHTBAUPROFILE Universität der Bundeswehr München Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik Institut für Leichtbau Prof.Dr.-Ing. H. Rapp Stand: 14. Januar 2011 Gerätetechnisches
Gerätetechnisches Praktikum: Leichtbau LEICHTBAUPROFILE Universität der Bundeswehr München Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik Institut für Leichtbau Prof.Dr.-Ing. H. Rapp Stand: 14. Januar 2011 Gerätetechnisches
Physik 4, Übung 2, Prof. Förster
 Physik 4, Übung, Prof. Förster Christoph Hansen Emailkontakt 4. April 03 Dieser Text ist unter dieser Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Physik 4, Übung, Prof. Förster Christoph Hansen Emailkontakt 4. April 03 Dieser Text ist unter dieser Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.
D-ERDW, D-HEST, D-USYS Mathematik II FS 15 Dr. Ana Cannas. Serie 8: Satz von Green und Oberflächenintegrale
 D-ERDW, D-HEST, D-USYS Mathematik II FS 5 Dr. Ana Cannas Serie 8: Satz von Green und Oberflächenintegrale Bemerkungen: Die Aufgaben der Serie 8 bilden den Fokus der Übungsgruppen vom./3. April.. Den Satz
D-ERDW, D-HEST, D-USYS Mathematik II FS 5 Dr. Ana Cannas Serie 8: Satz von Green und Oberflächenintegrale Bemerkungen: Die Aufgaben der Serie 8 bilden den Fokus der Übungsgruppen vom./3. April.. Den Satz
Musterprotokoll am Beispiel des Versuches M 12 Gekoppelte Pendel
 * k u r z g e f a s s t * i n f o r m a t i v * s a u b e r * ü b e r s i c h t l i c h Musterprotokoll am Beispiel des Versuches M 1 Gekoppelte Pendel M 1 Gekoppelte Pendel Aufgaben 1. Messen Sie für
* k u r z g e f a s s t * i n f o r m a t i v * s a u b e r * ü b e r s i c h t l i c h Musterprotokoll am Beispiel des Versuches M 1 Gekoppelte Pendel M 1 Gekoppelte Pendel Aufgaben 1. Messen Sie für
Musterlösung: Partikelbewegung im Fluid
 Musterlösung: Partikelbewegung im Fluid 0. Januar 016 Wiederholung Ein Ausschnitt notwendiger Grundlagen für die Berechnung stationärer Sinkgeschwindigkeiten von Partikeln im Fluid. Annahmen: Partikel
Musterlösung: Partikelbewegung im Fluid 0. Januar 016 Wiederholung Ein Ausschnitt notwendiger Grundlagen für die Berechnung stationärer Sinkgeschwindigkeiten von Partikeln im Fluid. Annahmen: Partikel
V1 - Verifikation des Ohm schen Gesetzes
 V1 - Verifikation des Ohm schen Gesetzes Michael Baron, Frank Scholz 02..0 1 Aufgabenstellung Messung von Strom I R und Spannung U R an einem vorgegebenen festen Widerstand R für eine ganze Versuchsreihe
V1 - Verifikation des Ohm schen Gesetzes Michael Baron, Frank Scholz 02..0 1 Aufgabenstellung Messung von Strom I R und Spannung U R an einem vorgegebenen festen Widerstand R für eine ganze Versuchsreihe
Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz
 Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz Protokoll «A10 - AVOGADRO-Konstante» Martin Wolf Betreuer: Herr Decker Mitarbeiter: Martin Helfrich Datum:
Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz Protokoll «A10 - AVOGADRO-Konstante» Martin Wolf Betreuer: Herr Decker Mitarbeiter: Martin Helfrich Datum:
3. Erhaltungsgrößen und die Newton schen Axiome
 Übungen zur T1: Theoretische Mechanik, SoSe13 Prof. Dr. Dieter Lüst Theresienstr. 37, Zi. 45 Dr. James Gray James.Gray@physik.uni-muenchen.de 3. Erhaltungsgrößen und die Newton schen Axiome Übung 3.1:
Übungen zur T1: Theoretische Mechanik, SoSe13 Prof. Dr. Dieter Lüst Theresienstr. 37, Zi. 45 Dr. James Gray James.Gray@physik.uni-muenchen.de 3. Erhaltungsgrößen und die Newton schen Axiome Übung 3.1:
9.5 Graphen der trigonometrischen Funktionen
 9.5 Graphen der trigonometrischen Funktionen 9.5 Graphen der trigonometrischen Funktionen. Unter dem Bogenmass eines Winkels versteht man die Länge des Winkelbogens von auf dem Kreis mit Radius (Einheitskreis).
9.5 Graphen der trigonometrischen Funktionen 9.5 Graphen der trigonometrischen Funktionen. Unter dem Bogenmass eines Winkels versteht man die Länge des Winkelbogens von auf dem Kreis mit Radius (Einheitskreis).
201 Wärmeleitfähigkeit von Gasen
 01 Wärmeleitfähigkeit von Gasen 1. Aufgaben 1.1 Messen Sie die relative Wärmeleitfähigkeit x / 0 (bezogen auf Luft bei äußerem Luftdruck) für Luft und CO in Abhängigkeit vom Druck p. Stellen Sie x / 0
01 Wärmeleitfähigkeit von Gasen 1. Aufgaben 1.1 Messen Sie die relative Wärmeleitfähigkeit x / 0 (bezogen auf Luft bei äußerem Luftdruck) für Luft und CO in Abhängigkeit vom Druck p. Stellen Sie x / 0
M1 Maxwellsches Rad. 1. Grundlagen
 M1 Maxwellsches Rad Stoffgebiet: Translations- und Rotationsbewegung, Massenträgheitsmoment, physikalisches Pendel. Versuchsziel: Es ist das Massenträgheitsmoment eines Maxwellschen Rades auf zwei Arten
M1 Maxwellsches Rad Stoffgebiet: Translations- und Rotationsbewegung, Massenträgheitsmoment, physikalisches Pendel. Versuchsziel: Es ist das Massenträgheitsmoment eines Maxwellschen Rades auf zwei Arten
Aktivierungsenergie und TK R -Wert von Halbleiterwerkstoffen
 Fachbereich 1 Laborpraktikum Physikalische Messtechnik/ Werkstofftechnik Aktivierungsenergie und TK R -Wert von Halbleiterwerkstoffen Bearbeitet von Herrn M. Sc. Christof Schultz christof.schultz@htw-berlin.de
Fachbereich 1 Laborpraktikum Physikalische Messtechnik/ Werkstofftechnik Aktivierungsenergie und TK R -Wert von Halbleiterwerkstoffen Bearbeitet von Herrn M. Sc. Christof Schultz christof.schultz@htw-berlin.de
Musterlösung zum Grundlagenbeispiel Getriebewelle Klausur Maschinenelemente, 29. Oktober 1999
 . Musterlösung zum Grundlagenbeispiel Getriebewelle Klausur Maschinenelemente, 29. Oktober 1999 13. Januar 23 1 Riemenkräfte Abbildung 1 zeigt die Kräfte und Momente, die auf die freigeschnittene untere
. Musterlösung zum Grundlagenbeispiel Getriebewelle Klausur Maschinenelemente, 29. Oktober 1999 13. Januar 23 1 Riemenkräfte Abbildung 1 zeigt die Kräfte und Momente, die auf die freigeschnittene untere
Elastizität und Torsion
 INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
Versuch 11 Einführungsversuch
 Versuch 11 Einführungsversuch I Vorbemerkung Ziel der Einführungsveranstaltung ist es Sie mit grundlegenden Techniken des Experimentierens und der Auswertung der Messdaten vertraut zu machen. Diese Grundkenntnisse
Versuch 11 Einführungsversuch I Vorbemerkung Ziel der Einführungsveranstaltung ist es Sie mit grundlegenden Techniken des Experimentierens und der Auswertung der Messdaten vertraut zu machen. Diese Grundkenntnisse
Lineare Bewegungsgesetze. 1. Theoretische Grundlagen Der Vektor der Momentangeschwindigkeit eines Massepunktes ist. , (1) dt . (2)
 M03 Lineare Bewegungsgesetze Die Zusammenhänge zwischen Geschwindigkeit, Beschleunigung, Masse und Kraft werden am Beispiel eindimensionaler Bewegungen experimentell mit Hilfe eines Bewegungsmesswandlers
M03 Lineare Bewegungsgesetze Die Zusammenhänge zwischen Geschwindigkeit, Beschleunigung, Masse und Kraft werden am Beispiel eindimensionaler Bewegungen experimentell mit Hilfe eines Bewegungsmesswandlers
Untersuchungen zur gegenseitigen Beeinflussung von Silo und Austragorgan
 Untersuchungen zur gegenseitigen Beeinflussung von Silo und Austragorgan Dissertation Dietmar Schulze (1991) Anmerkungen zur vorliegenden Dissertation als pdf-datei Die im Jahr 1991 nur in gedruckter Ausgabe
Untersuchungen zur gegenseitigen Beeinflussung von Silo und Austragorgan Dissertation Dietmar Schulze (1991) Anmerkungen zur vorliegenden Dissertation als pdf-datei Die im Jahr 1991 nur in gedruckter Ausgabe
Übungen mit dem Applet Kurven in Polarkoordinaten
 Kurven in Polarkoordinaten 1 Übungen mit dem Applet Kurven in Polarkoordinaten 1 Ziele des Applets...2 2 Wie entsteht eine Kurve in Polarkoordinaten?...3 3 Kurvenverlauf für ausgewählte r(ϕ)...4 3.1 r
Kurven in Polarkoordinaten 1 Übungen mit dem Applet Kurven in Polarkoordinaten 1 Ziele des Applets...2 2 Wie entsteht eine Kurve in Polarkoordinaten?...3 3 Kurvenverlauf für ausgewählte r(ϕ)...4 3.1 r
Versuch 3 Das Trägheitsmoment
 Physikalisches A-Praktikum Versuch 3 Das Trägheitsmoment Praktikanten: Julius Strake Niklas Bölter Gruppe: 17 Betreuer: Hendrik Schmidt Durchgeführt: 10.07.2012 Unterschrift: Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung
Physikalisches A-Praktikum Versuch 3 Das Trägheitsmoment Praktikanten: Julius Strake Niklas Bölter Gruppe: 17 Betreuer: Hendrik Schmidt Durchgeführt: 10.07.2012 Unterschrift: Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung
Versuch dp : Drehpendel
 U N I V E R S I T Ä T R E G E N S B U R G Naturwissenschaftliche Fakultät II - Physik Anleitung zum Physikpraktikum für Chemiker Versuch dp : Drehpendel Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Einführung
U N I V E R S I T Ä T R E G E N S B U R G Naturwissenschaftliche Fakultät II - Physik Anleitung zum Physikpraktikum für Chemiker Versuch dp : Drehpendel Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Einführung
Übungsblatt 2 ( )
 Experimentalphysik für Naturwissenschaftler Universität Erlangen Nürnberg SS 01 Übungsblatt (11.05.01) 1) Geschwindigkeitsverteilung eines idealen Gases (a) Durch welche Verteilung lässt sich die Geschwindigkeitsverteilung
Experimentalphysik für Naturwissenschaftler Universität Erlangen Nürnberg SS 01 Übungsblatt (11.05.01) 1) Geschwindigkeitsverteilung eines idealen Gases (a) Durch welche Verteilung lässt sich die Geschwindigkeitsverteilung
Inhalt. 1. Aufgabenstellung und physikalischer Hintergrund 1.1. Was ist ein elektrischer Widerstand? 1.2. Aufgabenstellung
 Versuch Nr. 03: Widerstandsmessung mit der Wheatstone-Brücke Versuchsdurchführung: Donnerstag, 28. Mai 2009 von Sven Köppel / Harald Meixner Protokollant: Harald Meixner Tutor: Batu Klump Inhalt 1. Aufgabenstellung
Versuch Nr. 03: Widerstandsmessung mit der Wheatstone-Brücke Versuchsdurchführung: Donnerstag, 28. Mai 2009 von Sven Köppel / Harald Meixner Protokollant: Harald Meixner Tutor: Batu Klump Inhalt 1. Aufgabenstellung
Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie Lösungsvorschläge zu Übungsblatt 4
 TUM, Zentrum Mathematik Lehrstuhl für Mathematische Physik WS 3/4 Prof. Dr. Silke Rolles Thomas Höfelsauer Felizitas Weidner Tutoraufgaben: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie Lösungsvorschläge
TUM, Zentrum Mathematik Lehrstuhl für Mathematische Physik WS 3/4 Prof. Dr. Silke Rolles Thomas Höfelsauer Felizitas Weidner Tutoraufgaben: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie Lösungsvorschläge
Versuch P2-71,74: Kreisel. Auswertung. Von Jan Oertlin und Ingo Medebach. 25. Mai Drehimpulserhaltung 2. 2 Freie Achse 2
 Versuch P2-71,74: Kreisel Auswertung Von Jan Oertlin und Ingo Medebach 25. Mai 2010 Inhaltsverzeichnis 1 Drehimpulserhaltung 2 2 Freie Achse 2 3 Kräftefreie Kreisel 2 4 Dämpfung des Kreisels 3 5 Kreisel
Versuch P2-71,74: Kreisel Auswertung Von Jan Oertlin und Ingo Medebach 25. Mai 2010 Inhaltsverzeichnis 1 Drehimpulserhaltung 2 2 Freie Achse 2 3 Kräftefreie Kreisel 2 4 Dämpfung des Kreisels 3 5 Kreisel
Übungen mit dem Applet Schiefer Wurf
 Schiefer Wurf 1 Übungen mit dem Applet Schiefer Wurf 1 Mathematischer Hintergrund... Übungen mit dem Applet...5.1 Einfluss des Abwurfwinkels... 5. Einfluss der Abwurfhöhe... 6.3 Einfluss der Abwurfgeschwindigkeit
Schiefer Wurf 1 Übungen mit dem Applet Schiefer Wurf 1 Mathematischer Hintergrund... Übungen mit dem Applet...5.1 Einfluss des Abwurfwinkels... 5. Einfluss der Abwurfhöhe... 6.3 Einfluss der Abwurfgeschwindigkeit
Bestimmung des Massenverhältnisses bei der Reaktion von Magnesium mit Sauerstoff
 8 0 6 0 4 0 2 0 0 0 0 1 0 8 0 6 0 4 0 2 0 L m 1.1 Konstante Massenproportionen Untersuche, welches Volumen Sauerstoff für die Reaktion mit verschiedenen Massen Magnesium jeweils benötigt wird. Geräte 2
8 0 6 0 4 0 2 0 0 0 0 1 0 8 0 6 0 4 0 2 0 L m 1.1 Konstante Massenproportionen Untersuche, welches Volumen Sauerstoff für die Reaktion mit verschiedenen Massen Magnesium jeweils benötigt wird. Geräte 2
Bestimmung der Geschwindigkeitskonstanten einer Esterverseifung
 Versuchsprotokoll: Bestimmung der Geschwindigkeitskonstanten einer Esterverseifung Gruppe 10 29.06.2013 Patrik Wolfram TId:20 Alina Heidbüchel TId:19 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 3 2 Theorie...
Versuchsprotokoll: Bestimmung der Geschwindigkeitskonstanten einer Esterverseifung Gruppe 10 29.06.2013 Patrik Wolfram TId:20 Alina Heidbüchel TId:19 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 3 2 Theorie...
MATHEMATIK 3 STUNDEN
 EUROPÄISCHES ABITUR 2013 MATHEMATIK 3 STUNDEN DATUM : 10. Juni 2013, Vormittag DAUER DER PRÜFUNG: 2 Stunden (120 Minuten) ERLAUBTES HILFSMITTEL Prüfung mit technologischem Hilfsmittel 1/6 DE AUFGABE B1
EUROPÄISCHES ABITUR 2013 MATHEMATIK 3 STUNDEN DATUM : 10. Juni 2013, Vormittag DAUER DER PRÜFUNG: 2 Stunden (120 Minuten) ERLAUBTES HILFSMITTEL Prüfung mit technologischem Hilfsmittel 1/6 DE AUFGABE B1
Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems
 THEORETISCHE AUFGABE Nr. 1 Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems Wissenschaftler können den Abstand Erde-Mond mit großer Genauigkeit bestimmen. Sie erreichen dies, indem sie einen Laserstrahl an einem
THEORETISCHE AUFGABE Nr. 1 Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems Wissenschaftler können den Abstand Erde-Mond mit großer Genauigkeit bestimmen. Sie erreichen dies, indem sie einen Laserstrahl an einem
P1-53,54,55: Vierpole und Leitungen
 Physikalisches Anfängerpraktikum (P1 P1-53,54,55: Vierpole und Leitungen Matthias Ernst (Gruppe Mo-24 Ziel des Versuchs ist die Durchführung mehrerer Messungen an einem bzw. mehreren Vierpolen (Drosselkette
Physikalisches Anfängerpraktikum (P1 P1-53,54,55: Vierpole und Leitungen Matthias Ernst (Gruppe Mo-24 Ziel des Versuchs ist die Durchführung mehrerer Messungen an einem bzw. mehreren Vierpolen (Drosselkette
Viskositätsmessung mit dem Rotationsviskosimeter
 Versuch: 1 Versuchsziel und Anwendung Viskositätsmessung mit dem Rotationsviskosimeter Die Aufgabe besteht darin, ein Schmieröl auf sein Viskositätsverhalten in Abhängigkeit von der Temperatur zu untersuchen.
Versuch: 1 Versuchsziel und Anwendung Viskositätsmessung mit dem Rotationsviskosimeter Die Aufgabe besteht darin, ein Schmieröl auf sein Viskositätsverhalten in Abhängigkeit von der Temperatur zu untersuchen.
PRAKTIKUM Grundlagen der Messtechnik. VERSUCH GMT 01 Auswertung von Messreihen
 1 Fachbereich: Fachgebiet: Maschinenbau Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Kaufmann PRAKTIKUM Grundlagen der Messtechnik VERSUCH GMT 01 Auswertung von Messreihen Version
1 Fachbereich: Fachgebiet: Maschinenbau Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Kaufmann PRAKTIKUM Grundlagen der Messtechnik VERSUCH GMT 01 Auswertung von Messreihen Version
Abiturprüfung Physik, Grundkurs. Aufgabe 1: Das Fadenstrahlrohr ausgewählte Experimente und Überlegungen
 Seite 1 von 8 Abiturprüfung 2010 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe 1: Das Fadenstrahlrohr ausgewählte Experimente und Überlegungen 1. Im Fadenstrahlrohr (siehe Abbildung 1) wird mit Hilfe einer
Seite 1 von 8 Abiturprüfung 2010 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe 1: Das Fadenstrahlrohr ausgewählte Experimente und Überlegungen 1. Im Fadenstrahlrohr (siehe Abbildung 1) wird mit Hilfe einer
Lösung 05 Klassische Theoretische Physik I WS 15/16. y a 2 + r 2. A(r) =
 Karlsruher Institut für Technologie Institut für theoretische Festkörperphsik www.tfp.kit.edu Lösung Klassische Theoretische Phsik I WS / Prof. Dr. G. Schön Punkte Sebastian Zanker, Daniel Mendler Besprechung...
Karlsruher Institut für Technologie Institut für theoretische Festkörperphsik www.tfp.kit.edu Lösung Klassische Theoretische Phsik I WS / Prof. Dr. G. Schön Punkte Sebastian Zanker, Daniel Mendler Besprechung...
Herbst 2010 Seite 1/14. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Klausur Technische Mechanik II für Maschinenbau. Musterlösungen (ohne Gewähr)
 Seite 1/14 rage 1 ( 2 Punkte) Ein Stab mit kreisförmiger Querschnittsfläche wird mit der Druckspannung σ 0 belastet. Der Radius des Stabes ist veränderlich und wird durch r() beschrieben. 0 r () Draufsicht:
Seite 1/14 rage 1 ( 2 Punkte) Ein Stab mit kreisförmiger Querschnittsfläche wird mit der Druckspannung σ 0 belastet. Der Radius des Stabes ist veränderlich und wird durch r() beschrieben. 0 r () Draufsicht:
Fadenpendel (M1) Ziel des Versuches. Theoretischer Hintergrund
 Fadenpendel M1) Ziel des Versuches Der Aufbau dieses Versuches ist denkbar einfach: eine Kugel hängt an einem Faden. Der Zusammenhang zwischen der Fadenlänge und der Schwingungsdauer ist nicht schwer zu
Fadenpendel M1) Ziel des Versuches Der Aufbau dieses Versuches ist denkbar einfach: eine Kugel hängt an einem Faden. Der Zusammenhang zwischen der Fadenlänge und der Schwingungsdauer ist nicht schwer zu
Untersuchungen zum Slip-Stick- Effekt am Ringschergerät
 LEHRSTUHL FÜR VERFAHRENSTECHNIK DES INDUSTRIELLEN UMWELTSCHUTZES Montanuniversität Leoben vtiu.unileoben.ac.at Franz-Josef-Straße 18 A-8700 Leoben Bachelorarbeit Untersuchungen zum Slip-Stick- Effekt am
LEHRSTUHL FÜR VERFAHRENSTECHNIK DES INDUSTRIELLEN UMWELTSCHUTZES Montanuniversität Leoben vtiu.unileoben.ac.at Franz-Josef-Straße 18 A-8700 Leoben Bachelorarbeit Untersuchungen zum Slip-Stick- Effekt am
Brückenschaltung (BRÜ)
 TUM Anfängerpraktikum für Physiker II Wintersemester 2006/2007 Brückenschaltung (BRÜ) Inhaltsverzeichnis 9. Januar 2007 1. Einleitung... 2 2. Messung ohmscher und komplexer Widerstände... 2 3. Versuchsauswertung...
TUM Anfängerpraktikum für Physiker II Wintersemester 2006/2007 Brückenschaltung (BRÜ) Inhaltsverzeichnis 9. Januar 2007 1. Einleitung... 2 2. Messung ohmscher und komplexer Widerstände... 2 3. Versuchsauswertung...
1. Bestimmen Sie die Phasengeschwindigkeit von Ultraschallwellen in Wasser durch Messung der Wellenlänge und Frequenz stehender Wellen.
 Universität Potsdam Institut für Physik und Astronomie Grundpraktikum 10/015 M Schallwellen Am Beispiel von Ultraschallwellen in Wasser werden Eigenschaften von Longitudinalwellen betrachtet. Im ersten
Universität Potsdam Institut für Physik und Astronomie Grundpraktikum 10/015 M Schallwellen Am Beispiel von Ultraschallwellen in Wasser werden Eigenschaften von Longitudinalwellen betrachtet. Im ersten
Übungen zur Experimentalphysik 3
 Übungen zur Experimentalphysik 3 Prof. Dr. L. Oberauer Wintersemester 2010/2011 5. Übungsblatt - 22.November 2010 Musterlösung Franziska Konitzer (franziska.konitzer@tum.de) Aufgabe 1 ( ) (8 Punkte) Ein
Übungen zur Experimentalphysik 3 Prof. Dr. L. Oberauer Wintersemester 2010/2011 5. Übungsblatt - 22.November 2010 Musterlösung Franziska Konitzer (franziska.konitzer@tum.de) Aufgabe 1 ( ) (8 Punkte) Ein
Institut für Technische Chemie Technische Universität Clausthal
 Institut für echnische Chemie echnische Universität Clausthal echnisch-chemisches Praktikum CB Versuch: Extraktion Einleitung Die Flüssig-Flüssig-Extraktion ist ein thermischer Prozess zur rennung eines
Institut für echnische Chemie echnische Universität Clausthal echnisch-chemisches Praktikum CB Versuch: Extraktion Einleitung Die Flüssig-Flüssig-Extraktion ist ein thermischer Prozess zur rennung eines
Praktikum Optische Technologien Anleitung zum Versuch Dicke Linsen
 Fachbereich Energietechnik Lehrgebiet für Lasertechnik und Optische Technologien Prof. Dr. F.-M. Rateike Praktikum Optische Technologien Anleitung zum Versuch Dicke Linsen August 204 Praktikum Optische
Fachbereich Energietechnik Lehrgebiet für Lasertechnik und Optische Technologien Prof. Dr. F.-M. Rateike Praktikum Optische Technologien Anleitung zum Versuch Dicke Linsen August 204 Praktikum Optische
HANDOUT. Vorlesung: Glas-Grundlagen. Mechanische Eigenschaften
 Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an der Universität des Saarlandes HANDOUT Vorlesung: Glas-Grundlagen Mechanische Eigenschaften Leitsatz: 02.06.2016 "Die große Schwankungsbreite der erreichten
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an der Universität des Saarlandes HANDOUT Vorlesung: Glas-Grundlagen Mechanische Eigenschaften Leitsatz: 02.06.2016 "Die große Schwankungsbreite der erreichten
Spezifischer elektrischer Widerstand und TK R -Wert von Leiter- und Widerstandswerkstoffen
 Fachbereich 1 Laborpraktikum Physikalische Messtechnik/ Werkstofftechnik Spezifischer elektrischer Widerstand und TK R -Wert von Leiter- und Widerstandswerkstoffen Bearbeitet von Herrn M. Sc. Christof
Fachbereich 1 Laborpraktikum Physikalische Messtechnik/ Werkstofftechnik Spezifischer elektrischer Widerstand und TK R -Wert von Leiter- und Widerstandswerkstoffen Bearbeitet von Herrn M. Sc. Christof
LK Lorentzkraft. Inhaltsverzeichnis. Moritz Stoll, Marcel Schmittfull (Gruppe 2) 25. April Einführung 2
 LK Lorentzkraft Blockpraktikum Frühjahr 2007 (Gruppe 2) 25. April 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 2 Theoretische Grundlagen 2 2.1 Magnetfeld dünner Leiter und Spulen......... 2 2.2 Lorentzkraft........................
LK Lorentzkraft Blockpraktikum Frühjahr 2007 (Gruppe 2) 25. April 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 2 Theoretische Grundlagen 2 2.1 Magnetfeld dünner Leiter und Spulen......... 2 2.2 Lorentzkraft........................
Rheinische Fachhochschule Köln
 Rheinische Fachhochschule Köln Matrikel-Nr. Nachname Dozent Ianniello Semester Klausur Datum Fach Urteil BM, Ing. K 8 11.7.14 Kinetik, Kinematik Genehmigte Hilfsmittel: Punkte Taschenrechner Literatur
Rheinische Fachhochschule Köln Matrikel-Nr. Nachname Dozent Ianniello Semester Klausur Datum Fach Urteil BM, Ing. K 8 11.7.14 Kinetik, Kinematik Genehmigte Hilfsmittel: Punkte Taschenrechner Literatur
Mathematische Probleme, SS 2015 Montag $Id: quadratisch.tex,v /06/22 12:08:41 hk Exp $
 Mathematische Probleme, SS 15 Montag 6 $Id: quadratischtex,v 111 15/06/ 1:08:41 hk Exp $ 4 Kegelschnitte 41 Quadratische Gleichungen In der letzten Sitzung hatten wir die Normalform (1 ɛ )x + y pɛx p =
Mathematische Probleme, SS 15 Montag 6 $Id: quadratischtex,v 111 15/06/ 1:08:41 hk Exp $ 4 Kegelschnitte 41 Quadratische Gleichungen In der letzten Sitzung hatten wir die Normalform (1 ɛ )x + y pɛx p =
Verzerrungen und Festigkeiten
 Verzerrungen und Festigkeiten Vorlesung und Übungen 1. Semester BA Architektur KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Verzerrungen
Verzerrungen und Festigkeiten Vorlesung und Übungen 1. Semester BA Architektur KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Verzerrungen
Koordinatensysteme der Erde
 Koordinatensysteme der Erde Es gibt verschiedene Arten, die Position eines Punktes auf der Oberfläche einer Kugel (manchmal auch Sphäre genannt) darzustellen, jede hat ihre Vor-und Nachteile und ist für
Koordinatensysteme der Erde Es gibt verschiedene Arten, die Position eines Punktes auf der Oberfläche einer Kugel (manchmal auch Sphäre genannt) darzustellen, jede hat ihre Vor-und Nachteile und ist für
Definition von Sinus und Cosinus
 Definition von Sinus und Cosinus Definition 3.16 Es sei P(x y) der Punkt auf dem Einheitskreis, für den der Winkel von der positiven reellen Halbachse aus (im Bogenmaß) gerade ϕ beträgt (Winkel math. positiv,
Definition von Sinus und Cosinus Definition 3.16 Es sei P(x y) der Punkt auf dem Einheitskreis, für den der Winkel von der positiven reellen Halbachse aus (im Bogenmaß) gerade ϕ beträgt (Winkel math. positiv,
Labor zur Vorlesung Physik
 Labor zur Vorlesung Physik 1. Zur Vorbereitung Die folgenden Begriffe sollten Sie kennen und erklären können: Gravitationsgesetz, Gravitationswaage, gedämpfte Torsionsschwingung, Torsionsmoment, Drehmoment,
Labor zur Vorlesung Physik 1. Zur Vorbereitung Die folgenden Begriffe sollten Sie kennen und erklären können: Gravitationsgesetz, Gravitationswaage, gedämpfte Torsionsschwingung, Torsionsmoment, Drehmoment,
Vorbereitungsaufgaben zur Klausur Mathematik I für Studierende des Studienganges Elektrotechnik und Informationssystemtechnik
 Vorbereitungsaufgaben zur Klausur Mathematik I für Studierende des Studienganges Elektrotechnik und Informationssystemtechnik (Aufgaben aus Klausuren). Bestimmen und skizzieren Sie in der Gaußschen Zahlenebene
Vorbereitungsaufgaben zur Klausur Mathematik I für Studierende des Studienganges Elektrotechnik und Informationssystemtechnik (Aufgaben aus Klausuren). Bestimmen und skizzieren Sie in der Gaußschen Zahlenebene
Physikalisches Praktikum 3. Semester
 Torsten Leddig 30.November 2004 Mathias Arbeiter Betreuer: Dr.Hoppe Physikalisches Praktikum 3. Semester - Newtonsche Ringe - 1 1 Newtonsche Ringe: Aufgaben: Bestimmen Sie den Krümmungsradius R sowie den
Torsten Leddig 30.November 2004 Mathias Arbeiter Betreuer: Dr.Hoppe Physikalisches Praktikum 3. Semester - Newtonsche Ringe - 1 1 Newtonsche Ringe: Aufgaben: Bestimmen Sie den Krümmungsradius R sowie den
FEM-Modellbildung und -Berechnung von Kehlnähten
 FEM-Modellbildung und -Berechnung von Kehlnähten 1. Problemstellung und Lösungskonzept Die wesentliche Schwierigkeit bei der Berechnung einer Kehlnaht ist die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Geometrie
FEM-Modellbildung und -Berechnung von Kehlnähten 1. Problemstellung und Lösungskonzept Die wesentliche Schwierigkeit bei der Berechnung einer Kehlnaht ist die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Geometrie
Musterlösung zu den Übungen zur Vorlesung Mathematik für Physiker II. x 2
 Musterlösung zu den Übungen zur Vorlesung Mathematik für Physiker II Wiederholungsblatt: Analysis Sommersemester 2011 W. Werner, F. Springer erstellt von: Max Brinkmann Aufgabe 1: Untersuchen Sie, ob die
Musterlösung zu den Übungen zur Vorlesung Mathematik für Physiker II Wiederholungsblatt: Analysis Sommersemester 2011 W. Werner, F. Springer erstellt von: Max Brinkmann Aufgabe 1: Untersuchen Sie, ob die
Ferienkurs Experimentalphysik 3
 Ferienkurs Experimentalphysik 3 Musterlösung Montag 14. März 2011 1 Maxwell Wir bilden die Rotation der Magnetischen Wirbelbleichung mit j = 0: ( B) = +µµ 0 ɛɛ 0 ( E) t und verwenden wieder die Vektoridenditäet
Ferienkurs Experimentalphysik 3 Musterlösung Montag 14. März 2011 1 Maxwell Wir bilden die Rotation der Magnetischen Wirbelbleichung mit j = 0: ( B) = +µµ 0 ɛɛ 0 ( E) t und verwenden wieder die Vektoridenditäet
