QUO VADIS GESUNDHEITSPOLITIK?
|
|
|
- Astrid Nelly Becker
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 QUO VADIS GESUNDHEITSPOLITIK? Das Onlinemagazin zur Gesundheitspolitik
2 Inhalt Inhaltsverzeichnis Titelstory Quo vadis Gesundheitspolitik?... 4 Seite 11 Diskussionsrunde am Tag der Hausarztmedizin Kommunikation...6 Standpunkt Günther E. Buchholz E-Health-Gesetz Eine Datenautobahn mit Hindernissen... 8 Nachrichten Diskussionsrunde am Tag der Hausarztmedizin VDGH Mitgliederversammlung 2015 Der Diabetes Tsunami Seite Pharma-Großhandelstag DAK-Gesundheit Versorgungsreport Schlaganfall Berliner Runde des BAH Schrittinnovationen in der Arzneimittelbranche Pharma-Großhandelstag MDS Begutachtung von Behandlungsfehlern / Jahresstatistik vfa-frühjahrs-symposium 2015 Innovationen im Dienste der Gesellschaft AOK-BV Faktenboxen Seite 26 AOK-BV Faktenboxen 2
3 Inhalt Berichte 4. QMR Kongress Qualitätsmessung und Qualitätsmanagement mit Routinedaten...29 Seite Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) 52. Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbandes (DAV)...33 Boulevard ABDA Sommerfest...37 Betriebliche Krankenversicherung feiert 10-jähriges Jubiläum...42 IKK e.v. Gesundheit trifft Zirkus...48 Rezensionen Monsieur Optimist...56 Seite 37 ABDA Sommerfest Gemüse Das Kochbuch...58 Impressum...60 Seite 42 Betriebliche Krankenversicherung feiert 10-jähriges Jubiläum Seite 48 IKK e.v. Gesundheit trifft Zirkus 3
4 TITELSTORY Quo vadis Gesundheitspolitik? Die Gesetzesmaschinerie läuft und läuft und läuft. Die Weichen sind von der großen Koalition auf freie Fahrt gestellt, und der Bundesrat bremst nicht ab eigentlich für Politik und Exekutive ein traumhafter Zustand. Aber kleine Hindernisse sind am Horizont schon erkennbar das für die Pflegegesetzgebung notwendige finanzielle Polster dürfte wohl nicht reichen, entweder wird man weiter an der Beitragssatzschraube nach oben drehen oder die geplanten Leistungen etwas herunterschrauben müssen. Dies wird Hermann Gröhe zur Zeit nicht schrecken, denn dieses kleine Hindernis wird erst nach der Bundestagswahl in der Öffentlichkeit relevant werden. Die Erkenntnis, dass Zusatzbeiträge in der GKV auch durch weitere, großzügige Ausgaben gepuscht erhoben werden müssen und stetig ansteigen werden, ist nicht neu, könnte aber Hermann Gröhe noch vor der Bundestagswahl unangenehm aufstoßen. Die Zeit der Leistungsverbesserungen, der vermeintlich milden Gaben der Politik ( Wir haben Geld in die Hand genommen ) war nur ein kurzes Intermezzo, bald ist wieder strenge Finanzdisziplin und sind auch Spargesetze angesagt. Im Wahlkampf könnten diese steigenden Beiträge thematisiert werden, dann wird es keine große Koalition, die in der Gesundheitspolitik eisern zusammensteht, mehr geben. SPD und die Oppositionsparteien könnten z.b. die Abschaffung der alleinigen Belastung der Arbeitnehmer durch Zusatzbeiträge auf ihre Fahnen schreiben und dann hilft auch keine Wettbewerbslyrik mehr, die in der realen Welt ohnehin niemand glaubt. Für die Bürger zählt nur, was sie ausgeben müssen, ob es nun der Beitrag oder der Zusatzbeitrag ist. Für einen Durchschnittsverdiener könnten steigende Zusatzbeiträge leicht den Verzicht auf den Familienurlaub oder auf etliche Weihnachtsgeschenke bedeuten. Aus Erfahrung weiß man, dass sich mit Gesundheitspolitik zwar keine Wahlen gewinnen, wohl aber verlieren lassen. Unter den Wählern sind mehr Beitragszahler als Patienten, und die Interessen der Beitragszahler sind niedrige Beiträge. Es könnte also sein, dass sich das forsche Durchregieren rächt. Hermann Gröhe und die Union werden sich Gedanken machen müssen, wie sie sich über den Wahltermin retten können. Manchmal hat man einfach Dusel, und Dusel gehört auch zu einer erfolgreichen Politik. Gefährlich werden könnten bei entsprechender medialer Aufarbeitung auch die strukturpolitischen Sündenfälle, die immer mehr zunehmen. Erwähnt seien hier nur diejenigen, die sich medial ausschlachten lassen, weil sie leicht zu erklären, zu verstehen und mit einem einfachen Label zu versehen sind. 4
5 TITELSTORY Ein Paradebeispiel stammt aus dem Präventionsgesetz. 35 Mio. werden aus den Beitragsgeldern in die dem BMG nachgeordnete Behörde BZgA transferiert. Mag dieser Transfer vielleicht sogar rechtlich sauber sein (man hört schon von Ferne den Ruf nach einer Verfassungsklage), politisch ist er es auf keinen Fall. Man kann sich die Schlagzeilen der Yellow Press schon vorstellen, gegen die man sich mit einer vermeintlich formalrechtlichen Argumentationen allein schlecht wehren kann. Für jeden Wahlkampfstrategen sind solche Angriffe Leckerbissen. Auch im ehealth-gesetz lassen sich einige solcher Problemzonen finden, wie die Regelung zur Strafaktion Verwaltungshaushalte bei nicht Einhaltung der Fristen. Man stelle sich vor, die Industrie liefert nicht fristgerecht, wie trotz anderseitiger Beteuerungen schon geschehen, und die Haushalte würden tatsächlich gekürzt. Die Überschrift in den Boulevardzeitungen könnte z.b. heißen Gesundheitswesen der Industrie ausgeliefert oder ähnlich. Daraus lässt sich, garniert mit einigen anderen Häppchen, schon ein kleiner Skandal hervorzaubern. Ähnliche Beispiele könnten viele Seiten füllen, und man fragt sich, warum Hermann Gröhe und die Koalitionäre sich ohne Not in solche Gefahr begeben. Es ist bei hellem Licht betrachtet, nur schwer nachzuvollziehen, warum diese vielen ordnungspolitischen Sündenfälle begangen werden, meist nur um eines kleinen Vorteils willen. Auch steht die grundsätzliche Frage im Raum, warum das Pendel immer mehr weg von einer Ordnungspolitik, die den Rahmen z. B. für einen Wettbewerb nach bestimmten Regeln setzt, nicht etwa hin zu einer Böden einziehenden Strukturpolitik, sondern zu reiner Prozesspolitik oder gar zu Einzelregelungen hin ausschlägt. Honi soi qui mal y pense. Für Vertreter der sozialen Marktwirtschaft, sprich für Ordoliberale, ist dies ein ekelhafter Graus. Schon im Jahr 2009 veröffentlichten 80 Professoren der Volkswirtschaft einen Aufruf zur Rettung der Ordnungspolitik in der FAZ genutzt hat es, obwohl das hohe Lob der sozialen Marktwirtschaft und der Ordnungspolitik immer wieder in Sonntagsreden wie ein Mantra vorgetragen wird, zumindest für die Gesundheitspolitik nicht. Eine pragmatische Politik, wie zur Zeit praktiziert, die einigen Marktteilnehmern und Akteuren immer wieder in einzelnen Punkten entgegenkommt, einzelne Punkte in ihrem Sinn regelt, kann und wird höchstwahrscheinlich den Protagonisten auf die Füße fallen und dem Gesundheitswesen schaden. 5
6 KOMMUNIKATION Liebe Leserin, liebe Leser, in der letzten Zeit sorgen wir uns ein wenig um unsere Politiker und Lawmaker. Nehmen wir als ein Beispiel unter vielen den Entwurf eines Gesetzes für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen. Unter C. Alternativen heißt es: Keine. Das bedeutet, um im Jargon zu bleiben, alternativlos. Aber stimmt dies überhaupt? Selbstverständlich nicht! Es sind etliche Alternativen vorstellbar, so, dass man die Selbstverwaltung ihr Geschäft betreiben lässt, dass sich die Telematikinfrastruktur es gibt längst eine, die man nur vernetzen müsste einfach weiterentwickelt, dass man nur bestimmte Standards setzt usw. Alternativlos nein! Das wissen auch das und der BMG, aber warum steht dann im Text Alternativen keine? Nun gut, könnte man erwidern, es sind doch letztlich nur Formeln und das ändert doch am Inhalt der Gesetze nichts. Aber ist das korrekt? Zumindest kommen Zweifel auf. Noch merkwürdiger wird es unter F. Weitere Kosten Kosten, die über die aufgeführten Ausgaben und den genannten Erfüllungsaufwand hinausgehen, entstehen durch das Gesetz nicht. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. Aber stimmt dies? Die Frage ist doch, wie stark sich die Ausgaben der Krankenkassen, sprich der Beitragszahler und das sind 91% der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, auf die Beitragssätze, insbesondere auf die Zusatzbeiträge wie immer man sie nennt auswirken, die dann wiederum Auswirkungen haben. Näheres erfährt man, betrachtet man D. Haushaltsaufgaben ohne Erfüllungsaufwand. Da heißt es unter 1) Bund Keine, unter 2) Länder und Gemeinden Keine und 6
7 KOMMUNIKATION dann folgt unter 3) Gesetzliche Krankenversicherung ein langer Abschnitt zusätzliche Ausgaben in nicht quantifizierbarer Höhe nicht quantifizierbar Höhe der Mehrausgaben...abhängig von dem Umfang und der Ausgestaltung der zu vereinbarenden Vergütung unterer zweistelliger Millionenbetrag unterer dreistelliger Millionenbetrag usw. Es ist richtig, dass vieles davon Investitionen in eine zukunftsweisende Infrastruktur sind, anderes sind aber Locksummen für Leistungserbringer. Sind Infrastrukturaufgaben nicht Aufgaben des Bundes? Man kann nun durchaus argumentieren, dass dies eine spezifische Infrastruktur ist, aber sind nicht auch Wasseraufbereitungen spezifische Infrastrukturen? Egal, wie man dies bewerten mag, dem Beitragszahler, der 91% der Steuerzahler ausmacht, zahlt via Beiträge. Betrachtet man nur den Steuerzahler, dann entstehen ihm keine Kosten, nur dem Beitragszahler, der sich aber mit dem Steuerzahler in 91% der Fälle ein Portemonnaie teilt. Ist es dann nicht ein wenig seltsam zu schreiben, dass den Bürgerinnen und Bürgern keine Kosten entstehen? Formal mag dies richtig sein, aber nicht in der Realität, und es ist ein Rechnen von der einen in die andere Tasche. Die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung fällt nicht vom Himmel, sondern wird aus dem Portemonnaie der Beitragszahler bezahlt. Dies wird leider allzu oft schlicht vergessen, wenn nicht, würde es sich wohl um Zynismus des Gesetzgebers handeln. Ihr highlights team 7
8 STANDPUNKT E-Health-Gesetz Eine Datenautobahn mit Hindernissen Dr. Günther E. Buchholz, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) Quelle: KZBV Der Aufbau eines sicheren elektronischen Netzes, welches es Zahnärzten, Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen ermöglicht, sensible Sozialdaten von Patienten geschützt zu kommunizieren, ist ein wichtiges und sinnvolles Ziel. Dass die Bundesregierung vorsieht, den Aufbau einer Telematikinfrastruktur mittels des geplanten Gesetzes für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesund heitswesen zügig voranzutreiben, wird durch die KZBV daher auch im Grundsatz begrüßt. Fristen und Sanktionen bei deren Überschreitung kontraproduktiv Die Plan der Regierung, den Aufbau der Telematikinfrastruktur durch Fristen und damit verknüpfte Sanktionen bei deren Überschreitung zu beschleunigen, steht dem gesamten 8
9 STANDPUNKT Vorhaben aber grundsätzlich kontraproduktiv entgegen und schmälert gleichzeitig die Akzeptanz für derartige Strukturen bei den Leistungserbringern. Mögliche finanzielle Einbußen führen darüber hinaus zu einer Unkalkulierbarkeit der Haushalte der beteiligten Körperschaften. Die ebenso scharfe wie berechtigte Kritik von Seiten der Kassenärztlichen sowie der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und auch des GKV-Spitzenverbandes verwundert wenig, behindern derartige Strafzölle doch die Wahrnehmung ureigenster Aufgaben der Selbstverwaltung und damit letztlich auch die zielgerichtete Unterstützung des Projektes. Auch ist es generell fraglich, ob eine derartige Maßnahme rechtlich überhaupt zulässig ist. Hier wird seitens des Gesetzgebers unmittelbar in die Selbstverwaltungsautonomie in einem Bereich eingegriffen, der von diesem nicht zu verantworten ist. Nach dem aktuellen Gesetzentwurf ist die gematik gehalten, die erforderlichen Maßnahmen bis zum 30. Juni 2016 durchführen, damit Dienste zur Onlineprüfung und -aktualisierung der Versichertenstammdaten wie Name, Geburtsdatum, Anschrift oder Krankenversichertennummer ermöglicht werden. Die Vorgaben starrer Fristen sind mit der Gefahr qualitativer Einbußen verbunden. Dies betrifft sowohl mögliche Abstriche bei der Erprobung als auch beim Aufbau der Telematikinfrastruktur. Praxen zahlen für unverschuldete Verzögerungen Auch die vorgesehenen Abzüge bei den Abrechnungen in Zahnarztpraxen im Fall von zeitlichen Verzögerungen sind völlig unangemessen. Zahnärzten und Ärzten, die ab 1. Juli 2018 ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Versichertenstammdatenprüfung nicht nachkommen, soll die Vergütung von Kassenleistungen dann pauschal um ein Prozent gekürzt werden. Diese Form der Umsetzung ist realitätsfern, und die Sanktionierung mittels Honorarkürzungen trifft die Falschen, jedenfalls dann, wenn sie nicht einmal die Möglichkeit haben, das intendierte Ergebnis auch zu erzielen: Die Ausstattung von Praxen mit Komponenten für die Onlineanbindung ist überaus komplex und die entsprechende Infrastruktur zu großen Teilen von externen Technikdienstleistern abhängig. Die Praxen haben auf die beteiligten Unternehmen und ihre Arbeitsabläufe aber nicht den geringsten Einfluss! Hier wird also die Verantwortung einer möglichen Verzögerung an völlig falscher Stelle verortet. Angesichts der immensen Zahl der zahnärztlichen und ärztlichen Praxen ist es fraglich, ob die Industrie überhaupt in der Lage ist, die notwendigen 9
10 STANDPUNKT technischen Strukturen fristgerecht und flächendeckend zu installieren. Vor diesem Hintergrund stellen die geplanten Strafmaßnahmen zwar einen erheblichen Eingriff in die zahnärztliche Berufsfreiheit dar, sorgen allerdings in keiner Weise dafür, die notwendigen Vorgänge zu beschleunigen und die Akzeptanz für ein so zentrales gesundheitspolitisches Projekt zu erhöhen. Hinzu kommt, dass den Praxen durch die Aktualisierung der Versichertenstammdaten auf der Elektronischen Gesundheitskarte (egk) ein nicht geringer zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht. Ärgerlich ist dabei besonders, dass es sich um eine administrative Aufgabe handelt, die originär den Kassen zufällt. Wichtig ist daher, wenn schon diese Arbeit gesetzlich fixiert in den Praxen geleistet werden muss, dass der zusätzliche Aufwand für die Zahnärzte auch in angemessener Weise vergütet wird. Fazit Die Bundesregierung ist leider der ausführlichen und fundierten Argumentation der gemeinsamen Stellungnahme zum Referentenentwurf des Gesetzes nicht gefolgt und hat an den Sanktionsregelungen festgehalten. Es bleibt festzustellen, dass das Androhen von Strafen und das Setzen von nicht einzuhaltenden Fristen dem zügigen Auf- und Ausbau der Datenautobahn alles andere als dienlich ist. Dem Gesetzgeber sollte vielmehr bewusst sein, dass es andere, bereits bewährte Instrumente gibt, um den weiteren Projektverlauf sicherzustellen. Dazu zählt zum Beispiel die Möglichkeit, dass die gematik gegenüber der Industrie Vertragsstrafen aussprechen kann, wenn vereinbarte Leistungen nicht pünktlich erbracht werden. 10
11 NACHRICHTEN v. l.: Jens Spahn (MdB CDU), Joachim Szecsenyi (Universitätsklinikum Heidelberg), Anni Dunkelmann, Ulrich Weigeldt (Deutscher Hausärzteverband), Naomi Lämmlin (bvmd), Karl Lauterbach (MdB SPD); Quelle: Svea Pietschmann Diskussionsrunde am Tag der Hausarztmedizin Berlin, Zum ersten Mal fand ein bundesweiter Tag der Hausarztmedizin mit dem Schwerpunkt Nachwuchssicherung statt. Das Thema diskutierten Naomi Lämmlin, Präsidentin des Bundesverbandes Medizinstudierender, Karl Lauterbach, Jens Spahn, Joachim Szecsenyi und Ulrich Weigeldt, moderiert von Anni Dunkelmann (rbb). Die Diskutanten waren sich einig, dass zwar noch viel zu tun, aber auch schon einiges in Bewegung gekommen ist. Joachim Szecsenyi betonte die Erfolge des Förderprogramms Baden-Württemberg für Joachim Szecsenyi (Universitätsklinikum Heidelberg); Quelle: Svea Pietschmann 11
12 NACHRICHTEN den ländlichen Raum, das die Weiterbildung für 560 Ärztinnen und Ärzte organisiert. Die Weiterbildungsdauer sei um 1 bis 2 Jahre gesunken, ein bundesweites Förderprogramm sei notwendig. Naomi Lämmlin bestärkte Joachim Szecsenyi in dieser Auffassung, das Blockpraktikum sei oft nicht gut organisiert, die Weiterbildung für Allgemeinmedizin dauere zu lang. Karl Lauterbach mahnte an, die Attraktivität des Hausarztberufs zu stärken weniger Bürokratie, ein hohes Einkommen, flexible Arbeitszeiten und Werbung, dass der Hausarzt den Schlüssel für Gesundheit in der Hand halte, seien wichtig. Schon heute könne man als Hausarzt richtig gut verdienen, bestätigte ihn Jens Spahn. Bestimmte Mythen seien immer noch in den Köpfen, so über Wirtschaftlichkeitsprüfungen und, dass ein Drittel der Leistungen nicht bezahlt werde. Der Schlüssel liege in der Schwerpunktwahl und der Gestaltung des Studiums. Deshalb sei es notwendig, sich mit den Gesundheits- und Wissenschaftsministern zusammenzusetzen (am nächsten Tag fand das 1. Bund-Länder-Treffen zum Masterplan Medizinstudium statt). Karl Lauterbach und Jens Spahn berichteten von der abschließenden Runde zu den Änderungsanträgen zum GKV-Versorgungsstärkungsgesetz, dass bis zu 5% der vorgesehenen Fördermittel für Weiterbildung in Kompetenzzentren zur Verfügung gestellt werden sollen. Mit der Stiftung Perspektive Hausarzt habe der Hausärzteverband, so Ulrich Weigeldt, sich der Problematik angenommen. Schon während des Studiums müsse der Zugang zu Ulrich Weigeldt (Deutscher Hausärzteverband); Quelle: Svea Pietschmann hausärztlichen Praxen geschaffen, den Studierenden Ängste genommen werden. Die Bedeutung von Einkommen werde zu Zeiten des Studiums unterschätzt, als Hausärzte könnten sie mit einem guten Einkommen rechnen. Immer noch würden Fachärzte ohne Ende produziert, kein Ärztetag vergehe, ohne die Schaffung eines neuen Arztes. Nur 10% absolvierten ihre Weiterbildung in der Allgemeinmedizin. 12
13 NACHRICHTEN VDGH Mitgliederversammlung 2015 Der Diabetes Tsunami Berlin, In der diesjährigen Mitgliederversammlung des Verbandes der Diagnostica-Industrie (VDGH) stand das Thema Diabetes im Mittelpunkt. Vertreter aus Politik und Wissenschaft sowie Betroffene diskutierten die Herausforderungen durch die Volkskrankheit. Matthias Borst (VDGH); Quelle: Henning Schacht Angesichts 6 Mio. Betroffener und Neuerkrankungen jährlich sprach Matthias Borst von einem Diabetes-Tsunami, der auf Deutschland zurolle. Die Kostendimension sei auch angesichts der Folgeerkrankungen eine Herausforderung für das Gesundheitssystem. Der VDGH fordere einen runden Tisch mit unterschiedlichen Disziplinen und der Risikobereitschaft, in Technologie zu investieren. Diabetes am Helmholtz Zentrum München, berichtet über neue Ergebnisse aus der Diabetesforschung, Ursachenforschung, über die Gefahr von Unterzuckerung, die Sicherheit neuer Medikamente und über ein personalisiertes Diabetesmanagement. Ursachen seien ein enorm komplexes Network, deshalb sei ein multifaktorieller Ansatz erforderlich, personalisierte Ansätze würden benötigt. Fortschritt werde durch Technologie erzielt, gute Schulungen seien nötig und sollten wiederholt, softwareapplizierte Applikationen im Idealfall immerwährend modifiziert werden. Auch die Diabetes-Diagnostik habe sich weiterentwickelt. Therapeutische Optionen nähmen zu, eine Vielzahl sicherer Medikamente sei zugänglich. Ob diese auch erstattet würden, beschäftige das IQWiG und den GBA. Die Sicherheit neuer Medikamente stehe stark im Fokus. Allein in diesem Jahr würden noch 3 Studien zur kardiovaskulären Sicherheit mit Patienten vorgestellt. Oliver Schnell, Leiter der Forschergruppe Oliver Schnell (Helmholtz Zentrum München); Quelle: Henning Schacht 13
14 NACHRICHTEN v. l.: Oliver Schnell (Helmholtz Zentrum München), Dietrich Monstadt (MdB CDU), Susanne Kluge, Günther Jonitz (ÄK Berlin), Matthias Borst (VDGH); Quelle: Henning Schacht In ökonomischer Hinsicht stellte er durch die Verminderung der Messfehlerbreite ein Einsparpotential von 25 Mio. jährlich in Aussicht. In der anschließenden Podiumsdiskussion betonte Udo Walz, seit 25 Jahren Typ-2-Diabetiker, die Vorteile von Insulinpumpen, Diabetes- Sensoren und sensibilisierte für die Wichtigkeit der präventiven Pediküre. Dietrich Monstadt, ebenfalls Betroffener, führte die Vorteile einer nationalen Diabetesstrategie aus, ein Ansinnen, das von allen Seiten positiv aufgenommen wurde. Sie hätten einen entsprechenden Antrag formuliert. Wenn sie die SPD überzeugt hätten, wollten sie einen Initiativantrag beschließen lassen. Dann erfolge die Umsetzung einer nationalen Strategie gemeinsam mit dem BMG. Diese Strategie sei dringend erforderlich. Man müsse zu einer einheitlichen Entwicklung finden, Länder und Kommunen mitnehmen. Auch Kultus, Landwirtschaft und andere Ressorts müssten einbezogen werden. Allein von der Kostenseite sei es sinnvoll, Ärzte einzubeziehen. Keine Gruppe könne eine nationale Diabetesstrategie allein auf den Weg bringen. Ein Plan zur Diabetesbehandlung sei in Sachsen erfolgreich umgesetzt worden. Dort hätten sich Krankenhäuser, Diabetologen und Hausärzte zusammengesetzt. Innerhalb von einem Quartal hätten die Werte im gesamten Freistaat eine erhebliche Verbesserung aufgewiesen, dies könne man auf die Nation übertragen. Als Arzt sei das Wichtigste für den Patienten, was man investieren könne, Zeit. Der Innovationsfonds könne vielleicht die Eintrittspforte dafür sein, dass Ärzte mehr Zeit investieren könnten, ohne an Verdienst einzubüßen. Der Präsident der Berliner Ärztekammer Günther Jonitz stellte eine 3. Revolution im Gesundheitswesen in Aussicht von einer Kosten- zu einer Werteorientierung. Bereits auf dem Deutschen Ärztetag hätten Themen wie Kommunikation, Compliance und Adherence einen größeren Stellenwert eingenommen. Auch Matthias Borst befürwortete einen nationalen Diabetes Plan. Sie könnten neue Produkte in den Markt bringen, um die Diagnostik zu verbessern. Die Erstattung virtueller Medizin sei ein Schritt, der in der Zukunft folgen solle. 14
15 NACHRICHTEN DAK-Gesundheit Versorgungsreport Schlaganfall Berlin, Die DAK-Gesundheit veröffentlichte ihren ersten Versorgungsreport zum Thema Schlaganfall im Rahmen eines gemeinsamen Symposiums mit BIOTRONIK und Bayer HealthCare. Der Schlaganfall sei eine der Krankheiten, die komplexe Versorgungsprozesse auslösten und prototypisch für vermehrten Versorgungsbedarf sei, begründete Herbert Rebscher die Auswahl gerade dieser Erkrankung. Der Versorgungsreport sei der Auftakt einer Reihe von Versorgungsreporten zu komplexen Versorgungsthemen. Es sei wichtig zu untersuchen, welche Schritte als nächstes zu gehen seien, denn angesichts immer komplexeren Versorgungszusammenhängen und immer mehr Spezialisten müsse man sich fragen, wer das Nebeneinander mehrerer Spezialisten in langen Versorgungsabläufen koordiniere. Probleme sollten gemeinsam angegangen werden, auch in offener Partnerschaft mit der Industrie. Herbert Rebscher (DAK-Gesundheit) Hans-Dieter Nolting, Geschäftsführer des IGES Instituts, präsentierte das Potential zur Vermeidung von Schlaganfällen und damit verbundener Gebrechen, sowie das damit verbundene finanzielle Einsparpotential. Er kam nach einer von der WHO entwickelten Methodik zu dem Schluss, dass realistisch eine Krankheitslast von knapp DALY (Disability Adjusted Life Years) und mindestens 67,9 Mio. eingespart werden könnten. Anne Barzel, Fachärztin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, lobte den Einsatz des arriba-risikorechners. Roberto Belke, CENE BIOTRONIK, pries die Vorzüge des Biomonitors, der im Rahmen eines (bisher exklusiven) IV-Vertrags mit der DAK-Gesundheit als Implantat Vorhofflimmern detektiert. 15
16 NACHRICHTEN 2. Berliner Runde des BAH Schrittinnovationen in der Arzneimittelbranche Berlin, Nach Hermann Kortland (BAH) stehen in Zeiten des AMNOG Schrittinnovationen nicht im Fokus der Diskussion. Das AMNOG ziele auf neue Wirkstoffe, auf Sprunginnovationen. Daneben gebe es aber auch Schrittinnovationen, z.b. neue galenische Formen, Weiterentwicklung bekannter Wirkstoffe, ein therapeutischer Fortschritt, der aber häufig sozialrechtlich über Festbeträge und das Preismoratorium eingefangen werde. Markus Rudolph (Initiative Arzneimittel für Kinder) ergänzte die Thematik im Impulsvortrag. Beispiele für Schrittinnovationen aus dem Bereich Kinderarzneimittel seien auch ein besser schmeckender Hustensaft oder ein Antibiotikum, das nur 2 Mal am Tag eingenommen werden müsse, was es ermögliche, dass Eltern arbeiten könnten. Aus Sicht der Betroffenen hätten solche Schrittinnovationen eine hohe Relevanz, würden aber oft mit Scheininnovationen in einen Topf geworfen. Während Sprunginnovationen oft noch große Nebenwirkungen aufwiesen, brächten Schrittinnovationen therapeutisch verbesserte Eigenschaften mit sich. Schrittinnovationen seien Wegbereiter des pharmazeutischen Fortschritts, auf sie würden undifferenziert Festbeträge, Rabattverträge und Preismoratorium angewendet. Besonderer Handlungsbedarf bestehe für PUMA-Arzneimittel, rein für die pädiatrische Verwendung weiter entwickelte Hermann Kortland (BAH); Quelle: Svea Pietschmann Markus Rudolph (Initiative Arzneimittel für Kinder); Quelle: Svea Pietschmann Medikamente. Die EU-Kommission spreche von einem Misserfolg der europäischen Förderung von PUMA-Arzneimitteln, weil diese europäische Initiative durch nationale Regelungen ausgehebelt werde. 16
17 NACHRICHTEN v. l.: Markus Rudolph (Initiative Arzneimittel für Kinder), Lutz Boden (BAH), Andreas Mihm, Volker Möws (TK), Joachim Becker (BMG), Michael Hennrich (MdB CDU); Quelle: Svea Pietschmann In der sich anschließenden moderierten Diskussion äußerte Lutz Boden (BAH) Bedenken. Der BAH sorge sich, dass nur auf große Innovationen geschaut werde. Schrittinnovationen fielen hinten runter. Entscheidend sei der patientenorientierte Nutzen, so Volker Möws (TK), sie setzten Stichwort lernendes System dort an, wo Probleme lägen, z.b. bei Kinderarzneimitteln. Das AMNOG allein reiche nicht. Joachim Becker (BMG) erklärte, dieses Thema sei nicht neu. Es werde nicht in Festbeträge eingruppiert, wenn ein therapeutischer Mehrnutzen bestehe. Die Frage der Qualitätsmessung von Schrittinnovationen beantworte der Gesetzgeber allerdings nicht. Michael Hennrich gestand zu, beim Thema PUMA müsse man wohl nachjustieren. Er sympathisiere damit, bei PUMA-Arzneimitteln einen ähnlichen Weg wie den der Orphan Drugs zu beschreiten. Volker Möws wies in diesem Zusammenhang auf laufende Gesetzgebungsverfahren und deren unmittelbare finanzielle Auswirkungen hin. Man müsse sich deshalb überlegen, ob man bewährte Strukturen anpassen wolle. Bedenken äußerte Martin Weiser (BAH), weil PUMA nur einen kleinen Teil, 2% ausmachten, 98% seien nicht vom AM- NOG-Verfahren betroffen und würden undifferenziert von Festbeträgen erfasst. Man benötige für die richtige Fragestellung die richtige Lösung. Was erwarteten sie vom Pharma-Dialog? Bislang sei der Dialog sehr AMNOG-lastig, so Lutz Boden. Es sei entscheidend, aufeinander zuzugehen und den Dialog konsequent weiterzuführen es bedürfe eines Wettbewerbs der Ideen. Sie ständen seit Jahrzehnten im ständigen Dialog mit der Pharmaindustrie, berichtete Jochen Becker, ein solcher, spezieller Dialog habe zwar schon einmal stattgefunden, aber einen derart strukturierten Dialog hätten sie noch nicht geführt es würden dieses Mal klarer Sachthemen fokussiert. Hermann Kortland hielt das Schlusswort und zog ein Resümee. Das Ziel der Veranstaltung sei erreicht, die Stigmatisierung von Schrittinnovationen abzubauen, diese seien entsprechend angemessen zu honorieren. 17
18 NACHRICHTEN 7. Pharma-Großhandelstag Quelle: PHAGRO Berlin, Der PHAGRO Vorsitzende Thomas Trümper formulierte klare Erwartungen an Hermann Gröhe, an die erste Rede eines Gesundheitsministers auf einem Pharma-Großhandelstag: Nicht nur die Apotheken seien abgekoppelt von der wirtschaftlichen Entwicklung, auch der Großhandel. Der Markt ändere sich, dem AMNOG habe die Annahme zu Grunde gelegen, dass die Anzahl der Packungen um jährlich 5% zunehme, in Wirklichkeit seien es dagegen in den letzten 4 Jahren insgesamt nur 2,5% gewesen. Die Politik habe andere Marktpartner entlastet, sie noch nicht. Er hoffe, dass der Minister in seiner Rede darauf eingehen werde. Doch der Gesundheitsminister tat ihm und dem Publikum diesen Gefallen nicht, bescheinigte dem Großhandel aber immerhin eine große Bedeutung für die Gewährleistung einer sicheren und hochwertigen Arzneimittelversorgung. Man müsse nicht lange auf Arzneimittel warten, der Großhandel funktioniere geräuschlos. Er würdige diese Arbeit mit Dank. Mit dem Thema Sicherheit müsse man sich auseinandersetzen, insbesondere mit der Lieferkette, um kein Opfer 18
19 NACHRICHTEN Hermann Gröhe (BMG); Quelle: PHAGRO von Arzneimittelfälschungen zu werden und die Patienten zu schützen. Er freue sich deshalb über SecurPharm. Auch der Parallelhandel müsse sicherer werden, man müsse eine Lösung im europäischen Rechtsrahmen finden. Im Pharmadialog spreche man über die Probleme der Verfügbarkeit bestimmter Wirkstoffe. Dies müsse auch international diskutiert werden, zunächst gehe es dort aber um die Rahmenbedingungen für Forschung und Produktion. Das AMNOG sei ein lernendes System. Thomas Trümper hakte selbstverständlich nach. Er freue sich natürlich über den Besuch des Ministers, müsse aber auch die Sorgen des Großhandels zum Ausdruck bringen. Hermann Gröhe habe auf das AMNOG als lernendes System hingewiesen, dies müsse dann aber auch für sie, d.h. ihre Marge, gelten. Wie der Minister betrieben sie ihr Geschäft geräuschlos, dann werde man aber auch oft vergessen. Ein lernendes System sollte dies wahrnehmen. Der Minister war jedoch schon längst wieder auf dem Weg zu seinem nächsten Termin. Dieser Großhandelstag hatte noch einen weiteren Höhepunkt, den konzeptionellen Vortrag des Verbandsvorsitzenden: Wie positioniert sich der vollversorgende Großhandel? und dieser stellte ausdrücklich seine persönliche Auffassung und keine offizielle Verbandsposition dar. Er analysierte 3 Alternativen: 1. Direct-to-Pharmacy (DTP) Vertrieb der gesamten Produktpalette eines Herstellers exklusiv über nur einen Logistiker, 2. Reduced wholesale model (RWM) ein Hersteller habe nur bis zu 3 Großhändler, 3. Zentralbelieferung, 19
20 NACHRICHTEN die er ablehne, um sich anschließend entschieden für den vollsortierten Großhandel auszusprechen. Auch der europäische Großhandelsverband GIRP (29 Länderverbände, 9 Direktmitglieder) vertrete, so Thomas Trümper, in seinen erneuerten Statuten die klassische Großhandelsdistribution des vollversorgenden Großhandels. Die Versuche des Großhandels, sich in Richtung Hersteller weiterzuentwickeln, seien Thomas Trümper (PHAGRO); Quelle: PHAGRO nicht erfolgreich gewesen, auch die Umgehung der Apotheken mit einer Direktbelieferung an Patienten funktioniere nicht. Es lägen auch keine Belege dafür vor, dass die Distribution über Ketten billiger sei. Ein angestellter Apotheker in den USA sei teurer als der Inhaber einer deutschen Apotheke. Wachsende Ketten führten zu einer Schrumpfung des freien Markts. In Deutschland agierten zunehmend Apothekengruppierungen unabhängig von Großhändlern von der reinen Einkaufsgenossenschaft bis hin zu marketingstarken Gruppen mit Außenauftritt. Dies habe den Großhandel veranlasst, sich ebenfalls in Kooperationen zu organisieren, um Einkaufsmacht zu bündeln, künftig wohl auch über die Grenzen hinaus. Die Internationalisierung des Großhandels eröffne neue Aspekte für einen Mehrwert. Darüber hinaus solle sich der Großhandel als Dienstleister positionieren, sowohl gegenüber den Herstellern als auch gegenüber den Apotheken. Den Herstellern könne man z.b. mit Warenmanagement zur genaueren Planung ihrer Produktionszyklen helfen, die Apotheken z.b. durch Verkaufsförderung und Personalschulung unterstützen. Auf den Punkt gebracht, sieht er die strategischen Optionen des Großhandels in dem Ausbau von Marktmacht (international) und dem von Dienstleistungen für Hersteller und Apotheken, aber die herstellerneutrale Vollversorgung soll das Grundprinzip bleiben. 20
21 NACHRICHTEN MDS Begutachtung von Behandlungsfehlern / Jahresstatistik 2014 Berlin, Stefan Gronemeyer, leitender Arzt und Geschäftsführer des MDS, Max Skorning, Leiter Patientensicherheit des MDS, und Astrid Zobel, Leitende Ärztin Sozialmedizin des MDK Bayern, erläuterten den Journalisten in einer Pressekonferenz die Jahresstatistik Die medizinischen Dienste hätten Gutachten wegen Verdachts auf Behandlungsfehler erstellt und in Fällen einen solchen attestiert. Obwohl die Zahl im Vergleich zu 2013 leicht angestiegen sei, müsse sie im Vergleich zu den Behandlungen in Deutschland als gering eingeschätzt werden. Studien zeigten, dies sei aber nur die Spitze eines Eisbergs. Die Dunkelziffer sei hoch, auch, weil für Patienten oft nicht zu erkennen sei, dass ein Fehler vorliege, oft gingen sie einem Verdacht auch nicht nach. Sie wollten Patienten ermutigen, den Arzt anzusprechen, ggf. ihre Krankenkasse zu informieren und ein Gutachten erstellen zu lassen. Bestätige sich ihre Vermutung, dass ein Behandlungsfehler vorliege, sei v. l.: Stefan Gronemeyer, Michaela Gehms (beide MDS), Astrid Zobel (MDK Bayern), Max Skorning (MDS); Quelle: MDS / bildschön 21
22 NACHRICHTEN ein Gutachten eine gute Voraussetzung für Schadenersatzansprüche. Für gesetzlich Versicherte würden keine Kosten entstehen. Wenn es in Zukunft selbstverständlicher würde, dass gut informierte Patienten den Anstoß gäben, einem Verdacht auf Behandlungsfehler nachzugehen, erziele man mehr Transparenz. Bislang spiele sich das meiste unter der Wasseroberfläche ab. Transparenz entstehe auch durch eine landesweite Erfassung und Dokumentation von Behandlungsfehlern, z.b. in den USA und England längst üblich. In den erstellten Gutachten zu vermuteten Behandlungsfehlern habe sich in 74,1% der Fälle der Vorwurf nicht bestätigt. In 3,3% der Fälle seien Behandlungsfehler ohne Schaden festgestellt worden, in 25,9% Behandlungsfehler mit Schaden, in 20,3% sei der Fehler kausal für den Schaden gewesen, in 3,7% der Fälle die Kausalität unklar und in 1,9% der Fälle liege keine Kausalität vor. Auf die Sektoren bezogen seien 2/3 der Behandlungsfehler im stationären Bereich, 1/3 im ambulanten Bereich festgestellt worden. Der Großteil der festgestellten Fehler trete in operativen Eingriffen und deren direktem Umfeld auf. Was die Bestätigungsquoten angehe, finde man keine Unterschiede in den Sektoren 26,2% im ambulanten, 25,7% im stationären Sektor. Sie hätten keine Erkenntnisse, wo Fehler sich häuften. Die häufigsten Behandlungsanlässe, für die man Fehler festgestellt habe, seien Knie- und Hüftgelenksverschleiß, Zahnbehandlung und Dekubitus. Aber die Behandlungsanlässe verteilten sich breit Diagnosen. Sie hätten besondere Ereignisse betrachtet Never Events bzw. Serious Reportable Events. In USA und England würde diese verpflichtet erfasst, seien ein systematisch bestehendes Risiko. Ein Fehlerregister sei notwendig, besonders für Never Events. Man habe kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsdefizit. Anerkannte Maßnahmen wie OP-Checklisten, regelmäßige Notfallund Teamtrainings oder das kritische Hinterfragen der Medikation würden noch nicht systematisch und flächendeckend umgesetzt. Die medizinischen Dienste unterstützten mit ihrer Arbeit eine neue Sicherheitskultur. 22
23 NACHRICHTEN vfa-frühjahrs-symposium 2015 Innovationen im Dienste der Gesellschaft Barbara Steffens (Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter NRW); Quelle: vfa Berlin, Barbara Steffens sprach ein Grußwort und eröffnete damit das Symposium in der nordrheinwestfälischen Landesvertretung. Innovationen im Dienste der Gesellschaft seien für sie alle eine entscheidende Diskussion für die Zukunft welche Innovationen seien im Dienste der Gesellschaft notwendig? 2050 würden 3,1 Mio. Menschen pflegebedürftig sein. Es seien Herausforderungen, deren Dimensionen man heute noch nicht abschätzen könne. Immer mehr Probleme machten nicht an Landes- und Ländergrenzen halt. Es entständen nicht nur mehr Bedarfe, auch die Ressourcen würden knapper. Dies betreffe nicht nur die Ressource Mensch, sondern auch die Ressource Geld. Die Bedarfe seien, lasse man alles einfach weiterlaufen, nicht mehr zu decken. Verschiedene Ansätze seien bereits diskutiert worden. Rationierung werde in Deutschland nicht Fuß fassen können, eine Gewinnspannenverkleinerung der pharmazeutischen Industrie sei angesichts steigenden Bedarfs an Arzneimitteln eine Option, doch Anreize zur Forschung müssten bestehen bleiben. Sie wollten kein Mehr an Pflegejahren, sondern an Lebensqualität gewinnen. Auch Arzneimitteltherapiesicherheit, auf individuelle Bedarfe abgestimmt, sei eine Frage. Alles dies werde nicht ausreichen, man müsse gemeinsam Prävention forcieren, um der Entwicklung entgegen zu steuern. Sie erhofften sich, Fragen von Wechsel und Nebenwirkung, Verstehbarkeit von Informationen, auch vor dem Hintergrund Migration, sektorenübergreifende Versorgung, Telemedizin etc. beantworten zu können. Sie hätten aber nicht nur die politische Entwicklung im Blick, sondern müssten auch fragen, ob Patienten diesen Weg gehen wollten. Sie müssten besser, wirkungsvoller und 23
24 NACHRICHTEN präziser werden, Innovationen in Struktur, Anwendung und Produkten generieren. Die Antibiotikaversorgung werde nicht einfach zu stemmen sein, Entwicklungskosten müssten im Auge behalten werden. Sie wolle persönlich an die Firmen appellieren, notwendige Innovationen für Kinder bereitzustellen, dies sei zwar eine kleine Gruppe, doch bestehe für sie eine gesellschaftliche Verantwortung. Sie hoffe, diesen Weg gemeinsam gehen zu können. vorhandenen Potentiale? Überwiege die Vorsicht? Viele wichtige Innovationen seien in Deutschland entdeckt, aber in anderen Ländern zur Marktreife gebracht worden, weil in Deutschland die Chancen kleingeredet würden. Politik, Forschung und Wissenschaft seien an einem Punkt angelangt, an dem sie nicht nur produktiv nebeneinander arbeiten könnten Ebola sei ein besonders eindrückliches Beispiel. Gemeinsames Vorgehen werde voneinander gefordert, benötigt würden gemeinsame Strategien. Daneben kämen neue Player wie Google auf den Markt, wie wolle man mit ihnen umgehen? Was geschehe mit Gesundheitsdaten? Hier ständen die 68er versus Generation Facebook. Birgit Fischer (vfa); Quelle: vfa Die Gäste begrüßte Birgit Fischer. Was Innovationen im Dienst der Gesellschaft angehe, die forschenden Arzneimittelfirmen hätten im vergangenen Jahr über 40 bahnbrechende Medikamente in die Versorgung gebracht. Die Reaktionen seien interessant, Patienten dankbar, Krankenkassen zeigten sich sorgenvoll, die Öffentlichkeit würde Therapieoptionen gelegentlich nicht wahrnehmen. Die Wirksamkeit von Therapien erschließe sich zumeist nur einem kleinen Teil der Bevölkerung. Ihre Unternehmen ständen für Innovation, doch nutze man die Friedrich von Bohlen und Halbach (dievini Hopp BioTech); Quelle: vfa Friedrich von Bohlen und Halbach (Geschäftsführer dievini Hopp BioTech holding) zitierte als Einstieg Albert Einstein: Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn ich gedenke in ihr zu leben, 24
25 NACHRICHTEN um dann über die Zukunft der Medizin und den Standort Deutschland zu sprechen. Betrachte man die personalisierte Medizin, besser die Präzisionsmedizin, dann finde ein Übergang von Old Medicine zu New Medicine statt, dieser hänge auch mit technologischen Rahmenbedingungen, dem Social Networking oder der mobilen Konnektivität zusammen. Ein Paradigmenwechsel in der Medizin hin zu einer IT-zentrierten, wissenschaftlich molekular begründeten Medizin sei zurzeit zu beobachten, auch ein Big Data Thema. Die Adaption persönlicher Patientendaten sei eine notwendige Voraussetzung. Nicht nur die Datenmengen nähmen zu, die Daten selbst würden komplexer. Patienten würden häufiger sicherer behandelt werden können. Krebs werde eine chronische Erkrankung werden, bei Aids habe man es schon erreicht. Die fallspezifischen Kosten würden sinken. Er wünsche sich von der Politik, dass sie sich diesem Thema annehme (1% der Einkommenssteuer als steuerliche Fördersumme die Industrie benötige eine Wagniskapitalkultur). Nach diesem Statement trat Hagen Pfundner in einen Dialog mit Friedrich von Bohlen und Halbach ein. Vor 3 Jahren hätten sie schon einmal ein Symposium über personalisierte Medizin veranstaltet, damals sei das Thema noch weit weg gewesen. Für dieses Thema benötige man gesellschaftliche Akzeptanz, denn es habe enorm an Dynamik gewonnen. Ziel sei, den Patientennutzen ins Zentrum zu stellen, medizinische Versorgung anders zu verstehen. In Deutschland habe man wahnsinnig tolle Ideen, doch primäre Wertschöpfung finde nicht in Deutschland statt. Die Frage sei doch, wie man diese in Deutschland halte? Dazu bedürfe es einer gesellschaftlich anerkannten Gründer- und Unternehmerkultur und die Verfügbarkeit von Kapital, antwortete Friedrich von Bohlen und Halbach auf diese Frage. Hagen Pfundner verwies auf Barack Obama, der Präzisionsmedizin zum nationalen Ziel erklärt und 5 Mrd. $ als Anschubkapital zu Verfügung gestellt habe. Friedrich von Bohlen und Halbach vermisste ein derart klares Bekenntnis von Angela Merkel, bessere Rahmenbedingungen für Wagniskapital. Hagen Pfundner forderte ein, Föderalismus nicht vor Clusterstrukturen zu stellen. Es müsse ihnen gelingen, die Rahmenbedingungen anzupassen, die Dynamik sei gewaltig. v. l.: Friedrich von Bohlen und Halbach (dievini Hopp BioTech), Hagen Pfundner (vfa); Quelle: vfa 25
26 NACHRICHTEN v. l.: Kai Behrens, Jürgen Graalmann (beide AOK-BV), Gerd Gigerenzer (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung), Wolf-Dieter Ludwig (AkdÄ, Helios Klinikum Buch) AOK-BV Faktenboxen Berlin, Jürgen Graalmann im O-Ton: Google sei Dank seien alle Informationen verfügbar 300 Mio. Treffer erhalte man zum Thema Gesundheit. Dies sei eine unvorstellbare Menge, die oft zu Hilflosigkeit führe. Der WIdOmonitor solle helfen, gesundheitsrelevante Informationen zu finden. Ergebnisse einer Studie mit europaweit eingesetztem Fragebogen zeigten, dass bei 60% der GKV-Versicherten die Fähigkeit zur Krankheitsbewältigung und Gesunderhaltung unzureichend ausgebildet sei, dies sei ein Hinweis gewesen, dass man tätig werden müsse. Mehr als ein Viertel schätze es als kompliziert ein, gesundheitsrelevante Informationen zu finden. Ein Drittel empfinde es als schwierig, gesundheitsrelevante Daten zu verstehen, zwei Drittel, die Glaubwürdigkeit der Gesundheitsrisiken einzuschätzen. Ein Viertel sei kaum in der Lage, Arztinformationen eigenverantwortlich umzusetzen. Der mündige Patient existiere anscheinend noch nicht. Der Informationsbedarf steige, ebenso wie das Gefühl der Verunsicherung. Dies sei kein Problem bestimmter Bevölkerungsschichten. Aktuellstes Wissen verständlich und kompakt aufzubereiten, sei ihr Ansatz. Die Faktenboxen sollten eine Kompassfunktion übernehmen. Zielsetzung sei der informiertere Patient, der eine aktivere Rolle in der 26
27 NACHRICHTEN Jürgen Graalmann (AOK-BV) Therapie einnehmen könne. Kassen, Medizin und Wissenschaft zögen dazu an einem Strang, er wolle sich bei Wolf-Dieter Ludwig, Gerd Gigerenzer und Atilla Altiner bedanken. Für Gerd Gigerenzer, Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, sind die Faktenboxen eine Bildungsrevolution. Es handle sich um eine einfache, klare Darstellung medizinischer Ergebnisse. Z.B. würden keine relativen, sondern absolute Risiken dargestellt. Faktenboxen seien in den USA erfunden worden. Sie ständen im Obama-Care-Gesetz, aber niemand erstelle und verteile sie verhindert von Interessengruppen. Die AOK sei die erste Kasse, die diese Faktenboxen erstelle. Jürgen Graalmann werde sicherlich in nächster Zeit einige Attacken aushalten müssen. Durch die Faktenbox zu Eierstockkrebs-Früherkennung durch Ultraschall würden Ergebnisse von Frauen, die zur Früherkennung gingen, denen von Frauen, die nicht gingen, gegenübergestellt Frauen hätten teilgenommen, seien aufgeführt. Ultraschalluntersuchungen verringerten das Risiko, an Eierstockkrebs zu sterben, nicht, dies sei der Stand der Forschung. Verunsicherung entstehe, da Eierstöcke unnötig entfernt würden. Einige Frauen erlitten zudem schwere Nebenwirkungen. Weitere Faktenboxen: Gerd Gigerenzer (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung) 2 Faktenboxen zum Thema Impfen (Kombinierte Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln, Influenza für Menschen ab 60 Jahren) Röntgen bei allgemeinen Rückenbeschwerden Stoßwellentherapie beim Tennisarm Kinderkrankengeld 27
28 NACHRICHTEN Nahrungsergänzungsmittel Vitamin D gegen Knochenbrüche Nahrungsergänzungsmittel Vitamin D gegen Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen Nahrungsergänzungsmittel für Männer Selen gegen Krebs Nahrungsergänzungsmittel für Männer Selen gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen Kieferorthopädische Behandlung. Wolf-Dieter Ludwig (AkdÄ, Helios Klinikum Buch) Gesundheitskompetenz bedeute kompetenten Umgang mit Nutzen und Risiken einer Behandlung. Sie hätten untersucht, ob Menschen diese Form der Faktenboxen verständen. Sie hätten die Faktenbox der besten existierenden Information, hier der der Deutschen Krebshilfe, gegenübergestellt. Die Faktenbox habe einen etwa doppelt so hohen Informationszuwachs erzielt, wie die Information der Deutschen Krebshilfe. Die Einschätzung des Risikos, an Eierstockkrebs zu sterben, habe sich stärker an das tatsächliche Risiko angenähert. Er hoffe, dass diese 11 Faktenboxen der Anfang einer Serie seien. Er hoffe auf die Chance für Deutschland, Vorreiter zu werden, offen Patienten zu informieren. Wolf-Dieter Ludwig bestärkte ihn aus ärztlicher Sicht. Der informierte Patient sei wichtig und habe derzeit nicht die Information, die er benötige. Desinformation durch interessengeleitete Informationsverbreitung dominiere, der man nicht genügend entgegenzusetzen habe. Unrealistische Erwartungen würden geschürt z.b. für Personalisierte Medizin u.a. Leistungen, die mehr schadeten als nutzten und dem Patienten nicht zuzumuten seien. Es lägen über 100 AMNOG-Beschlüsse vor, diese kämen so gut wie nicht bei den Ärzten an. Vor diesem Hintergrund werde sich auch die AOK mit dem Thema mittels Faktenboxen beschäftigen. Diese Faktenboxen basierten auf bester Evidenz, sehr guten, randomisierten Studien. Zum Zeitpunkt der Zulassung gebe es, wenn überhaupt, eine randomisierte Studie, erst 5-10 Jahre nach Zulassung existierten genügend Informationen, um sachgerecht zu informieren. Dies werde einige Schwierigkeiten in der Umsetzung der Faktenboxen aufwerfen. Es müsse mehr kooperiert werden, um zu informieren. Polypharmazie sei ein weiteres Thema, das die AOK aufgreifen werde. Ein Befolgen der Leitlinien könne zu einer faktischen Vergiftung dieser Patienten führen. Dies müsse individueller gestaltet werden. Faktenboxen zwängen den Arzt, sich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen, denn wenn Patienten sehr genau informiert seien, würden Ärzte verstärkt gefordert. 28
29 BERICHTE 4. QMR Kongress Qualitätsmessung und Qualitätsmanagement mit Routinedaten Potsdam, Francesco de Meo eröffnete den Kongress mit den Worten, dass sie zum 4. Mal den QMR-Kongress veranstalteten und fragte, ob sich dies überhaupt lohne. Seine Antwort sei Ja. In der Gesetzgebung werde unterstellt, dass Krankenhäuser und ihre Mitarbeiter keine eigene Motivation zur Verbesserung der Qualität hätten. Er erlebe dies in Kliniken anders. Man müsse Qualität ernst nehmen, als relevant für Patienten. Von Qualität könne man nur reden, wenn diese beim Patienten ankomme. Oft verberge sich hinter dem Begriff Qualität nur das jeweilig eigene Interesse Pfleger, Chefärzte, usw. Es gehe nicht immer nur um objektive Kriterien, auch subjektive Kriterien seien relevant, wenn auch schwerer messbar. Die Initiative Qualitätsmedizin (IQM) und Qualitätskliniken.de (4QD) hätten eine gemeinsame Dachorganisation, die Stiftung Initiative Qualitätskliniken (SIQ!), gegründet. Diese habe fünf Grundsätze: 1. Qualitätsmanagement aus Routinedaten 2. Weiterentwicklung der Qualitätsindikatoren (G-IQI) 3. Transparenz der Qualitätsergebnisse 4. Überprüfung durch Peer Review Verfahren 5. Berücksichtigung weiterer Qualitätsdimensionen nach Evaluation. Francesco de Meo (IQM); Quelle: Tom Maelsa Auf dem Kongress werde der Bogen von der Theorie zur Praxis gespannt, formulierte Uwe Deh. Die Kombination von Peer Review und Qualitätsmessung auf der Basis von Routinedaten sei ein vielversprechender Weg. Er halte Peer Reviews für eine gute Möglichkeit, Qualität zu verbessern. Was könne man sich vom neuen Qualitätsinstitut erhoffen? Er erhoffe sich Impulse für die Praxis. Ein gewisses Risiko bestehe darin, sich innerhalb des GBA in Interessensgegensätze zu verstricken. Mit Christof Veit habe man aber einen klugen und umsichtigen Institutsleiter gefunden, der hoffentlich den Weg zu mehr Kooperation und sektorenübergreifender Qualitätsmessung ebnen könne. 29
30 BERICHTE Qualitätsinitiativen benötigten Pluralität, in diesem Sinne sei auch IQM zu verstehen. Qualität sei kein Expertenthema mehr. Man müsse mehr über Anreize für Akteure nachdenken weniger über Gebote oder Verbote. Er könne nicht viel zum Referentenentwurf KHSG sagen Zuschläge für alles, Mindeststandards von Ländern unterschreitbar Zuckerbrot für jeden. Bessere Behandlungsqualität müsse beim Patienten ankommen. Die nötigen Instrumente zur Messung der Qualität auf Basis von Routinedaten lägen vor. Auf diesem Fachkongress seien nicht diejenigen anwesend, die in Schützengräben lägen, sondern diejenigen, die etwas bewegen wollten. Auch im Krankenhausreformgesetz sei eine verstärkte Nutzung von Routinedaten vorgesehen. Die Nutzung von Routinedaten sei ein Beleg dafür, welche Bedeutung Initiativen von Kassen und Ärzten hätten. Es könnten damit aber nur bestimmte Aspekte abgedeckt werden. Deshalb müssten gesonderte QS-Daten erhoben und Patientenbefragungen durchgeführt werden. Mit dem Referentenentwurf solle eine Stärkung der Qualitätssicherung erreicht werden, die in Deutschland schon unstreitig ein hohes Niveau habe. Der Referentenentwurf sei im Unterschied zu den Eckpunkten noch verschärft worden es müssten gute Gründe vorliegen, wenn man von den Vorgaben des GBA abweichen wolle. Im Ergebnis rechne sie mit einer einheitlichen Anwendung. Gute Qualität habe ihren Preis, deshalb seien Qualitätszu- und -abschläge vorgesehen. Mit den künftigen Qualitätssicherungsmaßnahmen solle kein Haus an den Pranger gestellt, sondern der Qualitätsgedanke noch stärker etabliert werden. Patienten hätten einen Anspruch darauf, dass jede Leistung gut erbracht werde. v. l.: Uwe Deh (AOK-BV), Annette Widmann-Mauz (BMG); Quelle: Tom Maelsa Annette Widmann-Mauz brachte die politische Perspektive ein. Das IQTIG sei eine wesentliche Voraussetzung für eine dauerhafte Qualitätssicherung. Qualitätssicherung sei eigentlich eine urärztliche Initiative kommentierte Regina Klakow-Franck, mit intrinsischer Motivation, ganz selbstverständlich eine Aufgabe der ärztlichen Profession, damit alle ein gleich gutes Qualitätsmindestniveau erreichten. Der Koalitionsvertrag bedeute für sie eine Renaissance der Idee des Qualitäts- 30
31 BERICHTE Regina Klakow-Franck (GBA); Quelle: Tom Maelsa wettbewerbs. Der GBA habe die Aufgabe, Qualitätsmindeststandards im Wettbewerb zu setzen. 3 Gesetzgebungen seien aktuell relevant, GKV-FQWG, GKV-VSG und KHSG. Es sei ein großes Methodenarsenal, nicht nur die Nutzung von Routinedaten sei von Bedeutung, sondern eine dreifache Datengrundlage QS-Dokumentation der Leistungserbringer, Routinedaten und Patientenbefragungen. Das IQTIG müsse eine eigene Datenannahmestelle aufbauen. Dem GBA komme die Aufgabe zu, einheitliche Qualitätsstandards, Vorgaben für eine bundeseinheitliche Qualitätssteuerung zu setzen. Dies bedeute hohe methodische Anforderungen auf Grund erforderlicher Rechtssicherheit. Eine datenbasierte Versorgungssteuerung reiche nicht aus, Ergänzungen z.b. durch Peer Reviews seien notwendig. Patrizia Theurer erläuterte die Qualitätsstrategie wie die Rahmengesundheitsziele in Österreich, im Besonderen die Gesundheitsziele Nr. 3 Stärkung der Patrizia Theurer (Bundesministerium für Gesundheit, Wien); Quelle: Tom Maelsa Gesundheitskompetenz der Bevölkerung und Nr. 10 Qualitativ hochstehende und effiziente Gesundheitsversorgung für alle sicherstellen umgesetzt würden. Um alle Akteure auf eine Linie zu bringen, habe man die Zielsteuerung-Gesundheit geschaffen, eine Partnerschaft von Bund, Ländern und Sozialversicherung. Ziel des Gesundheitsqualitätsgesetzes (2005) sei ein flächendeckendes österreichisches Qualitätssystem, bundeseinheitlich, sektoren- und berufsgruppenübergreifend. Die Abgabe von Leistungen sei an Qualitätsstandards geknüpft, zumindest theoretisch. Gegen verbindliche Vorgaben hätten sich die Länder gestellt. Qualitätsstandards seien Vorgaben zu Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität, Bundesqualitätsleitlinien oder Bundesqualitätsrichtlinien, z.b. bezüglich des Aufnahme- und Entlassmanagements. Eine Versorgungsleitlinie zu präoperativer Diagnostik sei trotz Konsens nur in Salzburg umgesetzt worden. Sehr erfolgreich verlaufe eine gerade durchgeführte Patientenbefragung mit Fragebögen. Sie glaubten, dass dadurch wesentliche Rückschlüsse möglich seien. 31
32 BERICHTE Oliver Peters (BAG); Quelle: Tom Maelsa Quelle: Tom Maelsa Diese Patientenbefragung werde dann durch eine Bevölkerungsbefragung (Stichprobe) ergänzt, bei der sie durch die Uni Bremen unterstützt würden. Schwerpunkte der Patientensicherheitsstrategie seien Qualität der Ausbildung der Gesundheitsberufe, Krankenhaushygiene, Medikationssicherheit, der Einsatz von Antibiotika und die Förderung von Gesundheitskompetenz. Hinzu komme eine bundesweite Ergebnisqualitätsmessung mit Jahresschwerpunkten, in diesem Jahr Herniotomie, Hysterektomie und Linksherzkatheter. Oliver Peters beleuchtete die Schweizer Qualitätsstrategie. Das Parlament fordere ein stärkeres und direktes Engagement des Bundes für die Verbesserung der Patientensicherheit und Qualität sowie eine nationale Struktur für Qualität und Wirtschaftlichkeit. Der Bund solle die führende Rolle übernehmen und eine klare und eindeutige Rollenverteilung regeln. Die Qualitätsstrategie habe eine lange, bis in das Jahr 2006 zurückgehende Diskussionsgeschichte. Ziele seien die Reduktion von vermeidbaren kritischen Zwischenfällen, die Sicherstellung von best practice Behandlungen, eine Vermeidung von Überversorgung, die Reduktion der Kosten schlechter Qualität, ein Ausbau und bessere Nutzung von Qualitätsindikatoren, die flächendeckende Durchsetzung von anerkannten Standards der Patientensicherheit, sowie die regelmäßige Überprüfung von Leistungen und Leistungserbringern. Die Vorträge aus Österreich und der Schweiz zeigten, dass auch in internationaler Perspektive das Thema Qualität politisch hoch gesetzt wird und eine entsprechende Vielzahl von Instrumenten zum Einsatz kommt, allerdings auch, dass auch dort Schwierigkeiten in der Umsetzung bestehen. Allein die Koordination der verschiedenen Akteure für eine bundesweit einheitliche Versorgungsqualität scheint in allen 3 Ländern eine Mammut-, vielleicht sogar eine Sisyphusarbeit zu sein. 32
33 BERICHTE 52. Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) Berlin, Im Mittelpunkt des 1. Tages des traditionellen DAV-Wirtschaftsforums standen die politischen Forderungen der Apothekerschaft, unterfüttert durch Analysen der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für die Diskussion mit Gesundheitspolitikern des Bundestages. Fritz Becker machte den politischen Aufschlag. Die aktuelle Gesetzgebung biete gute Chancen, bisher noch nicht Erreichtes umzusetzen. Das VSG betrachte die pharmazeutische Versorgung zu wenig, z.b. kein Antragsrecht der Apotheker für den Innovationsfonds. Mit der Festschreibung des Apothekenabschlags gehöre das Streiten zwischen DAV und GKV-SV der Vergangenheit an. Diese Festschreibung mache jedoch eine jährliche Anpassung unabdingbar. Darüber sei man sich im Grundsatz sogar mit dem GKV- SV einig. Nötig seien klare Regelungen, die Fritz Becker (DAV) 33
34 BERICHTE Claudia Korf (DAV) mehr Leistungen und steigende Kosten berücksichtigten. Retaxationen auf Null seien völlig überzogene Maßnahmen. Die Aufforderung an den GKV-SV verankert im GKV-VSG werde zu weiteren Verhandlungen nach Inkrafttreten des Gesetzes führen. Wenn keine Einigung absehbar sei, werde der DAV die Schiedsstelle anrufen. Eine weitere Forderung sei die adäquate Entlohnung aufwändiger Rezepturen (zusätzlich zum Arbeitspreis auch Festzuschlag) und Dokumentationspflichten. Hier sei man von der Kostendeckung meilenweit entfernt. Der Nacht- und Notdienstfonds des DAV sei ein erfolgreiches Beispiel verwaltungskostenschlank, aber für die zugesagten 120 Mio. reichten 16 Cent nicht aus 20 Cent seien erforderlich. Es sei bedauerlich, dass das Präventionsgesetz nicht auf die spezifischen Stärken der Apotheker für niedrigschwellige Angebote setze, um z.b. die Durchimpfungsquote der Bevölkerung deutlich zu erhöhen. Mit dem E-Health-Gesetz müsse man Optionen schaffen, damit Apotheker und Ärzte zum Wohl des Patienten zusammenarbeiteten, Stichwort Medikationsplan. Claudia Korf und Eckart Bauer analysierten die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen und zogen daraus Konsequenzen für die Apotheken nüchtern und sachlich. Während die GKV und andere Leistungsbereiche von der Konjunktur profitierten, nähmen die Apotheken an der wirtschaftlichen Entwicklung nicht teil, so Claudia Korf. Die Bedeutung der verschreibungspflichtigen, hochpreisigen Arzneimittel nehme zu. Im Vergleich zum Versandhandel zeige sich, dass die öffentliche Apotheke immer dann 1. Wahl sei, wenn der Patient Hilfe benötige. Ansonsten sei der Versandhandel wie in anderen Bereichen auch auf dem Vormarsch. Die Beratung bleibe deshalb ein zentrales Merkmal der Apotheken vor Ort. Die Erstellung eines Medikationsplans könne angesichts des bestehenden hohen Selbstmedikationsanteils ohne Apotheken nicht funktionieren. Die Finanzentwicklung der GKV, gerade auch die ungleich verteilten Finanzreserven der einzelnen Kassen, führten zu einem Zusatzbeitragsvermeidungswettbewerb und einem Angriff auf die Liquiditätsreserve des Fonds. Vor diesem Hintergrund sei der Ausgang des Pharmadialogs offen und ein erneutes Arzneimittelspargesetz nicht auszuschließen. 34
35 BERICHTE Eckart Bauer (DAV) Ihre Conclusio: Die öffentliche Apotheke habe eine Zukunft als vertrauenswürdige Bezugsquelle von Arzneimitteln und als kompetente, niederschwellige Anlaufstation für Fragen rund um das Thema Medikation. Eckart Bauer wurde konkreter. Die Umsatzverteilung des Jahres 2014 zeige, dass 61% der Apotheken unter dem Durchschnitt von 2,024 Mio. lägen. Es gebe zwar ein regelmäßiges Umsatzwachstum seit 2002, auch wegen der Verteilung des Umsatzes auf weniger Betriebsstätten. Aber was das Betriebsergebnis, korrigiert um den Verbraucherpreisindex angehe, liege man immer noch unter den Werten von Anfang Von einer Teilnahme an der Wohlfahrtssteigerung der Gesellschaft sei nichts festzustellen im Unterschied etwa zum ärztlichen Einkommen. Die leichte Betriebsergebnissteigerung des vergangenen Jahres resultiere zu einem erheblichen Teil aus der Nachtund Notdienstvergütung. Die Einflussfaktoren des Jahres 2015 ließen keine Impulse für eine relevante Ergebnisverbesserung erkennen, das Betriebsergebnis 2015 werde mithin in der Nähe von 2014 liegen. In der gesundheitspolitischen Diskussionsrunde trafen Fritz Becker und Andreas Kiefer auf die Bundestagsabgeordneten Michael Hennrich, Kordula Schulz-Asche und Harald Weinberg. Über die Fraktionsgrenzen hinweg wurde große Zustimmung für die Rolle der Apotheken und den Weg, den sie mit ihrem Perspektivkonzept eingeschlagen haben, signalisiert. Doch mit konkreten Zusagen hielten sich alle zurück, besonders der Vertreter der v. l.: Andreas Kiefer (BAK), Fritz Becker (DAV), Michael Hennrich (MdB CDU), Reiner Kern (ABDA), Kordula Schulz-Asche (MdB die Grünen), Harald Weinberg (MdB die Linke) 35
36 BERICHTE Koalition, Michael Hennrich, der sich nur vieles vorstellen könne, etwa bei Prävention, Innovationsfonds, Medikationsmanagement oder E-Health. Er sei weniger dafür, das Fixum zu erhöhen als vielmehr die Beratungselemente. Dagegen Fritz Becker: Sie forderten doch nur eine regelmäßige, einoder zweijährige wirtschaftliche Überprüfung. Es könne doch nicht sein, dass sie von der wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt würden. Kein Verständnis hatten alle 3 Abgeordnete für die Nullretaxerei der Krankenkassen (Harald Weinberg). Andreas Kiefer warb für ein gemeinsames Medikationsmanagement von Apothekern und Ärzten. ARMIN zu installieren dauere, werde aber funktionieren. Es sei durch die Modellprojekte gelungen, das Medikationsmanagement zu definieren mit klaren Zuständigkeiten für Ärzte und Apotheker. Es sollte nichts Paralleles entstehen. AUSGABE 13/15 3. JUNI 2015 HIGHLIGHTS 14/ JUNI 2015 Highlights Magazin Interview mit Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer Ausgabe 13/15 und 14/15 Online lesen DIE KRANKENHAUSREFORM DER GROSSE DURCHBRUCH? Das Onlinemagazin zur Gesundheitspolitik Das Onlinemagazin zur Gesundheitspolitik 36
37 Boulevard Quelle: ABDA ABDA SOMMERFEST Berlin, Schon vor längerer Zeit wurde bekannt, dass die ABDA ihr Sommerfest in diesem Jahr nicht in ihren eigenen Räumen im Mendelsohn Palais ausrichten würde, sondern in einer Kirche. Eine Kirche, dachte man ein wenig ungläubig? Es war eine Kirche und zwar die Heilig-Kreuz- Kirche in Berlin Kreuzberg, eine evangelische Backsteinkirche im neugotischen Stil zwischen 1885 und 1888 erbaut. Im 2. Weltkrieg zerstört, wurde sie in den 1950iger Jahren vereinfacht wieder aufgebaut, 1995 saniert und umgebaut, so dass sie auch für weltliche Zwecke mit Raum für ca. 500 Personen genutzt werden kann. Bemerkenswert sind z.b. die modernen Glasfenster von Johannes Schreiter, eine Location die an sich schon sehenswert ist. 37
38 Boulevard v. l.: Mathias Arnold, Friedemann Schmidt, Fritz Becker (alle ABDA); Quelle: ABDA Vor der Kirche standen die Gastgeber und begrüßten die Gäste freundlich. Friedemann Schmidt und Fritz Becker zeigten sich fröhlich und zu Scherzen aufgelegt und kein wenig pastoral! Betrat man die Kirche, erstaunte die klare, schlichte, aber doch edle Gestaltung. In der Mitte stand der Altar ebenerdig, mit Bibel, Antependium und einer großen Altarkerze, abgetrennt durch eine Kordel vom übrigen Raum. Dieser bestach auch durch seine Größe und die Höhe der Kuppel. Überall waren Stehtische aufgestellt und auch für ein bequemes Sitzen war gesorgt große, dunkelbraune Ledergarnituren luden zu einem gemütlichen Plausch ein. An der Wand hing wie ein Parament ein Plakat der ABDA, von dem eine riesige, nette und junge Apothekerin die Gäste anlächelte. Auf einer leichten Erhöhung im Schiff saß die Band Barfleas, die den Abend musikalisch untermalte mit leichtem, sanftem Jazz. Blickte man durch das Kirchenschiff, sah man in einen großen Garten, der von weißen Zelten mit Stehtischen, Sitzbänken und 2 Buffets und Getränkestation vollständig ausgefüllt war. Henning Fahrenkamp (BPI); Quelle: ABDA Wolfgang Späth (Pro Generika); Quelle: ABDA Bernadette Sickendiek (Phagro); Quelle: ABDA 38
39 Boulevard Quelle: ABDA Katrin Vogler (MdB die Linke); Quelle: ABDA Schnell füllte sich das Kirchenschiff und überall hörte man witzeln, sonntags habe die Kirche zum Gottesdienst wohl nicht so viele Besucher immerhin hatten sich 400 Gäste angesagt und zeitweise schien es, als seien es noch mehr. Unter den Gästen sah man neben vielen Abgeordneten etliche Vertreter aus dem BMG, dem Kanzleramt, der Krankenkassen, des GKV-SV, der Ärzteschaft, aus der pharmazeutischen Industrie und dem Handwerk. Es war eine illustre Schar auch ein Kompliment für die AB- DA. Zur Begrüßung wurden Crémant, Säfte und einige Häppchen serviert. Der Geräuschpegel der Unterhaltung war hoch und das allgemeine Gemurmel nahm durch den Hall in der Kirche ein seltsames, aber interessantes Timbre an. Offensichtlich mangelte es nicht an Gesprächsstoff und man konnte viele auch private, freundschaftliche Gespräche hören. Die ABDA und Friedemann Schmidt sind für kurze Reden bekannt, und auch in diesem Jahr hielt er sich an dieses Konzept. Dietrich Monstadt (MdB CDU); Quelle: ABDA 39
40 Boulevard Friedemann Schmidt (ABDA); Quelle: ABDA Es sei viel darüber spekuliert worden, warum sie in diesem Jahr einen neuen Ort gewählt hätten, so Friedemann Schmidt. Bauund brandschutzrechtliche Gründe hätten einen Strich durch ihr traditionelles Fest gemacht. Angesichts 400 Ehrengästen wolle er die Zahl der namentlich begrüßten auf 12 reduzieren, dies sei nicht als Priorisierung, sondern als Rationierung zu verstehen es seien 13 Gäste, die er namentlich begrüßen wolle, Rationierungsentscheidungen funktionierten eben nie vollkommen. Er begrüße noch in Abwesenheit BMG Hermann Gröhe, alle Abgeordneten des deutschen Bundestags, an der Spitze den Vizepräsident des deutschen Bundestags Johannes Singhammer, Edgar Franke, Ingrid Fischbach, Karl-Josef Laumann, Verena Bentele, Friedhelm Julius Breucher, Ulrike Elsner, Doris Pfeiffer, Andreas Gassen, Ulrich Weigeldt, Hermann Stefan Keller. Er danke ebenso den Vertretern von Fach- und Tagespresse für ihr Erscheinen. Quelle: ABDA 40
41 Boulevard Birgit Fischer (vfa); Quelle: ABDA beibehalten und auch den Caterer, die Kochlandschaften. Dazu wurde ein Weiß-, ein Rotwein, ein kühles Bier, und Cocktails serviert und fertig ist das Konzept für ein Sommerfest. Besonders beliebt waren übrigens die Sushis, die, wie auch andere Speisen im Flying Service gereicht wurden. Jetzt folge die Predigt. Für jemanden wie ihn, der gern öffentlich rede, sei es ein Lebenstraum, einmal in einem Kirchenraum vor einer andächtigen Gemeinde eine lange Gardinenpredigt zu halten. Dieser Traum werde er sich heute nicht erfüllen. Es gebe viel Kritisches, wie auch viel Konstruktives zu sagen zur aktuellen Gesundheitspolitik es werde heute Abend auch viel gesagt werden, doch nicht jetzt und vor allen Dingen nicht von ihm. Er entlasse das Auditorium vertrauensvoll in die Hände seiner 33 Kollegen, weg von der Präsentationsform des Frontalunterrichts in ein wirksameres Kleingruppensystem. Er hoffe auf gute Gespräche und danke dem Team von Kerstin Schumann und Reiner Kern für die Organisation des Abends. Die Sorge um das leibliche Wohl liege bei den kochenden Landschaften. Er wünsche viel Spaß. In unglaublich kurzer Zeit wurden die Buffets geentert, da mehrere Stationen aufgebaut waren, entstanden keine langen Schlangen, auch nicht, wie sonst oft, an den Grillstationen den Grill auf ihrem Sommerfest hatte die ABDA zur Freude vieler Die ABDA hatte zwar für alle Witterungen vorgesorgt, aber es war ein lauer Abend nicht zu warm, nicht zu kalt, gerade richtig für ein Fest im Freien. Fazit: Es war ein gelungener Abend, die Location exzellent, die Speisen vielfältig, für jeden Geschmack etwas und die Stimmung hervorragend. Es war für die Gastgeber wohl ein langer Abend, denn lange schien sich der Kirchgarten kaum leeren zu wollen. Herbert Pfennig (apobank); Quelle: ABDA 41
42 Boulevard BETRIEBLICHE KRANKEN- VERSICHERUNG FEIERT 10-JÄHRIGES JUBILÄUM v. l.: Lars Grein (BKK PwC), Annette Widmann-Mauz (BMG), Jürgen Brennenstuhl (BKV); Quelle: BKV Berlin, Trotz harter Konkurrenz durch das ABDA- Sommerfest, war die Location im Leonardo Hotel in Berlin Mitte gut gefüllt. Die Gastgeber begrüßten ihre Gäste und die Prominenz v.a. der Krankenkassenlandschaft, aber auch der Politik. Die Gäste stürzten sich beim Aperitif in freudige Diskussionen, die sich vornehmlich um erneute GDL- Streiks und das Tarifeinheitsgesetz drehten. 42
43 Boulevard v. l.: Jürgen Brennenstuhl (BKV), Franz Knieps (BKK- DV), Lars Grein (BKK PwC); Quelle: BKV v. l.: Lars Grein (BKK PwC), Doris Pfeiffer (GKV-SV), Jürgen Brennenstuhl (BKV); Quelle: BKV Jürgen Brennenstuhl hieß alle willkommen. Aus Tradition stark sei ihr Motto, dem sie auch in Feierlichkeiten gerecht werden wollten. Sie freuten sich, heute das 10-jährige Jubiläum zu begehen, dies sei nicht lang, wenn man sich die Mitgliedsunternehmen anschaue. Ziele der 16 Gründungskassen, die am in Stuttgart die eigene politische Interessenvertretung ins Leben gerufen hätten, seien stabile Beiträge, gute Leistungen und bester Service mit persönlicher Betreuung im Betrieb. Sie wollten für das Erfolgsmodell betriebsbezogener BKKn kämpfen. Die Gründung im Jahr 2005 sei in stürmischer Zeit geschehen. Viele BKKn seien hoch verschuldet gewesen, die Politik nur auf Wachstum und Öffnung fokussiert. Die Bundestagswahl habe zu einschneidenden Reformbestreben und Debatten darüber geführt, ob 50 Krankenkassen ausreichend seien, die Kassenstruktur durch gesetzliche Vorgaben tiefgreifend zu regulieren sei. Die Frage nach der Existenzberechtigung von BKKn nach der Öffnung der Krankenkassen sei der Beginn gewesen sei erstmalig eine gesetzliche Haftungsbegrenzung für Betriebsbezogene BKKn auf 20% festgeschrieben worden. Sie ständen jedoch für mehr als die Existenzsicherung ihres Kassentyps, wie z.b. für die Stärkung von Prävention im BGM. Daneben stehe eine Vielzahl von Kooperationsprojekten der Mitgliedskassen. Ihre Erfolgsfaktoren seien ihre in der GKV einmalige Geschlossenheit, die enge Einbindung und Beteiligung der Selbstverwaltung in die Vereinsarbeit und schlanke Strukturen ein ehrenamtlicher Vorstand aus 4 43
44 Boulevard v. l.: Jürgen Brennenstuhl (BKV); Quelle: BKV Vorständen und 4 Selbstverwaltern sowie ein tolles Team im Berliner Büro mit Norbert Schleert, Franziska Seidel und Wolf Witte. Dies sei die Organisation des Vereins, damit hätten sie eine hohe Effizienz und Schlagkraft. Für die nächsten 10 Jahre wünschten sie sich mehr Wettbewerb in der GKV, weniger Regulierung, Spielräume für Kooperation mit Trägerunternehmen in BGM und betriebsnahen Versorgungsstrukturen, Erleichterung von Konzernerstreckung betriebsbezogener BKKn und eine Stärkung der Selbstverwaltung. Als Gastrednerin gratulierte Annette Widmann-Mauz zum 10. Geburtstag mit Spielen und Musik sei es eine richtige Geburtstagsfeier. Die BKV sei der Grundschule gerade entwachsen, wenn man dies ins Verhältnis setzte zum Methusalem der gesamten gesetzlichen Krankenversicherung, die 2008 bereits ihr 125-jähriges Jubiläum feierte, dann mute es eher wie eine kleinere Veranstaltung an. Aber wenn man den BKV-Verband kenne, wisse man, er sei zwar klein aber wirklich oho. Hier mache nicht die Masse das Geschäft, sondern hier sei Qualität in den Krankenkassen die sie repräsentierten. Methusalem und die BKKn eigentlich seien die BKKn als sogenannte Fabrikkrankenkassen schon längst am Markt gewesen, bevor das Gesetz am beschlossen worden sei. Das Greisenalter der GKV täusche trotz des hohen Alters ein falsches Bild vor, denn die GKV strotze vor Gesundheit. Dieser Verein als eine besondere Ausprägung von BKKn, die besonders nah am Unternehmen seien, sowie die gesamte gesetzliche Krankenversicherung 44
45 Boulevard v. l.: Michael Aust (Bertelsmann BKK), Dietrich von Reyher (Bosch BKK), Lars Grein (BKK PwC), Jürgen Brennenstuhl (BKV), Ramadan Dirlik (BKK Aesculap), Thorsten Greulich (BKK EWE); Quelle: BKV seien in gutem Zustand, ebenso wie das Gesundheitssystem auch wenn es immer besser sein könne. Es erfülle 3 wichtige Kriterien: umfassender Schutz für Versicherte, sozial gerecht und innovativ. Dies sei ein hohes Gut. Der Zugang sei weiter gegeben, dies solle so bleiben. Sie müssten sich immer wieder im Wettbewerb neu orientieren, auch den Wettbewerbern gegenüber, genauso wie es Aufgabe der Politik sei, dieses System immer weiter voranzutreiben um state of the art zu bleiben. Die BKKn und insbesondere diese Form sei eine der tragenden Säulen dieses Gesundheitssystems, nicht nur historisch betrachtet als Ausgangspunkt, sondern auch durch den engen Bezug der Krankenkassen zum jeweiligen Trägerunternehmen. Sie leisteten nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Gesundheit der Mitarbeiter des Betriebes, sondern unterstützten damit auch die Arbeit der Annette Widmann-Mauz (BMG); Quelle: BKV 45
46 Boulevard jeweiligen Trägerunternehmen, indem sie die betriebliche Sozialpolitik für eine bestmögliche Gesundheitsversorgung der Beschäftigten ermöglichten. Dies könne nicht hoch genug eingeschätzt werden. Gerade die traditionellen BKKn hätten sich dadurch ihren eigenständigen Platz im gesamten GKV-System und vor allem auch im Wettbewerb der Krankenkassen untereinander berechtigterweise geschaffen und leisteten einen wichtigen Beitrag für eine qualitativ hochstehende wirtschaftliche Versorgung. Dass dies immer wichtiger werde, zeigten die Entwicklungen, die allgemein in der Gesellschaft, in der Gesundheitspolitik einmal mehr, zu beobachten seien. Die persönliche Gesundheit habe einen hohen Stellenwert, dieser Anspruch münde in der Erwartung, selbstbestimmt und gesund älter werden zu können. Die Menschen wollten sich auf ein System verlassen können. Gute Gesundheit und ein gutes System ermöglichten es den Menschen, Ziele im Leben umsetzen, ihre Potentiale zu nutzen und an der Gesellschaft teilzunehmen. Längere Lebenszeit ermögliche auch längere Erwerbstätigkeit. In welchem Zustand werde man älter? Chronische Erkrankungen und Multimorbidität spielten eine wesentliche Rolle. Die Wahrscheinlichkeit, im Erwachsenenalter eine chronische Erkrankung zu erwerben, liege bei 20%, mit 65 Jahren bereits bei 50%, mindestens eine chronische Erkrankung zu haben. Also müssten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, den Gesundheitszustand möglichst lange zu erhalten. Dies führe zu Fragen, wie der nach Vermeidung von Pflegebedürftigkeit und Unterstützung von Leistungsfähigkeit. Prävention und Gesundheitsförderung spielten dafür eine wichtige Rolle. Die Betriebe mit Sozialpartner und Sozialversicherungsträgern seien gefordert, ein entsprechendes Umfeld in Betrieben zu schaffen. Sie als Bundesregierung wollten dies unterstützen. Neben dem Präventionsgesetz hätten sie dazu eine Vielzahl von Initiativen aufgelegt, die sie unterstützten, wie die Krebsfrüherkennung. Aber auch andere Themen müssten stärker in den Mittelpunkt gerückt werden, wie das Thema Stress am Arbeitsplatz und das Thema Fehlzeiten (Krankengeldfallmanagement, hier könnten die BKKn ihre Kompetenz an den Tag legen), hier müsse etwas getan werden und hier lägen ihre größten Stärken. Sie wünschten sich mehr Freiheiten, sie hätten bereits viele Freiheiten erhalten, die es mit Leben zu erfüllen gelte. Es bestehe kein Hindernis mehr durch die neue Form der Zusatzbeiträge, die volle Autonomie in finanzieller und unter Versorgungsgesichtspunkten qualitativer Hinsicht auszuleben. Der Innovationsfonds für herausragende Versorgungsmodelle sei eine Einladung, kreativ tätig zu werden. Sie gratuliere und bedanke sich für die gute konstruktive Zusammenarbeit der letzten Jahre, sie sei auch beim 5. Geburtstag dabei gewesen und komme auch zu weiteren Geburtstagen gern wieder. Sie hoffe, dass die Impulse und Ideen nicht ausgingen. 46
47 Boulevard Quelle: BKV Im Anschluss konnten die Gäste Ideen, Anregungen und Wünsche auf Kärtchen in eine Zeitkapsel eine Glaskugel im Eingangsbereich werfen. Was dabei herauskam, wird die BKV bei ihrem 20-jährigen Jubiläum präsentieren. Zunächst einmal wurden die Gäste jedoch mit guter Musik und einem verblüffend geschickten Zauberer unterhalten. Bei mildem Wetter wurde gegrillt, gut gegessen und getrunken, musiziert, das Netzwerk gepflegt und bis in die Nacht schlicht gut gefeiert. Quelle: BKV Quelle: BKV Quelle: BKV 47
48 Boulevard IKK E.V. GESUNDHEIT TRIFFT ZIRKUS Quelle: IKK e.v. Berlin, Begehrt sind die Einladungen für Feste im Gesundheitswesen, aber für kaum ein Fest so wie für das alljährliche Gesundheit trifft Zirkus des IKK e.v. in der Bar jeder Vernunft. Welch` großartige Abende hat der IKK e.v. der gesundheitspolitischen Szene schon beschert, an wie vielen dieser Abende wurden gesundheitspolitisch relevante Gespräche erfolgreich geführt! Gesundheit trifft Zirkus ist ein Erfolgsmodell, könnte die Gesundheitspolitik dies doch nur von ihren Projekten unumstritten und unbestreitbar behaupten! In diesem Jahr entführten uns der IKK e.v. 48
49 Boulevard Katherine Mehrling; Quelle: IKK e.v. gelegentlich ein wenig schmuddelig und (für die damalige Zeit) schlüpfrig, eben das quirlige Paris! und Katherine Mehrling, die mit ihrer Band den Abend musikalisch bestritt, nach Paris, in das Paris der 1940iger, 1950iger und 1960iger Jahre. Dieses Paris war nicht nur die Stadt der Träume von Liebe, es war die Stadt der Chansons, des Jazz, der Literaten, des Films, der bildenden Kunst, der politischen Philosophen, eine Stadt voller Leben, voller Gegensätze, geprägt vom Existenzialismus, aber auch von der Hoffnung auf ein besseres Morgen und das alles mit einem ungeheuren Charme und Lebenslust, gemischt mit der gewohnten leichten Misanthropie aller Großstädter, die Stadt voller kleiner Bars, Cafés, Bistros und Brasserien, Quelle: IKK e.v. Nach einem herzlichen Empfang durch die bestens gelaunten Hans-Jürgen Müller und Jürgen Hohnl (Hans Peter Wollseifer stieß auf Grund anderer Verpflichtungen erst später hinzu), einigen kleinen Schlucken und horsd`œuvres kamen die Gäste an diesem eher frischen Abend langsam auf Temperatur. Der alte Spiegelsaal war mit Kerzen erleuchtet, unterstützt durch ein wenig moderne v. l.: Hans-Jürgen Müller (IKK e.v.), Andreas Fabri, Jürgen Hohnl (IKK e.v.); 49
50 Boulevard Quelle: IKK e.v. Lichttechnik an der Decke mit vielen bunten Lampen darunter ein riesiges IKK Plakat, illuster wie die Schar der Gäste. Viele Abgeordnete, das BMG, das Bundeskanzleramt, der Bundesrat, viele Verbände alle waren vertreten und fanden sich gespannt im festlich eingedeckten Spiegelsaal ein. Hans-Jürgen Müller begrüßte die Gäste und kündigte einen international agierenden Zirkus an die Bar der Vernunft habe ihre Wiege in Belgien, am Eingang habe eine Band französische und englische Lieder gesungen, davon werde man an diesem Abend noch mehr hören Edith Piaf habe nicht selbst kommen können, aber sie hätten einen guten Ersatz gefunden. Der Rotwein sei aus Frankreich, der Weißwein komme aus Deutschland, die Gäste aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands und er selbst komme aus USA unserem Sachsen-Anhalt. Sie seien nicht immer so erfreut, wenn so viel Einfluss Europas auf das deutsche Gesundheitssystem ausgeübt werde. Mit dem Vertrag von Lissabon seien die EU- Mitgliedstaaten in der Festlegung und der Organisation des Gesundheitswesens im Grundsatz weiterhin frei, aber der Einfluss der Brüsseler Bürokratie wachse. Europa sei aber zum Glück mehr als das. 50
51 Boulevard Hans-Jürgen Müller (IKK e.v.); Quelle: IKK e.v. Vor einem Jahr hätten sie 5-jähriges Jubiläum gefeiert, seitdem sei viel geschehen. Am habe die Bund-Länder-AG zum ersten Mal zur Krankenhausreform getagt, heute liege immerhin ein Referentenentwurf vor. Der Regierungsentwurf zum PSG sei im Mai 2014 beraten worden, jetzt sei er in Kraft manchmal gehe es eben schnell. Im Juli 2014 habe die Anhörung zum Haushaltsbegleitgesetz stattgefunden, die große Koalition habe den Steuerzuschuss des Bundes für die GKV auf 11,5 Mrd. gekürzt. Dies seien 2 Mrd. weniger als gesetzlich festgelegt. Im Juli 2014 habe der Bundesrat das Gesetz zur Finanzreform der GKV beschlossen, der Weg sei damit frei geworden für versichertenseitige Zusatzbeiträge mit einen festen Beitragssatz von 14,6% ab Bei den Innungskrankenkassen hätten nicht alle 14,6% nehmen können, es sei sehr unterschiedlich. Dass die Versicherten in Zukunft die Suppe allein auslöffeln sollten, sei etwas, das er als Versichertenvertreter selbstveständich arg kritisiere, aber auch Hans Peter Wollseifer sei seiner Meinung. Je nachdem, wie die Beiträge aufwüchsen, sei die Politik in der Pflicht, die Arbeitgeber mit einzubeziehen. Der Bundestag habe das Gesetz zu besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf verabschiedet, das VSG und das Präventionsgesetz seien im Dezember vom Bundeskabinett beschlossen worden. Das Hospiz- und Palliativgesetz und ihr Lieblingsgesetz das E-Healthgesetz ständen noch an. Er appelliere an die Bundestagsabgeordneten, wirklich einmal etwas Vernünftiges zu beschließen. Es könne nicht sein, dass die Gesundheitskarte nur ein Bild enthalte und nicht mehr könne. Es tue ihnen für die Leistungserbringer leid, aber die Krankenkassen zahlten und müssten auch bestimmen, was auf der Karte gespeichert werde. Was jeden Tag an Geld herausgeworfen werde, sei auf ihrer Seite einsichtig, man könne auf der Schuldenuhr verfolgen, welche Summen bereits verschlungen worden seien. Jede Sekunde tickere sie Tausende von Euro herunter, ohne dass die Versicherten etwas davon hätten. Die Politik müsse sich darum kümmern, hier bestehe dringender Handlungsbedarf. 51
52 Boulevard Jürgen Hohnl (IKK e.v.); Quelle: IKK e.v. Voller Charme führte anschließend Jürgen Hohnl durch das Programm. IKK goes Paris, va à Paris. Ein Stern am Himmel sei Edith Piaf. Marlene Dietrich habe der Piaf nicht widerstehen können, als diese darum bat, la vie en rose singen zu dürfen, und selbst Hitchcock habe dieses Lied für einen seiner Filme verwandt. Der 2. Stern sei Katherine Merling, die mit ihrer Band aus der Provinz, aus Hessen über New York in die Hauptstadt gekommen sei. Es war ein Erlebnis, die junge Hessin bekanntere und unbekanntere Piaf-Lieder in eigener Interpretation hören zu können. Ihre Stimme unterscheidet sich deutlich von der der Piaf, nicht geprägt von Leid, Entbehrungen und tiefer Trauer, sondern eine junge Stimme, eher frisch als traurig, weniger klar, aber auch weniger hart, leicht rauchig-jazzig mit einem größeren Stimmvolumen. Man spürt den Einfluss des Jazz, Amerikas, auch in den Arrangements mit einem Hauch von Morbidität und Sexualität gewürzt. Ein kleines, zierliches Persönchen, mit 1,55 Metern ist Katherine Mehrling immerhin größer als die Piaf, sie hat ein zartes Gesicht, dem man ansieht, dass sie kein solch hartes Leben geführt hat wie die Piaf. Dennoch herrschte schon beim ersten Ton eine Atmosphäre wie in den Katherine Mehrling und Band; Quelle: IKK e.v. 52
53 Boulevard v. l.: Klaus Kirschner (GBA), Katherine Mehrling; Quelle: IKK e.v. kleinen Kellerlokalen im Paris der 1950iger. Aber es war nicht alles 1:1 1950, man hörte eher neue Jazztöne, auch Kleid, Frisur und Make-up der Sängerin waren eher 1950 Neo. Das erste Lied war voller pathetischer Melancholie wie viele der Lieder der Piaf. Am 19. Oktober wäre Edith Piaf 100 Jahre alt geworden, tatsächlich sei sie nur 47 geworden vielleicht weil sie nicht in der IKK versichert gewesen sei sinnierte Katherine Merling laut. Dann sang sie wieder herrlich alte Lieder wie sous le ciel de Paris und selbstverständlich auch la vie en rose, aber auch Marlene Dietrichs Ich bin die fesche Lola und Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt in neuem Gewand, teilweise auf Denglisch und dann noch Hildegard Knefs Ich hab noch einen Koffer in Berlin ein Medley, auch als Hommage an Berlin. Aufgelockert wurde die Vorstellung durch einen Schuss Komödiantisches, Katherine Merling suchte sich ein Opfer und ihre Wahl fiel auf Hans-Jürgen Müller. Mit einem leichten französischen Akzent hauchte sie ihn an: Ich finde Sie sehr sexy. Sie hätte jetzt Zeit, es sei ein Schnäppchen, nur 20 Franc pro Minute. Schallendes Gelächter! Dazu passend sang sie Milord auf Deutsch mit Gesten wie ihre großen Vorbilder. Glücklich mache es sie, wenn Hans-Jürgen Müller mit ihr singe und das tat er auch zur Gaudi der Gäste. Auch Klaus Kirschner, Fritz Becker und Ulrike Elsner mussten mitsingen. Man verrät wohl kein Geheimnis, wenn man berichtet, dass an diesem Abend keine neuen Talente entdeckt wurden, die dem Gesundheitswesen verlustig gegangen wären. Großer Applaus und die Gäste wurden in die Pause entlassen, sie konnten sich am Buffet stärken und wurden hervorragend bewirtet. Dazu ein Gläschen Wein oder Bier und die Gespräche wurden wieder aufgenommen. Nach kurzer Zeit ertönte der Gong und alle kehrten zurück in den Spiegelsaal zum 2. Teil 53
54 Boulevard Quelle: IKK e.v. Quelle: IKK e.v. des Konzertes, der mit einem verjazzten Ganz Paris träumt von der Liebe eröffnet wurde. Dann erwischte es wieder den tapfer lächelnden Hans-Jürgen Müller Darf ich Ha-Jü sagen? Sie durfte. Dann einige scherzhafte Intermezzi über die Gesundheit Rotwein sei Anti-Aging, Gesundheit unsexy, auch Prävention Du bist so makrobiotisch und Sie leben doch davon, dass die Leute sich nicht so gut ernähren. Katherine Mehrling sang auch von Charles Aznavour auf Deutsch Ich bin ein Homo wie sie sagen aus dem Jahr 1972, damals ein Spießerschock. Selbstverständlich fehlte auch Non rien de rien, non je ne regrette rien nicht. Tobender Applaus und Zugaberufe. Für die Lieder Schau mich bitte nicht so an auf sächsisch und L` amour wurde mit stehenden Ovationen gedankt, Ha-Jü überreichte der Sängerin und den Bandmitgliedern 54
55 Boulevard v. l.: Edgar Franke (MdB SPD), Andreas Triemer (IKK Classic), Hans Peter Wollseifer (IKK e.v.); Quelle: IKK e.v. Quelle: IKK e.v. Blumen, Jürgen Hohnl dankte strahlend allen Mitarbeitern des IKK e.v., denen der Bar jeder Vernunft, eröffnete das Nachspeisenbuffet und nannte die Spendenadresse von Ärzten ohne Grenzen. Damit war das offizielle Programm beendet und eine neue Gesprächsrunde begann. Der Abend war für den IKK e.v. wieder einmal ein voller Erfolg! v. l.: Roy Kühne (MdB CDU), Georg Lopata (axentis); Quelle: IKK e.v. 55
56 REZENSIONEN Monsieur Optimist Die meisten von uns lieben ihre Herkunftsfamilie, was diese uns oft nicht ganz einfach macht, aber dennoch lieben wir sie. Als kleine Kinder scheinen sie uns vollkommene, unfehlbare, unerreichbare Heroen zu sein, als Pubertierende unerklärliche, bösartige, lebensfeindliche Wesen, verhaftet in der Vergangenheit. Als Erwachsene sehen wir sie immer klarer, aber auch kritisch. Wir erkennen ihre Fähigkeiten, ihre Stärken, aber auch ihre Brüche, ihre Ungereimtheiten, ihre Absonderlichkeiten. Es tauchen immer mehr Fragen auf, wie und warum diese uns lieben Menschen sich in dieser Weise entwickelt haben. Manche von uns begeben sich auf den Weg, die Geschichte der Herkunftsfamilien aufzuarbeiten, um sie und letztlich damit auch uns selbst besser verstehen zu können. Es kann ein schwieriger, zuweilen auch schmerzhafter sein, auf dem uns viele Überraschungen erwarten. Auf diesen Weg hat sich auch Alain Berenboom begeben, ohne zu wissen, was ihn am Ende erwarten würde. Der Ausfluss seiner Recherchen ist das in Französisch 2013 erschienene Original Monsieur Optimiste, mit dem er seinem Vater und seiner gesamten Herkunftsfamilie ein literarisches Denkmal setzt, ein literarisches Denkmal vielleicht, weil er mit Friedhöfen und entsprechenden Ritualen wenig anzufangen weiß. Alain Berenboom wurde 1947 in Brüssel geboren, genauer gesagt in Schaerbeek (wie viele andere prominente Belgier). Er ist Professor für Urheberrecht an der Freien Universität Brüssel, ein bekannter, erfolgreicher Anwalt und Schriftsteller. Sein Vater, Chaïm Berenbaum, seinerseits Sohn eines orthodoxen polnischen Juden und einer offensichtlich in dem Maße, in dem sein Vater orthodox war, freigeistigen und geschäftstüchtigen Mutter, nimmt in den 1920iger Jahren ein Pharmaziestudium in Lüttich auf. Nach erfolgreichem Abschluss wird er Apotheker und lässt sich nieder. In seiner Apotheke lernt er eine wunderschöne Jüdin aus dem Baltikum kennen und damit nimmt die Geschichte ihren Lauf. Sie heiraten, wollen nicht nach Osteuropa zurück, assimilieren sich, überleben, anders als der Großteil der Familie, die in Polen geblieben ist, mit großem Mut und Engagement in der belgischen Resistance die deutsche Besetzung. Dann wird Alain geboren. Er ist schon voll und ganz Belgier. Dass er Jude ist, spielt für ihn, wie eigentlich auch für seine Eltern, keine Rolle. 56
57 REZENSIONEN Es sind andere Dinge als das Judentum und die Shoah, die für die kleine Familie von alltäglicher Bedeutung sind, dennoch findet man in dieser Familie viel Jüdisches. Nicht, dass Sabbat gefeiert würde, aber die Haltung gegenüber dem Leben, der neuen Heimat, dem Erfolg und vor allem der Bildung sind stark von der jüdischen Kultur geprägt. Nur das alles weiß Alain als Kind und als junger Mann nicht. Etliche Jahre nach dem Tod seines Vaters und seiner Mutter macht sich Alain Berenboom (so schrieben sich die Berenbaums nach dem Krieg) daran, die Kiste mit den Erinnerungsstücken seiner Mutter zu sichten und auszuwerten. Um die Briefe seines Großvaters lesen zu können, benötigt er eine Übersetzung, er hat weder polnisch noch jiddisch gelernt. Die Stücke aus der Erinnerungskiste seiner Mutter lassen die Geschichte der Familie lebendig werden und seine eigenen Erinnerungen fließen ein. Mit hintergründigem Humor beschreibt er die für die Leser liebenswerten Schrullen seiner Eltern, beschreibt aber auch die im Hintergrund immer anwesende tiefe Trauer um die ermordeten Lieben in seiner Familie, obwohl sie nicht thematisiert wird. Seine Eltern und etliche andere Verwandten, die das Grauen überlebten, haben trotz allem ihr Leben gelebt, ohne Verbitterung und mit dem Wunsch, sich vollständig zu assimilieren. Beide Eltern sind Freigeister, die jegliche religiöse oder ideologische Bindung oder gar Verbohrtheit vehement ablehnen. Sie sind mutige, anständige Menschen, wie man sich seine Eltern wünscht. Ebenso wünscht sich auch der Leser, dass ihnen ein solch schweres Schicksal erspart geblieben wäre. Dies alles beschreibt Alain Berenboom in einer zarten, liebevollen Sprache. Er würzt sie kunstvoll mit jenem Hauch dieses eigenartigen Humors, der immer wieder in herrliche Ironie und Selbstironie gleitet, diesen leichten Stil, den heute nur noch wenige Schriftsteller beherrschen. Er berichtet von diesen unfassbaren Schicksalen seiner Familie, ohne in unerträgliches Pathos, Larmoyanz, Klagen oder Anklagen zu verfallen. Was er an seinen Eltern, besonders an seinem Vater über alle Maßen schätzt, ist jener unbändige Optimismus, der notwendig war, um über 2000 Jahre als Juden in Europa zu überleben. Dies ist sein jüdisches Erbe, für das er mit diesem Buch seinem Vater dankt und beweist, dass er der Sohn seines Vaters ist. Dies ist weit mehr, als gelegentlich einen Stein auf das Grab der Eltern zu legen. Monsieur Optimist, für das der Autor einen renommierten Literaturpreis gewonnen hat, ist ein leises Buch, arbeitet nicht mit grellen Effekten, Stereotypen und Plattituden, lässt Lächeln, treibt an einigen Stellen eine Träne ins Auge und geht zu Herzen. Den Übersetzern Tanya Graf und Helmut Moysich kann man zu dieser einfühlsamen Übersetzung ohne Brüche nur gratulieren. Alain Berenboom, Monsieur Optimist, Berlin, 2015, ISBN
58 REZENSIONEN Gemüse Das Kochbuch Wer Gemüse immer noch als mehr oder weniger lästige, eigentlich überflüssige Beilage zu Fleisch oder Fisch betrachtet, selbst kein Vegetarier oder Veganer ist und auch keine zu Gast hat, sollte dieses Buch noch nicht einmal in die Hand nehmen. Es ist nichts für Sie! Wer dagegen Gemüse und Salate in beinahe jeder Art, Farbe, Form und Zubereitungsart liebt, Fisch und Fleisch dagegen als eine wundervolle, gelegentlich willkommene Bereicherung des eigenen Speiseplanes betrachtet, Flexitarier oder gar Parttime- oder Fulltime Veggi ist, für den ist dieses Buch eine wahre Wonne. Gemüse (auch Früchte), roh oder gekocht sind die Stars dieses Buches, deren Zubereitung die entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet wird. Einige Rezepte werden den meisten Hobbyköchen bekannt sein, anderes erstaunt und entfacht sofort Lust, die Gerichte nachzukochen. Einiges wiederum ist durchaus bodenständig, auch für einen kleinen, einfachen Imbiss geeignet, anderes würde auch in der Sterneküche seinen Platz finden. 58
59 REZENSIONEN Die Küche ist süddeutsch-österreichisch inspiriert, aber modern. Sie bietet eine Abwechslung zu den mediterran angehauchten vegetarischen Kochbüchern, die man zumeist auf dem Markt findet. Mit diesem Buch lassen sich mühelos exzellente 10-Gänge-Menüs zusammenstellen, die, von entsprechenden Weinen begleitet, den Ansprüchen von Gourmets standhalten können. Dies verwundert auch nicht, haben sich zwei der Autoren eine Haube im Gault Millau erkocht. Die Zeiten freudloser Vegetarier sind endgültig vorbei. Der Verzicht auf die alltägliche Fleischportion aus gesundheitlichen, ökologischen und sozialen Gründen muss, liest man dieses Buch mit seinen beinahe 320 Seiten, nicht mit einem Verlust an Lebensqualität einhergehen. Die Rezepte sind alphabetisch nach den unterschiedlichen Gemüsen sortiert, die Beschreibung der Zubereitung ist leicht verständlich und auch für ungeübte Köche zu handhaben. Die Bilder regen nicht nur den Speichelfluss an, laden nicht nur zum Durchblättern an, sondern bieten auch hervorragende Anregungen für ein modernes Anrichten. Gemüse, Das Kochbuch, ist ein rundum gelungenes Kochbuch, sicherlich auch ein Geschenk, das Freude und Freunde bereiten wird. Andrea Grossmann, Michael Kolm, Johann Papst, Gemüse, Das Kochbuch, 2015, Wien, Graz, Klagenfurt, ISBN
Qualitätsinstitutionen im Gesundheitswesen. Who is who?
 Qualitätsinstitutionen im Gesundheitswesen Who is who? 1. DVMD-Frühjahrssymposium Hannover, 04.03.2016 Gabriele Damm, Dipl.-Dok. (FH), Systemauditor ZQ, Hannover Qualitätsinstitutionen im Gesundheitswesen
Qualitätsinstitutionen im Gesundheitswesen Who is who? 1. DVMD-Frühjahrssymposium Hannover, 04.03.2016 Gabriele Damm, Dipl.-Dok. (FH), Systemauditor ZQ, Hannover Qualitätsinstitutionen im Gesundheitswesen
Entschließung des Bundesrates zur Umsetzung eines Nationalen Diabetesplans
 Bundesrat Drucksache 252/14 (Beschluss) 11.07.14 Beschluss des Bundesrates Entschließung des Bundesrates zur Umsetzung eines Nationalen Diabetesplans Der Bundesrat hat in seiner 924. Sitzung am 11. Juli
Bundesrat Drucksache 252/14 (Beschluss) 11.07.14 Beschluss des Bundesrates Entschließung des Bundesrates zur Umsetzung eines Nationalen Diabetesplans Der Bundesrat hat in seiner 924. Sitzung am 11. Juli
Nutzenstiftende Anwendungen
 Nutzenstiftende Anwendungen Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit konkretem, greifbaren Nutzen und überschaubarer Komplexität Digitalisierung der persönlichen Gesundheitsdaten am Beispiel Elektronischer
Nutzenstiftende Anwendungen Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit konkretem, greifbaren Nutzen und überschaubarer Komplexität Digitalisierung der persönlichen Gesundheitsdaten am Beispiel Elektronischer
Qualität löst alle Probleme?
 Dr. Barbara Voß, Frühjahrstagung der gwrm, 2. Juni 2015 Qualität löst alle Probleme? Wir wollen, dass die Qualitätsorientierung in der Versorgung eine Erfolgsgeschichte wird. Hermann Gröhe bei der 6. Qualitätssicherungskonferenz
Dr. Barbara Voß, Frühjahrstagung der gwrm, 2. Juni 2015 Qualität löst alle Probleme? Wir wollen, dass die Qualitätsorientierung in der Versorgung eine Erfolgsgeschichte wird. Hermann Gröhe bei der 6. Qualitätssicherungskonferenz
Qualitätsmessung und Qualitätsmanagement aus Sicht des G-BA
 Qualitätsmessung und Qualitätsmanagement aus Sicht des G-BA Nationale Qualitätsstrategien 4. QMR-Kongress Qualitätsmessung und Qualitätsmanagement mit Routinedaten Potsdam 04. Mai 2015 Dr. Regina Klakow-Franck,
Qualitätsmessung und Qualitätsmanagement aus Sicht des G-BA Nationale Qualitätsstrategien 4. QMR-Kongress Qualitätsmessung und Qualitätsmanagement mit Routinedaten Potsdam 04. Mai 2015 Dr. Regina Klakow-Franck,
Brennpunkt-Konferenz: Krankenhäuser unter neuen politischen Rahmenbedingungen. Gemeinsam für mehr Wissen. in Kooperation mit
 02516582402516623362516592642516602880251658240251662336251659 26425166028802516623362516592642516602880251658240251662336251 6592642516602880251658240251662336251 Gemeinsam für mehr Wissen Brennpunkt-Konferenz:
02516582402516623362516592642516602880251658240251662336251659 26425166028802516623362516592642516602880251658240251662336251 6592642516602880251658240251662336251 Gemeinsam für mehr Wissen Brennpunkt-Konferenz:
DAK-Gesundheit im Dialog Patientenorientierung im Gesundheitswesen
 DAK-Gesundheit im Dialog Patientenorientierung im Gesundheitswesen Der aktive und informierte Patient Herausforderung für den Medizinbetrieb und Erfolgsfaktor für das Gesundheitswesen? Präsident der Bayerischen
DAK-Gesundheit im Dialog Patientenorientierung im Gesundheitswesen Der aktive und informierte Patient Herausforderung für den Medizinbetrieb und Erfolgsfaktor für das Gesundheitswesen? Präsident der Bayerischen
Entschließung des Bundesrates zur Umsetzung eines Nationalen Diabetesplans. Der Ministerpräsident Kiel, 6. Juni 2014 des Landes Schleswig-Holstein
 Bundesrat Drucksache 252/14 06.06.14 Antrag der Länder Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Thüringen Entschließung des Bundesrates zur Umsetzung eines Nationalen Diabetesplans Der Ministerpräsident
Bundesrat Drucksache 252/14 06.06.14 Antrag der Länder Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Thüringen Entschließung des Bundesrates zur Umsetzung eines Nationalen Diabetesplans Der Ministerpräsident
Digital Health. Dr. Bernhard Rohleder Bitkom-Hauptgeschäftsführer Berlin, 15. September 2016
 Digital Health Dr. Bernhard Rohleder Bitkom-Hauptgeschäftsführer Berlin, 15. September 2016 Gesundheitsrecherche im Internet ist für viele selbstverständlich Informieren Sie sich im Internet über Gesundheitsthemen?
Digital Health Dr. Bernhard Rohleder Bitkom-Hauptgeschäftsführer Berlin, 15. September 2016 Gesundheitsrecherche im Internet ist für viele selbstverständlich Informieren Sie sich im Internet über Gesundheitsthemen?
Gesundheitsregionen: Welche Überlegungen dahinter stecken
 Es gilt das gesprochene Wort. Bei Fragen und Anregungen freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme: oliver.kessler@hslu.ch Gesundheitsregionen: Welche Überlegungen dahinter stecken Fachtagung Gesundheitsregionen
Es gilt das gesprochene Wort. Bei Fragen und Anregungen freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme: oliver.kessler@hslu.ch Gesundheitsregionen: Welche Überlegungen dahinter stecken Fachtagung Gesundheitsregionen
Unabhängige Beratung und Begutachtung im Interesse der Patienten sichern
 MDK-Gemeinschaft Unabhängige Beratung und Begutachtung im Interesse der Patienten sichern Essen/Berlin (12. März 2013) - Die Gemeinschaft der Medizinischen Dienste (MDK und MDS) sieht den Ausbau der Patientensicherheit
MDK-Gemeinschaft Unabhängige Beratung und Begutachtung im Interesse der Patienten sichern Essen/Berlin (12. März 2013) - Die Gemeinschaft der Medizinischen Dienste (MDK und MDS) sieht den Ausbau der Patientensicherheit
Medizin trifft Recht: Gibt es Regelungslücken in der Qualitätssicherung des SGB V?
 Medizin trifft Recht: Gibt es Regelungslücken in der Qualitätssicherung des SGB V? QS-Konferenz des G-BA, Potsdam, 29.11.2010 Dr. Ilona Köster-Steinebach Agenda 1. Einleitung 2. Fragen zur Qualitätssicherung
Medizin trifft Recht: Gibt es Regelungslücken in der Qualitätssicherung des SGB V? QS-Konferenz des G-BA, Potsdam, 29.11.2010 Dr. Ilona Köster-Steinebach Agenda 1. Einleitung 2. Fragen zur Qualitätssicherung
Frühe Nutzenbewertungen nach AMNOG: Einblicke in die aktuellen Verfahren und mögliche Auswirkungen für Ärzte und Patienten
 Frühe Nutzenbewertungen nach AMNOG: Einblicke in die aktuellen Verfahren und mögliche Auswirkungen für Ärzte und Patienten Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) 35a Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln
Frühe Nutzenbewertungen nach AMNOG: Einblicke in die aktuellen Verfahren und mögliche Auswirkungen für Ärzte und Patienten Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) 35a Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln
Vertrauen schaffen. Zukunft gestalten. Unternehmensleitsätze der AOK Rheinland / Hamburg Die Gesundheitskasse
 Vertrauen schaffen. Zukunft gestalten. Unternehmensleitsätze der AOK Rheinland / Hamburg Die Gesundheitskasse 2013 Präambel...4 1 Unternehmen positionieren...8 2 Markt ausbauen...10 3 Produkte weiterentwickeln...11
Vertrauen schaffen. Zukunft gestalten. Unternehmensleitsätze der AOK Rheinland / Hamburg Die Gesundheitskasse 2013 Präambel...4 1 Unternehmen positionieren...8 2 Markt ausbauen...10 3 Produkte weiterentwickeln...11
Mechthild Kern, Mainz. Statement zum Thema. "EMNID-Umfrage: Was hält die Bevölkerung von der Positivliste?"
 Mechthild Kern, Mainz Statement zum Thema "EMNID-Umfrage: Was hält die Bevölkerung von der Positivliste?" Wie vom Gesetzgeber beschlossen, soll im Laufe dieses Jahres von einer eigens für diese Aufgabe
Mechthild Kern, Mainz Statement zum Thema "EMNID-Umfrage: Was hält die Bevölkerung von der Positivliste?" Wie vom Gesetzgeber beschlossen, soll im Laufe dieses Jahres von einer eigens für diese Aufgabe
vdek-bewertung des Koalitionsvertrages Deutschlands Zukunft gestalten von CDU, CSU und SPD für die ambulante Versorgung
 Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung Der vdek bewertet positiv, dass die Koalition mehr Anreize zur Ansiedlung von Ärzten in strukturschwachen Gebieten schaffen und flexiblere Rahmenbedingungen
Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung Der vdek bewertet positiv, dass die Koalition mehr Anreize zur Ansiedlung von Ärzten in strukturschwachen Gebieten schaffen und flexiblere Rahmenbedingungen
!" # $$ ) * #+, -,. & /
 !" # $$ %& '(& ) * #+, -,. & / 2 Die Bundesregierung hat Eckpunkte für eine große Gesundheitsreform vorgelegt. Aber können diese zur Lösung der bestehenden Probleme beitragen? ver.di will eine Gesundheitsreform,
!" # $$ %& '(& ) * #+, -,. & / 2 Die Bundesregierung hat Eckpunkte für eine große Gesundheitsreform vorgelegt. Aber können diese zur Lösung der bestehenden Probleme beitragen? ver.di will eine Gesundheitsreform,
Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung möge beschließen:
 TOP 7 Antrag 1 Bericht an die Vertreterversammlung der KBV Positionspapier Erwartungen der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten an eine zukunftssichere Gesundheitspolitik Vorstand KBV Die Vertreterversammlung
TOP 7 Antrag 1 Bericht an die Vertreterversammlung der KBV Positionspapier Erwartungen der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten an eine zukunftssichere Gesundheitspolitik Vorstand KBV Die Vertreterversammlung
Fakten, die für die PKV sprechen.
 Fakten, die für die PKV sprechen. Neuauflage Nov. 2016 95 % der Versicherten sind mit den Leistungen der PKV zufrieden. Von solchen Zustimmungswerten können andere Branchen nur träumen. Ein zusätzlicher
Fakten, die für die PKV sprechen. Neuauflage Nov. 2016 95 % der Versicherten sind mit den Leistungen der PKV zufrieden. Von solchen Zustimmungswerten können andere Branchen nur träumen. Ein zusätzlicher
Frauengesundheit. Umfrage unter 150 führenden Spezialisten
 Frauengesundheit Umfrage unter 150 führenden Spezialisten Zielsetzung Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.v. (VFA) hat das Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie
Frauengesundheit Umfrage unter 150 führenden Spezialisten Zielsetzung Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.v. (VFA) hat das Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie
Jens Hennicke Leiter der TK-Landesvertretung Sachsen-Anhalt 14. Oktober 2013, Halle (Saale)
 Jens Hennicke Leiter der TK-Landesvertretung Sachsen-Anhalt 14. Oktober 2013, Halle (Saale) Alterung der Gesellschaft "Altern ist eine Zumutung!" (Zitat: Loriot) 2 Gesundheitsversorgung unter dem Druck
Jens Hennicke Leiter der TK-Landesvertretung Sachsen-Anhalt 14. Oktober 2013, Halle (Saale) Alterung der Gesellschaft "Altern ist eine Zumutung!" (Zitat: Loriot) 2 Gesundheitsversorgung unter dem Druck
Telemedizinische Vernetzung Das Projekt Aufbruch Bayern 3. Telemedizin-Fachtagung Bayern 2013
 Telemedizinische Vernetzung Das Projekt Aufbruch Bayern 3. Telemedizin-Fachtagung Bayern 2013 Ministerialdirigent Herwig Heide München, 7. Mai 2013 Herausforderungen der Gesundheitspolitik Demografischer
Telemedizinische Vernetzung Das Projekt Aufbruch Bayern 3. Telemedizin-Fachtagung Bayern 2013 Ministerialdirigent Herwig Heide München, 7. Mai 2013 Herausforderungen der Gesundheitspolitik Demografischer
Hochschulambulanzen aus Sicht der GKV: Teurer Luxus oder. Versorgung?
 Hochschulambulanzen aus Sicht der GKV: Teurer Luxus oder unverzichtbar für die ambulante Versorgung? Uwe Deh Geschäftsführender Vorstand AOK-Bundesverband 03.04.2014, Berlin Frühjahrsforum der Deutschen
Hochschulambulanzen aus Sicht der GKV: Teurer Luxus oder unverzichtbar für die ambulante Versorgung? Uwe Deh Geschäftsführender Vorstand AOK-Bundesverband 03.04.2014, Berlin Frühjahrsforum der Deutschen
DMP-Realität nach 10 Jahren
 DMP-Realität nach 10 Jahren Dr. Maximilian Gaßner Präsident des Bundesversicherungsamtes Übersicht 1. Einführung der DMP 2. DMP in der Praxis Kritik und Würdigung 3. Ausblick in die Zukunft von DMP 4.
DMP-Realität nach 10 Jahren Dr. Maximilian Gaßner Präsident des Bundesversicherungsamtes Übersicht 1. Einführung der DMP 2. DMP in der Praxis Kritik und Würdigung 3. Ausblick in die Zukunft von DMP 4.
Elektronische Gesundheitskarte (egk) Hinweise zum Basis-Rollout der egk
 KZBV Postfach 41 01 69 50861 Köln An alle Kassenzahnärztlichen Vereinigungen V4 / Nr. 386 / 24.06.2008 Verteiler: KZVen Körperschaft des öffentlichen Rechts Abteilung Telematik Universitätsstraße 73 50931
KZBV Postfach 41 01 69 50861 Köln An alle Kassenzahnärztlichen Vereinigungen V4 / Nr. 386 / 24.06.2008 Verteiler: KZVen Körperschaft des öffentlichen Rechts Abteilung Telematik Universitätsstraße 73 50931
Rede des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie Dr. Philipp Rösler anlässlich der Jahreskonferenz der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft
 Rede des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie Dr. Philipp Rösler anlässlich der Jahreskonferenz der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft [Rede in Auszügen] Datum: 14.12.2012 Ort: axica, Berlin
Rede des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie Dr. Philipp Rösler anlässlich der Jahreskonferenz der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft [Rede in Auszügen] Datum: 14.12.2012 Ort: axica, Berlin
MB-Studi-Barometer 2016
 Berlin, 26.02.2016 MB-Studi-Barometer 2016 Zusammenfassung der Ergebnisse Im Koalitionsvertrag haben CDU/CSU und SPD angekündigt, in einer Konferenz der Gesundheits- und Wissenschaftsminister von Bund
Berlin, 26.02.2016 MB-Studi-Barometer 2016 Zusammenfassung der Ergebnisse Im Koalitionsvertrag haben CDU/CSU und SPD angekündigt, in einer Konferenz der Gesundheits- und Wissenschaftsminister von Bund
Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001)
 Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001) Diese Erklärung wurde vom ENBGF auf dem Netzwerktreffen am 16. Juni 2001 verabschiedet und auf der anschließenden
Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001) Diese Erklärung wurde vom ENBGF auf dem Netzwerktreffen am 16. Juni 2001 verabschiedet und auf der anschließenden
21 Rentenversicherungsträger scheuen Leistungsvergleiche (Kapitel 1113 Titelgruppe 02)
 21 Rentenversicherungsträger scheuen Leistungsvergleiche (Kapitel 1113 Titelgruppe 02) 21.0 Der Gesetzgeber hat die Träger der Deutschen Rentenversicherung verpflichtet, ihren Verwaltungsaufwand zu senken
21 Rentenversicherungsträger scheuen Leistungsvergleiche (Kapitel 1113 Titelgruppe 02) 21.0 Der Gesetzgeber hat die Träger der Deutschen Rentenversicherung verpflichtet, ihren Verwaltungsaufwand zu senken
Gesundheitswirtschaft im Spannungsfeld von Patientenversorgung und Renditesicherung Visionen eines innovativen Geschäftsmodelles
 Gesundheitswirtschaft im Spannungsfeld von Patientenversorgung und Renditesicherung Visionen eines innovativen Geschäftsmodelles DAK Gesundheit im Dialog Mit innovativen Modellen die Zukunft der Versorgung
Gesundheitswirtschaft im Spannungsfeld von Patientenversorgung und Renditesicherung Visionen eines innovativen Geschäftsmodelles DAK Gesundheit im Dialog Mit innovativen Modellen die Zukunft der Versorgung
Was braucht ein gut vernetztes Gesundheitssystem in Deutschland? 01. Juni 2016, Berlin Prof. Dr. Arno Elmer (IHP)
 Was braucht ein gut vernetztes Gesundheitssystem in Deutschland? 01. Juni 2016, Berlin Prof. Dr. Arno Elmer (IHP) Abbau von ÜBERVERSORGUNG Abbau von UNTERVERSORGUNG SORGENFREIES LEBEN Das intelligent vernetzte
Was braucht ein gut vernetztes Gesundheitssystem in Deutschland? 01. Juni 2016, Berlin Prof. Dr. Arno Elmer (IHP) Abbau von ÜBERVERSORGUNG Abbau von UNTERVERSORGUNG SORGENFREIES LEBEN Das intelligent vernetzte
Erfahren Sie in Dänemark. die Geheimnisse eines Gesundheitssektors der Spitzenklasse
 Erfahren Sie in Dänemark die Geheimnisse eines Gesundheitssektors der Spitzenklasse 1 3 Unser Ansatz in Dänemark, den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig Anstrengungen zur Verbesserung
Erfahren Sie in Dänemark die Geheimnisse eines Gesundheitssektors der Spitzenklasse 1 3 Unser Ansatz in Dänemark, den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig Anstrengungen zur Verbesserung
Wozu brauchen wir eine vernetzte Versorgung?
 Wozu brauchen wir eine vernetzte Versorgung? Matthias Meierhofer Vorstandsvorsitzender des bvitg e. V. ehealth-kongress 17. Oktober 2014, Darmstadt Wer wir sind. Der bvitg vertritt die in Deutschland führenden
Wozu brauchen wir eine vernetzte Versorgung? Matthias Meierhofer Vorstandsvorsitzender des bvitg e. V. ehealth-kongress 17. Oktober 2014, Darmstadt Wer wir sind. Der bvitg vertritt die in Deutschland führenden
Haben Privatspitäler eine Zukunft?
 Haben Privatspitäler eine Zukunft? Spital-Strategien für die Zukunft Health Insurance Days, 24. und 25. April 2014 Peter Fischer, VRP Lindenhofgruppe LINDENHOFGRUPPE Drei Standorte, ein Ziel: höchste Patientenzufriedenheit
Haben Privatspitäler eine Zukunft? Spital-Strategien für die Zukunft Health Insurance Days, 24. und 25. April 2014 Peter Fischer, VRP Lindenhofgruppe LINDENHOFGRUPPE Drei Standorte, ein Ziel: höchste Patientenzufriedenheit
Qualitätsbericht. der IKK classic. für das Behandlungsprogramm. IKK Promed Brustkrebs. in der Region Baden-Württemberg
 Qualitätsbericht der IKK classic für das Behandlungsprogramm IKK Promed Brustkrebs in der Region Baden-Württemberg vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 Präambel Patienten können in Deutschland auf eine leistungsfähige
Qualitätsbericht der IKK classic für das Behandlungsprogramm IKK Promed Brustkrebs in der Region Baden-Württemberg vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 Präambel Patienten können in Deutschland auf eine leistungsfähige
Evaluation der Integrierten Versorgung aus ökonomischer Sicht1) 2)
 4. 4. Deutscher Kongress für für Versorgungsforschung Evaluation der Integrierten Versorgung aus ökonomischer Sicht1) 2) Wasem J, Focke A, Schillo S, Marks P, Bakowski N, Höppner K, Schulz S, Hessel F
4. 4. Deutscher Kongress für für Versorgungsforschung Evaluation der Integrierten Versorgung aus ökonomischer Sicht1) 2) Wasem J, Focke A, Schillo S, Marks P, Bakowski N, Höppner K, Schulz S, Hessel F
Das Präventionsgesetz
 Das Präventionsgesetz -Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention- Severin Schmidt, Leiter Gesprächskreis Sozialpolitik FES 1 Gliederung 1. Hintergrund 2. Ziele 3. Eckpunkte und Maßnahmen
Das Präventionsgesetz -Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention- Severin Schmidt, Leiter Gesprächskreis Sozialpolitik FES 1 Gliederung 1. Hintergrund 2. Ziele 3. Eckpunkte und Maßnahmen
Prof. Dr. Stefan Greß. Finanzentwicklung in der GKV faire Bedingungen für den Kassenwettbewerb?
 Prof. Dr. Stefan Greß Finanzentwicklung in der GKV faire Bedingungen für den Kassenwettbewerb? Vortrag bei der Veranstaltung des BKK-Dachverbands BKK im Dialog Morbi-RSA sachgerecht gestalten am 23. September
Prof. Dr. Stefan Greß Finanzentwicklung in der GKV faire Bedingungen für den Kassenwettbewerb? Vortrag bei der Veranstaltung des BKK-Dachverbands BKK im Dialog Morbi-RSA sachgerecht gestalten am 23. September
Finanzierung von Gesundheitstelematik -Impulsvortrag-
 Finanzierung von Gesundheitstelematik -Impulsvortrag- MinDirig Norbert Paland Bundesministerium für Gesundheit Leiter der Unterabteilung "Haushalt/Telematik" Telematik-Konferenz, Potsdam 13. Februar 2008
Finanzierung von Gesundheitstelematik -Impulsvortrag- MinDirig Norbert Paland Bundesministerium für Gesundheit Leiter der Unterabteilung "Haushalt/Telematik" Telematik-Konferenz, Potsdam 13. Februar 2008
Das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) - Welche Auswirkungen hat das Gesetz auf die Apotheken?
 Das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) - Welche Auswirkungen hat das Gesetz auf die Apotheken? Dr. rer. nat. Holger Knoth, Leiter der Klinik-Apotheke Seite 1 Welche Tätigkeitsfelder in der Apotheke
Das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) - Welche Auswirkungen hat das Gesetz auf die Apotheken? Dr. rer. nat. Holger Knoth, Leiter der Klinik-Apotheke Seite 1 Welche Tätigkeitsfelder in der Apotheke
Qualitätsbericht der IKK gesund plus
 Qualitätsbericht der IKK gesund plus nach 137f Abs. 4 Satz 2 SGB V für das Behandlungsprogramm IKKpromed Diabetes mellitus Typ 1 Kalenderjahr 2014 Inhalt PRÄAMBEL... 3 GRUNDLAGEN... 4 IKKpromed-Teilnehmer
Qualitätsbericht der IKK gesund plus nach 137f Abs. 4 Satz 2 SGB V für das Behandlungsprogramm IKKpromed Diabetes mellitus Typ 1 Kalenderjahr 2014 Inhalt PRÄAMBEL... 3 GRUNDLAGEN... 4 IKKpromed-Teilnehmer
Meine persönliche Checkliste
 Meine persönliche Checkliste Leitfaden für Ihr Gespräch mit dem Arzt und praktische Informationen rund um die Erkrankung und ihre Behandlung. Was Sie fragen sollten, was Sie wissen sollten Der Umgang mit
Meine persönliche Checkliste Leitfaden für Ihr Gespräch mit dem Arzt und praktische Informationen rund um die Erkrankung und ihre Behandlung. Was Sie fragen sollten, was Sie wissen sollten Der Umgang mit
Qualitätsbericht der IKK Südwest
 Qualitätsbericht der IKK Südwest nach 137f Abs. 4 Satz 2 SGB V für das Behandlungsprogramm IKKpromed Diabetes mellitus Typ 1 Kalenderjahr 2014 Inhalt PRÄAMBEL... 3 GRUNDLAGEN... 4 IKKpromed-Teilnehmer
Qualitätsbericht der IKK Südwest nach 137f Abs. 4 Satz 2 SGB V für das Behandlungsprogramm IKKpromed Diabetes mellitus Typ 1 Kalenderjahr 2014 Inhalt PRÄAMBEL... 3 GRUNDLAGEN... 4 IKKpromed-Teilnehmer
Qualitätsorientierung
 Qualitätsorientierung tsorientierung aus Sicht der hessischen Krankenhäuser Mai 2014 Qualitätsorientierung tsorientierung aus Sicht der hessischen Krankenhäuser 10 Positionen: Wofür die hessischen Krankenhäuser
Qualitätsorientierung tsorientierung aus Sicht der hessischen Krankenhäuser Mai 2014 Qualitätsorientierung tsorientierung aus Sicht der hessischen Krankenhäuser 10 Positionen: Wofür die hessischen Krankenhäuser
Die Herausforderungen an das Gesundheitswesen in Sachsen-Anhalt
 Die Herausforderungen an das Gesundheitswesen in Sachsen-Anhalt Vor dem Hintergrund einer ständig alternden Bevölkerung Dr. Dr. Reinhard Nehring Innovationsforum MED.TEC.INTEGRAL 22./23.09.2008 Demografischer
Die Herausforderungen an das Gesundheitswesen in Sachsen-Anhalt Vor dem Hintergrund einer ständig alternden Bevölkerung Dr. Dr. Reinhard Nehring Innovationsforum MED.TEC.INTEGRAL 22./23.09.2008 Demografischer
Das Präventionsgesetz - Ablauf eines politischen Entscheidungsprozesses in Deutschland
 Medizin Lotte Habermann-Horstmeier Das Präventionsgesetz - Ablauf eines politischen Entscheidungsprozesses in Deutschland Studienarbeit Dr. med. Lotte Habermann- Horstmeier Ablauf des politischen Entscheidungsprozesses
Medizin Lotte Habermann-Horstmeier Das Präventionsgesetz - Ablauf eines politischen Entscheidungsprozesses in Deutschland Studienarbeit Dr. med. Lotte Habermann- Horstmeier Ablauf des politischen Entscheidungsprozesses
Frau Dr. Irmgard Stippler Vorstandsvorsitzende AOK Rheinland-Pfalz/Saarland
 Bedeutung und Umsetzung von Qualität: Die Perspektive einer Krankenkasse Gesundheitsökonomische Gespräche 07. Oktober 2016 Hochschule Ludwigshafen am Rhein - Ludwigshafen am Rhein Frau Dr. Irmgard Stippler
Bedeutung und Umsetzung von Qualität: Die Perspektive einer Krankenkasse Gesundheitsökonomische Gespräche 07. Oktober 2016 Hochschule Ludwigshafen am Rhein - Ludwigshafen am Rhein Frau Dr. Irmgard Stippler
Regional gut versorgt Handlungsbedarf für eine leistungsfähige medizinische Rehabilitation
 Regional gut versorgt Handlungsbedarf für eine leistungsfähige medizinische Rehabilitation Frank Winkler Stellv. Leiter der vdek-landesvertretung Baden-Württemberg BDPK-Bundeskongress 2015 24. Juni 2015
Regional gut versorgt Handlungsbedarf für eine leistungsfähige medizinische Rehabilitation Frank Winkler Stellv. Leiter der vdek-landesvertretung Baden-Württemberg BDPK-Bundeskongress 2015 24. Juni 2015
Erklärung von Hermann Gröhe, Gesundheitsminister Mitglied des Deutschen Bundestags
 Erklärung von Hermann Gröhe, Gesundheitsminister Mitglied des Deutschen Bundestags anlässlich des Hochrangigen Ministertreffens auf VN-Ebene zu HIV/AIDS vom 8. 10. Juni 2016 in New York - 2 - - 2 - Sehr
Erklärung von Hermann Gröhe, Gesundheitsminister Mitglied des Deutschen Bundestags anlässlich des Hochrangigen Ministertreffens auf VN-Ebene zu HIV/AIDS vom 8. 10. Juni 2016 in New York - 2 - - 2 - Sehr
AMNOG-Fachtagung des G-BA Besondere Therapiesituationen Bedingte Zulassung, Kinderarzneimittel und Orphan Drugs
 AMNOG-Fachtagung des G-BA Besondere Therapiesituationen Bedingte Zulassung, Kinderarzneimittel und Orphan Drugs Martin Völkl, Director Market Access & Public Affairs, Celgene GmbH Warum forschen Pharmaunternehmen?
AMNOG-Fachtagung des G-BA Besondere Therapiesituationen Bedingte Zulassung, Kinderarzneimittel und Orphan Drugs Martin Völkl, Director Market Access & Public Affairs, Celgene GmbH Warum forschen Pharmaunternehmen?
Mittwoch, Uhr. Depression Grundlagen, Diagnostik und Therapie: eine Zwischenbilanz. Fortbildungsreihe 2016
 Depression 2016 Grundlagen, Diagnostik und Therapie: eine Zwischenbilanz Dr. med. Hans Werner Schied Mittwoch, 07.12.2016 17.00 18.30 Uhr MediClin Zentrum für Psychische Gesundheit Donaueschingen Fortbildungsreihe
Depression 2016 Grundlagen, Diagnostik und Therapie: eine Zwischenbilanz Dr. med. Hans Werner Schied Mittwoch, 07.12.2016 17.00 18.30 Uhr MediClin Zentrum für Psychische Gesundheit Donaueschingen Fortbildungsreihe
Pädiatrische Studien aus Sicht der Forschungsförderung
 Pädiatrische Studien aus Sicht der Forschungsförderung BfArM - Kinderarzneimittel-Symposium "More Medicines for Minors - Arzneimittelzulassung für Kinder und Jugendliche verbessern" Dr. Alexander Grundmann
Pädiatrische Studien aus Sicht der Forschungsförderung BfArM - Kinderarzneimittel-Symposium "More Medicines for Minors - Arzneimittelzulassung für Kinder und Jugendliche verbessern" Dr. Alexander Grundmann
Therese Stutz Steiger, Vorstandsmitglied Esther Neiditsch, Geschäftsleiterin
 Therese Stutz Steiger, Vorstandsmitglied Esther Neiditsch, Geschäftsleiterin 17. März 2014 Überblick ProRaris Rare Disease Days in der Schweiz Nationale Strategie für Seltene Krankheiten Aktuelle Fragen;
Therese Stutz Steiger, Vorstandsmitglied Esther Neiditsch, Geschäftsleiterin 17. März 2014 Überblick ProRaris Rare Disease Days in der Schweiz Nationale Strategie für Seltene Krankheiten Aktuelle Fragen;
Wie gut ist Deutschland vor Infektionen geschützt? Eine Experten-Umfrage zu Impfungen und Impfverhalten
 Pressekonferenz Wie gut ist Deutschland vor Infektionen geschützt? Eine Experten-Umfrage zu Impfungen und Impfverhalten 12. Dezember 2006 Berlin Impfstoff-Forschung: Bürokratie verhindert Innovation Statement
Pressekonferenz Wie gut ist Deutschland vor Infektionen geschützt? Eine Experten-Umfrage zu Impfungen und Impfverhalten 12. Dezember 2006 Berlin Impfstoff-Forschung: Bürokratie verhindert Innovation Statement
Lob- & Beschwerdebericht
 Lob- & Beschwerdebericht des Wilhelmsburger Krankenhauses Groß-Sand zur Hamburger Erklärung für das Jahr 2014 Malika Damian Leitung Qualitätsmanagement Sandra Bargholz Mitarbeiterin im Qualitätsmanagement
Lob- & Beschwerdebericht des Wilhelmsburger Krankenhauses Groß-Sand zur Hamburger Erklärung für das Jahr 2014 Malika Damian Leitung Qualitätsmanagement Sandra Bargholz Mitarbeiterin im Qualitätsmanagement
Fritz Beske Institut für Gesundheits-System-Forschung Kiel
 Fritz Beske Institut für Gesundheits-System-Forschung Kiel Gemeinnützige Stiftung Pressemitteilung zur Pressekonferenz des IGSF am 12. Oktober 2011 in Berlin - Langfassung - Festzuschüsse können helfen:
Fritz Beske Institut für Gesundheits-System-Forschung Kiel Gemeinnützige Stiftung Pressemitteilung zur Pressekonferenz des IGSF am 12. Oktober 2011 in Berlin - Langfassung - Festzuschüsse können helfen:
Das Krankheitsspektrum der Zukunft
 Das Krankheitsspektrum der Zukunft Expertenumfrage unter 100 führenden deutschen Forschern Zielsetzung Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.v. (VFA) hat das der Charité mit der Experten-Umfrage
Das Krankheitsspektrum der Zukunft Expertenumfrage unter 100 führenden deutschen Forschern Zielsetzung Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.v. (VFA) hat das der Charité mit der Experten-Umfrage
Vernetzung im Gesundheitswesen. Die häufigsten Fragen zur elektronischen Gesundheitskarte.
 Vernetzung im Gesundheitswesen. Die häufigsten Fragen zur elektronischen Gesundheitskarte. 3. Kann ich nicht einfach meine alte Krankenversichertenkarte behalten? Die elektronische Gesundheitskarte ist
Vernetzung im Gesundheitswesen. Die häufigsten Fragen zur elektronischen Gesundheitskarte. 3. Kann ich nicht einfach meine alte Krankenversichertenkarte behalten? Die elektronische Gesundheitskarte ist
Workshop zur Ethik der Kosten-Nutzen- Bewertung medizinischer Maßnahmen
 Workshop zur Ethik der Kosten-Nutzen- Bewertung medizinischer Maßnahmen Chancen und Risiken einer indikationsübergreifenden Kosten-Nutzen- Bewertung Prof. Dr. Jürgen Wasem Alfried Krupp von Bohlen und
Workshop zur Ethik der Kosten-Nutzen- Bewertung medizinischer Maßnahmen Chancen und Risiken einer indikationsübergreifenden Kosten-Nutzen- Bewertung Prof. Dr. Jürgen Wasem Alfried Krupp von Bohlen und
Klinische Krebsregister
 Klinische Krebsregister Dorothee Krug Abteilung Stationäre Versorgung Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) XVIII. Gesundheitspolitisches Symposium 28. Oktober 2016 in Magdeburg Krebserkrankungen in Deutschland
Klinische Krebsregister Dorothee Krug Abteilung Stationäre Versorgung Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) XVIII. Gesundheitspolitisches Symposium 28. Oktober 2016 in Magdeburg Krebserkrankungen in Deutschland
Health-i Board - Panel. E-Health in Deutschland. Chancen, Herausforderungen, Risiken. Zum Thema:
 Health-i Board - Panel Zum Thema: E-Health in Deutschland Chancen, Herausforderungen, Risiken Q1 E-Health, also der Einsatz digitaler Technologien im Gesundheitswesen, schreitet voran. Bei immer mehr Hilfsmitteln
Health-i Board - Panel Zum Thema: E-Health in Deutschland Chancen, Herausforderungen, Risiken Q1 E-Health, also der Einsatz digitaler Technologien im Gesundheitswesen, schreitet voran. Bei immer mehr Hilfsmitteln
Einheitlicher Leistungskatalog und differenzierte Versorgungsangebote?
 Einheitlicher Leistungskatalog und differenzierte Versorgungsangebote? Prof. Dr. Herbert Rebscher Vorstandsvorsitzender der DAK Wettbewerb in der Gesundheitsversorgung Wie viel Differenzierung ist produktiv
Einheitlicher Leistungskatalog und differenzierte Versorgungsangebote? Prof. Dr. Herbert Rebscher Vorstandsvorsitzender der DAK Wettbewerb in der Gesundheitsversorgung Wie viel Differenzierung ist produktiv
Nr. 158 Name: Kompetenznetz Parkinson - Benchmarking in der Patienten-Versorgung - Depression bei der Parkinson-Krankheit (KND)
 Quellen Informationsgrundlage für diesen Datensatz Name der Qualitätsinitiative Internetlink der Initiative nur aus Recherche Kompetenznetz Parkinson - Benchmarking in der Patienten-Versorgung - Depression
Quellen Informationsgrundlage für diesen Datensatz Name der Qualitätsinitiative Internetlink der Initiative nur aus Recherche Kompetenznetz Parkinson - Benchmarking in der Patienten-Versorgung - Depression
Mitteilung zur Kenntnisnahme
 17. Wahlperiode Drucksache 17/0496 05.09.2012 Mitteilung zur Kenntnisnahme Änderung der Störerhaftung für WLAN-Betreiber Freies WLAN in Berlin Drucksachen 17/0255 und 17/0424 Abgeordnetenhaus von Berlin
17. Wahlperiode Drucksache 17/0496 05.09.2012 Mitteilung zur Kenntnisnahme Änderung der Störerhaftung für WLAN-Betreiber Freies WLAN in Berlin Drucksachen 17/0255 und 17/0424 Abgeordnetenhaus von Berlin
Workshopbeschreibungen
 10. Arbeitsschutzforum am 14./15. September 2015 in der DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund en Perspektive: Betriebe und Beschäftigte KMU/Dienstleistung Chancen, Risiken, Betroffenheit und Relevanz
10. Arbeitsschutzforum am 14./15. September 2015 in der DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund en Perspektive: Betriebe und Beschäftigte KMU/Dienstleistung Chancen, Risiken, Betroffenheit und Relevanz
Die Bezahlbarkeit der Krankenversorgung ein Blick zurück und voraus... 11. Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)... 15
 Gesamtinhalt Abkürzungen... 9 Die Bezahlbarkeit der Krankenversorgung ein Blick zurück und voraus... 11 Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)... 15 I. Wissenswertes zur GOÄ Erläuterungen... 15 1. Allgemeines...
Gesamtinhalt Abkürzungen... 9 Die Bezahlbarkeit der Krankenversorgung ein Blick zurück und voraus... 11 Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)... 15 I. Wissenswertes zur GOÄ Erläuterungen... 15 1. Allgemeines...
Klinische Versorgungsforschung: Warum, wieso, und wie?
 Klinische Versorgungsforschung: Warum, wieso, und wie? Werner Vach Koordinierungsstelle Versorgungsforschung Medizinische Fakultät der Universität Freiburg Was ist Versorgungsforschung? Was ist Versorgungsforschung?
Klinische Versorgungsforschung: Warum, wieso, und wie? Werner Vach Koordinierungsstelle Versorgungsforschung Medizinische Fakultät der Universität Freiburg Was ist Versorgungsforschung? Was ist Versorgungsforschung?
Aufklärung im Wandel Vom Motivieren zum Informieren. Früherkennung von Brustkrebs Mammographie-Screening-Programm. Dr. Barbara Marnach-Kopp
 Aufklärung im Wandel Vom Motivieren zum Informieren Früherkennung von Brustkrebs Mammographie-Screening-Programm Dr. Barbara Marnach-Kopp Tutzing, 11. September 2010 1 EMMA September 1996 Titel des Berichtes:
Aufklärung im Wandel Vom Motivieren zum Informieren Früherkennung von Brustkrebs Mammographie-Screening-Programm Dr. Barbara Marnach-Kopp Tutzing, 11. September 2010 1 EMMA September 1996 Titel des Berichtes:
Rede von Ulrike Flach Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Gesundheit Mitglied des Deutschen Bundestages Grußwort
 Rede von Ulrike Flach Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Gesundheit Mitglied des Deutschen Bundestages Grußwort auf dem 1. Männergesundheitskongresses der BZgA "Männergesundheit
Rede von Ulrike Flach Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Gesundheit Mitglied des Deutschen Bundestages Grußwort auf dem 1. Männergesundheitskongresses der BZgA "Männergesundheit
Medizinische und pflegerische Versorgung im ländlichen Raum Gemeinsam für Lebensqualität. Andreas Böhm
 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Medizinische und pflegerische Versorgung im ländlichen Raum Gemeinsam für Lebensqualität Andreas Böhm Referat 41: Grundsatzfragen der Gesundheitspolitik,
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Medizinische und pflegerische Versorgung im ländlichen Raum Gemeinsam für Lebensqualität Andreas Böhm Referat 41: Grundsatzfragen der Gesundheitspolitik,
Niedersächsischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache 17/2645. Antwort auf eine Kleine schriftliche Anfrage - Drucksache 17/2342 -
 Niedersächsischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache 17/2645 Antwort auf eine Kleine schriftliche Anfrage - Drucksache 17/2342 - Wortlaut der Anfrage der Abgeordneten Uwe Schwarz, Holger Ansmann, Marco
Niedersächsischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache 17/2645 Antwort auf eine Kleine schriftliche Anfrage - Drucksache 17/2342 - Wortlaut der Anfrage der Abgeordneten Uwe Schwarz, Holger Ansmann, Marco
Qualitätsbericht der IKK Südwest. für das Behandlungsprogramm IKKpromed Diabetes mellitus Typ 2
 Qualitätsbericht der IKK Südwest für das Behandlungsprogramm IKKpromed Diabetes mellitus Typ 2 Kalenderjahr 2014 Inhalt PRÄAMBEL... 3 GRUNDLAGEN... 4 IKKpromed-Teilnehmer zum 31.12.2014... 5 Altersverteilung
Qualitätsbericht der IKK Südwest für das Behandlungsprogramm IKKpromed Diabetes mellitus Typ 2 Kalenderjahr 2014 Inhalt PRÄAMBEL... 3 GRUNDLAGEN... 4 IKKpromed-Teilnehmer zum 31.12.2014... 5 Altersverteilung
Kopfpauschale vs. Bürgerversicherung
 Kopfpauschale vs. Bürgerversicherung Bärbel Brünger Pressesprecherin des Verbandes der Ersatzkassen NRW vdek e.v. Veranstaltung in Schloss-Holte-Stukenbrock - 14.April 2010 Warum brauchen wir eine Reform
Kopfpauschale vs. Bürgerversicherung Bärbel Brünger Pressesprecherin des Verbandes der Ersatzkassen NRW vdek e.v. Veranstaltung in Schloss-Holte-Stukenbrock - 14.April 2010 Warum brauchen wir eine Reform
Statement von Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung
 Statement von Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung Meine Herren und Damen, kann man mit Vitaminen der Krebsentstehung vorbeugen? Welche Kombination von Medikamenten bei AIDS ist
Statement von Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung Meine Herren und Damen, kann man mit Vitaminen der Krebsentstehung vorbeugen? Welche Kombination von Medikamenten bei AIDS ist
Remscheid, 26. September 2014
 Remscheid, 26. September 2014 Blickpunkt Psychiatrie in NRW Psychiatrie hat großen Anteil an Krankenhausausgaben Bei der TK in NRW 2013 ca. 139 Mio. Euro von ca. 1,4 Mrd. Euro insgesamt Dies ist der drittgrößte
Remscheid, 26. September 2014 Blickpunkt Psychiatrie in NRW Psychiatrie hat großen Anteil an Krankenhausausgaben Bei der TK in NRW 2013 ca. 139 Mio. Euro von ca. 1,4 Mrd. Euro insgesamt Dies ist der drittgrößte
Palliative Versorgung in Deutschland was haben wir was brauchen wir.?
 Palliative Versorgung in Deutschland was haben wir was brauchen wir.? Sozialmedizinische Begutachtungsgrundlagen ambulanter palliativer Versorgungsbedarfe Hamburg 20.Mai 2015 Dr. Joan Elisabeth Panke Seniorberaterin
Palliative Versorgung in Deutschland was haben wir was brauchen wir.? Sozialmedizinische Begutachtungsgrundlagen ambulanter palliativer Versorgungsbedarfe Hamburg 20.Mai 2015 Dr. Joan Elisabeth Panke Seniorberaterin
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit
 Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit Grußwort von Frau Ministerialrätin Dr. Monika Kratzer bei der Fachveranstaltung zum Thema Patientenorientierung - Selbsthilfeorganisationen und Ärzte
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit Grußwort von Frau Ministerialrätin Dr. Monika Kratzer bei der Fachveranstaltung zum Thema Patientenorientierung - Selbsthilfeorganisationen und Ärzte
Integrierte Versorgung durch Hausärztinnen, Hausärzte und Apotheken
 Integrierte Versorgung durch Hausärztinnen, Hausärzte und Apotheken Hausärztinnen, Hausärzte und Apotheken als Partner der Patientinnen und Patienten und für mehr Qualität und Wirtschaftlichkeit Thomas
Integrierte Versorgung durch Hausärztinnen, Hausärzte und Apotheken Hausärztinnen, Hausärzte und Apotheken als Partner der Patientinnen und Patienten und für mehr Qualität und Wirtschaftlichkeit Thomas
Qualitätsbericht der IKK Brandenburg und Berlin
 Qualitätsbericht der IKK Brandenburg und Berlin nach 137f Abs. 4 Satz 2 SGB V für das Behandlungsprogramm IKKpromed Diabetes mellitus Typ 1 Kalenderjahr 2014 Inhalt PRÄAMBEL... 3 GRUNDLAGEN... 4 IKKpromed-Teilnehmer
Qualitätsbericht der IKK Brandenburg und Berlin nach 137f Abs. 4 Satz 2 SGB V für das Behandlungsprogramm IKKpromed Diabetes mellitus Typ 1 Kalenderjahr 2014 Inhalt PRÄAMBEL... 3 GRUNDLAGEN... 4 IKKpromed-Teilnehmer
Seminar 5 Im Fokus: Netzarbeit konkret - Bestandsaufnahmen und Perspektiven zur vernetzten Versorgung
 Seminar 5 Im Fokus: Netzarbeit konkret - Bestandsaufnahmen und Perspektiven zur vernetzten Versorgung Ergebnisse der Umfrage unter Netzvorständen und -geschäftsführern 1 Steckbrief eingegangene Fragebögen:
Seminar 5 Im Fokus: Netzarbeit konkret - Bestandsaufnahmen und Perspektiven zur vernetzten Versorgung Ergebnisse der Umfrage unter Netzvorständen und -geschäftsführern 1 Steckbrief eingegangene Fragebögen:
Die Regelung wurde eingeführt durch das GKV- Gesundheitsreformgesetz v mit Wirkung vom
 Exkurs Positivliste Der Gesetzgeber hatte in 33 a SGB V bestimmt, dass das BMGS ermächtigt wird, durch Rechtsverordnung eine Liste der verordnungsfähigen Arzneimittel zu erlassen. Die Regelung wurde eingeführt
Exkurs Positivliste Der Gesetzgeber hatte in 33 a SGB V bestimmt, dass das BMGS ermächtigt wird, durch Rechtsverordnung eine Liste der verordnungsfähigen Arzneimittel zu erlassen. Die Regelung wurde eingeführt
Mehr Spielraum für Kooperationsverträge
 4. MSD Forum GesundheitsPARTNER 17. September 2014 Peter Kurt Josenhans AOK Bremen/Bremerhaven Kooperation im Gesundheitswesen > 300.000 Ergebnisse bei google.de Zusammenarbeit der Leistungserbringer Ärzte/Fachdisziplinen
4. MSD Forum GesundheitsPARTNER 17. September 2014 Peter Kurt Josenhans AOK Bremen/Bremerhaven Kooperation im Gesundheitswesen > 300.000 Ergebnisse bei google.de Zusammenarbeit der Leistungserbringer Ärzte/Fachdisziplinen
Qualitätsmessung: Angemessenheit der Indikationsstellung
 Qualitätsmessung: Angemessenheit der Indikationsstellung 3. Berliner Forum der AWMF Gemeinsam klug entscheiden Initiative der AWMF und ihrer Fachgesellschaften Berlin 15. Oktober 2015 Dr. Regina Klakow-Franck,
Qualitätsmessung: Angemessenheit der Indikationsstellung 3. Berliner Forum der AWMF Gemeinsam klug entscheiden Initiative der AWMF und ihrer Fachgesellschaften Berlin 15. Oktober 2015 Dr. Regina Klakow-Franck,
Chancen für die Versorgung durch Telemonitoring und ehealth
 Chancen für die Versorgung durch Telemonitoring und ehealth Dr. Günter Braun Gesundheitsversorgung der Zukunft, 16.04.2010, Bayerischer Landtag, Aristo Telemed ehealth, Telemedizin, Telemonitoring ehealth
Chancen für die Versorgung durch Telemonitoring und ehealth Dr. Günter Braun Gesundheitsversorgung der Zukunft, 16.04.2010, Bayerischer Landtag, Aristo Telemed ehealth, Telemedizin, Telemonitoring ehealth
Der Nationale Normenkontrollrat hat den Regelungsentwurf geprüft.
 Berlin, 5. Juli 2016 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. 6 Abs. 1 NKRG: Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen
Berlin, 5. Juli 2016 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. 6 Abs. 1 NKRG: Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen
Der Gesundheits-Kombi: stabil, gerecht und transparent
 Der Gesundheits-Kombi: stabil, gerecht und transparent Modell einer Gesundheitsprämie mit sozial gestaffelten Beiträgen Die christlich-liberale Koalition will die gesetzliche Krankenversicherung so weiterentwickeln,
Der Gesundheits-Kombi: stabil, gerecht und transparent Modell einer Gesundheitsprämie mit sozial gestaffelten Beiträgen Die christlich-liberale Koalition will die gesetzliche Krankenversicherung so weiterentwickeln,
Onkologie, quo vadis? Stunde der Wahrheit : Alles für alle geht nicht mehr!? Berlin, 6. Februar Ulrich Dietz Bundesministerium für Gesundheit
 7. Lilly Deutschland Jahres-Symposium zur Versorgung von Krebspatienten Onkologie, quo vadis? Stunde der Wahrheit : Alles für alle geht nicht mehr!? Berlin, 6. Februar 2009 Ulrich Dietz Bundesministerium
7. Lilly Deutschland Jahres-Symposium zur Versorgung von Krebspatienten Onkologie, quo vadis? Stunde der Wahrheit : Alles für alle geht nicht mehr!? Berlin, 6. Februar 2009 Ulrich Dietz Bundesministerium
Einflüsse von aktuellen Trends und Stakeholderinteressen auf die Verbreitung von Pervasive Computing im Gesundheitswesen
 Einflüsse von aktuellen Trends und Stakeholderinteressen auf die Verbreitung von Pervasive Computing im Gesundheitswesen Eine interdisziplinäre Betrachtung Andreas Gräfe Institut für Technikfolgenabschätzung
Einflüsse von aktuellen Trends und Stakeholderinteressen auf die Verbreitung von Pervasive Computing im Gesundheitswesen Eine interdisziplinäre Betrachtung Andreas Gräfe Institut für Technikfolgenabschätzung
Tragende Gründe. Vom 22. November Inhalt 1. Rechtsgrundlage Eckpunkte der Entscheidung Verfahrensablauf... 4
 Tragende Gründe zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses zur ambulanten Sanierungsbehandlung von Trägern des Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung
Tragende Gründe zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses zur ambulanten Sanierungsbehandlung von Trägern des Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung
Mitteilung. Aufruf der PEG zum umsichtigen Einsatz von Antibiotika aus Anlass der Veröffentlichung der Pariser WAAAR Deklaration
 Ihr Kontakt: Prof. Dr. Michael Kresken Geschäftsstelle der PEG Tel.: 02226/908 916 Fax: 02226/908 918 Email: geschaeftsstelle@p-e-g.org Rheinbach, 23. Juni 2014 Aufruf der PEG zum umsichtigen Einsatz von
Ihr Kontakt: Prof. Dr. Michael Kresken Geschäftsstelle der PEG Tel.: 02226/908 916 Fax: 02226/908 918 Email: geschaeftsstelle@p-e-g.org Rheinbach, 23. Juni 2014 Aufruf der PEG zum umsichtigen Einsatz von
Herzlich willkommen in Hannover zum BVMed-Forum Homecare ALTENPFLEGE 2014
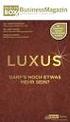 Herzlich willkommen in Hannover zum BVMed-Forum Homecare ALTENPFLEGE 2014 Grundlagen der HOMECARE-Versorgung Zukunftsmodelle in der Homecare-Versorgung Behandlungspfade Hilfsmittelversorgung 2020 Rolle
Herzlich willkommen in Hannover zum BVMed-Forum Homecare ALTENPFLEGE 2014 Grundlagen der HOMECARE-Versorgung Zukunftsmodelle in der Homecare-Versorgung Behandlungspfade Hilfsmittelversorgung 2020 Rolle
Krankenhausversorgung neu geplant Offene Baustellen nach dem KHSG
 6. MSD Forum GesundheitsPARTNER Krankenhausversorgung neu geplant Offene Baustellen nach dem KHSG 14. September 2016 Prof. Dr. Boris Augurzky Problemfelder im Krankenhausbereich im Jahr 2015 1 2 3 4 5
6. MSD Forum GesundheitsPARTNER Krankenhausversorgung neu geplant Offene Baustellen nach dem KHSG 14. September 2016 Prof. Dr. Boris Augurzky Problemfelder im Krankenhausbereich im Jahr 2015 1 2 3 4 5
Versandhandel: Sparen an der Patientensicherheit?
 Versandhandel: Sparen an der Patientensicherheit? Kai Vogel Symposium Fortschritt der Arzneimittelversorgung oder Gesundheitsgefährdung Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 11. Oktober 2007 Gliederung
Versandhandel: Sparen an der Patientensicherheit? Kai Vogel Symposium Fortschritt der Arzneimittelversorgung oder Gesundheitsgefährdung Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 11. Oktober 2007 Gliederung
Holger Jegust. 07. März 2009 Fachhochschule Osnabrück
 Welchen Einfluss nimmt das Vergütungssystem auf die Entwicklung in einem Krankenhaus, medizinische Innovationen einzuführen? 07. März 2009 Fachhochschule Osnabrück Gliederung 1. Einführung 1.1 Vorstellung
Welchen Einfluss nimmt das Vergütungssystem auf die Entwicklung in einem Krankenhaus, medizinische Innovationen einzuführen? 07. März 2009 Fachhochschule Osnabrück Gliederung 1. Einführung 1.1 Vorstellung
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten (Patientenrechtegesetz) München, 29.3.
 Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten (Patientenrechtegesetz) München, 29.3.2012 1 Inhalt Ausgangslage Allgemeines zum Patientenrechtegesetz Änderungen
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten (Patientenrechtegesetz) München, 29.3.2012 1 Inhalt Ausgangslage Allgemeines zum Patientenrechtegesetz Änderungen
Angestellten-Forum des ZVK e. V. Stuttgart, Andrea Wolf
 Angestellten-Forum des ZVK e. V. Stuttgart, 04.03.2016 Andrea Wolf Die externe stationäre Qualitätssicherung am Beispiel der Orthopädie und Unfallchirurgie Implikationen für die Physiotherapie (Aktuelle
Angestellten-Forum des ZVK e. V. Stuttgart, 04.03.2016 Andrea Wolf Die externe stationäre Qualitätssicherung am Beispiel der Orthopädie und Unfallchirurgie Implikationen für die Physiotherapie (Aktuelle
Stellungnahme der Deutschen Rheuma-Liga zum Referentenentwurf
 Stellungnahme der Deutschen Rheuma-Liga zum Referentenentwurf Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstruktur-
Stellungnahme der Deutschen Rheuma-Liga zum Referentenentwurf Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstruktur-
auch aus Sicht der Krankenkassen ist dies hier heute eine erfreuliche Veranstaltung.
 Es gilt das gesprochene Wort. Es gilt das gesprochene Wort. Es gilt das gesprochene Wort. Sehr geehrte Frau Ministerin, meine Damen und Herren, auch aus Sicht der Krankenkassen ist dies hier heute eine
Es gilt das gesprochene Wort. Es gilt das gesprochene Wort. Es gilt das gesprochene Wort. Sehr geehrte Frau Ministerin, meine Damen und Herren, auch aus Sicht der Krankenkassen ist dies hier heute eine
Politische Balance zwischen Innovationsförderung und Kostenkontrolle 10 Thesen
 Innovationen in in der der Onkologie: Was Was ist ist der der Nutzen wert? wert? BDI BDI initiativ-symposium, Berlin, 07.09.2011 Politische Balance zwischen Innovationsförderung und Kostenkontrolle 10
Innovationen in in der der Onkologie: Was Was ist ist der der Nutzen wert? wert? BDI BDI initiativ-symposium, Berlin, 07.09.2011 Politische Balance zwischen Innovationsförderung und Kostenkontrolle 10
Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist: Beginn der Rede!
 Grußwort des Staatssekretärs im Bundesministerium für Bildung und Forschung Dr. Wolf-Dieter Dudenhausen anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereins zur Förderung des Deutschen Forschungsnetzes (DFN)
Grußwort des Staatssekretärs im Bundesministerium für Bildung und Forschung Dr. Wolf-Dieter Dudenhausen anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereins zur Förderung des Deutschen Forschungsnetzes (DFN)
