Detlef Sack Christoph Strünck (Hrsg.) Verbände unter Druck Protest, Opposition und Spaltung in Interessenorganisationen
|
|
|
- Paul Böhme
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Detlef Sack Christoph Strünck (Hrsg.) Verbände unter Druck Protest, Opposition und Spaltung in Interessenorganisationen SONDERHEFT 2/2016
2
3 Detlef Sack Christoph Strünck (Hrsg.) Verbände unter Druck Protest, Opposition und Spaltung in Interessenorganisationen
4 Zeitschrift für Politikwissenschaft
5 Zeitschrift für Politikwissenschaft Christoph Strünck/Detlef Sack Detlef Sack/Christoph Strünck Werner Bührer Beate ohler-och Thomas Haipeter Detlef Sack/Sebastian Fuchs Martin Behrens/Andreas H. Pekarek Wolfgang Schroeder/Sascha ristin Futh/Michaela Schulze Hagen Lesch
6 Rainer Eising Jürgen Mittag/Jörg-Uwe Nieland atharina van Elten Detlef Sack/Christoph Strünck
7 Z Politikwiss (2016) (Suppl 2) 26:1 7 DOI /s z AUFSÄTZE Die Mitgliedschaftslogik der Verbände zwischen Exit und Voice Einleitung Christoph Strünck Detlef Sack Online publiziert: 15. August 2016 Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 Zusammenfassung Die Einleitung des Sonderbands skizziert dessen zentrale Fragestellung. Nachdem sich die Verbändeforschung in jüngerer Zeit vor allem der Einflusslogik von Verbänden gewidmet hat, ist es fruchtbar, wenn nicht notwendig, sich wieder verstärkt der Mitgliedschaftslogik zuzuwenden. Der Organisationswandel von Verbänden beruht sowohl auf deren Management und internen onflikten bzw. Unterstützung als auch auf erheblichen Veränderungen in deren Umwelt. Für die Analyse der Mitgliedschaftslogik erweist sich Hirschmans onzept von Loyalität, Widerspruch und Austritt als instruktiv. Die Einleitung gibt einen Überblick über die einzelnen Beiträge. The logic of membership between exit and voice Introduction Abstract The introduction to the special issue displays its central research question. As interest group research has been dedicated to the analysis of logic of influence in recent years a shift towards the logic of membership appears to be fruitful, if not necessary. The change of associations is based on their management, support from the members, and internal conflicts as well as on the considerable changes of their environment. Hirschman s concept of loyalty, exit, and voice still proves to be inspiring for the analysis of the logic of membership. The introduction gives an overview of the contributions of the special issue. Prof. Dr. C. Strünck Philosophische Fakultät, Politikwissenschaft, Universität Siegen, AR-C 3215, Adolf-Reichwein-Straße 2, Siegen, Deutschland Christoph.Struenck@uni-siegen.de Prof. Dr. D. Sack ( ) Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld, X-C3-210, Universitätsstraße, Bielefeld, Deutschland detlef.sack@uni-bielefeld.de D. Sack, C. Strünck (Hrsg.), Verbände unter Druck, DOI / _1, Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
8 2 C. Strünck, D. Sack Verbände machen Druck: Wie Interessenorganisationen versuchen, Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen, ist ein ernthema politikwissenschaftlicher Forschung. Verbände stehen aber auch unter Druck. Denn ihre Legitimation wird immer wieder in Zweifel gezogen. Wen repräsentieren Verbände überhaupt, führen sie die Öffentlichkeit in die Irre? Auch nimmt die ritik an vermeintlich intransparenten bis korrupten Strukturen des Lobbyismus zu. Zugleich befinden sich viele der klassischen Verbände in einer rise. Mitglieder laufen ihnen weg, der Generationswechsel an der Führungsspitze gestaltet sich schwierig, das eigene wirtschaftliche und politische Umfeld verändert sich radikal. Also: Verbände geraten unter Druck, wenn es in ihnen gärt. Mühsam austarierte onflikte innerhalb der Mitglieder brechen auf, verschiedene Lager führen Machtkämpfe, wirtschaftlicher Wandel verändert Interessenlagen. Solche internen Probleme sind selten Gegenstand politikwissenschaftlicher Forschung. Das hat nicht nur damit zu tun, dass der empirische Zugang schwierig ist. Es hat auch damit zu tun, dass der Abgesang auf die klassischen Mitgliedsorganisationen allgegenwärtig ist. Dieser Meinungskonjunktur folgt offenbar auch die Forschung. Sie widmet sich lieber neuen Formen des Lobbyismus und der politischen ommunikation. Das ist modisch, hat aber auch onsequenzen für die Theorie. Auch wenn die beiden Dimensionen der Einflusslogik und der Mitgliedschaftslogik (Streeck 1991) zu den wichtigsten ategorien der Interessengruppen-Forschung gehören, widmet sich die Zunft fast ausschließlich der Einflusslogik. Das vorliegende Sonderheft beschäftigt sich hingegen vorwiegend mit dem Innenleben von Verbänden, deren Mitgliedschafts- und Organisationslogik. Nach wie vor erwarten politische Entscheidungsträger nicht nur Informationen von den Verbänden. Sie wollen auch wissen, wie die Stimmungslage an der Basis ist, welche Positionen innerhalb der Verbände mehrheitsfähig sind. Wenn Verbände ihre Einflusslogik maximieren wollen, müssen sie solche politischen Informationen liefern und gegebenenfalls auch Positionen innerhalb der Mitgliedschaft vermitteln oder sogar durchsetzen. Ablösen von ihren Mitgliedern können sich die Verbandsführungen jedoch nicht. Manche ziehen ihre Macht vor allem daraus, dass sie die Interessen der Mitglieder ins Feld führen. Allerdings besteht die unst darin, der Mitgliedschaftslogik zu folgen, ohne dass heterogene Interessen die Handlungsfähigkeit oder gar den Bestand des Verbandes gefährden. Insofern prägt die Mitgliedschaftslogik in der Praxis die Strategie von Verbandsführungen, die sie jedoch mit der Einflusslogik austarieren müssen. Aus Sicht der Mitglieder sind ihre eigenen Handlungsoptionen auf den ersten Blick begrenzt. Sind Mitglieder unzufrieden mit ihrem Verband, können sie kritisieren, protestieren, opponieren (Voice) oder den Verband verlassen (Exit). Albert O. Hirschmans klassische ategorien sind für viele Beiträge im vorliegenden Sonderheft ein wichtiger Bezugspunkt (Hirschman 1970). Hirschman selbst hatte sich vor allem mit Unternehmen beschäftigt; Vereinigungen wie Verbände und andere Interessenorganisationen sind ebenfalls ein sehr guter Forschungsgegenstand, um diese etablierte Theorie kollektiven Handelns anzuwenden.
9 Die Mitgliedschaftslogik der Verbände zwischen Exit und Voice Einleitung 3 Zur Exit-Strategie gehört im Übrigen auch, sich nicht weiter ehrenamtlich im Verband zu engagieren, eine Art inneres Exil. Hirschman interessierte sich außerdem dafür, wie loyale Bindungen an Organisationen entstehen. Loyalität im Sinne einer affektiv-emotionalen omponente deutet darauf hin, dass Hirschman die Mitglieder von Organisationen nicht nur als rationale Nutzenmaximierer sah, sondern auch ihre normativen Präferenzen und soziale Zugehörigkeit in den Blick nahm. Dieser letzte Aspekt ist für Gegenwartsanalysen wie im vorliegenden Sonderheft von besonderer Bedeutung. Seit Streecks Diktum vom aussterbenden Stammkunden (Streeck 1987) ist es ein Gemeinplatz, dass es keine natürlichen Mitglieder und Mitgliedermilieus für Verbände mehr gibt. Insofern wäre Loyalität mehr und mehr eine prekäre Ressource für die Verbände; interessanterweise bei relativ gleichbleibender genereller Bereitschaft, sich sozial und politisch zu engagieren (Simonson et al. 2016). Stimmt diese These, so haben wir es in erster Linie mit sozialem Wandel bzw. einer Erosion sozial-moralischer Milieus zu tun, der auch Interessengruppen erfasst. Dies wäre eine makrosoziologische Erklärung dafür, warum etablierten Verbänden die Mitglieder ausgehen und sie nur schwer neue finden. aum erklären kann diese makrosoziologische Perspektive allerdings, warum in Verbänden in der letzten Zeit immer wieder onflikte aufbrechen und sich manche Verbände sogar spalten. Unterstellt man, dass für Verbandsmitglieder ein osten-nutzen alkül an Bedeutung gewonnen hat, dann geraten die Marktbedingungen in den Blick. onflikte bis hin zur Spaltung können auch damit zu tun haben, dass sich die ökonomische Umwelt so stark verändert hat, dass die Interessenlagen der Mitglieder immer heterogener werden. Wirtschaftlicher Strukturwandel, der auf solchen Großtendenzen wie etwa der Transnationalisierung der Wertschöpfungsketten und der Digitalisierung von Industrie und Dienstleistungen beruht, aber auch mit neuen unternehmerischen Strategien (etwa der Untervertragsvergabe oder IT-Dienstleistungsauktionen) einhergeht, führt zu deutlichen Interessenunterschieden zwischen Unternehmen. Veränderte Marktbedingungen erwachsen auch aus politischen Entscheidungen. Aktuelle Beispiele dafür sind die Energiebranche oder das Wachstum der Bio-Landwirtschaft. In Extremfällen spalten sich Verbände, wie zum Beispiel in der Pharmaindustrie, in der Milchwirtschaft oder im Einzelhandel. Politische Regulierung oder der Strukturwandel einzelner Branchen sind die wesentlichen Ursachen dafür. Es kann aber auch verbandsinterne Gründe für wachsende onflikte geben. Es mag sein, dass einzelne, besonders einflussreiche Mitglieder mit den Leistungen ihres Verbandes nicht mehr zufrieden sind. Das kann die Qualität von konkreten Dienstleistungen betreffen oder aber auch das politische Geschick, zwischen Lagern im Verband zu vermitteln und Positionen zu finden. Und hier schließt sich der reis zu den sozial-moralischen Milieus. Wenn traditionelle Loyalitäts-Bindungen an Organisationen schwinden und rationale osten-nutzen-alküle zunehmen, so steigen möglicherweise auch die Erwartungen der Mitglieder an das Leistungsangebot der Verbände. Es macht Sinn, zwischen den Faktoren soziale Milieus, politische und wirtschaftliche Umwelt sowie Leistungen des Verbandes zu unterscheiden. Ob es verstärkt zu Voice oder auch Exit kommt, wie sehr Verbände überhaupt noch auf Loyalität setzen können, hängt von diesen drei Faktoren und ihren Wechselwirkungen ab.
10 4 C. Strünck, D. Sack Das ist aber nur ein sehr allgemeiner analytischer Rahmen für das, was den inhaltlichen Fokus dieses Sonderheftes ausmacht. Die zwei theoretisch, historisch und polit-ökonomisch wichtigsten Verbandstypen bilden den Mittelteil des Bandes: Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften. Beide haben damit zu kämpfen, dass sich Branchen massiv verändern und Regierungen zugleich die Bedingungen der Interessenvermittlung verändern: durch neue Produktstandards, gesetzliche Mindestbedingungen oder Neuregelungen in Arbeitsmarktregimen. An diesen auch für die Verbändeforschung zentralen Feldern lässt sich zeigen, wie verbandsinterne onflikte zu Steuerungsproblemen werden und warum Mitglieder nach wie vor eine relevante Größe sind, um die Handlungsfähigkeit von Verbänden zu erklären. Es geht dabei nicht immer nur um konkrete Aktionen aus und in der Mitgliedschaft: Es reichen schon die Anforderungen der Mitglieder und wie Verbandsführungen diese Erwartungen wahrnehmen. Auf die Mitglieder und deren Einflussmöglichkeiten konzentriert sich auch der dritte Themenblock. In so unterschiedlichen Sphären wie dem Euro-Lobbying, Ärzteorganisationen oder Sportverbänden offenbaren sich die Bedingungen und onsequenzen innerverbandlichen Protests und wo der Einfluss der Mitglieder auf ihren Verband versiegt. Einfluss kann nur ausüben, wer eine erkennbare Position hat. Und diese Position hängt maßgeblich davon ab, wie die Integrationsfähigkeit der Verbände nach innen ist. Vor allem aber müssen Verbandsführungen erst einmal erkennen können, welche Bedürfnisse und Interessen ihre Mitglieder haben. Was theoretisch so trivial klingt, ist häufig genug in der Praxis ein Problem. Die Beiträge der Autorinnen und Autoren nehmen verschiedene Verbandstypen und Politikfelder in den Blick. Ein gemeinsamer Ausgangspunkt und Topos ist Heterogenität: der Mitgliederinteressen, der Verbandsleistungen, der Verbandstypen. Detlef Sack und Christoph Strünck konzentrieren sich im einleitenden theoretischen Beitrag auf Güter und Leistungen von Verbänden. Unterschieden werden Verbände mit individuellen Mitgliedern und Meta-Verbände, die Organisationen und komplexe Akteure als Mitglieder haben, etwa Unternehmen. Sack und Strünck gehen davon aus, dass Verbände sehr unterschiedliche Güter produzieren und dies unterschiedlich gut machen. Dabei geht es nicht nur um die bekannten privaten und kollektiven Güter, sondern auch um spezifische Clubgüter wie das brokering in Meta-Organisationen oder die soziale Vergemeinschaftung in Assoziationen mit Individuen als Mitglieder. Welchen Bedarf an Gütern die Mitglieder haben und wie sie die Qualität der angebotenen Verbandsgüter einschätzen: Daran entscheidet sich, ob Verbände im größeren Stil mit Exit und Voice zu rechnen und zu kämpfen haben. Die Leistungen des Bundesverbandes der Deutschen Industrie scheinen bislang keinen Anlass zu größerer ritik zu geben. Dennoch kämpft auch der BDI mit internen onflikten, die dieser größte Wirtschaftsdachverband aber zu moderieren versteht, wie Werner Bührer in seinem zeithistorischen Beitrag dokumentiert. Seit der Gründung der Bundesrepublik hatte der Nachfolgeverband des Reichsverbandes der Deutschen Industrie mit internen Protesten um Gesetzesvorhaben und die richtige organisationspolitische Strategie zu kämpfen. Bis heute entstand daraus keine manifeste Opposition oder gar ein echter onkurrenzverband. Dies liegt unter anderem daran, dass der frühere Interessenkonflikt zwischen Rohstoff-Förderern und
11 Die Mitgliedschaftslogik der Verbände zwischen Exit und Voice Einleitung 5 produzierender Industrie heute nicht mehr prägend ist. Für einen echten Gegenverband gibt es daher keine Gründe. Auch Beate ohler-och widmet sich in ihrem Beitrag der deutschen Industrie und ihren Branchen-Interessenvertretungen. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen ist ein zentrales Dilemma: Der Einfluss der Verbände steigt, wenn sie sich auf eine möglichst breite Mitgliederbasis stützen können. Je breiter diese jedoch ist, desto schwieriger fällt es den Verbandsführungen, interne Heterogenität in aggregierte Interessen umzumünzen. Beate ohler-och vermisst die Heterogenität der Verbandslandschaft, indem sie zahlreiche Indikatoren für Heterogenität nutzt. Trotz erstaunlicher Erfolge des BDI zeigt der Beitrag, dass Branchenwandel und andere Faktoren die Integrationsfähigkeit der Wirtschaftsverbände schwächen. Thomas Haipeter analysiert die Strategie von Arbeitgeberverbänden, unzufriedene und potentielle Mitglieder mit Sondermitgliedschaften ohne Tarifbindung zufriedenzustellen. Anhand von fünf Untersuchungsbranchen zeigt Haipeter, dass neben strukturellen ökonomischen Veränderungen die Arbeitgeberverbände unterschiedliche Strategien mit dem OT-Angebot verfolgen. Es geht hier nicht allein um die Verbesserung der Verhandlungsposition in Tarifauseinandersetzungen, sondern auch um eine mittelbare Mitgliederbindung. Überdies sind OT-Arbeitgeberverbände nicht in allen Branchen gleichermaßen von Bedeutung. Detlef Sack und Sebastian Fuchs beschäftigen sich mit oppositionellen Bewegungen in Wirtschaftskammern, das heißt in den Industrie- und Handels-, den Handwerks- und der Wirtschaftsprüferkammer. Obwohl oder vielleicht auch gerade weil es sich bei diesen Organisationen um Zwangskörperschaften mit Pflichtmitgliedschaft handelt, bescheren Hirschmans ategorien Exit, Voice und Loyalty auch hier besondere Einsichten. Sack und Fuchs machen deutlich, dass es verschiedene Stufen von Voice und auch von Exit gibt. Eigentlich verlassen können die Mitglieder die Organisation zwar nicht. Doch der Rückzug aus Ehrenämtern, die Unterstützung kritischer räfte innerhalb der Führungsgremien und die Beteiligung an einer kammerkritischen Oppositionsbewegung sind Alternativen. Zwar bedroht dieses Protestrepertoire die ammern nicht in ihrem Bestand. Dafür befördert es jedoch einen graduellen Wandel dieser traditionellen Interessenvertretungen. Martin Behrens und Andreas Pekarek eröffnen mit ihrem Beitrag den Themenblock über onflikte innerhalb und zwischen Gewerkschaften. Sie konstatieren, dass es auch im deutschen Gewerkschaftssystem verschiedene Lager gibt, die sich voneinander abgrenzen lassen. Zugleich haben sich seit den 1960er-Jahren immer wieder Allianzen zwischen Gewerkschaften gebildet, nicht immer entlang der Lagergrenzen. Je nach politischem Thema kommt es zu lagerübergreifenden Allianzen, die in der jüngsten Zeit auch häufiger werden. Was aus analytischer Perspektive als rationaler Prozess erscheinen mag, ist jedoch in der Praxis häufig ein emotional aufgeladener onflikt, der die Gewerkschaften herausfordert. Wolfgang Schroeder, Sascha ristin Futh und Michaela Schulze fragen, warum es um die Einführung eines Mindestlohns onflikte zwischen den DGB-Gewerkschaften gab. Gewerkschaften mit hohem Organisationsgrad und hohem Lohnniveau wollten die Tarifautonomie nicht durch einen Mindestlohn indirekt eingeschränkt sehen. Andere Gewerkschaften mit Organisationsschwächen hofften hingegen auf staatlichen Beistand. Ein Ausweg aus diesem onflikt war ein Formelkompromiss
12 6 C. Strünck, D. Sack unter der Flagge des DGB. Der Beitrag zeigt daher auch, welche Puffer- und Bypass-Funktion Dachverbände haben können, wenn die Mitgliedsorganisationen unterschiedliche Interessenlagen haben. Hagen Lesch greift ein Phänomen auf, dass nicht neu ist, aber für neue Schlagzeilen sorgt: die so genannten Sparten- oder Berufsgewerkschaften wie die Vereinigung Cockpit oder die Gewerkschaft der Lokomotivführer Deutschlands. Am Beispiel vergangener Tarifrunden kann Hagen Lesch zeigen, dass die Spartengewerkschaften tatsächlich deutlich konfliktorientierter waren, auch gegenüber Gewerkschaften in der eigenen Branche. Allerdings hat dies offenbar nicht dazu geführt, dass die Mitglieder dieser Gewerkschaften finanzielle Vorteile gegenüber den Mitgliedern anderen Gewerkschaften hätten. Im Vordergrund der zwischengewerkschaftlichen Auseinandersetzungen stehen ohnehin Statuskonflikte und weniger Verteilungsfragen. Im letzten Themenblock, der den Einfluss von Mitgliedern in unterschiedlichen Verbandstypen und -ebenen untersucht, macht Rainer Eising den Auftakt. Er fragt sich, ob und wann Mitglieder von europäischen Interessenverbänden ausscheren und andere oalitionen suchen, weil sie unzufrieden mit ihrer Interessenvertretung sind. Wenn sie ritik an der Informationspolitik haben und ihre Präferenzen nicht ausreichend berücksichtigt sehen, suchen Unternehmen tatsächlich andere Allianzen auf EU-Ebene. Die europäischen Verbände reagieren darauf, indem sie ihre Informationspolitik verbessern und bei ihrer Interessenaggregation auch größere Unterschiede zwischen Mitgliederinteressen berücksichtigen. Jürgen Mittag und Jörg-Uwe Nieland widmen sich mit der FIFA einem der einflussreichsten internationalen Sportverbände. Obwohl die FIFA wahrscheinlich die weltweit erfolgreichste Monopolorganisation ist, gibt es erhebliche innere onflikte, und das nicht erst seit den jüngsten orruptionsskandalen. Mittag und Nieland analysieren, warum diese onflikte dennoch keine schlagkräftige Oppositionsbewegung in Gang bringen. Die ombination aus Stimmrechten und Verteilungsmasse sorgt dafür, dass die FIFA ein durchaus plurales Gebilde ist, dessen Führung jedoch in ernfragen Interessenkongruenz herstellen kann. atharina van Elten schaut zum Schluss auf eine Profession, die dank ihrer Geschlossenheit lange Zeit zu den erfolgreichsten gehörte: die Ärzteschaft. Selbst die durch die Pflichtmitgliedschaft stabilisierten Ärztekammern und assenärztlichen Vereinigungen sind unter Druck geraten. Stärkere Verteilungs- und Statuskonflikte zwischen verschiedenen Ärztegruppen tragen die onflikte auch in selbstverwaltete örperschaften hinein. Hier haben die Ärztekammern aufgrund des pluralisierten Rollenverständnisses ihrer Mitglieder weniger Integrationsprobleme als die Ven. Deren Schwerpunkt in der Honorarpolitik inspiriert immer mehr Mitgliedsgruppen zum Voice, bis hin zu Putschversuchen an der Führungsspitze. Dennoch vermuten Teile der Ärzteschaft, dass onflikte auch von der Gesundheitspolitik forciert werden, um gesundheitspolitische Entscheidungen leichter durchsetzen zu können. Alle Beiträge des Bandes zeigen, dass Mitglieder für die Verbände nicht nur als Ressource relevant sind. Viele Verbände versuchen, ihre Responsivität gegenüber Mitgliedern zu erhöhen, weil zu starke Unzufriedenheit die Integrationsfähigkeit schwächt. Unzufrieden sind Mitglieder nicht nur dann, wenn die Qualität der Verbandsleistungen nicht stimmt. Unzufrieden sind häufig ganz bestimmte Mitglieder, weil sie in einer heterogenen Mitgliedschaft aus ihrer Sicht zu wenig Gehör finden,
13 Die Mitgliedschaftslogik der Verbände zwischen Exit und Voice Einleitung 7 oder die Verbandsgüter nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wenn Verbandsführungen ihre Responsivität erhöhen, kann das auch onsequenzen für die Leistungen und Güter der Verbände haben. Unzufriedenheit sagt daher zwar auch etwas über die Performance von Verbänden aus. Sie ist aber vor allem ein Indikator für innerverbandliche Fliehkräfte. Wie diese wirken und wie Verbände diesen mit unterschiedlichen Verbandsgütern entgegenwirken, loten wir im folgenden theoretischen Einleitungsbeitrag aus. Im Epilog zu diesem Sonderheft greifen wir zentrale theoretische Einsichten und empirische Erkenntnisse noch einmal auf. Literatur Hirschman, Albert O Exit, voice, and loyalty. Responses to decline in firms, organizations, and states. Cambridge: Harvard University Press. Simonson, Julia, Claudia Vogel, und Clemens Tesch-Römer Freiwilliges Engagement in Deutschland. Der Deutsche Freiwilligensurvey Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen. Streeck, Wolfgang Vielfalt und Interdependenz. Überlegungen zur Rolle der intermediären Organisationen in sich ändernden Umwelten. ölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 39(3): Streeck, Wolfgang Interest Heterogeneity and Organizing Capacity. Two Class Logics of Collective Action? In Political choice. Institutions, rules, and the limits of rationality, Hrsg. Roland M. Czada, Adrienne Windhoff-Heritier, und Hans eman, Frankfurt a.m.: Campus.
14 I. Theoretischer ontext
15 Z Politikwiss (2016) (Suppl 2) 26:11 33 DOI /s y AUFSÄTZE Austritt und Widerspruch in Interessenorganisationen. Eine güter-zentrierte Theorie zur Analyse innerverbandlicher onflikte Detlef Sack Christoph Strünck Online publiziert: 15. August 2016 Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 Zusammenfassung Der Beitrag konzentriert sich auf die Güter und Leistungen von Verbänden. Detlef Sack und Christoph Strünck geht es nicht nur um die bekannten privaten und kollektiven Güter, sondern auch um spezifische Clubgüter wie das brokering in Meta-Organisationen oder die soziale Vergemeinschaftung in Assoziationen mit Individuen als Mitglieder. Welchen Bedarf an Gütern die Mitglieder haben und wie sie die Qualität der angebotenen Verbandsgüter einschätzen, daran entscheidet sich, ob Verbände im größeren Stil mit exit und voice zu rechnen und zu kämpfen haben. Exit and voice in interest groups An asset-oriented theory for the analysis of intra-associational conflicts Abstract The article focuses on goods and services that associations provide. Detlef Sack and Christoph Strünck not only care about private and collective goods. Additionally, they analyze specific club goods such as brokering in organizations with corporate members and community building in those with individuals as members. What members need and how they assess the goods quality is pivotal to avoid exit and voice in associations. Für hilfreiche ommentare und ritik bedanken wir uns bei atharina van Elten, Martin och, Helmut Voelzkow und den beiden anonymen Gutachtern. Prof. Dr. D. Sack ( ) Fakultät für Soziologie X-C3-210, Universität Bielefeld, Universitätsstrasse, Bielefeld, Deutschland detlef.sack@uni-bielefeld.de Prof. Dr. C. Strünck Philosophische Fakultät, Politikwissenschaft AR-C 3215, Universität Siegen, Adolf-Reichwein-Straße 2, Siegen, Deutschland Christoph.Struenck@uni-siegen.de D. Sack, C. Strünck (Hrsg.), Verbände unter Druck, DOI / _2, Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
16 12 D. Sack, C. Strünck 1 Einleitung Die Integrationskräfte etablierter Verbände und Interessengruppen schwinden seit Jahren. Inner- und außerverbandlicher Protest nimmt zu, Verbände spalten sich, kleinere, spezialisierte Interessengruppen treten auf den Plan. Die Pharmaindustrie und der Einzelhandel sprechen nicht (mehr) mit einer Stimme, in der Ärzteschaft brodeln die Verteilungskonflikte. Im Jahr 2016 trat mit der Steag einer der größten Energieversorger aus seinem Branchenverband aus. Selbst die durch Pflichtmitgliedschaft privilegierten ammern haben es mit einer gewachsenen Oppositionsbewegung zu tun (Sack/Fuchs sowie van Elten in diesem Band). Die Verbändeforschung nimmt derzeit kaum Notiz von diesen Entwicklungen. Nach wie vor dominiert der Diskurs über professionalisierten Lobbyismus. Phänomene wie Protest und Opposition innerhalb und außerhalb von Verbänden werden hingegen kaum wahrgenommen, geschweige denn analysiert. Im Folgenden stellen wir Formen von Widerspruch und Abwanderung in etablierten Verbänden dar und loten deren onsequenzen aus. Dabei werden wir uns maßgeblich auf Hirschmans Ansatz zu Abwanderung und Widerspruch (Hirschman 2004 [1970]) beziehen und diesen theoretisch-konzeptionell erweitern. 1 Mit Blick auf die Bedarfe in Verbänden identifizieren wir zwei unterschiedliche, zentrale Clubgüter: für die Verbände mit individuellen Mitgliedern die soziale Vergemeinschaftung und für die Meta-Organisationen, deren Mitglieder Organisationen sind, die kompromissorientierte Mediation. Unsere theoretisch-konzeptionellen Überlegungen ordnen sich in die Debatten der Verbändeforschung ein (Lang et al. 2008), die sich holzschnittartig betrachtet in drei Teilen entfaltet. Es gibt erstens diejenigen Analysen der Lobby- und Population Ecology-Forschung, die sich mit dem politischen Einfluss der Verbände befassen. Die Lobbytätigkeit wird dabei sowohl im Hinblick auf die staatlichen Akteure, die beeinflusst werden sollen, als auch im Hinblick die onkurrenz von Verbänden in der organisatorischen Ökologie von Assoziationen untereinander betrachtet. Die zentrale Fragestellung ist, ob und wie es Verbänden gelingt, in onkurrenz zu anderen Verbänden und mit Hilfe bestimmter Ressourcen (Informationen, Geld, Wählerstimmen) politische Entscheidungen in ihrem Sinne zu beeinflussen (z. B. Lowery und Gray 2004; Baumgartner et al. 2009; Eising et al. 2015; Bernhagen et al. 2015; Paster 2015). Diese Forschung scheint derzeit gerade mit Blick auf die Europäische Union sehr gut aufgestellt (z. B. Beyers et al. 2014; lüver et al. 2015; s. a. von Blumenthal und von Winter 2014). Der zweite Forschungsstrang kombiniert die neo-korporatistische Forschung (Traxler 1986; Czada 1994; Schmitter und Streeck 1999) mit der Varieties of Capitalism-Forschung (Hall und Soskice 2001) und konzentriert sich auf zwei Fragestellungen. Die erste lautet, wie sich eigentlich Verbände mit Unterstützung von Staat und Politik konstituiert haben und warum ihnen öffentliche Aufgaben und ompetenzen zur Selbst-Regulierung übertragen wurden (Martin und Swank 2012). Die zweite Fragestellung zielt daher darauf ab, wie sich das (im Fokus 1 Für eine Anwendung des Ansatzes von Hirschman in der Parteienforschung vgl. Stoy und Schmid (2011).
17 Austritt und Widerspruch in Interessenorganisationen 13 stehende) enge Bündnis zwischen Staat und Verbänden unter den Bedingungen fortschreitender ökonomischer Globalisierung, informationstechnologischen Wandels und regulatorische Liberalisierung verändert hat. Es werden Zweifel laut, ob korporatistische Arrangements überhaupt noch effektiv sind (Martin und Swank 2012, S. 128 ff.; Paster 2015, S. 21 ff.). Auch dieser Forschungsstrang scheint uns in der Debatte um den aktuellen Wandel von Staat und apitalismus sehr präsent. Der dritte Forschungsstrang zielt auf die Beziehungen innerhalb der Verbände ab, die als offene Organisationen in einer Umwelt betrachtet werden (Scott 1998; Lang et al. 2008, S. 34 ff.). Von Belang sind hier die Mitgliedschaftslogik, also etwa die interne Interessenaggregation und der Ressourcentausch zwischen Mitgliedern und Organisation (Berkhout 2013, S. 234 ff.), wie auch die Interaktion zwischen den Mitgliedern und dem hauptamtlichen Apparat des Verbandes (Schmitter und Streeck 1999, S. 65 ff.). Die,klassische Fragestellung bleibt diejenige nach der,logik der kollektiven Organisierung (Olson 1998 [1965]). Die onstitution der Verbände wurde in der Forschung zu Pluralismus, in der Neuen Politischen Ökonomie sowie in der Austauschtheorie bearbeitet (Sebaldt 2006, S. 15 ff.). Hierbei standen etwa die Präferenzen der Mitglieder und ihre shared attitudes (Truman 1971 [1951], S. 33 ff.), das Problem des Free-Ridings oder das Angebot des Verbandes im Blick, also die Anreize, die von einer Organisation geschaffen wurden. Der starting point ist derjenige Entrepreneur, der möglichen Mitgliedern ein Angebot unterbreitet (Salisbury 1969, S. 11 f.). Die dritte Fragestellung lautet daher, wie Verbände unter der Bedingung erheblichen sozioökonomischen Wandels bestehen bleiben können (s. unten). Welche internen onflikte zeigen sich bei Umweltwandel in der Mitgliedschaft? Wie gelingt es Verbänden, ihre Mitglieder an sich zu binden (und damit ihren Bestand zu sichern)? Dies sind aktuelle Fragestellungen, die jedoch derzeit in der Verbändeforschung kaum bearbeitet werden. Unser theoretischer Beitrag sortiert sich in diesen dritten Forschungsstrang ein und basiert auf einer Renaissance und Neufassung der Tauschtheorie (Salisbury 1969; Groser 1979; Berkhout 2013), unter besonderer Berücksichtigung des Bedarfs an Clubgütern seitens der Mitglieder (Bennett und Robson 2001). Wir verlagern also den Fokus innerhalb der Mitglied-(Verband-)Unternehmer-Beziehung. Dieser liegt bisher auf der Seite der aktiven Entrepreneure und der Anreize, die gegeben werden (Salisbury 1969). Damit ist eine Tendenz verbunden, die Mitgliedschaft als zu sozialisierende und disziplinierende,unterstützungsmasse zu betrachten (Berkhout 2013, S. 234 f.). Wir richten hier aber den Blick auf die Mitglieder als eigenwillige Akteure mit bestimmten Präferenzen. Damit rücken wir Bedürfnisse und Bedarfe der Mitglieder als erklärenden Faktor der Verbandsentwicklung wieder stärker in den Mittelpunkt. Die Relevanz unserer Überlegung ergibt sich nicht allein aus dem derzeitig defizitären Forschungsstand. Denn Einflussnahme ist auf ganz unterschiedliche Weise daran gekoppelt, wie die Interessen von Mitgliedern aggregiert werden. Theoretisch-konzeptionell schließen wir, wie oben angedeutet, an Hirschmans Überlegungen zu Abwanderung und Widerspruch an (Hirschman 2004 [1970]). Wir gehen davon aus, dass immer weniger Mitglieder loyal zu ihren Verbänden stehen. Prozesse der gesellschaftlichen Individualisierung und Pluralisierung verstärken die
18 14 D. Sack, C. Strünck zweckrationale Orientierung in Interessenorganisationen, gefühlsmäßige, traditionelle Bindungen schwinden, Loyalität abnimmt und Abwanderung steigt (Beck 1993). Verbandsführungen ihrerseits können sich nicht vollständig sicher sein, welche Bedarfe die Mitglieder an die jeweilige Assoziation adressieren und wie Mitglieder ihre Leistungen einschätzen. Wir unterscheiden grundsätzlich zwei lassen von Verbänden. Die einen etwa Gewerkschaften, Umweltschutzverbände, Sozialverbände, aber auch Sportvereine und ulturinitiativen haben natürliche Personen und Individuen als Mitgliederbasis. Die anderen Verbände kennen juristische Personen und Organisationen als Mitglieder. Dazu gehören etwa Dachverbände und Verbandsverbände, wie etwa die FIFA, der DGB, der BDI oder der Bundesverband Erneuerbare Energien. Diese Meta-Organisationen (Ahrne und Brunsson 2008) folgen, so unsere zentrale Annahme, einer erkennbar anderen Mitgliedschaftslogik als Verbände, die Individualmitglieder haben. 2 Solche Meta-Organisationen können in ihrer Mitgliedschaft wiederum unterschiedliche onstellationen aufweisen: eine relative Ressourcensymmetrie, ein fokales Mitglied als dominanten Akteur oder zwei gleich große Lager in der Mitgliedschaft. Meta-Organisationen tauchen also in drei verschiedenen Varianten der Mitgliedschaftslogik auf. Somit unterscheiden wir insgesamt vier verschiedene Typen von Mitgliedschaft: die klassische individuelle Mitgliedschaft sowie drei Varianten in Verbänden mit korporativen, organisierten Mitgliedern, bei denen Macht- und Ressourcenverteilung erkennbar differieren. Wir erweitern Hirschmans Überlegungen zu Abwanderung, Widerspruch und Loyalität in zwei Schritten. Für die Verbände mit Individualmitgliedschaft verfolgen wir die Entwicklung von Protest und onflikt auf der Basis des von Opp (2009) vorgelegten onzepts zu sozialen Bewegungen. Es befasst sich mit Wahrnehmungen, ompetenzen und Anreizen für Personen. Für Verbände, deren Mitglieder Organisationen sind, nutzen wir das onzept der Meta-Organisationen (Ahrne und Brunsson 2008). Dabei beziehen wir vor allem die Forschung zu Unternehmensverbänden mit ein als demjenigen Forschungszweig, der sich wiederholt mit dem Verhältnis von Assoziation und ressourcenstarken Mitgliedern befasst hat. In einem weiteren Schritt argumentieren wir, dass sich der Leistungsrückgang (Hirschman 2004 [1970], S. 3) von Verbänden besser erfassen lässt, wenn man diesen auf zwei spezifische, vom Verband zu erbringende Clubgüter bezieht. Verbände mit individueller Mitgliedschaft müssen neben individuellen Gütern und Dienstleistungen auch die soziale Vergemeinschaftung in ihr Leistungsportfolio aufnehmen. Meta- Organisationen hingegen stellen angesichts einer Mitgliedschaft mit unterschiedlichen Interessen und Ressourcen vor allem Güter her wie Mediation, Brokering und 2 Der grundsätzliche Unterschied zwischen Individuen und Organisationen liegt darin, dass Organisationen einen höheren Grad der Spezifikation ihrer Ziele ebenso auf wie eine höhere apazität und bessere Ressourcenausstattung aufweisen, ihre Ziele auch zu verfolgen. Wir definieren Organisationen in diesem Zusammenhang als natürliche Systeme (Scott 1998, S. 56 ff.), die in sich selbst komplex und auf das Überleben in einer (ggf. turbulenten) Umwelt ausgerichtet sind, unterschiedliche Formalisierungsgrade aufweisen und unterschiedliche, nicht stets ausgewiesene Ziele verfolgen. Uns ist dabei durchaus bewusst, dass es sich hier um eine idealtypische Unterscheidung zwischen Organisation und Individuum handelt, wie man etwa bei kleinen, familiengeführte Unternehmen sehen kann.
19 Austritt und Widerspruch in Interessenorganisationen 15 ompromissfindung. Die empirische Verbändeforschung sollte daher nicht nur prinzipiell wieder stärker die Binnenlogik von Interessenorganisationen beachten. Sie sollte genauer analysieren, welche unterschiedlichen Bedürfnisse individuelle und organisierte Mitglieder anmelden und wie sie ihre Verbandsführungen und Verbandsgüter bewerten. 2 Erscheinungsformen der Unzufriedenheit Das management of diversity (Schmitter und Streeck 1999, S. 15), auf dem Verbände und andere Interessenorganisationen beruhen, wird aus drei Richtungen herausgefordert. Erstens durch eine sich verändernde Umwelt (Makro-Ebene), deren Wandel mit neuen externen Anforderungen an die Assoziationen einhergeht (vgl. Abschn. 3). Zweitens durch veränderte Unterstützung und Forderungen einer im Wandel befindlichen Mitgliedschaft (Mikro-Ebene). Und drittens durch endogene Prozesse organisatorischer Differenzierung, Verselbstständigung und der Herstellung neuer Güter (Meso-Ebene). ombiniert man die drei ategorien Umweltanforderungen, Zusammensetzung der Mitgliedschaft und Organisationslogik in jeweils dichotomer Ausprägung (Stabilität/Wandel), dann lässt sich erahnen, wie unterschiedlich die Anforderungen an Verbände sein können. Nimmt man vor diesem Hintergrund die mögliche Unzufriedenheit von Mitgliedern in den Blick, dann zeigt diese sich in folgenden Formen. Allseits bekannt ist der Mitgliederrückgang in großen etablierten Verbänden, etwa bei den DGB-Einzelgewerkschaften, auch wenn dieser derzeit nicht weiter anzuhalten scheint (DGB 2016). Beim Austritt aus der Gewerkschaft handelt es sich klassisch um die Wahrnehmung der Exit-Option im Sinne von Hirschman. 3 Diese kann eine besondere Gestalt annehmen, wenn Mitglieder aus bestehenden Assoziationen austreten und alternative bzw. oppositionelle Verbände gründen, die eine spezifische Mitgliedschaftsgruppe organisieren und andere Forderungen gegenüber ihrer Umwelt vertreten. In diesem Zusammenhang ist etwa an die Spaltung und Desintegration von Branchenverbänden in der Pharmaindustrie (Lang und Schneider 2007, S. 230 f.), im Handel oder in der Energiewirtschaft zu denken. Dazu gehört auch die in der Öffentlichkeit aufgrund ihrer Streikfähigkeit stärker wahrgenommene neue Bedeutung von Spartengewerkschaften wie etwa der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) oder der Pilotenvereinigung Cockpit (Schroeder et al. 2011; Lesch in diesem Band). Mitglieder verlassen also nicht einfach nur ihre Organisation, sondern treten einer anderen bei und werten sie damit auf. Ein partielles Opting-out findet dann statt, wenn Mitglieder mit dem Leistungsvermögen des Verbandes unzufrieden sind und sich mehr davon versprechen, ihre Interessen individuell zu verfolgen. Das kann dazu führen, dass Public Affairs Agenturen mit Tätigkeiten betraut werden, die eigentlich zum Aufgabenbereich von Verbänden gehören. Auch die Verbreitung von OT-Arbeitgeberverbänden gehört zu dieser Artikulationsform von Unzufriedenheit (Haipeter 2010; Behrens 2011; Haipeter in diesem Band). 3 Für Unternehmensverbände vgl. Helfen (2006) und Silvia (2010).
20 16 D. Sack, C. Strünck Eine eher leise Exit-Option besteht darin, die formale Mitgliedschaft zwar aufrechtzuerhalten, die aktive Beteiligung und das Engagement in der jeweiligen Assoziation jedoch zu suspendieren und sich auf eine passive Mitgliedschaft zurückzuziehen (Westdeutscher Handwerkskammertag 2005). Dieser Rückzug aus dem Engagement in der Assoziation ist jedoch nur dann von Belang, wenn dadurch das Leistungsvermögen und die Legitimität gegenüber der Umwelt nachhaltig beeinträchtigt werden, insofern sie ihre apazitäten zur participation in public policy (Traxler 2010, S. 163) einbüßen. Im Sinne der Voice-Option äußern Mitglieder ihre Unzufriedenheit, wenn in den entsprechenden Gremien inhaltliche und personelle Alternativen präsentiert, diskutiert und gegebenenfalls entschieden werden; also eine interne ritik formuliert wird. Die Effekte für die Organisationen können dabei durchaus unterschiedlich sein. Interne ritik kann zu Reformen und angemessener Anpassung an die Umwelt führen, ebenso wie zu einer internen Blockade der Organisation aufgrund grundlegender (personalisierter) Differenzen. Diese lösen dann wiederum den Exit aus. Es kommt vergleichsweise selten vor, dass von unzufriedenen Mitgliedern von außen ritik an Assoziationen geübt wird (externe Voice). Dies geschieht insbesondere dann, wenn es sich um Interessenorganisationen mit Zwangsmitgliedschaft handelt; so etwa bei österreichischen und deutschen Wirtschaftskammern, denen inzwischen externe Oppositionsbewegungen gegenüberstehen (Sack und Fuchs in diesem Band). Wie Mitglieder ihre Unzufriedenheit äußern, hängt maßgeblich vom Grad ihrer Loyalität ab. Dieser Schlüsselbegriff (Hirschman 2004 [1970], S. 70) ist bei Hirschman als ategorie eher vage bestimmt. Es kann sich sowohl um rationale Erwartungen als auch um eine längerfristige, stabile psychologische Bindung an eine Organisation handeln. Sind Mitglieder nur begrenzt loyal, werden sie bei Unzufriedenheit mit den Leistungen ihres Verbands am ehesten austreten, also Exit wählen. Steigt ihre Loyalität, so ist es wahrscheinlicher, dass sie ritik üben, also die Option Voice nutzen. Sehr loyale Mitglieder, die unzufrieden sind, werden ihre ritik aller Wahrscheinlichkeit nach zurückhalten und nichts unternehmen (Hirschman 2004 [1970], S. 65 ff.). Diese Form des Neglect hatte Hirschman nicht explizit ausgearbeitet; sie ist jedoch ebenfalls eine relevante Verhaltensweise von Mitgliedern, die Verbänden unter Stress eine gewisse Stabilität gibt (Bajoit 1988; Barry 1974). 3 Struktur der Mitgliedschaft Eine der gängigen Unterscheidungen von Interessenorganisationen ist diejenige zwischen Assoziationen, die Individuen als Mitglieder haben (zum Beispiel Einzelgewerkschaften und Vereine), und denjenigen, die Organisationen als Mitglieder haben (zum Beispiel Arbeitgeberverbände mit Unternehmen oder Dachverbände mit Einzelverbänden). Die letztgenannten werden auch als Meta-Organisationen bezeichnet
21 Austritt und Widerspruch in Interessenorganisationen 17 (Ahrne und Brunsson 2008). 4 Diese Unterscheidung ist für die Erklärung innerverbandlicher onflikte relevant. Individuen haben Motive, Organisationen verfolgen Zwecke. Organisationsstrategisch bedeutend ist in diesem Zusammenhang die Trennung von Zweck und Motiv (Luhmann 1999, S. 128 ff.). Individuen verfolgen nicht nur Interessen, sondern orientieren sich an Werten, folgen Gefühlen und bewahren eine personale Identität. Organisationen werden durch instrumentelle Rationalität bestimmt, die einer internen Aggregation und ontrolle unterliegen, und erhalten sich durch selbstreferentielle Prozesse. Zugleich weisen Organisationen eine spezifischere Zweckbestimmung und eine höhere Handlungskapazität auf (Scott 1998, S. 56 ff.). Aus dieser Unterscheidung der Mitgliedschaft ergibt sich, dass onzepte der Erklärung von Abwanderung und Widerspruch unterschiedlich gebaut sein müssen. Im erstgenannten Fall gründen sie auf sozialpsychologischen Annahmen, im zweitgenannten Fall auf organisationstheoretischen. Im erstgenannten Fall geht es darum, wie onsumentinnen, Bürgerinnen und Eltern als Einzelpersonen auf den Leistungsabfall von Organisationen reagieren. Im zweitgenannten Fall wäre zu klären, wie Unternehmen oder Mitgliedsverbände mit schlechterer Performanz umgehen. Eine weitere wichtige Unterscheidung mit Blick auf die Mitgliedschaft von Assoziationen ist deren relative Homogenität oder Heterogenität. Es handelt sich hier um eine zweite gängige Unterteilung in der Forschung zu Mitgliedschaften in Assoziationen. Dabei wird angenommen, dass eine geringe Gruppengröße eine relative Homogenität voraussetzt bzw. deren Herstellung erleichtert (Schmitter und Streeck 1999, S. 25 f.). Umgekehrt kann man die Hypothese aufstellen, dass die Heterogenität sich mit der Vergrößerung der Gruppe erhöht. Diese Unterscheidung von Homogenität/Heterogenität ist mitnichten unüblich, aber aus verschiedenen Gründen nur bedingt hilfreich. Der Vermutung beispielsweise, dass eine homogene Interessengruppe eher handlungsfähig ist, kann entgegengehalten werden, dass überlappende Mitgliedschaften dazu führen, dass Assoziationen jeweils zweckspezifisch durchaus handlungsfähig sind (Truman 1971, S. 157 ff.; Czada 1992). Des Weiteren ist für die Unterscheidung Homogenität/Heterogenität nicht geklärt, ob sich diese jeweils auf die ökonomischen Interessen oder auf die soziokulturellen Normen der Mitglieder bezieht, also auf instrumentell-kalkulierende oder affektivwertorientierte Motive und Ausrichtungen. Assoziationen können auf der Basis von Identität oder komplementären Interessen entstehen (Schmitter und Streeck 1999, S. 26), Mitglieder können sich überdies an unterschiedlichen Gemeinschaftsvorstellungen orientieren, etwa der einer politisch-kalkulierenden Gemeinschaft im Sinne Eastons oder einer gegebenen, gleichsam familiären sozialen Gemeinschaft im Ver- 4 Die idealtypische Unterscheidung zwischen Organisationen mit Individuen und Meta-Organisationen mit Organisationen als Mitgliedern ist aus verschiedenen Gründen ein Artefakt: Mit Blick auf die Individuum-Organisation-Differenz kennen Organisationen mit dem Prinzipal-Agenten Problem nicht nur Informationsasymmetrien zwischen Organisationsleitung und Mitgliedschaft, sondern auch die strategische Verselbständigung der Organisationsleitung, die durchaus Raum für personale Idiosynkrasien eröffnet. Der Raum des Personalen ist zudem bei Organisationen unterschiedlich institutionell bestimmt. Er ist etwa bei Aktiengesellschaften (um auf Unternehmen einzugehen) anders bestimmt als bei GbRs oder GmbHs. Schließlich sind bei kollektiven Organisationen Prozesse der internen Willensbildung zu identifizieren, die ausgesprochen personal geprägt sein können.
22 18 D. Sack, C. Strünck ständnis von Tönnies (Sack et al. 2014, S. 168 ff.). Loyalität wird häufig mit affektivwertorientierten Motiven in Verbindung gebracht. Heterogenität und Homogenität bezieht sich jedoch nicht allein auf die Zwecke und Logiken der individuellen oder korporativen Akteure. Auch die Größenverhältnisse, etwa im Sinne der Dominanz eines Unternehmens oder einer kleinen Gruppe von Unternehmen in einem Wirtschaftsverband (Schmitter und Streeck 1999, S. 25; van Waarden 1992, S. 143 ff.; Lang 2011), können zu heterogenen Verbänden führen. Das kann auch bedeuten, dass die Organisation durch wenige, aber beitragsstarke Gruppen und fokale Akteure dominiert wird (Olson 1998, S. 32 f., siehe unten). 4 Verbändelandschaft im Wandel: Umwelt, Organisation und Mitglieder Die Veränderungen, mit denen Verbände umgehen, lassen sich also in drei Dimensionen diskutieren: im ontext sich verändernder Umweltbedingungen (Makro), im ontext der administrativen Logik von Verbänden (Meso,,organisation matters ) und im ontext sich wandelnder Erwartungen und alkulationen der Mitglieder (Mikro) (vgl. Tab. 1). Die Folgen veränderter Umweltbedingungen sind beispielsweise für Wirtschaftsverbände umfassend diskutiert worden (Paster 2015). Sie dienen uns hier lediglich als Beispiel für Herausforderungen, mit denen auch andere Assoziationen befasst sind. Internationalisierung, IT, Finanzmarktdominanz, steigende omplexität von Märkten sowie die stärkere vertikale Differenzierung von Unternehmen verändern Interessenlagen und damit auch die Bedingungen für Verbände. Nur auf den ersten, eher ahistorischen Blick mögen die Profitinteressen des apitals in Marxscher Perspektive äußerst homogen sein. Allerdings bilden die vielfältigen Produzenteninteressen von Unternehmen nicht nur wirtschaftliche onkurrenz ab. Auch (verbands-)politisch verknüpfen sich damit höchst unterschiedliche Erwartungen, wie Märkte reguliert und gesetzliche Rahmenbedingungen gestaltet werden sollten. Produzenten und Händler, forschende und nicht-forschende Unternehmen, Anbieter konventioneller oder erneuerbarer Energie: Angesichts komplexer Märkte ist es keineswegs einfach, die Interessen privater Unternehmen zusammenzuführen. Anbieterinteressen sind fragmentiert, und die Marktdynamik verstärkt diesen Effekt (Streeck 1991). Insbesondere die Internationalisierung macht es schwerer, Interessen zu aggregieren: Die onflikte zwischen großen und kleinen Unternehmen wachsen, die zunehmende Arbeitsteilung und vertikale Diversifizierung der Produktion fragmentiert die Unternehmensinteressen weiter (Streeck und Visser 2006). Damit ändern sich die Bezugspunkte für verbandliche Arbeit deutlich. Ebenso wandeln sich die Bedarfe der Mitglieder, wenn es um Dienstleistungen und kollektive Güter geht. Mitglieder erwarten ein stärkeres Leistungsvermögen der Verbände, was auch neue onkurrenzen zwischen Mitgliedern, aber auch zwischen Verbänden erzeugen kann (Lang und Schneider 2007). Mit der gestiegenen Börsenkapitalisierung von Unternehmen und mit Strategien des kostenreduzierenden Outsourcings gingen, wie etwa am Beispiel der Automobilindustrie und des so genannten López-Effekt gezeigt werden kann, eine Verschärfung des Wettbewerbs innerhalb der
23 Austritt und Widerspruch in Interessenorganisationen 19 Tab. 1 Wandel in der Umwelt von Verbänden (Beispiel Wirtschaftsverbände). (Quelle: Eigene Zusammenstellung) Ökonomischer ontext Politischer ontext Verbandsmanagement Mitgliedschaft Neue Produkte und Wertschöpfungsketten durch technologische Entwicklung, Tertiarisierung und Transnationalisierung, zum Beispiel ommunikationstechnologie Reorganisation der bestehenden Wertschöpfungsketten, zum Beispiel Subcontracting Neue Politikfelder bzw. paradigmatischer Wandel in Politikfelder, zum Beispiel Energiepolitik Staatlicher Wandel und Mehrebenenregieren, zum Beispiel Europäisierung Horizontale Reorganisation, zum Beispiel Public Private Partnership Strategie in der Domänenkonkurrenz zwischen Verbänden, zum Beispiel Pharmabranche Organisationsreformen, zum Beispiel New Public Management, Social Media Individualisierung und neue Assoziierung, zum Beispiel religiös oder genderbezogene Unternehmensverbände Interne Reformen von Organisationen als Mitglieder, zum Beispiel Beendigung betrieblicher Ausbildung Mitgliedschaft und eine Interessendivergenz einher, die als divisive pressure bezeichnet wurde (Silvia und Schroeder 2007, S. 13). Infolge des Wandels änderten sich nicht allein die Erwartungen, sondern erhöhten sich auch onflikte innerhalb der Mitgliedschaft. Auch andere Verbände bewegen sich in einer turbulenten Umwelt. Die Gewerkschaften spüren einen deutlichen Wandel in der Arbeitswelt: Beschäftigungsverhältnisse verändern sich, Lohnregime werden heterogener, die Digitalisierung dezentralisiert die ontrollmöglichkeiten des Managements. Die Angebote der Gewerkschaften können bei wachsender Unsicherheit durchaus attraktiv sein für neue Arbeitnehmerschichten. Doch je spezifischer die Berufsgruppen sind, desto attraktiver kann es sein, kleine, spezialisierte Interessenvertretungen zu haben. Die großen Einheitsgewerkschaften etwa in Deutschland erfasst außerdem die rise der Arbeitgeberverbände. Wenn deren Organisationsgrad zurückgeht, schwinden auch die Möglichkeiten der Gewerkschaften, Tarifverträge zu schließen (Behrens 2011). In der Sphäre der Politik lässt sich ebenfalls zwischen Innovation und Reorganisation im Wandel unterscheiden. In manchen Politikfeldern hat ein grundlegender Paradigmenwechsel stattgefunden. Es handelt sich hier um politische Entscheidungen, aufgrund derer neue Domänen im Markt entstehen, die dazu führen können, dass sich die Integrationskraft etablierter Verbände nicht aufrechterhalten lässt. Im Feld der Energiepolitik hat sich beispielsweise gezeigt, dass der Bundesverband Erneuerbare Energien einen Bedeutungsgewinn verzeichnen konnte, während wiederum die vier dominanten Energieversorgungsunternehmen ihre Interessenvertretung außerverbandlich organisiert haben. Infolge politisch-programmatischer Innovation veränderte sich die Verbandslandschaft in dem Politikfeld (Hirschl 2008; Sack 2013, S. 240 ff.). In der Gesundheitspolitik bringen die ostendämpfungspolitik und die daraus resultierenden Verteilungskämpfe Ärztegruppen gegeneinander auf, die ansonsten ihre Interessen monopolisiert hatten. Die Öffnung der Landwirtschaft zum Weltmarkt erschüttert Bauernverbände, die ihre internen onflikte nicht mehr zudecken können.
24 20 D. Sack, C. Strünck Die Mehrebenenlogik europäischer Politik wirkt sich ebenfalls aus. Auch diese Entwicklung konfrontiert die Verbände damit, ihre Interessenartikulation und -aggregierung zu erneuern und ihre Güter zu verbessern. Die wachsende Bedeutung der einzelnen Interessenvertretung durch transnationale onzerne, aber auch durch Public Affairs Agenturen zeigen, dass nicht alle Wirtschaftsverbände diesen Anpassungsprozess vollzogen haben (Platzer 2010; Eising in diesem Band). Zu den Umweltbedingungen der Verbände gehört auch die onkurrenzsituation, in der sie sich befinden. Gerade im deutschen orporatismus waren lange Zeit private Interessenregierungen mit Repräsentationsmonopolen einzelner Verbände die Regel (Streeck und Schmitter 1985). Doch die zunehmende Politisierung von Handlungsfeldern hat auch die Verbändelandschaft pluralisiert. Es ist gerade für die Mitgliedschaftslogik bedeutsam, wenn stärkerer Wettbewerb herrscht, sich neue Verbände bilden, Mitglieder zwischen Organisationen wechseln. Optionen wie Exit, Voice oder Neglect werden dann nicht nur durch den Grad der Loyalität beeinflusst, sondern auch durch die Auswahl und Art an Verbänden. Auf der Mesoebene der Verbände sind zwei Veränderungsprozesse erkennbar. So geht es bei diesen zunächst darum, im Zuge der Domänenkonkurrenz aufgrund des Wandels von Technologien, Wertschöpfungsketten und Politikfeldern eine Strategie zu entfalten, die sich positiv auf den Erhalt des Verbandes auswirkt. So hat es etwa dem Hausärzteverband und dem Marburger Bund neue Mitglieder beschert, als sie sich angesichts wachsender Verteilungskämpfe offensiv für eigene Verhandlungsund Vertragsstrategien entschieden haben. Zweitens sind Verbände damit befasst, sich durch Organisationsreformen, etwa im Sinne des New Public Managements, nicht nur an veränderte Umweltbedingungen (im Sinne höherer Effektivität), sondern auch an die interne Willensbildung seitens der Mitglieder anzupassen, im Sinne von höherer Effizienz und Partizipation (Schulz-Walz 2006). Dies kann die Qualität verbandlicher Güter maßgeblich verbessern oder verschlechtern. Auf diese Weise können Verbände die Zufriedenheit ihrer Mitglieder beeinflussen. Das ist umso wichtiger, als Individualisierung und Pluralisierung nicht nur soziale und politische Milieus verändern, sondern auch das Innenleben der Verbände (Beck 1993). Wenn auf der Mikroebene die Loyalität zu Verbänden brüchiger wird, kommt es umso mehr darauf an, welche Güter den Mitgliedern angeboten werden. Allerdings sind auch die neuen Bedarfe der Mitglieder entscheidend. In der Interaktion zwischen Mitgliedern und Verband ist in diesem Sinne die omplementarität der Erwartungen und Angebote für die innerverbandliche Integration und Handlungsfähigkeit nach außen ausschlaggebend. 5 Güter als Gestaltungselement von Verbandsführungen Leistungen der Verbände, die Art der Güter, der Bedarf der Mitglieder und die Leistungsbewertung sind das Scharnier zwischen der Makro- und der Mikroebene innerhalb der Verbände. Dabei ist das Spektrum von Gütern groß. Unterscheiden
25 Austritt und Widerspruch in Interessenorganisationen 21 lassen sich private Güter, ollektivgüter und Clubgüter. 5 Private Güter sind Produkte und Dienstleistungen die als selektive Anreize wirken. Jeder nimmt sie individuell in Anspruch. Ein Verband kann sie unter besonderen Bedingungen sozusagen maßgeschneidert nur für seine Mitglieder anbieten. Dennoch ist es möglich, dass die Mitglieder sich solche privaten Güter wie Versicherungen oder Beratung auch am Markt oder über andere Organisationen beschaffen können. Das Gegenstück dazu ist das Clubgut (Buchanan 1965). Es lässt sich nur über den Verband herstellen und nur Mitglieder kommen in seinen Genuss. Dem Begriff entsprechend lässt sich das am besten an Vereinen veranschaulichen: Wettkampfveranstaltungen existieren nur, weil sie gemeinsam von Vereinen organisiert werden, die außerdem gemeinschaftlich Sportstätten betreiben. Die Mitglieder haben jeweils einen deutlich sichtbaren Nutzen, müssen aber auch einen erkennbaren Teil dazu beitragen, dass Güter bereit stehen. Am schwierigsten für Verbände ist die Situation bei der dritten Form, den ollektivgütern. Ein Automobilverband, der sich für mehr Verkehrssicherheit einsetzt, eine Umweltgruppe, die saubere Luft zum Ziel hat oder auch eine Gewerkschaft, die einen Tarifvertrag erkämpft: Für alle gilt, dass aus unterschiedlichen Gründen auch Nicht-Mitglieder von diesen ollektivgütern profitieren. Lobbying produziert solche ollektivgüter; erstrittene Regelungen kommen häufig allen Betroffenen zugute. Es gibt Güter, die Merkmale von Club- und ollektivgütern tragen. Ein Beispiel dafür bietet der Hausärzteverband. Seit einigen Jahren können die gesetzlichen rankenkassen so genannte Selektivverträge mit Ärztegruppen schließen. Die assenärztliche Vereinigung als öffentlich-rechtliche Monopolorganisation wird so umgangen (Gerlinger und Urban 2010). Die Mitglieder des Hausärzteverbandes können zu besonderen onditionen Patienten in Versorgungsprogrammen behandeln und erhalten eine spezifische Vergütung. Auch wenn der Verband den Sondervertrag nicht selbst komplett kontrolliert, gleicht das Ergebnis eher einem Club- als einem ollektivgut: Tatsächlich muss man Mitglied des Hausärzteverbandes sein, um in das Versorgungsmodell einsteigen zu können. Das Beispiel zeigt, wie Verbandsführungen durch bestimmte Güter und klare Grenzziehungen die Zufriedenheit ihrer Mitglieder beeinflussen und Abwanderung wie Widerspruch somit steuern können. Mit Clubgütern gelingt das am besten; bei privaten Gütern besteht immer das Risiko, dass sich die Mitglieder auch woanders versorgen können. Und ollektivgüter müssen so erfolgreich kommuniziert werden, dass Mitglieder dadurch motiviert werden. Der von uns skizzierte externe Wandel auf der Makroebene verändert jedoch in der Mitgliedschaft die Bewertung von und den Bedarf an Gütern. Er verändert auch die Bedingungen, unter denen Verbände solche Güter herstellen können. Gerade die Mitglieder, die im Rahmen der Wettbewerbsbeziehungen zwischen Mitgliedern (s. oben) Nachteile zu erleiden haben, können in erhöhtem Maße und gleichsam kompensatorisch bestimmte Leistungen vom Verband erwarten. 5 Wir verwenden daher ein nicht-essentialistisches onzept von Gütern. Das bedeutet, dass der Bedarf an Gütern nicht stabil und gegeben ist, sondern sowohl von äußeren Rahmenbedingungen als auch von der Wahrnehmung, den Werten und den Gefühlen der Mitglieder abhängt.
26 22 D. Sack, C. Strünck Während Verbände relativ autonom ihre Clubgüter gestalten können, sieht es bei ollektivgütern anders aus. Hier müssen Verbände häufig mit Dritten verhandeln oder auf deren Strategien reagieren. Es treten ja nicht allein die Verbände als Produzenten kollektiver Güter auf, sondern eben auch Staat und Markt. Verbände und ihre Mitglieder sind also mit kollektiven Gütern konfrontiert, an deren Erstellung sie nicht,kaumodernicht erfolgreichbeteiligt waren. Diese kollektiven Güter entziehen sich in der Tendenz dem verbandlichen Handlungsspielraum, haben aber Effekte für die Organisation. ollektivgüter können gerade in Zeiten des Wandels für eine bestehende Mitgliedschaft generalisierende oder diskriminierende Effekte haben. Generalisierend meint, dass der Nutzen eines ollektivgutes allen Mitgliedern zugutekommt bzw. mindestens pareto-optimal ist. Diskriminierende Effekte werden dann offenbar, wenn Regulierungen (beispielsweise zum Patentschutz, zum Infrastrukturausbau oder zur Preisgestaltung) innerhalb der Mitgliedschaft Gewinner und Verlierer erzeugen, also manche Mitglieder profitieren, andere hingegen manifeste Nachteile zu vergegenwärtigen haben. Wir gehen also gegenüber der gängigen Differenzierung 6 aufgrund des (möglichen) redistributiven Charakters davon aus, dass kollektive Güter für die Mitgliedschaft diskriminierende, trennende und konfliktverschärfende Eigenschaften haben können. Seien es erleichterte Patente für Arzneimittel, liberalisierte Ladenöffnungszeiten, die Förderung erneuerbarer Energien oder attraktivere Gebührenordnungen für freie Berufe: Mit jedem dieser Güter, aber auch mit der verbandlichen Anpassung an Umweltveränderungen, gibt es Gewinner und Verlierer, können neue onflikte in der Mitgliedschaft entstehen. Denn die Erwartungen der Mitglieder an private Güter, an Clubgüter und kollektive Güter sind unterschiedlich, und die Mitglieder bewerten die Leistungen ihrer Verbände entsprechend. Hier verbinden sich der Wandel der Umwelt, das organisationsinterne Management und die individuelle Motivation und Disposition der Mitglieder. 6 Protest und Güterbedarf in unterschiedlichen Verbänden Sind Mitglieder mit den Gütern ihrer Verbände nicht zufrieden, kann das zu innerverbandlichem Protest führen. Die meisten Theorien des Protests haben einen breiten Blick auf das politische System und die Gesellschaft. Protest äußert sich dann, wenn Menschen unzufrieden sind mit Entwicklungen, die von allgemeiner Bedeutung sind. Entsprechend werden Protestbewegungen untersucht, die oftmals einen geringen Formalisierungsgrad haben. Will man diese Theorien auf Organisationen und auch organisationsinternen Protest anwenden, so müssen die Besonderheiten von Verbänden berücksichtigt werden. Am zutreffendsten lassen sich Theorien des Protests auf die klassischen freiwilligen Vereinigungen mit individuellen Mitgliedern anwenden. 6 Rivalität und Nichtrivalität kollektiver Güter und deren Exklusivität oder allgemeine Zugänglichkeit.
27 Austritt und Widerspruch in Interessenorganisationen Soziale Vergemeinschaftung in Verbänden mit individuellen Mitgliedern Einzelpersonen sind in Assoziationen unterschiedlich stark engagiert und nicht alle sind der Lage, effektiv Einfluss zu nehmen und mitzugestalten. Es gibt also In- und Outsider. Da es uns in diesem Artikel darum geht, idealtypische onfigurationen von Verbänden zu unterscheiden, gehen wir an dieser Stelle jedoch vereinfachend von einer relativen Ressourcensymmetrie zwischen Einzelpersonen als Mitgliedern von Assoziationen aus, also einer relativen Homogenität nicht nur bezüglich ihrer Präferenzen, sondern auch hinsichtlich ihrer apazitäten. Ausschlaggebend für die Tätigkeit im Verband sind nicht nur die Präferenzen, sondern auch eine Orientierung an sozialer Vergemeinschaftung. Opp und ittel weisen in einer empirischen Analyse zu sozialem Protest darauf hin, dass die Beteiligung weniger durch inhaltliche Interessen bestimmt wird, sondern dadurch, sich in soziale Netzwerke zu integrieren (2010; s. a. Simonson et al. 2016, S. 407 ff.). Auch qualitative Befunde weisen darauf hin, dass für das Engagement in Verbänden der Aspekt der sozialen Identifikation und Gemeinschaft wie auch der gesellschaftlichen Anerkennung von erheblicher Bedeutung sind (Sack et al. 2014, S. 182 ff.). Loyalität zeigt sich hier als diffus-affektive Bindung an eine Gemeinschaft (Easton 1965; Westle 1989). Die Interaktionsbeziehungen sind in diesem Sinne eher von Dialog und kommunitären Orientierungen bestimmt. Mit Bezug auf die oben aufgeführten Makro-Meso-Mikro-Überlegungen zum verbandlichen Wandel und unserer Ausgangsannahme, dass sich Bedarfe und Erwartungen der individuellen Mitglieder verändern, schließen wir am synthetischen, strukturell-kognitiven Modell des sozialen Protestes von Opp an (2009). 7 Dieses fokussiert auf jene Variablen auf der Makroebene (etwa veränderte politische Gelegenheiten, neue Regierungskoalitionen, neue Technologien oder sozialer Wandel), die auf sozialpsychologische Faktoren wirken, um dann wiederum zu individuellem Protestverhalten führen. Daraus können sich auf der Makroebene Protestbewegungen entwickeln. Im Sinne der Theorie der kollektiven Organisierung liegt das Scharnier zwischen der Art und Weise, wie Individuen Umweltereignisse deuten und den Anreizen, die sowohl durch Umwelteffekte als auch durch die kognitive Wahrnehmung selber geschaffen werden. Individuelles Protestverhalten führt dann emergent zu Makrophänomenen des Protests (Opp 2009, S. 327 ff.). Motivierend und intervenierend zugleich wirkt eine für organisatorisches und politisches Handeln zentrale individuelle Disposition, nämlich die Political Efficacy. Die Bedeutung, dass die entsprechende Handlung wirksam ist bzw. sein kann, setzt sich bekanntermaßen aus zwei Dimensionen zusammen. Das ist zum einen ein individuelles ompetenzbewusstsein, also die Wahrnehmung, dass über entsprechende Ressourcen (zum Beispiel Bildung, Abkömmlichkeit, rhetorisches Geschick, Geld) in einem hinreichenden Maße verfügt wird. Die zweite Dimension besteht in der Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit vor dem Hintergrund externer Respon- 7 Wir teilen den ontologischen Ausgangspunkt des Modells: The term,cognitive suggests that one major variable on the microlevel is that individuals perceive (or recognize) the macro changes. In other words, the,definition of the situation is important for individual action. Thus, structures (in a wide sense) and their perception are relevant (Opp 2009, S. 330).
28 24 D. Sack, C. Strünck sivität und bestimmter Gelegenheiten (Campbell et al. 1954, S. 187 ff.; Vetter 1997; Opp 2009, S. 332). Damit ist der Bogen gespannt zu den Anreizen, auf die oppositionelles Handeln reagiert. Es kann sich um veränderte interne politische Gelegenheiten handeln, wie etwa einen Wechsel an der Verbandsspitze oder neue gesetzliche Regelungen. Es können sich Situationen ergeben, in denen bislang latent gehaltene Einschätzungen und Bewertungen offen geäußert werden. Und schließlich kann es organisationsexterne Anreize geben, etwa neue Regulierungen, die Protestverhalten hervorrufen, weil sie als ungerecht wahrgenommen werden. Zugleich wird in diesen Fällen die Reaktion der eigenen Organisation als unangemessen und unzureichend bewertet. Wenn der Gesetzgeber zum Beispiel die Möglichkeit schafft, Versorgungsverträge jenseits der assenärztlichen Vereinigungen zu schließen, bietet er damit einen Anreiz für selektive Abwanderung. Die Versuche der assenärztlichen Vereinigungen, solche Verträge unattraktiv erscheinen zu lassen, mobilisieren die bereits unzufriedenen Mitglieder zusätzlich. Für unsere Zwecke adaptieren wir das Modell von Opp in zweifacher Weise. Erstens beziehen wir die Meso-Ebene des Verbandes ein. Dadurch wird aus einem Mikro-Makro-Modell ein Modell aus drei Ebenen: Mikro (Individuum als Mitglied) Meso (Verband/Organisation) Makro (sozio-ökonomische und politisch-institutionelle Umwelt). Zweitens stellen wir statt des Anreizes dieser nimmt bei Opp (2009, S. 331 ff.) eine ähnlich zentrale Stellung ein wie in der Austauschtheorie (Salisbury 1969) die Gütererwartungen und -bewertungen der Mitglieder ins Zentrum unserer Überlegungen. Dafür machen wir drei Gründe geltend. Theoretisch-konzeptionell sind Anreize auf Objekte bezogen, die zum Handeln motivieren. Anreize sind durch eine Richtung und eine Erwartung bestimmt. Insofern erscheint es uns logischer, auf das Objekt des Anreizes zu fokussieren, also auf die Güter. Außerdem sind Anreize in dem Sinne einseitig, als die Individuen diese lediglich als Angebot wahrnehmen. Die ategorie des Gutes weist hingegen deutlicher zwei Seiten aus, nämlich die der Erwartungen und des Bedarfs einerseits und des Angebots und der Bewertung andererseits. Schließlich werden die Mitglieder damit deutlicher zu Akteuren der Verbandsentwicklung. Für Mitglieder stehen Erwartungen an Güter im Mittelpunkt. Neben dem praktischen Nutzen und der Befriedigung von politischen Präferenzen bieten Güter auch affektive Bindungen und soziale Vergemeinschaftung (Opp und ittel 2010). Sowohl die individuelle Disposition der Mitglieder (u. a. durch den Grad der Loyalität) als auch Gelegenheiten, die durch Verbandsgüter oder Umweltveränderungen entstehen, entscheiden mit darüber, ob Mitglieder abwandern oder protestieren. Wie aber äußert sich Protest in Verbänden, deren Mitglieder ebenfalls oder ausschließlich Organisationen sind? 6.2 Interessenmediation in Verbänden mit Organisationen als Mitglied Organisationen als Mitglieder von Verbänden sind an sozialer Vergemeinschaftung nicht interessiert, sondern an Zwecken und an relativer Autonomie. Die organisationssoziologische Debatte um Meta-Organisationen hat gezeigt, dass es einen
29 Austritt und Widerspruch in Interessenorganisationen 25 grundlegenden Unterschied bei innerverbandlichem Protest macht, wenn anstatt von Individuen Organisationen Mitglieder von Verbänden sind (Ahrne und Brunsson 2008, S. 2 f., 107 ff.). Auch in der Forschung zu Wirtschaftsverbänden wird die besondere Rolle von Unternehmen und insbesondere großen Unternehmen als Mitglieder in Verbänden betont (Traxler 1986, 2010). Einige leiten daraus sogar ein Paradox ab: Bei den Unternehmen als der Hauptklientel der Arbeitgeberverbände haben wir es mit besonders durchsetzungsstarken und ressourcenreichen Interessen zu tun, aber deren kollektive Vertretung [...] erweist sich als prekär (Behrens 2011, S. 5). Angesichts vieler kleiner und mittelständischer Unternehmen muss man die Einschätzung nicht teilen, dass es sich zwangsläufig um ressourcenreiche Interessen handelt. Wichtig ist aber, dass sich auch hier die Frage stellt, wie Mitglieder als Organisationen eine eigenständige Dynamik in Richtung Widerspruch und/oder Abwanderung entwickeln (Traxler 1986, S. 27 ff.). Dies betrifft Dachverbände, deren Mitglieder Verbände sind (Verbandsebene) ebenso wie Verbände, deren Mitglieder andere juristische Personen sind. Auch Organisationen haben eine Identität und relative Autonomie; sie sind zugleich an bestimmbaren und begrenzten Zwecken orientiert. Organisationen als Mitglieder von Meta-Organisationen können ihre Interessen teilweise auch alleine verfolgen. Daher ist es relevant, welche Art von kollektiven Mitgliedern ein Verband hat. Anders als bei der Mitgliedschaft von Individuen, für die wir pauschal und vereinfachend eine relative Ressourcensymmetrie unterstellt haben, gehen wir von drei idealtypischen Strukturen der korporativen Mitgliedschaft aus: 1. einer Mitgliedschaft mit sehr geringen Größenunterschieden und annähernder Ressourcensymmetrie der Organisationen, 2. einer Mitgliedschaft, die durch den dominanten Ressourceneinsatz einer fokalen Organisation bestimmt wird, 3. und einer (potentiellen) Mitgliedschaft, die gleichsam durch zwei fokale Organisationen bzw. zwei Lager bestimmt wird. So haben die Mitglieder einiger Handwerksinnungen und Verbände kleiner und mittelständischer Unternehmen nicht die notwendigen Ressourcen, um Güter selber zu produzieren, für die Bedarf besteht. Für Verbände in der Automobil- und Chemieindustrie wiederum ist darauf verwiesen worden, dass deren Organisationsfähigkeit davon abhängt, dass einzelne, transnational agierende onzerne die entsprechenden Ressourcen für die Verbandstätigkeit bereitstellen, aber durchaus auch selbst handlungsfähig sind. Gerade weil eine fokale Organisation die wesentlichen Ressourcen einbringt, wird die Organisierung erleichtert (Lang 2011; s. a. Olson 1998, S. 33 f.). Schließlich ist für bestimmte Branchen gezeigt worden, dass deren (potentielle) Mitgliedschaft in zwei jeweils mit erheblichen Ressourcen ausgestattete Lager zerfällt, so etwa in der Pharmabranche (Lang und Schneider 2007, S. 230 f.) und im Groß- und Einzelhandel (Behrens 2011, S. 174 ff.). Die Unterscheidung in drei Strukturen der korporativen Mitgliedschaft ist deshalb relevant, weil sich daraus unterschiedliche Folgen für die Gestaltung der Delegationsbeziehungen im Verband und die Artikulation von Unzufriedenheit ergeben. Während für Organisationen mit Individualmitgliedschaft das Verhältnis und die Vermittlung zwischen sozialer Vergemeinschaftung und Heterogenität von grund-
30 26 D. Sack, C. Strünck legender Bedeutung sind, ist dies bei Meta-Organisationen die Balance zwischen Wettbewerb und ooperation. Ausschlaggebend für die Interaktionsbeziehungen in Verbänden mit organisierten Mitgliedern ist einerseits, dass diese eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen müssen (etwa nationale Sportverbände), aber darüber hinaus sowohl konkurrieren (etwa bei Wettkämpfen) als auch zusammenarbeiten müssen (etwa bei der Mittelverteilung von Übertragungsrechten). Allgemein formuliert existiert ein Bereich der Ähnlichkeit, der funktional erforderlich ist, es besteht aber auch eine tension between similarity and dissimilarity (Ahrne und Brunsson 2008, S. 93). Auch für Unternehmensverbände wurde konstatiert, dass die Durchsetzung eines gemeinsamen Zieles gegenüber anderen Marktteilnehmern die Stilllegung des onkurrenzverhältnisses [in der Mitgliedschaft] im Hinblick auf dieses Ziel erfordert (Traxler 1986, S. 66). Es gibt hier offenkundig strukturelle Spannungen zwischen Unternehmen (als Organisationen) und ihren jeweiligen Verbänden: Unternehmen konkurrieren untereinander und stehen zugleich vor dem Problem, diese Wettbewerbslogik in eine Interessenvertretungslogik nach außen zu transformieren. Dann erscheinen Marktkonkurrenten als geschätzte Mitstreiter zur Durchsetzung gemeinsamer Ziele (Behrens 2011, S. 30). Es gibt also eine generelle Spannung zwischen Wettbewerbs- und ooperationslogik. In diesem Zusammenhang hebt Martin Behrens hervor, dass die besondere Leistung eines Verbandes nun darin bestünde, dass individuelle Unternehmensinteressen in kollektive Verbandspositionen und darauf basierenden Handlungen überführt werden, die genauen Facetten und Hintergründe dieser Individualinteressen gegenüber den anderen Verbandsmitgliedern allerdings sorgsam verborgen werden müssen (Behrens 2011, S. 41). Insofern in Verbänden mit Organisationen als Mitglieder das Austarieren zwischen Wettbewerb und ooperation notwendig ist, um die Funktionsfähigkeit des Verbandes zu erhalten, sehen sich die Meta-Organisationen mit einer typischen Mixed Motive onstellation in der Mitgliedschaft konfrontiert. Es geht nun wesentlich um die Frage, wie innerhalb der Meta-Organisation das Verhältnis zwischen Wettbewerb und ooperation zwischen den Mitgliedern so reguliert werden kann, dass der Wettbewerb nicht die Erstellung von kollektiven Gütern durch die Metaorganisation einschränkt oder gar blockiert. Dieses lässt sich strategisch auf zwei Wegen bewerkstelligen. Im Sinne einer battle of sexes-spielsituation werden die unterschiedlichen Präferenzen der Mitglieder sequenziert, also in eine Abfolge der Erstellung von jeweils spezifischen Gütern überführt, die jeweils bestimmten Teilen der Mitgliedschaft zugutekommen. Ein anderer Weg ist, eine Sphäre des Wettbewerbs und eine der ooperation zu bilden. Der Bereich der Zusammenarbeit wird isoliert (Behrens 2011). 8 Die Delegationsverhältnisse in Meta-Organisationen zwischen Mitgliedschaft und Leitung unterscheiden sich je nach Struktur der Mitgliedschaft erheblich. Theoretisch entsteht durch das Delegationsverhältnis zwischen dem Prinzipal (etwa den 8 Als formale Strukturen, um die Spannung zwischen Wettbewerb und ooperation zu bearbeiten, dienen etwa Zulassungsverfahren für Mitglieder, Verschwiegenheitspflichten, die Installation eines,mitgliederfernen Stabs, aber auch die Beratungen in Fachausschüssen und die onfliktschlichtung in Schiedsgerichten (Behrens 2011, S. 73 ff.).
31 Austritt und Widerspruch in Interessenorganisationen 27 Mitgliedern einer Assoziation) und dem Agenten (etwa der Verbandsspitze) eine Machtasymmetrie: Die Agenten haben aufgrund ihres Informationsvorsprungs zusätzliche strategische apazitäten und können sich gegenüber der Willensbildung in der Mitgliedschaft verselbstständigen. Für Meta-Organisationen ist diese Annahme zu präzisieren und einzuschränken. Sie ist dann plausibel, wenn es sich um eine eher breite und plurale Mitgliedschaft mit eher symmetrischer, aber geringer Ressourcenausstattung handelt. Für Verbände mit wenigen fokalen Mitgliedern stellt sich das Delegationsverhältnis deutlich anders dar: Diese können maßgeblich auf die Leitungsebene einwirken. Die Geschäftsführung ist gegenüber fokalen Mitliedern nicht allein deshalb in einer relativ schwächeren Position, weil sie aus Sicht der letztgenannten einen sekundären, nicht einen primären organisatorischen Zweck verfolgt, damit also durchaus entbehrlich ist. Dieses andere Delegationsverhältnis zeigt sich dann auch in spezifischen Rollenkonstellationen: In der Föderation der Schwedischen Industrie managers complained that they were sometimes treated as subordinate assistants by the most prominent managers of large enterprises (Ahrne und Brunsson 2008, S. 112). Vor allem zeigt sich in dieser Art von Assoziationen, dass wichtige Mitglieder lediglich im geringen Maße auf die Produktion von Clubgütern und kollektiven Gütern angewiesen sind. Diese Meta-Organisationen erweisen sich gegenüber ihren Mitgliedern als schwach, insofern sie von deren Ressourcen abhängen (Ahrne und Brunsson 2008, S. 85 ff., 2012, S. 59). In der drittgenannten onstellation (zwei fokale Mitglieder bzw. Lager) ergibt sich wiederum ein anderes Delegationsverhältnis: Einzelne Mitglieder suchen die Allianz mit der Verbandsleitung, um sich durchzusetzen. Diese wiederum kann in dieser onstellation ein besonderes Clubgut anbieten, nämlich das Brokering zwischen zwei Lagern. In dieser dritten idealtypischen onstellation mit zwei unterschiedlich ausgeprägten Lagern, kommt der Leitung der Meta-Organisation die Funktion der Mediation zu. Zugleich ist diese Mitgliedschaftsstruktur aus Sicht des Verbandes eine durchaus prekäre, insoweit bei dauerhafter Unzufriedenheit eines Lagers die Hürden für einen kompletten Exit und die Neugründung eines Verbands niedrig sind. So war es zum Beispiel der Fall in der deutschen Pharmabranche (Lang und Schneider 2007, S. 230 f.). In Meta-Organisationen, so unser Zwischenfazit, stellt sich die Frage nach der Güterproduktion in anderer Weise. Neben den üblichen Clubgütern, wie etwa internen Informationen, Beratung oder Rechtsschutz für Mitglieder, wird eine besondere Leistung angeboten: Mediation und Brokering, die Sequenzierung der mixed-motive- onstellation und der Isolierung einer Sphäre der Zusammenarbeit und des Dialogs. Das ist das spezifische Clubgut von Meta-Organisationen, auf das sich die Erwartungen der Mitglieder richten. An dieser Stelle kommen wir auf den externen Wandel zurück, mit dem die Verbändelandschaft konfrontiert ist. Verbände mit Individualmitgliedern und Meta- Organisationen sind mit Umwelten konfrontiert, die neuen Bedarf an kollektiven Gütern erzeugen, etwa im Sinne neuer politischer Regulierungen. Dabei sind Organisationen als Mitglieder aus zwei Gründen fordernder als Individuen: Sie stehen im Wettbewerb und sie sind durch eine instrumentelle Rationalität und eine apazi-
32 28 D. Sack, C. Strünck tät geprägt, aufgrund derer die Nachfrage nach Clubgütern und kollektiven Gütern zeitnah spezifiziert werden kann und muss. Dies setzt Meta-Organisationen unter Stress, da sie unter den Bedingungen verstärkter sozio-ökonomischer (etwa in Wertschöpfungsketten) oder politisch-institutioneller (etwa beim Paradigmenwechsel in Politikfeldern) Veränderungen rasch die Leistungserbringung für die Mitglieder anpassen muss. Zugleich sind sie mit einer zunehmenden divisive pressure (Silvia und Schroeder 2007, S. 13) und Umverteilungen in der Mitgliedschaft genau aufgrund des technologisch-ökonomischen und politisch-institutionellen Wandels befasst. Dies führt nun dazu, dass ein erhöhter Bedarf nach dem speziellen Clubgut Interessenmediation besteht. Meta-Organisationen haben also zwei Anforderungen (veränderte ollektiv- und Clubgüter und erhöhten Mediationsbedarf) zu bewältigen. Es ist diese Gleichzeitigkeit, die ihren,leistungsabfall aus Sicht von Mitgliedern praktisch unvermeidlich macht und Unzufriedenheit erzeugt, wenn nicht gar erzeugen muss. Wir gehen also davon aus, dass sich innerverbandlicher Protest in Meta-Organisationen deutlicher zeigt und stärker auswirkt. Die Beispiele der Pharmaindustrie, des Einzelhandels, des Bauernverbandes oder auch der Industrie- und Handelskammern unterstreichen das. Hier haben sich Verbände gespalten oder müssen erhebliche interne Spannungen aushalten. Bei den Verbänden mit Individualmitgliedern beobachtet man eher, dass etablierte Verbände über konkurrierende Verbände angegriffen werden. 7 Abwanderung und Widerspruch: Folgen für die Verbände und die Verbändeforschung Organisationen mit Individualmitgliedern sind aus verschiedenen Gründen besonders anfällig für Abwanderung. Der Austritt aus der Organisation ist niedrigschwellig und hat kaum unmittelbare Folgen. Maßgeblich für die Abwanderung können Schwierigkeiten des Verbandes sein, entsprechende Güter in angemessener Weise zu erbringen, etwa wenn Tarifverhandlungen nicht zu akzeptablen Ergebnissen führen bzw. nicht den in der Mobilisierungsphase geweckten Erwartungen entsprechen. Die Abwanderung zu alternativen Organisationen, etwa Spartengewerkschaften, geht neben der Unzufriedenheit mit dem Leistungsvermögen der bisherigen Organisationen darauf zurück, dass es eine bestimmte Gelegenheitsstruktur gibt (eine alternative Organisation) und sich die Einzelpersonen zutrauen, in und mit dieser neuen Organisation ihren Bedarf an Clubgütern zu befriedigen (Political Efficacy). ritisch ist überdies die Bereitstellung des speziellen Clubgutes Identität und sozial-moralisches Milieu. Insbesondere große Verbände stehen hier vor dem Dilemma, zwischen dem effizienten Management einer Organisation und sozialer Vergemeinschaftung zu vermitteln. Unter den Bedingungen eines erweiterten Marktes von Identitätsangeboten (als Gelegenheitsstruktur) gibt es Möglichkeiten, den niedrigschwelligen Austritt mit dem Eintritt in eine neue Organisation zu verbinden, welche für derartige Angebote steht, also etwa religiös orientierte oder genderpolitische Gruppenbildung anbietet. Für Meta-Organisationen mit einer breiten Mitgliedschaft stellt sich die Situation etwas anders dar. Ähnlich ist sie zunächst darin, dass bei Unzufriedenheit mit dem
33 Austritt und Widerspruch in Interessenorganisationen 29 Leistungsvermögen einer Organisation ein Austritt eher erfolgt, wenn entsprechende Alternativangebote existieren. Dieser Weg wird durch Informationsasymmetrien und fehlenden Einfluss auf die Verbandsleitung zusätzlich befördert. Durch den Exit wird eine bereits bestehende oder neu etablierte Meta-Organisation gestärkt, die eine Subkategorie der bisherigen Mitgliedschaft repräsentiert (Ahrne und Brunsson 2008, S. 117). Sind Mitglieder mit dem Verband unzufrieden, ohne dass es Alternativen gibt, können claims for democracy (Ahrne und Brunsson 2011, S. 94) eingefordert werden, im Sinne stärkerer innerer Demokratisierung. Die Wahlrechte in Meta-Organisationen werden so zum wesentlichen Feld der Auseinandersetzung. onflikte um angemessene Wahlrechte (zur Stärkung von Voice) prägen bei geringen Austrittsmöglichkeiten sowohl sehr heterogene Verbände als auch diejenigen, die von wenigen Mitgliedern und deren Interessen dominiert werden (Ahrne und Brunsson 2008, S. 118 ff., 2011, S. 94 f.; Sack 2012). Wenn es Meta-Organisationen gelingt, sich intern so zu differenzieren, dass sie ihren Mitgliedern eine Vielzahl von Leistungen, Beteiligungsformen und Schlichtungsmöglichkeiten anbieten, also sowohl die Mitwirkungsmöglichkeiten als auch die Anzahl der Clubgüter erhöhen, dann können onflikte in der Mitgliedschaft entschärft werden. Es ergeben sich Möglichkeiten für einen partiellen Exit, also ein Opting-Out von bestimmten Pflichten. In diesem Sinne lässt sich beispielsweise die Entwicklung von OT-Verbänden interpretieren (Behrens 2011, S. 198 ff.; Haipeter in diesem Band). Der Exit von fokalen Mitgliedern mit einer hohen Ressourcenausstattung ist aus zwei Gründen eher unwahrscheinlich. So sind diese organisierten Mitglieder aufgrund ihrer apazitäten und ihrer zentralen Rolle in der Organisation durchaus in der Lage, auf die Verbandsleitung in ihrem Sinne einzuwirken. Die Drohung mit der Abwanderung seitens dieser Mitglieder kann auf die hauptamtliche Leitungsebene und den Stab wie auch auf die Gremien der Organisation disziplinierend wirken. Dies ist jedoch keineswegs zwingend. Weniger ressourcenstarke Mitglieder, denen jedoch in Gremien mit dem Prinzip,Ein Mitglied Eine Stimme erhebliches Gewicht zukommt, können den Prozess der kollektiven Willensbildung im Verband dazu nutzen, die großen Mitglieder zu übervorteilen. Dieser Prozess muss nun wiederum nicht zwangsläufig zum Austritt fokaler Mitglieder führen. Diese haben gerade aufgrund ihrer apazitäten nicht nur die Möglichkeit, wesentliche Clubgüter selbst zu erstellen, sondern sie können mit Blick auf kollektive Güter alternative, außerverbandliche Strategien verfolgen, die erfolgversprechend sind, etwa eigene Allianzen beim Lobbying bilden (Eising in diesem Band). Es handelt sich um eine weitere Form des partiellen Opting-Out. Die Situation stellt sich etwas anders dar, wenn sich innerhalb einer Meta-Organisation zwei Lager mit fokalen Akteuren gegenüberstehen. Wie bereits diskutiert, ergibt sich hier der Bedarf nach einem zusätzlichen Clubgut, nämlich dem der Mediation und des Brokerings. Die Leitungsebene der Assoziation kann also eine strategisch wichtige Position gegenüber Mitgliedern mit hohen apazitäten einnehmen. Allerdings handelt es sich um eine prekäre onstellation, insoweit die benannten Mitglieder über hinreichend Ressourcen verfügen, abzuwandern und alternative Meta-Organisationen zu gründen. Es hängt also viel am konkreten Management der
34 30 D. Sack, C. Strünck Meta-Organisation. Verbände vermitteln nicht einfach nur zwischen Umwelt und Mitgliedern; sie können Proteste selbst heraufbeschwören oder ihnen vorbeugen. Unzufriedenheit mit und innerhalb von Verbänden ist kein neues Phänomen. Wir haben jedoch versucht, einige theoretische Bezugspunkte neu zu ordnen. Erstens erscheint es uns sinnvoll, den Begriff der Loyalität (Hirschman) im Sinne eines an Eastman angelehnten Legitimitätskonzeptes weiter zu differenzieren, also verschiedene Objekte der Zurechnung von Angemessenheit zu identifizieren; dazu gehören dann eben neben kalkulativ-evaluativen Zurechnungen von Performanz auch die affektive Bindung an eine Gemeinschaft. Zweitens sehen wir für die Artikulation der Unzufriedenheit die (wahrgenommene) Ressourcenausstattung von individuellen und korporativen Akteuren wie auch neue Gelegenheitsstrukturen (etwa die Existenz alternativer Verbände) als bedeutsam an. Drittens sind die Strukturen der Mitgliedschaft systematisch in den Blick zu nehmen. Wir haben mit der Differenzierung in Verbände mit individuellen und organisierten Mitgliedern sowie den vier Modellen der Mitgliedschaft eine einfache idealtypische Unterscheidung vorgeschlagen. Viertens rücken wir den Begriff des Gutes in den Mittelpunkt, nicht den des Anreizes. Güter sind nicht gegeben, sondern werden von den Mitgliedern des Verbandes nachgefragt, sie werden als zweckmäßig, irrelevant oder gar diskriminierend wahrgenommen. Die skizzierten Umweltveränderungen, seien diese sozio-ökonomischer oder politisch-institutioneller Natur, wie auch der Wandel von Präferenzen bei den Mitgliedern übersetzt sich sowohl in den Bedarf an (neuen) Gütern als auch in die Einschätzung von (bisher erbrachten) Gütern. Auf diese beiden, empirisch messbaren Seiten des Gutes konzentriert sich der Wandel in der Verbandslandschaft. Von diesem Ausgangspunkt aus entwickeln sich die Tendenzen der Abwanderung und des Widerspruchs in etablierten Assoziationen. Bei der Ermittlung dieses Güterbedarfs sehen wir aber auch eine neue Linie für die empirische Forschung. Wer neue onfliktlinien verstehen will, wer die Frage beantworten will, in wessen Namen eigentlich Verbände Einfluss nehmen, der muss sich mit der Welt der Verbandsgüter beschäftigen. Diese Meta-Ebene kommt in der Verbändeforschung viel zu kurz. Wenn sich die Verbändeforschung dieser Ebene wieder stärker widmet, relativiert sich nicht nur der Abgesang auf die Mitglieder. Es wird auch deutlich, dass nicht alle Güter von alternativen Organisationen wie Agenturen, Anwaltskanzleien oder hauptberuflichen Lobbyisten angeboten werden können. urz: Es zeigt sich, wie relevant eine echte Verbändeforschung ist, die sich nicht in Lobbyismus-Studien erschöpft. Literatur Ahrne, Göran, und Nils Brunsson Meta-organizations. Cheltenham: Edward Elgar. Ahrne, Göran, und Nils Brunsson Organization outside organizations. The significance of partial organization. Organization 18(1): Ahrne, Göran, und Nils Brunsson How Much do Meta-Organizations Affect Their Members? In Weltorganisationen, Hrsg. Martin och, Wiesbaden: VS. Bajoit, und Guy Exit, voice, loyalty... and apathy. Les réactions individuelles au mécontentement. Revue française de sociologie 29(2): Barry, Brian Review Article Exit, Voice, and Loyalty. British Journal of Political Science 4(1):
35 Austritt und Widerspruch in Interessenorganisationen 31 Baumgartner, Frank R., M. Berry Jeffrey, Marie Hojnacki, David C. imball, und Beth L. Leech Lobbying and Policy Change. Who Wins, Who Loses, and Why. Chicago London: University of Chicago Press. Beck, Ulrich Die Erfindung des Politischen. Zu einer Theorie reflexiver Modernisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Behrens, Martin Das Paradox der Arbeitgeberverbände. Von der Schwierigkeit, durchsetzungsstarke Unternehmensinteressen kollektiv zu vertreten. Berlin: edition sigma. Bennett, Robert J., und J.A. Paul Robson Exploring the market potential and bundling of business association services. Journal of Services Marketing 15(3): Berkhout, und Joost Why interest organizations do what they do. Assessing the explanatory potential of exchange approaches. Interest Groups & Advocacy 2(2): Bernhagen, Patrick, Andreas Dür, und David Marshall Information or context. What accounts for positional proximity between the European Commission and lobbyists? Journal of European Public Policy 22(4): Beyers, Jan, Laura Andreas Dür Chaqués Bonafont, Rainer Eising, Danica Fink-Hafner, David Lowery, Christine Mahoney, William Maloney, und Daniel Naurin The INTEREURO Project. Logic and structure. Interest Groups & Advocacy 3(2): von Blumenthal, Julia, und Thomas von Winter Interessengruppen und Parlamente. Wiesbaden: VS. Buchanan, James M An economic theory of clubs. Economica 32(125):1 14. Campbell, Angus, Gerald Gurin, und E. Warren Miller The Voter Decides. Evanston: Row, Peterson and Company. Cathie, Martin Jo, und Duane Swank The political construction of business interests. Coordination, growth, and equality. Cambridge: Cambridge University Press. Czada, Roland Interessengruppen, Eigennutz und Institutionenbildung. Zur politischen Logik kollektiven Handelns. In Leistungen und Grenzen politisch-ökonomischer Theorie. Eine kritische Bestandsaufnahme zu Mancur Olson, Hrsg. laus Schubert, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Czada, Roland onjunkturen des orporatismus. Zur Geschichte eines Paradigmenwechsels in der Verbändeforschung. In Staat und Verbände, Hrsg. Wolfgang Streeck, Opladen: Westdeutscher Verlag. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Zugegriffen: 06. Juli Easton, David A systems analysis of political life. New York, London, Sydney: John Wiley & Sons. Eising, Rainer, Daniel Rasch, und Patrycja Rozbicka Institutions, policies, and arguments. Context and strategy in EU policy framing. Journal of European Public Policy 22(4): Gerlinger, Thomas, und Urban Hans-Jürgen Auf dem Weg zum Systemwechsel Gesundheitspolitik schwarz-gelb. Blätter für deutsche und internationale Politik 55(1): Groser, Manfred Grundlagen der Tauschtheorie des Verbandes. Ansatzpunkte zu einer Sozialökonomik des Verbandes. Berlin: Duncker & Humblot. Haipeter, Thomas OT-Mitgliedschaften und OT-Verbände. In Handbuch Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Deutschland, Hrsg. Wolfgang Schroeder, und Bernhard Weßels, Wiesbaden: VS. Hall, Peter A., und David Soskice Varieties of capitalism. The institutional foundation of comparative advantages. Oxford: Oxford University Press. Helfen, Markus Wirtschaftsverbände in Deutschland Zur Leistungsfähigkeit der politischen Organisationen der privaten Wirtschaft. urzstudie des Lehrstuhls für Internationales Management, RWTH Aachen. Aachen: RWTH Aachen. Hirschl, Bernd Erneuerbare Energien-Politik. Eine Multi-Level Policy-Analyse mit Fokus auf den deutschen Strommarkt. Wiesbaden: VS. Hirschman, Albert Otto Abwanderung und Widerspruch. Reaktionen auf Leistungsabfall bei Unternehmungen, Organisationen und Staaten. Tübingen: Mohr Siebeck. lüver, Heike, Caelesta Braun, und Jan Beyers Legislative lobbying in context. Towards a conceptual framework of interest group lobbying in the European Union. Journal of European Public Policy 22(4): Lang, Achim Interorganisatorische oordination von Wirtschaftsverbänden. Relationale Dynamiken zwischen Hierarchie und Wettbewerb. PVS Politische Vierteljahresschrift 52(1):51 77.
36 32 D. Sack, C. Strünck Lang, Achim, und Volker Schneider Wirtschaftsverbände. Verbandspolitik im Spannungsfeld von divergierenden Interessen und hierarchischer Integration. In Interessenverbände in Deutschland. Lehrbuch, Hrsg. Thomas von Winter, und Ulrich Willems, Wiesbaden: VS. Lang, Achim, arsten Ronit, und Volker Schneider From Simple to Complex. An Evolutionary Sketch of Theories of Business Association. In Organized Business Interests in Changing Environments. The Complexity of Adaptation, Hrsg. arsten Ronit, Jürgen R. Grote, Achim Lang, und Volker Schneider, Houndsmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lowery, David, und Virginia Gray A neopluralist perspective on research on organized interests. Political Research Quarterly 57(1): Luhmann, Niklas Zweckbegriff und Systemrationalität. Über die Funktion von Zwecken in sozialen Systemen. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Olson, Mancur Die Logik des kollektiven Handelns. ollektivgüter und die Theorie der Gruppen. Tübingen: Mohr Siebeck. Opp, arl-dieter Theories of political protest and social movements. A multidisciplinary introduction, critique, and synthesis. London New York: Routledge. Opp, arl-dieter, und Bernhard ittel The dynamics of political protest. Feedback effects and interdependence in the explanation of protest participation. European Sociological Review 26(1): Paster, Thomas Bringing power back in. A review of the literature on the role of business in welfare state politics. MPlfG Discussion Paper, Bd. 15/3. öln: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Platzer, Hans-Wolfgang Europäische Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände. In Handbuch Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Deutschland, Hrsg. Wolfgang Schroeder, und Bernhard Weßels, Wiesbaden: VS. Sack, Detlef Regieren und Governance in der BRD. Ein Studienbuch. München: Oldenbourg. Sack, Detlef, atharina van Elten, und Sebastian Fuchs Legitimität und Self-Governance. Organisationen, Narrative und Mechanismen bei Wirtschaftskammern. Baden-Baden: Nomos. Sack, Detlef Demokratisierung in der ammerlandschaft. Prozesse und mögliche Effekte am Beispiel der Wirtschaftsprüferkammer In Jahrbuch des ammer- und Berufsrechts 2011, Hrsg. Winfried luth, Halle (Saale): Peter Junkermann. Salisbury, Robert H An exchange theory of interest groups. Midwest Journal of Political Science 13(1):1 32. Schmitter, Philippe C., und Wolfgang Streeck The organization of business interests. Studying the associative action of business in advanced industrial societies. MPlfG Discussion Paper, Bd. 99/1. öln: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Schroeder, Wolfgang, Viktoria alass, und Samuel Greef Berufsgewerkschaften in der Offensive. Vom Wandel des deutschen Gewerkschaftsmodells. Wiesbaden: VS. Schulz-Walz, Franziska Mitgliederorientierte Organisationsgestaltung in Wirtschaftsverbänden. Bedeutung, Herausforderungen und onzeptionen. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag. Scott, W. Richard Organizations. Rational, natural, and open systems. Upper Saddle River: Prentice-Hall. Sebaldt, Martin Theorie und Empirie einer Forschungstradition. Das Panorama der klassischen Verbändeforschung. In lassiker der Verbändeforschung, Hrsg. Martin Sebaldt, und Alexander Straßner, Wiesbaden: VS. Simonson, Julia, Claudia Vogel, und Clemens Tesch-Römer Freiwilliges Engagement in Deutschland. Der Deutsche Freiwilligensurvey Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA). Stephen, Silvia J Mitgliederentwicklung und Organisationsstärke der Arbeitgeberverbände, Wirtschaftsverbände und Industrie- und Handelskammern. In Handbuch Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Deutschland, Hrsg. Wolfgang Schroeder, und Bernhard Weßels, Wiesbaden: VS. Stephen, Silvia J., und Wolfgang Schroeder Why are german employers associations declining? Arguments and evidence. Comparative Political Studies 40(12): Stoy, Volquart, und Josef Schmid Der Aufstieg der Linkspartei oder was passiert, wenn Loyalität schwindet. Zeitschrift für Parlamentsfragen 42(2): Streeck, Wolfgang, und Philippe C. Schmitter Private interest government. Beyond market and state. London: SAGE. Streeck, Wolfgang, und Jelle Visser Organized business facing internationalization. In Governing interests. Business associations facing internationalization, Hrsg. Wolfgang Streeck, Jürgen Grote, Volker Schneider, und Jelle Visser, London New York: Routledge.
37 Austritt und Widerspruch in Interessenorganisationen 33 Streeck, Wolfgang Interest heterogeneity and organizing capacity. Two class logics of collective action? In Political choice. Institutions, rules, and the limits of rationality, Hrsg. Roland M. Czada, Adrienne Windhoff-Heritier, und Hans eman, Frankfurt am Main: Campus. Traxler, Franz Interessenverbände der Unternehmer. onstitutionsbedingungen und Steuerungskapazitäten, analysiert am Beispiel Österreichs. Frankfurt am Main New York: Campus. Traxler, Franz The long-term development of organised business and its implications for corporatism. A cross-national comparison of membership, activities and governing capacities of business interest associations, European Journal of Political Research 49(2): Truman, David B The governmental process. Political interests and public opinion. New York: Praeger. van Waarden, Frans Zur Empirie kollektiven Handelns. Geschichte und Struktur von Unternehmerverbänden. In Leistungen und Grenzen politisch-ökonomischer Theorie. Eine kritische Bestandsaufnahme zu Mancur Olson, Hrsg. laus Schubert, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Vetter, Angelika Political Efficacy Reliabilität und Validität. Alte und neue Meßmodelle im Vergleich. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag. Westdeutscher Handwerkskammertag (WHT) Freiwilliges Engagement in einer ökonomisierten Welt. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Ehrenämter im NRW-Handwerk. Düsseldorf: Westdeutscher Handwerkskammertag. Westle, Bettina Politische Legitimität. Theorien, onzepte, empirische Befunde. Baden-Baden: Nomos.
38 II. Die Spaltung des apitals? onflikte in der organisierten Wirtschaft
39 Z Politikwiss (2016) (Suppl 2) 26:37 52 DOI /s AUFSÄTZE Opposition im Bundesverband der Deutschen Industrie Werner Bührer Online publiziert: 21. September 2016 Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 Zusammenfassung Bis heute hat es innerhalb des Bundesverbands der Deutschen Industrie keinen dauerhaften Protest, keine etablierte Opposition oder gar eine Spaltung gegeben. Dennoch bildeten sich seit der Gründung nach 1945 immer wieder oppositionelle Strömungen und Lager. Werner Bührer analysiert die Gründe für diese internen onflikte. Er zeigt, wie es der Verbandsspitze bis heute gelungen ist, Fliehkräfte in der deutschen Industrie innerverbandlich zu integrieren. Internal conflict in the Federation of German Industry Abstract The Federation of German Industry has not faced serious internal protest, let alone separatist movements. However, after the association was founded after World War II, seeds of conflict and disarray were planted. Werner Bührer scrutinizes reasons for internal rows. He traces the way the Federation s management has succeeded in mitigating those conflicts. 1 Einleitung Protest und Opposition gab und gibt es nach offizieller Lesart im Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) nicht von einer organisatorischen Spaltung ganz zu schweigen. Und dieses Problem kommt in den wichtigsten Arbeiten zum BDI (Braunthal 1965; Mann 1994; Burgmer 1999) explizit auch gar nicht vor. Lässt man die Geschichte des Spitzenverbands seit Oktober 1949 Revue passieren, fallen jedoch einige politische, wirtschafts- und personalpolitische Entwicklungen und Prof. Dr. W. Bührer ( ) TUM School of Education, Technische Universität München, Marsstr. 20, München, Deutschland Werner.Buehrer@tum.de D. Sack, C. Strünck (Hrsg.), Verbände unter Druck, DOI / _3, Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
40 38 W. Bührer Entscheidungen ins Auge, die im Verband höchst kontrovers diskutiert wurden und durchaus verbandsinternen Widerspruch bis hin zu massiven, teilweise auch öffentlich artikulierten Protesten gegen die Spitze des BDI auslösten. Dies war der Fall etwa im Streit um die Gründung der Montanunion 1950/51, das artell- bzw. Wettbewerbsgesetz Mitte der 1950er-Jahre, eine Fusion der Spitzenverbände Mitte der 1970er-Jahre einschließlich der Ausbootung des designierten Präsidenten, zeitgemäße Verbandsstrukturen angesichts zunehmender Europäisierung und Globalisierung seit den 1990er-Jahren. Zu nennenswerten Verbandsaustritten oder gar zu einer organisatorischen Abspaltung vom BDI kam es jedoch in keinem dieser Fälle. Das ist insofern bemerkenswert, als es ja 1895 mit dem Bund der Industriellen durchaus eine Gegen- bzw. Neugründung aus dem damaligen Spitzenverband der Industrie, dem Centralverband Deutscher Industrieller, heraus gegeben hatte und zwar unter anderem aufgrund von industrieinternen Differenzen in der artellfrage, in der Zoll- und Handelspolitik sowie in der Frage des Verhältnisses zu den Gewerkschaften. In der Literatur wird diese Spaltung übrigens mit der Existenz zweier großer Lager in der Industrie den Rohstoffproduzenten und der verarbeitenden Industrie erklärt (Ullmann 1988, S. 79 ff.). Ob das Verschwinden dieser Lager oder zumindest die Einebnung der Unterschiede zwischen ihnen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Erklärung für das Ausbleiben einer neuerlichen organisatorischen Spaltung taugt, darauf wird zurückzukommen sein. Jedenfalls entstanden bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ungefähr gleichzeitig die für lokale und regionale sowie teilweise öffentlich-rechtliche Belange zuständigen Industrieund Handelskammern und die freien, privatrechtlich und nach Branchen organisierten Wirtschaftsverbände, die sich um die wirtschaftspolitischen Interessen ihrer Mitglieder kümmerten. Etwas später wurden die Arbeitgeberverbände gegründet, die das sozial- und tarifpolitische Terrain für sich beanspruchten gründeten sowohl die Arbeitgeberverbände als auch die Wirtschaftsverbände und die ammern in Gestalt der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), des Ausschusses für Wirtschaftsfragen der industriellen Verbände die Umbenennung in BDI erfolgte im Frühjahr 1950 und des Deutschen Industrie- und Handelstages ihren jeweiligen Dachverband (Schroeder und Weßels 2010). Bereits vier Jahre nach riegsende war damit das traditionelle dreisäulige, horizontal nach Bundes- und Länderorganisationen und vertikal nach Industriezweigen und -sparten gegliederte deutsche Verbandssystem wieder hergestellt. Während der BDI in jenen Jahren als Sprachrohr und Vertretung der Großindustrie manche Beobachter waren sogar überzeugt: der Schwerindustrie galt, legte er seit den 1990er-Jahren großen Wert darauf, ein mittelständischer Verband zu sein: Mehr als 95 % der Firmen, die über unsere Mitgliedsverbände zum BDI gehören, immerhin , haben eine mittelständische Struktur, betonte der damalige Präsident Hans-Olaf Henkel (Henkel 2000, S. 9). Zurzeit umfasst der BDI 36 Mitgliedsverbände, denen ihrerseits über Unternehmen mit rund 8 Mio. Beschäftigten angehören (BDI 2016).
41 Opposition im Bundesverband der Deutschen Industrie 39 Im Folgenden möchte ich anhand der oben erwähnten Fälle erläutern, wie die Spitze des BDI mit Widerspruch und Protest umging, wie es ihr jeweils gelang, die Opposition ruhig zu stellen bzw. zu integrieren. Im Einklang mit der sozialwissenschaftlichen Verbändeforschung gehe ich somit von der Annahme aus, dass die Verbandspolitik von einer recht kleinen Zahl von ehren- und hauptamtlichen Personen Präsident, Präsidium, Hauptgeschäftsführung bestimmt wird (vgl. Teubner 1978, S. 55 f.). Unzufriedenheit unter den Verbandsmitgliedern mit der offiziellen Verbandspolitik kann sich in Form von entsprechenden Voten etwa bei Abstimmungen auf Mitgliederversammlungen, divergierenden öffentlichen Stellungnahmen oder Austritten bzw. Austrittsdrohungen äußern. Das begriffliche Instrumentarium, das die politikwissenschaftliche Oppositionsforschung entwickelt hat (vgl. Helms 2002, S. 9 ff.), dient hauptsächlich der Analyse demokratischer politischer Systeme und zeichnet sich durch ein parlamentszentrierte(s) Verständnis von Opposition aus (Helms 2002, S. 13). Deshalb ist es für die Analyse innerverbandlicher onflikte wenig geeignet. Schon eher lassen sich manche Begriffe verwenden, die sich in der historiographischen Forschung zum Widerstand im Dritten Reich teilweise auch in der DDR eingebürgert haben: Dies gilt insbesondere für den Terminus Verweigerung als gezieltes, systemkritisches und zum Teil auf öffentliche Wirkung bedachtes Verhalten etwa Boykott bestimmter Anordnungen und Vorschriften, Protest oder Widerspruch als öffentliche, massenhafte Missbilligung bestimmter Maßnahmen des Regimes, und Opposition als bewusste und organisierte Aktivitäten mit dem Ziel der Ablösung bzw. des Sturzes der Führung (vgl. Eckert 1995). Da auch diese Begriffe einem bestimmten historisch-politischen ontext entstammen, müssten sie gewissermaßen entnazifiziert werden, um sie zur Untersuchung der onflikte im BDI einsetzen zu können. Am besten geeignet erscheint die Begriffstrias Exit, Voice und Loyalty, die Hirschman vorschlägt, zumal er ausdrücklich erwähnt, dass sie auch auf Organisationen anwendbar sei (1970, S. 3). Auch wenn die Exit-Option im Falle eines konkurrenzlosen Spitzenverbands eher theoretischer Natur ist, können nennenswerter innerverbandlicher Dissens oder Austrittsdrohungen von der Verbandsspitze keinesfalls ignoriert werden. Dies gilt in noch höherem Maße für Voice, bei Hirschman definiert als any attempt [...] to change, rather than to escape from, an objectionable state of affairs, whether through individual or collective petition [...], or through various types of actions and protests, including those that are meant to mobilize public opinion (1970, S. 30). Im BDI dominierte allerdings, so mein Befund, ungeachtet gelegentlicher ritik am Präsidenten oder am Geschäftsführer, die dritte Option. Vorausschicken möchte ich, dass sich mein methodischer Zugriff auf die Thematik als Historiker genauer: Zeithistoriker von demeiner Sozialwissenschaftlerin oder eines Sozialwissenschaftlers unterscheidet: Der Beitrag, der auf einem Forschungsvorhaben zur Geschichte des BDI gründet, stützt sich vor allem auf Akten der Hauptgeschäftsführung und des Präsidiums, aber auch auf andere unveröffentlichte und veröffentlichte Unterlagen des BDI. Er versteht sich als Versuch einer exemplarischen empirischen Rekonstruktion des Umgangs mit verbandsinterner Opposition, ohne jedoch theoretische Aspekte gänzlich zu ignorieren.
42 40 W. Bührer 2 Protest gegen die Dominanz der Schwerindustrie im neuen Spitzenverband Der erste ernsthafte onflikt entstand sogar schon vor der Gründung des BDI. Selbstbewusst und ohne sich von der Last der Vergangenheit einengen zu lassen, steuerten einige Schwerindustrielle um den Generaldirektor der Oberhausener Gutehoffnungshütte, Hermann Reusch, ungeachtet der noch fehlenden rechtlichen Grundlage auf die Gründung eines Spitzenverbandes zu. Die Arbeitsgemeinschaft Eisen und Metall (AGEM), der auch die Elektroindustrie sowie die feinmechanische und optische Industrie angehörten, nahm wie selbstverständlich für sich das Recht in Anspruch, in Fragen von allgemeinem (wirtschafts-)politischem Interesse als Sprecherin der Gesamtindustrie aufzutreten. 1 Im Frühjahr 1949 hielt Reusch den Zeitpunkt für gekommen, diesem Anspruch eine noch breitere Legitimationsbasis zu verschaffen. Alle bedeutenden Verbände der Bizone wurden aufgefordert, der Arbeitsgemeinschaft das Mandat zu erteilen, treuhänderisch die Gründung eines Dachverbands vorzubereiten. Dieser Wirtschaftspolitische Ausschuss industrieller Verbände sollte die Zusammenarbeit koordinieren. Adressaten dieser Initiative waren insbesondere die Gesamtvertretungen der Chemieund der Textilindustrie. 2 Ihr eigentlicher Zweck dürfte indes darin bestanden haben, die Arbeitsgemeinschaft Eisen und Metall und vor allem deren engeren Vorstand vom Verdacht einer einseitigen Vertretung der britischen Zone und damit der Schwerindustrie zu befreien ein Anliegen, das angesichts der kritischen Haltung, die gewisse süddeutsche reise in der Industrie gegenüber der Arbeitsgemeinschaft einnahmen, durchaus verständlich war. 3 Gegen diesen Vorschlag erhoben nur die Vertreter der Textilindustrie Einspruch. Vor allem Otto A. H. Vogel, zugleich Präsident der Industrie- und Handelskammer Augsburg, sah die Gefahr einer Überorganisation, wenn neben der vorgesehenen Spitzenvertretung der ammern ein weiterer Dachverband in Erscheinung trete; außerdem monierte er das Übergewicht von Eisen und Stahl. Reusch erinnerte in seiner Antwort daran, dass es im deutschen Verbandswesen mit Arbeitgeberverbänden, Wirtschaftsverbänden und Industrie- und Handelskammern immer drei Säulen gegeben und diese Arbeitsteilung sich durchaus bewährt habe; den zweiten Einwand konterte er mit dem Hinweis, dass die Schwerindustrie in dem geplanten Zusammenschluss ebenso wenig wie in der Arbeitsgemeinschaft vertreten sei dort dominiere vielmehr die verarbeitende Industrie. Da er aus dem reis der übrigen Verbandsfunktionäre keine Unterstützung erhielt, stellte Vogel seine Bedenken vorerst zurück. Die weiteren organisatorischen Arbeiten übernahm ein sechsköpfiger Gründungsausschuss, dem außer Fritz Berg, dem späteren ersten Präsidenten des 1 Vgl. AGEM an ordt v , Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, NW 53/ Vgl. Protokoll der Besprechung des engeren Vorstands der AGEM am , Archiv der IH Augsburg (AIHA), NL Vogel, Industrie/AGEM Feb.-Mai Froehlich an Beutler v , BDI-Archiv (BDIA), RA 1.
43 Opposition im Bundesverband der Deutschen Industrie 41 BDI, und Reusch Repräsentanten der Chemie- und der Bauindustrie angehörten; nachträglich wurde Vogel für die Textilindustrie benannt. 4 Waren die Sorgen Vogels wegen des Übergewichtes der Schwerindustrie berechtigt? Zwar spielte mit Reusch ein Stahlindustrieller in der Arbeitsgemeinschaft eine maßgebliche Rolle, doch die eigentliche Interessenvertretung dieser Branche, die Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, hatte sich bereits im Juni 1948 aus der Arbeitsgemeinschaft zurückgezogen. Und der Steinkohlenbergbau hatte sich an den Versuchen zur Gründung eines Spitzenverbandes von Anfang an nicht beteiligt, da in diesem Industriezweig keine freie Interessenvertretung existierte (Abelshauser 1984, S. 50 f.). Die gängige These vom dominierenden Einfluss der Schwerindustrie bei der Formierung einer neuen Spitzenorganisation nach Art des früheren Reichsverbandes der Deutschen Industrie, wie sich Reusch einmal ausdrückte, ist also schon aus diesen Gründen zu relativieren. 5 Aber auch der ostenverteilungsschlüssel, der in der Regel einen gewissen Eindruck von den räfteverhältnissen in einem Verband vermittelt, stützt diese These nicht. Wie aus einer Aufstellung vom November 1948 hervorgeht, finanzierten drei Verbände die Vertretungen der Elektro-, der Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie sowie des Maschinenbaus zu jeweils 15 % die Auslagen der Arbeitsgemeinschaft Eisen und Metall, fünf weitere brachten jeweils 10 und die feinmechanische und optische Industrie 5 % auf. 6 Ein Übergewicht einer Branche lässt sich daraus nicht ableiten. Und Reusch schließlich agierte in seinem Amt nicht als Interessenvertreter seiner Branche, sondern der Industrie insgesamt. In der Stahlindustrie waren vielmehr warnende Stimmen zu vernehmen, aus der Arbeitsgemeinschaft könnte, nach Weimarer Muster, ein Bündnis der verarbeitenden Industrien gegen die Stahlerzeugung entstehen. Reusch war übrigens über den Rückzug des gewerkschaftsinfiltrierten Stahlverbandes keineswegs unglücklich, ließ sich doch unter diesen Bedingungen seine Absicht, die Arbeitsgemeinschaft zum letzten Bollwerk der Unternehmerschaft auszubauen, leichter verwirklichen. 7 Da die Opposition gegen den geplanten Spitzenverband hauptsächlich aus dem Textilverband kam, wurde ein Treffen zwischen Mitgliedern des Gründungsausschusses und dem Präsidium von Gesamttextil arrangiert. Doch eine Annäherung der Standpunkte gelang nicht. Vogel erneuerte für die Textilseite, unterstützt von anderen Präsidiumsmitgliedern, seinen Vorschlag einer engeren Verzahnung der Industrie- und Handelskammern und der Wirtschaftsverbände dergestalt, dass die Landesvertretungen des Spitzenverbandes aus den länderweise zusammenzufassenden Industrieabteilungen der ammern, und zwar unter Abstimmung mit den Landesorganisationen der Wirtschaftsverbände, gebildet werden sollten. 4 Protokoll der Besprechung industrieller Wirtschaftsverbände am und, aus der Sicht der Arbeitsgemeinschaft Gesamttextil, Vermerk Staratzke v , AIHA, NL Vogel, Industrie/AGEM Feb.- Mai (sic!) Diese These z. B. bei Berghahn, Unternehmer, S. 63 f.; das Zitat aus Reusch an Erhard v , Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv (RWWA), NL H. Reusch, / Vorläufiger Verteilungsschlüssel für die Auslagen der AGEM v mit Begleitschreiben AGEM an WV Elektroindustrie v , BDIA, RA 1. 7 Die Formulierung aus Reusch an Wellhausen v , Bundesarchiv, oblenz (BA), NL Blücher/94.
44 42 W. Bührer Und sein Wuppertaler ollege Carl Neumann unterstrich, dass die neue Spitzenorganisation kein Interessentenverband im Stile von 1914 sein dürfe und nicht zuletzt aus ostengründen der Grundsatz größter Einfachheit beachtet werden müsse. Reusch, AGEM-Geschäftsführer Wilhelm Beutler und die übrigen Mitglieder des Gründungsauschusses beharrten dagegen auf einer klaren Trennung zwischen Verbänden und ammern. Reusch begründete diesen Standpunkt damit, dass der Zentralverband bei den kommenden wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen möglichst schlagkräftig sein müsse und der dafür erforderliche einfache Aufbau durch eine komplizierte Verbindung von Industrieabteilungen und Wirtschaftsverbänden von vorherein verhindert werde. Um die Gegenseite zu beruhigen, versicherte Reusch, dass Interessen-, aber keine Interessentenpolitik betrieben werden solle, und Beutler schlug vor, die personelle Zusammensetzung der geplanten Landesverbände den im jeweiligen Bundesland ansässigen Mitgliedsverbänden zu überlassen. 8 Weil es Vogel offensichtlich gelang, in Bayern und Württemberg Unterstützung für seine Pläne zu mobilisieren, wuchs sich die Auseinandersetzung allmählich zu einem Nord-Süd-onflikt aus, in den persönliche Animositäten, die latente Rivalität zwischen Wirtschaftsverbänden und ammern sowie ein tiefverwurzeltes Misstrauen gegen die Schwerindustrie an Rhein und Ruhr hineinspielten. Je näher die geplante Gründungsversammlung rückte, desto heftiger wurde der Streit zwischen der Arbeitsgemeinschaft Eisen und Metall und den süddeutschen Frondeuren. Reusch warf den ammern vor, sie wollten die Industrieverbände klein halten und würden unberechtigte Führungsansprüche erheben. 9 Vogel wiederum unterstellte Reusch, er wolle die Industrie- und Handelskammern vernichten, um in eigennütziger Weise eine neue Organisation aufziehen zu können; es sei sinnlos, wie vor 1932 wieder zwei Spitzen zu bilden, die sich nicht nur unter sich, sondern auch vor den Behörden bekämpfen und gerade das tun, was wir alle miteinander nicht wollen. 10 Grundsatzfragen der Wirtschafts- und Ordnungspolitik spielten in dieser ontroverse mit wechselnden Fronten keine Rolle. Reusch und seine Mitstreiter ließen sich durch industrieinterne Bedenken jedoch nicht beirren, zumal auch der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft, Ludwig Erhard, das Vorhaben wohlwollend begleitete. 11 Der Streit zwischen Nord und Süd konzentrierte sich angesichts des näher rückenden Termins für die Gründung auf die Besetzung der Ämter. Zwischen dem 7. und dem 14. Oktober tobte eine regelrechte Telegramm-Schlacht zwischen Augsburg und Düsseldorf, dem Sitz der AGEM Notiz über die Verhandlungen des Gründungsausschusses mit dem Präsidium Gesamttextil am , RWWA, NL H. Reusch, /228. In einem Brief an BDI-Präsident Necker v hat einer der Teilnehmer an diesem Treffen, der damalige Hauptgeschäftsführer von Gesamttextil, Hans-Werner Staratzke, bestritten, dass der Vorschlag, die Industrieabteilungen der ammern zu einem wichtigen Pfeiler des geplanten Spitzenverbandes zu machen, in den Auseinandersetzungen eine größere Rolle gespielt habe. Die überlieferten Protokolle vermitteln indes einen anderen Eindruck. (Eine opie dieses Briefes hat mir dankenswerterweise Herr Franz, damals Leiter der Abteilung Europapolitik im BDI, überlassen.) 9 Reusch an Wellhausen v , BA, NL Blücher/ Vogel an van Delden v , AIHA, NL Vogel, Industrie/AGEM, Feb.-Mai (sic!) Pohle an Zangen v , Mannesmann-Archiv, M Zahlreiche Belege in AIHA, NL Vogel, Industrie/AGEM, Feb.-Mai (sic!) 1949.
45 Opposition im Bundesverband der Deutschen Industrie 43 Umkämpft war insbesondere das Amt des Präsidenten. Die Eisenleute favorisierten Fritz Berg, die Textilindustrie Carl Neumann. Eine ampfkandidatur Neumanns, die Vogel eine Zeitlang befürwortet hatte, scheiterte daran, dass Neumann selbst wenig Neigung zeigte. Der entscheidende Schachzug der nicht-bayerischen Mitglieder des Gründungsausschusses dürfte indes darin bestanden haben, mit Vogel den hartnäckigsten Widersacher als andidaten für das Amt des Vizepräsidenten einzubinden. Nach dieser Entscheidung entspannte sich die Lage merklich, wenngleich Vogel und Neumann unmittelbar vor der konstituierenden Sitzung heftige ritik an den vorgesehenen Wahlen des Präsidenten und der Präsidiumsmitglieder übten und sogar mit dem Gedanken spielten, ihre Mitarbeit aufzukündigen. 13 So konnte am 19. Oktober 1949 in öln die zumindest nach außen einigermaßen harmonisch wirkende Gründungsversammlung stattfinden. 14 Zum Präsidenten wurde Fritz Berg gewählt, zu einem der beiden Vizepräsidenten Vogel. Mit anderen Worten, der hartnäckigste Opponent wurde ruhiggestellt, indem er mit einem repräsentativen Posten im neuen Spitzenverband bedacht wurde. Welche Motive Vogel letztlich leiteten, gegen Reusch und dessen Mitstreiter zu opponieren, lässt sich anhand der verfügbaren Akten nicht zweifelsfrei klären. Gegen die Vermutung, er habe gewissermaßen im Interesse der Industrie- und Handelskammern gehandelt, spricht seine eher unbedeutende Rolle im DIHT, wo er keinesfalls als Wortführer in Erscheinung trat. Plausibler erscheint deshalb die Annahme, er habe eine neuerliche Vorherrschaft der Ruhrindustrie unbedingt verhindern wollen. Einen drohenden Exit und die mögliche Gründung eines konkurrierenden Spitzenverbands konnten Reusch und Berg jedenfalls dadurch verhindern, dass sie auf die ritik an ihrem urs eingingen und die befürchtete schwerindustrielle Dominanz durch die Aufnahme weiterer Repräsentanten anderer Branchen in die maßgeblichen Gremien des neuen Dachverbands verminderten. Voice hatte sich für die Opponenten also ausgezahlt. 3 Widerspruch gegen die Montanunion 1950/51 Innerverbandlicher und industrieinterner Dissens machte sich auch in der Frage der europäischen Integrationspolitik bemerkbar. Anders als die Organisation for European Economic Cooperation löste die zweite Integrationsinitiative der Nachkriegszeit, der Schumanplan und die daraus hervorgegangene Europäische Gemeinschaft für ohle und Stahl (EGS), beim BDI zwiespältige Reaktionen aus. Schon die erste ausführlichere Stellungnahme vom 7. Juni 1950 auf den Vorschlag des französischen Außenministers Robert Schuman zur Zusammenlegung der Montanindustrien Deutschlands, Frankreichs und anderer westeuropäischer Länder schwankte zwischen grundsätzlicher Zustimmung und der Sorge, dass eine neue überstaatlich 13 Vermerk Staratzke v , AIHA, NL Vogel, BDI, Okt ; Stelter an Lange v , Archiv für Christlich-Demokratische Politik (ACDP), VI /1. 14 Vgl. Einladung und Gründungsaufruf in: Mannesmann-Archiv, M
46 44 W. Bührer fundierte Bürokratie mit ausgesprochen planwirtschaftlichen Tendenzen entstehen könnte. 15 Der Bundesverband erhoffte sich von der Montanunion ein Ende sowohl der alliierten ontrollen und Restriktionen in den beiden für den Wiederaufbau so wichtigen Industriezweigen als auch der als diskriminierend empfundenen Dekonzentrationsund Dekartellisierungspolitik. An den Verhandlungen über den Schumanplan waren Vertreter des BDI nur in untergeordneter Funktion beteiligt: Berg und Reusch gehörten zwar dem zur Beratung der deutschen Unterhändler eingesetzten wirtschaftlichtechnischen Ausschuss an, nahmen an den Sitzungen aber nur sporadisch teil. Als zumindest das Ziel gleicher Startbedingungen in der entscheidenden Verhandlungsphase im Frühjahr 1951 in weite Ferne rückte und überdies die ursprünglich vorgesehenen Mitsprachemöglichkeiten der Industriellen zu Gunsten der Leitungsinstanz der geplanten ohle-stahl-gemeinschaft der Hohen Behörde immer mehr eingeschränkt wurden, verschärften Berg und Reusch zusammen mit anderen Industriellen ihre ritik an dem Projekt. Sieforderten, den Vertrag nur zu unterzeichnen, wenn gewährleistet sei, dass die deutsche Seite bei der Produktion, den Investitionen und der Organisation damit war vor allem der Erhalt der Verbundwirtschaft, d. h. des Zechenbesitzes der Stahlwerke gemeint gegenüber ihren onkurrenten aus den anderen Mitgliedsländern nicht benachteiligt werde. Außerdem bemängelten sie den starken Dirigismus und die Bewirtschaftungsvollmachten der Hohen Behörde (Bührer 1986; ipping 1996). Doch diese Proteste, die zum Teil heftiger ausfielen als jene der unmittelbar betroffenen Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, blieben nicht zuletzt deshalb letztlich ohne Erfolg. Die Befürworter einer konsequenten Obstruktionspolitik, allen voran die graue Eminenz des BDI, Hermann Reusch, konnten sich gegen die kompromissbereiten räfte im Präsidium und unter den Verbandsmitgliedern nicht durchsetzen. Offenbar wollte die BDI-Spitze keinen onflikt mit der Eisen- und Stahlindustrie riskieren, deren Repräsentanten mehrheitlich auch gegen den Standpunkt Reuschs für eine konstruktive Mitarbeit in der Montanunion eintraten (Bührer 2008, S. 54 ff.). Das Dilemma, in dem sich der Bundesverband angesichts der Integrationsinitiativen der fünfziger Jahre befand, wird am Beispiel der EGS besonders deutlich: Die widerwillige Akzeptanz der Montanunion resultierte in erster Linie aus der Einsicht in die politische Notwendigkeit; unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten hätte der BDI eine Beteiligung der Bundesrepublik nämlich ablehnen müssen. Dass ein rasches deutsches Comeback von der aktiven Beteiligung an den Bemühungen um die wirtschaftliche Integration Europas, in welcher Form auch immer, abhing, daran zweifelte in den maßgeblichen reisen der Industrie allerdings kaum jemand. Insofern konnte es die Spitze des BDI gewiss verschmerzen, dass die kooperationswilligen und kompromissbereiten räfte in der Industrie und im Verband letztlich die Oberhand behielten. Der Dissens musste nicht ausgetragen werden, der BDI konnte sein Image als kompromissloser Verteidiger deutscher wirtschaftspolitischer Interessen wahren, indem er den Repräsentanten der Schwerindustrie 15 Rede Bergs, Protokoll erste ordentl. Sitzung Hauptausschuss u. erste wirtschaftspolit. Tagung in Schwetzingen am , S. 16.
47 Opposition im Bundesverband der Deutschen Industrie 45 zeitweise das Feld praktischer Europapolitik überließ. Eine Exit -Drohung hatte in dieser Auseinandersetzung gar nicht im Raum gestanden, die von den meisten Eisen- und Stahlindustriellen praktizierte Voice -Option wurde dadurch ihrer im Grunde durchaus BDI-kritischen Tendenz beraubt, dass die Differenzen über die richtige Integrationspolitik zumindest vorübergehend externalisiert wurden. 4 Streit um das Wettbewerbsgesetz Ging es in der Frage der europäischen Integration in erster Linie um industriebzw. verbandsinterne Differenzen, standen sich in der Auseinandersetzung um das Wettbewerbs- bzw. artellgesetz zunächst hauptsächlich der BDI-Präsident und der Bundeswirtschaftsminister gegenüber. Die Abwehrfront gegen die Pläne Erhards, organisiert und angeführt von schwerindustriellen reisen im BDI und in der Dachorganisation der Industrie- und Handelskammern, dem Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT), trug am Ende maßgeblich dazu bei, einen radikalen Bruch mit der deutschen artelltradition zu verhindern. Von Anfang an lehnte der BDI einen ruinösen Wettbewerb ab. Er begründete seine Haltung mit der Notwendigkeit, die kleineren und mittleren Betriebe zu schützen und soziale Belastungen etwa in Folge von Firmenpleiten zu vermeiden. Außerdem verwies er auf die Existenz ausländischer artelle, deren Druck die deutsche Industrie nicht schutzlos ausgeliefert werden dürfe. 16 Ob diese Ziele mit einer Verbots- oder einer Missbrauchsregelung erreicht werden sollten, ließ der Bundesverband zunächst offen. Erst als der Bundeswirtschaftsminister und sein ollege vom Justizministerium auf ein generelles artellverbot zusteuerten, bezog der BDI eindeutig Stellung: Die Verbotsgesetzgebung in der im Herbst vorliegenden Fassung, hieß es in einer Erklärung des Präsidiums vom 9. November, sei aus wirtschaftlichen Gründen nicht tragbar und wecke starke verfassungsrechtliche und verwaltungstechnische Bedenken. Ein auf dieser Grundlage erlassenes Gesetz würde eine rechtliche und moralische Diskriminierung der deutschen gewerblichen Wirtschaft bedeuten, eine allgemeine Rechtsunsicherheit und dadurch eine Lähmung der Unternehmerinitiative zur Folge haben und letztlich erhebliche Gefahren für die soziale Marktwirtschaft in sich bergen. Ferner würde ein solches Gesetz die Bundesrepublik in Europa in eine Außenseiterrolle drängen, die mit den Integrationsbestrebungen im europäischen Wirtschaftsraum nicht vereinbar sei. 17 Um für seinen Standpunkt zu werben, intensivierte der BDI nicht nur seine ontakte zum Bundeswirtschaftsministerium und anderen mit der Materie befassten staatlichen und parlamentarischen Stellen, er regte auch eine Studienreise in die USA an und organisierte eine Diskussionsveranstaltung, auf der artellanhänger und -gegner zu Wort kamen. 16 Themenliste für die Unterredung mit Adenauer, ohne Datum (November 1949), AIHA, Nachlass Vogel, Nr Zit. n. Walter Herrmann, Der organisatorische Aufbau und die Zielsetzungen des BDI, in: Bundesverband der Deutschen Industrie (Hg.), Fünf Jahre BDI. Aufbau und Arbeitsziele des industriellen Spitzenverbandes, Bergisch Gladbach, Heider-Verlag, 1954, S. 37 ff., bes. S. 71.
48 46 W. Bührer Nachdem sich der BDI in der Öffentlichkeit zunächst mit ritik an dem urs Erhards zurückgehalten hatte, um die Alliierten nicht zum Eingreifen zu provozieren, eskalierte der Streit im Laufe des Jahres Der Bundeswirtschaftsminister wurde des Dogmatismus geziehen, dieser konterte mit dem Vorwurf, der BDI wolle die alte artellherrlichkeit restaurieren. Eine neuerliche Attacke Erhards gegen die drohende unternehmerische Planwirtschaft beantwortete der BDI-Präsident mit einer Verteidigung der artelle, die durchaus mit der Marktwirtschaft vereinbar seien und zur Abschwächung von onjunkturschwankungen beitragen könnten; ein artellverbot beeinträchtige hingegen die erwünschte Steigerung der Produktivität und begünstige onzentration und Bürokratisierung. 18 Unterdessen hatte das abinett einen auf dem Verbotsprinzip basierenden Gesetzentwurf verabschiedet und Bundesrat und Bundestag zugeleitet. Eine abschließende Behandlung während der ersten Legislaturperiode erfolgte jedoch nicht, weil selbst die Fraktionen der Regierungsparteien CDU/CSU und FDP das Gesetzesvorhaben keineswegs einhellig unterstützten. Der anfängliche Eindruck einer einheitlichen Ablehnung einer Verbotsregelung in der Industrie täuschte indes. Meinungsverschiedenheiten zeigten sich nämlich auch im Unternehmerlager selbst. Je nach Industriezweig, Firmengröße und Art der produzierten Güter war das Interesse an artellen unterschiedlich stark ausgeprägt. onnte der BDI anfangs auf eine hohe Zustimmung zu seiner Politik verweisen, so begann die Front 1953/54 zu bröckeln. Fest an der Seite des BDI stand die Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie. Deren Vorsitzender Gerhard Schroeder beklagte auf der Mitgliederversammlung im Mai 1955, dass ohle und Eisen selbst in Zeiten einer Hochkonjunktur niemals in der Lage gewesen seien, ihre Preise an der höheren Nachfrage auszurichten, also zu erhöhen: Dann muss man sich aber auch zu dem Grundsatz bekennen, dass bei rückläufiger Entwicklung des Marktes die Anforderungen an das marktwirtschaftliche Verhalten der Eisen- und Stahlindustrie nicht übersteigert werden dürfen. 19 Mit anderen Worten: die WVESI war nicht bereit, in risenzeiten die Preisbildung in der Stahlindustrie dem Markt mit seinem Spiel von Angebot und Nachfrage zu überlassen. Schroeder verriet zwar nicht, wie man sich die Festlegung der Preise stattdessen vorstellte, doch war das sicherlich nicht ohne gewisse kartellartige Absprachen möglich. In anderen Branchen war die Solidarität mit dem harten urs des BDI weniger stark ausgeprägt. Nachdem zunächst nur die Interessenvertretung der markenorientierten onsumgüterindustrie und die Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer (ASU) Sympathien mit Erhards onzeption zu erkennen gegeben hatten, meldete im Juli 1954 eine Gruppe von 31 zum Teil namhaften Industriellen in einem Brief an Berg ritik an der Linie des BDI an, indem sie für ein artellverbot votierten. Zu den Unterzeichnern gehörten. Blessing (Margarine-Union), W. van Delden (Gesamttextil), A. Haffner (Salamander-Werke), G. Henle (löckner), F. Janssen (rupp), A. noerzer (Bosch), H. Nordhoff (Volkswagen), W. Soehngen (Rhein- 18 Der Briefwechsel ist dokumentiert in der Zeitschrift Wirtschaft und Wettbewerb 1952, Hefte 11 u Schroeder zit. n. H. Uebbing, Stahl, S. 296.
49 Opposition im Bundesverband der Deutschen Industrie 47 stahl), O. Springorum (Gelsenkirchener Bergwerks AG), M. H. Schmid (Zellstoff Waldhof), H. Winkhaus (Mannesmann) und W. Ziervogel (Ruhrgas) also keineswegs nur Repräsentanten der onsumgüterindustrie (Berghahn 1985, S. 177). 20 Ihre Zustimmung zum Verbotsprinzip machten diese Unternehmer, was in der einschlägigen Literatur oft unterschlagen wird, allerdings davon abhängig, dass das Gesetz gewisse Ausnahmen wie Rationalisierungs- und onditionenkartelle zuließ. Zwar solidarisierte sich das Präsidium des BDI daraufhin mit Berg, und der Präsident beeilte sich, Erhard zu informieren, dass das allgemeine Missbrauchsprinzip nach wie vor von der überwiegenden Mehrheit der Industrie als die zweckmäßigste und gerechteste Lösung angesehen werde. 21 Gleichwohl bedeutete die Aktion der 31 Dissidenten aus der Wirtschaft zweifellos eine Schwächung der Position des BDI. Bergs Hoffnung, den Bundeskanzler für den Standpunkt des BDI zu gewinnen, weil gegen den Widerstand großer Teile der Industrie kein Gesetz durchzubringen sei, erfüllte sich ebenfalls nicht. Zwar zeigte sich Berg in einem Telegramm an onrad Adenauer von dem Beschluss der Bundesregierung, das artellgesetz ohne die vom BDI verlangten Änderungen dem Bundestag vorzulegen, persönlich verletzt ; aber selbst die von Berg geäußerte Sorge, dass damit die Existenz der mittelständischen Industrie auf das Schwerste gefährdet sei, beeindruckte den Bundeskanzler nicht. 22 Solche Manöver verärgerten lediglich den Bundeswirtschaftsminister, der kein Verständnis dafür zeigte, dass der BDI-Präsident immer gleich Rückhalt beim anzler suche, statt sich mit ihm auseinanderzusetzen. Schließlich könne die Regierung nicht so weit gehen, nur Gesetze zu verabschieden, die der Bundesverband gebilligt habe. 23 Die im September beginnenden Gespräche zwischen den Beamten des Wirtschaftsministeriums und den artellexperten des BDI die zuständige Abteilung für Wettbewerbsordnung leitete inzwischen ausgerechnet Arno Sölter, der sich in den vierziger Jahren einen Namen als Verteidiger der artelle gemacht hatte mündeten denn auch in einem Gesetzentwurf, der zwar dem Verbotsprinzip folgte, aber viele Ausnahmen zuließ. Es dauerte indes noch zwei Jahre, ehe sich der Bundesverband in einer Gemeinschaftserklärung der Spitzenverbände der Wirtschaft vom 1. September 1956 wenigstens nach außen hin mit dem artellverbot abfand. In dieser Erklärung bekannten sich die Verbände zwar zum Leistungswettbewerb als einem Grundpfeiler der sozialen Marktwirtschaft, allerdings mit der Einschränkung, dass dieser Leistungswettbewerb keine schrankenlose Freiheit im Markte bedeute: Um ein Höchstmaß an volkswirtschaftlichem Ertrag sicherzustellen und unsere mittelständische Wirtschaftsstruktur nicht durch Wettbewerbsauswüchse zu 20 Seibt an Müller-Armack u. a., , BA, B 102/17084, H. 1; Vgl. J. Poeche, Die Stellungnahme der westdeutschen Industrie zum Entwurf eines Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, unveröffentlichte Diplomarbeit, 1963, S. 27 ff. (Der Verf. dankt Herrn Poeche für die Erlaubnis zur Benutzung der Arbeit). 21 Berg an Erhard, , BA, B 102/17084, H Berg an Adenauer, , ibid., B 102/17084, H Cf. Rücksprache mit Erhard am , ACDP, I /2; IV. Logbuch, , Nachlass Otto A. Friedrich (Der Verf. dankt Paul J. Friedrichs für die Erlaubnis zur Benutzung des Nachlasses).
50 48 W. Bührer gefährden, bedürfe der Wettbewerb vielmehr einer Ordnung. 24 Intern wurden die Zweifel an den Theorien des reinen Marktautomatismus und der unfehlbaren Intelligenz des freien Marktes sogar noch deutlicher artikuliert. 25 Welche Merkmale im Umgang der BDI-Spitze mit einer zahlenmäßig zwar nicht bedrohlich großen, aber doch durch einige prominente Namen gekennzeichneten Opposition lassen sich im Streit um das artellgesetz erkennen? Verschweigen konnte der BDI die Differenzen nach dem öffentlichen Vorstoß der ritiker nicht, also bemühte er sich, die ontroverse herunterzuspielen und die Opponenten zu marginalisieren. Fast alle Mitgliedsverbände des BDI hätten sich immer wieder für den Missbrauchsgrundsatz ausgesprochen, so der Jahresbericht 1954/55, daran könne auch die Tatsache nichts ändern, dass einzelne Industrielle sich bisweilen in Äußerungen und Veröffentlichungen auf den Boden der Verbotsgesetzgebung gestellt hätten. Dafür mussten die Abweichler auch ritik einstecken: Aus welchen Gründen dies auch geschehen sei auf jeden Fall sei es verfehlt, diejenigen Unternehmer, die auf das artellinstrument angewiesen seien, als wettbewerbsfeindlich zu bezeichnen. 26 Exit war auch in dieser Auseinandersetzung für die ritiker des offiziellen urses in der artellfrage keine ernsthafte Option. Der BDI reagierte auf den öffentlich artikulierten Protest Voice, indem er seinem Präsidenten den Rücken stärkte und in den entscheidenden Gesprächen mit dem Wirtschaftsministerium doch eine etwas höhere ompromissbereitschaft an den Tag legte. 5 Meinungsverschiedenheiten über die Fusion der Spitzenverbände BDI und BDA Die Möglichkeit der wirtschafts- und sozialpolitischen Interessenvertretung der Unternehmerschaft durch einen Verband war, wie erwähnt, bereits unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, im Zusammenhang mit der Reorganisation unternehmerischer Interessenverbände, diskutiert, jedoch bald und ohne größere Widerstände von Seiten der Fürsprecher einer Einheitslösung verworfen worden. Einzelne Unternehmer und Verbandsfunktionäre brachten diese Idee jedoch immer wieder ins Gespräch mit dem Argument, dadurch Doppelarbeit vermeiden und folglich osten einsparen zu können. Während seiner zweiten Amtsperiode, die von 1974 bis 1976 dauerte, griff BDI-Präsident Hans-Günther Sohl diesen Gedanken auf, zumal mit Hanns Martin Schleyer ein geeigneter andidat zur Verfügung zu stehen schien. Seinen Vorstoß begründete Sohl u. a. damit, dass die deutsche Industrie einen einheitlichen Spitzenverband brauche, der in der Wirtschafts- und Sozialpolitik gleichermaßen kraftvoll auftreten könne. Mit seinem Wunschkandidaten für den Posten war er sich einig, dass die angestrebte Fusion der beiden Verbände zunächst durch die in Personalunion wahrgenommenen Präsidentenämter vorbereitet werden sollte mit dem Ziel, die Zusammenar- 24 BDI-Jahresbericht 1956/57, S Vgl. Poeche, Stellungnahme, S. 31 ff. 26 BDI-Jahresbericht 1954/55, S. 172 f.
51 Opposition im Bundesverband der Deutschen Industrie 49 beit rationeller, kostensparender und noch effizienter zu gestalten. Eine öffentliche Diskussion des Fusionsplanes hielt er für verfrüht, da der Begriff heute noch als Reizvokabel missverstanden und missbraucht werde. Er vereinbarte mit Schleyer deshalb strikte Vertraulichkeit über die Details ihrer Absprache: Es sollte uns nicht stören, dass diese politische onzeption, von der für die Zukunft unseres Landes viel abhängen kann, zunächst nur auf unserer beider Augen (sic!) und auf unserem Vertrauen zueinander beruht. Viele wichtige Dinge in der Geschichte sind auf die gleiche Weise entstanden. 27 Diese abschließende, pathetische Bemerkung lässt erkennen, dass Sohl die geplante Fusion nicht als rein organisatorische Maßnahme verstanden wissen wollte, sondern als Entscheidung von weitreichender politischer Bedeutung. Auf der Präsidiumssitzung des BDI am 28. Januar 1976 stellte er seinen Vorschlag einer Doppelpräsidentschaft zur Diskussion, um bei Aufrechterhaltung der Selbständigkeit der Organisationen ökonomisch noch rationeller und politisch noch effizienter handeln zu können. Der designierte Nachfolger im Amt des BDI-Präsidenten, urt Hansen vom Bayer-onzern, sollte zu gegebener Zeit seinen Platz für Schleyer räumen. Das BDI-Präsidium stimmte diesem Vorschlag laut Protokoll zu. 28 Ob Sohl insgeheim bereits vorher entschlossen war, Schleyer ohne das Intermezzo Hansen zu installieren, oder ob diese Idee erst nach und nach aufkeimte, lässt sich anhand der vorhandenen Akten nicht eindeutig klären. Um den Plan der Doppelpräsidentschaft für die Hansen nach Sohls Überzeugung nicht in Frage kam zügig verwirklichen zu können, musste Hansen jedenfalls zum freiwilligen Verzicht auf das Amt des BDI-Präsidenten, das er frühestens zum 1. Januar 1977 hätte antreten können, bewegt werden kein ganz einfaches Unterfangen. Auf einer gemeinsamen Präsidial- und Vorstandssitzung Ende März 1976 fasste Sohl die bisherigen verbandsinternen Überlegungen dahingehend zusammen, dass sein Vorschlag einer Personalunion auf Präsidentenebene ein weitgehend positives Echo gefunden habe, dass es jedoch in den Stimmungen und Meinungen...Nuancierungen gebe, die widersprüchlich seien. Einerseits sei der Wunsch nach einer baldigen Fusion der beiden Verbände zu vernehmen, andererseits die Befürchtung, dass sich durch eine Doppelpräsidentschaft im Grunde nichts ändern werde. Möglicherweise war Hansen in der Zwischenzeit zum Rückzug gedrängt worden, denn den Vorschlag, mit der Doppelpräsidentschaft schon zum 1. Januar 1977, also unmittelbar nach Ablauf der Amtszeit Sohls, zu beginnen, trug er selbst vor. Sohl dankte Hansen denn auch ausdrücklich für dessen konstruktives und selbstloses Verhalten. Obwohl die große Mehrheit der Sitzungsteilnehmer überzeugt war, dass eine Doppelpräsidentschaft weitere Rationalisierungserfolge erwarten lasse und eine größere Durchschlagskraft der Argumente zur Wahrung gemeinsamer Belange erzielt werden könne, überwogen bei einigen Mitgliedern nach wie vor die Bedenken. Der Vorschlag, Schleyer mit Wirkung vom 1. Januar 1977 zum Präsidenten des BDI zu wählen, wurde zwar ohne Gegenstimmen, aber bei immerhin drei Enthaltungen seitens der Repräsentanten der Branchen autschuk, unststoffe 27 Sohl an Schleyer v , Thyssenrupp-Archiv, TT, Sohl/ Niederschrift Präsidialsitzung v , BDIA, HGF Pro bis Januar 1976.
52 50 W. Bührer und Metalle angenommen. 29 Hansen wurde damit entschädigt, dass er während der Doppelpräsidentschaft Schleyers dessen Vertretung übernehmen sollte. 30 Auch in diesem Fall wurde also die Taktik der Einbindung qua nomineller Aufwertung angewandt nach dem Muster, das bereits 1949 mit Erfolg gegenüber Otto Vogel praktiziert worden war. Ob das Amt des Stellvertreters des Doppelpräsidenten, das es ja laut Satzung gar nicht gab, tatsächlich eine Aufwertung darstellte, darüber mag man streiten; besser als ein verschämter Verzicht auf die BDI-Präsidentschaft ohne jegliche Gegenleistung war diese Lösung allemal. Damit war der Weg frei für die Inthronisation Schleyers zum 1. Januar Die Bedenken gegen dieses Experiment Personalunion, die insbesondere verbandsintern laut wurden und hauptsächlich den tatsächlichen Einsparungsmöglichkeiten 31 sowie den unterschiedlichen Images der BDI agiere objektiv, die BDA dagegen als ampfverband gegen Gewerkschaften 32 galten, blieben indes bestehen. Und auch Schleyer selbst scheinen bald erste Zweifel beschlichen zu haben: Leute, hätte ich das bloß nicht gemacht, soll er gesagt haben, irgendwann muss das wieder auseinandergehen 33. Als nach seiner Ermordung ein neuer Präsident gesucht werden musste, wurde die Idee der Doppelpräsidentschaft wieder fallengelassen, zumal, wie Sohl einräumte, eine geeignete Persönlichkeit nicht zur Verfügung stand. 34 In den 1980er und den 1990er-Jahren lebte die Idee immer wieder einmal auf zu einer tatsächlichen Fusion kam es auf Bundesebene allerdings nicht. Im Gegenteil, der BDI verteidigte die Drei-Marken-Strategie unternehmerischer Verbandsarbeit und -organisation als bewährtes und sinnvolles onzept, ungeachtet gelegentlicher ritik aus der Unternehmerschaft an überflüssigen osten durch Doppelarbeit und obwohl in den späten 1990er-Jahren auf Länderebene einige Fusionen sozial- und wirtschaftspolitischer Verbände geglückt waren (Burgmer 1999, S. 211 ff.). Wie massiv diese ritik tatsächlich war, lässt sich nicht genau taxieren. Deren Ansatzpunkte waren jedenfalls der Eindruck zu hoher osten und mangelnder Transparenz der Verbandsleistungen, insbesondere der Ergebnisse des formellen und informellen Lobbying für die über die Mitgliedsverbände angeschlossenen Unternehmen (Bührer 2010, S. 56). Und immerhin sah sich der BDI gezwungen, einen Reorganisationsprozess einzuleiten mit dem Ziel der ostenreduzierung und Umstrukturierung auf dem Wege des geringsten innerverbandlichen Widerstandes. Der Verband blieb dabei indes, nach dem Urteil einer Beobachterin, im Rahmen des Vorhandenen, der althergebrachten traditionellen Strukturen (Burgmer 1999, S. 128 f.). Parallel zu diesen internen Reorganisationsbemühungen beauftragte der BDI die Unternehmensberatungsgesellschaft Roland Berger, ein unabhängiges Gutachten zur strategischen Neuausrichtung zu erarbeiten. Von diesem objektiven Gutachten erhoffte sich die BDI-Spitze angesichts des enormen Drucks der Mitgliedsverbände 29 Niederschrift gemeinsame Präsidial- und Vorstandssitzung des BDI am , Bayer AG, Unternehmensgeschichte/Archiv, BAL Hansen an Sohl v , Thyssenrupp-Archiv, TT, Sohl/ Hansen an Neef v , ebd. 32 Notiz Zimmermann v , ebd. 33 Zit. n. Hachmeister 2004, Schleyer, S Vgl. Ich nicht, in: DER SPIEGEL v , S. 36 ff.
53 Opposition im Bundesverband der Deutschen Industrie 51 eine innerverbandliche Legitimation. Gegenstand des Berger-Gutachtens sollten ursprünglich auch die Vor- und Nachteile einer Fusion der Spitzenverbände sein, doch da die BDA und der DIHT eine Beteiligung an der Erstellung der Studie ablehnten, wurde dieses Problem ausgeklammert und eine Empfehlung zugunsten der Drei-Marken-Strategie ausgesprochen (Burgmer 1999, S. 130 ff.). Dass ungeachtet dieser Empfehlung eine Mehrheit der Unternehmer mit dem Wirken der Spitzenverbände unzufrieden war, wird man auch mit Blick auf eine allerdings nichtrepräsentative Umfrage des Münchner ifo-instituts, nach der 77 % der Befragten eine Fusion von BDI und BDA befürworteten, kaum bestreiten können (Burgmer 1999, S. 83). Wie bedrohlich diese Unzufriedenheit aus Sicht der BDI-Spitze tatsächlich war, lässt sich aufgrund der Quellenlage nicht präzise beurteilen doch offensichtlich bedrohlich genug, um auf Voice aus der Mitgliedschaft mit eigenen Reformbemühungen und der Initiierung eines externen Evaluierungsprozesses zu reagieren. 6 Fazit Die Befunde meiner exemplarischen Untersuchung des Umgangs der BDI-Spitze mit verbandsinterner Opposition lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Exit im Sinne einer Abspaltung wie im späten 19. Jahrhundert oder eines dramatischen Mitgliederschwunds fand nicht statt. Zur Erklärung sei darauf verwiesen, dass die noch in der Weimarer Republik kaum zu überwindende Vetoposition der Schwerindustrie nach 1945 rasch erodierte und die Interessenkonflikte in der Industrie dadurch an Schärfe verloren: Eine Verbandsgründung gegen die Schwerindustrie entbehrte damit jeglicher Notwendigkeit. Überdies stellte die Existenz starker Gewerkschaften ein schlagendes Argument gegen eine organisatorische Zersplitterung im Unternehmerlager dar. Wie verhält es sich mit der Option einer selektiven Abwanderung im Sinne Eisings (vgl. Eising 2016)? Wirtschaftspolitische Interessenorganisationen, wie sie in den 1950/60er-Jahren in Gestalt der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer oder der Arbeitsgemeinschaft Junger Unternehmer existierten und sich in den hier untersuchten onflikten auch hin und wieder artikulierten, stellten letztlich keine ernsthafte Alternative zum BDI dar. Eine Abwanderung aus dem BDI in diese Verbände fand nicht statt. Die späteren und aktuellen Gesprächsrunden im anzleramt auf nationaler oder beispielsweise der European Round Table of Industrialists auf europäischer Ebene sind m. E. jedoch weniger als selektive Abwanderung zu verstehen denn als Belege für eine nach wie vor voranschreitende organisatorische Ausdifferenzierung, welche die Existenz des BDI (bis jetzt) jedoch keineswegs in Frage stellt. Voice war in vielfältigen Formen und unterschiedlicher Intensität anzutreffen, diese Option war die gängige Form zur Artikulation von ritik und Unzufriedenheit. Wenn inhaltliche Fragen im Mittelpunkt standen, z. B. bei der Auseinandersetzung um das artellgesetz oder den urs in der europäischen Integration, suchte die BDI-Spitze nach ompromissen oder sie überließ den direkt betroffenen Branchen vorübergehend die öffentliche Arena. Wenn die Differenzen stärker personenoder branchenbezogen geprägt waren, versuchte die Verbandsspitze den oder die
54 52 W. Bührer ritiker zu integrieren, indem er oder sie durch prestigeträchtige Ämter zum Stillhalten veranlasst wurden. Insgesamt bleibt jedoch festzuhalten, dass im BDI Loyalty gegenüber der Verbandsspitze in den ersten gut 60 Jahren seiner Existenz eindeutig überwog. Literatur Abelshauser, Werner Der Ruhrkohlenbergbau seit Wiederaufbau, rise, Anpassung. München: C. H. Beck. BDI Zugegriffen: 2. April Berghahn, Volker R Unternehmer und Politik in der Bundesrepublik. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Braunthal, Gerard The federation of german industry in politics. Ithaca: Cornell University. Bührer, Werner Ruhrstahl und Europa. Die Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie und die Anfänge der europäischen Integration München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag. Bührer, Werner Die Spitzenverbände der westdeutschen Industrie und die europäische Integration seit Motive, onzepte, Politik. Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2: Bührer, Werner Geschichte und Funktion der deutschen Wirtschaftsverbände. In Handbuch Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Deutschland, Hrsg. Wolfgang Schroeder, und Bernhard Weßels, Wiesbaden: VS. Burgmer, Inge Maria Die Zukunft der Wirtschaftsverbände. Am Beispiel des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e. V. Bonn: Institut für wissenschaftliche Publikationen. Eckert, Rainer Die Vergleichbarkeit des Unvergleichbaren. Die Widerstandsforschung über die NS- Zeit als methodisches Beispiel. In Zwischen Selbstbehauptung und Anpassung. Formen des Widerstands und der Opposition in der DDR, Hrsg. Ulrike Poppe, Rainer Eckert, und Ilko-Sascha owalczuk, Berlin: Ch. Links. Eising, Rainer Selektive Abwanderung im EU-Verbandssystem. Das Strategierepertoire unzufriedener Mitglieder. Zeitschrift für Politikwissenschaft. doi: /s x. Hachmeister, Lutz Schleyer. Eine deutsche Geschichte. München: C.H.Beck. Helms, Ludger Politische Opposition. Theorie und Praxis in westlichen Regierungssystemen. Opladen: Leske + Budrich. Henkel, Hans-Olaf Begrüßung durch den Präsidenten. In Unternehmerverbände und Staat in Deutschland, Hrsg. Werner Bührer, und Edgar Grande, Baden-Baden: Nomos. Herrmann, Walter Der organisatorische Aufbau und die Zielsetzungen des BDI. In Fünf Jahre BDI Aufbau und Arbeitsziele des industriellen Spitzenverbandes, Hrsg. Bundesverband der Deutschen Industrie, Bergisch Gladbach: Heider. Hirschman, Albert O Exit, voice, and loyalty. Responses to decline in firms, organizations, and states. Cambridge: Harvard University Press. ipping, Matthias Zwischen artellen und onkurrenz. Der Schuman-Plan und die Ursprünge der europäischen Einigung Berlin: Duncker & Humblot. Mann, Siegfried Macht und Ohnmacht der Verbände. Das Beispiel des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e. V. (BDI) aus empirisch-analytischer Sicht. Baden-Baden: Nomos. Schroeder, Wolfgang, und Bernhard Weßels Handbuch Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Deutschland. Wiesbaden: VS. Teubner, Gunther Organisationsdemokratie und Verbandsverfassung. Rechtsmodelle für politisch relevante Verbände. Tübingen: Mohr Siebeck. Ullmann, Hans-Peter Interessenverbände in Deutschland. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
55 Z Politikwiss (2016) (Suppl 2) 26:53 74 DOI /s AUFSÄTZE Deutsche Industrieverbände: Studie zur Heterogenität der Verbandswirklichkeit Beate ohler-och Online publiziert: 20. September 2016 Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 Zusammenfassung Die Heterogenität von Verbänden steht im Mittelpunkt dieses Beitrags. Beate ohler-och gibt einen Einblick in den Facettenreichtum des Verbandssystems der deutschen Industrie, zeigt die typischen onstellationen innerverbandlicher Interessenkonflikte auf und beleuchtet, wie Verbände strategisch mit dem Dilemma umgehen, das sie als intermediäre Akteuren haben: Sie brauchen eine breite Mitgliederbasis, um politisch einflussreich zu sein. Doch jede Ausdehnung der Mitgliedschaft bedroht die Verbandsidentität und macht es schwieriger, die Mitgliederinteressen zu bündeln und gezielt nach außen zu vertreten. German business association of industry: heterogeneity as the defining feature Abstract This contribution puts the heterogeneity of business interest groups in focus. It is the first systematic and comprehensive analysis of the diversity of the German associations of industry. It explores the main reasons for conflicts. Beate ohler-och analyses how associations address a crucial dilemma: large numbers of members make for political influence. At the same time, they weaken straight advocacy. Associations strive to adapt their organisation to meet this dilemma. They seek to incorporate both the logic of influence and the logic of membership. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. B. ohler-och ( ) Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, Universität Mannheim, Mannheim, Deutschland Beate.ohler@uni-mannheim.de D. Sack, C. Strünck (Hrsg.), Verbände unter Druck, DOI / _4, Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
56 54 B. ohler-och 1 Die Vielfalt der Wirtschaftsverbände: Wichtig, aber meist übersehen Wirtschaftsverbände sind nur ein wenn auch gewichtiger Teil der Gesamtpopulation der Verbände in einem politischen System. Eine bewährte lassifikation nimmt die gesellschaftliche Funktion von Verbänden in den Blick (Sahner 1988) und unterscheidet nach dem gesellschaftlichen Teilbereich, aus dem heraus sie agieren, und dem Objekt- bzw. Zielbereich, auf den ihr Handeln ausgerichtet ist. Die gesellschaftliche Verortung von Wirtschaftsverbänden ist eindeutig und einheitlich, auch wenn ihre spezifischen Handlungsfelder variieren (Grote et al. 2007; Reutter 2012; Sebald und Straßner 2004; Weber 1977; Winter und Willems 2007). Wirtschaftsverbände verstehen sich in ihrer überwiegenden Mehrheit als politische Interessenvertretung, sie erbringen zusätzlich Dienstleistungen für ihre Mitglieder und übernehmen in bestimmten Fällen öffentliche Aufgaben. Einige erfüllen gleichzeitig auch die Funktion eines Arbeitgeberverbandes. Als Dach-, Branchenoder Fachverband unterscheiden sie sich in der Reichweite ihrer Interessenvertretung und sie grenzen sich durch ihre jeweils spezifische Domäne voneinander ab. Deren Zuschnitt wird durch die Struktur der Mitglieder Handwerk, Industrie, mittelständische Familienbetriebe sowie das Tätigkeitsprofil der Unternehmen Handel, Herstellung, Dienstleistungen bestimmt. Ein gemeinsames ennzeichen ist ihre rechtliche Verfassung; im Unterschied zu den ammern sind sie als Vereine mit freiwilliger Mitgliedschaft organisiert. Von diesen Unterscheidungen abgesehen wird den Wirtschaftsverbänden eine weitgehende Uniformität unterstellt und sie werden Fallstudien ausgenommen als einheitlicher Akteur behandelt. Die Selbstdarstellung der Verbände bestärkt diese Wahrnehmung. Sie sind stets um ein einheitliches Auftreten in der Öffentlichkeit bemüht: So wie der Bundesverband der Deutschen Industrie beansprucht, die Stimme der deutschen Industrie zu sein, treten Branchen- und Fachverbände als unangefochtene Repräsentanten ihrer Wirtschaftszweige auf. Die These dieses Beitrages ist dagegen, dass Heterogenität das dominante Merkmal der deutschen Wirtschaftsverbände ist und Interessendivergenzen die Wirklichkeit deutscher Verbandsarbeit prägen. 2 Theoretische Überlegungen und methodisches Vorgehen In der vorliegenden Untersuchung wurden keine manifesten onflikte untersucht, wie sie beispielsweise in der Abspaltung der forschenden Pharmaindustrie vom Pharmaverband in Erscheinung traten. Zum einen sind solche extremen Fälle nur die Spitze eines Eisbergs und erlauben keine verallgemeinerbaren Rückschlüsse. Zum anderen scheitert eine systematische Erhebung von onflikten auf der Grundlage von Verbandsberichten und Versammlungsprotokollen an der Unwilligkeit der Verbände, sie zu dokumentieren. Aus dem gleichen Grund stoßen Befragungen hier an ihre Grenzen. Deshalb konzentriert sich die Untersuchung auf die Bedingungen, durch die Interessendivergenzen entstehen und das Potential von onflikten haben. Die theoretischen Überlegungen folgen dem Ansatz von Schmitter und Streeck (1999), wonach die Organisation wirtschaftlicher Interessen ebenso von der onstel-
57 Deutsche Industrieverbände: Studie zur Heterogenität der Verbandswirklichkeit 55 lation der (potentiellen) Unternehmensmitgliedschaft als auch den Besonderheiten des politischen Adressatensystems geprägt ist. Die jeweils herrschenden Bedingungen der Einflusslogik können es Verbänden erschweren oder erleichtern, mit Spannungen im System der Mitgliederlogik umzugehen. So entschärft die korporatistische Interessenvermittlung typischerweise die bei einer Vielzahl von Unternehmen übliche Trittbrettfahrer-Problematik. Ein hoher Stellenwert formaler Beteiligungsverfahren mindert außerdem für Verbände die Gefahr, dass sich ihre an Ressourcen starken Mitglieder verselbständigen. Beschränkt man, wie hier, die Analyse des Verbandssystems auf nur ein politisches System, so kann man einige Faktoren der Einflusslogik (Schmitter und Streeck 1999, S. 30 ff.) als konstant unterstellen. Die grundlegenden Spielregeln der Interessenvermittlung und die Arbeitsverteilung zwischen Politik und Verwaltung gelten für alle, der Sachverstand und die Eigenständigkeit der Ministerialbürokratie ist in allen Politikfeldern gegeben, der Wechsel in der parteipolitischen Ausrichtung der Regierung trifft alle gleichermaßen und die zunehmende Bedeutung der EU gilt ebenfalls für (fast) alle Wirtschaftszweige. Bei differenzierter Betrachtung zeigt sich allerdings, dass andere Bedingungen der Einflusslogik variieren. So unterscheiden sich öffentliche Aufmerksamkeit und damit die Empfänglichkeit der politischen Entscheidungsträger für Meinungstrends deutlich nach Politikfeldern. Bei kritischen Themen wie Umweltbelastung, Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz und Gesundheit stehen einige Unternehmen mehr und andere weniger im Rampenlicht der Öffentlichkeit. In ähnlicher Weise haben die Aufwertung der Leitungsebene in den deutschen Ministerien und die damit einhergehende Politisierung der Verwaltung (Hustedt 2013) unterschiedliche Auswirkungen auf Unternehmen und Verbände. Gleiches gilt für wirtschaftspolitische Weichenstellungen wie die Energiewende und, manchmal nicht weniger dramatisch, für regulative Politik. So waren die Anforderungen der Chemikalienverordnung REACH eine erhebliche Herausforderung für die unmittelbar betroffenen Unternehmen. Mit anderen Worten, Unternehmen sind je nach ihrem spezifischen Produkt- und Produktionsprofil von politischen Maßnahmen unterschiedlich betroffen und stellen folglich andere Anforderungen an ihren Verband. Dies betrifft sowohl die Stoßrichtung der Interessenvertretung als auch die Versorgung mit einschlägigen rechtlichen, technischen und volkswirtschaftlichen Informationen und das bedarfsgerechte Serviceangebot. Die erste These ist, dass die daraus resultierenden Interessendivergenzen je nach Aggregationsstufe der Verbände unterschiedlich ausgeprägt sind. Fachverbände, die einen schmalen Produktionssektor repräsentieren, haben weniger mit widersprüchlichen Anforderungen ihrer Mitglieder zu kämpfen als die umfassenderen Branchenverbände und vor allem als der Dachverband, der für einen ganzen Wirtschaftsbereich spricht. In engem Zusammenhang damit steht die zweite These, dass ein rascher Politikwandel die Interessengegensätze tendenziell verschärft. Dahinter steht die Grundannahme des historischen Institutionalismus (Pierson und Skocpol 2002), dass langjährige Anpassungsprozesse zu institutionellen Strukturen und Verfahren geführt haben, mit denen Ausgleichsmechanismen für konkurrierende Interessen gefunden wurden und diese nicht rasch an wechselnde Gegebenheiten angepasst werden können.
58 56 B. ohler-och Hinzu kommt, dass selbst einheitliche Maßnahmen der regulativen Politik die Unternehmen je nach Produkt- und Produktionsprofilen in unterschiedlicher Weise betreffen. So ist die dritte These, dass ein Verband mit einem breiten Tätigkeitsfeld seiner Mitglieder mit stark divergierenden Erwartungshaltungen und gegebenenfalls onflikten konfrontiert ist. Unabhängig von den Bedingungen der Einflusslogik beeinflusst die onstellation der unternehmerischen Population die Organisationsfähigkeit wirtschaftlicher Interessen und das innerverbandliche onfliktpotential. Seit Olson (1965) wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Unternehmen die Organisationsbereitschaft beeinflusst und dass Verbände, die ihr politisches Gewicht durch den Nachweis eines hohen Organisationsgrads erhöhen wollen, versuchen werden, Unternehmen durch ein zusätzliches Leistungsangebot an sich zu binden. So werden Aufgabenprofil und die Verwendung von Geldern zum Gegenstand innerverbandlicher onflikte. Insgesamt ist die Verfügung über Ressourcen und die unterschiedliche Finanzstärke der Unternehmen für alle Verbände eine kritische Angelegenheit. Wenn, wie im deutschen politischen System, die politischen Entscheidungsträger den Verbänden einen hohen Stellenwert in der gesellschaftlichen Interessenvermittlung zuerkennen (Traxler 2010), dann hängt die Bereitschaft, einem Verband beizutreten, nicht so sehr von der Größe eines Unternehmens ab. Aber die Größenunterschiede sorgen für erhebliche Interessendivergenzen. leine und mittelständische Unternehmen (MU) verfügen nicht über die Mittel und das Personal, regelmäßig politische Entwicklungen zu beobachten oder sich beispielsweise in internationale onsortien der Forschungsförderung einzubringen. Gerade global tätige MU sind auf die Informationsversorgung ihres Verbands und dessen politische Interessensvertretung angewiesen. Große Unternehmen mit gut ausgestatteten volkswirtschaftlichen Abteilungen und einem geschulten Stab für Governance Relations können solche Aufgaben weitgehend selbst erledigen und sind deswegen wenig geneigt, ihrem Verband umfangreiche Mittel für solche Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Weil die großen Mitgliedsfirmen in der Regel den Löwenanteil der Verbandsfinanzierung tragen, sind der Umfang und die Verwendung des Verbandsbudgets ständige Quelle der Auseinandersetzung. Auch in Verbänden mit Verbandsmitgliedschaft, wie sie im BDI und in vielen Branchenverbänden zu finden sind, gibt es ähnliche Auseinandersetzungen, weil hier Mitgliedsverbände von ganz unterschiedlicher Finanzkraft zusammenkommen. Daraus resultiert die vierte These, dass die Unterschiede an wirtschaftlicher Leistungskraft innerhalb und zwischen Verbänden mit erheblichen Interessendivergenzen verbunden sind und Ursache von onflikten sein können. Während in Verbänden mit direkter Unternehmensmitgliedschaft die Größenunterschiede direkt zum Tragen kommen, sind sie in Verbandsverbänden verdeckt. In diesen Fällen kommen einige Verbände den Forderungen der Großunternehmen nach unmittelbarer Mitsprachemöglichkeit dadurch entgegen, dass sie ihnen eine Direktmitgliedschaft ermöglichen. Diese Strategie stößt bei den Fachverbänden nicht auf ungeteilte Zustimmung, wird aber bei sehr ungleichen Größenstrukturen akzeptiert, zumal wenn sie zur Sicherung der Verbandseinkommen beiträgt.
59 Deutsche Industrieverbände: Studie zur Heterogenität der Verbandswirklichkeit 57 Nach These fünf sind verbandliche Organisationsstrukturen als Anpassung an unterschiedliche Größenverhältnisse zu sehen, mit denen Interessenkonflikte jedoch nur begrenzt ausgeglichen werden können. Wirtschaftliche Veränderungen hinterlassen immer deutliche Spuren im Gefüge der Wirtschaftsverbände. Verbände haben die konjunkturellen Einbrüche im letzten Jahrzehnt unmittelbar durch stagnierende Mitgliederzahlen und die nachlassende Bereitschaft gespürt, hohe Mitgliedsbeiträge zu zahlen (Nicklich und Helfen 2013). Industrien im Niedergang bauen dagegen auf die Unterstützung ihres Verbandes und streben nach innerverbandlichem onsens (Schmitter und Streeck 1999, S. 28), können aber dessen finanziellen und personellen Abbau nicht verhindern. onfliktreicher ist die Situation in Verbänden und vor allem zwischen Verbänden, deren Mitglieder in unterschiedlichem Maße unter strukturellen Problemen leiden bzw. von technologischen Innovationsschüben profitieren. Daraus ergibt sich als sechste These, dass vor allem eine differenzierte wirtschaftliche Entwicklung innerhalb der Verbandsmitgliedschaft zu Interessensdivergenzen und möglichen onflikten führen wird. Aus diesen sechs Thesen lässt sich herausdestillieren, dass zwei Größen Interessendivergenzen und onfliktpotential erwarten lassen: die Differenziertheit der Wirtschaftstätigkeit und das Gefälle in der Wirtschaftskraft der Mitglieder eines Verbandes. Die Differenziertheit der Wirtschaftstätigkeit bezieht sich auf die Spannweite der wirtschaftlichen Aktivitäten von Unternehmen, die ein Verband seiner Domäne zurechnet. Ein Schwerpunkt der hier vorliegenden empirischen Arbeit war die angemessene Erfassung der Verbandsdomänen. Die Verbände definieren ihre Domäne in Bezug auf ihre tatsächlichen Mitglieder und eine bestimmte potentielle Mitgliedschaft. In der Mehrzahl der Fälle stimmt die Verbandsdomäne der Branchen nicht mit der amtlichen lassifikation von Wirtschaftszweigen überein. Durch Nachfrage bei den Verbänden konnten meist Grenzüberschreitungen identifiziert, aber nicht immer eindeutige Ergebnisse erzielt werden, weil etliche Verbände den Aktivitätsbereich ihrer (potentiellen) Mitgliedschaft nicht angemessen in den amtlichen Statistiken erfasst sehen. Die Auswertung stützt sich auf die mit den Verbänden abgesprochenen WZ-lassen. 1 Den Verbänden sei an dieser Stelle nachdrücklich für ihre ooperationsbereitschaft gedankt. Auch die Unterschiede in Wirtschaftskraft und onzentration wurden auf der Grundlage der so definierten Domänenabgrenzung gemessen, wobei zum einen Umsatz, Zahl der Unternehmen und Beschäftigte und zum anderen die Aufteilung der Unternehmen nach Beschäftigungsgrößenklassen herangezogen wurden. 2 Daten zur Verbandsorganisation wurden den Internetdarstellungen der Verbände, Verbandsberichten und Satzungen entnommen; in zahlreichen Fällen waren auch hierzu Nachfragen erforderlich. Diese Recherchen erstreckten sich auf Statistisches Bundesamt (2008); die WZ-lassen sind seit der Reform von 2008 identisch mit der NACE lassifizierung von EUROSTAT. Es wurde mit den vierstelligen WZ-lassen gearbeitet. Von den angegebenen WZ-lassen wurden nur solche berücksichtigt, die vom Verband mit über 70 % als der eigenen Domäne zugehörig angegeben wurden. 2 Alle Daten beziehen sich auf 2013.
60 58 B. ohler-och Industrieverbände, 3 die Berechnungen erfassen die 40 im BDI vertretenen Branchenverbände bzw. die 30 industriellen Verbände mit BDI-Direktmitgliedschaft. Ergänzend wurden über hundert Gespräche mit den Geschäftsführern von allen Branchenverbänden und ausgewählter Fachverbände 4 geführt, um die Validität der Thesen zu prüfen. 3 Hierarchie und Tiefenstaffelung im System der deutschen Industrieverbände Die hierarchische Organisation gilt als Markenzeichen des Verbandssystems der deutschen Industrie und man kann in ihr eine ideale Anpassung an das deutsche System der Interessenvermittlung sehen (Grote et al. 2007; Lang und Schneider 2007, S. 223). Danach organisieren Fachverbände spezialisierte Sektoren und repräsentieren deren oft technisch bestimmte Interessen im ontakt mit den zuständigen Fachreferaten der Ministerien. Branchenverbände vertreten die übergreifenden Belange eines größeren Wirtschaftsbereichs; sie konzentrieren sich in ihrer Interessenvertretung auf die wirtschaftlichen Folgen politischer Interventionen und zielen dementsprechend stärker auf die Leitungsgremien von Ministerien. Spitzenverbände wie der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) engagieren sich vor allem bei wirtschaftspolitischen Richtungsentscheidungen und richten sich an Politik und Öffentlichkeit. Die Realität weicht nicht unerheblich von dieser abstrakten Blaupause ab. Der hierarchische Aufbau ist ungleichgewichtig und die Ebenen sind teils verschoben. Trotzdem wird vor allem im Vergleich mit dem britischen Verbändesystem deutlich, dass immer noch das Modell der sektorenspezifischen Repräsentationsmonopole und ihrer hierarchischen Zuordnung vorherrscht. 5 Zunächst trifft es zu, dass der BDI als Spitzenverband der Industrie ausschließlich Branchenverbände umfasst, 6 von denen einige wiederum auf Fachverbänden aufbauen, die sich auf die Vertretung eines enger spezialisierten Wirtschaftszweiges konzentrieren. 7 In den meisten Branchenverbänden können Unternehmen direkt Mitglied werden, in anderen sind sie nur über ihren Fachverband indirekt vertreten. Zusätzlich zu dieser fachlichen Ausdifferenzierung gibt es sowohl beim BDI als auch bei einigen Branchenverbänden territoriale Untergliederungen. Funktion und Stellung dieser Landesverbände sind höchst unterschiedlich, aber zumeist untergeordnet. Ein Ausnahmefall ist der Hauptverband der Bauindustrie (HDB). Hier sind die Landesverbände die eigentlichen Akteure, d. h. 3 BDI sowie 208 im BDI direkt bzw. indirekt vertretene Branchen- bzw. Fachverbände und weitere 141 Industrieverbände ohne BDI-Anbindung. 4 Erfasst wurden alle Fachverbände, die sich im zurückliegenden Jahrzehnt reorganisiert hatten und eine Auswahl von nicht-reorganisierten Verbänden im gleichen Wirtschaftsfeld. 5 So gilt die Charakterisierung von Bennet (1997) auch noch in 2015 wie die Erhebung aller Wirtschaftsverbände im Vereinigten önigreich und in Deutschland im EUROLOB II Projekt (ohler-och und Quittkat 2016) ergab. 6 Im Jahr 2015 waren es 35 Vollmitglieder und fünf weitere Mitglieder, die in einer Arbeitsgemeinschaft Industriengruppe zusammengefasst sind. 7 In 2015 vertreten sie insgesamt über hundert Fachverbände.
61 Deutsche Industrieverbände: Studie zur Heterogenität der Verbandswirklichkeit 59 Abb. 1 Die Gliederung des industriellen Verbandssystems (ohne Landesverbände). Unternehmensverbände sind als Quadrate dargestellt, Verbandsverbände als reise mit der Zahl ihrer Verbandsmitgliedschaften; Verbände mit gemischter Mitgliedschaft (BBS, BVE, VCI, VRB) wurden der Gruppe der Verbandsverbände zugeordnet
62 60 B. ohler-och Unternehmen werden Mitglied im Landesverband und die bauindustriellen Landesverbände konstituieren den nationalen Verband. Die Landesverbände liegen quer zu der auf fachliche Spezialisierung aufgebauten Stufung von Fachverband, Branchenverband und Dachverband. Allerdings gibt es nur in wenigen Wirtschaftszweigen einen solchen dreistufigen Aufbau. 8 Die Mehrheit der im BDI vertretenen Branchenverbände hat Unternehmen als Mitglieder, so dass die Verbandshierarchie in der Industrie überwiegend auf zwei Stufen begrenzt ist (Abb. 1). In einigen Fällen wird dieser stufenweise Aufbau dadurch durchbrochen, dass spezialisierte Verbände sowohl Mitglied in einem Branchenverband als auch direktes Mitglied im BDI sind. Dies trifft für die beiden Verbände der Pharmaindustrie (BPI und vfa) zu, die sowohl im Chemieverband als auch im BDI vertreten sind. In gleicher Weise sind die Verbände der Zuckerindustrie (VdZ) und der aliund Salzindustrie (VS) Mitglied sowohl im Branchenverband der Ernährungsindustrie BVE als auch im BDI und der Verband der Gießereien (BDG) ist neben seiner Mitgliedschaft im Branchenverband Metalle (WVM) auch direkt im BDI vertreten. In den Interviews wurden keine Stimmen laut, dass diese Art der Doppelvertretung zu Reibungen oder einem Übergewicht in der Interessenvertretung führe. Des Weiteren darf nicht übersehen werden, dass zahlreiche Industrieverbände nicht im BDI-System vertreten sind. Einige Branchenverbände waren nie Mitglied oder haben den BDI im zurückliegenden Jahrzehnt verlassen 9. Gleiches gilt für eine ganze Reihe von Fachverbänden, die sich entweder nie einem Branchenverband angeschlossen hatten oder in den letzten Jahren ihre Mitgliedschaft aufgegeben haben. 10 Unter den rund 141 Verbänden 11 ohne BDI-Anbindung gibt es nur sehr wenige Verbände mit Verbandsmitgliedern; 12 die überwältigende Mehrheit vertritt Unternehmen direkt. 4 Der BDI ein facettenreicher Verband Ganz im Unterschied zu seinem Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit ist der BDI ein sehr facettenreicher Verband mit einer sehr ungleichgewichtigen Zusammensetzung. Zum einen umfasste der BDI immer schon Mitglieder von sehr unterschiedlichem wirtschaftlichem Gewicht und Domänenzuschnitt. Zum anderen hat sich der BDI in den letzten fünfzehn Jahren von einem reinen Industrieverband zu einem Verband gewandelt, der auch für Dienstleistungsbranchen offen ist. 8 Die Aussage von Sebaldt und Straßner, es sei jeder Industrieverband (Branchenverband) wiederum als Dachverband mehrerer Fachverbände für fast jeden Industriezweig konzipiert (2004, S. 104), geht völlig an der Wirklichkeit vorbei. 9 Zum Wandel der deutschen Industrieverbände ausführlicher ohler-och (2016). 10 Dies gilt für 22 Fachverbände der im BDI im Jahr 1999 vertretenen 35 Branchenverbände. 11 Die Zahlenangabe stützt sich auf die Angaben zu sonstige Industrien in Oeckl online; nicht berücksichtigt wurden Gütegemeinschaften, Plattformen und Foren, Brüsseler Büros, nationale Vertretungen von EU Verbänden und Förderinstitutionen; ( ). 12 Nur diese sind in Abb. 1 dargestellt.
63 Deutsche Industrieverbände: Studie zur Heterogenität der Verbandswirklichkeit Das moderne Profil des BDI Das rasche Wachstum des Informations- und ommunikationssektors führte 1999 zur Gründung und Aufnahme eines neuen Branchenverbandes (BITOM), der nicht mehr dem Profil eines reinen industriellen Herstellerverbandes entsprach (Lang 2006, S. 155). Die in BITOM organisierten Unternehmen sind nämlich sowohl Hardware- als auch Softwareproduzenten sowie reine Dienstleister. Mit der Satzungsänderung von 2001 öffnete sich der BDI dann grundsätzlich für industrienahe Dienstleister. 13 Auch wenn die Dienstleistungen industrienah sind, wie im Falle der Technischen Überwachungsvereine oder der Beratenden Ingenieure, ist die Art ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit kaum mit der industriellen Produktion vergleichbar. Besonders augenfällig ist dies bei der Immobilienwirtschaft und bei der Tourismusindustrie, deren Verbände als erste das Angebot der Mitgliedschaft wahrnahmen. Hier spielen weder technische Regulierung noch staatliche Forschungsförderung oder Innovationspolitik eine Rolle. Vor allem vertreten diese Verbände Wirtschaftszweige, deren Strukturen sich von denjenigen der herstellenden Industrie ganz erheblich unterscheiden. Die Zahl der Unternehmen in der Tourismus- und Immobilienwirtschaft übersteigt bei weitem die der reinen Industriebranchen. Es handelt sich wie auch bei den Ingenieurberatungsbüros ganz überwiegend um kleine und kleinste Unternehmenseinheiten, was sich in einem niedrigen Organisationsgrad niederschlägt. Der Verband Beratender Ingenieure (VBI) schätzt seinen Organisationsgrad selbst auf etwa acht Prozent. Ähnlich niedrig dürfte er beim Verband der Tourismuswirtschaft (BTW) liegen, der beansprucht für fast drei Millionen Beschäftigte in der Tourismuswirtschaft zu sprechen, aber an direkten Mitgliedern weniger als 30 Unternehmen hat. Auch die Zahl der direkten Unternehmensmitglieder im Verband der Mobilitäts- und Verkehrsdienstleister (Agv MoVe) und im Immobilienverband (ZIA) ist mit 62 bzw. 170 Firmen überschaubar und kaum repräsentativ für die Tausenden von Anbietern in diesem Wirtschaftszweig. Der niedrige Organisationsgrad dieser Verbände steht im deutlichen ontrast zu den Industrieverbänden, die in ihrer überwiegenden Mehrheit, gemessen am Umsatz, zwischen 80 und 100 % ihres Wirtschaftszweiges repräsentieren. Diese strukturellen Unterschiede und vor allem das doch sehr abweichende Tätigkeitsprofil der Dienstleistungsverbände veranlasste einige Gesprächspartner zu der Bemerkung, dass der BDI eben nicht mehr der alt bekannte Repräsentant der deutschen Industrie sei. 4.2 Die leinen und Großen im BDI Am augenfälligsten sind die Größenunterschiede zwischen den BDI-Mitgliedern gemessen an Umsatz, Zahl der Beschäftigten und Zahl der Unternehmen. 14 Die 13 Seit 2003 sind fünf Verbände der industrienahen Dienstleister dem BDI beigetreten. Dazu zählen die Verbände der Tourismuswirtschaft (BTW), der Beratenden Ingenieure (VBI), der TÜV Unternehmen (VdTÜV), der Immobilienwirtschaft (ZIA) und der Mobilitäts- und Verkehrsdienstleister (Agv MoVe). 14 Bei den verbandlichen Entscheidungsverfahren wird den Größenunterschieden meist durch ein gestaffeltes Stimmrecht Rechnung getragen.
64 62 B. ohler-och Abb. 2 Größenvergleich der Verbände industrienaher Dienstleister und Industrieverbände neuen Mitglieder aus den industrienahen Dienstleistungen fallen gänzlich aus dem Rahmen (Abb. 2). Selbst wenn man nur die Verbände der herstellenden Industrie vergleicht, sind die Unterschiede erheblich. 15 Eine besondere Gruppe bilden die Verbände, die nur kollektiv über ihre Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Industriengruppe im BDI vertreten sind. 16 Es sind besonders kleine Verbände, denen dieser Sonderstatus mit reduziertem Beitrag nicht zuletzt aus Rücksicht auf ihre Finanzschwäche gewährt wird. 17 Aber auch die weiteren 30 Branchenverbände vertreten Wirtschaftsbereiche, die weit auseinanderliegen gemessen an der Zahl der Unternehmen, der Beschäftigten und dem wirtschaftlichen Umsatz. Ebenso ist die Spannbreite im Tätigkeitsspektrum der Unternehmen erheblich. 18 Es gibt Branchenverbände, die nur einen ganz schmalen Wirtschaftssektor repräsentieren, wie die Zucker- oder die Zigarettenindustrie, während andere Verbände weit gespannte und heterogene Produktionsbereiche umfassen wie die Elektrotechnik- und Elektronikindustrie und den Maschinenbau (Tab. 1). In Bezug auf das wirtschaftliche Gewicht kann man deutlich drei unterschiedliche Gruppen unterscheiden (Tab. 2). Die Größenunterschiede sind besonders deutlich zwischen einer Gruppe von fünf Verbänden, 19 die jeweils kleine und überschaubare Wirtschaftszweige vertreten, und 15 Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden im Falle von BITOM nur die Tätigkeitsbereiche und Wirtschaftsleistungen der Hardware produzierenden Unternehmen berücksichtigt sind fünf Verbände Mitglied; sie vertreten die Automaten- (VDAI), die Dental- (VDDI), die unststoff- (WV), die Leder- (VDL) und die Schmuck-, Uhren-, Silberwaren und verwandten Industrien (BV Schmuck). 17 Die fünf Verbände wurden in der Vergleichsuntersuchung nicht weiter berücksichtigt. 18 Der Umfang des Tätigkeitsspektrums, gemessen an der Zahl der von einem Verband vertretenen NACE Unterkategorien, reicht von 1 bis Außer den erwähnten Verbände der Zucker- (VdZ) und Zigarettenindustrie (DZV) zählen hierzu auch die der ali- und Salzindustrie (VS), der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) sowie die der Erdöl- und Erdgasgewinnung (WEG).
65 Deutsche Industrieverbände: Studie zur Heterogenität der Verbandswirklichkeit 63 Tab. 1 Unterschiede in der Spannbreite der Tätigkeiten und dem wirtschaftlichen Gewicht der industriellen Branchenverbände des BDI Spannbreite Wirtschaftliches Gewicht Unternehmen Beschäftigte Umsatz (in Mrd. EUR) Minimum ,0 Maximum ,00 Mittelwert 8, , ,87 65,95 Median 4,00 310, ,00 26,90 Modus ,0 Std.abweichung s 8, , ,67 93,41 Varianz s 2 65, , , ,74 Tab. 2 Durchschnittliches Wirtschaftsgewicht der Industrieverbände des BDI Mittelwert leine Sektoren Mittelgroße Sektoren Große Sektoren Unternehmen 18,00 821, ,00 Beschäftigte 9323, , ,14 Umsatz (in Mrd. EUR) 6,58 26,90 208,45 einer Gruppe von sieben großen Verbänden, 20 die mehr wirtschaftliches Gewicht einbringen als alle anderen Verbände zusammen. Eine mittlere Gruppe umfasst die Mehrzahl der BDI-Verbände; sie repräsentiert Wirtschaftszweige mit deutlich kleinerer, aber immer noch nennenswerter Wirtschaftskraft. Sie vertreten zusammengenommen weniger als 30 % des Umsatzes und der Beschäftigung, aber rund 40 % der im BDI repräsentierten Unternehmen (Tab. 3, Abb. 3). Neben dem wirtschaftlichen Gewicht unterscheiden sich die Verbände wie oben erwähnt auch ganz erheblich in Bezug auf das Tätigkeitsspektrum ihrer Mitglieder. In der Regel gilt, dass ein breites Tätigkeitsspektrum mit einem hohen wirtschaftlichen Gewicht einhergeht. Allerdings trifft dies nicht bei allen Wirtschaftszweigen zu und vor allem sind die Unterschiede im wirtschaftlichen Gewicht sehr viel ausgeprägter als die Spannbreite der in einem Verband vertretenen wirtschaftlichen Tätigkeiten (Tab. 4). Die kleinen, finanziell schwachen Wirtschaftsverbände wissen, dass sie wenig Einfluss auf die Politik des BDI ausüben und halten sich bei verbandsinternen ontroversen eher zurück. 21 Sie schätzen aber ihre Mitgliedschaft im BDI, weil nur er ihre spezifischen Anliegen wirksam öffentlich vertreten kann, wie beispielsweise in der Schmuckindustrie den Umgang mit Blutdiamanten. Die wirtschaftsstarken Verbände mit heterogener Mitgliedschaft wünschen sich dagegen eine onzentration 20 Es sind die Verbände der Automobil- (VDA), der Chemie- (VCI), der Ernährungs- (BVE), der Stahlund Metallverarbeitungsindustrie (WSM), der Verbundwirtschaft (VDV) und der bereits erwähnten E&E Industrie (ZVEI) und des Maschinenbaus (VDMA). 21 Interviews mit den Verbänden der Arbeitsgemeinschaft Industriengruppe und dem BDI.
66 64 B. ohler-och Tab. 3 Beitrag der drei Gruppen zu den im BDI vertretenen Wirtschaftsleistungen a Summe (BDI 30) leine Sektoren Mittelgroße Sektoren Große Sektoren P P P %von %von %von BDI 30 BDI 30 BDI 30 Unternehmen , , ,72 Beschäftigte , , ,81 Umsatz 1976,5 32,9 1,66 486,5 24, ,1 73,82 (in Mrd. EUR) N , ,0 7 23,3 a Bezugsgröße ist die Gesamtheit der im Industriebereich des BDI erbrachten Leistungen, d. h. ohne die industrienahen Dienstleister und ohne die in der Arbeitsgemeinschaft Industriengruppe vertretenen Wirtschaftszweige Abb. 3 Vertretung der drei Gruppen im BDI und Anteil ihrer Wirtschaftsleistung Tab. 4 Zusammenhang von Wirtschaftsleistung und Tätigkeitsspektrum Spannbreite Unternehmen Beschäftigte Umsatz (in Mrd. EUR) Spannbreite 1 Unternehmen 0,726 *** 1 Beschäftigte 0,692 *** 0,737 *** 1 Umsatz (in Mrd. EUR) 0,405 ** 0,311 0,807 *** 1 *** p < 0,001; **p <0,05 der BDI-Arbeit auf zentrale wirtschaftspolitische Fragen. Von einigen wird kritisch bemerkt, dass der BDI sich verleiten lasse, Mädchen für alles zu sein und sich deshalb auch gegen eine Reduktion des Budgets stemme. 4.3 Domänenzuschnitt: Wettbewerb an den Rändern Nach den Satzungsprinzipien des BDI sollen nur die Spitzenvertretungen einer gesamten Industriegruppe als Mitglied zugelassen werden, doch in der Praxis gibt es hiervon einige Abweichungen. Zu nennen ist zum einen die Pharmabranche, die
67 Deutsche Industrieverbände: Studie zur Heterogenität der Verbandswirklichkeit 65 mit zwei konkurrierenden Verbänden im BDI vertreten ist. Nach der Ausgliederung (1993) des Verbandes der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) aus dem Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) war die Pharmaindustrie zunächst nicht mehr im BDI vertreten (Lang und Schneider 2007, S. 230). Erst nach längeren Verhandlungen einigte man sich darauf, beide Verbände aufzunehmen. Zusätzlich verwischt die Doppelung von Branchen- und BDI-Mitgliedschaft die Domänenabgrenzung. So ist die Pharmabranche zum einen selbständiger Akteur im BDI, zum anderen wird sie vom Branchenverband der Chemie vertreten. Beim Verband der Ernährungsindustrie ist der Fall des Verbandes der ali- und Salzindustrie (VS) kritisch: Entstanden durch den Zusammenschluss des Vereins Deutsche Salzindustrie e. V. mit dem aliverein e. V. (2006), ist der VS nun vornehmlich eine Interessenvertretung der in der ali- und Salzgewinnung tätigen Bergbauunternehmen und fällt so aus dem Rahmen des Ernährungsverbandes BVE. Eine Ausweitung der eigenen Domäne durch Fusion ist auch der Grund für die direkte BDI-Mitgliedschaft des Gießereiverbandes (BDG) zusätzlich zu seiner Mitgliedschaft im Branchenverband Metalle (WVM). Der BDG spricht auch für die Eisen- und Stahlgießereien, während WVM auf die Interessen der Nichteisen-Metallindustrie konzentriert ist. Nicht zu übersehen ist ferner, dass die Austritte von Fachverbänden aus einem Branchenverband bzw. Neuaufnahmen in etlichen Fällen zur Aufweichung der Domänengrenzen geführt haben. Von VDA, VDMA, ZVEI sowie BITOM wird kritisch beobachtet, wie die zunehmende Digitalisierung der Produktion und der Einbau von immer mehr elektronischen omponenten in Produkte und Anlagen die bisherige Domänenabgrenzung in Frage stellt. Gleiches geschieht durch unternehmenspolitische Entwicklungen, die auch in anderen Branchen wie z. B. im Anlagenbau auftreten, wo Firmen ihre unternehmerischen Tätigkeiten entlang der Wertschöpfungskette ausdehnen und somit ihre traditionelle Branchenzugehörigkeit in Frage stellen. Weniger sichtbar, aber sehr bedeutsam ist die Aufhebung der Branchengrenzen durch die bereits jetzt bestehende überlappende Mitgliedschaft von Unternehmen. Selbst mittelständische Unternehmen sind oft Mitglied in mehreren Verbänden. Bei der Mehrzahl der Großkonzerne ist dies die Regel. So bestätigen Insider im Interview, dass die BASF als global agierendes Unternehmen der Chemieindustrie Mitglied in mehr als tausend Verbänden ist. Diese hohe Zahl von Verbandsmitgliedschaften mag eine Ausnahme sein, doch es ist eindeutig, dass das Tätigkeitsprofil vieler Firmen über den Verantwortungsbereich von Fachverbänden und selbst von Branchenverbänden hinausreicht. 5 Die Heterogenität der Branchenverbände 5.1 Mitsprache und Formen der Mitgliedschaft Der Wunsch nach unmittelbarer Mitsprache kann nur in Form direkter Unternehmensmitgliedschaft und in relativ kleinem reis erfüllt werden. Die entsprechenden Voraussetzungen sind in Branchenverbänden ganz kleiner Wirtschaftszweige gegeben. Umfasst ein Verband eine sehr große und heterogene Mitgliedschaft, so ist zu
68 66 B. ohler-och Tab. 5 Verhältnis zwischen wirtschaftlicher Größe und Art der Mitgliedschaft Mittelwert Unternehmen Beschäftigte Umsatz (in Mrd. EUR) Firmen-Direktmitgliedschaft 716, ,33 74,33 Verbandsverbände 1051, ,29 26,40 Tab. 6 Verhältnis zwischen Tätigkeitsspektrum und Art der Mitgliedschaft leines Spektrum Mittleres Spektrum Großes Spektrum Firmen-Direktmitgliedschaft a Gemischte Mitgliedschaft Verbandsverbände a VDMA und ZVEI Sehr großes Spektrum erwarten, dass die Interessen in Fachverbänden gebündelt werden und der Branchenverband eine Föderation von Fachverbänden ist. Das Nebeneinander von vielen kleinen und einigen großen Unternehmen in einem Verband lässt eine Vorzugsbehandlung der wirtschaftlich gewichtigen Akteure erwarten. Die Branchenverbände der deutschen Industrie zeigen genau dieses Muster. In ihrer Mehrheit haben sie Unternehmen als Mitglieder, zum kleineren Teil sind sie Vereinigungen von Fachverbänden oder haben sowohl Unternehmen als auch Verbände als direkte Mitglieder. 22 Von der Wirtschaftskraft einer Branche kann man dagegen nicht auf die Art der Mitgliedschaft schließen. Allerdings zeigt der Vergleich der Mittelwerte, dass die Direktmitgliedschaft von Unternehmen in denjenigen Branchen weiter verbreitet ist, in denen Umsatz und Beschäftigung auf weniger Unternehmen als in der Vergleichsgruppe konzentriert sind. Mit anderen Worten: Unternehmen mit wirtschaftlichem Gewicht wollen offenkundig direkten Einfluss auf ihren Verband haben (Tab. 5). Die Vielgestaltigkeit einer Branche ist dagegen ein guter Indikator für die Regelung der Form der Mitgliedschaft. Aus der Untersuchung ergibt sich, dass Branchen mit engem Tätigkeitsfeld tendenziell Unternehmen als Direktmitglieder haben. Je breiter das Spektrum wirtschaftlicher Tätigkeiten, desto häufiger setzen sich Branchenverbände aus Fachverbänden zusammen. Schwierig ist dabei allerdings die Zuordnung der Verbände des Maschinenbaus (VDMA) und der E&E Industrie (ZVEI). Formal betrachtet sind sie Branchenverbände mit direkter Unternehmensmitgliedschaft, aber in der Praxis handeln sie wie ein Verband von Fachverbänden. Ordnet man VDMA und ZVEI dementsprechend ein, ist der Zusammenhang hochsignifikant 23 (Tab. 6). Die Marktstrukturen sind überraschenderweise kein eindeutiger Anhaltspunkt für die verbandliche Organisationsstruktur. Zu erwarten wäre, dass die direkte Unternehmensmitgliedschaft bei hohen onzentrationsstrukturen überwiegt und der Typ 22 Das Zahlenverhältnis bei den Mitgliedsverbänden des BDI unter Einbeziehung der AG Industriengruppe ist 25 (reine Unternehmensmitgliedschaft) zu 8 (reine Verbandsverbände) zu 7 (gemischte Mitgliedschaft). 23 Chi-Quadrat = (df =6);p < 0,000.
69 Deutsche Industrieverbände: Studie zur Heterogenität der Verbandswirklichkeit 67 Abb. 4 Zusammenhang von Umsatzkonzentration nach Beschäftigungsgrößenklassen und Art der Mitgliedschaft des Verbände-Verbandes in Wirtschaftszweigen mit einer Vielzahl von Mittelstandsunternehmen zu finden ist (Abb. 4). Die beiden Industrieverbände mit der größten Mitgliederzahl widersprechen gerade dieser Erwartung. Der Maschinenbauverband VDMA, der 3100 ganz überwiegend mittelständische Unternehmen vertritt, und auch der E&E Verband ZVEI, der unter seinen 1600 Mitgliedern neben einigen Global Players überwiegend kleinere Unternehmen hat, sind Branchenverbände mit direkter Unternehmensmitgliedschaft. Wer bei VDMA oder ZVEI als Fachverband auftritt, ist formal betrachtet lediglich eine administrative Untergliederung des Verbandes. Diese Fachverbände erfreuen sich allerdings großer Eigenständigkeit und treten in der Öffentlichkeit und gelegentlich auch gegenüber der Politik wie autonome Akteure auf. Sie sind Dreh- und Angelpunkt der Zusammenarbeit mit den Unternehmen und gerade für die hochspezialisierten mittelständischen Unternehmen sind sie und nicht der Verband als solcher die eigentliche Heimat. 24 Die starke Ausdifferenzierung der hausinternen Fachverbände erklärt, warum die personelle Ausstattung von VDMA und ZVEI alle anderen nationalen und europäischen Verbände überragt. 24 Die enge Bindung an den jeweiligen Fachverband wurde in Interviews sowohl mit der Hauptgeschäftsführung als auch mit Geschäftsführern der Abteilungen und mit Unternehmen bestätigt.
Der normative Ansatz in der Stakeholder-Theorie
 Wirtschaft Marcus Habermann Der normative Ansatz in der Stakeholder-Theorie Studienarbeit Semesterarbeit Der normative Ansatz in der Stakeholder-Theorie Institut für Strategie und Unternehmensökonomik
Wirtschaft Marcus Habermann Der normative Ansatz in der Stakeholder-Theorie Studienarbeit Semesterarbeit Der normative Ansatz in der Stakeholder-Theorie Institut für Strategie und Unternehmensökonomik
Regieren und Governance in der BRD
 SUB Hamburg A 2014/ 1724 Regieren und Governance in der BRD Ein Studienbuch von Detlef ^ack Universität Bielefeld Oldenbourg Verlag München Inhaltsverzeichnis Vorwort V 1 Ziel des Buches 1 2 Stile der
SUB Hamburg A 2014/ 1724 Regieren und Governance in der BRD Ein Studienbuch von Detlef ^ack Universität Bielefeld Oldenbourg Verlag München Inhaltsverzeichnis Vorwort V 1 Ziel des Buches 1 2 Stile der
Harmonisierung oder Differenzierung im Hochschulwesen: was streben wir in Österreich an?
 Harmonisierung oder Differenzierung im Hochschulwesen: was streben wir in Österreich an? Prof. Dr. Antonio Loprieno, Vorsitzender des ÖWR Herbsttagung des Wissenschaftsrats: Differenzierung im Hochschulsystem.
Harmonisierung oder Differenzierung im Hochschulwesen: was streben wir in Österreich an? Prof. Dr. Antonio Loprieno, Vorsitzender des ÖWR Herbsttagung des Wissenschaftsrats: Differenzierung im Hochschulsystem.
Interessenvertretung durch Verbände eine Sonderrolle? Basanta Thapa
 Interessenvertretung durch Verbände eine Sonderrolle? Basanta Thapa Verbände in der Presse (28.11.) Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen zeigt sich erfreut über den Ausgang der Volksabstimmung zu
Interessenvertretung durch Verbände eine Sonderrolle? Basanta Thapa Verbände in der Presse (28.11.) Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen zeigt sich erfreut über den Ausgang der Volksabstimmung zu
Individualisierung bei Max Weber. Steffi Sager und Ulrike Wöhl
 Individualisierung bei Max Weber Steffi Sager und Ulrike Wöhl Gliederung 1. Einleitung 2. Das soziale Handeln 3. Werthaftigkeit und Sinnhaftigkeit des Handelns 4. Die Orientierung am Anderen 5. Zusammenwirken
Individualisierung bei Max Weber Steffi Sager und Ulrike Wöhl Gliederung 1. Einleitung 2. Das soziale Handeln 3. Werthaftigkeit und Sinnhaftigkeit des Handelns 4. Die Orientierung am Anderen 5. Zusammenwirken
Teil III: Politikfelder die inhaltliche Dimension der Politik
 Teil III: Politikfelder die inhaltliche Dimension der Politik Policy: bezeichnet den inhaltlichen (den materiellen) Teil von Politik, wie er im Deutschen üblicherweise durch verschiedene Politikbereiche
Teil III: Politikfelder die inhaltliche Dimension der Politik Policy: bezeichnet den inhaltlichen (den materiellen) Teil von Politik, wie er im Deutschen üblicherweise durch verschiedene Politikbereiche
Abbildungsverzeichnis...VI Tabellenverzeichnis... VII Abkürzungsverzeichnis...VIII
 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis...VI Tabellenverzeichnis... VII Abkürzungsverzeichnis...VIII 1 Einführung... 1 1.1 Problemstellung und Zielsetzung... 1 1.2 Aufbau und Vorgehensweise der Untersuchung...
Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis...VI Tabellenverzeichnis... VII Abkürzungsverzeichnis...VIII 1 Einführung... 1 1.1 Problemstellung und Zielsetzung... 1 1.2 Aufbau und Vorgehensweise der Untersuchung...
Ökonomische Effekte der Dienstleistungsfreiheit: Ergebnisse empirischer Untersuchungen zur Dienstleistungsrichtlinie
 Ökonomische Effekte der Dienstleistungsfreiheit: Ergebnisse empirischer Untersuchungen zur Dienstleistungsrichtlinie Tagung zur Dienstleistungsfreiheit in der EU: Deutsche und Ungarische Perspektiven Budapest,
Ökonomische Effekte der Dienstleistungsfreiheit: Ergebnisse empirischer Untersuchungen zur Dienstleistungsrichtlinie Tagung zur Dienstleistungsfreiheit in der EU: Deutsche und Ungarische Perspektiven Budapest,
Teil 1: Ökonomische und politikwissenschaftliche Grundlagen
 Teil 1: Ökonomische und politikwissenschaftliche Grundlagen Marktversagen I: Öffentliche Olson, Mancur, 1965, The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge, Harvard University
Teil 1: Ökonomische und politikwissenschaftliche Grundlagen Marktversagen I: Öffentliche Olson, Mancur, 1965, The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge, Harvard University
Katja Stamer (Autor) Ehrenamt Management Impulse und praktische Hilfestellungen zur Förderung des Ehrenamtes in Sportvereinen
 Katja Stamer (Autor) Ehrenamt Management Impulse und praktische Hilfestellungen zur Förderung des Ehrenamtes in Sportvereinen https://cuvillier.de/de/shop/publications/6637 Copyright: Cuvillier Verlag,
Katja Stamer (Autor) Ehrenamt Management Impulse und praktische Hilfestellungen zur Förderung des Ehrenamtes in Sportvereinen https://cuvillier.de/de/shop/publications/6637 Copyright: Cuvillier Verlag,
Nachhaltige Unternehmen Zukunftsfähige Unternehmen? Corporate Responsibility bei der AUDI AG
 Nachhaltige Unternehmen Zukunftsfähige Unternehmen? Corporate Responsibility bei der AUDI AG Dr. Peter F. Tropschuh 16. November 2013 1. Was ist Corporate Responsibility? Grundlagen unternehmerischer Nachhaltigkeit
Nachhaltige Unternehmen Zukunftsfähige Unternehmen? Corporate Responsibility bei der AUDI AG Dr. Peter F. Tropschuh 16. November 2013 1. Was ist Corporate Responsibility? Grundlagen unternehmerischer Nachhaltigkeit
Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft 10. Vorlesung 22. Dezember Policy-Analyse 1: Einführung
 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft Policy-Analyse 1: Einführung 1 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft Vgl. Böhret, Carl u.a.: Innenpolitik und politische Theorie. Ein Studienbuch.
Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft Policy-Analyse 1: Einführung 1 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft Vgl. Böhret, Carl u.a.: Innenpolitik und politische Theorie. Ein Studienbuch.
Rasmus Beckmann, M.A. Universität zu Köln. Liberalismus. Lehrstuhl für Internationale Politik und Außenpolitik Prof. Dr.
 Rasmus Beckmann, M.A. Liberalismus Lehrstuhl für Internationale Politik und Außenpolitik Prof. Dr. Thomas Jäger Leitfragen 1. Nennen Sie drei theoretische Perspektiven zur Analyse der internationalen Beziehungen?
Rasmus Beckmann, M.A. Liberalismus Lehrstuhl für Internationale Politik und Außenpolitik Prof. Dr. Thomas Jäger Leitfragen 1. Nennen Sie drei theoretische Perspektiven zur Analyse der internationalen Beziehungen?
Arbeitsbeziehungen im Rheinischen Kapitalismus. Zwischen Modernisierung und Globalisierung
 Jürgen Hoffmann Arbeitsbeziehungen im Rheinischen Kapitalismus Zwischen Modernisierung und Globalisierung WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT Inhalt Gewerkschaften in Deutschland: Jenseits gesellschaftlicher Hegemonie
Jürgen Hoffmann Arbeitsbeziehungen im Rheinischen Kapitalismus Zwischen Modernisierung und Globalisierung WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT Inhalt Gewerkschaften in Deutschland: Jenseits gesellschaftlicher Hegemonie
Ergebnisbericht 2012/2013
 Unterstellte Wirkungen Wirkungen von Unterstellungen Befragung von Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen des Forschungsprojekts Politische Kommunikation in der Online Welt Ergebnisbericht 0/0 Düsseldorf,.
Unterstellte Wirkungen Wirkungen von Unterstellungen Befragung von Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen des Forschungsprojekts Politische Kommunikation in der Online Welt Ergebnisbericht 0/0 Düsseldorf,.
Bäuerliche Prinzipien der Zukunft Im Einklang mit Ökologie, Ökonomie und Unternehmertum. Bauernstammtisch Derndorf, 08. April 2010
 Bäuerliche Prinzipien der Zukunft Im Einklang mit Ökologie, Ökonomie und Unternehmertum Bauernstammtisch Derndorf, 08. April 2010 Strukturwandel in der Landwirtschaft seit Jahrzehnten enormer Wandel: Auf
Bäuerliche Prinzipien der Zukunft Im Einklang mit Ökologie, Ökonomie und Unternehmertum Bauernstammtisch Derndorf, 08. April 2010 Strukturwandel in der Landwirtschaft seit Jahrzehnten enormer Wandel: Auf
Das Medianwählermodell
 Das Medianwählermodell Ökonomische Theorie der Politik A.4.1 Das Medianwählermodell untersucht Entscheidungen, die auf Grundlage der Mehrheitsregel in einer repräsentativen Demokratie gefällt werden 2
Das Medianwählermodell Ökonomische Theorie der Politik A.4.1 Das Medianwählermodell untersucht Entscheidungen, die auf Grundlage der Mehrheitsregel in einer repräsentativen Demokratie gefällt werden 2
Ehrenamt verstehen Vortrag am 18. Oktober 2016 in Strobl
 Vortrag am 18. Oktober 2016 in Strobl PD Dr. Bettina Hollstein Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien Gliederung 1. Ehrenamt: Definition und Zahlen 2. Ehrenamt in ökonomischer
Vortrag am 18. Oktober 2016 in Strobl PD Dr. Bettina Hollstein Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien Gliederung 1. Ehrenamt: Definition und Zahlen 2. Ehrenamt in ökonomischer
Diversifikation und Kernkompetenzen
 Wirtschaft Markus Klüppel Diversifikation und Kernkompetenzen Masterarbeit RheinAhrCampus Remagen Fachbereich: Betriebs- und Sozialwirtschaft Studiengang: MBA Masterthesis Diversifikation und Kernkompetenzen
Wirtschaft Markus Klüppel Diversifikation und Kernkompetenzen Masterarbeit RheinAhrCampus Remagen Fachbereich: Betriebs- und Sozialwirtschaft Studiengang: MBA Masterthesis Diversifikation und Kernkompetenzen
Theorien der Europäischen Integration. LEKT. DR. CHRISTIAN SCHUSTER Internationale Beziehungen und Europastudien
 Theorien der Europäischen Integration LEKT. DR. CHRISTIAN SCHUSTER Internationale Beziehungen und Europastudien FAKULTÄT FÜR EUROPASTUDIEN WINTERSEMESTER 2016 Phasen der Integrationstheorie Phase Zeit
Theorien der Europäischen Integration LEKT. DR. CHRISTIAN SCHUSTER Internationale Beziehungen und Europastudien FAKULTÄT FÜR EUROPASTUDIEN WINTERSEMESTER 2016 Phasen der Integrationstheorie Phase Zeit
2. Politische Funktionen von Massenmedien
 2. Politische Funktionen von Massenmedien Grundsätzlich weisen die Massenmedien 7, d. h. Printmedien, Medien des Rundfunks (Hörfunk und Fernsehen) und Online-Medien (Internet), eine Vielzahl von politischen
2. Politische Funktionen von Massenmedien Grundsätzlich weisen die Massenmedien 7, d. h. Printmedien, Medien des Rundfunks (Hörfunk und Fernsehen) und Online-Medien (Internet), eine Vielzahl von politischen
Staat und Wirtschaft in Russland
 Petra Stykow Staat und Wirtschaft in Russland Interessenvermittlung zwischen Korruption und Konzertierung VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhalt Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen 10 Abkürzungsverzeichnis
Petra Stykow Staat und Wirtschaft in Russland Interessenvermittlung zwischen Korruption und Konzertierung VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhalt Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen 10 Abkürzungsverzeichnis
2. Theoretische Grundlagen der Sozialstrukturanalyse
 2. Theoretische Grundlagen der Sozialstrukturanalyse 2.1. Sozialstruktur und soziale Ungleichheit - Soziologie ist eine Wissenschaft, die kollektive (agreggierte) soziale Phänomene beschreiben und erklären
2. Theoretische Grundlagen der Sozialstrukturanalyse 2.1. Sozialstruktur und soziale Ungleichheit - Soziologie ist eine Wissenschaft, die kollektive (agreggierte) soziale Phänomene beschreiben und erklären
Lobbyismus in Deutschland und den USA - Adressaten und Methoden im Vergleich
 Politik Judith Blum Lobbyismus in Deutschland und den USA - Adressaten und Methoden im Vergleich Studienarbeit Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. Seminar für Wissenschaftliche Politik Hauptseminar:
Politik Judith Blum Lobbyismus in Deutschland und den USA - Adressaten und Methoden im Vergleich Studienarbeit Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. Seminar für Wissenschaftliche Politik Hauptseminar:
Die Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union (1997)
 Die Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union (1997) Diese Deklaration wurde von allen Mitgliedern des Europäischen Netzwerkes für betriebliche Gesundheitsförderung
Die Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union (1997) Diese Deklaration wurde von allen Mitgliedern des Europäischen Netzwerkes für betriebliche Gesundheitsförderung
Der bürokratietheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse
 Der bürokratietheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse Allison, Graham T./ Zelikow, Philip (1999 2 ): Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis, New York: Longman. The decisions and actions
Der bürokratietheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse Allison, Graham T./ Zelikow, Philip (1999 2 ): Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis, New York: Longman. The decisions and actions
Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren?
 Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
11. Institutionen und Entwicklungsstufen
 11. Institutionen und Entwicklungsstufen Texte: Acemoglu et al. S.1-11, 29-39, 51-53. Klump/Brackert. 11.1 Institutionen und Wachstum Institutions are the rules of the game in a society or, more formally,
11. Institutionen und Entwicklungsstufen Texte: Acemoglu et al. S.1-11, 29-39, 51-53. Klump/Brackert. 11.1 Institutionen und Wachstum Institutions are the rules of the game in a society or, more formally,
Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement
 Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Mitbestimmt geht s mir besser! Seite 1 Leitlinien für Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Beteiligung: Marginalisierten Gruppen eine Stimme geben!
Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Mitbestimmt geht s mir besser! Seite 1 Leitlinien für Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Beteiligung: Marginalisierten Gruppen eine Stimme geben!
Modulhandbuch Master Politikwissenschaft (Nebenfach) Vertiefungsmodul: Politische Systeme, MA Politikwissenschaft (Nebenfach)
 Modulhandbuch Master Politikwissenschaft Modulübersicht: Vertiefungsmodul: Politische Systeme Vertiefungsmodul: Politische Ökonomie Vertiefungsmodul: Politische Theorie und Ideengeschichte Vertiefungsmodul:
Modulhandbuch Master Politikwissenschaft Modulübersicht: Vertiefungsmodul: Politische Systeme Vertiefungsmodul: Politische Ökonomie Vertiefungsmodul: Politische Theorie und Ideengeschichte Vertiefungsmodul:
Management - Strategische Unternehmensführung
 Inhalt der Vorlesung 1. Gegenstand der BWL und Betriebswirtschaftliche Funktionen 2. Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsprogramme 3. Entscheidungen als Grundelemente der BWL 4. Rahmenbedingungen wirtschaftlichen
Inhalt der Vorlesung 1. Gegenstand der BWL und Betriebswirtschaftliche Funktionen 2. Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsprogramme 3. Entscheidungen als Grundelemente der BWL 4. Rahmenbedingungen wirtschaftlichen
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse
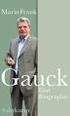 Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
Verfeinerungen des Bayesianischen Nash Gleichgewichts
 Spieltheorie Sommersemester 007 Verfeinerungen des Bayesianischen Nash Gleichgewichts Das Bayesianische Nash Gleichgewicht für Spiele mit unvollständiger Information ist das Analogon zum Nash Gleichgewicht
Spieltheorie Sommersemester 007 Verfeinerungen des Bayesianischen Nash Gleichgewichts Das Bayesianische Nash Gleichgewicht für Spiele mit unvollständiger Information ist das Analogon zum Nash Gleichgewicht
Antworten Anfrage Lobbycontrol
 CPP 18.8.2014 Antworten Anfrage Lobbycontrol A) Grundsätze und Transparenz der Interessenvertretung 1. Nach welchen Grundsätzen und Maßstäben organisieren Sie die politische Interessenvertretung Ihres
CPP 18.8.2014 Antworten Anfrage Lobbycontrol A) Grundsätze und Transparenz der Interessenvertretung 1. Nach welchen Grundsätzen und Maßstäben organisieren Sie die politische Interessenvertretung Ihres
Thomas von Winter Ulrich Willems (Hrsg.) Interessenverbände in Deutschland
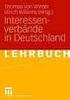 Thomas von Winter Ulrich Willems (Hrsg.) Interessenverbände in Deutschland Thomas von Winter Ulrich Willems (Hrsg.) Interessenverbände in Deutschland Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Thomas von Winter Ulrich Willems (Hrsg.) Interessenverbände in Deutschland Thomas von Winter Ulrich Willems (Hrsg.) Interessenverbände in Deutschland Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Workshopbeschreibungen
 10. Arbeitsschutzforum am 14./15. September 2015 in der DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund en Perspektive: Betriebe und Beschäftigte KMU/Dienstleistung Chancen, Risiken, Betroffenheit und Relevanz
10. Arbeitsschutzforum am 14./15. September 2015 in der DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund en Perspektive: Betriebe und Beschäftigte KMU/Dienstleistung Chancen, Risiken, Betroffenheit und Relevanz
Einführung in die Politikgeschichte des industriellen Zeitalters
 Einführung in die Politikgeschichte des industriellen Zeitalters A. Politische Grundbegriffe 11. Partizipationstypen (Stykow, S. 86ff.) Was heißt Partizipation? Zu offenen liberalen Bürgergesellschaften,
Einführung in die Politikgeschichte des industriellen Zeitalters A. Politische Grundbegriffe 11. Partizipationstypen (Stykow, S. 86ff.) Was heißt Partizipation? Zu offenen liberalen Bürgergesellschaften,
3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung
 Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
Inhaltsverzeichnis. Vorwort 11 Vorwort zur zweiten Auflage 12
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 Vorwort zur zweiten Auflage 12 Kapitel 1: Governance - Modebegriff oder nützliches sozialwissenschaftliches Konzept? 13 Arthur Benz /Nicolai Dose 1.1 Zur Beziehung von Begriff
Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 Vorwort zur zweiten Auflage 12 Kapitel 1: Governance - Modebegriff oder nützliches sozialwissenschaftliches Konzept? 13 Arthur Benz /Nicolai Dose 1.1 Zur Beziehung von Begriff
Ein Programm zur Steigerung der betriebswirtschaftlichen Effizienz von Verbänden
 Mehrwert durch Ressourcenoptimierung Ein Programm zur Steigerung der betriebswirtschaftlichen Effizienz von Verbänden erstellt von:, Berlin Dr. Hans Werner Busch BERLIN I BRÜSSEL Berlin, Mai 2010 Allg.
Mehrwert durch Ressourcenoptimierung Ein Programm zur Steigerung der betriebswirtschaftlichen Effizienz von Verbänden erstellt von:, Berlin Dr. Hans Werner Busch BERLIN I BRÜSSEL Berlin, Mai 2010 Allg.
1. Grundlagen der Politikwissenschaft... 11
 5 Inhalt 1. Grundlagen der Politikwissenschaft...................... 11 1.1 Was heißt hier Wissenschaft?............................. 11 1.1.1 Alltagsnähe der Politik............................ 11 1.1.2
5 Inhalt 1. Grundlagen der Politikwissenschaft...................... 11 1.1 Was heißt hier Wissenschaft?............................. 11 1.1.1 Alltagsnähe der Politik............................ 11 1.1.2
Aufgaben des Kanzlers im 21. Jahrhundert Thesen zur Hochschulgovernance
 Aufgaben des Kanzlers im 21. Jahrhundert Thesen zur Hochschulgovernance Prof. Dr. Dorothea Jansen Universität Speyer und FÖV Speyer Web: http://www.uni-speyer.de/jansen http://www.foev-speyer.de/governance
Aufgaben des Kanzlers im 21. Jahrhundert Thesen zur Hochschulgovernance Prof. Dr. Dorothea Jansen Universität Speyer und FÖV Speyer Web: http://www.uni-speyer.de/jansen http://www.foev-speyer.de/governance
Observatorium für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa. Stand: November 2009
 Observatorium für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa Stand: November 2009 Ausgangslage Trotz geringer originärer Kompetenzen der EU werden viele sozialpolitische Themen auf der EU-Ebene diskutiert,
Observatorium für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa Stand: November 2009 Ausgangslage Trotz geringer originärer Kompetenzen der EU werden viele sozialpolitische Themen auf der EU-Ebene diskutiert,
Sicherheitswahrnehmungen im 21. Jahrhundert. Eine Einführung. Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht
 Sicherheitswahrnehmungen im 21. Jahrhundert Eine Einführung Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht 1 Sicherheit 2009 Einleitung Ausgangspunkt Stellung der Sicherheit in modernen Gesellschaften Risiko, Gefahr
Sicherheitswahrnehmungen im 21. Jahrhundert Eine Einführung Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht 1 Sicherheit 2009 Einleitung Ausgangspunkt Stellung der Sicherheit in modernen Gesellschaften Risiko, Gefahr
Kollaborative Ökonomie Potenziale für nachhaltiges Wirtschaften
 Kollaborative Ökonomie Potenziale für nachhaltiges Wirtschaften Jahrestagung des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung Geschäftsmodell Nachhaltigkeit Ulrich Petschow 21. November 2013, Berlin
Kollaborative Ökonomie Potenziale für nachhaltiges Wirtschaften Jahrestagung des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung Geschäftsmodell Nachhaltigkeit Ulrich Petschow 21. November 2013, Berlin
Rapoport: Eine Klassifikation der Konflikte
 Rapoport: Eine Klassifikation der Konflikte Das grundlegende Kennzeichen des menschlichen Konflikts ist das Bewußtsein von ihm bei den Teilnehmern. S. 222 Erste Klassifikation Teilnehmer Streitpunkte Mittel
Rapoport: Eine Klassifikation der Konflikte Das grundlegende Kennzeichen des menschlichen Konflikts ist das Bewußtsein von ihm bei den Teilnehmern. S. 222 Erste Klassifikation Teilnehmer Streitpunkte Mittel
Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie in Baden-Württemberg
 Forschungsprojekt Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie in Baden-Württemberg Ergebnisse der Telefonbefragung 13 Prof. Dr. Thorsten Faas Institut für Politikwissenschaft Universität Mainz Prof. Dr. Rüdiger
Forschungsprojekt Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie in Baden-Württemberg Ergebnisse der Telefonbefragung 13 Prof. Dr. Thorsten Faas Institut für Politikwissenschaft Universität Mainz Prof. Dr. Rüdiger
Gesellschaftstheorien und das Recht
 Vorlesung Rechtssoziologie HS 2012 Gesellschaftstheorien und das Recht Emile Durkheim Ass.-Prof. Dr. Michelle Cottier Juristische Fakultät Universität Basel Emile Durkheim (1858-1917) Rechtssoziologie
Vorlesung Rechtssoziologie HS 2012 Gesellschaftstheorien und das Recht Emile Durkheim Ass.-Prof. Dr. Michelle Cottier Juristische Fakultät Universität Basel Emile Durkheim (1858-1917) Rechtssoziologie
Die Textilbranche als Teil der Konsumgesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung: Eine Analyse. Bachelorarbeit
 Die Textilbranche als Teil der Konsumgesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung: Eine Analyse Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft
Die Textilbranche als Teil der Konsumgesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung: Eine Analyse Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft
Wie Du mir, so ich Dir: Fairness und Gerechtigkeit in Partnerschaften
 Wie Du mir, so ich Dir: Fairness und Gerechtigkeit in Partnerschaften Seminar Gerechtigkeitstheorien und ihre praktische Anwendung SS 2008 Dozentin Dipl. Psych.Tanja Nazlic Gliederung Die Equity Theorie
Wie Du mir, so ich Dir: Fairness und Gerechtigkeit in Partnerschaften Seminar Gerechtigkeitstheorien und ihre praktische Anwendung SS 2008 Dozentin Dipl. Psych.Tanja Nazlic Gliederung Die Equity Theorie
Wandel des Wahlverhaltens. Das deutsche Parteiensystem und die Krise der politischen Repräsentation
 Geisteswissenschaft Sebastian Krätzig Wandel des Wahlverhaltens. Das deutsche Parteiensystem und die Krise der politischen Repräsentation Am Beispiel der FDP und der Piratenpartei Masterarbeit Gottfried
Geisteswissenschaft Sebastian Krätzig Wandel des Wahlverhaltens. Das deutsche Parteiensystem und die Krise der politischen Repräsentation Am Beispiel der FDP und der Piratenpartei Masterarbeit Gottfried
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Politik und Wirtschaft. Analysekompetenz (A)
 Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Politik und Wirtschaft Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, Bildungsstandards und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Politik und Wirtschaft Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, Bildungsstandards und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der
Qualität und Qualitätskultur an Hochschulen in sich diversifizierenden Hochschulsystemen
 Qualität und Qualitätskultur an Hochschulen in sich diversifizierenden Hochschulsystemen Prof. Dr. Antonio Loprieno Rektor der Universität Basel Präsident der CRUS Qualitätssicherung zwischen Diversifizierung
Qualität und Qualitätskultur an Hochschulen in sich diversifizierenden Hochschulsystemen Prof. Dr. Antonio Loprieno Rektor der Universität Basel Präsident der CRUS Qualitätssicherung zwischen Diversifizierung
Informationen zur Klausur
 Informationen zur Klausur http://innen.politik.uni-mainz.de/2015/07/14/ informationen-zur-klausur-im-basismodul-brd-5/ bzw. innen.politik.uni-mainz.de/ Aktuelles Soziale Bewegungen und unkonventionelle
Informationen zur Klausur http://innen.politik.uni-mainz.de/2015/07/14/ informationen-zur-klausur-im-basismodul-brd-5/ bzw. innen.politik.uni-mainz.de/ Aktuelles Soziale Bewegungen und unkonventionelle
Foresight Workshop Ausgangslage und Beschreibung
 2030 Foresight Workshop Future Urban Mobility: Städte als Zentren der Neuordnung des Mobilitätsmarktes Erkennen Sie die wesentlichen Marktveränderungen und strategischen Handlungsoptionen für Ihr Unternehmen
2030 Foresight Workshop Future Urban Mobility: Städte als Zentren der Neuordnung des Mobilitätsmarktes Erkennen Sie die wesentlichen Marktveränderungen und strategischen Handlungsoptionen für Ihr Unternehmen
Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft 9. Vorlesung 15. Dezember Politische Kommunikation 2: Wahlen
 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft 9. Vorlesung 15. Dezember 2009 Politische Kommunikation 2: Wahlen 1 2 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft 9. Vorlesung 15. Dezember 2009
Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft 9. Vorlesung 15. Dezember 2009 Politische Kommunikation 2: Wahlen 1 2 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft 9. Vorlesung 15. Dezember 2009
Leistungssprogramm von Dienstleistern der politischen Kommunikation
 Leistungssprogramm von Dienstleistern der politischen Kommunikation Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Masterkurs: Dienstleister der politischen Kommunikation Dozentin: Stephanie Opitz WS 2008/2009
Leistungssprogramm von Dienstleistern der politischen Kommunikation Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Masterkurs: Dienstleister der politischen Kommunikation Dozentin: Stephanie Opitz WS 2008/2009
Stärkung der Tarifbindung in der IG Metall
 Stärkung der Tarifbindung in der IG Metall 12. Workshop Europäische Tarifpolitik am 15. und 16. Mai 2017 in Berlin Ricarda Bier und Juan-Carlos Rio Antas IG Metall FB Tarifpolitik 1 Wir haben euch mitgebracht:
Stärkung der Tarifbindung in der IG Metall 12. Workshop Europäische Tarifpolitik am 15. und 16. Mai 2017 in Berlin Ricarda Bier und Juan-Carlos Rio Antas IG Metall FB Tarifpolitik 1 Wir haben euch mitgebracht:
Mikrofundierung des soziologischen Neo-Institutionalismus und weiterführende Arbeiten
 Mikrofundierung des soziologischen Neo-Institutionalismus und weiterführende Arbeiten Themenbereich 5: Performance Measurement in Organisationen Perspektiven des soziologischen Neo-Institutionalismus Referent:
Mikrofundierung des soziologischen Neo-Institutionalismus und weiterführende Arbeiten Themenbereich 5: Performance Measurement in Organisationen Perspektiven des soziologischen Neo-Institutionalismus Referent:
Prof. Dr. Claus W. Gerberich Führen nach dem St. Galler Management Modell
 Führen nach dem St. Galler Management Modell Die zunehmend globalen Märkte von heute sind einem immer stärkeren und schnelleren Wandel unterworfen und vernetzen sich. Klassische Branchengrenzen verschwinden.
Führen nach dem St. Galler Management Modell Die zunehmend globalen Märkte von heute sind einem immer stärkeren und schnelleren Wandel unterworfen und vernetzen sich. Klassische Branchengrenzen verschwinden.
erklärende Variable intervenierende Variablen zu erklärende Variable
 erklärende Variable intervenierende Variablen zu erklärende Variable Grundbegriffe 10a Entscheidung zur Intervention Bürokratischer Prozeß Interessen Öffentlichkeit Exekutive Legislative Eigene Rolle Perzeption
erklärende Variable intervenierende Variablen zu erklärende Variable Grundbegriffe 10a Entscheidung zur Intervention Bürokratischer Prozeß Interessen Öffentlichkeit Exekutive Legislative Eigene Rolle Perzeption
Öffentlichkeitsarbeit gewinnt bei Verbänden an Bedeutung
 Öffentlichkeitsarbeit gewinnt bei Verbänden an Bedeutung Institut für angewandte PR führt kleine Umfrage durch Wie aktiv sind Verbände in Punkto Öffentlichkeitsarbeit? Welche Schwerpunkte setzen sie und
Öffentlichkeitsarbeit gewinnt bei Verbänden an Bedeutung Institut für angewandte PR führt kleine Umfrage durch Wie aktiv sind Verbände in Punkto Öffentlichkeitsarbeit? Welche Schwerpunkte setzen sie und
INHALTSVERZEICHNIS. TEIL I. Rahmenbedingungen und Formen der Organisation von Unternehmern
 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT TABELLENVERZEICHNIS FIGURENVERZEICHNIS ABKUERZUNGSVERZEICHNIS iii x xii xiii Kapitel Seite 1. EINLEITUNG (H. Kriesi) 1 1.1. Warum Wirtschaftsverbände? 1 1-.2. Die verbandsmässige
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT TABELLENVERZEICHNIS FIGURENVERZEICHNIS ABKUERZUNGSVERZEICHNIS iii x xii xiii Kapitel Seite 1. EINLEITUNG (H. Kriesi) 1 1.1. Warum Wirtschaftsverbände? 1 1-.2. Die verbandsmässige
Corporate Social Responsibility in der Schweiz
 Brigitte Liebig (Hrsg.) Corporate Social Responsibility in der Schweiz Massnahmen und Wirkungen Haupt Verlag Bern Stuttgart Wien, HOCHSCHULE I LIECHTENSTEIN Bibliothek Abbildungsverzeichnis 11 Tabellenverzeichnis
Brigitte Liebig (Hrsg.) Corporate Social Responsibility in der Schweiz Massnahmen und Wirkungen Haupt Verlag Bern Stuttgart Wien, HOCHSCHULE I LIECHTENSTEIN Bibliothek Abbildungsverzeichnis 11 Tabellenverzeichnis
Einführung in Problematik und Zielsetzung soziologischer Theorien
 Fabian Karsch Lehrstuhl für Soziologie. PS: Einführung in soziologische Theorien, 23.10.2006 Einführung in Problematik und Zielsetzung soziologischer Theorien Was ist eine Theorie? Eine Theorie ist ein
Fabian Karsch Lehrstuhl für Soziologie. PS: Einführung in soziologische Theorien, 23.10.2006 Einführung in Problematik und Zielsetzung soziologischer Theorien Was ist eine Theorie? Eine Theorie ist ein
Einstellungen zu Demokratie in Österreich
 Einstellungen zu Demokratie in Österreich Mag. Roland Teitzer - Stipendiat der österreichischen Akademie der Wissenschaften (DOC) am Institut für Soziologie der Universität Wien Unterstützung für die Demokratie
Einstellungen zu Demokratie in Österreich Mag. Roland Teitzer - Stipendiat der österreichischen Akademie der Wissenschaften (DOC) am Institut für Soziologie der Universität Wien Unterstützung für die Demokratie
PD Dr. Ansgar Klein BBE Europa-Newsletter 10/2013. Input Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE)
 PD Dr. Ansgar Klein BBE Europa-Newsletter 10/2013 Input Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) Forum Europa mitentscheiden Teil II Zwischen Bürgerbeteiligung und Lobbyismus 11.15 bis 12.45
PD Dr. Ansgar Klein BBE Europa-Newsletter 10/2013 Input Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) Forum Europa mitentscheiden Teil II Zwischen Bürgerbeteiligung und Lobbyismus 11.15 bis 12.45
Von Greenpeace & CO Wie arbeiten die internationalen Umweltorganisationen
 Von Greenpeace & CO Wie arbeiten die internationalen Umweltorganisationen Dr. Achim Brunnengräber Freie Universität Berlin priklima@zedat.fu-berlin.de Die neuen Sterne am Firmament globaler Politik! Spiegel
Von Greenpeace & CO Wie arbeiten die internationalen Umweltorganisationen Dr. Achim Brunnengräber Freie Universität Berlin priklima@zedat.fu-berlin.de Die neuen Sterne am Firmament globaler Politik! Spiegel
Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre
 6 Wie eine Volkswirtschaft funktioniert Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre Die Volkswirtschaftlehre (VWL) beschäftigt sich mit den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen eines Staates: der Volkswirtschaft.
6 Wie eine Volkswirtschaft funktioniert Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre Die Volkswirtschaftlehre (VWL) beschäftigt sich mit den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen eines Staates: der Volkswirtschaft.
Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001)
 Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001) Diese Erklärung wurde vom ENBGF auf dem Netzwerktreffen am 16. Juni 2001 verabschiedet und auf der anschließenden
Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001) Diese Erklärung wurde vom ENBGF auf dem Netzwerktreffen am 16. Juni 2001 verabschiedet und auf der anschließenden
Europäische Öffentlichkeit. EUROPA VERDIENT ÖFFENTLICHKEIT.
 Europäische Öffentlichkeit. EUROPA VERDIENT ÖFFENTLICHKEIT. Thesenpapier zur Interdisziplinären Zukunftskreissitzung Politik und Wirtschaft / Medien und Kommunikation, 30.04.2012 Thesen in Zusammenarbeit
Europäische Öffentlichkeit. EUROPA VERDIENT ÖFFENTLICHKEIT. Thesenpapier zur Interdisziplinären Zukunftskreissitzung Politik und Wirtschaft / Medien und Kommunikation, 30.04.2012 Thesen in Zusammenarbeit
Zur Ausarbeitung einer Evaluationsordnung - Unter Berücksichtigung von Rechtslage und Hochschulmanagement
 Wirtschaft Boris Hoppen Zur Ausarbeitung einer Evaluationsordnung - Unter Berücksichtigung von Rechtslage und Hochschulmanagement Projektarbeit Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Diplomstudiengang
Wirtschaft Boris Hoppen Zur Ausarbeitung einer Evaluationsordnung - Unter Berücksichtigung von Rechtslage und Hochschulmanagement Projektarbeit Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Diplomstudiengang
Neue Biotechnologien zwischen wissenschaftlich-technischer Rationalisierung und öffentlichem Diskurs
 Univ.-Prof. Dr. Thomas Saretzki Lehrveranstaltungen 1. Lehraufträge an der Universität Hamburg Fachbereich Philosophie und Sozialwissenschaften, Institut für Politische Wissenschaft Übungen bzw. Lektürekurs
Univ.-Prof. Dr. Thomas Saretzki Lehrveranstaltungen 1. Lehraufträge an der Universität Hamburg Fachbereich Philosophie und Sozialwissenschaften, Institut für Politische Wissenschaft Übungen bzw. Lektürekurs
Institutionenökonomik
 Stefan Voigt Institutionenökonomik WILHELM FINK VERLAG MÜNCHEN Inhaltsverzeichnis Vorwort 15 Einführung 17 Teil I: Fragen, Annahmen, Methoden: Die Grundlagen 23 Kapitel 1: Die Grandlagen 25 1.1 Das ökonomische
Stefan Voigt Institutionenökonomik WILHELM FINK VERLAG MÜNCHEN Inhaltsverzeichnis Vorwort 15 Einführung 17 Teil I: Fragen, Annahmen, Methoden: Die Grundlagen 23 Kapitel 1: Die Grandlagen 25 1.1 Das ökonomische
Kompetenzen für die moderne Arbeitswelt
 Fallstudie: ias-gruppe Fachlaufbahn für Arbeitsmediziner und Sicherheitsfachkräfte Mit der Fachlaufbahn für Arbeitsmediziner und Sicherheitsfachkräfte bietet die ias-gruppe ihren Mitarbeitern einen strukturierten
Fallstudie: ias-gruppe Fachlaufbahn für Arbeitsmediziner und Sicherheitsfachkräfte Mit der Fachlaufbahn für Arbeitsmediziner und Sicherheitsfachkräfte bietet die ias-gruppe ihren Mitarbeitern einen strukturierten
Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann
 Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS
Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS
Trendanalyse Berufliche Aus- und Weiterbildung in Deutschland
 Trendanalyse Berufliche Aus- und Weiterbildung in Deutschland Impressum Herausgeber bfw Unternehmen für Bildung Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des DGB GmbH (bfw) Schimmelbuschstraße
Trendanalyse Berufliche Aus- und Weiterbildung in Deutschland Impressum Herausgeber bfw Unternehmen für Bildung Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des DGB GmbH (bfw) Schimmelbuschstraße
Aggregierte Präferenzen: Liberalismus (Rasmus Beckmann)
 Liberalismus Folie 1 Aggregierte Präferenzen: Liberalismus (Rasmus Beckmann) Gliederung 1. Einordnung der liberalen Außenpolitiktheorie in den Kontext der Vorlesung 2. Abgrenzung vom traditionellen Liberalismus
Liberalismus Folie 1 Aggregierte Präferenzen: Liberalismus (Rasmus Beckmann) Gliederung 1. Einordnung der liberalen Außenpolitiktheorie in den Kontext der Vorlesung 2. Abgrenzung vom traditionellen Liberalismus
Begriffe der Friedens- und Konfliktforschung : Konflikt & Gewalt
 Begriffe der Friedens- und Konfliktforschung : Konflikt & Gewalt Vorlesung zur Einführung in die Friedensund Konfliktforschung Prof. Dr. Inhalt der Vorlesung Gewaltbegriff Bedeutungsgehalt Debatte um den
Begriffe der Friedens- und Konfliktforschung : Konflikt & Gewalt Vorlesung zur Einführung in die Friedensund Konfliktforschung Prof. Dr. Inhalt der Vorlesung Gewaltbegriff Bedeutungsgehalt Debatte um den
Facetten der Globalisierung
 Johannes Kessler Christian Steiner (Hrsg.) Facetten der Globalisierung Zwischen Ökonomie, Politik und Kultur VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis 11 Tabellenverzeichnis
Johannes Kessler Christian Steiner (Hrsg.) Facetten der Globalisierung Zwischen Ökonomie, Politik und Kultur VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis 11 Tabellenverzeichnis
Theorie der Öffentlichkeit
 Theorie der Öffentlichkeit Politische Kommunikation Sommersemester 2004 Fragestellungen 1. Was meint der Begriff öffentlich bzw. Öffentlichkeit? 2. Was macht eine Meinung zur öffentlichen Meinung? 3. Welche
Theorie der Öffentlichkeit Politische Kommunikation Sommersemester 2004 Fragestellungen 1. Was meint der Begriff öffentlich bzw. Öffentlichkeit? 2. Was macht eine Meinung zur öffentlichen Meinung? 3. Welche
Der Verein das Erfolgsmodell?
 Der Verein das Erfolgsmodell? Annette Zimmer Tagung Engagement braucht Leadership Berlin, 6. Mai 2013 Prof. Dr. Annette Zimmer Institut für Politikwissenschaft Scharnhorststraße 100 48151 Münster Fundamentale
Der Verein das Erfolgsmodell? Annette Zimmer Tagung Engagement braucht Leadership Berlin, 6. Mai 2013 Prof. Dr. Annette Zimmer Institut für Politikwissenschaft Scharnhorststraße 100 48151 Münster Fundamentale
Soziale und regionale Ungleichheiten im freiwilligen Engagement Älterer
 Soziale und regionale Ungleichheiten im freiwilligen Engagement Älterer Julia Simonson & Claudia Vogel Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA) Produktivität und Potenzial : Neues Alter alte Ungleichheiten?
Soziale und regionale Ungleichheiten im freiwilligen Engagement Älterer Julia Simonson & Claudia Vogel Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA) Produktivität und Potenzial : Neues Alter alte Ungleichheiten?
Vorlesung VII: Politische Legitimität und das Konzept der politischen Unterstützung von David Easton
 Ausgewählte Themen der Politischen Soziologie: Bürger und Politik im internationalen Vergleich Vorlesung VII: Politische Legitimität und das Konzept der politischen Unterstützung von David Easton Universität
Ausgewählte Themen der Politischen Soziologie: Bürger und Politik im internationalen Vergleich Vorlesung VII: Politische Legitimität und das Konzept der politischen Unterstützung von David Easton Universität
Die Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschland
 Leo Kißler Ralph Greifenstein Karsten Schneider Die Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschland Eine Einführung VS VERLAG Inhalt Abbildungsverzeichnis 11 Tabellenverzeichnis 11 Abkürzunesverzeichnis
Leo Kißler Ralph Greifenstein Karsten Schneider Die Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschland Eine Einführung VS VERLAG Inhalt Abbildungsverzeichnis 11 Tabellenverzeichnis 11 Abkürzunesverzeichnis
3 Herausforderungen globaler Sicherheitspolitik. 3.1 Der Ukraine-Konflikt Gefahr für die Energiesicherheit und den Frieden Europas?
 Kompetenzorientiert unterrichten mit ners Kolleg Politik und Wirtschaft Internationale Politik und Wirtschaft. Frieden, Sicherheit und Globalisierung (BN 73005) Schwerpunktmäßig (S. 10f.) Verbindliche
Kompetenzorientiert unterrichten mit ners Kolleg Politik und Wirtschaft Internationale Politik und Wirtschaft. Frieden, Sicherheit und Globalisierung (BN 73005) Schwerpunktmäßig (S. 10f.) Verbindliche
Den Stillstand bewegen. Praxis der Soziologie VISIONEN UND WIRKSAMKEIT SOZIALWISSENSCHAFTLICHER ARBEIT
 Den Stillstand bewegen. Praxis der Soziologie ÖGS-Kongress 05 Österreichische Gesellschaft für Soziologie Universität Wien, 22.-23. September 2005 VISIONEN UND WIRKSAMKEIT SOZIALWISSENSCHAFTLICHER ARBEIT
Den Stillstand bewegen. Praxis der Soziologie ÖGS-Kongress 05 Österreichische Gesellschaft für Soziologie Universität Wien, 22.-23. September 2005 VISIONEN UND WIRKSAMKEIT SOZIALWISSENSCHAFTLICHER ARBEIT
Statistisches Bundesamt Deutschland
 Engagement deutscher Unternehmen im Ausland Unternehmen verlagern zunehmend wirtschaftliche Tätigkeiten ins Ausland. Gesicherte Informationen zu diesem Globalisierungsphänomen und über die Auswirkungen
Engagement deutscher Unternehmen im Ausland Unternehmen verlagern zunehmend wirtschaftliche Tätigkeiten ins Ausland. Gesicherte Informationen zu diesem Globalisierungsphänomen und über die Auswirkungen
Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft 8. Vorlesung 01. Dezember Artikulation und Aggregation von Interessen 3: Verbände
 Artikulation und Aggregation von Interessen 3: Verbände 1 Parteienstaatstheorie nach Gerhard Leibholz Parteien als die eigentlichen politischen Handlungseinheiten der moderne Parteienstaat als eine rationalisierte
Artikulation und Aggregation von Interessen 3: Verbände 1 Parteienstaatstheorie nach Gerhard Leibholz Parteien als die eigentlichen politischen Handlungseinheiten der moderne Parteienstaat als eine rationalisierte
Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien
 Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2006/07 Kernbereich der Friedens- und Konfliktforschung K o n f l i k t a n a l y s e & K o n f
Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2006/07 Kernbereich der Friedens- und Konfliktforschung K o n f l i k t a n a l y s e & K o n f
Die Europäische Zentralbank: Kritische Betrachtung ihrer Geldpolitik und demokratischen Stellung
 Politik Robert Rädel Die Europäische Zentralbank: Kritische Betrachtung ihrer Geldpolitik und demokratischen Stellung Studienarbeit Freie Universität Berlin Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften
Politik Robert Rädel Die Europäische Zentralbank: Kritische Betrachtung ihrer Geldpolitik und demokratischen Stellung Studienarbeit Freie Universität Berlin Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften
Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld
 Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Spieltheorie. Yves Breitmoser, EUV Frankfurt (Oder)
 Spieltheorie Yves Breitmoser, EUV Frankfurt (Oder) Was ist Spieltheorie? Was ist Spieltheorie? Analyse strategischer Interaktionen Was ist Spieltheorie? Analyse strategischer Interaktionen Das heißt insbesondere
Spieltheorie Yves Breitmoser, EUV Frankfurt (Oder) Was ist Spieltheorie? Was ist Spieltheorie? Analyse strategischer Interaktionen Was ist Spieltheorie? Analyse strategischer Interaktionen Das heißt insbesondere
Anmerkungen zur Verwendung des Schullehrplans im Jahrgang 10
 Anmerkungen zur Verwendung des Schullehrplans im Jahrgang 10 Die Aufgabe der Fachkonferenz ist es unter anderem, einen Schullehrplan zu erarbeiten, nach dem die Fachlehrrinnen und Fachlehrer sicherstellen
Anmerkungen zur Verwendung des Schullehrplans im Jahrgang 10 Die Aufgabe der Fachkonferenz ist es unter anderem, einen Schullehrplan zu erarbeiten, nach dem die Fachlehrrinnen und Fachlehrer sicherstellen
ERKLÄRUNGEN ZUM PRÄFERENZPROFIL
 Myers-Briggs Typenindikator (MBTI) Der MBTI ist ein Indikator er zeigt an wie Sie sich selbst einschätzen welche Neigungen Sie haben und wie diese Neigungen Ihr Verhalten beeinflussen können. Der MBTI
Myers-Briggs Typenindikator (MBTI) Der MBTI ist ein Indikator er zeigt an wie Sie sich selbst einschätzen welche Neigungen Sie haben und wie diese Neigungen Ihr Verhalten beeinflussen können. Der MBTI
Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement im Sport
 Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement im Sport Vortrag auf dem Jahrestreffen Forum Sport 2013 der SPD Sport im Mittelpunkt. Herausforderungen und Zukunft des Ehrenamtes im Sport Berlin, 11.06.2013
Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement im Sport Vortrag auf dem Jahrestreffen Forum Sport 2013 der SPD Sport im Mittelpunkt. Herausforderungen und Zukunft des Ehrenamtes im Sport Berlin, 11.06.2013
Wieviel Gesundheitsförderung macht das Präventionsgesetz möglich?
 Wieviel Gesundheitsförderung macht das Präventionsgesetz möglich? Kritische Anmerkungen aus der Perspektive von Public Health Kassel 06.07.2016 Prof. Dr. Beate Blättner Kritische Anmerkungen aus Public
Wieviel Gesundheitsförderung macht das Präventionsgesetz möglich? Kritische Anmerkungen aus der Perspektive von Public Health Kassel 06.07.2016 Prof. Dr. Beate Blättner Kritische Anmerkungen aus Public
A0 & Unternehmenskultur in Krisensituationen. Prof. Sonja A. Sackmann, Ph.D.
 Unternehmenskultur in Krisensituationen Prof. Sonja A. Sackmann, Ph.D. A0 & Institut für Entwicklung zukunftsfähiger Organisationen Universität der Bundeswehr München Werner-Heisenberg-Weg 39 85579 Neubiberg
Unternehmenskultur in Krisensituationen Prof. Sonja A. Sackmann, Ph.D. A0 & Institut für Entwicklung zukunftsfähiger Organisationen Universität der Bundeswehr München Werner-Heisenberg-Weg 39 85579 Neubiberg
Der More Economic Approach in der EU Wettbewerbspolitik: 5 Thesen
 Der More Economic Approach in der EU Wettbewerbspolitik: 5 Thesen Hans W. Friederiszick & Rainer Nitsche ESMT Competition Analysis 2. Wissenschaftlicher Roundtable, DIW Berlin, 26. Oktober, 2007 More Economic
Der More Economic Approach in der EU Wettbewerbspolitik: 5 Thesen Hans W. Friederiszick & Rainer Nitsche ESMT Competition Analysis 2. Wissenschaftlicher Roundtable, DIW Berlin, 26. Oktober, 2007 More Economic
